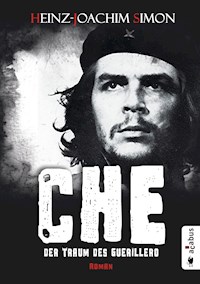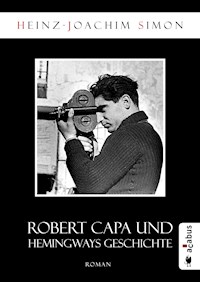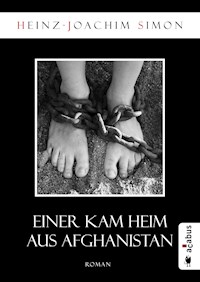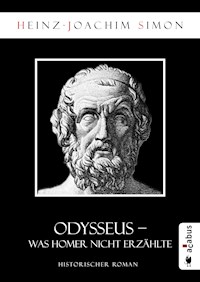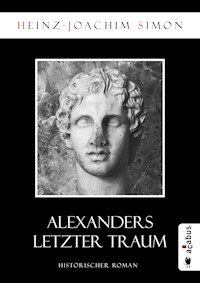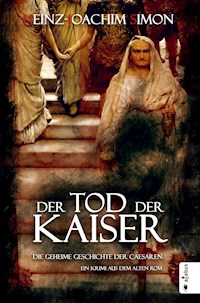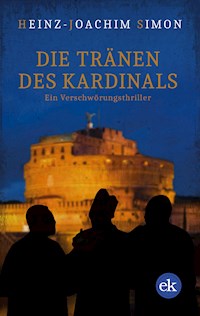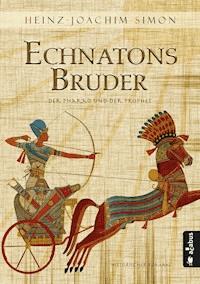
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Acabus Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Tauchen Sie ein in die Zeit der Pharaonen! Was 1350 vor Chr. begann, bestimmt noch heute unser Leben. Am Anfang stand der geheimnisvolle Amenhotep IV., der sich Echnaton nannte. Er verehrte die Sonnenscheibe Aton als einzigen Gott. Für ihn baute er die Stadt Achet-Aton und lebte dort abgeschieden vom Volk. Als er starb, verfielen seine Tempel, man verfluchte ihn und tilgte seinen Namen. Aber da kam einer, der sich sein Bruder nannte und seine Idee bewahrte. Dieser Mann, ein ägyptischer Prinz, hieß Thotmes. Die Israelis riefen ihn Moses. Moses wuchs am Hof des Pharao auf, wurde zu dessen Schwertarm, schlug gewaltige Schlachten und musste doch verfemt in die Wüste flüchten. Dort begegnete er Gott und kehrte zurück, kämpfte gegen Haremhab, den neuen Pharao, dem er schließlich ein Volk entriss und aus Ägypten führte. Vom Berg Sinai brachte er der Menschheit die Regeln zu einem sittlichen Leben. Niemals gab es einen Menschen, der so hoch stieg, so tief stürzte und doch zum Gründungsvater der monotheistischen Religionen wurde. www.heinz-joachim-simon.de
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 898
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Heinz-Joachim Simon
Echnatons Bruder
Der Pharao und der Prophet
Roman
Simon, Heinz-Joachim: Echnatons Bruder. Der Pharao und der Prophet, Hamburg, acabus Verlag 2018
1. Auflage
ePub-eBook: ISBN 978-3-86282-571-4
PDF-eBook: ISBN 978-3-86282-570-7
Print: ISBN 978-3-86282-569-1
Lektorat: ds, acabus Verlag
Cover: © Annelie Lamers, acabus Verlag
Covermotiv: © https://pixabay.com/de/%C3%A4gyptische-tutunkhamun-pharao-1822038/; https://pixabay.com/de/hintergrund-design-material-papier-1266640/
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Der acabus Verlag ist ein Imprint der Diplomica Verlag GmbH,
Hermannstal 119k, 22119 Hamburg.
_______________________________
© acabus Verlag, Hamburg 2018
Alle Rechte vorbehalten.
http://www.acabus-verlag.de
»Tief ist der Brunnen der Vergangenheit. Sollte man ihn nicht unergründlich nennen?«
Thomas Mann, Joseph und seine Brüder
Der Herr sprach zu Mose:
»Ich habe dich zum Gott gesetzt für den Pharao, und Aaron, dein Bruder, soll dein Prophet sein.«
2. Moses,7
»Wie ist es möglich, dass ein einzelner Mensch
eine so außerordentliche Wirkung entfaltet,
dass er aus indifferenten Individuen und Familien
ein Volk formt, ihm seinen endgültigen Charakter prägt
und sein Schicksal für Jahrtausende bestimmt?«
Prolog
Von Wort und Tat
Er war ein Fürst im Ägyptenland und ein Gott. Seine Herrschaft war segensreich für sein Volk. Gewaltig waren seine Taten. Man nannte seinen Namen ehrfurchtsvoll am Ufer des Euphrat und unter den Zedern des Libanon. Er schlug die Fremdvölker der Wüste und zog für einen geheimnisvollen Gott aus dem Land der Fleischtöpfe in die Wüste, und der Gott wanderte in einer Staubsäule vor ihm her. Sein Gesicht brannte vor Eifer, das Wort zu erfüllen. Er war ein Heiliger, doch er war so göttlich wie die Pharaonen und auch so sterblich, unsterblich nur durch seine Taten. Die Spuren seines Fußes mögen verweht sein, aber seine Worte gelten ewiglich. Noch in hunderttausenden von Jahren wird man seinen Namen rühmen. Denn seit er auf Erden wandelte, unterscheidet man Gut und Böse.
Er nannte sich Thotmes und hatte auch andere Namen, über die noch zu berichten sein wird. Der dies niederschreibt, ist ein Grieche, der unter den Habiru aufwuchs, die manche auch Hebräer nennen. Er ließ mich gelten. Ich war sein Freund, Bruder, Berater und Schildträger. Seine rechte Hand nannte er mich manchmal. Mein Name ist Eumenes. Damals wohnte ich in Gosen, im Delta des Ägyptenlandes, unter den Fronknechten für die Tempel des großen Pharao Amenophis III. Geheiligt ist sein Name den Ägyptern. Sie mussten Ziegel brennen und sie aufeinandertürmen und wurden dafür ernährt. Mein Vater stammte aus Mykonos, manchmal auch aus Theben, dies wechselte, je nachdem wie viel Bier er getrunken hatte. Er betrieb das ehrenwerte Handwerk eines Wasserschöpfers. Meine Mutter war eine Ausgestoßene der Habiru, die darin gefehlt hatte, sich mit einem Fremden einzulassen. Mein Vater glaubte an Zeus, Apoll und Poseidon, meine Mutter an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ganz klug wurde ich lange Zeit nicht daraus. Auf jeden Fall betete sie zu einem geheimnisvollen Gott, dessen Namen man nicht nennen durfte, und wenn sie niederkniete, stand auch keine Statue in unserer kargen Hütte und zu einem Tempel habe ich sie auch niemals gehen sehen. Vater spottete, wenn sie nicht anwesend war, dass sie Niemand anbetete, aber er ließ ihr ihren Glauben. Ihr Volk glaubte, dass nur das Kind einer Habiru-Frau auch ein Habiru ist. Das hätte mir noch gefehlt. Es war der große Kummer meiner Mutter, dass ich wie ein Grieche dachte und mich auch als solcher verstand. Wer wollte schon einem Volk angehören, das so verachtet war wie die Habiru, die die niedrigsten Fronarbeiten verrichten mussten.
Wir waren aber in dem Dorf meiner Kindheit die einzigen Griechen. Ich lebte unter lauter Habiru und das brachte mich in die Lage, sie besser zu verstehen als die Ägypter. Thotmes’ Eltern waren unsere Nachbarn. Es war also unvermeidlich, dass wir uns kennenlernten, und so spielte ich mit ihm die kindlichen Spiele, lernte mit ihm in den Wasserläufen des Deltas schwimmen, und das Dorf sah in uns eine Plage, weil wir in den Dinkelfeldern herumtobten, die Jungen des Dorfes zu einer Bande sammelten, die gegen das Nachbardorf kämpfte, wenn auch unsere Waffen nur Stöcke waren. Auch größere Frevel wurden uns nachgesagt, wie der Einbruch in die bewachten Kornsilos, was unseren Familien öfter ein Festmahl außer der Reihe ermöglichte. Nein, damals ahnte niemand von uns, mich eingeschlossen, mit wem wir die wilden Spiele betrieben. Doch schon damals hätte man erkennen können, dass er anders war. Sein Geist schied uns von ihm.
Plötzlich war der Bach, der durch unser Dorf floss, der Euphrat und der Erdhaufen gegenüber unserem Schöpfrad Megiddo und jenseits, auf der anderen Seite des Flusslaufes, war das Land der Hyksos und wir durften nicht einfach hinüberschwimmen, sondern mussten Balken zu einem Floß zusammenfügen, das die Schiffsstreitmacht des Pharao darstellte und uns in das Land der Hyksos bringen sollte. Trotz seiner verrückten Ideen folgten ihm alle, denn er hatte einen jähzornigen Charakter, wenn man ihm nicht gleich folgte. Mich behandelte er jedoch stets sanftmütig und so wurde ich zu seinem Schatten. Mich beeindruckten seine Fantasie und vor allem seine Fähigkeit, selbst die absonderlichsten Fantasien zu verwirklichen. Kurz: Er war der geborene Anführer und es gab niemanden, der ihm ein zweites Mal widersprach.
Es gab schon damals Gerüchte über Thotmes. Geheimnisvolle Andeutungen, ein Raunen umwaberte ihn. Die Leute im Dorf beschwerten sich nicht bei seinem Vater, sondern natürlich beim ungeliebten Nachbarn, dem Griechen. Doch dem kamen sie damit gerade recht. Mein Vater lachte nur und sagte: »Für die Taten der Jungen bin ich nicht verantwortlich. Beschwert euch bei den Göttern, die durch die Büsche toben, heißen sie Pan oder gar Dionysos. Jungen müssen sich austoben, sonst werden sie solche Duckmäuser, wie ihr es seid.«
Aber selbst als die Kriegsknechte des Pharao durch die Orte streiften, um die Frevler zu suchen, die sich am Eigentum des Pharao, eben jener Kornspeicher, vergangen hatten, verriet uns niemand, obwohl alle wussten, dass es Thotmes mit seiner Bande war. Oh ja, damals schon hielt ihn jeder für einen wilden Jungen, der durch den Lanzenstoß eines Kriegsknechtes früh im ›Haus des Lebens‹ enden würde.
Ich bin mit ihm hoch gestiegen und tief gefallen und habe ihn auf den Spuren seines unsichtbaren Gottes begleitet, und als sein Schicksal uns trennte, bin ich zurückgegangen an das Ufer des großen Meeres, unweit des letzten Atontempels, wo ich mich als Schreiber verdingte. Und da ich nicht nur die heiligen Buchstaben der Ägypter, sondern auch die Schriften der Babylonier beherrsche, habe ich mein Auskommen. Mein Herz zittert noch nicht, aber ich spüre, dass mein Atem kürzer wird und die Gicht an meinen Knochen zerrt. An das fern Vergangene erinnere ich mich besser als an das, was ich vor Kurzem verrichtet habe.
Ich lebe ohne Gefährtin. Die Götter geben mir keinen Trost. Ich lebe ohne sie. Weder glaube ich an die griechischen Götter, noch an Osiris, Isis oder Amun. Selbst der Gott, dessen Namen man nicht nennen darf, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, ist mir fremd geblieben. Ich habe gesehen, welche Ansprüche er stellt und das hat mir die Lust genommen, mich auf ihn einzulassen. Oh ja, ich weiß: Es ist ein Mangel, wenn man keinen Gott hat, den man um Beistand bitten kann. Es fehlen die Pflichten, die einen mit Beistand belohnen. Doch andererseits bin ich frei und in meinem Tun niemandem verantwortlich. Ich weiß, dass dies nicht ohne Gefahren ist und werde davon berichten.
Thotmes sagte einmal, wer ohne Gott ist, lebt wie ein Tier. Darüber denke ich noch heute nach und du, Fremder, der du diese Zeilen liest, solltest auch darüber nachdenken. Ein anderes Mal sagte er, dass jemand, der ein Leben ohne Gott führt, wie ein Klumpen Lehm ist, den der Töpfer als ungeeignet beiseite warf. Er konnte einem mit solchen Aussagen den Kopf schwermachen. Ja, das war später, als er sich selbst erkannt hatte.
Ich bin allein, aber nicht einsam, denn ich habe die Erinnerungen und damit genug zu tun, um die dunklen Gedanken abzuwehren. Ich stehe also auf, bevor der Morgenstern verlischt, mache am Strand ein paar Übungen, die meine Gelenke krachen lassen, trinke einen Schluck Wasser, gehe an die Arbeit und lege Zeugnis ab über jenen Thotmes, der die Welt veränderte. Die Gedanken an unsere gemeinsame Zeit wärmen mich und das Blut fließt wieder schneller durch die Adern. Ich höre mein Herz schlagen. Ich tauche tief hinab, noch vor die Zeit, als Thotmes geboren wurde.
Du wirst dich vielleicht fragen, wie ich, Eumenes, von den Tagen und den Ereignissen weiß, die vor mir geschehen sind. Im Haus des Pharao wird viel erzählt und die vielen Diener, seien es nun Sklaven oder Amtspersonen, die Frauen nicht zu vergessen, haben nichts anderes zu tun, als die kleine Welt im Haus des Pharao im Gleichgewicht zu halten. Nichts bleibt hier verborgen, jede Veränderung, jede Neuigkeit wird eifernd aufgegriffen und weitererzählt und aus dem Tod einer Mücke wird der Tod eines Elefanten.
Am Abend sitze ich im Licht der Öllampen auf dem Dach meines Hauses und rufe aus der Vergangenheit zurück, was Thotmes und mir widerfahren ist. Manchmal gehe ich hinaus ans Ufer des großen Wassers, nehme den weißen Sand und lasse ihn durch meine Finger rieseln und es kommt mir vor, als würde mein Leben durch die Finger gleiten. Oh ja, ich bin am Ende meines Lebens angekommen und so warte ich jeden Morgen auf der Düne auf den Sonnenball und sehe zu, wie er sich rotballig aus dem Meer erhebt … und sehe vor ihm Thotmes die Arme heben.
So höre, mein Freund, was geschah. Höre, wie es im Haus des Pharao anfing. Amenophis hatte seiner eigenen Tochter beigewohnt. Erschrick nicht über die Sitten, die sich ägyptische Könige anmaßen, sie sehen darin die Reinerhaltung des göttlichen Blutes und wähnen sich ohne Schuld.
Kein Mensch ist ohne Fehl, kein Mensch ist je aus dem Reich des Westens zurückgekehrt, so dass wir nicht wissen, ob der Frevel auf der Waage des Anubis zu schwer wiegt. So beginne ich nun die Geschichte. Die Sonne steigt rot aus dem Meer empor.
1. Buch
Der Samen der Götter
1
Die Lust des Löwen
Es war zu der Zeit, als Hapi, die große Nilflut, kam und mächtig und segensreich über die Ufer trat. Die Menschen liefen an den Fluss und sangen das Lied der ewigen Wiederkehr des Lebens. Der Hohepriester Unas trat vor den Pharao und pries ihn und die Götter:
»Heil dir, Gebieter von Biene und Binse. Heil dir, Leben und Gesundheit. Deine Herrschaft ist voller Segen und Amun-Re ist mit dir, oh Herrlicher. Gehe zu den Weibern und verkehre mit ihnen und zeuge, denn stark sind deine Lenden, wie ein Stier deine Brunst. Der Sohn, den du in dieser Nacht zeugst, wird ein großer Fürst, den man noch in Jahrtausenden rühmt.«
Der Pharao schüttelte energisch den Kopf. Still ward es in der Halle der Morgenröte.
»Ich habe bereits viele Söhne und Amenhotep hat gute Anlagen. Obwohl er noch ein halbes Kind ist, beherrscht er bereits die heilige Schrift und übt sich am Speer. Ein Löwe wird aus ihm werden.«
Unas verbeugte sich und legte den Kopf zur Seite.
»Wie gut du sprichst, oh Herrlicher. Doch man weiß nie, was die Götter in ihrer Weisheit beschlossen haben. Die Vorzeichen sind sehr verwirrend, was Amenhotep betrifft.«
»Ha, verwirrend? Was redest du da, Unas? Er geht mit großem Eifer in den Amuntempel und scheuert sich die Knie wund vor dem Abbild des Amun-Re.«
»Zweifellos. Er ist sehr gläubig. Aber es ist eine seltsame Unrast in ihm, eine Sehnsucht, ein Durst, den niemand zu stillen vermag. Es dünkt Amun richtig, einen zweiten Pfeil im Köcher zu haben. Geh zu deiner Tochter Nefertari und liege ihr bei und zeuge einen Sohn. Nie waren die Vorzeichen günstiger.«
Der König erhob sich von seinem Thron, winkte Unas heran und zog an seinem Ohrläppchen, wie er es immer tat, wenn er trotz seines milden Gemütes unzufrieden war.
»Unas, Unas, was legst du mir im Namen der Götter auf? Sie ist meine Tochter und gerade zur Geschlechtsreife erblüht. Ich wollte ihr die Lust meines alten Leibes ersparen und sie glücklich Kind sein lassen. Denn mit dem ersten roten Tau beginnt für die Weiber die Beschwernis des Lebens.«
»Wie edel du denkst, oh Herrlicher. Aber es ist nun einmal von den Göttern gestattet, dass der Pharao sein Blut bewahrt, damit es rein bleibt und sich niemand anmaßt, vom gleichen Blut zu sein und Ansprüche zu stellen. Was dem Volk verwehrt ist, wirkt beim Vertreter des Osiris segensreich. Gehe also noch in dieser Nacht zu dem Weibe von deinem Blut und opfere aus der Quelle des heiligen Lebens. Amun gab uns Zeichen in der Leber des weißen Stieres, im Stand der Sterne, dass man noch in tausenden von Jahren deinen Sohn rühmen wird.«
»Meinen Sohn Amenhotep?«
»Auch ihn. Sicher. Vor allem den Sohn, den du heute Nacht zeugen wirst.«
Amenophis schwieg und bedachte seine Taten und Herrschaft. Es war immer richtig gewesen, überlegte er, die Ratschläge des Unas zu befolgen.
Er seufzte und wedelte unzufrieden mit der Hand.
»Du machst mir nichts als Mühe, Unas!«
Der Hohepriester warf sich auf die Erde, legte die Hände über dem Kopf zusammen und rief: »Wir sind alle in der Hand des Amun-Re.«
»So ist es wohl«, erwiderte Amenophis grimmig. Er wusste, dass er wohl oder übel den Rat des Unas befolgen würde. »Du darfst dich deinen heiligen Pflichten widmen«, verabschiedete er ihn ungnädig.
Also ließ er nach dem Nachtmahl seine Tochter kommen. Teje, die mit ihm auf dem Horusthron saß, seine Gemahlin, mehr noch seine Beraterin und Herrscherin über das Frauenhaus, sah dies ungern und machte ihm Vorwürfe.
»Warum lässt du dieses Kind kommen?«, fragte sie mit einem Unterton, der ihm sagte, dass sie Ärger machen würde.
Sie war eine große schöne Frau, größer als all die Frauen, die sonst in seinem Palast lebten. Er schätzte sie sehr.
»Amun will es«, sagte er verlegen.
»Was weißt du schon von den Göttern!«, erwiderte sie abwinkend.
Sie durfte sich das erlauben. Eine andere hätte er schon längst aus seinem Harem entfernen lassen. Doch er wusste, was er an Teje hatte. Längst hatte er akzeptiert, dass sie klüger war als er und dass sein Verdienst, das Land so glücklich zu lenken, eigentlich ihr gebührte. Ohne ihre Unterstützung hätte er das Gesetz der Maat nicht so problemlos bewahren können.
»Unas hat von Vorzeichen gesprochen, die dies erfordern. Es muss wohl sein. Ich habe keine andere Wahl, als Amun-Re zu gehorchen.«
»Unas zu gehorchen, meinst du wohl. Er ist korrupt und nur darauf aus, Spenden einzustreichen, die den Tempel des Amun-Re noch reicher machen. Bei jedem Kind musst du Amun-Re eine Dankesgabe überreichen. Darum geht es ihm. Vielleicht hat ihm auch die Mutter der Nefertari einige Goldspangen zugesteckt. Die Thebanerin strebt danach, durch ihre Tochter deine Gunst zu erlangen und mich zu verdrängen. Du weißt doch, dass ihre Familie gegen mich intrigiert, weil ich nicht von den besten Familien des Reiches abstamme. Sie hoffen, dass deine Lust auf Nefertari anhalten wird, auf ein junges, willfähriges Geschöpf, das noch mit dem Tau des Morgens bedeckt ist.«
»Geh! Du verdirbst mir die Laune!«, brüllte Amenophis erzürnt, wusste er doch, dass sie recht hatte, dass sie mal wieder klüger dachte als er. Doch konnte er den Unas erzürnen, sich Amun-Re verweigern?
Teje nannte ihn einen geilen Bock und anderes und er ließ es sich mit hängendem Kopf gefallen. Er war betrübt über dieses Zerwürfnis. Sie war ihm Frau, Schwester, Mutter und verbreitete eine friedvolle Stimmung und … er war sie seit Jahrzehnten gewohnt. Er konnte sich keine bessere Frau auf dem Osiristhron vorstellen. Aber ihre Vorwürfe ließen ihn trotzig werden und bestärkten ihn in seinem Entschluss, ihr zu zeigen, dass er der Pharao war und alle Menschen ihm zu folgen hatten, auch die Hauptfrau.
Und so kam das Kind zu ihm, vertraute seiner väterlichen Liebe und schrie, als er das tat, was der Priester ihm geraten hatte. Sie schlug um sich und weinte, als er sich in ihr verströmte. Er dachte, das würde sich geben. Aber als er sie wieder kommen ließ, wehrte sie sich noch wilder, schrie zu Hathor, zerkratzte ihm Arme und Brust und erbrach sich in seinem Bett. Dies ernüchterte ihn sehr und er unterließ es, sie noch einmal kommen zu lassen, obwohl ihm Unas dazu riet.
Er schämte sich der Tränen, die sie geweint hatte. Sie jedoch vergaß die Nächte mit ihrem Vater nicht, nicht die Schmerzen, den Ekel vor dem faltigen Fleisch, und sie hasste ihren Vater von nun an. Wenn sie ihm begegnete, mied sie seinen Blick, schlug die Augen nieder und dies ließ auch später nicht nach.
Der Vater ließ ihr kostbare Geschenke und Ehrungen zukommen, die sie annahm, denn sie sah es als berechtigtes Entgelt für das, was sie erduldet hatte. Gleichwohl war sie zum Weib erwacht und sah die Jünglinge in ihrem Umfeld mit anderen Augen an als vor der Nacht mit dem Vater, der ihre Kindheit jäh beendet hatte.
Wenn sie sich im Palastgarten am Ufer des Nils erging, fiel ihr einer der Gärtner auf, der für die Rosenbüsche verantwortlich war. Er sah aus wie die Götterstatuen der alten Könige, hatte breite Schultern, einen hohen Wuchs, einen flachen Bauch, sein Fleisch war fest, und die Muskeln die eines Kriegers. Besonders aber beeindruckte sie sein leidenschaftliches, stolzes Gesicht mit den dunklen Augen. Er war ein Sklave mit Namen Isaak, ein Habiru, wie sie von ihren Dienerinnen erfuhr, Abkömmling eines Sklavenvolkes. Immer sah er sie unverwandt, fast frech an, obwohl er doch wusste, dass er ein Niemand war und sie dem Geschlecht der Götter angehörte. Erst verweigerte sie sich seinen dreisten Blicken und versuchte, ihm aus dem Wege zu gehen. Aber sie ertappte sich bald dabei, dass es sie immer in den Garten zog, wenn sie wusste, dass er an den Rosenbüschen arbeitete. Und dann erkannte sie, was sie in den Garten trieb. Es war nicht nur die Lust des erwachten Weibes, sondern der Plan, dem Vater und Pharao das zu verweigern, was er in ihren Leib gesenkt hatte. Sie glaubte zu spüren, dass sein Samen sie erweckt hatte und sie der Hilfe Hathors, der kuhäugigen Göttin, bald bedürfen würde. Und sie fasste einen Plan, wie er schlimmer nicht gegen die Gesetze des Amun und des Palastes verstoßen konnte. Er sollte auf das Reich der Biene und Binse gewaltige Auswirkungen haben.
Sie war flink im Geiste und ihr fiel das ein, was klugen Frauen immer rechtzeitig einfällt. Sie stellte sich hilflos. Dicht vor den Rosenbüschen, wo Isaak die Triebe zurückschnitt, strauchelte sie, knickte mit dem Fuß um und fiel hin. Isaak starrte sie an, wagte aber nicht zu ihr zu gehen.
»Du Dummkopf, siehst du nicht, dass ich nicht aufstehen kann!«, fauchte sie.
Seine Hände ließen die Zweige erzittern, war er doch ein Niemand und sie aus dem Geschlecht des Pharao.
»Nun rühr dich endlich!«, schimpfte sie und nun kam er zögerlich zu ihr und beugte sich über sie.
»Heb mich auf und bring mich zur Bank bei der Hecke.«
Er zögerte immer noch, stand tief gebeugt über dem Fuß mit der goldenen Sandale und wagte nicht, ihr göttliches Fleisch zu berühren. Sie gab ihm einen Schlag in den Nacken.
»Nun mach schon, Sohn eines Nilpferdes!«
Es blieb ihm also gar nichts anderes übrig, als sie hochzuheben und auf ihr fast durchsichtiges Gewand zu sehen, was verrutscht war und seine Knie zittern ließ wie das Laub zur Zeit der Nilflut.
Sie umfasste seinen Hals und ließ sich zu der Rosenhecke tragen, die durchaus dazu geeignet war, die beiden vor neugierigen Blicken zu schützen. Sie schmiegte sich an ihn und ihre kleinen Brüste drückten gegen seinen Brustkorb. Sie roch seinen Körper und sein Schweiß schien ihr besser zu riechen als der parfümierte Leib ihres Vaters. Sie griff unter seinen Lendenschurz und fühlte sein Geschlecht stark und drängend wie das des Apisstiers.
Als sie auf der Bank lag, öffnete sie ihre Beine und zog ihn auf sich, und er vermochte ihr nicht zu widerstehen, vielleicht aus Angst und vielleicht besinnungslos über ihre Gunst. Jedenfalls erschauerte er vor Lust, als sie sich ihm entgegendrückte, und folgte seiner Begierde und sie nahm ihn auf und nun erfuhr sie, was körperliche Liebe sein konnte, und sie schrie aus Lust an diesem Nachmittag im Park des Palastes des Pharao Amenophis.
Sie tat es zweimal mit ihm und dann offenbarte sie Isaak ihren Plan.
»Ich bin schwanger von dir. Die Göttin Hathor meint es gut mit mir. Du weißt, was es bedeutet, wenn dies bekannt wird. Ein Unwürdiger hat die Tochter des Pharao geschwängert. Ein todeswürdiges Verbrechen. Man wird dich in das Becken des Sobek werfen.«
Natürlich hatte Isaak Angst, dem Krokodilgott geopfert zu werden. Sein Gesicht zeigte seine Not und er dauerte sie. Mit hängendem Kopf starrte er auf sie nieder.
»Sei nicht so ein Hasenfuß! Es gibt eine Lösung.«
»Willst du das Kind nicht bekommen?«, stotterte er schüchtern.
»Ich versündige mich doch nicht gegen Hathor, die Kuhäugige. Nein, das Kind werde ich austragen und du wirst es fortbringen, damit es der Pharao nicht als sein Kind anerkennt.«
Wie konnte Isaak auch die ganze Verworfenheit ihres Plans erahnen? Es war eine Intrige, die so böse war wie der Gott Seth. Sie hatte nicht vor zu verschweigen, dass sie schwanger war und dem Pharao ein Kind gebären würde. Abgesehen davon, dass man dies im Haus der Frauen ohnehin nicht verbergen konnte. Sie hatte vor, ihm, dem Pharao, dieses Kind, das vom Hohepriester Unas mit solch günstigen Vorzeichen bedacht worden war, zu nehmen. Es war ihr Kind und sie wollte mit ihm dem Pharao eine Wunde zufügen. Bestürzt fragte Isaak, wohin er das Kind bringen solle.
»Lass dir etwas einfallen, Dummkopf!«, schimpfte sie ihn. Das war nicht mehr dieses zarte Wesen, das sich hingebungsvoll an ihn geschmiegt hatte.
»Ich kann meine Arbeit hier nicht im Stich lassen. Es würde doch auffallen, wenn ich den Garten verlasse und mit einem Kind fliehe«, jammerte er.
Isaak war schön wie ein griechischer Apoll, aber mit außergewöhnlichen Geistesgaben hatten ihn die Götter nicht ausgestattet.
»Ach, was für einem Esel habe ich mich hingegeben. Du wirst doch irgendwelche rechtschaffenen Leute kennen, die gern ein Kind aufnähmen.«
Isaaks Gesicht hellte sich auf.
»Mein Bruder Amram. Er und sein Weib Jochebed haben bisher vergebens den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs angefleht, ihnen einen Sohn zu schenken. Doch bisher hat sie Gott nicht erhört.«
»Sind es gute Leute?«
»Ja. Sie sind aus dem Stamm der Levi. Wir sind die besten unter den Habiru. Man sagt uns große Geistestiefe und Frömmigkeit nach.«
»Sie werden das Kind also gut behandeln.«
Er nickte heftig.
»Na siehst du. Es gibt für alles einen Weg. Isis und Hathor werden mit uns sein. Der Pharao wird verflucht sein wie Seth, der Mörder des Osiris. Nun schenk mir noch einmal Lust, die Zeit ist günstig. Wer weiß, ob wir in den nächsten Wochen oder Monaten dazukommen werden.«
So genoss sie noch einmal seinen Leib und dann nie wieder.
Lange blieb es nicht verborgen, wie es um sie stand. Eines Tages kam Teje zu ihr und sah sie missgünstig an.
»Der Löwe hat dir also seinen Samen nicht umsonst gegeben?«
»Sieht man das nicht?«, erwiderte sie widerborstig und bekam eine Ohrfeige.
»Du bildest dir darauf etwas ein? Der Löwe hat schon hunderte von Frauen beglückt und im Haus der Frauen tummeln sich allein zwei Prinzen und noch mehr Prinzessinnen.«
»Aber niemand wurde mit solchen Auspizien gezeugt«, erwiderte sie hitzig.
»Ach, du meinst die lächerlichen Voraussagen des Hohepriesters Unas?«
»Noch in tausenden von Jahren wird man den Namen meines Kindes kennen.«
Teje gab ihr eine zweite Ohrfeige.
»Du dummes Ding! Das sagte er nur, um dem Herrn über Biene und Binse zu schmeicheln und ihm weitere Geschenke für den Tempel zu entlocken.«
»Als ich seinen Samen empfing, hörte ich das Gebrüll eines Löwen«, log sie trotzig. Dabei bestand die Erinnerung an die erste Nacht nur aus einem Schleier aus Feuer und Schmerz. Doch Teje lächelte höhnisch über diesen Versuch, sie einschüchtern zu wollen.
»Wie dumm du bist. Unreif. Ein Kind noch. Ich werde dich zukünftig genau beobachten. Ich werde dafür sorgen, dass dir der Pharao niemals wieder beiwohnt. Verlass dich darauf!«
Wer so lange die Herrin im Haus der Frauen gewesen war, wer dem Pharao mit großer Weisheit die Hand hielt, duldete keine Veränderung des Gleichgewichtes. Sie wusste sehr wohl, dass Amenophis mit Scham und Liebe Nefertari zugetan war und das Kind dieses Kindes als etwas Besonderes ansehen würde. War es doch ein Beweis, dass seine erschlafften Lenden immer noch zeugen konnten. Seine Liebe zu dieser Frucht konnte ihren Söhnen gefährlich werden und sie hatte nicht vor, dies zuzulassen.
»Denke immer daran, dass mein Auge auf dir ruht, wenn du dem Pharao begegnen solltest. Senke dein Gesicht und blicke zu Boden, sonst trifft dich meine Hand.«
Mit diesen Worten rauschte sie hinaus.
Du wirst schon sehen, dass sich Unas’ Prophezeiung erfüllen wird, dachte Nefertari hasserfüllt. Und der alte Pavian wird darunter zu leiden haben.
In der Nacht des Pfauenfestes gebar Nefertari einen Sohn. Als man ihr das Kind in den Arm legte, betrachtete sie es mit Scheu. Das also war in ihr gewesen. Zärtlich strich sie über den Flaum. Sie hielt das Kind für ein besonders schönes Baby, was ihr alle bestätigten, und sie sah es als Tribut an das Schicksal an, das diesem winzigen Wesen bestimmt war. Dieses Kind würde eines Tages ein Allgewaltiger unter dem Himmel sein.
Den Pharao erfüllte die späte Frucht seiner Lenden mit großem Stolz. Noch einmal nannte er sich einen glücklichen Menschen.
»He, ein großes Schicksal wartet auf ihn?«, fragte er Bestätigung suchend den Hohepriester.
»Noch in mehr als tausend Jahren wird man seinen Namen rühmen.« Worte, für die sich Unas später grämte.
Einige Tage, nachdem Nefertari das Wochenbett verlassen hatte, ging sie mit dem Kind in den Garten und zeigte es Isaak. Sie sagte: »Es ist dein Sohn. Sorge dafür, dass er im Schoß deiner Familie aufwächst.«
Isaak glaubte im Gesicht des Kindes sein Abbild zu entdecken, nahm es in die Arme und verspürte eine tiefe Liebe in sich. »Thotmes«, flüsterte er innig.
»Thotmes? Das ist kein Name für den Sohn des Amenophis. Offiziell ist er natürlich der Sohn des Pharao«, fügte sie schnell hinzu. »Aber es soll mir recht sein. Ein Name ist so gut wie der andere. Er wird ihm selbst Bedeutung geben.«
»Er soll ein guter Mensch werden«, sagte Isaak trotzig.
»Ein bedeutender Mensch«, verbesserte sie ihn und fragte scharf: »Ist alles vorbereitet?«
Es gefiel ihr, mit welcher Liebe er das Kind ansah, und es gefiel ihr auch wieder nicht. Wie konnte sich ein Habiru einbilden, dass das Kind ihm gehörte?
»Ja, wenn sich die Dienerinnen am Ufer des Flusses mit ihm ergehen, werde ich mit meinem Bruder im Schilf warten und das mit Pech beschmierte Kästlein an mich nehmen. Mein Bruder wird das Kind wie seinen eigenen Sohn in seiner Familie aufnehmen und großziehen.«
Es war ein alter Brauch, das Kind schon bald nach der Geburt in einem Kästlein, das man auch als kleines Boot bezeichnen konnte, auf dem Nil schwimmen zu lassen, um es dem Hapi zu zeigen und ihn um Schutz für das Kind am Ufer des großen Flusses zu bitten. Möge es nie Hunger und ein gutes Leben haben.
»Niemand darf etwas über seine Herkunft erfahren, bis ich es zu mir rufe.«
»Es wird geschehen, wie du es verlangst, Herrin!«, antwortete Isaak demütig.
»Das will ich meinen. Sonst findest du dich bald in der Barke des Osiris auf dem Weg zum Totenreich.«
Sie selbst sorgte dafür, dass es so ablief, wie sie es geplant hatten. Sie zeigte dabei eine Kaltblütigkeit, die einer Pharaonin würdig gewesen wäre. Die Dienerinnen hatten am Ufer Matten ausgebreitet und Nefertari hatte Wein ausschenken lassen. Es gab kleine Kuchen und alle waren guter Dinge.
»Kommt, lasst uns meinen Sohn dem segenbringenden Nil anvertrauen, damit Hapi ihn erkennt und von nun an vor allem Übel bewahrt.«
Sie legten das Kind in das mit Pech abgedichtete Kästlein, gingen mit ihm an das Wasser und senkten es in die Flut und sangen ein Lied zur Ehre der segensreichen Göttin. Wie ein Boot tanzte das Kästlein auf dem funkelnden Nil. Da brachen zwei vermummte Männer aus dem Schilf heraus, stießen die Dienerinnen zurück, ergriffen das Kästlein und verschwanden mit ihm wieder im Schilf. Die Dienerinnen schrien aufgeregt, reckten die Hände, aber aus Angst und vielleicht auch wegen des zu viel genossenen Weins vermochten sie nicht richtig zu denken und den Flüchtigen zu folgen. Sie schrien nach Hilfe und weinten und rauften sich die Haare. Endlich eilten Kriegsleute herbei und durchsuchten das Schilf und die Gegend, doch fanden sie weder das Boot noch das Kind.
Als dem Pharao der Vorfall gemeldet wurde, senkte er den Kopf und sah in dem Verschwinden dieses besonderen Kindes die Strafe dafür, dass er sich an seiner eigenen Tochter vergangen hatte.
»Es waren die Götter, vielleicht die kuhohrige Hathor, die mich strafen und nicht zulassen wollte, dass ich einen Sohn bekomme, den man noch in tausend Jahren rühmt.«
Er ließ Unas kommen. Dieser hatte schon von der Entführung gehört und wackelte bedenklich mit seinem Kopf.
»Fürwahr, ein seltsames Unglück. Ein unerhörter Frevel. Es gibt Legenden, dass Kinder, in einem pechverschmierten Kästlein angeschwemmt, zu mächtigen Herrschern wurden, aber nie umgekehrt, dass ein Kind im pechverschmierten Kästlein verschwindet. Vielleicht liegt die Bedeutung darin, dass jemand aus dem Königshaus auszieht, um mit fremden Völkern zu einem Allgewaltigen zu werden.«
»Unas, Unas, was redest du für einen Unsinn!«, grollte Amenophis. »Du sagtest mir einen Sohn voraus, der in aller Herrlichkeit über Ober- und Unterägypten herrscht.«
Nefertari sah seine Qual und weidete sich an seinem Unglück. Ich habe dir, obwohl ohne die Macht der Götter, das vergolten, was du mir angetan hast, sagte sie sich triumphierend.
Amenophis ließ alle Dienerinnen töten und, nachdem die Kriegsknechte nach einer tagelangen Suche ergebnislos zurückkamen, ließ er auch sie umbringen. So groß war sein Zorn. Teje aber war froh, diese Frucht des alten Leibes aus dem Haus zu haben. Unas grübelte noch eine Weile über diesen Vorfall. Später, viel später sollte er erkennen, dass dieser zu den Auspizien gehörte. Als der Tempel des Amun-Re verödet war, als zwischen den Granitplatten Gras wuchs und der Sand der Wüste durch die Hallen strich, wusste er, dass sich alles auf dieses Ereignis, auf das Verschwinden des Kindes, zurückführen ließ.
Amenophis lebte noch viele Jahre, aber zeugte keine weiteren Kinder mehr. Unas bestätigte Amenophis, dass Amenhotep den Thron der Binse und Biene besteigen würde.
»Wenn du die Fahrt nach Westen zu Osiris angetreten hast, wird er deine Nachfolge antreten«, sagte er zu dem alten Pharao.
Zu seiner Tochter Nefertari ging Amenophis auch jetzt nicht mehr und sie scheute seinen Blick, wo sie ihn auch traf.
Das Kind Thotmes, wie Isaak es getauft hatte, wuchs in Gosen beim Bruder des Isaak auf und niemand vermisste es im Haus des Pharao. Nur Nefertari schmerzte manchmal das Herz, wenn sie an der Uferstelle vorbeiging, wo ihr Kind verschwunden war.
Thotmes’ Heimstatt war nur eine Hütte an einem Nebenarm des Nils. Um die Hütten des Dorfes standen die Brennöfen und so lernte er früh den Geruch des Ziegelfeuers kennen. Jochebed, seine Stiefmutter, zog ihn mit Liebe und Strenge auf. Als wäre ein Zwang von ihr genommen, gebar sie nun auch einen Sohn, den sie Aaron nannte. Aber an der Liebe zu Thotmes änderte dies nichts. Amram, sein Vater, war ein Schmied, der täglich an der Esse stand und die Bronze fließen und erkalten ließ und daraus Speere und Schwerter für die Krieger des Pharao schmiedete. Ein ehrenwerter Beruf, der mehr einbrachte als das Ziegel brennen. Er war ein Mann des Feuers und sein Wort galt viel im Dorf.
So wuchs Thotmes in Unkenntnis über seine Herkunft heran und wähnte sich nicht besser als die Nachbarskinder, mit denen er schon bald die Plage des Dorfes wurde. Sein bester Freund war Eumenes, den er nie fragte, zu wem seine Eltern mit ihm beteten. Dieser erfasste schon bald, dass es mit Thotmes etwas Besonderes auf sich hatte. Selbst die Aufseher des Pharao, meist Krieger aus Nubien und Syrien, schlugen nie mit ihren langen Stöcken nach ihm, wenn sie durch das Dorf marschierten, nicht weil sie seine Herkunft kannten, sondern weil von seiner Haltung und seinem Gesicht eine Hoheit ausging, die sie beeindruckte. Instinktiv erkannten sie, dass dieser Knabe jemand war, der einmal Befehle erteilen würde. Auch Amram erkannte schon früh, dass er ein erstaunliches Kind war und schickte ihn zu einem Schreiber namens Nun, ein Habiru von zweifelhafter Herkunft, der aber für alle Dörfler in Gosen die Einsprüche, Klagen und anderen Schriftverkehr übernahm. Er galt allgemein als weiser Mann. Man sagte ihm nach, dass er von den Ufern des Euphrat nach Ägypten gekommen war, um das rätselhafte Volk der Ägypter zu studieren. Und dieser Lehrer staunte, wie schnell der Schüler lernte, wie dessen Geist gleich einem Schwamm alles aufsog, was er ihm über die Ägypter, die alten Habiru und andere Völker im fernen, geheimnisvollen Babylonien erzählte. Thotmes’ Gesicht glühte, als er von Gilgamesch und Enkidu erfuhr, von ihrer Suche nach dem ewigen Leben.
»Er ist so anders als alle Schüler, die man in meine Obhut gegeben hat. Wer hat bei deiner Frau gelegen und solch ein Kind gezeugt?«, fragte er scherzhaft Amram. Dieser lief rot an und verbat sich solche frivolen Worte.
»Er ist ein Sohn des Volkes, das an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs glaubt«, erwiderte er heftig. »Der Herr wirkt manchmal in der kleinsten Hütte.«
Er gestand niemandem die Herkunft des Thotmes und erklärte dessen Anderssein ganz allgemein damit, dass die Amrams aus dem Haus Levi schon immer ein wacher Geist auszeichnete.
»Er ist zweifellos gesegnet«, pflichtete der Schreiber bei. »Er ist mit seinen sechs Hapi verständiger als manch Zwölfjähriger. Amram, Amram, ich befürchte, vor ihm werden wir gewöhnlichen Menschen eines Tages die Knie beugen oder man wird ihn wegen seiner Klugheit lästig finden und der Neid der anderen wird ihn verfolgen.«
»Wen hat der Bruder in unsere Obhut gegeben?«, fragte er so manches Mal am Abend, wenn die Kinder schliefen, sein Weib Jochebed.
»Wir haben Thotmes als Geschenk angenommen und sind glücklich, seit er bei uns ist. Erst nach ihm schenkte uns Gott Aaron. Beten wir, dass Thotmes uns nicht wieder genommen wird. Ich fühle mich gesegnet, seit er bei uns ist.«
»Weib, Weib, was bildest du dir ein? Wir sind nichts Besonderes und das Besondere an Thotmes ist nur sein wacher Geist.«
»Nimm es, wie der Herr es für uns und ihn richtet! Es wird wohlgetan sein.«
Und als Thotmes zwölf Sommer bei den Habiru als Sohn Amrams galt, hatte er bereits die Statur eines Fünfzehnjährigen. Einer Bande von Jungen war er der Anführer. Selbst Ältere, mit zwei, drei Jahren Vorsprung, erkannten ihn als Häuptling an. Nachdem sie wieder einmal die Jungen des Nachbardorfes mit Steinwürfen und Stockschlägen verjagt hatten, stellte Thotmes fest, dass dies langweilig war und ihrer nicht würdig, denn es stand doch seit geraumer Zeit fest, dass sie stets siegten.
»Wir brauchen einen Gegner, der uns ebenbürtig ist.«
Sie saßen am Ufer des Flusses, versteckt hinter Schilf und anderen hohen Sumpfpflanzen. Thotmes hatte als Anführer einen Reif aus Binsen auf dem Kopf. In der Mitte brannte ein kleines Feuer. Über den Flammen drehte sich ein Spieß mit Fröschen und kleinen Fischen, die ein leckeres Mahl versprachen.
»Wer ist der natürliche Feind der Habiru?«, fragte er die Runde.
»Die Wächter, die Kriegsknechte des Pharao«, antwortete ihm die Runde wie ein Mann.
»Richtig. Dann wollen wir sie davon überzeugen, dass der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs sie strafen wird, das Volk der Habiru zu Sklaven gemacht zu haben.«
»Irgendwelche Vorschläge?«, assistierte ihm Eumenes. Alle schwiegen.
Thotmes’ Blick ging über sie hinweg am Ufer entlang, wo er einen Baum sah, um dessen Astloch Bienen schwärmten.
»Dort sehe ich unsere Waffen«, sagte er bestimmt.
Die Jungen blickten sich um, zuckten mit den Achseln und machten ratlose Gesichter und warteten, dass Thotmes ihnen erklärte, was er vorhatte.
»Du meinst, wir sollten uns von den Bienen stechen lassen?«, spottete Eumenes, der sich jedes Mal ärgerte, wenn er die Gedankengänge des Freundes nicht nachvollziehen konnte, erhob er doch den Anspruch, dass die Griechen das klügste aller Völker waren.
»Wir werden die Wächter heute Nacht in einer grandiosen Schlacht vernichten!«
»Ha!«, machte Eumenes. »Was hast du dir denn wieder ausgedacht?«
»Wir werden uns die Honigwaben holen, zu den Häusern der Wächter gehen und ihre Türen mit Honig beschmieren. Sie werden auf Tage nicht in ihren Häusern wohnen können«, sagte Thotmes im selbstherrlichen Ton eines Priesters.
»Und wir werden vorher gestochen werden und aussehen, als wären wir vom Aussatz befallen«, höhnte Hosea, der zwei Jahre älter war und schlecht verwinden konnte, dass Thotmes beim Ringkampf seine Schultern auf die Erde gedrückt hatte.
»Aber nein!«, wehrte Thotmes überlegen ab. »Wir werden vorher am Fuß des Baumes Melisse und Baldrian verbrennen. Der Rauch wird sie müde und friedlich machen. Kann sein, dass sie dich trotzdem stechen, weil du, wie wir alle wissen, ungeschickt bist.«
»Und das funktioniert?«, ließ Hosea nicht locker. »Thotmes als Herr der Bienen?«
Thotmes schob seinen Binsenkranz zurecht und sagte: »Untertan ist mir Bienenvolk und anderes Getier.« Alle lachten. Thotmes verzog nicht das Gesicht.
Wie er es vorausgesagt hatte, so lief es ab. Die Bienen blieben ruhig und ließen es zu, dass sie die Waben aus dem Astloch holten und den Honig an die Hütten der Wächter schmierten.
Am nächsten Tag war großes Wehklagen unter den Wächtern. Vielfach von Bienen gestochen, liefen sie aus ihren Hütten, rannten zum Fluss und warfen sich dort ins Wasser. Viele Tage lang konnten sie ihre Häuser nicht betreten. Sie gingen zum weisen Nun und fragten ihn, welche Bewandtnis dieses seltsame Ereignis habe. Nun, der aus den Äußerungen seiner Schüler wusste, was geschehen war, legte die Stirn in Falten und wiegte sich mit entrücktem Gesicht vor und zurück.
»Ein übles Vorzeichen«, sprach er schließlich. »Wisst ihr nicht, dass der Pharao Herr der Binse und Biene ist, Herrscher über Ober- und Unterägypten? Wenn die Bienen euch stechen, ist es ein Hinweis, dass der Pharao mit euch unzufrieden ist. Die nächste Warnung kann noch schlimmer ausfallen, wenn ihr euer Verhalten nicht ändert.«
»Worin haben wir gefehlt, guter Nun?«, rief Raneb, ein Nubier und ihr Anführer, der als besonders gewalttätig galt. Schon sein dunkles, grobschlächtiges Aussehen löste Furcht aus.
»Dazu muss ich die Sterne befragen. Werdet ihr befolgen, was euch der Ratschlag des Osiris weist?«
»Ja. Natürlich. Wir werden befolgen, was der Gott verlangt«, beteuerte Raneb.
Als sie am nächsten Tag wiederkamen, bat er die Wächter, sich zu ihm zu setzen. Lange schwieg er mit in den Nacken gelegtem Kopf. Als ein Falke das Dorf überflog, nickte er und murmelte etwas Unverständliches.
»Ist der Spruch der Götter ungünstig ausgefallen?«, fragte Raneb ängstlich.
»Wie man es nimmt. Aber ihr müsst euch ändern. Horus hat es eben bestätigt. Die Habiru sind wertvolle Knechte des Pharao, die unermüdlich für ihn arbeiten, damit Tempel zu seinen Ehren entstehen. Aber durch eure Schläge geschwächt, können sie nicht so hart arbeiten, wie sie es gern tun würden. Viele Tage gehen dem Pharao durch Krankheit der Habiru verloren. Ihr wisst doch, dass Amenophis eins ist mit Osiris und Herr über Binse und Biene? Deswegen schickte er euch die Bienenvölker. Wenn ihr aufhört, die Habiru zu drangsalieren, wird der Krieg der Bienen gegen euch aufhören. Beschmiert eure Türen mit Essig, geht in den Tempel und betet zu Osiris, und schon wird die Strafe von euch genommen werden.«
Von da an hörten die Wächter eine Zeit lang auf, die Habiru zu bedrängen.
Natürlich blieb nicht verborgen, welche Rolle Thotmes dabei gespielt hatte und die Habiru waren stolz auf ihren kleinen Helden. Amram und Jochebed sahen sich darin bestätigt, dass sie einen besonderen Menschen großzogen.
Aber auch Raneb erfuhr bald, dass der Sohn des Schmieds mit dem Krieg der Bienen gegen ihn und seine Leute etwas zu tun gehabt hatte. Eines Morgens, als Thotmes auf dem Weg zum Schreiber Nun war, fing er ihn an der Sykomore des Sobek oberhalb des Flusslaufes ab, in dem etliche Krokodile blinzelnd aus dem Wasser sahen und auf Opfer lauerten.
Raneb, der Nubier, war ein großer, breitschultriger, muskelbepackter Mann von dunkler, fast schwarzer Hautfarbe mit einem Gesicht wie ein Fels, kantig und vernarbt.
»Du sollst der Knirps sein, der uns die Bienen auf den Hals geschickt hat!«
Der Anblick des Knaben verblüffte ihn. Er hatte gehört, dass der Junge nicht älter als zwölf Hapi sei. Aber ihm stand jemand gegenüber, der kurz vor dem Jünglingsalter zu sein schien, ihm bereits bis zum Hals reichte und ihm selbstbewusst entgegensah.
»Ich bin nicht der Pharao, der den Bienen Befehle erteilt!«, erwiderte Thotmes und sah ihm furchtlos in die Augen.
»Ein Frechdachs bist du also. Siehst du unten die Krokodile?«, drohte er mit bösem Grinsen. »Sie warten bereits auf ihr erstes Tagesmahl.«
Die vier Kriegsknechte, die Raneb begleiteten, kreisten Thotmes roh lachend ein und schmähten den Jungen und seine Eltern. Auf ein Zeichen ihres Anführers packten die Männer Thotmes, um ihn hinunter zum Fluss zu den Krokodilen zu schleppen. Thotmes schlug um sich, was ihm nicht viel nützte. Doch es kam etwas dazwischen – und war dies bereits ein Zeichen? Der Himmel hatte sich bereits vor Ranebs Ankunft verdunkelt. Als sie den Jungen, an Händen und Füßen festhaltend, im hohen Bogen zu den Krokodilen schleudern wollten, fuhr ein Blitz aus der Wolke, ein Donnerschlag folgte und ließ die Vögel erschrocken auffliegen. Die Krokodile tauchten ab. Und damit nicht genug. Der Blitz hatte die Sykomore vor dem Fluss in Brand gesetzt, die wie eine Fackel brannte. Vor Schreck ließen sie Thotmes fallen und starrten fassungslos auf den brennenden Baum. Sie zweifelten nicht daran, dass ein Gott gesprochen hatte. Thotmes hatte sich zwar auch erschrocken, aber statt zu fliehen, was jeder andere getan hätte, nutzte er die Furcht der Wächter.
»Sehr nur, wie Sobek zürnt, wenn ihr euch an einem vergreift, der unter seinem Schutz steht!«
Die Wächter wandten sich jäh um und liefen voller Panik davon. Thotmes sah sich das Feuer des brennenden Baumes an und fragte sich nicht zum ersten Mal: Wer bin ich?
Als er sich später mit Eumenes traf und ihm von dem Vorfall erzählte, sagte dieser: »Ich weiß auch nicht so recht, wer du bist. Du bist jedenfalls anders als alle hier im Dorf, das steht mal fest. Vielleicht bist du aus einem Kuckucksnest?«
Thotmes gab ihm einen Schlag in den Nacken.
»Sag das nicht noch einmal! Ich bin der älteste Sohn von Amram und Jochebed und liebe sie beide und sie lieben mich.«
»Warum schlägst du mich? Ich bin doch dein bester Freund!«, klagte Eumenes.
»Entschuldige, ich bin manchmal etwas heftig in meinen Gefühlswallungen«, besänftigte er den Freund.
»Das solltest du dir sagen, bevor du zuschlägst«, maulte Eumenes.
»Ich werde jedenfalls der beste Schmied im Delta werden«, versuchte er sich selbst davon zu überzeugen, dass er in die Fußstapfen seines Vaters treten und als geachteter Habiru aus dem Stamm der Levi gelten würde.
Von nun an sahen die Wächter an ihm vorbei, wenn sie ihm begegneten. Unter ihnen waren Geschichten im Umlauf, dass dieser Sohn des Schmieds unter dem Schutz des Sobek oder gar Osiris stehe und man sich besser nicht mit einem Schützling der Götter anlege.
So lebte Thotmes ohne nennenswerte Zwischenfälle im Haus des Amram, lernte am Vormittag beim Schreiber Nun nicht nur die Schriftzeichen, sondern hörte auch von den Babyloniern, Hyksos und Hethitern, vom Aufstieg und Niedergang der Reiche. Am Nachmittag half er dem Vater in der Schmiede und traf sich gegen Abend mit den Freunden und war ihnen der Anführer, der immer neue Spiele erfand. So verging die Zeit in der behüteten Liebe von Amram und Jochebed bis zu seinem vierzehnten Lebensjahr.
Bis das Boot auf dem Flussarm auftauchte, mit silbernen Platten beschlagen, wie man es funkelnder noch nie gesehen hatte. Die Habiru verließen die Brennöfen und selbst die Wächter gingen bis an den Fluss. Mit ruhigem Schlag kam das Boot heran und ein Priester des Amun entstieg ihm. Seine Halsketten leuchteten wie Sonnenstrahlen. Der Priester fragte nach dem Haus des Amram und betrat dessen Hütte mit missbilligendem Blick. Amram sah ihm erschrocken entgegen und legte den Arm um die Schultern von Thotmes, denn er ahnte, dass man seinetwegen gekommen war.
»Das Haus des Pharao verlangt den Knaben Thotmes zurück.«
Amram stöhnte und senkte den Kopf.
»Der Knabe mit dem stolzen Blick ist es, nicht wahr?« Der Priester deutete mit seinem silbernen Krummstab auf den Jungen, der ihn mit offenem Mund anstarrte. Mit hängendem Kopf nickte Amram.
»Ich wusste, dass Thotmes nicht ewig bei uns bleiben würde. Seine Mutter will ihn sicher zurück. Und das ist nur recht«, flüsterte er.
»Er ist mein Sohn!«, schrie Jochebed heftig. Doch Amram schüttelte den Kopf.
»Nein, Frau. Wir wissen beide, wie er zu uns gekommen ist. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs hat uns ein Geschenk gemacht, indem er uns Thotmes gab und nun gibt er ihn seiner Mutter zurück. Fügen wir uns in seinen Ratschluss.« Er legte Thotmes die Hand auf den Kopf und sagte unter Tränen: »Wir müssen uns trennen, Sohn. Man wird dir im Haus des Pharao erzählen, wer du bist und wie es dazu kam, dass wir dir eine Zeitspanne Vater und Mutter waren.«
Der Priester zupfte ärgerlich an seinem Halsschmuck, hatte er doch nicht vor, länger als nötig in dieser Lagune zu verweilen, wo der Rauch der Brennöfen die Sonne hinter einem Schleier verbarg, geschweige denn in diesem Haus, in dem es nach Ziegen- und Schafsmist stank, der hier als Brennmaterial verwendet wurde.
»Was hat das zu bedeuten, Vater?«, fragte Thotmes verwirrt.
»Du wirst dahin gehen, woher du gekommen bist. Ich hoffe, dass dich der Herr Abrahams, Isaaks und Jakobs weiter beschützt. Wir durften vierzehn Jahre deine Eltern sein, mehr war uns nicht zugemessen. Ich habe immer gehofft, dass man dich bei uns belässt, aber es sollte nicht sein.«
»Wer bin ich denn?«, fragte Thotmes voller Angst vor der Antwort.
»Das wirst du im Haus des Pharao bald erfahren!«, sagte der Priester schroff, der einen unmündigen kleinen Jungen erwartet hatte und sich nun einem Knaben gegenübersah, der ihm fordernd in die Augen blickte.
Und so schickte sich Thotmes in sein Schicksal und umarmte voller Inbrunst die Frau, die er als seine Mutter angesehen hatte, und empfing den letzten Rat Amrams: »Sei ehrlich, treu und voller Barmherzigkeit. Achte das Gesetz und vergiss nicht, zu wem wir dich beten gelehrt haben.«
Thotmes schluchzte, als er die Hütte und das Dorf verließ. Die Kinder des Dorfes standen traurig am Wegesrand und winkten ihm zu. Eumenes folgte ihm weinend bis zum Ufer.
»Du kommst doch zurück, Thotmes? Lass uns nicht im Stich!«, schrie er.
Thotmes verließ Gosen mit bangem Herzen, aber trotzigem Geist. Wohin man ihn auch bringen würde, er würde den Weg hierher zurückfinden.
2
Die Heimkehr des Sohnes
Alles, was geschieht in Ober- und Unterägypten, geschieht durch die Götter, so predigen es die Priester, und der Herr der Binse und Biene vollstreckt ihren Willen. Er ist der fleischgewordene Gott, Inkarnation der Götter Osiris und Horus, und Bewahrer von Ordnung und Recht.
Viele Hapi waren ins Land gegangen. Der Nil hatte die Ufer gewässert und den segensreichen Schlamm gebracht und das Land war im Gleichgewicht der Maat. Die Götter liebten Amenophis und ließen ihn lange bei seinem Volk. Die Menschen waren an ihn gewöhnt und liebten ihn und konnten sich nicht vorstellen, dass er nicht mehr in seinem Haus in Theben unter ihnen weilte. Nefertari war nie wieder zum Pharao gerufen worden, gleichwohl galt sie als seine Gemahlin, aber dies traf auch für viele andere Frauen im Haus der Frauen zu.
Ihr Leben verlief eintönig und alle Ehren wurden ihr schal, alle Annehmlichkeiten zu einer Gewohnheit, die sie nicht mehr wahrnahm. Je älter sie wurde, umso nutzloser fühlte sie sich. Sie trank gleichgültig den Becher des Glücks und erkannte auf dessen Grund nur die Sinnlosigkeit ihres Daseins. Immer öfter schlich sich nun in ihre Gedanken, dass sie einen Sohn geboren hatte und sie fragte sich, was aus ihm geworden war. Anfangs vermochte sie den Gedanken wieder zu verdrängen, aber wie eine Mücke kam er immer wieder und störte ihre Ruhe.
Eines Tages fasste sie den Entschluss, ihm nachzugeben. Sie ging in den Garten und suchte den Gärtner auf, dem sie sich einst hingegeben hatte und der nun zum Obergartenpfleger aufgerückt war. Beinahe hätte sie ihn nicht wiedererkannt. Wie Tau hatte sich die Zeit auf sein Gesicht gelegt. Seine Haut war grau und die Muskeln waren schlaff geworden. Seine Schönheit war nur eine Erinnerung. Er übte keinen Reiz mehr auf sie aus. Im Gegenteil, sie fand Widerwillen bei dem Gedanken, sich ihm einst hingegeben zu haben.
»Du Schmutz unter meinen Sandalen! Was ist aus dem Kind geworden?«, fragte sie kalt und voller Hochmut, jede Vertraulichkeit von vornherein unterbindend.
Er sah sie lange schweigend an. Sie stampfte mit dem Fuß auf. »Nun rede!«
Ein Lächeln flog über sein Gesicht, sanft und voller Verständnis.
»Du hast dich nicht verändert, Nefertari.«
»Deine Rede ist mir wie Fliegengesumm! Ist das Kind tot?«
»Oh nein. Es lebt bei meinem Bruder im Delta, wie ich es dir damals zugesagt habe. Es geht ihm gut und es wächst zu einem prächtigen Jungen heran.«
»Fragt er nach mir? Geht er in den Tempel?«
»Nein. Du weißt doch, warum dies nicht geht, soll er doch ein Findelkind sein. Jochebed ist ihm die Mutter. Er weiß nicht von dir und den Tempel braucht er nicht aufzusuchen. Er betet zu dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs.«
»Er betet nicht zu Amun-Re?«
»Nein. Wie sollte er auch? Er wächst als Habiru auf.«
»Wie einer aus dem Sklavenvolk«, stellte sie unzufrieden fest.
»Wie einer aus dem Volk, das für den Pharao die Tempel baut«, bestätigte er.
»Er kennt also nicht den Weg in den Westen zur Waage des Anubis und das Urteil vor Osiris?«
»Nein. Mit solchen Greueln lässt ihn mein Bruder nicht aufwachsen.«
»Greuel? Was wagst du mir ins Gesicht zu sagen, Unwürdiger? Mein Sohn ist verworfen, wenn er nicht weiß, was jeder unseres Volkes weiß.«
»Er ist ein Habiru, Nefertari«, wiederholte er sanft.
Angst presste das Herz der Prinzessin zusammen, wurde sie sich doch wieder bewusst, dass sie gegen das Gleichgewicht der Maat, gegen Wahrheit, Ordnung und Gerechtigkeit, verstoßen hatte. Damit würde ihre Lebenswaage vor Osiris nicht im Gleichgewicht sein und ihr Herz würde von einem Dämon verschlungen werden.
»Mein Sohn muss in ordentliche Verhältnisse.«
»Dann lass ihn dort leben, wo er ist. Er wächst zu einem Menschen heran, wie man ihn sich besser kaum vorstellen kann. Wie ich von einem Habiru aus seinem Dorf hörte, ist er weit über sein Alter klug und wird ein Gerechter unter dem Herrn.«
»Er ist ein Prinz aus dem Hause Amenophis. Er gehört in den Palast. Ich werde dir Bescheid geben, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe.«
»Du willst ihn als deinen Sohn anerkennen?«, fragte er erstaunt. »Du hast dich doch seiner geschämt!«
»Ach was. Ich hatte andere Gründe damals, ihn wegzugeben. Doch es ist viel Zeit verflossen. Ich war damals sehr … jung und verletzt«, gestand sie stockend.
»Du bist dir der Tragweite bewusst?«, insistierte Isaak und betrachtete sie aufmerksam. Die Jahre schienen spurlos an ihr vorbeigegangen zu sein. Aber um ihren Mund lag ein grämlicher Zug, der ihn dauerte.
»Wieso? Welcher denn?«
»Er ist ein Habiru und … mein Sohn.«
Sie zuckte mit den Achseln.
»Er ist vor allem mein Sohn und wird sein, was ich will. Er hat das Blut unserer Familie in seinen Adern«, gab sie zurück.
»Warum dieser Sinneswandel?«
»Ich will es so!«
Der Obergartenpfleger, dem sie einst ihren Leib überlassen hatte, verneigte sich tief.
»Du bist die Tochter und Gemahlin des Allgewaltigen, ich verstehe.«
»So ist es, Habiru!«, erwiderte sie und ging aus dem Garten.
Ihr Entschluss war gefasst. Sie wollte ihren Sohn zurück, um ihrem Leben einen Sinn zu geben und das Unrecht wieder gut zu machen, das sie einst begangen hatte. Sie überlegte lange, wie sie vorgehen sollte, und beriet sich mit ihrer Amme, die ihr näher war als ihre leibliche Mutter. Aber auch sie wusste keinen Rat.
»Immerhin hast du den Sohn des Pharao weggegeben«, warnte sie Nefertari. »Ich habe dich damals gewarnt, dass es gegen die göttliche Ordnung verstößt, das Kind fortzugeben. Du hast dein Muttersein verletzt.«
»Ja, ja. Summe mir nicht so ärgerliche Vorhaltungen. Du weißt doch, was passiert war.«
»Der Pharao wird zornig werden, wenn er die Wahrheit erfährt. Wer weiß, was geschieht, wenn du ihm deinen Frevel gestehst. Er wird dich aus seinem Palast entfernen und dich irgendeinem Gefolgsmann schenken und du wirst in dessen Frauenhaus an der Grenze des Reiches ein langweiliges, ödes Leben führen. Besinne dich, Nefertari!«
Sie fantasierten wilde Pläne und kamen doch zu keiner Lösung. Da die Amme erkannte, dass Nefertaris Wunsch nach ihrem Kind umso stärker wurde, je größer die Hindernisse erschienen, verwies sie schließlich auf Teje.
Die Hauptfrau des Pharao war erstaunt, als Nefertari um eine Audienz bei ihr bat.
»Du bist doch die Tochter jener Frau, die glaubte, sie könnte mich aus dem Herzen Amenophis’ verdrängen, nur weil du kurz das Bett des Königs geteilt hast.«
Sie lag langgestreckt auf einer goldenen Liege und musterte Nefertari feindselig. Die Dienerinnen fächerten ihr Luft zu.
»Ich habe gefehlt. Ich möchte dir ein Geheimnis anvertrauen und um deinen Rat bitten.«
»So? Einen Rat willst du? Dann lass hören.«
Sie scheuchte die Dienerinnen hinaus und hieß Nefertari, sich zu setzen und nickte ihr aufmunternd zu. Als sie sah, das Nefertari noch mit sich kämpfte, sagte sie weniger streng:
»Da war doch diese Geschichte, als die Frucht des Pharao entführt wurde, nicht wahr? Der Pharao war damals sehr bestürzt. Er war so stolz darauf gewesen, in seinem Alter noch zeugen zu können. Der Hohepriester hatte ihm einen Floh ins Ohr gesetzt, dass aus diesem Knaben dem Reich ein Schild und Schwert erwachsen würde, ein Gewaltiger, dessen Name noch in tausenden von Jahren unvergessen ist.«
Nefertari nickte. »Es geht um den Knaben. Wir ließen ihn, wie es Brauch ist, in einem Kästchen aus Pech auf dem Nil schwimmen und es kamen Männer und entführten ihn.«
»Ich erinnere mich. Und?«
»Ich hatte es mit einem Diener abgesprochen; er half mir, das Kind zu entführen.«
Teje sprang auf und starrte sie verwundert an.
»Warum, bei Amun-Re? Was war der Grund?«
»Ich wollte … Ich war noch ein halbes Kind. Der Pharao hatte mir wehgetan und ich wollte ihm wehtun. Die Frucht der Nächte mit ihm sollte ihm keine Freude bereiten. Ich wollte auch durch das Kind nicht ständig an das Unglück erinnert werden. Jawohl, der Pharao bereitete mir nur Schmerz und Scham.«
»Dein eigen Fleisch und Blut aus dem Samen des Pharao weggeben? Ein unerhörter Frevel an der Göttlichkeit des Pharao. Du bist eine Verworfene und dümmer als ein Mistkäfer!«
»Ja, ich war töricht und so jung.«
»Und dieser Diener, der dir geholfen hat? Warum half er dir?« Sie legte den Finger an ihr Kinn und nickte. »Ich verstehe. Du hast dich mit ihm …«
Nefertari senkte den Kopf, aber schwieg.
»Oh ja, ich verstehe. Du hast mit ihm … und weißt vielleicht nicht einmal, ob das Kind von ihm oder vom Pharao stammt.«
»Oh doch …doch! Ich weiß, dass es vom großen Pharao, unserem Herrn, stammt. Aber ich hasste ihn so und wollte es nicht. Er war doch mein Vater.«
»Du bist sicher die dümmste Frau, die je im Haus der Frauen gelebt hat. Jede Frau ist glücklich, wenn sie von meinem Gemahl ein Kind empfängt.«
»Seth hat mich auf Abwege geführt.«
»Schieb es nicht auf Seth! Was ist mit dem Diener?«
»Er ist … tot«, log sie. Ihn zum Tode zu verurteilen, vermochte sie dann doch nicht.
»Nun, wenigstens brauchen wir uns um den nicht zu kümmern, du Verworfene!«
»Ich war doch so jung, noch ein Kind«, wiederholte sie.
»Ja, ja. Das sagtest du schon. Und, was willst du? Warum gestehst du mir dein Verbrechen?«
»Ich will das Kind wieder zurück, will meinen Fehler wiedergutmachen.«
»Du willst, dass er in seine Rechte als Sohn des Amenophis eingesetzt wird, dieses Kind, das vielleicht der Sohn eines Sklaven ist?«
»Nein, nein! Ich habe das Kind schon gefühlt, bevor ich mit dem Habiru …«
»Und nun willst du, dass ich dir helfe, dass der Pharao deine Schuld verzeiht und diese peinliche Frucht in seinem Haus als Prinz aufnimmt? Warum sollte ich dir helfen?«
»Weil du die Gerechtigkeit herstellen kannst. Ich weiß mir keinen anderen Rat, oh, große Hauptfrau des Pharao. Jeder weiß, dass du sein Herz und Ohr besitzt.«
»Du willst, dass ich mich für eine Frau einsetze, die dümmer ist als Käfer und Würmer«, sagte sie nun nachdenklich geworden.
Teje war mit den Jahren eine harte und berechnende Frau geworden, hatte sie doch viele Intrigen gegen ihre Stellung abwehren müssen. Sie war trotzdem nicht nur Hauptfrau des Pharao geblieben, sondern auch seine Beraterin geworden, der Amenophis blind vertraute. Mehr konnte sie nicht erreichen und ihr blieb nur, dass ihr Sohn Amenhotep sein Nachfolger wurde. Aber sie wusste sehr wohl, dass dessen Zartheit und Neigung, sich allein den Göttern angenehm zu zeigen, ihn nicht gerade dazu prädestinierte, sich gegen Thronansprüche aus der Reihe der mächtigen Familien zu erwehren. Seine ständige Zwiesprache mit den Göttern machte ihr schon lange Sorgen. Aber ein Bruder, der wegen seiner nicht ganz makellosen Abstammung ohne jede Chance war, ihm gefährlich zu werden, konnte ein Schutz, ein Schild für ihn sein und die Rute gegen andere Thronanwärter. Jemand, der durch ihre Gnade im Haus des Pharao lebte, der mit Amenhotep aufwuchs, würde dessen Schwäche vielleicht ausgleichen können.
»Gut!«, sagte sie entschlossen. »Ich werde zu meinem Gemahl gehen. Du wirst ihn demütig um seine Huld anflehen. Vielleicht wirst du seinen Leib wärmen müssen.«
»Ich soll …?«, rief Nefertari erschrocken. Zu gut erinnerte sie sich, wie qualvoll ihr die Umarmungen des Vaters gewesen waren und welch Ekel sie erfüllt hatte und nun … war er noch älter geworden.
»Ich denke, du willst deinen Sohn zurückhaben?«, sagte Teje kalt. »Also, wie ist es?«
»Ich werde tun, was du verlangst«, sagte sie demütig. »Wird der große Pharao mir verzeihen?«
Teje zuckte mit den Achseln. Aber sie hielt dies nicht für unmöglich. Sie kannte sich im Seelenleben ihres Gemahls aus.
Amenophis hatte einen guten Tag gehabt, weil die Priester des Amun-Re ihm wieder einmal ein langes Leben vorausgesagt hatten. An diesem Tag mundete das zarte Fleisch einer Antilope besonders gut und der Nachmittag mit einer dickbusigen Nubierin brachte ihm angenehme Erinnerungen an die Freuden früherer Jahre … in diesem glücklichen Moment kam sie zu ihm in sein Gemach, kniete vor ihm nieder und bat ihm um Vergebung für die Störung.
»Was soll das, Teje? So demütig kenne ich dich nicht. Meist zerren und kneifen deine Worte an mir herum. Also, was willst du?«
»Ich möchte für eine deiner Töchter bitten, die einen großen Fehler gemacht hat und sich danach verzehrt, deine Vergebung zu erhalten.«
»Ha, was soll das? Da steckt doch mehr dahinter, Teje. Noch nie hast du dich für eine meiner Töchter interessiert, geschweige denn dich für sie eingesetzt.«
Der Pharao nahm ein Stück Honigkonfekt, steckte es sich in den Mund und verzog sein Gesicht, denn seine Zähne bereiteten ihm schon seit Jahren Kummer. Er versuchte sich mit einer Dattel von seinem Schmerz abzulenken, was jedoch keine Erleichterung brachte. Trotzdem, so erkannte Teje, war er immer noch in gnädiger Stimmung.
»Ich habe eine deiner Töchter, die kleine Nefertari, mittlerweile eine reife Frau, unter meine Obhut genommen und sie bittet um Vergebung, was sie dir einst angetan hatte.«
»Ha, war das nicht die Tochter, die meine Gunst nicht … Na, jedenfalls hat sie sich sehr ablehnend gezeigt.« Seine Stimmung schlug um. Mit schmerzlich verzogenem Gesicht fuhr er fort: »Ja, sie hat mir leidgetan. Sie mochte mit mir nicht … Du weißt schon. Es ist schlimm, wenn das eigene Blut einen derart ablehnt. Ich wollte ihr doch nichts Böses tun, sondern sie mit meiner Liebe ehren. Aber sie schrie immerzu, erbrach sich auf meine Brust … Ich habe sie fortgeschickt, denn ihr Anblick hat mir Pein bereitet.«
»Nicht jede Tochter will so von ihrem Vater geliebt werden.«
»Ich weiß. Ich weiß doch. Ich habe es bereut, was ich ihr antat. Sie war ein zärtliches, glückliches Kind und vertraute mir. Aber was ich tat, geschah nur, weil es der Tradition entspricht.«
»Nicht nur«, sagte Teje trocken.