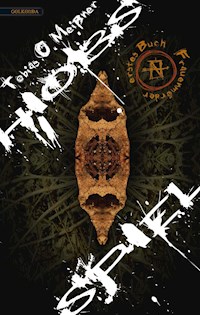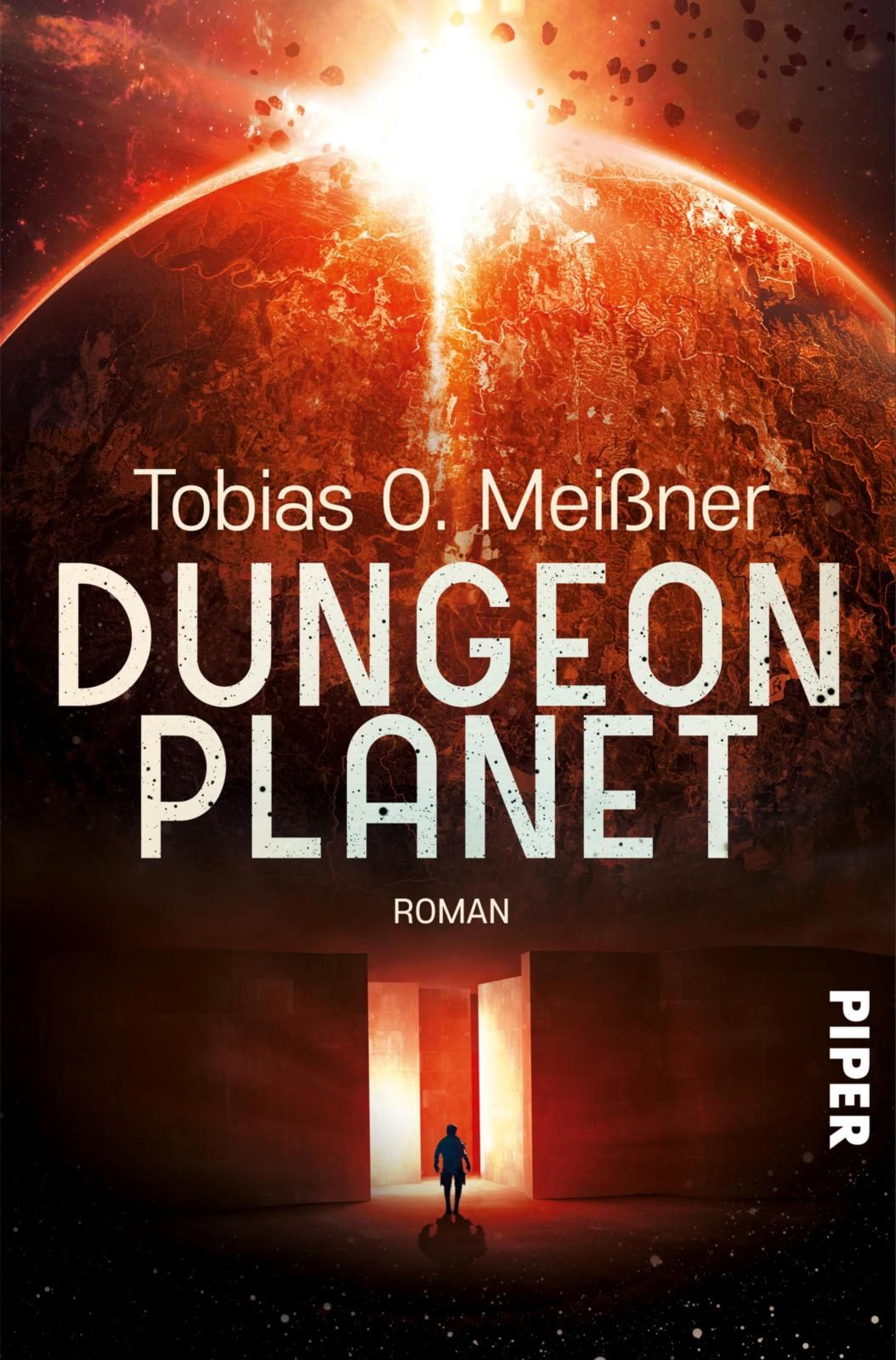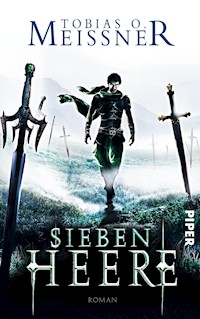2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Niemand kennt seinen Namen. Bevor er seine Opfer tötet, spricht er kein Wort. Er dringt in die Städte der Menschen ein und bringt Verwüstung. Er ist der Barbar – und sein Weg führt über Leichen, durch Blutströme und mündet in pures Entsetzen. Als die Menschen versuchen, den Barbaren für ihre Zwecke zu benutzen, gerät alles außer Kontrolle: Aus völliger Ruhe explodiert er zur totalen Raserei. Er besitzt kein Verständnis für Eigentum, Wert oder Schönheit. Er desertiert, zerstört alles und zieht, vom Blut seiner Feinde überströmt, durch unsere Straßen. Wage es nicht, dich dem Barbaren in den Weg zu stellen! Wenn du ihm begegnest, senke stattdessen den Blick. Denn der Barbar ist der vollendete Wilde – mit einer Würde und Gewalt, wie sie sonst nur einer Gottheit gleichkommen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
PIPER DIGITAL
die eBook-Labels von Piper
Unsere vier Digitallabels bieten Lesestoff für jede Lesestimmung!
Für Leserinnen und Leser, die wissen, was sie wollen.
Mehr unter www.piper.de/piper-digital
ISBN 978-3-492-98173-6
Oktober 2015 © für diese Ausgabe: Fahrenheitbooks, ein Imprint der Piper Verlag GmbH, München / Berlin 2015 Deutschsprachige Ausgabe: © Piper Verlag GmbH, München 2012 Covergestaltung: FAVORITBUERO, München Covermotiv: © Fotokostic/ shutterstock.com Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung, können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich Fahrenheitbooks nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
»Zivilisation ist unnatürlich.Sie ist eine Laune des Zufalls.Aber die Barbarei wird letztlich immer die Oberhand behalten.«
(Robert E. Howard: Jenseits des Schwarzen Flusses)
üBeRSCHReiTeN
Um den Tod zu begehen, waren die Menschen gekommen.
Zuerst zerstreuten sie sich noch anderweitig.
Doch dann blies der Henker in sein Horn.
Die Menschen auf dem Festmarktplatz setzten sich in Bewegung. Weg von den Buden mit ihrem Fleischrauch und den kandierten Krusten, weg von den Feuerspeiern, die ihre Hitze über die Köpfe der Schaulustigen hauchten, weg von den überdachten Kartentischen, auf denen Hütchenspieler ihre Lügen verschleierten, weg von dem von stummgenähten Leibsklaven gezogenen Karussell, den schnatternden Wahrsagerinnen mit den Gesichtsbrandzeichen, den feilbietenden Fellhändlern, den Geschichten erzählenden Guckkastenmännern, den Tänzerinnen, die sich nach der Art von Schlangen wiegten, den Handwerkern mit ihrem zerbrechlich gehäuften Tand, den Kerzendrehern mit ihren Bienenwachshänden, den Sektenanwerbern mit ihren gemalten Untergängen, den Obstfrauen mit ihren schrumpeligen Früchten, den Getränkeausschenkern mit ihrem Schaum und ihren Scherereien, den Zuckerstangenmachern mit ihren klebrigen Versprechungen, den Musikanten, die sich selbst zum Tanz aufspielten, den dressierten, nacktrasierten Bärenkindern, weg von den bettelnden Krüppelkindern und den miteinander verfeindeten Glasbläserschulen.
Der Henker hatte in sein Horn geblasen, und alle Attraktionen verblassten vor der Holzbühne mit dem Richtblock.
Die Menschen drängelten, um die besten Stehplätze zu ergattern.
Unweit der Bühne gab es ein hölzernes Treppenpodest für die Ehrwürdigen und Schönen der Stadt. An die sechzig Sitzplätze standen dort zur Verfügung, vom Pöbel sorgfältig durch Ketten abgesperrt und von Bütteln behütet. Von diesen Sitzplätzen waren höchstens achtzehn besetzt, und der junge Gelehrte Welw Indencron war einer dieser wenigen. Um nichts in der Welt hätte er diese Hinrichtung verpassen mögen, denn er hatte bereits den kurzen Prozess mitverfolgt, den man dem Hinzurichtenden zugestanden hatte. Indencron war fasziniert gewesen, ausgesprochen fasziniert. Noch niemals zuvor hatte er einen Angeklagten erlebt, der kein einziges Wort erwidert hatte. Indencron studierte die Menschwissenschaften an der Akademie dieser Niederstadt und glaubte, schon einiges begriffen zu haben über das Wesen der Menschen, aber einer wie dieser war ihm noch nie untergekommen.
Die Menschen drängelten. Kinder nach ganz vorne. Ein Ältlicher kam zu Fall und schimpfte. Zwei Frauen beschwerten sich, dass sie zu wenig sehen konnten. »Setz dich doch auf meine Schultern, und zwar vor mein Gesicht, dann haben wir beide was davon, selbst wenn ich mit dem Rücken zur Köpfung stehen muss«, schlug ein Grobian der jüngeren der beiden Zeternden vor. Es gab Gelächter und hin und her fliegende Beleidigungen. Viele in der Menge aßen etwas, das sie sich eben noch von einer der Buden mitgenommen hatten, und da viel geschoben und gedrängt wurde, bekleckerten sich auch viele Leute gegenseitig, und es wurden herzhafte Knüffe und Maulschellen ausgeteilt.
Mit einem Wort: Die Stimmung stieg.
Der Henker war ein stattlicher Bursche mit einem Bauch wie ein Weinfass. Statt einer Henkerskapuze wie in anderen Städten üblich trug dieser eine blattgoldene Maske der unparteiischen Gerechtigkeit. Sein Richtbeil war nicht minder eindrucksvoll. Nicht jeder Mann im Publikum wäre in der Lage gewesen, dieses gewaltige Gerät überhaupt anzuheben. Der Henker ließ die Arme kreisen. Es wehte ein kühler Wind, er wollte nicht mit kalten Muskeln arbeiten.
Man brachte den Delinquenten.
Zwischen dem hinteren Bühnenbereich und dem Gefängnisgebäude wurde eine Gasse durch Seile und vereinzelte Stadtbüttel freigehalten. Auch dort drängten sich schon Schaulustige, die vorne keinen Platz mehr gefunden hatten. Die Schwächlicheren, die weniger Frechen und die Schlauen. Die Bühne war nämlich nicht erhaben genug, dass man von vorne ab der fünften Reihe noch gut sehen konnte, aber hier hinten war deutlich weniger los.
Der Delinquent hatte eine Kapuze auf, wie sie in anderen Städten der Henker trug.
Seine Hände waren hinter dem Körper gefesselt, seine Füße durch eine Kette behindert, die ihm nur Trippelschritte erlaubte. Dennoch gingen ein »Ah!« und ein »Oh!« durch die Menge. Der Delinquent war außergewöhnlich groß. Sein Körper starrte vor Schmutz, wies aber beeindruckend modellierte Muskeln und auch etliche Narben auf. Man konnte sein Gesicht nicht sehen, aber sein nur mit einem Schurz aus grobem Leinen bekleideter Leib schien jung zu sein, höchstens Mitte zwanzig. Im Gegensatz zum Henker zierte kein Quäntchen Fett seinen flach atmenden Bauch. Es war nicht zu erkennen, ob er Furcht hatte vor dem, was ihm bevorstand. Die Kapuze und die Trippelschritte verwehrten ihm eine wie auch immer geartete Haltung.
Ihm voraus ging der Stadtschreiber, flankiert von zwei Bütteln. Hinter dem Delinquenten kamen noch mal zehn Büttel in Zweierformation. Zehn schien einigen Zuschauern eine außergewöhnlich hohe Zahl zu sein, in der Regel hatten zum Tode Verurteilte allenfalls vier bis sechs Büttel hinter sich.
Über ein schmales Treppchen betrat der Stadtschreiber die Bühne, die beiden vorderen Büttel führten den Delinquenten an den Schultern ebenfalls hinauf. Der Henker spuckte schon mal in die Hände und verrieb die Spucke zwischen seinen wurstigen Fingern.
Der Verurteilte wurde zum Richtblock geführt und nahm dahinter Aufstellung. Sein Kopf machte den Eindruck, unter der Kapuze schuldbewusst gesenkt zu sein.
Genüsslich entrollte der Stadtschreiber ein Pergament und begann vorzutragen. Sein Redestil war ein eigenwilliger Singsang, in dem er einzelne, zufällig wirkende Worte betonte. Den Bürgern der Stadt war diese Melodie wohlvertraut.
»Hochverehrte Bürger! Auf Ratschluss der Stadtverwaltung befördern wir heute vom Leben ZUM Tode einen Mann, dessen Namen wir nicht kennen und der sich auch während des gerechten Prozesses auf unvergleichlich starrsinnige Weise geweigert HAT, uns über sich und seine Beweggründe Auskunft zu geben, obwohl Untersuchungen seiner Zunge und seines Kehlkopfes ergeben haben, dass er DURCHAUS des Sprechens mächtig ist. Wir wissen nur, dass er nicht von hier stammt, nicht aus dieser STADT und nicht aus diesem oder einem der angrenzenden Länder. Vermutungen deuten auf die Urwälder des Nordens HIN, aber das sind selbstverständlich in aller Begründetheit nur Vermutungen. Was wir wissen, mit Sicherheit, was BEZEUGT wurde von etlichen, ist, dass dieser Mann, dieser Unhold, in unserer Stadt vier Menschen erschlagen hat, dass vier Elternpaare nichts als TRÄNEN haben, wegen einer Wirtshauskeilerei, die aus sämtlichen akzeptablen Fugen GERIET. Zwei der vier Getöteten waren Büttel, die versuchten, des Rasenden habhaft zu werden, was ein umso schwerer wiegendes Verbrechen darstellt, weil der Verurteilte dadurch bewies, dass er das Recht UND Gesetz unserer Stadt missbilligt. Nur unter großen Mühen und erwähnten Verlusten konnte er ÜBERHAUPT dingfest gemacht werden, und selbst im Gefängnis betrug er sich dermaßen störrisch und uneinsichtig, dass er in gesonderte Verwahrung genommen werden MUSSTE. Wir werden nun unserer Pflicht nachkommen, diesen Unhold vom Leben zum Tode zu befördern, NICHT aus Rachsucht oder Vergeltungswut, wie seinesgleichen das tun würden, sondern aus dem begründeten Verdacht heraus, dass andernfalls weitere Unschuldige ihr Leben durch seine Hände verlieren WÜRDEN. Das Urteil wird VOLLSTRECKT im Einklang mit den Gesetzen des Hochadels. Der Kopf des Unholds wird im Nachfolgenden auf dem Schandpodest vorm Rathaus AUSGESTELLT und darf ausdrücklich von jedermann bespien werden.«
Die Holztribüne für die Betuchteren hatte sich inzwischen gefüllt. Indencron sog mit geweiteten Nüstern den Wohlgeruch der stadtbekannten Kurtisane Chaerea ein, die unmittelbar vor ihm Platz genommen hatte. Ganz vorne saßen die Angehörigen der vier Opfer des Unholds und schienen haltlos zwischen Weinen und Verwünschungen hin- und herzuschwanken. Das gesamte Podest bebte unter dieser Unruhe. Welw Indencron fragte sich, ob es überhaupt stabil genug konstruiert worden war. Als es noch fast leer gewesen war, hatte er sich ganz nach oben gesetzt, um den möglichst besten Blick über die Volksmenge zu haben, aber nun bereute er seinen Entschluss und hätte lieber weiter unten Platz genommen, doch da war nun alles besetzt. Immerhin entschädigte ihn Chaereas sinnlicher Duft für seine Sorgen. Sie wandte sich sogar einmal zu ihm um und lächelte ihn kokett an, war aber mindestens zwanzig Jahre zu alt, um seinem Geschmack zu entsprechen.
Die Menge johlte und rief den Stadtsprecher mit Namen. Er war beliebt aufgrund seines eigentümlichen Singsangs. Er solle noch irgendetwas weiterreden, forderten einige. Andere verlangten, dass man endlich mit der Köpferei anfange, wegen der sie doch schließlich gekommen seien.
Indencron blickte sich auf dem gesamten Marktplatz um. Auf zweien der Hausdächer konnte er Büttel mit Armbrüsten ausmachen. Das war eine ganz neuartige Vorsichtsmaßnahme, so etwas hatte er bei einer Hinrichtung noch nie gesehen. Der Verurteilte musste sich im Gefängnis wirklich ganz außerordentlich ungebührlich betragen haben.
Beim Prozess war nichts davon zu bemerken gewesen. Er interessierte sich für solche Fälle, in denen Individuen sich mit einer Übermacht anlegten. Das Aufbegehren gegen eine Mehrzahl schien ihm dem Studium des Menschseins eine hochinteressante Facette hinzuzufügen.
Während des Prozesses hatte der Unhold – so war er auch dort schon bezeichnet worden – überwiegend mit gesenktem Kopf dagestanden und ausschließlich geschwiegen. Er hatte ausgesehen, als würde er im Stehen schlafen, doch Indencron war den Verdacht nicht losgeworden, dass er sehr aufmerksam alles um sich herum registrierte, überwiegend durch das Gehör. Er hatte sich sogar mit einem Kommilitonen darüber gestritten, der der festen Überzeugung gewesen war, der Unhold sei nicht nur brutal, sondern auch blöde. Obschon der Unhold beim Prozess keine Kapuze getragen hatte, war von seinem Gesicht aufgrund der Haare nicht viel zu sehen gewesen. Es konnte aber durchaus sein, dass es sich bei ihm um einen Mann handelte, der den Frauen gefiel. Die Reaktionen der Damen auf der Prozessbalustrade wie nun auch Chaereas interessiertes Vorlehnen schienen jedenfalls diese Theorie zu unterstützen.
Jetzt zwang man ihn auf den Richtblock. Er wehrte sich nicht so, wie es ihm vielleicht möglich gewesen wäre. Zwei der Büttel drängten ihn mit Stäben in die Knie und zerrten seinen Kopf und Oberkörper auf den kerbigen, schwarz patinierten Block. Die Kapuze würde er aufbehalten. Sie war eine Vorsichtsmaßnahme. Früher war es oftmals vorgekommen, dass den Geköpften Speichel aus dem Mund oder Rotz aus der Nase spritzte. Man wollte dies den Schaulustigen der ersten Reihe ersparen und ließ den Kopf deshalb adrett eingepackt in den Fangkorb plumpsen.
Der Henker stieß noch einmal weithin vernehmlich in sein Horn, damit auch die letzten Schwätzer begriffen, dass es nun ernst wurde. Dann stiefelte er breitbeinig zu seinem riesenhaften Beil und zog dieses mit einem vernehmlichen Geräusch aus dem Holzklotz. Trotz seiner hübschen goldenen Maske, die den berühmten Gleichgültigen Jüngling darstellte, fand Indencron, dass der Henker weitaus brutaler und blöder wirkte als der Delinquent. Man musste aber wahrscheinlich auch beides sein, um seinen Lebensunterhalt mit dem Durchhauen von wehrlosen Hälsen bestreiten zu können.
Links neben Indencron wurde eine Vertreterin des Hochadels ohnmächtig. Die Aufregung war wohl zu viel. Halt: Indencron musste sich korrigieren – es war ein Mann, der dort seufzend in sich zusammensackte. Ein lang gelockter, weiß getünchter Mann.
Indencron schmunzelte. Der Hochadel, der nicht zeitweilig zu Vergnügungen außerhalb der Stadt weilte, durfte sich eine Hinrichtung nicht entgehen lassen. Es musste eine große Belastung sein, unbedingt bei allem dabei gewesen seinzu wollen.
Der Henker ließ sein Beil angeberisch in der Hand kreisen. Die Schneide surrte metallisch. Die beiden Büttel, die den Verurteilten bis eben noch auf den Richtblock gedrückt hatten, ließen diesen los und entfernten sich zwei Schritte, um nicht besudelt zu werden.
Der Henker stellte sich neben den Richtblock, seufzte oder rülpste vernehmlich und hob das Beil.
Totenstille setzte ein. Dies war immer der aufregendste aller Augenblicke. Indencron sah, dass Chaereas Dekolleté beinahe aus seinen Verschnürungen platzte, so heftig atmete die Ärmste. Die Axtklinge spiegelte in der Sonne. Es war ein allerliebster, wolkenloser Tag. Gestern hatte es noch geregnet. Heute hielt auch der Himmel, wie an dieser Hinrichtung interessiert, den Atem an.
Jetzt kam das Beil herab.
Die Menge schrie erwartungsvoll. Die Stimme der Menge war hoch, eher weiblich als männlich.
Der Delinquent richtete sich auf. Ob er sich mit den Oberarmmuskeln stützte oder die Bewegung ganz alleine aus dem Bauch heraus stemmte, war nicht zu erkennen. Das Beil jedenfalls schnitt haarscharf an seinem Kapuzengesicht vorbei und blieb unblutig im Richtblock stecken.
Selbst die Vögel über dem Marktplatz schienen in diesem Moment im Flug innezuhalten.
Der Verurteilte schnellte sich aus den Knien in den Stand und wandte sich halb um, sodass seine hinter seinem Rücken gefesselten Hände die Beilschneide berührten.
Der Henker zögerte. Zu lange. Als er dann das Beil wieder hochreißen wollte, breitete der Verurteilte seine Arme aus. Fetzen der Fesselung trudelten zu Boden. Von seinen Handgelenken quoll Blut. Um dermaßen schnell sein zu können, hatte er in Kauf nehmen müssen, sich selbst zu schneiden. Der Henker stand immer noch vor ihm, das eingeschlagene Beil in beiden Händen, den massiven Leib vorgebeugt. Schwerfällig, brutal und blöde. Der Verurteilte schlug ihm mit dem Handballen gegen das Kinn der Maske. Das Antlitz des Gleichgültigen Jünglings verformte sich unter dieser Wucht zu einer säuerlichen Grimasse. Der Henker strauchelte stöhnend einen halben Schritt zurück und musste das Beil loslassen. Der Verurteilte riss sich mit links die Kapuze vom Kopf und nahm mit rechts das riesige Beil an sich. Das Geräusch, als es aus dem Richtblock schlüpfte, war wie das Einsaugen von Luft.
»Er hat die Axt! Er hat die Axt!«, schrie vollkommen überflüssig irgendjemand, und in die Menge direkt vor der Bühne kam die Bewegung der Panik.
Wie der Verurteilte nun dastand, die Lippen geschürzt, den Kopf vorgereckt, den Bauch jedoch flach und beinahe nicht atmend, wirkte er für einen Moment in den Augen von Welw Indencron wie etwas Vorzeitliches, Unüberwindbares, Unbegreifliches. »Vielleicht ist dieser Mann unfassbar«, dachte der junge Gelehrte, und bevor nun das Blut zu sprühen begann, war dieser Gedanke durchaus von Bewunderung durchtränkt.
Dann aber griff der Verurteilte an, und die Panik schien selbst die Gebäude ringsum zum Erzittern zu bewegen.
Er führte das Beil, für das selbst der stämmige Henker zwei Hände gebraucht hatte, einhändig in einem flirrenden Halbkreis und sprang dabei nach vorne. Seine Füße waren immer noch aneinandergekettet, deshalb musste er mit geschlossenen Beinen springen, was normalerweise vielleicht komisch ausgesehen hätte, unter diesen Umständen jedoch eher grausig-grotesk wirkte. Der Henker, der alles falsch gemacht hatte – danebengeschlagen, zu lange gezögert, unter Schlagwirkung zurückgewichen, nun zu spät nach vorne –, bekam das Beil in den Leib, faltete sich um die Schneide, als wäre er aus aufgeblasenem Pergament, und wurde abgestreift als ein vergessenswerter Kadaver. Die Menge schrie. Der Verurteilte sprang nochmals, die Schneide sirrte nun dunkelrot, beschrieb einen weiteren Halbkreis, dann noch einen, beide um Ebenen voneinander versetzt und aus dem Schwung des vorhergegangenen geboren. Die vordrängenden Büttel wurden wie mit einem X markiert, klafften auf und verteilten sich blutverströmend auf der Bühne.
»Zurück, ihr Idioten!«, schrie ihr Kommandant, dessen Gesicht ein fahlweißes Zerrbild war. Und nach oben gewandt: »Worauf wartet ihr denn? Erschießt ihn doch!«
Der Verurteilte hielt inne und blickte ebenfalls hoch. Zwei Armbrustbolzen rasten wie an Schnüren gerissen durch die Luft auf ihn zu. Dem einen entging er, indem er sich ein Stück weit abduckte. Den zweiten ließ er gegen die Beilschneide klirren, die er schützend vor sich hielt. Jetzt hatte er Zeit gewonnen. Die Schützen mussten erst nachladen. Er sprang wieder zu den Bütteln, die sich gegenseitig behinderten. Ihr Kommandant hatte den Rückzug befohlen, aber sie standen einander alle im Weg. Das Beil erwischte zwei weitere von ihnen, die brüllend hinfortgerissen wurden, als hätte die Pranke eines Riesen sie davongefegt. Das Beil erzeugte seine eigene Geschwindigkeit, schien Leben zu entwickeln, indem es den Tod brachte. Durstig schnitt es sich durch Schicksale. Der Körper des Verurteilten war wie ein Rittmeister, der ein schwer zu bändigendes Pferd bewegt.
Die Menschen flüchteten. Auch sie standen sich im Weg. Einige fielen und wurden übertrampelt. Andere bekamen im Pressen der Menge keine Luft mehr und verloren das Bewusstsein.
Welw Indencron starrte wie gebannt. Die Kurtisane Chaerea raffte ihre hochgeschlitzten Röcke und suchte das Weite. Ihre Blicke irrten wie punktförmige Hilferufe durch die Gegend.
Welw Indencron vergaß sie vollständig. Er hatte noch niemals zuvor Menschen, die nicht zum Tode verurteilt worden waren, sterben sehen. Menschen, die darauf gar nicht gefasst gewesen waren. Was für ein Versäumnis für einen, der die Menschen studierte, dachte er nun. Er wusste gar nicht, was ihn mehr interessierte: die am Boden sich Wälzenden, die jammernd ihr Leben aushauchten, oder der Barbar, der als Vollstrecker des Beilwillens noch mehr und immer noch mehr Schaden anrichtete.
Der Mann schien ein klares Ziel zu haben: den Kommandanten der Stadtbüttel. Auf diesen arbeitete er sich zu mit seinen seltsamen schleifenden Sprüngen, die ihn aussehen ließen, als führte er einen fremdartigen Volkstanz auf. Oben auf den Dächern klackten wieder die Armbrüste. Indencron, der selbst einmal versucht hatte, eine zu spannen, musste anerkennen, dass sie schnell waren, offensichtlich hervorragend ausgebildet in dem, was sie taten.
Der Verurteilte entging dem einen Bolzen, indem er einen Büttel griff und hinter sich zerrte, der dadurch noch im Schmerzensschreien stumm geschossen wurde. Der andere Bolzen traf den Verurteilten in das linke Schulterblatt. Drang ein. Blieb stecken. Der Verurteilte reagierte nicht darauf. Als wäre er bereits ein Leichnam, der sich vermehrte, indem er weitere Leichen zeugte.
Die Menge kämpfte miteinander, anstatt einträchtig weg von der Bühne zu fliehen. Es gab zu viele widersprüchliche Richtungen, zu viele Ziele. Einige wollten jemanden retten, andere nur sich selbst entfernen. Man kämpfte mit Zähnen und Klauen. Man erdrückte sich, beinahe wie aus Zuneigung. Und man kam kaum fort von der Todesbühne, als ginge von ihr ein Bannzauber aus.
Der Verurteilte trieb das Beil durch die Büttel wie eine Herde Tiere durch einen Ort. Er bahnte sich Wege, wo keine waren. Zu springen brauchte er nicht mehr, denn alles ballte sich am Rand um den Kommandanten.
Der Tod des Kommandanten war ein eigenartiger. Er schrie nicht vor Schmerz oder vor Wut, nein, er schimpfte mit seinen Untergebenen. Er suchte die Schuld nicht bei sich, sondern bei anderen, die ihn im Stich gelassen oder falsch gehandelt hatten. Und so starb er, indem er sich nichts eingestand, indem er bis zuletzt darauf beharrte, ein Einsamer im Recht zu sein, während sich in Wirklichkeit sein Innerstes mit dem der anderen zu einem ununterscheidbaren Gemenge vermischte.
Der Verurteilte war ein Gleichmachen.
Sie hatten ihn abfertigen wollen als einen, der keinen Platz unter ihnen hatte, und nun schuf er sich Platz und zeigte ihnen auf, dass keiner von ihnen ihm ebenbürtig war.
Die Armbrustschützen waren schnell. Indencron konnte den Impuls kaum unterdrücken, »Obacht!« zu rufen. Er identifizierte sich mit dem Einzelnen, der die Masse schlachtete. Vielleicht, weil er sich auch immer von den anderen unterschieden hatte, mit seinen Ansichten über den Irrweg der Zivilisationen. Aber er war immer schwächlich gewesen dabei, schwächlich und von Zweifeln zerfressen. Hier wurde ihm eine andere Vorgehensweise vor Augen geführt. Wenn es ums nackte Überleben ging, gab es keine Zweifel mehr.
Der Verurteilte entging den nächsten beiden Schüssen, indem er den Leichnam des Kommandanten als Schild benutzte, während er diesen untersuchte. Irgendetwas schien der Kommandant bei sich zu haben, das der … natürlich! Indencron fasste sich an den Kopf. Der Schlüssel für die Fußkette. Der Kommandant erzitterte unter dem Einschlag der beiden Bolzen. Der Verurteilte schleuderte den Toten von sich, ging in die Hocke und nestelte völlig ohne Deckung an seinen Füßen herum. Er musste schneller sein als das Nachladen der Schützen. Schneller als die Büttel, die ihn vielleicht erneut angreifen würden, dies aber nicht wagten. Die Büttel ergriffen jetzt die Flucht. Ihr Kommandant war gefallen. Und keinem von ihnen bezahlte die Stadt auch nur annähernd genug, dass er sein Leben für sie weggeworfen hätte.
Die Menge kreischte. Blut hatte sich seinen Weg bis zum vorderen Rand der Bühne gebahnt und begann nun auf den Marktplatz zu tropfen. Dies war eine Hinrichtung, die man so schnell nicht vergessen würde. Nicht eine Hinrichtung von vielen, sondern eine Hinrichtung vieler.
Die Kette klirrte zu Boden.
Der Verurteilte war jetzt vollkommen frei.
Er nahm das schwere Beil auf, rannte zum vorderen Bühnenrand und sprang mitten hinein in die Menge. Die beiden nächsten Bolzen surrten über ihn hinweg und knallten hinter ihm ins Holz der Bühne. Sein Sprung war zu schnell, zu wild gewesen.
Er landete auf den Köpfen und Schultern von Gaffern, die sich nicht anders zu helfen wussten, als ihn von sich zu drücken, hochzuheben, weiterzuschieben. Für ein paar Momente schwamm er über die Köpfe der schreienden Menschen wie durch einen haarigen See. Dann ließ man ihn fallen und stob auseinander. Er verschwand in der Menge. Die Schützen, schwitzend mit Nachladen beschäftigt, hatten kein Ziel mehr.
Von der Holztribüne aus betrachtet ähnelte die Menge vielfarbigen Ratten, in deren Mitte man ein Feuer geworfen hatte. In alle Richtungen hetzten und krochen sie. Viele blieben aber auch liegen, überrannt, zerpresst oder von Erschöpfung übermannt. Einige flüchteten sich zu Indencron die Tribüne hinauf und sahen dabei aus wie Schiffsbrüchige, die sich an einen sinkenden Bug klammern. Indencron versuchte den Delinquenten auszumachen, konnte ihn aber nirgends sehen. Er schaute zu den beiden Schützen hinauf. Die waren mit ihren mühseligen Waffen beschäftigt. So langsam schien das dauernde Nachspannen ihre Kräfte zu übersteigen.
Die Tribüne erbebte. Indencron schreckte zusammen.
Vor ihm, dann an ihm vorüber.
Der Verurteilte. Blutend aus seiner Schulterwunde. Dabei aber so schnell. Er rannte die Stufen der Tribüne hinauf und darüber hinaus, an Indencron vorbei, was vollkommen widersinnig war, denn hinter der Tribüne war nichts mehr. Sie stand mitten auf dem Marktplatz und führte als Treppe ins Nichts. Der Verurteilte war ihre linke Flanke hinaufgelaufen und ins Leere gesprungen. So dicht an Indencron vorüber, dass dieser ihn hatte riechen können. Der Mann roch nicht nach Schweiß, eher nach Kerker. Und nach dem Blut und Fleisch von Fremden.
Indencron musste sich drehen wie ein Korkenzieher, um die Flugbahn des Mannes verfolgen zu können. Er war schnell hochgerannt, hatte sich weit abgestoßen, flog nun hoch hinauf. Und erreichte die Dachkante, über der einer der beiden Schützen stand.
Der war noch nicht ganz mit Nachladen fertig und machte nun ein quiekendes Geräusch. Furcht. Nackte Furcht ließ ihn seine Handgriffe verfummeln. Aber der andere. Der andere war beinahe so weit und nahm Maß.
Der Delinquent zerrte sich selbst in die Höhe. Indencron konnte nicht erkennen, ob er dabei das Beil benutzte, indem er es irgendwo oberhalb einhieb und daran emporklomm. Aber es war möglich, dass er es so machte, denn sein Emporziehen sah hebeltechnisch außergewöhnlich mühelos aus, fast als würde er angehoben.
Beide Schützen standen nicht direkt auf Dachschräge und Schindeln, sondern auf vorgelagerten, balkonartigen Plattformen, die gerade genügend Platz boten für einen einzigen Menschen. Es gab keinerlei Geländer oder Brüstung dort oben, die Plattformen waren eigentlich nicht zum Betreten gedacht und vom Kommandanten lediglich wegen ihrer hervorragenden strategischen Lage als Schützenstandorte ausgewählt worden. Der Schütze wich nun instinktiv fiepend zurück, als sich der Mörder zu ihm auf die kleine Fläche zog. Aber er konnte nicht weg. Hinter ihm ragte die Dachschräge auf. Vom Dachbodenfensterchen aus führte die Strickleiter hinab, über die er auf die Plattform gelangt war. Aber der Mörder war schon da. Niemals würde er schnell genug die Strickleiter hochkommen.
Wäre er schon mit Nachladen fertig gewesen, hätte er nun aus nächster Nähe schießen können. Aber er war noch nicht fertig. Die Armbrust und der nächste Bolzen klapperten zu Boden. Der Mörder hob das Beil an.
Die Armbrust des entfernten Schützen klackte.
Der Mörder duckte sich weg. Der Bolzen drang dem waffenlosen Schützen in die Brust. Er zappelte kurz, kippte gegen die Dachschräge und rutschte daran hinunter, bis er getötet mit halb offenem Mund und halb geöffneten Augen auf der Plattform zu sitzen kam.
Der Schütze von gegenüber hatte seinen eigenen Kameraden erschossen.
Für einen Augenblick starrten die beiden sich über die Festmarktplatzschlucht hinweg an, der Delinquent mit ruhigen, der Armbrustschütze mit brennenden Augen.
Dann krümmte sich der Schütze, um sich voll und ganz dem Nachladen seiner Waffe widmen zu können.
»Jetzt habe ich dich, du Mistkerl«, stieß er zwischen seinen Zähnen hervor. »Selbst wenn du die Armbrust aufhebst und selbst zu spannen beginnst, bin ich vor dir fertig und habe den ersten Schuss, denn ich habe schon angefangen, und du zögerst immer noch, du dummer Barbar. Diesmal kann ich gar nicht danebenschießen. Ich kenne jetzt alle deine Bewegungen. Du kannst dich nicht wegducken, und du kannst auch nicht jedes Mal das Beil vor dich halten. Jetzt bist du fällig.«
Der Geflohene betrachtete die Schlucht. Sie war viel zu weit für einen Sprung.
»Jetzt erwische ich dich, ich mach dich fertig, ich nagele dich ans Dach, ich beende das alles hier, es ist egal, was du tust, selbst runterspringen bringt dir nichts, mein Bolzen ist immer noch schneller als du und holt dich ein. Ich hab dich schon einmal erwischt, in die Schulter, und jetzt gebe ich dir den Rest.« Der Monolog des Schützen steigerte sich mehr und mehr ins Besessene hinein. Möglicherweise war der andere Schütze, den er eben aus Versehen erschossen hatte, nicht nur sein Kamerad, sondern sogar sein bester Freund gewesen.
Der Geflohene musterte ihn und seinen Stand. Der Schütze war beinahe fertig mit Nachladen. Sein Gemurmel war nun unverständlich, aber er grinste in Erwartung eines großen persönlichen Triumphes.
Der Geflohene nahm das Henkersbeil in beide Hände, holte damit aus, drehte sich einmal um die eigene Achse, um genügend Schwung zu holen, und schleuderte das Beil über den Marktplatz in Richtung des zweiten Schützen.
Unter keinen Umständen war ein dermaßen großes Beil eine präzise Wurfwaffe. Der Schütze duckte sich zwar mit einem überraschten Ausdruck im Gesicht, doch das Beil ging selbstverständlich fehl, deutlich über den Schützen hinweg, der nun wieder zu grinsen begann. Mehrere Schritt über ihm krachte das massive Beil gegen die Dachschräge und schlug ein wie ein Katapultgeschütz. Ziegel barsten, brachen, wurden einwärts gedrückt. Ein Dachbalken splitterte. Etliche Ziegel begannen zu rutschen, lösten eine Lawine aus halbierten und zertrümmerten aus, die stetig breiter wurde. Mittendrin das Beil selbst, das – mit seiner Klinge abwärts schwingend wie ein Pendel – auf den Standvorsprung des Schützen zurutschte. Der Schütze beachtete das Getöse zu spät. Er hatte schon anlegen wollen, denn er war mit Nachladen fertig. Als er sich jetzt umwandte, erfasste ihn die Lawine aus Schutt und Henkerswerkzeug. Es gab auch auf dieser Plattform kein Geländer und keine Brüstung. Die Lawine spülte dem Schützen gegen Füße, Waden und Knie und riss ihn mit sich. Kreischend ließ er die Waffe fallen und versuchte sich ins Dach zu krallen, doch alles bewegte sich abwärts, auch er selbst. Sein Schrei in die Tiefe wurde vom Getöse der unten zerplatzenden Schindeln beinahe noch übertönt.
Nur unter Mühen riss Indencron den Blick von dem rechts abgestürzten Schützen und schaute wieder nach links oben, wo der erschossene Armbrustmann noch immer saß. Von dem Flüchtenden war nichts mehr zu sehen. War er so schnell die Strickleiter hinauf und durch das Fenster hindurch? Nein. Wahrscheinlich hatte er die Strickleiter nur benutzt, um außen am Dach hochzukommen, und sich nicht erst umständlich durch das schmale Fenster gequetscht, sondern war weiter hoch zum First und darüber hinweg. Er war nun auf der anderen Seite, dem Marktplatz abgewandt, unbewaffnet, angeschossen, aber frei.
Welw Indencron blieb einfach sitzen, bis nach und nach neue Schaulustige sich einfanden, um das Blutbad zu begutachten.
Überall lagen Leichen.
Die Musik des Festmarktes war vollständig zum Erliegen gekommen, und es wirkte, als würde sie so bald nicht wieder einsetzen.
Um den Tod zu begehen, waren die Menschen gekommen.
Sie hatten bekommen, was sie begehrten.
MiSSaCHTeN
Er konnte den Bolzen in seiner Schulter nicht erreichen.
Sosehr er sich auch krümmte und drehte, der Bolzen steckte im blinden Raum, im Unfassbaren fest und störte. Schmerzen strömten von ihm aus wie Klänge von einem durchdringenden Sänger.
Er befand sich auf einer Landstraße. Hinter ihm, wenn er sich umwandte, schwankte eine Stadt. Zur Stadt führte, kaum zu erkennen, eine Fährte blutiger Tropfen. Etwas rann ihm über den ganzen Rücken. Er lehnte sich gegen einen Baum, in dessen borkiger Rinde hundert Spinnen auf ihren Netzflächen lauerten.
Es wurde dunkel, und es wurde hell, und es war noch immer derselbe Tag.
Er beschloss zu rennen.
Vielleicht war der Schmerz langsamer als er.
So rannte er. Verließ den Weg, als voraus ein Wagen sichtbar wurde. Rannte querfeldein. Blumen knickend, durch Gräser schürfend wie durch grüne Brandung.
Keuchend ließ er sich nieder, auf Knie und Ellenbogen, das lange Haar im Gras. Ameisen wechselten von Halmen zu Haaren, krabbelten zu ihm empor. Er beobachtete.
Richtete sich auf. Die Sonne stach hinter Wolken hervor nach ihm. Ein goldener Speer hinter einem Schild. Er wehrte den Stoß ab. Sein linker Arm, in dessen Schulter etwas Schweres steckte, war langsamer als der rechte. Er musste sich das merken. Im Getümmel einer Schlacht konnte das von Bedeutung sein.
Es wurde dunkel, und es wurde hell, und es war noch immer derselbe Tag.
Er hatte sich etwas einprägen wollen, daran konnte er sich noch erinnern.
Aber was er sich hatte einprägen wollen, das hatte er ganz vergessen.
Die Wiese breitete die Arme aus. Ganz hinten, am Ende der Welt, kauerte ein Gehöft. Dort mochte es Schatten geben, einen Brunnen, Wasser.
Er rannte wieder ein paar Schritte, dann gaben seine Beine nach. Seine linke Wade war nass vom Blut. Je mehr er sich bewegte, desto mehr. Je weniger er sich wehrte, desto mehr.
Er wälzte sich auf den Rücken. Knurrend, mit gebleckten Zähnen.
Etwas hinderte ihn daran, auf dem Rücken zu liegen. Etwas stemmte ihn halbhoch, sodass seine Haare ihm ins Gesicht fielen. Etwas hämmerte an ihm. Ein unerbittlicher Schlag. Forschend im Gestein nach einer Ader, die noch etwas enthielt. Er schloss die Augen. Gegen das Sonnenlicht leuchteten seine Lider rot.
Er versuchte zu lachen oder zu schlafen. Alles war ihm gleich.
Etwas stupste gegen ihn. Eine weiche, feuchte Nase. Ein Rind. Mit einem Glöckchen um den Hals. Erst jetzt konnte er das Glöckchen hören. Auch das Rind hatte er nicht näher kommen gehört. Aber das Rupfen des Grasens konnte er ganz deutlich hören. Rupf-rupf-rupf. Rupf-rupf-rupf. Und dabei kaute es und schaute ihn nicht mehr an, mit langen Wimpern, schönen, ruhigen Augen.
Er stemmte sich hoch. An seinem Rücken hing ein Volk, das an ihm zog. Ein Volk aus Meißeln.
Das Rind flüchtete vor ihm, als er schwankend aufstand.
Es sah nicht aus, als wäre es zum Rennen geboren.
Er stand, umgeben von Grün. Der Wind ordnete die Gräser zu Wellen. Wolkenschatten wischten über ihn hinweg. Sie waren gigantisch. Die größten Gebilde, die er jemals gesehen hatte. Tausendfaltig standen sie am Himmel. Leuchtendes Weiß. Schwebende Massive.
Es wurde dunkel, und es wurde hell, und es war noch immer derselbe Tag.
Er setzte sich selbst in Bewegung, im Verhältnis zur übrigen Welt.
Schnürte durch höheres Gras, das Getreide war.
Er hatte Hunger. Im Kerker hatte es fast nie etwas zu essen gegeben, und wenn, dann nur einen stinkenden Schleim aus Bohnen und Reis. Er war in einem Kerker gewesen. Aber wo war der Kerker jetzt hin? Hatte sich verflüchtigt. Hatte vielleicht niemals wirklich existiert.
Er lachte, rannte wieder, weil er es anders nicht aushielt. Das Gehöft zappelte näher.
Es wurde dunkel, und es wurde hell, und es war noch immer derselbe Tag.
Das Getreide ließ sich nun nicht mehr hinhalten. Es kam hoch und fasste nach ihm und rang ihn zu Boden. Er wehrte sich, doch alle Waffen, die jemals in seinem Besitz gewesen waren, hatten sich ebenfalls verflüchtigt, hatten vielleicht niemals wirklich existiert.
Er öffnete den Mund. Schloss die Augen. Sein Bewusstsein hatte vielleicht niemals wirklich existiert.
Es dunkelte. Tiere näherten sich ihm, schnupperten. Feldhamster. Ein Hase, der in der Nähe sein Geschäft machte. Sehr viel später ein streunender Kater mit einem Fleck rechts der Nase. Der Kater tatzte sogar nach dem Liegenden, aber nur aus Neugier, weil hier sonst nie jemand lag.
Es wurde hell. Ein neuer Tag brach an. Menschen schwatzten auf dem Hof. Spannten einen Wagen an. Fuhren davon. Bemerkten den Liegenden nicht.
Er erwachte. Wälzte sich herum, bis er den Bolzen wieder spürte. Beinahe hätte er geschrien.
Setzte sich auf. Der Himmel war ganz anders, die Wolken kleiner, zerstoben, ihrer Macht beraubt.
Ihm war schlecht vor Hunger und Durst. Sein Kopf dröhnte vor Schmerzen. Sein linker Arm war taub, die Hand, die Finger. In der Schulter wütete ein Tier, das sich nach drinnen fraß, aber er konnte nichts erreichen, sosehr er auch die rechte Hand überstreckte.
Er erhob sich. Käfer und Grashüpfer stürzten von ihm. Nur ein paar Stechmücken hatten sich festgesaugt. Er schwitzte. Atmete rasselnd.
Er betrat das Gehöft. Fand einen Brunnen. Förderte Wasser und soff wie ein Pferd. Im Haus musste es etwas zu essen geben.
Er trat durch die Tür. Es war niemand zu sehen.
Er suchte nicht lange, sondern folgte einfach seiner Nase. Es gab eine Kammer, in der Würste lufttrockneten und Schinken. Er schlug seine Zähne in den Schinken, der sehr hart war. Dennoch gelang es ihm, faserige Brocken aus dem Fleisch zu reißen. Eine Kette weißschimmliger Würste hängte er sich um den Hals. Und stolperte wieder nach draußen. Innen war es viel zu dunkel gewesen, außen viel zu hell. Er wischte nach der pochenden Sonne, verfehlte sie, stürzte beinahe, fing sich aber.
Vom Gehöft führte ein Weg in den schattigen Wald. Gerne hätte er sich mit beiden Händen den Schinken vors Gesicht gehalten und einfach gefressen, aber die Linke rührte sich nicht mehr. Er musste mit rechts auskommen, was bewältigbar war, weil die Rechte ohnehin seine bessere Schwerthand war.
Der Wald machte sich um ihn herum breit. Viele Ameisen. Gezwitscher in den Bäumen. Nadeln rieselten, wenn ein Kletterhörnchen sprang. In seiner linken Seite baute ein Specht sein Nest. Der Schmerz ragte inzwischen bis hinab in die Kniekehle. Abermals versuchte er ihn zu packen und zu erwürgen, aber der Schmerz entkam ihm, obwohl er seinen Standort gar nicht zu verändern schien.
Er bleckte die Zähne.
Hier, im tiefen Wald, überkam ihn die Lust, ein Reh totzubeißen.
Aber die Tiere flohen ihn nun. Sein Blut wehte vor ihm her wie die Fahne eines Trunkenen.
Er wollte sich gegen einen Baum lehnen und traf nur den Raum zwischen zwei Bäumen. Schwer fiel er auf Wurzelwerk und Moos. Das Wurzelwerk ähnelte der Schrift, mit der man ihm schon oft vor der Nase herumgewedelt hatte. Die Stadtmenschen konnten in dieser Schrift Worte und Sprache finden wie in einem Versteck.
Es wurde dunkel, und es wurde hell, und es war noch immer derselbe Tag.
Es wurde dunkel, und es wurde hell, und es war noch immer derselbe Tag. Dieser Tag war dunkler im Wald als außerhalb, aber es war dennoch derselbe.
Er krallte sich ins Moos und stemmte sich daran hoch. Es war ihm, als würde er die Welt von sich wegschieben. Verächtlich.
Als er stand, schlug er sein Wasser ab, mitten auf dem Weg. Er bekam schon wieder Durst. Torkelte weiter. Es war nicht einfach, den Weg zu treffen. Seine Schritte wollten überallhin, sogar nach oben, zu den Schwarzdrosseln, manchmal.
Als er das nächste Mal stürzte, mochte es viele Stunden später sein, die Schatten wurden schon länger, und sein Sturz war ein langsames In-sich-Zusammenfalten. Es war, als würden seine Knochen sich verflüssigen und alles innerhalb seiner Haut nach unten rutschen. Er kämpfte beinahe eine Viertelstunde darum, sich aufrecht halten zu können, aber er verlor diesen Kampf. Die Handfläche, die er vor Augen hielt, war weiß wie städtisches Pergament. Er hatte Blut verloren und verloren und verloren. Der Weg hinter ihm war ein See, der vor ihm eine Wüste.
Seine Zähne klapperten. Er krümmte sich einwärts und erwartete die Nacht, aber die Sonne steckte wie festgenagelt im Himmel und leuchtete ihn aus, in zunehmend tiefer werdendem Rot.
Er konnte Beine sehen und zählen. Zwölf Beine von Wildschweinen. Sechs einer Ameise. Sechs einer Waldwespe, die zwischen den Haaren seines Armes balancierte. Vier eines Fuchses. Vier eines Dachses. Zwei einer alten Frau, die mit ihm redete. Die Frau verschwand und kehrte zurück. Dann schlug sie ihn, mit einem Stock oder einem Besen. Schimpfte mit ihm. Schlug erneut. Er verstand kein Wort. Er stieß ein tiefes Grollen aus, das sich zu einem Heulen steigerte.
Die Frau war fort.
Die Dunkelheit flutete um ihn herum, rauschend wie ein Meer. Mit der Dunkelheit kam auch die Furcht. Vor dem Unbekannten. Den Toten. Den Nachzerrern.
Er lag, und eine Starre überfiel ihn. Er kämpfte auch gegen sie und unterlag. Irgendetwas, irgendein Wesen, kam und schnupperte an dem Bolzen. Er lag gekrümmt auf der Seite und bot den Bolzen jedermann dar. Durch den Bolzen verströmte sich pochend sein Dasein in den Wald.
Er schlief. Irgendetwas rüttelte an dem Bolzen. Murmelte zahnlos. Es war die alte Frau. Sie führte kein Licht mit sich. Alles war Dunkelheit, nicht einmal Mond oder Sterne erreichten den Waldboden. Er trieb auf einem Floß aus Moos durch ein pechschwarzes Labyrinth.
Er schlief. In seinen Träumen lachte und weinte er. In einem Nirgendwo.
Etwas rüttelte an ihm. Etwas roch sehr fremd. Etwas zog an seinem Rücken, zog ihm die Wirbelsäule aus dem Leib, riss sämtliche Innereien und Eingeweide mit, ließ nur seine schlafende Hülle zurück. Etwas salbte ihn mit Gestank. Etwas rollte ihn auf den Rücken. Er konnte nun sehen, im Dunkeln sehen. Alle Dinge hatten graue Umrisse. Die Augen der Alten leuchteten hell wie kleine Sonnen. Auch aus ihrem Mund kam Licht.
Sie riss ihm seinen Lendenschurz weg, zerrte ihn frei.
Ächzend stieg sie auf ihn auf und ritt ihn. Ihr zahnloser Mund glänzte vor seinem Gesicht, das Licht der Milchstraße enthaltend, ihr langes graues Haar wischte über seine Stirn. Ihre Brüste hingen schlaff bis zu ihm herab.
Und dennoch fühlte es sich gut an, besser als alles andere davor. Er überließ sich.
Es wurde hell, und es wurde dunkel, und es war noch immer dieselbe Nacht.
Er mochte geschlafen haben.
Eine alte Stimme raunte in sein Ohr: »Du erkennst den Tod nicht an, mein hübscher Junge. Nur deshalb bist du noch am Leben.«
Dann war er allein und lachte und weinte. Niemand sah ihn, das war wichtig.
Am Morgen tropfte die Sonne wie Tau von sämtlichen Blättern. Vögel sangen, beäugten ihn, hofften auf etwas zu fressen.
Ihn dürstete.
Er legte den Unterarm über die Augen, um den Sonnentau abzumildern. Zu seiner Überraschung war es der linke Unterarm. Er konnte ihn wieder bewegen. Noch tat es weh, aber es war sehr viel besser als gestern.
Er rollte auf seinem Rücken hin und her und spürte dem Fremdkörper nach. Der Fremdkörper war weg. Womöglich zu Blut zerschmolzen.
Er war nackt. Sein Lendenschurz fort, die Würste und der Schinken ebenfalls.
Durst trieb ihn hoch.
Er fand Regenwasser in einem vom Blitz erschlagenen Baumstamm. Er schöpfte mit der Hand und trank, dann schleckte er das Wasser mit der Zunge wie ein Tier. Es schmeckte harzig, bereitete ihm Behagen.
Er blickte sich um. Moos wuchs auch an den Bäumen. Er konnte die Himmelsrichtung bestimmen daran, aber er hatte vergessen, woher er gekommen war oder wohin er hatte gehen wollen. Nur weg von hier, wahrscheinlich. Immer weiter. Das kam ihm vertraut vor.
Er setzte sich in Bewegung, versuchte wieder das Rennen, wechselte von Lichtern zu Schatten und weiter zum Licht. Es wurde hell und wurde dunkel, wurde hell und wieder dunkel, und der Tag blieb er selbst.
Dann fand er das Reh. Es war noch jung, hatte weiße Flecken.
Es zitterte vor ihm, die Flanken zuckten, es schaute ihn an mit feuchten Augen, geblähten, feuchten Nüstern.
Er ging auf es zu und berührte es an der Stirn und unterm Maul.
Bilder stürmten durch seinen Kopf, Bilder von Wut und Zerreißen.
Er kämpfte dagegen an, wollte weitergehen, einfach nur weitergehen, es dabei bewenden lassen, rennen und leben, aber er unterlag, wie meistens.
Das Blut war am mächtigsten, und er hatte viel zu viel davon verloren.
BeDRäNGeN
Sie kam zum Fluss, um sich zu waschen.
Zwischen ihren Beinen trug sie noch Spuren ihres Liebhabers, ihres guten Jungen, wie sie ihn nannte. Ihr Gang war federnd und beschwingt, ihre Haare an den Schläfen und im Nacken noch feucht, das Gesicht erhitzt und voller Lächeln. Es war sehr schön gewesen mit ihrem guten Jungen, wie immer, wenn er sich morgens vor der Arbeit fortstahl und sich eine Stunde oder eine halbe für sie Zeit nahm. Aber nun musste sie sich lossagen von seinen Spuren und den Gedanken an ihn, den Erinnerungen ihres Körpers an seine Berührungen, denn auch sie musste ins Dorf, um auf dem Markt ihre Waren feilzubieten. Die Leute sollten nicht merken, dass sie einen Liebhaber hatte. Solange sich die Männer des Dorfes allesamt bei ihr Chancen ausrechneten, kauften sie mehr bei ihr ein.
Zärtlich befühlte sie die Ohrringe, die ihr guter Junge ihr geschenkt hatte. Im Dorf würde sie die nicht tragen können, das würde zu viel über sie beide verraten. Aber hier draußen hinter den Feldern unter den Bäumen des Flusses genoss sie den Schmuck, das golden wirkende Metall, das sich in der Morgensonne erwärmte wie die Finger ihres guten Jungen. Sie schmückte sich gern für den Fluss. Der Fluss durfte wissen, dass sie glücklich war und vergeben.
Auf dem Wasser tanzte glitzernd das Licht. Libellen und Mücken schwirrten umher. Eine Kröte saß auf einem Stein und blinzelte in eine andere Richtung. Als das Mädchen sich dem Fluss näherte, hüpfte die Kröte dennoch vorsichtig ins Wasser.
Das Mädchen ging hinein, bis zu den Schenkeln, das einfache Kleid angehoben, damit es nicht nass wurde. Wo vorher Stoff ihre Blößen bedeckte, glitzerte nun Wasserschimmer. Sanft zog der Fluss an ihren Beinen, umspülte sie träge mit Kühlung und Drang. Sie knickte ein wenig die Knie ein und wusch sich gründlich. Das Wasser war sehr kalt an ihren empfindsamsten Stellen, aber sauber und klar. Die Spuren ihres Liebsten trieben im Fluss davon. Winzige Fische flitzten vorüber. Der Schatten eines Reihers fiel über sie. Der graue Vogel flog weiter, verschwand hinter Bäumen.
Ein schweres Rascheln ließ sie aufblicken.
Aus dem Wald des jenseitigen Ufers trat ein Mann. Er war vollkommen nackt und blutverschmiert. Seine Hände bis hinauf zu den Ellenbogen, sein Bauch, seine Oberschenkel und Knie – es sah aus, als wäre er mit bräunlicher Farbe besprenkelt worden. Aber es war keine Farbe. Es war trocknendes Blut. Das Mädchen hatte bei Schlachtungen ausgeholfen, und einmal auch bei einer Geburt. Sie war mit den Färbungen des Lebens vertraut.
Sie wollte sich wegducken, stand aber mitten im Fluss. Er musste sie sehen. Das allgegenwärtige Glitzern gab sie preis.
Er sah sie und machte keinerlei Anstalten, seine eigene Blöße zu bedecken. Seine Haut war dunkler als die der Dörfler oder der Städter. Seine Haare waren lang, verhüllten beinahe sein Gesicht. Er war hübsch, aber auf eine unangenehme, herablassende Weise. Sein Gesichtsausdruck sah aus, als würde er schmollen.
Er trat an seiner Uferseite bis an das Wasser. Hockte sich hin und wusch sich erst mal die Hände bis hinauf zu den Ellenbogen. Dann die Brust, die Achselhöhlen und den Bauch. Sie konnte sehen, dass ihre Anwesenheit Auswirkungen auf ihn hatte.
Ihr Atmen ging schneller. Rückwärts zog sie sich langsam aus dem Wasser zurück. Ihr Kleid, das sie vorher hochgehalten hatte, damit es nicht nass wurde, ließ sie nun sinken. Sie wollte nicht von ihm gesehen werden. Sie hatte bereits einen Liebhaber. Sie war glücklich und vergeben. Und ihr guter Junge war jetzt nicht mehr in der Nähe, sondern war auf seinem rötlichen Pferd ins Dorf geritten, um seinen eigenen Tag zu beginnen.