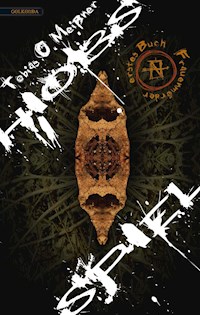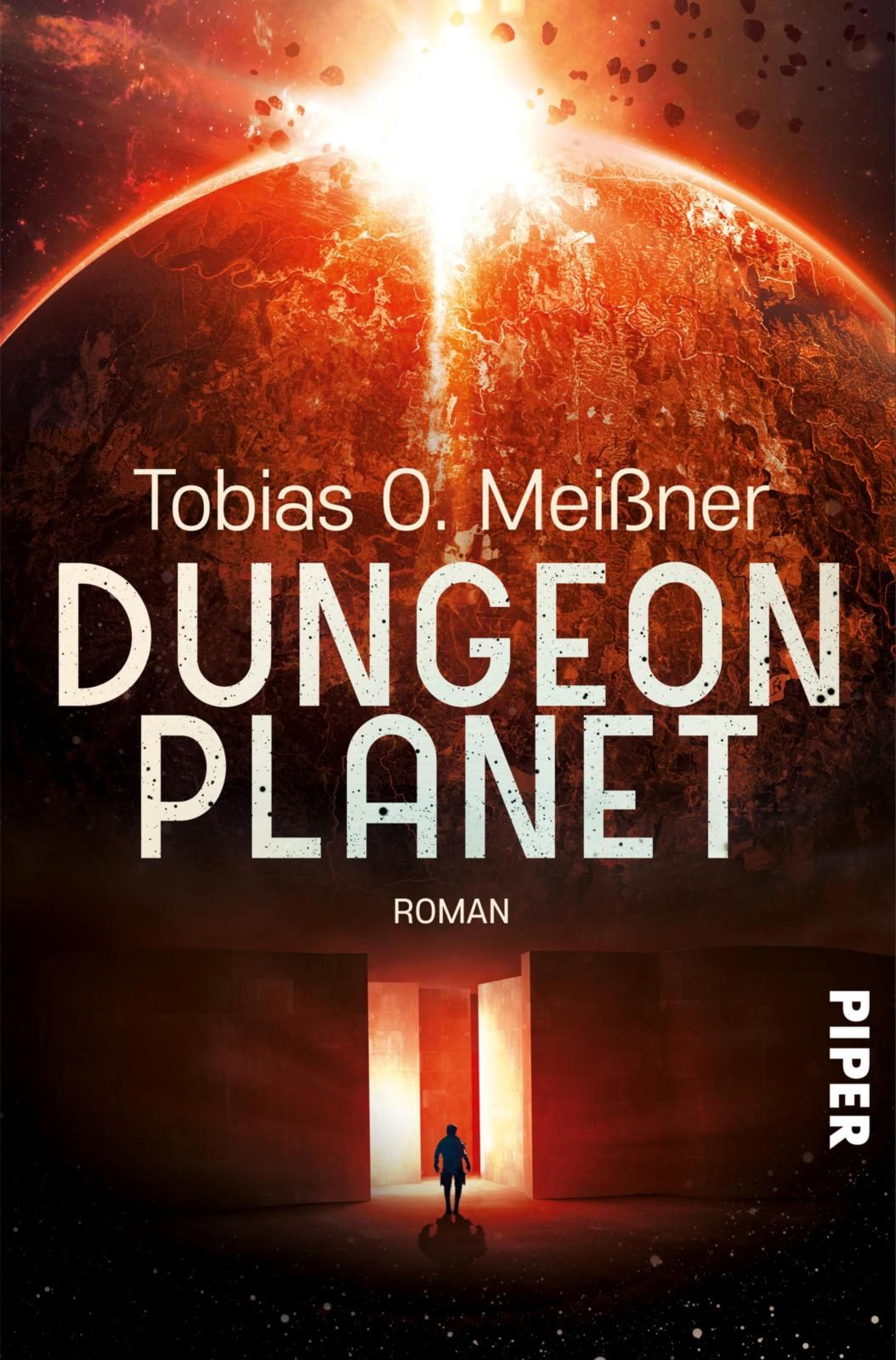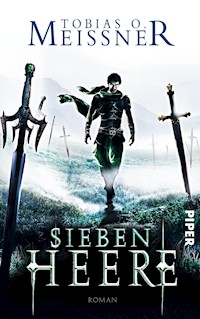9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Erenis ist eine Amazone, eine wunderschöne und mächtige Meisterschülerin der Kriegskunst. Getrieben von einer rastlosen Raserei, fordert sie die stärksten Männer heraus – doch kämpft sie nicht, um zu siegen, sondern um zu töten. Gnadenlos. Fanatisch. Ohne einen einzigen Fehler zu machen. Dann erfährt Erenis, dass die Feinde ihrer Kindheit noch immer am Leben sind, und zieht los, um sie endgültig im Kampf zu besiegen. Doch ahnt die Amazone nicht, welch monströse Gegner sie damit zum Duell fordern wird ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Entdecke die Welt der Piper Fantasy:
Dieses Buch ist gewidmet: Agnes de Chastillon, auch genannt die Schwarze Agnes, der Roten Sonya von Rogatino, Jirel of Joiry und Raven, der Schwertmeisterin
Mein Dank gebührt Guy de Maupassant,
dessen Novelle »Boule de suif« ich für meine Kutschensequenz angehalten und überfallen habe.
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
1. Auflage 2013
ISBN 978-3-492-96386-2
© Piper Verlag GmbH, München 2013 Umschlaggestaltung: Guter Punkt, München Umschlagabbildung: Anke Koopmann, Guter Punkt, unter Verwendung von Motiven von Shutterstock Datenkonvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
So schnaub ihm deines Mundes blutigen Atem nach! Mit deiner Eingeweide Gluthauch dörr ihn aus! Ihm nach denn! Jage, jage und vernichte ihn!
Aischylos: Die Eumeniden
Wie ein Schwarm goldener Schmetterlinge tanzte das Licht über dem Fluss, und in diesem Licht sah Stenrei sie zum ersten Mal.
Zu diesem Zeitpunkt wusste er noch nicht, dass sie die Klingentänzerin war.
Er beobachtete sie, wie jeder Junge von sechzehn Jahren eine schöne Frau beim Baden beobachtet hätte, vorausgesetzt, er hat sich noch nicht durch ein Geräusch verraten und kann sich eines ebenfalls unbemerkten Rückzugs einigermaßen sicher sein.
Es war nichts weiter als ein Zufall.
Stenrei hatte sich auf einem seiner Streifzüge befunden. Die Waldstämme rührten sich wieder, raunten die Alten. Die Grünen Leute rüsteten zum Aufstand. Bewegten die Bäume. Schlugen aus. Röteten zum Herbst. Und die Niederstädte entsandten Truppen, um das Dickicht zu beruhigen. Stenrei träumte davon, einer solchen Truppe zu begegnen, sich nützlich machen zu können, vielleicht als ortskundiger Führer, vielleicht aber auch nur als Schildknappe oder Geschirrträger, ganz egal. Nur weg von hier, weg von Bosel, der Eintönigkeit, den ewig gleichen Gassen, weg von den Eltern und den anderen, die so gar nichts an sich hatten, was für ihn anziehend war.
Niemand in Bosel hatte Vorstellungen. Vorstellungen von der Welt jenseits der Wälder.
Es gab ein Sprichwort hier: »Hau den Baum und schaff ihn heim.« Das hieß: Nimm dir vor, was bewältigbar ist, sichere es und schere dich nicht um alles Weitere. Stenrei hasste diese Denkweise. Sie war wie die Arbeit seines Vaters, sie fügte Steine aufeinander, um kleine, kompakte Häuser daraus zu schaffen. Und in diese Häuser zogen dann kleine Familien und lebten winzige Leben. Aber die Welt war doch so riesig und bot so viele Wunder! Und jeder, der jemals durch Bosel gekommen war, um irgendwo anders hinzugehen, hatte in den Schenken davon Kunde gebracht. Von den Offenen Ländern. Den Wandernden Feuern. Den Bergen. Den Meeren. Der Hochstadt. Den Drachen und dickhäutigen Elfentieren.
Stenrei war ein Träumer. Aber keiner, der seine Nase in Bücher steckte. Sondern eher ein Abenteurer, dem man bislang noch nicht gestattet hatte, eine Waffe zu tragen. Gerne rannte er ungestüm und einsam durch den Wald, wenn seine Arbeit mit seinem Vater, dem Steinsetzer, es ermöglichte. Manchmal pirschte er auch. Mit sechzehn durfte er noch keinen Bogen tragen und kein Wild jagen. Dieses Dekret war erst einige Jahrzehnte alt und diente vor allem dem Schutz der Waldleute, auf die übereifrige Jugendliche aus den Steindörfern sonst Jagden veranstalten mochten. Aber dieses Dekret beraubte ihn aller Möglichkeiten. Er konnte sich nicht schulen. Nicht erwachsen werden vor der Zeit. Aber er konnte immerhin die Wälder durchstreifen und sie mehr und mehr kennenlernen. Das unendlich erscheinende, lichtdurchwölkte Immergrün mit seinen Hügeln und Grasflecken, mit den falkenköpfigen Götzen der Grünmenschen und den eigentümlichen Tieren, die dort hausten.
Heute hatte er gepirscht, war der Fährte einer Stachelbache gefolgt, bis hin zum Fluss.
Die Bache war schon lange nicht mehr dort gewesen. Hatte nur getrunken und dann weiter. Aber die Frau, die sich wusch, die war dort.
Das Licht tanzte auf der Strömung, als würden tausend Flämmchen züngeln.
Die Frau war ganz in Leder gekleidet, sehr enges Glattleder die Hose und sehr dünnes Wildleder das Hemd. Sie hatte die Hose nicht ausgezogen im Fluss, bei diesem Material war es gleichgültig, ob es nass wurde oder nicht, aber sie hatte sie sich heruntergestreift.
Nun sah er ihren Hintern, als sie sich dort und zwischen den Beinen wusch, und er sah von seinem Standpunkt aus immerhin zwei Drittel ihrer Brüste, als sie sich auch unter diesen mit frischem Wasser benetzte.
Es war aufregend. Zu aufregend, als dass er auch nur auf den Gedanken hätte kommen können, sich selbst beim Beobachten zu berühren. Er war viel zu sehr in Anspruch genommen vom Schauen. Sämtliche weiteren gleichzeitigen Tätigkeiten hätten ihn überfordert.
Mit offen stehendem Mund beobachtete er, wie die Frau im Fluss sich die Achseln und die Schenkel wusch, dann das Gesicht. Dann zog sie sich die Hose wieder hoch, was nicht einfach zu sein schien, weil sie sehr eng war. Unter der Hose zeichnete sich das prächtige Gesäß fast noch deutlicher, noch praller ab als vorher, als die Frau untenherum nackt gewesen war.
Dann knöpfte sie sich auch ihr Hemd wieder zu. Was schade war, denn Stenrei hätte sie gerne von vorne gesehen.
Sein Blick fiel auf das Schwert, das am Ufer neben ihrem Rucksack lag. So eines hatte er noch nie gesehen. Es hatte rote Muster in der Klinge, wie eine Schrift aus Blut, und es sah schwer aus. Er fragte sich, wie es wohl in seiner Hand liegen würde, aber er war kein Dieb, und wenn er sie fragte, ob er es einmal halten dürfe, würde sie ihn wahrscheinlich für ein Kind halten und auslachen.
Als er wieder zurückschaute zu der Frau, sah sie genau in seine Richtung.
Er erschrak bis ins Mark.
Er war aber doch gut genug verborgen, oder? Mehrere Schichten Blattwerk deckten ihn. Er konnte hindurch spähen, aber sie doch wohl nicht zurück? Und ein Geräusch hatte er doch ebenfalls nicht gemacht, da war er sich sicher.
Er schluckte. Zum ersten Mal sah er das Gesicht der Frau. Und obwohl er fürchten musste, von ihr entdeckt worden zu sein, war er fasziniert von ihren Zügen. Ihr Kinn war energisch, ihre Nase gerade, die Augen klar, von heller Farbe, blau oder grün, vielleicht eine Mischung aus beidem. Ihr dunkelblondes Haar mochte sehr lang sein, aber sie trug es zusammengebunden zu einer Ansammlung von Knoten. Besonders ihre Brauen gefielen ihm. Sie waren sanft geschwungen, sodass ihr Gesicht fast ein wenig hochmütig wirkte, aber sie waren schmal und nicht im Mindesten in der Mitte zusammengewachsen wie bei so manchen Mädchen aus dem Dorf.
Diese Brauen waren nicht gerunzelt. Also argwöhnte sie wohl nichts.
Tatsächlich blickte sie nicht lange in seine Richtung. Vielleicht hatte sie etwas gehört, einen auffliegenden Ufervogel womöglich, in seiner Nähe. Ein dummer Zufall. Nichts weiter.
Er entspannte sich, als sie das Lederhemd fertig zugeknöpft hatte, das von ihren Brüsten glänzend gespannt wurde, und zum Ufer watete, wo ihre Ausrüstung lag. Sie nahm ihren Rucksack und warf ihn sich über. Das Schwert schob sie sich ebenfalls auf den Rücken, der Rucksack schien eigens dafür vorgesehene Schlaufen zu besitzen. Auf so etwas wie eine Schwertscheide schien sie zu verzichten, sie trug den Stahl offen.
Dann tauchte sie ins Unterholz ein und war weg. Er hörte sie nur noch kurze Zeit, dann waren auch ihre Geräusche im Unterholz verschwunden.
Stenrei überlegte, ob er ihr folgen sollte.
Sie war außergewöhnlich schön. Sicherlich nicht aus diesem Land, ihr Gesicht wies eine nordische Fremdartigkeit auf, die ihn sehr ansprach. Sie war vielleicht fünfundzwanzig Jahre alt. Damit natürlich deutlich älter als er selbst, also etwa im Alter der Frau, die ihn immer noch ab und zu im Lesen und Schreiben unterrichtete. Aber sie gefiel ihm. Gefiel ihm viel besser als die Mädchen im Dorf. Diese Brauen. Das freche, offene Schwert. Ihr Blick. Wie sie sich bewegt hatte, sehr sicher und geschmeidig. Auch ihre Kleidung. Die Hose, die so tief auf den Hüften saß, dass man beinahe schon die Einkerbung des Hinterns sehen konnte. Allein dieser Hose zu folgen mochte schon mancherlei Mühsal wert sein.
Stenrei war begeistert von dieser Frau. Und spürte schon jetzt, nachdem er sie gerade erst ein paar Augenblicke lang hatte beobachten können, so etwas wie das ziehende Sehnen eines Verlusts in sich.
Er wollte ihr folgen. Sein Pirschen an ihr erproben. Es war ihm natürlich klar, dass das nicht ohne Gefahr sein würde. Sie war offensichtlich eine Schwertkriegerin. Das Schwert zeigte seine blutrote Schrift jedem, der solcherart zu lesen verstand. Sicherlich war die Trägerin einer solch beeindruckenden Waffe nicht gut zu sprechen auf Jungs, die ihr durchs Unterholz nachschlichen.
Er dachte hin und her, vor und zurück.
Aber wollte ihr folgen.
Er schlug ihre Richtung ein, weg vom Flimmern und Funkeln des Wassers, hinein in das tiefere Grün.
Und fand ihre Fährte nicht. Sie hatte keine hinterlassen. Sie war umsichtiger als eine Stachelbache, natürlich.
Er seufzte. Kratzte sich am bartlosen Kinn. Kratzte sich mit dem Daumen am Rücken.
Er wollte noch etwas umherstreifen. Vielleicht begegnete er ihr ja wieder. Wo ein Zufall war, mochten auch mehrere möglich sein. Sie konnte ja wohl kaum schlecht zu sprechen sein auf Jungs, die einfach nur im Wald umherstreiften. Zumal er von hier war und ein Anrecht darauf hatte, in dieser Gegend herumzuschlendern, während sie fremd war, fremd sein musste, denn er hatte noch nie von ihr gehört, sie nie zuvor gesehen.
Er konnte nicht wissen, dass sie die Klingentänzerin war, denn niemand hatte ihm je von ihr erzählt.
So wandelte er herum. In der ungefähren Richtung, in der sie verschwunden sein musste. Er war leiser noch als sonst dabei. Denn sie war doch sicherlich nicht auf Dauer lautlos. Vielleicht, wenn er Glück hatte, konnte er sie erlauschen, ein Rascheln vernehmen, ein Streifen von Zweigen über ihre Lederbeine, und sich dann wieder tarnen als einer, der ein Ziel hatte, der jemandem folgte.
Er wandelte herum, bis ihm plötzlich beide Beine weggehebelt wurden. Von einem anderen Bein. In Leder. Er schlug hin, die Welt plötzlich ein grüner Wasserfall. Rollte sich herum. Ächzte. Etwas rauschte. Das Schwert. Mit den roten Mustern in der Klinge, wie eine Schrift aus Blut. Mit der Spitze an seiner Kehle. Der Wasserfall kam zum Erliegen. Alles Grün erstarrte.
»Schleichst du mir nach?«, fragte die Frau. Sie sah nicht wütend oder aufgebracht aus, aber ihre Stimme brannte wie Eis.
»Nein, ich bin oft hier, oft im Wald …«
»Du hast mich beobachtet, im Fluss.«
»Bestimmt nicht! Bestimmt nicht!«
»Was hast du gesehen?«
»Nichts!« Das Schwert wurde schwerer auf seinem Kehlkopf. Er beschloss plötzlich, einfach nur die Wahrheit zu sagen, sich nicht zu verstricken. Wahrheit schien ihm das Einzige zu sein, was das Gewicht des Schwertes zumindest zu vermindern imstande war. »Von hinten, nur von hinten, im Fluss. Aber es war nichts als Zufall. Ich bin Euch nicht zum Fluss gefolgt. Ich war einem Wild auf der Spur, einem Schwein.«
»Wie passend. Einem Schwein. Doch wozu? Du hast ja nicht mal einen Bogen.«
»Zum Spaß. Zum Zeitvertreib. Ich mache das … oft. Zur Übung!«
Sie betrachtete ihn, wog ab. »Du hast Glück, Junge. Dass du kein Mann bist. Denn wärst du ein Mann, würde ich dich jetzt töten.« Sie nahm das Schwert von ihm und steckte es wieder weg. Von Nahem sah sie noch hübscher aus als vorhin am Fluss. Aber dennoch regte sich in ihm auch ein wenig Zorn.
»Warum töten?«, fragte er, während er vorsichtig aufstand. »Ich habe Euch nichts zuleide getan. Es gibt keinen Grund, mich dafür zu töten, dass ich Euch zufällig im Fluss sah.«
»Männer sind schon für weniger gestorben. Sag, gibt es in der Nähe hier ein Dorf?«
»Ja, gibt es. Bosel. Ich stamme von dort.«
»Führst du mich hin?«
»Was bekomme ich denn dafür?« Er wusste selbst nicht, woher er den Mut nahm, so dreist zu antworten. Etwas in ihrem Gesicht vielleicht. Sie war keine Räuberin. Sie war nicht freundlich, aber auch nicht feindselig. Man konnte mit ihr reden, also auch mit ihr verhandeln.
»Nichts«, sagte sie, lächelte beinahe, und ging an ihm vorbei. Es war die falsche Richtung, sie führte nicht nach Bosel. Sie ließ ihn einfach stehen.
Aber er wollte nicht, dass sie ging. Sie hatten nun ein Gespräch begonnen, das er gerne fortgesetzt hätte. Das war nämlich viel, viel besser, als ihr umständlich nachpirschen zu müssen.
»Wartet!«, rief er und wetzte an ihr vorüber, bis er wieder vor ihr war. »Wenn Ihr wirklich nach Bosel wollt, geht Ihr jetzt falsch. Aber in Bosel gibt es nichts. Nichts zu holen.«
»Wieso zu holen? Hältst du mich für eine Diebin?«
»Nein. Aber für eine Abenteurerin, vielleicht. Die ihr Schwert vermietet, gegen klingende Münze. In Bosel gibt es niemanden, der eine Kriegerin anheuern würde. Das sind alles ganz langweilige Leute dort.«
»Langweilig?«
»Ja.«
»Du langweilst dich dort?«
»Jeden Tag.«
»Dann führ mich hin. Ich gebe dir etwas zu sehen, von dem man in deinem Bosel noch lange sprechen wird. Noch sehr lange.«
Er nickte begierig.
Und führte sie durch den Wald.
Das Gezwitscher winziger Vögel begleitete sie. Die Sonne stach flimmernde Säulen durchs Blattwerk. Am Himmel bildeten sich Wolken, die nicht lange Bestand hatten. Es sah noch immer nicht nach Regen aus.
Die Frau mit dem Schwert sprach nicht. Er versuchte, ihr etwas zu erzählen, über bestimmte Bäume, die Namen hatten, über einen alten Steinkreis der Waldleute, über eine Stelle, an der es im Herbst Pilze gab, die nirgendwo sonst wuchsen. Einmal, sagte er, habe er ein Fabelwesen gesehen im tiefsten Tann. Ein wildes, zotteliges Pferd mit einem Hirschgeweih. Sie sagte nichts zu dem, was er erzählte. Fragte nicht einmal nach seinem Namen.
»Mein Name ist Stenrei«, versuchte er es deshalb. »Aber im Dorf nennen mich alle Sten.«
Auch das brachte nichts. Sie sagte ihm ihren Namen nicht.
Also redete er weiter über Mooskäfer und Windbruch, über die höchste Fichte weit und breit, an der sie gerade vorüberkamen, und über die Nester von Stibitzvögeln, in denen man manchmal Muschelschalen von weit entfernten Stränden finden konnte, von Stränden, die er noch nie gesehen hatte. Er fragte sie, ob sie das Meer kannte, und sie antwortete nicht, als wäre sie taub geworden.
Er plauderte ziemlich viel, bis sie den Wald verließen und ein moderiger Wegweiser Bosel zwei Meilen anzeigte.
»Von hier ab brauche ich dich nicht mehr«, sagte die Frau und klang beinahe freundlich dabei.
»Aber wir haben denselben Weg!«
»Willst du nicht noch im Wald herumtollen und Fabelwesen verfolgen und Muscheln suchen?«
»Nein. Jetzt will ich das Erzählenswerte sehen, das sich Euretwegen in Bosel ereignen wird.«
»Und wenn es mit Blut zu tun hat?«
»Mit Blut? Mit wessen Blut?«
»Das weiß ich noch nicht.«
»Na, dann erst recht!«
»Hast du denn schon mal einen Toten gesehen?«
»Aber klar. Meinen Großvater, als er gestorben war.«
»Hat dir das Angst gemacht?«
»Nein. Als er lebte, hatte ich mehr Angst vor ihm.«
Jetzt lächelte sie tatsächlich, und er fühlte sich, als hätte er ihr Herz erobert.
Der Weg nach Bosel war raurissig von der langen Trockenheit, karg und ereignislos.
Stenrei erzählte von einem Vorstoß der Waldleute, vor seiner Zeit, als sein Vater noch jung gewesen war. »Bis hierhin sind sie aus dem Wald gekommen«, berichtete er eifrig. »Und dort und dort haben die versammelten Steindörfer sie zurückgeschlagen.« Er deutete auf einzelne Baumbestände, die vor einer Generation vielleicht einmal als Deckung hergehalten haben mochten. Die Frau mit dem Schwert auf dem Rücken schien sich nicht zu interessieren für das, was er zu erzählen hatte.
Also schwieg auch er. Er sah ein, dass ihn dies vielleicht erwachsener wirken ließ. Außerdem war es womöglich tatsächlich albern, sich mit den Heldentaten der Vorväter zu schmücken, wenn man selbst noch nichts vorzuweisen hatte.
Schweigen.
Schweigen war gar nicht einfach, wenn man nicht alleine war. Die Stille zwischen ihm und ihr schien unleidliche Ärmchen auszubilden und an ihm zu zerren. Die Stille war Feindseligkeit sehr ähnlich, und er wollte keine Feindseligkeit mit dieser wirklich schönen Frau.
Bosel kam nur quälend langsam näher, die niedrige, unspektakuläre Silhouette mit den Schornsteinen und den wie geduckt wirkenden Häuschen. Stenrei lag auf der Zunge zu sagen: »Viele dieser Häuser hat mein Vater gebaut oder zumindest ausgebessert, und ich bin ihm dabei zur Hand gegangen«, aber nichts hätte ihn uninteressanter wirken lassen als dies. Er dachte nach über das wenige, das er und die Frau bislang gesprochen hatten, und der Gedanke an Blut und Tod sickerte in ihn ein und führte dazu, dass ihm zusehends mulmiger wurde. Hätte er mehr empfunden für sein Dorf, hätte er sich vielleicht gefragt, wen genau er hier mitbrachte. Aber dann wiederum: Spätestens seit dem Wegweiser hätte sie Bosel auch ohne ihn gefunden.
Als sie gemeinsam in die Hauptstraße hineingingen, an der die Läden standen und die beiden Schenken, Das Zugpferd und Zum alten Hobel, staunten die Leute nicht schlecht. Stenrei kannte jedes einzelne Gesicht, die Alten mit ihren mümmelnden, oft Tabak kauenden Kiefern, die Eltern mit ihren rau gearbeiteten Händen und den müden Augen, die Gleichaltrigen, die sich entweder herumtrieben oder sich nützlich zu machen versuchten, oder die Kinder, die bereits gelernt hatten, nach Münzen zu springen, die aus den Taschen von Reisenden fielen – aber keines dieser Gesichter hatte ihn jemals in Begleitung einer großen, bewaffneten Frau gesehen. Die Menschen raunten und zischelten. Einer spuckte Tabak aus. Mehrere legten ihre Werkzeuge weg und starrten.
Die Frau mit dem Schwert stellte sich mitten auf dem Hauptplatz auf. Hier war zweimal in der Woche Markt, drei Buden zwar nur, aber immerhin drei Buden von reisenden Händlern, die Waren feilboten, die nicht von hier waren und einen Hauch Besonderheit versprühten. Mindestens zwei Dutzend Schaulustige drückten sich inzwischen schon im Gesichtsfeld der Schwertfrau herum, Neugier, aber auch Misstrauen in den Gesichtern. Sie alle sahen ein wenig so aus, als würden sie gegen die Sonne blinzeln – selbst wenn sie die Sonne im Rücken hatten.
Die Frau nahm das Schwert aus den Schlaufen, steckte es vor sich in den hartgetretenen Boden, nahm den Rucksack ab, entnahm diesem ein Säckel voller Münzen, lehnte den Rucksack gegen das Schwert und knautschte das Münzsäckel klirrend in der linken Hand.
Stenrei stand unterdessen in ihrer Nähe und versuchte mit lungernden Schultern, die Daumen in den Gurt gehakt, so gefährlich und eingeweiht wie möglich dreinzuschauen.
Als die Schwertfrau ihn unvermittelt ansprach, zuckte er dennoch zusammen. »Wie heißt dieses Kaff noch mal? Bosen?«
»Bosel! Bosel«, antwortete er hastig und raunend wie ein Bühnenvershelfer.
Mit deutlich lauterer Stimme sagte sie: »Menschen von Bosel, hört mich an! Mein Name ist Erenis. Ich bin eine Schülerin des Schwertes, und ich folge dem verschlungenen roten Band des fernen Blutes. In meiner Hand halte ich einhundert Münzen frischer Prägung. Sie mögen dem stärksten Mann dieses Dorfes gehören, wenn es ihm gelingt, mich im Kampf zu bezwingen. Aber derjenige muss sich schnell entscheiden, denn ich werde nur zwei Stunden warten.«
»Was für ein Kampf?«, fragte einer, der etwa in Stenreis Alter war. »Mit Schwertern?«
»Mit was immer meinem Gegner beliebt. Aber ich werde dieses Schwert benutzen.«
»Und was heißt bezwingen, Mädchen?«, fragte ein breitschultriger Lockenkopf mit den Zügen eines bulligen Hundes. Stenrei kannte ihn besonders gut. Er hieß Kaskir und hatte schon immer gerne andere, Schwächere, herumgeschubst. Auch Stenrei. Stenrei konnte Kaskir nicht ausstehen. Außer zwei oder drei Speichelleckern konnte wahrscheinlich niemand in Bosel Kaskir ausstehen, womöglich nicht einmal Kaskirs Eltern. Aber mit ziemlicher Sicherheit war Kaskir jener »stärkste Mann im Dorf«, von dem die Frau – Erenis hieß sie also! – gesprochen hatte. Außer ihm kam höchstens noch Llender Dinklepp infrage, der sich früher eine Zeit lang als Söldner verdingt hatte, aber der litt schon seit einiger Zeit an Keuchatem und war für einen Kampf wohl nicht mehr gesund genug. Ausgerechnet Kaskir also konnte reich werden, indem er die schöne Frau besiegte. Einhundert Münzen! »Bis du weinst?«
Die Frau schaute Kaskir genau an und lächelte wieder beinahe. »Bis ich tot bin. Vorher hat man mich nicht bezwungen.«
»Aber das wäre doch schade. Ein leckerer Happen wie du. Lass uns einen Armdrückwettstreit draus machen, dann bin ich sofort dein Mann!« Mehrere Umstehende lachten. Es wurden immer mehr. Drei Dutzend jetzt schon. Kaskir sonnte sich in deren Aufmerksamkeit.
»Ich bin keine Schülerin des Armdrückens, sondern des Schwertes. Hundert Münzen sind mehr, als jeder von euch in seinem Leben auf einem Haufen sehen wird. Erkauft es euch mit Blut und mit Mumm, und nicht mit Gewinsel und Feilschen.«
Die Leute brummten. Murrten. Ein Mädchen mit zusammengewachsenen Augenbrauen sagte: »Erschlag sie doch einfach, Kaskir, nimm dir ihre Münzen und spendier uns allen ’ne Runde im Zugpferd!«
»Und was ist mit deinem Schwert?«, erkundigte Kaskir sich weiter. »Wenn du tot bist, brauchst du es ja wohl nicht mehr.« Wieder lachten einige. In ihrer Ratlosigkeit ordneten sie sich dem offenkundig Beherztesten bereitwillig unter.
»Ich sagte, du sollst aufhören zu feilschen. Willst du die Münzen oder das Schwert oder mich, dann komm her und nimm dir, wonach es dich verlangt. Aber hör auf zu quatschen wie einer, der die Bezeichnung Mann nicht verdient.«
Brummen. Murren. Zischen. »Willst du mich beleidigen?«, fragte Kaskir.
»Ich will dich niederwerfen«, antwortete Erenis, »und ich tue, was dazu nötig ist.«
Mehrere spuckten jetzt aus. Die Zuschauer, die nun schon fast vier Dutzend waren, wirkten, als rotteten sie sich zusammen, um gemeinsam gegen die unverschämte Fremde vorzugehen. Stenrei fühlte sich jetzt langsam ein wenig unwohl in seiner Position zwischen den Dörflern und Erenis. Fast wünschte er sich, dass niemand ihn beachtete, aber dieser Wunsch ging nicht in Erfüllung.
»Was hast du mit ihr zu schaffen, Sten?«, fragte eine Alte.
»Ich? Ich habe sie zufällig im Wald getroffen. Nichts weiter.«
»Hol du dir doch die Münzen.« Gelächter.
»Ich?«, fragte Stenrei erneut zurück. »Nein, kein Bedarf. Außerdem kann ich mit Waffen nicht umgehen. Ich darf ja nicht. Kaskir aber schon! Kaskir ist alt genug.«
Damit schob er dem drei Jahre älteren Lockenkopf wieder die Karten hin, der tatsächlich – das wussten alle hier, denn er ließ kaum eine Gelegenheit aus, es ihnen zu zeigen – stolzer Besitzer eines Breitschwerts war.
Kaskir leckte sich inzwischen die Lippen. Es war ihm deutlich anzusehen, wie sehr es in ihm arbeitete. Er war bedeutend breiter und schwerer als die Frau, mit Sicherheit also auch viel kräftiger. Er schaute sich um, ob jemand ihm den Ruf als Stärkster von Bosel streitig machen wollte.
»Ich könnt’s ja machen«, tönte er. »Aber es kommt mir ungerecht vor. Ich kann doch nicht einfach so ein Mädchen umlegen, das mir nicht allzu viel getan hat. Vielleicht solltest du besser gegen ein Mädchen kämpfen, Mädchen. So richtig mit Haareziehen und Augenkratzen und so.« Lang anhaltendes Gelächter brandete auf.
Erenis wartete, bis die Heiterkeit sich wieder gelegt hatte. Weiterhin hingen Blicke an ihrem Münzsäckchen, ihrer Klinge und auch an ihrem ledernen Hintern. Sie kannte das. Die Männer kamen nie über ihren Hintern hinweg, die Weiber nie über die Münzen. »Zwei Stunden nur. Zwei Stunden, um zu prahlen, zu lästern und sich wichtig zu machen. Dann ziehe ich weiter. Mitmeinen Münzen und mit der in alle umliegenden Dörfer getragenen Botschaft, dass in Bosel niemand Manns genug war, es mit mir aufzunehmen.«
Murren. Wütendes Flüstern.
»Schnapp sie dir, Kaskir«, keifte das Mädchen von vorhin. »Du kannst noch vorm Mittagessen mit ihr fertig sein. Und dann lad uns ein.« Sie schien Hunger und Durst zu haben.
»’s wär aber wirklich schade drum«, sagte Kaskir und grinste lüstern. »’s wär wirklich, wirklich schade.«
Erenis antwortete jetzt nicht mehr. Sie setzte sich im Schneidersitz neben ihren am Schwert lehnenden Rucksack und schloss die Augen, als wolle sie ein Nickerchen machen. Mitten auf dem Hauptplatz. Am helllichten Tag.
Das Gemurre und Geknurre um sie herum klang wie von aufgebrachten Hunden. Die Leute redeten sich die Köpfe hitzig. Stenrei nutzte die Gelegenheit, ein wenig von Erenis abzurücken. Sie schien ihn ohnehin vergessen zu haben. Die Leute jedoch, denen er sich näherte, damit sie ihn durchließen, starrten ihn feindselig an, als wäre er mit der Versucherin im Bunde. Denn genau dies war der Begriff, den die Frauen tuschelten: Versucherin. Und die Männer raunten, eher anerkennend: Dreistes Stück.
Schließlich meldete sich eine fettleibige Bauersfrau zu Wort: »Fall nicht auf sie rein, Kaskir. Sie hat letzte Woche in Tyrgen einen Mann umgelegt, den starken Haddut. Der Händler Milco hat mir davon erzählt.«
»Hat sie beim Kampf betrogen?«
»Nein, es ging wohl alles mit rechten Dingen zu, deshalb hat man sie auch ziehen lassen. Aber sie hat Haddut wirklich erschlagen. Wenn du dich drauf einlässt, wird sie dich töten.«
»Das muss sie erst mal fertigbringen«, warf Kaskir sich in die Brust.
»Das wird sie. Du hast sie doch selbst gehört. Sie ist eine Schwertschülerin und folgt einer blutroten Fahne. Sieh dir doch ihr Schwert an, wenn du mir nicht glaubst. Dort stehen die Namen all ihrer Opfer geschrieben, der bisherigen und der künftigen, in deren eigenem Blut.«
Das war eine waghalsige Behauptung, aber Milco, der Glaswarenhändler, hatte der Bauersfrau diese Legende genau so erzählt, und es war eine äußerst eindrucksvolle Geschichte gewesen.
Einige Boseler gingen näher heran und versuchten tatsächlich, in den Zierzeichen irgendwelche Namen zu lesen.
»Steht da irgendwo Kaskir drauf?«, fragte Kaskir, der nicht lesen konnte, abergläubisch.
Alle, die das Entziffern versuchten, auch auf beiden Seiten der Klinge, schüttelten die Köpfe. Sie konnten überhaupt keine nachvollziehbaren Worte erkennen.
»Dann bin ich keins ihrer Opfer«, schlussfolgerte Kaskir und lachte. »Ich hole mein Breitschwert, und dann geht’s los. Sorgt dafür, dass sie mir nicht abhaut, Leute! Mann, hundert Münzen! Das wird ein schönes rundes Fest heut Abend!«
Er ging weg, sein Schwert holen. Einige, die sich ihre Plätze für heute Abend beim Besäufnis sichern wollten, folgten ihm. Die übrigen Schaulustigen umstanden die Versucherin.
Noch andere Worte hatten sie für sie. Wenn sie so dasaß, legte die Hose beinahe die obere Hälfte ihres Gesäßes frei. Schamlos. Die Augen geschlossen, aber nicht wie schlafend wirkend, sondern eher wie lauschend. Leichtsinnig. Lebensmüde. Das Schwert funkelte im Licht. Aufwieglerisch. Unruhebringerin. Männerverderberin.
Jetzt lächelte Erenis ein wenig. Männerverderberin gefiel ihr.
Stenrei dagegen wurde von Gleichaltrigen umringt. Weil die ganze Angelegenheit an Umfang beständig zuzunehmen schien, wünschte er inzwischen eher unbemerkt aus der ganzen Sache herauszukommen, aber das wollte ihm ganz und gar nicht gelingen. »Seit wann kennst du sie?« »Habt ihr gekämpft miteinander?« »Hat sie ein Pferd irgendwo?« »Hat sie dich das Schwert anfassen lassen?« »Wie alt ist sie?« »Woher stammt sie?« »Sag, kann sie Kaskir wirklich besiegen? Kann eine Frau unseren Stärksten besiegen?«
Eigentlich war sich Stenrei ziemlich sicher, dass sie es konnte. Woher er diese Einschätzung nahm, wusste er selbst nicht so genau. Vielleicht war es das Selbstbewusstsein, das aus jeder ihrer Bewegungen sprach. Vielleicht aber auch einfach die Tatsache, dass auch er Kaskir nie halb so viel zugetraut hatte wie dieser sich selbst. Ein zorniger Herumschubser war er, dem man lieber aus dem Weg ging, aber ein echter Kämpfer vom Schlage eines Llender Dinklepp war er doch wohl kaum.
Es war eigenartig: Kaum hatte er an den ehemaligen Söldner gedacht, an den einzigen Boseler unter vierzig, der jemals wirklich an Gefechten teilgenommen hatte, als er ihn sah. Dinklepp stützte sich, kränklich aussehend, auf seine jüngere Schwester und näherte sich dem Hauptplatz. Jemand, vielleicht ebenjene Schwester, musste zu ihm gelaufen sein und ihm die Kunde von der Fremden gebracht haben.
Llender Dinklepp war kaum Mitte dreißig, aber die Keuchatemkrankheit hatte ihn ausgehöhlt, sodass er wie Mitte vierzig aussah. Sein Atem klang schleifend und mühsam. Sein langes Haar hatte schweißnasse Spitzen.
Stenrei machte sich frei von den ihn Umringenden und rannte zu Dinklepp hinüber. Er hatte schon immer viel übrig gehabt für den wenig prahlerischen, ausgemergelten Mann.
»Sie sitzt in der Mitte auf dem Boden«, erläuterte er, als er sah, dass Dinklepp den Hals reckte, weil er vor lauter Schaulustigen – es waren inzwischen gut fünf Dutzend – nichts zu sehen bekam.
»Ein Schwert mit roten Zeichen?«, knarzte dieser.
»Ja. Es steckt vor ihr im Boden. Seht selbst.«
Dinklepp stützte sich jetzt auf ihn und seine Schwester zugleich. Stenrei gewann dadurch wieder an Selbstvertrauen. Er hatte die Fremde hierhergebracht. Aber er stützte auch Dinklepp. Er brachte also nicht nur Unruhe und möglicherweise Blut über das Dorf.
Dinklepp ächzte, als er die Frau und ihr Schwert sehen konnte. »Klingentänzerin«, schnaufte er. »Ich dachte, es gibt gar keine mehr.«
»Klingentänzerin?«
»Ich habe mal eine solche Klinge gesehen, mit Blutstaben. Man sagte, sie dürfe nur von einer Frau getragen werden, die eine ganz bestimmte Schule durchlaufen hat.«
»Die Schule des Schwertes? Oder blutrote Fahne?«
Dinklepp runzelte die Stirn. »Nein, sie hatte einen Namen. Den Namen eines Mannes. Ich habe ihn vergessen. Ich habe vieles vergessen. Aber man sagte mir, die Schule gebe es nicht mehr. Sie sei bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Zwei oder drei der Schwerter soll es noch geben. Aber wie könnte sie wagen, eins zu führen, wenn sie nicht aus dieser Schule stammt?«
»Und das andere Schwert, das Ihr gesehen habt? Wer führte es?«
»Niemand. Niemand. Es gehörte zu einer Sammlung. In der Hochstadt. Der Sammlung eines reichen Mannes.« Er versank in Erinnerungen.
Nein, dachte Stenrei, Dinklepp hätte sich nicht mehr messen können mit dieser Schwertfrau, aber vor seiner heimtückischen Krankheit hätte er es sicherlich gekonnt. Llender Dinklepp war die einzige Ahnung von Größe in ganz Bosel.
Klingentänzerin. Diese fünf Silben dröhnten in ihm wie eine Tempelglocke.
Musste man Kaskir warnen? Ihm mitteilen, dass er hoffnungslos unterlegen war? Aber mit Kaskir konnte man nicht reden. Er würde lachen und höhnen und einen beiseiteschubsen, wie immer.
Vielleicht ist es besser so, dachte Stenrei, und er erschrak über diesen Gedanken. Er war zu feige dazwischenzugehen, das ja, aber er gönnte es Kaskir auch, einen furchtbaren Denkzettel zu erhalten. Und wenn Kaskir getötet wurde? Dann hatte Kaskir sich das schließlich selbst so ausgesucht, oder?
»Und diese Zeichen auf dem Schwert?«, fragte er Dinklepp. »Sind das wirklich die Namen der Opfer?«
»Nein. Blutstaben sind keine Schrift. Das sind eher … Blutbahnen.«
»Blutbahnen?«
»Ja. Damit das Blut in Ornamenten läuft. Auf diese Weise sollen, wenn ich mich recht erinnere, die aufgebrachten Geister der Getöteten besänftigt, geradezu eingelullt werden. Wie mit einer Melodie. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe so vieles vergessen.« Dinklepps Stimme versandete. Seine Schwester mahnte ihn, nicht so viel zu sprechen und mehr zu atmen.
Jetzt kehrte Kaskir zurück. Er trug sein Breitschwert grinsend über der Schulter und ging breitbeinig wie ein sehr großer Held. Sein Gefolge aus sechs, sieben Freunden tollte bewundernd um ihn herum wie junge Hunde.
Stenreis mulmiges Gefühl in der Magengegend wurde immer drängender. Klingentänzerin? Blut in Ornamenten? Geister der Getöteten? Er konnte Kaskir nicht ausstehen. Er konnte Bosel nicht ausstehen. Aber wollte er denn wirklich, dass Kaskir auf dem Hauptplatz hingeschlachtet wurde, damit sein Blut zur Melodie wurde? Was ging hier vor sich? War er verantwortlich? Hatte er nicht die Klingentänzerin hierher geführt? Zweifelsohne. Aber was war mit den Boselern los? Warum schlossen sie sich nicht gegen sie zusammen wie früher gegen die Waldmenschen und scheuchten sie fort? Warum stemmten sie sich der Gefahr nicht entgegen? Vom Glanz der einhundert vernähten Münzen eingelullt, umstanden sie die untätig Sitzende und unternahmen nichts, außer zeternd und zischelnd dem Unheil beizuwohnen.
Stenrei hatte das Gefühl, sie wachrütteln zu müssen.
Aber genau das war das Problem.
Das war schon immer das Problem mit Bosel gewesen: Niemand hier hatte Vorstellungen. Niemand ließ sich aufrütteln. Wenn die Waldmenschen kamen, ja – denn davon gab es Überlieferungen. Dann griff man zum Hackbeil und zur Egge und formierte sich mit anderen Dörfern zur Wehr, denn das hatte man hierzulande schon immer so gemacht. Aber wenn eine Frau ins Dorf kam und den Stärksten zum Sterben aufforderte? Dann stand man herum und gaffte und bohrte in der Nase und hielt Maulaffen feil und keifte »Versucherin«, aber die Versucherin hatte bereits gewonnen, bereits in Versuchung geführt, ein Spektakel anzuschauen und nicht das Geringste dagegen zu unternehmen.
Stenrei spürte dieses Boselhafte auch in sich. Angesichts der Überzahl von bald sechs Dutzend Schauwilligen kam ihm ein Entgegenstellen vergeblich vor. Es waren einfach zu viele. Sie würden nicht mehr auf ihn hören. Fünf oder sechs vielleicht, aber nicht sechs Dutzend Ältere und vermeintlich so viel Erfahrenere als er.
Mit hängenden Schultern schaute er zu, wie das Verhängnis, an dem er alles andere als unschuldig war, seinen Lauf nahm. Und fühlte sich dabei in seiner Tatenlosigkeit auf niederschmetternde Weise als echter Sohn dieses Dorfes.
Die Schwertfrau schlug die Augen auf, als sie Kaskirs glucksende Stimme hörte. Sie sah ihn und erhob sich. Dann zog sie das untere Ende ihres Wildlederhemdes hoch und verknotete es neu, dicht unter ihrem Busen. Die Menge machte ein Geräusch wie ein übergroßer Blasebalg. Männer atmeten ein, Frauen aus. Dann zog die Frau das Schwert aus dem Boden. Jede ihrer Bewegungen wirkte gelassen und geschmeidig. Die roten Muster auf der Klinge glommen im Sonnenlicht wie Glut.
Kaskir trat bis auf zehn Schritt an sie heran. »Wo tun wir’s, meine Schöne? Gleich hier?«
»Gleich hier. Denn du willst doch gesehen werden dabei, von deinesgleichen, oder etwa nicht?« Sie lächelte jetzt. Seitdem sie das Wort »Männerverderberin« gehört hatte, war dieses leichte Lächeln nicht mehr aus ihrem Gesicht gewichen.
Kaskir sah kurz ein wenig verunsichert aus, aber sein Freundeskreis drängte ihn vorwärts.
Eigentümlich, dachte Stenrei. Der Herumschubser wird jetzt geschubst. Ein Ablauf der Dinge hatte ihn erfasst, dem sich jetzt niemand mehr entgegenstemmen konnte.
Die Schaulustigen – acht Dutzend nun, an die hundert Boseler, und noch immer liefen welche von hinten hinzu oder waren welche unterwegs, um andere heranzuholen – machten den Hauptplatz so frei wie möglich, indem sie sich an die Hauswände zurückzogen. Nur der Rucksack mit dem Münzsäckel und die beiden Kämpfer blieben mitten auf dem Platz zurück.
Auf den Gesichtern der Boseler zeigte sich vor allem Verbissenheit. Stenrei überraschte dieser vorherrschende Gesichtsausdruck. Er hatte eher reine Schaulust, also Schadenfreude und Anfeuerung erwartet. Aber dann begriff er: Es ging um Bosels Ehre. Die Frau hatte das ganze Dorf herausgefordert, hatte damit gedroht, es in anderen Dörfern zu verspotten. Das musste verhindert werden, und Kaskir war der Mann, es zu verhindern. Die Dörfler gaben viel darauf, was über sie geredet wurde. Auch untereinander.
Stenrei fragte sich, was passieren würde, wenn Kaskir unterlag. Und er würde doch unterliegen, oder? Wenn Dinklepp sich nicht irrte? Was würden die Boseler dann machen? Konnten sie die Siegerin dann einfach ziehen lassen, im Vertrauen darauf, dass sie wenigstens nicht erzählen konnte, dass sich ihr in Bosel niemand gestellt hatte? Oder würden sie versuchen sich zusammenzuschließen? Mit Steinen werfen, weil die meisten von ihnen nicht kämpfen konnten? Kaskir rächen mit dem Material, aus dem Bosel bestand? Was für ein unschöner, unehrenhafter Gedanke.
Zum ersten Mal in seinem Leben bedauerte es Stenrei, dass es in Bosel keine Büttel gab. Büttel hätten wenigstens gewusst, wie die Gesetze lauteten und wie man eine solche Unruhestifterin des Ortes verweisen konnte. Aber nicht jedes Dorf hatte eine Garnison. Die nächste, besetzt mit kläglichen sechs Mann, war drei Dörfer entfernt. Es war selbst zu Pferd viel zu spät, diese jetzt noch zu verständigen und hierherzuholen.
Er konnte nichts tun. Es war unmöglich, die Stimme zu erheben gegen hundert, die verbissen fauchten und knurrten. Er hätte die Frau nicht nach Bosel führen dürfen. Aber er war dem Zauber ihrer unvollständigen Nacktheit im Schimmern und Kräuseln des Flusses erlegen.
Kaskir nahm sein Breitschwert in beide Hände und lockerte sich etwas. Er sah nicht aus, als würde er die ganze Sache sonderlich ernst nehmen. Auf die Kraft seiner Schwertschwünge konnte er immer vertrauen. Im Rahmen einer Wette hatte er schon einmal den Stützpfeiler eines alten Hauses mit diesem Schwert und einem einzigen Schlag durchtrennt.
Aber auch Erenis sah nicht besorgt oder besonders angespannt aus. Sie ging vor Kaskir auf und ab, bis er bedrohlich sein Schwert hob. Jetzt nahm sie eine eigenartige Stellung ein: Sie winkelte den linken Arm in Höhe des Halses an und legte die flache Schneide ihres Schwertes auf ihren linken Unterarm. Die Spitze zeigte dabei auf Kaskir. Als würde sie einen Stoß mit einem Stock vorbereiten, keinen Schwung mit einem Schwert. Ihren Körper stellte sie beinahe seitlich zu Kaskir, den Arm mit der Spitze voran, den Gegner über das Schwert hinweg betrachtend.
»Fangen wir an?«, fragte Kaskir.
»Jederzeit.«
»Mach sie fertig!«, rief das hungrige und durstige Mädchen.
»Feg sie einfach fort!«, ein anderer.
Stenrei betrachtete kurz Dinklepp. Der hatte das Atmen jetzt ganz eingestellt, hing wie an Fäden an jeder Bewegung der beiden Kontrahenten.
Kaskir machte einen Ausfallschritt nach links. Hob das Schwert. Brüllte. Stürmte vor.
Die Menge nahm sein Brüllen auf, klang dabei wie eine Herde.
Stenrei ächzte unwillkürlich. Er mochte gar nicht hinsehen, aber es ging nicht anders, auch er klebte, wie Dinklepp, an den Konturen dieses Schauspiels fest.
Erenis machte zwei Schritte zurück, behielt Kaskir auf Distanz und im Auge.
Kaskir wechselte nach rechts, brüllte noch mal, schwang jetzt sein Schwert nach ihr. Vorbei. Mit Wucht. Und schnell. Das Schwert brauste durch das Nichts. Und in seinen Ausschwung hinein folgte ihm ihr eigenes Schwert. Sie hatte sich gedreht, einmal um ihre Achse, ihr Schwert vom Arm genommen und hinter ihrem Körper entlang ihm in den auspendelnden Rücken oder die Seite geschlagen. Es gab ein Geräusch, eine Art nasses Reißen. Dann zog sie das Schwert an sich und nahm wieder ihre vorherige Haltung ein, die Klinge flach auf dem Unterarm.
Blut.
Da war Blut.
Das Ganze war so schnell gegangen, dass man durch ein kurzes Blinzeln womöglich alles versäumt hätte. Aber Stenrei hatte noch ein Nachbild von Kaskirs Wucht und Erenis’ Drehung vor Augen. Geradzu eingeätzt in seinen Blick. Wie die Frau sich öffnete, entfaltete, aus der Wendung heraus, und zustach oder zuschlug.
Kaskir stieß ein eigenartiges Geräusch aus. Ein keuchendes Pusten, als wäre er Dinklepp. Er fasste sich an den Rücken, wo sie ihn getroffen hatte. Die Hand, die er von dort zurückzog, war voller Blut. Sein grobes Arbeitshemd ebenfalls. Das übrige Blut lief über ihr Schwert. In Ornamenten. Blutstaben. Einer fremden Zunge des Verendens.
Kaskir versuchte zu lachen. Es klang kurzatmig. »Du hast Schwein gehabt, Mädchen. Ein Glückstreffer. Das schaffst du aber nicht noch mal!«
Sie machte drei Schritte rückwärts. Gab ihm mehr Raum. Er hob wieder sein Schwert an.
Einige Zuschauerinnen schrien auf, in ihre vor den Mund gehaltenen Hände hinein. Stenrei konnte nicht erkennen, weshalb sie schrien.
Dann gab Erenis plötzlich ihre Haltung auf und ging mit einfach nur noch locker in der Hand gehaltenem Schwert zu ihrem Rucksack hin, als wäre Kaskir gar nicht mehr vorhanden.
Es war vollkommen rätselhaft. Kaskir stand doch noch immer vor ihr, mit angehobenem Schwert, das Gesicht zwar zusehends schweißiger und bleicher, aber gefährlich. Bosels stärkster Mann, wer wollte ihm das streitig machen? Verwundet, also sicherlich gleich rasend wie ein von einem schlechten Pfeil getroffener Stacheleber.
Stenrei schaute wieder Dinklepp an. In dessen Augen schimmerten Tränen. Tränen?
»Was ist denn?«, fragte Stenrei.
»Es ist schon vorüber«, raspelte Dinklepp.
»Vorüber? Aber …«
Dann brach Kaskir zusammen. Er sackte nicht einfach nur in die Knie, nein, er stürzte über die Knie wie ins Nichts. Krachte schwer wie ein Sack in den Staub. Das Breitschwert klapperte sinnlos auf den Boden. Der Blutfleck war riesig, verklebte fast das ganze Hemd zu dunkelroten Falten.
»Aber … aber das war doch nur ein einziger Streich? War das Schwert etwa … vergiftet?«, stammelte Stenrei.
»Nein. Ein Streich genügt«, ächzte Dinklepps Stimme. »Das lernt man im Krieg. Alle Kunst kann einen nicht retten, wenn man an der richtigen Stelle getroffen wird. Man stirbt, zitternd wie ein Tier auf der Schlachtbank.«
»Man stirbt? Ihr meint … er ist tot?«
»Tot, ja. Darauf hatte sie es wohl abgesehen. Junge?«
Stenrei zuckte zusammen, als der schwer kranke ehemalige Söldner ihn jetzt so unmittelbar ansprach. »Ja?«
»Wenn die Leute jetzt versuchen, sie anzugreifen, um Kaskir zu rächen, wird es noch mehr Tote geben. Noch viel mehr. Wir müssen die Meute im Zaum halten. Die Frau abschirmen!«
»Sie abschirmen, ja. Sie abschirmen.« Stenrei wiederholte einfach nur, was Dinklepp gesagt hatte. Dann setzte er sich in Bewegung. Er wusste selbst nicht genau, weshalb er das tat. Vielleicht, weil Dinklepp für ihn eine Respektsperson war, und weil diese Respektsperson ihm gerade einen Auftrag erteilt hatte. Eine Gelegenheit, jetzt vielleicht doch noch etwas gutzumachen. Auch wenn er sich dabei zwischen sämtliche Fronten stellen musste.
Erenis rammte das Schwert neben dem Rucksack in den Boden, stopfte ihre Münzen in den Rucksack zurück und schnallte sich den Rucksack um. Dann nahm sie das Schwert wieder auf. Eine blutige Kerbe blieb zurück. Die Dörfler betrachteten diese Kerbe wie Schlafwandler. »Es war mir ein Vergnügen, wirklich«, sagte Erenis spöttisch und wandte sich zum Gehen. Stenrei beeilte sich, sich zu ihr durchzudrängen.
Inzwischen war das hungrige und durstige Mädchen bei Kaskir angelangt. Es stupste ihn mit dem Fuß, rüttelte ihn dann. »Kaskir? Was ist denn? Sag doch was!«
Die Menge verlagerte sich. Murren wurde lauter. Undeutliche Rufe, wie Blöken. Wie Buhrufe, wenn Komödianten nicht lustig genug waren.
Stenrei kam bei Erenis an. Sie schaute ihn verwundert an. »Hier entlang«, raunte er ihr zu. »Hier geht es am schnellsten raus. Ihr dürft jetzt nicht in die Gassen geraten.«
»Ich brauche keinen Führer, um aus diesem Nest zu finden«, sagte sie.
»Kommt jetzt! Schnell!« Er versuchte sie abzuschirmen, aber die Dörfler waren rundherum, stets war sie nach mehreren Richtungen ungedeckt. Immerhin bewegten sie sich auf das hintere Ende des Hauptplatzes zu.
»Er ist tot!«, schrie jetzt das Mädchen. »Sie hat Kaskir ermordet!«
»Das ist nicht wahr!«, sagte Stenrei mit lauter Stimme, beide Arme erhoben. »Ihr wisst, dass es nicht wahr ist. Es war kein Mord, sondern ein ehrlicher Kampf. Kaskir wollte sich hundert Münzen verdienen, aber er hat es leider nicht geschafft. Alles war rechtens.«
»Ein einziger Streich nur?«, fragte einer. Das Blöken der Herde begann nun verständliche Worte auszubilden. »Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu.«
»Gift! Da ist doch Gift im Spiel!«
»Sie hat uns reingelegt!«
»Hat unseren Kaskir umgebracht!«
»Lasst sie nicht entkommen!«
Kurz sah Stenrei Erenis’ Gesicht. Sie lächelte und wirkte sehr ruhig. Das Schwert noch immer in der Faust, nicht in den Schlaufen des Rucksacks. Und an dem Schwert: Boseler Blut.
»Alles war so abgesprochen«, widersprach Stenrei so laut wie möglich. »Ihr wart doch selbst dabei. Sie hat gewonnen und kann gehen. Wenn ihr sie hindern wollt, wird sie sich wehren müssen, und ihr habt selbst gesehen, dass sie nur einen einzigen Schlag brauchte, um Kaskir zu besiegen!«
»Das ist ein Zauberschwert!«
»Verfluchte Hexenklinge!«
»Und was hast du mit ihr zu schaffen, Stenrei? Bist du etwa plötzlich kein Boseler mehr?«
»Natürlich bin ich ein Boseler, das wisst ihr doch!« Stenreis Achseln zeigten Schweißflecken fast so groß wie Kaskirs Blutfleck. »Ich kenne diese Frau überhaupt nicht.«
»Aber du bist mit ihr gekommen! Machst du mit ihr gemeinsame Sache?«
»Unsinn! Ich hatte keine Ahnung, was passieren wird. Ich dachte, Kaskir macht sie fertig. Haben wir das nicht alle gedacht? Dass es ein Fest gibt heute Abend, und Kaskir lädt uns ein?«
»Du bist mit ihr zusammen gekommen. Ich hab’s genau gesehen!«
»Weil ich sie im Wald getroffen habe. Und mitgegangen bin, als sie den Weg nach Bosel einschlug. Ich war neugierig, was passieren würde. Wie ihr alle! Wie hätte ich sie denn aufhalten sollen, ohne Waffen, wenn selbst Kaskir mit seinem Schwert das nicht schaffen konnte?« Das war ein gutes Argument. Zumindest in den Köpfen einiger von den Erhitzten begann es zu arbeiten.
»Und jetzt? Warum nimmst du sie in Schutz?«
»Ich nehme nicht sie in Schutz, sondern euch! Alles war rechtens. Wenn sie sich wehrt, wird noch mehr Blut fließen. Und die Büttel, die dann kommen werden, müssen ihr recht geben!«
»Sie ist eine Mörderin!«
»Nein, es war ein ehrlicher Kampf. Ihr habt es doch gesehen.« Er nannte drei beim Namen, sprach sie direkt an. »Ihr wart dabei, habt von Anfang an zugeschaut. Nichts war unehrlich an diesem Kampf. Noch dazu eine Frau gegen einen Mann. Sie hat sich wahrlich keinen wehrlosen Gegner ausgesucht.«
Während dieses ganzen Redens waren Erenis und Stenrei weitergegangen, und vor ihnen hatte sich zwischen den Schaulustigen eine Gasse gebildet, möglicherweise vom Anblick des blutigen Schwerts zum Passierenlassen bewegt. Aber jetzt blieb Erenis plötzlich stehen, mitten in der Menschengasse.
»Wer hat dich eigentlich gebeten, für mich zu sprechen? Jeder Mann ist ein leichter Gegner für eine Frau.«
Stenrei schluckte. »Was? Ich versuche doch nur zu verhindern, dass …«
»Scher dich zu deinen Eltern, Junge. Ich brauche keinen Vermittler, der für mich Unsinn quasselt.«
Stenrei sah ihr Schwert. Die Gasse. Die Gasse aus Leibern. Aufklaffend. Blut. Ornamente, Melodien.
In seinem Inneren drehte sich ein Rad, das schlecht geschmiert war und an seinen Eingeweiden rieb, sie sogar mitriss, verzerrte. Er war für das alles hier mitverantwortlich. Er hatte Kaskir auf dem Gewissen. Aber Kaskir hatte sich auch selbst auf dem Gewissen, weil er dumm und überheblich gewesen war, sein ganzes Leben lang. Die Boseler, die jetzt im Begriff waren, in das blutige Schwert zu fassen, wären ebenfalls selbst schuld an ihrem Los, weil sie zu geistesträge waren, zu begreifen, dass sie wirklich in wenigen Augenblicken tot oder verstümmelt sein konnten. Sie hatten einfach keine Vorstellungen.
Stenrei schrie plötzlich. Er schrie Worte. »Lasst sie jetzt endlich durch, ihr Schwachköpfe! Oder wollt ihr allen Ernstes, dass sie euch alle niedermacht?«
Das zeitigte Wirkung. Vielleicht nicht die Worte. Aber die Lautstärke. Die Dörfler, immer darauf bedacht, nicht anzuecken, nicht aufzufallen, machten wieder mehr Platz. Erenis, verächtlich schnaubend, konnte durch sie hindurch den Platz verlassen. Stenrei folgte ihr noch, sie hatten jetzt das gesamte Dorf in ihrem Rücken. Aber nicht einmal die Blicke der Dörfler waren jetzt wie Pfeile, die sie durchbohrten. Die Blicke waren stumpf geworden. Wie mattgeohrfeigt.
Auch Dinklepp hatte sich nicht als Hilfe erwiesen. Er hatte zwar Wissen, war aber zu schwach, dieses Wissen in echte Hilfe umzusetzen.
Bosel kam Stenrei wie ein dem Untergang geweihter Schauplatz vor. Vielleicht würden wirklich bald die Waldmenschen kommen, um alles niederzubrennen.
»Ich hätte deiner Hilfe nicht bedurft. Bislang bin ich aus jedem Dorf alleine rausgekommen.«
Erenis’ Worte drangen erst mit Verzögerung zu ihm durch.
»In wie vielen Dörfern hast du das schon so gemacht?«, fragte er.
»Ich führe keine Listen. Ich nehme sie, wie sie kommen.« Erenis blieb stehen. Sie befanden sich nun schon beinahe am Ortsausgang. Die zusammengerotteten Dörfler waren immer noch zu sehen, neugierig, unzufrieden bis hin zur Rachsucht, aber zu furchtsam zur Selbstüberwindung. »Jetzt hör mir mal zu«, sprach sie Stenrei an. »Es stört mich, wie du mir schon seit Stunden hinterhertrottest. Mach dich von dannen, sonst werde ich meinen Grundsätzen untreu und erschlage einen, der noch gar kein Mann ist.«
Stenrei duckte sich unter ihren Worten, ganz unwillkürlich. Er war nicht der Held, der er gerne sein wollte. Zumindest noch nicht. Eines Tages aber schon. Dann würde er es ihr beweisen.
»Kein Grund, mich dauernd anzuschnauzen«, maulte er. »Ich habe dir nicht geschadet in Bosel. Im Gegenteil, ich war dir sehr von Nutzen.«
»Ich brauchte deine Hilfe nicht.«
»Ach, dann hau eben einfach ab.« Mehr enttäuscht als wütend ließ er sie stehen und ging in die Richtung der brodelnden Dörfler, um dort seine vielleicht gerechte Strafe zu empfangen. Dann blieb er stehen, drehte sich noch mal zu ihr um. Sie war ebenfalls bereits weitergegangen, wahrscheinlich, ohne noch im Geringsten über ihn nachzudenken. »He, eine Frage hätte ich aber noch!«
Sie ächzte. »Was denn?«
»Was bringt das?«
»Was bringt was?«
»So ein Kampf. Wenn du verlierst, bekommt er deine Münzen. Aber wenn du gewinnst, bekommst du nicht seine. Du hast dir ja nicht mal sein Schwert genommen.«
»Was soll ich denn auch mit noch einem Schwert?« Mehr antwortete sie ihm nicht. Sie ging davon, wie sie gekommen war. Die Klinge über dem Rucksack, die Schritte fest, der Gang beinahe der eines Mannes, aber viel, viel wohlgerundeter.
Er würde sie nie mehr wiedersehen.
Mit den Händen in den Hosentaschen, die Schultern hochgezogen wie in kaltem Regen, ging er zu seinesgleichen und fühlte sich dort falsch. Man bestürmte ihn. Fragen. Vorwürfe. Anschuldigungen. Selbst den Namen der Fremden hatten die meisten nicht mitbekommen. Sie waren so minderbemittelt und hoffungslos, dass es schon wehtat.
Etwa eine halbe Stunde lang versuchte er, die Dörfler zu beschwichtigen. Am schlimmsten war das hungrige und durstige Mädchen, das jetzt leer ausgehen würde. Stenrei kannte sie natürlich. Sie hatte schon immer zu Kaskirs Bewunderertruppe gehört.
Stenrei sah Kaskir dort liegen. Ein kläglicher Klumpen. In seinem erkaltenden Blut.
Dinklepp war auch nicht mehr da. Seine jüngere Schwester hatte ihn wohl zurückgeführt auf sein Krankenlager. Dort konnte er den Neugierigeren unter den Dörflern noch Fragen beantworten und würde sein Wissen wahrscheinlich bei jeder weiteren Frage noch ein wenig weiter aufbauschen, um immer wieder neue Einzelheiten hinzufügen zu können.
Stenrei ging nach Hause. Seine Mutter war nicht unter den Schaulustigen gewesen. Sie hatte zu Hause die Bodenbretter gescheuert. Auch der Vater war nicht dort gewesen. Er hatte zu arbeiten gehabt.
Zum Abendbrot in der Guten Stube mit den von Großvater handbemalten Tellern an den Wänden redete man bei Tisch über das Geschehene, das natürlich Bosels Tagesgespräch war. Stenreis Rolle in dem ganzen Spektakel wurde vom Vater wieder und wieder hervorgehoben und auf das Schärfste kritisiert. Die Stimme des Vaters war schneidend und überflüssig.
Stenrei aß Rindssuppe mit Brot und schmeckte nicht das Geringste. Er dachte über seinen Großvater nach, der der dümmste und nichtssagendste Mensch gewesen war, dem Stenrei jemals begegnet war. Die Weisheit der Ältesten war die erste Lüge gewesen, die Stenrei schon als Kind nicht mehr zu glauben beschlossen hatte.
Die Gute Stube kam ihm so stickig und eng vor wie niemals zuvor.
Selbst Kaskir … selbst der widerwärtige Kaskir hatte heute wenigstens einen richtigen Kampf kosten dürfen. Um hundert Münzen gefochten. Die Bewunderung und Hoffnungen eines ganzen Dorfes in sich aufgesogen. Und sogar in der Niederlage sprachen alle noch von ihm. Dass er es der Versucherin gezeigt hätte, wenn sie ihn nicht so »ehrlos« überrumpelt hätte.
Kaskir. Stenrei beneidete selbst dessen Ende.
Sein Vater dagegen: ein Mann, der hinter einer Fassade der Rechtschaffenheit und des Arbeitsfleißes ein absolutes Nichts an Meinungen, Gedanken und Wissen verbarg. Ihm schien einzig darum zu tun, dass sein Sohn und seine Frau sich an seine häuslichen Regeln hielten, diese beiden scheuchte er herum, weil sie kraft eines Gesetzes sein familiäres Eigentum waren, während er außerhalb dieser vier Wände jedem Auftraggeber in den Hintern kroch. Und nichts beschäftigte ihn. Gegen nichts erhob er sich. Nicht, wenn der Steuereintreiber kam und viel zu hohe Abgaben einforderte, weil er am Fürsten vorbei Anteile in seine eigenen Taschen abzweigte. Nicht, wenn sämtliche Baumaterialien minderwertig oder unfähig zusammengemischt worden waren. Nicht, wenn wochenlanger Regen alle Mühen eines Steinsetzers zunichtemachte. Stenreis Vater war wie ein farbloser Schwamm, der sich nur zu Hause als Tyrann aufspielte und gar nicht begriff, dass er sich gerade deshalb um jeden Rest von Würde brachte. Stenrei hatte keine Angst mehr vor ihm, seit er etwa neun Jahre alt gewesen war, und jetzt war er schon sechzehn.
Und seine Mutter? Die war eigentlich die Stärkere und Belesenere in dieser Ehegemeinschaft, ordnete sich aber unter, um ihre Vorstellung eines friedlichen und vorzeigbaren Familienlebens nicht zu gefährden. Stenrei hatte nie begriffen, was daran so wichtig sein sollte, dass man dem sein ganzes Dasein unterwarf. Gab es denn nicht da draußen eine Welt, die sich danach sehnte, durchstreift und erlebt zu werden? Sicherlich war seine Mutter einmal hübsch gewesen. Aber jetzt welkte sie nur noch vor sich hin, ging an den Hüften aus dem Leim und bereitete ihrem kläglichen Zimmerkönig eine zusammengestoppelte Behaglichkeit, damit dieser sich weiterhin als Herr fühlen konnte. Was für eine Hofnarrennummer!
Wortlos ging Stenrei auf sein Zimmer und warf sich aufs Bett.
Das Funkeln des Flusses verfolgte ihn.
Der Hintern der Fremden, nackt im Fluss, von Leder überspannt beim Weggehen.
Sie war so begehrenswert, so gefährlich und so unnahbar. Sie zog durchs Land und tötete. Tötete die Stärksten, ohne dabei Gewinn zu machen. Dabei hätte sie mit ihrem Aussehen als Tänzerin in der Hochstadt oder selbst einer der Niederstädte viele Münzen verdienen können.
Klingentänzerin.
In seinen Träumen tanzte sie mit ihm.
Am nächsten Morgen packte er ein paar Sachen, sämtliche Münzen, die er angespart hatte, und etwas zu essen in einen Tuchbeutel und verließ sein Elternhaus.
Er wollte sich nicht einmal verabschieden. Er wollte nicht miterleben, wie sein Vater, dieser Popanz, wieder schneidend wurde und Befehle zu erteilen versuchte. Er wollte nicht miterleben, wie die Augen seiner Mutter wässrig wurden, weil sie ihren Traum vom bescheidenen Familienglück zerplatzen spürte. Er wollte einfach nur weg. Vielleicht würde er ja eines Tages wiederkommen, um seinen Eltern die Beute seiner Abenteuer auf den Tisch der Guten Stube zu schütten. Einfach nur, um ihnen zu beweisen, dass die Welt erst jenseits der Grenzen von Bosel ihren Anfang nahm.
Er dachte darüber nach, in die Wälder zu gehen, wie er sich das immer ausgemalt hatte. Jetzt, wo der Frieden mit den Grünmännern mehr und mehr ins Wanken geriet, konnte er sich unter Umständen tatsächlich bei einer dort neu stationierten Truppe als Ortskundiger verdingen. Aber wollte er sich gleich in einen Krieg hineinziehen lassen? Einen Krieg, dessen Sinn er nicht verstand? Denn schon mehrmals während seiner Wanderungen in den Wäldern war er den Grünbemalten begegnet, und sie hatten ihn stets in Ruhe gelassen. Wenn sie jetzt aufsässig wurden, dann wahrscheinlich deshalb, weil man ihnen immer größere Teile der Wälder und mithilfe wandernder Heiliger auch ihren Glauben raubte, und weil sie das nicht mehr länger hinnehmen wollten, so wie Stenrei sein Leben in Bosel nicht mehr hinnehmen wollte.
Nein. Er ging beinahe, ohne darüber nachzudenken, in dieselbe Richtung, in die die Klingentänzerin verschwunden war. Er war einfach neugierig. Sie faszinierte ihn mehr als jeder andere Mensch, der ihm in den letzten Jahren begegnet war. Womöglich hieß ihrer Fährte zu folgen ebenfalls, sich in einen Krieg hineinziehen zu lassen. Aber es war ein überschaubarer Krieg. Der Krieg einer einzelnen Frau gegen die Dörfer. Und Stenrei wollte zu gerne wissen, was das alles eigentlich zu bedeuten hatte.
Während er die Hauptstraße von Bosel hinunterging, trafen ihn argwöhnische Blicke. Die Leute trugen ihm seine ungeklärte Rolle bei Kaskirs Ende nach. Wenn er nun der Fremden folgte, würden sie sich wahrscheinlich die Mäuler darüber zerreißen, ob er zu ihr gegangen war, weil er von Anfang an mit ihr unter einer Decke gesteckt hatte. Das Argument, dass sie keinen Gewinn gemacht hatte, den sie mit irgendeinem Verbündeten hätte teilen können, würde dabei natürlich unter den Tisch fallen. Hauptsache, man hatte einen Sündenbock gefunden.
Wie er die Dörfler verachtete! Ihr Ducken und Tratschen. Ihr schlechtgewissiges Zwinkern und humpeliges Herbeieilen, sobald ein Offizieller oder Uniformierter sich blicken ließ. Kriecherische Unterwürfigkeit. Zu Hause jedoch, den eigenen Kindern gegenüber: Verbote und Getue, als wäre man selbst ein Offizieller. Als hätte man Macht, nur weil man körperlich größer war. Das war auch Kaskirs Lebensmotto gewesen. Und das hatte ihn in ein frühes und klägliches Ende geführt.
Wie er das Dorf an sich verachtete! Jedes einzelne Haus sah aus, als hätte sein Vater es errichtet. Wie also sollte auch nur eines von ihnen etwas Herausragendes beherbergen können?
Der Moment, als er die Umrisse Bosels hinter sich ließ, hatte etwas Bedeutsames.
Er war schon oft außerhalb der Dorfgrenzen gewesen, jeden Tag, wenn es sich irgendwie einrichten ließ. Aber diesmal war es für immer. Oder zumindest für sehr lange Zeit.
Würde man ihn mit Verachtung strafen, weil er der Versucherin erlegen war? Oder um ihn trauern, nach einer kurzen Zeit des Grolls? Oder sich Sorgen um ihn machen? Legenden um ihn flechten, was er alles erleben mochte, falls nun wirklich Krieg kam?
Nein, für Legenden waren die Boseler zu einfallslos.
Einzig Llender Dinklepp würde womöglich etwas von einem Jungen zu erzählen wissen, der sich anschickte, ein Klingentänzer zu werden.
Aber vielleicht würde Dinklepp schon bald tot sein, ausgezehrt von Bosels Farb- und Hoffnungslosigkeit.
Der Weg, den Erenis genommen hatte, führte in gerader Linie zum nächsten Dorf. Stoppelige Felder. Distelbewuchs am Wegessaum. Trockene Bewässerungsgräben. Dann die Umrisse des nächsten Dorfes: Kattgraum. Ohne Ortsschild hätte man es auch für Bosel halten können, denn es war genauso öde und nichtssagend. Stenrei kannte Kattgraum recht gut, weil er mit seinem Vater mehrmals dort zu tun gehabt hatte.
In Kattgraum fand er tatsächlich Erenis’ unübersehbares Vermächtnis: Auch dieses Dorf weinte um seinen kräftigsten Sohn. Dieser hatte auf den Namen Furko gehört. Die schöne Fremde hatte ihm in einem Duell den Hals aufgeschnitten, und er war in den Armen seiner Freunde verblutet. Daraufhin hatten zwei dieser Freunde sich an die Verfolgung gemacht, um die schon wieder weitergezogene Mörderin zur Strecke zu bringen. Doch die Verfolger waren kurz nach Einbruch der Nacht heimgekehrt. Einem von ihnen fehlten zwei Finger der rechten Hand, und beide schlotterten so sehr vor Furcht, dass kein vernünftiger Hergang der Geschehnisse mehr aus ihnen herauszubekommen war.
Stenrei dachte darüber nach, ob er die beiden befragen sollte. Erenis hatte zwei Kämpfe an ein und demselben Tag gewagt und gewonnen. Mit Leichtigkeit, offensichtlich. Aber warum hatte sie die beiden Verfolger am Leben gelassen? Er wollte die grausame Frau verstehen lernen. Und er war zuversichtlich, sie einholen zu können. Denn sie verlor in jedem Dorf Zeit mit ihren Gefechten.
Dies war auch der Grund, weshalb er auf eine Befragung der beiden Überlebenden verzichtete. Er wollte die gewonnene Zeit nicht wieder einbüßen. Sondern Erenis wiederfinden. Und, wenn möglich, einen weiteren ihrer Kämpfe beobachten.
Er ließ sich ihre Richtung zeigen und eilte weiter. Mit einem Pferd hätte er sie im Nu einholen können, aber ein Reittier konnte er sich nicht leisten. Irgendwann jedoch musste auch sie einmal eine Nachtruhe einlegen. Wahrscheinlich im offenen Gelände, weil sie sich in den Dörfern viel zu viele Feinde machte, um dort in einer Herberge unterkommen zu können.
Leichter Sprühregen kam auf, der erste nach mehreren Wochen Trockenheit. Der Boden war dermaßen verkrustet, dass die Nässe nicht eindrang, sondern einen pollenhaltigen Schmierfilm bildete. Aber Stenrei wanderte rasch und voller Zuversicht. Er hatte das Gefühl, ein lohnendes Ziel vor Augen zu haben, vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben überhaupt, und das Marschieren war er von seinen Streifzügen durch die Wälder gewohnt. Er war nicht so fußlahm wie die anderen Dörfler. Er hatte sich schon vor Jahren das Umherstreifen beigebracht.
Im nächsten Dorf jedoch, Ammens, erlitt er einen Rückschlag. Die Klingentänzerin war hier nicht durchgekommen. Niemand hatte sie gesehen, und niemand hatte sein Leben verloren.
Konnte es sein, dass er sie überholt hatte? Wohl kaum schon jetzt. Er war ja fast einen ganzen Tag nach ihr aus Bosel aufgebrochen.
Nein, sie musste die Richtung geändert haben. Irgendwo hinter Kattgraum. Wahrscheinlich ausgelöst durch die Begegnung mit ihren beiden Verfolgern. Sie hatte keine Lust darauf gehabt, von einem noch größeren Kontingent von Furkos Freunden abermals aufgespürt zu werden.
Stenrei rief sich sein Wissen über die Lage der umliegenden Dörfer in Erinnerung und erkundigte sich auch noch diesbezüglich bei den Ammenser Einwohnern. Kaum weiter von Kattgraum entfernt als Ammens befand sich auch ein Flecken namens Kuntelt. Dorthin konnte sie sich gewandt haben. Oder genau in die entgegengesetzte Richtung, weiter über Land nach Schingerel. Von dort war es nicht mehr weit zur nächsten Niederstadt. Aber war Erenis denn überhaupt auf dem Weg zu einer Stadt? Oder fand sie alles, was sie suchte, in den Dörfern?
Stadt.
Dörfer.
Stenrei überlegte hin und her. Dann entschied er sich für die Dörfer. Kuntelt, und hinter Kuntelt dann entweder Drutau oder Lugg. Falls er in Kuntelt keine Spur von ihr fand, konnte er umkehren, Schingerel auslassen und gleich versuchen, Erenis in der Niederstadt einzuholen. Aber er glaubte nicht an die Stadt. Er hatte Erenis im Wald getroffen. Der Wald war so weit entfernt von allen Städten wie nur möglich.
Also eilte er weiter und versuchte, Kuntelt noch vor Einbruch der Nacht zu erreichen.
Das gelang ihm nicht ganz. Der Himmel, ohnehin verhangen wie mit einem Trauerflor, dunkelte schneller ein, als ihm lieb war. Der Sprühregen wurde stärker und zerplatzte an Stenrei mit tausend unbeträchtlichen Bedrängungen. Die Krume und ihre Beackerer mochten jauchzen vor Erleichterung, für einen Wanderer bedeutete der Regen matschiges Schuhwerk und verlangsamtes Vorankommen.
Stenrei stapfte durch eine Dunkelheit, die schwarz wie Tinte an ihm hochwaberte. Doch voraus über dem Horizont bildete sich ein fieberiges Leuchten aus.
War das etwa Kuntelt?
War Kuntelt bei Nacht denn nicht dunkel wie andere Dörfer auch?
Es durchfuhr Stenrei siedend heiß: Brannte Kuntelt etwa? Hatte die Klingentänzerin dieses Dorf dem Erdboden gleichgemacht?
Nein. Kuntelt brannte nicht. Aber es befand sich in buchstäblich heller Aufregung und leuchtete zittrig von hundert Fackeln und Laternen. Denn Kuntelt hatte sich von einem gesichtslosen Nichts in ein Schlachtfeld verwandelt. Weil Erenis hier durchgekommen war.