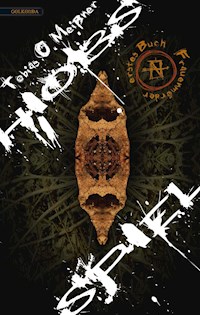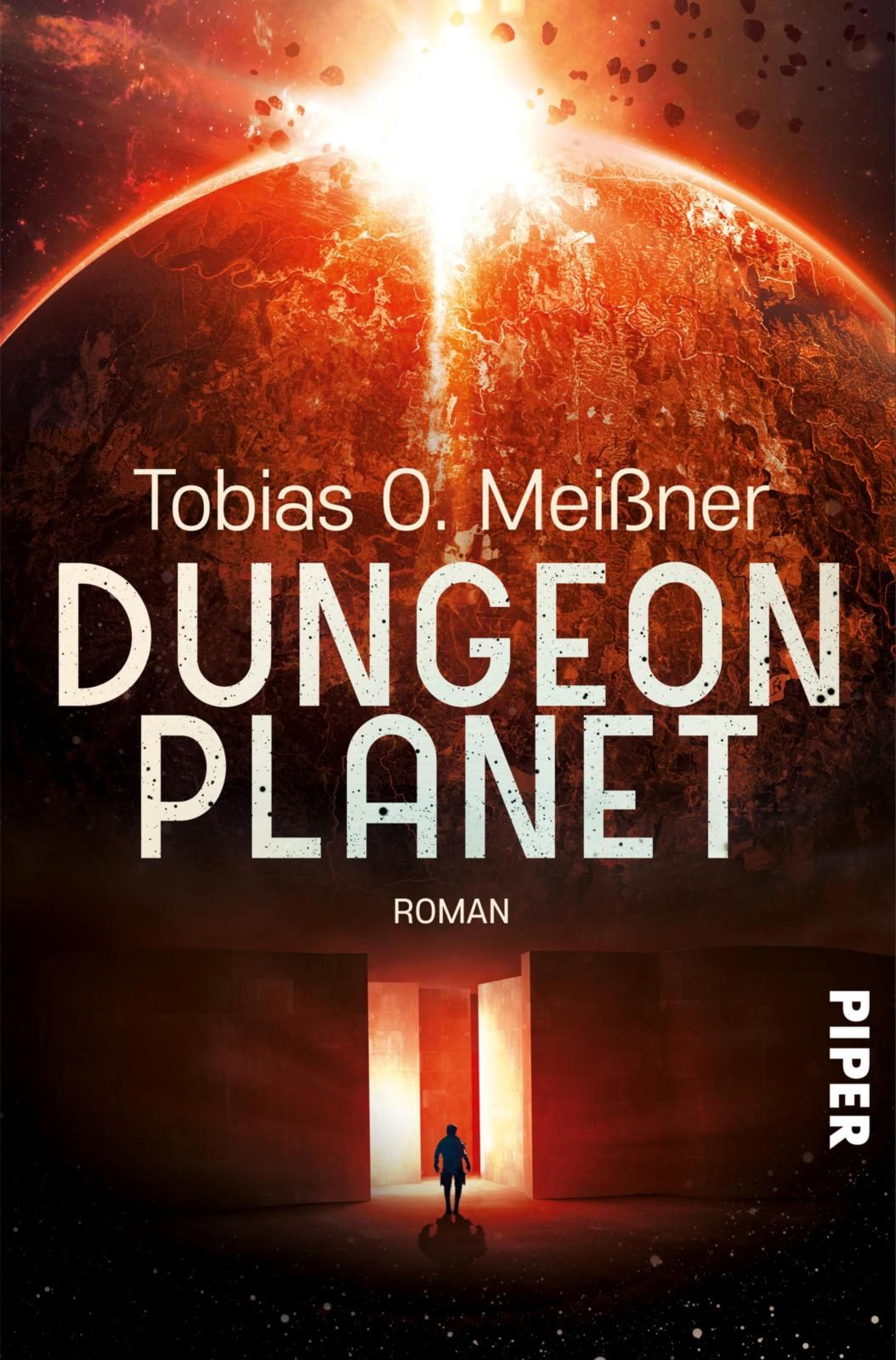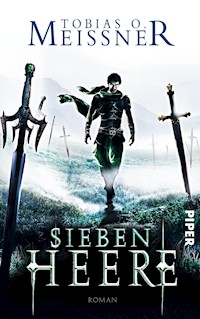2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Als Schreiber im Rathaus von Kuellen führt Rodraeg Delbane ein beschauliches Leben. Bis ihn eines Tages die schöne Schmetterlingsfrau Naenn als Anführer einer geheimnisvollen Truppe wirbt. Die Gefährten des »Kreises« wollen die phantastische Welt, in der sie leben, vor Zerstörung und Missbrauch bewahren. Doch schon beim ersten Einsatz scheitert Rodraeg. Nur knapp entrinnt er dem Untergang in der Hölle der Schwarzwachsminen und steht schließlich seinem Erzfeind in einem letzten Duell gegenüber …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
ISBN 978-3-492-98051-7 © für diese Ausgabe: Fahrenheitbooks, ein Imprint der Piper Verlag GmbH, München 2014 © Piper Verlag GmbH, München 2005 Covergestaltung: FAVORITBUERO, München Covermotiv: © Ellerslie / shutterstock.com Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe 2. Auflage 2008 In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich Fahrenheitbooks die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Prolog
Die Flaggen vor dem Zelteingang, gold und blau mit einer strahlenden Krone darauf, hingen schlaff im kalten Morgendunst. Der junge Hauptmann zögerte kurz, dann schlug er die Plane zur Seite.
»General? General!«
Der General rappelte sich mühsam auf die Ellenbogen. Seit gestern war er merklich gealtert, unrasiert, schwindlig vor Fieber. Die Felle, mit denen er sich zugedeckt hatte, waren fleckig von seinem nächtlichen Schweiß. Der junge Hauptmann, der jetzt vor seinem Lager stand, war der letzte Offizier dieses Ranges, der noch am Leben war. Alle anderen waren bereits umgekommen auf diesem von den Göttern verfluchten Feldzug, im Steinschlag begraben oder gefallen bei den Angriffen hinter dem düsteren Karstfeld.
»Was gibt es, Hauptmann?«
»Die Magier sagen, sie sind jetzt beinahe bereit.«
»Alle? Auch dieser Eigenbrötler mit den Bienen?«
»Alle, General. Man wartet auf Euer Kommando.«
»Ist es hell draußen oder dunkel?«
»Leider schon hell. Aber keine Anzeichen von Spähern.«
»Die gab es bisher nie, mein Junge. Anzeichen. Gut, ich komme.« Besorgt betrachtete der junge Hauptmann, wie sein General sich hochzog und wackelig im niedrigen Zelt stand. Die Bediensteten des Offizierstabes waren ebenfalls nicht mehr am Leben, deshalb mußte der alte, kranke Mann sich selber waschen und ankleiden. Der Stabsmedicus hätte hier sein sollen und sich kümmern, aber er war vom gleichen unerklärlichen Fieber befallen und starb zwei Zelte weiter vor sich hin. Magie, munkelten die Soldaten, die allem mißtrauten, was nicht mit Händen zu greifen war. Magie also auch auf seiten des Feindes.
Vom Feind hatten sie bislang tatsächlich kaum etwas zu sehen bekommen. Bizarre Gestalten, die über die Hänge von Schluchtwänden huschten und Pfeile und Speere von oben schleuderten. Schließlich die Steinlawine, die zwei ganze Züge verschüttete, fast einhundert Mann. Das vereiste Karstfeld, wo die Pferde eingebrochen waren und der ganze Troß ins Stocken kam und Umwege erkunden mußte. Mehrere der Kundschafter aus dem schlachtengewohnten Galliko waren nicht mehr zurückgekehrt. Dann die nächtlichen Angriffe. Die Dunkelheit so undurchdringlich wie Rauch. Ein seltsamer Geruch nach verbrannten Gewürzen. Haarige Schemen, mit den klirrenden Münzen der zivilisierten Welt verziert, griffen mit Steinschleudern an, warfen Speere und zogen sich dann wieder zurück. Immer mehr Verwundete. Immer mehr wurden krank von der Kälte, der Anspannung, den gelblichen Gasen, die überall waberten, und dem schlechten Wasser, das von der Haut abperlte wie Öl.
Nur den Magiern konnte das Fieber nichts anhaben. Sie waren eine eigene Einheit, meist unter sich, und sie schützten sich mit Kräutern und Bemalungen und komplizierten Ritualen. Es waren merkwürdige Menschen. Die meisten waren Priester der zehn Gottheiten, aber es waren auch andere unter ihnen, lebendige Rätsel. Einer war zwergwüchsig und hatte bunt gefärbte Zähne, ein anderer war am ganzen Leibe tätowiert. Zwei Frauen waren dabei, die blind waren und sich fortwährend an den Händen hielten. Ein Dunkelhäutiger mit langen Zöpfen, der sich selbst geißelte, um zu Kräften zu kommen. Einer hatte honiggelbes Haar und wurde unablässig von Bienen umschwärmt, obwohl der Winter hier im Norden noch härter war als in den mittleren Landen.
Im Winter ist der Feind am schwächsten, hatte es in der Hauptstadt Aldava geheißen. Im Winter schlafen die Affenmenschen in dunklen Höhlen und sind betäubt vom Qualm kokelnder Weinblätter. Auch die anderen Ungeheuer, die es hier oben jenseits der Felsenwüste gab, sollten im Winter ruhen oder träge vom im Herbst angefutterten Fett sein. Bislang hatten sich zwei Zusammenstöße mit Ungeheuern ereignet, der erste mit einem riesigen Panzerlöwen und der zweite mit einem Rudel Haihunde. Alle hatten ausgeruht und hungrig gewirkt, und alle hatten sie weitere Kerben in den torkelnden Heerwurm der Königin gebissen.
Daß die Informationen aus Aldava wenig taugten, wurde spätestens in der zweiten Woche des Feldzuges offenbar, nachdem der Feind sich immer noch nicht gezeigt hatte. Die Theoretiker des königlichen Hofes hatten Stein und Bein geschworen, daß die Affenmenschen einen so weiten Vorstoß auf ihr Gebiet nicht dulden und sich mit der üblichen Truppenstärke dem Heer entgegenwerfen würden – wie sie es vor Galliko und jenseits der Festung Carlyr immer getan hatten, seit Jahrhunderten schon. Alles wäre kein Problem gewesen, hätten die Theoretiker nur Recht behalten. Dieses Heer war das größte, das der Kontinent seit König Rinwes Kriegszeiten gesehen hatte, es bestand aus zweitausend gut ausgebildeten Männern und Frauen und war zusätzlich mit dieser einzigartigen Ansammlung verschiedenartiger Magier verstärkt. Wie ein Spaziergang mit einem großen Wischbesen sollte es werden – so hatte man es ihnen zumindest versprochen.
Doch die Affenmenschen dachten gar nicht daran, den Vorhersagen zu entsprechen. Sie griffen nicht auf breiter Front an, sondern nur mit kurzen Überfällen, und überließen das königliche Heer im gefährlichen Gelände sich selbst. Wenn sie doch angriffen, dann schnell, aus dem Hinterhalt, aus dem Dunkel heraus und aus möglichst großer Entfernung. Den Rest der Arbeit überließen sie ihrem Land.
Jetzt aber sollte sich das Blatt wenden. Die Kundschafter hatten eine Siedlung der Affenmenschen ausgemacht. Höhlen und lehmige Wohnhügel, fünfhundert bis tausend Bewohner. Kein kleines Dorf, eher schon ein wichtiger Anlaufpunkt für die Affenkrieger, die dem Heer bislang gefolgt waren. Ein Kundschafter aus Galliko nannte die löchrige Hügelgruppe, in der die Lagerfeuer rauchten, den ›Skorpionhaufen‹, weil etliche kleine, gelbliche Skorpione hier herumwimmelten.
Dieser ›Skorpionhaufen‹ bot endlich die Gelegenheit zum Gegenschlag. Dem General schwebte kein Angriff vor, kein unerfreuliches Gemetzel auch an Affenweibchen und Affenkindern. Vielmehr wollte er ein Zeichen setzen, das Furcht in die Herzen aller übrigen Affenmenschen trieb. Er wollte diese Siedlung ausradieren, als hätte sie nie existiert. Alles, was zurückbleiben sollte, war eine in den Boden gerammte königliche Fahne. Neu erobertes Land, mitten im Herzen des gegnerischen Territoriums.
Die Magier hatten die gesamte Nacht gebraucht, um alle Vorkehrungen zu treffen, aber jetzt schien es endlich vollbracht zu sein. Ein Senchak-Priester in zeremonieller Rüstung, der als Sprecher der Magier fungierte, kam dem General auf dem verschneiten Weg zu den vorgelagerten Posten entgegen.
»Es ist schon hell, Senchak-Bruder«, keuchte der General, der sich auf den jungen Hauptmann stützen mußte, um zügig voranzukommen. »Seid ihr dennoch unbemerkt geblieben?«
»Das sind wir, General. Die Affen sind ruhig und mit ihrem Alltag beschäftigt. Niemand hat sie vor uns gewarnt.«
»Was äußerst unglaubwürdig ist, findet Ihr nicht auch? Seit vierzehn Tagen werden wir immer wieder attackiert und von Feinden in die Irre geführt, und da sollte keiner der Affen auf die Idee gekommen sein, dieses Dorf, das auf unserem Weg liegt, zu warnen? Äußerst unglaubwürdig.« Er hustete und spuckte aus. »Nein, es ist so, wie ich gestern vermutet habe. Eine Falle. Dieser Skorpionhaufen ist eine Falle.«
Der Priester nickte. »Ihr könntet recht haben. Diese Hügel sind mit Sicherheit von einem weitläufigen Geflecht aus Gängen und Höhlen durchzogen. Dort kann man bequem ganze Armeen verstecken.«
»Ja. Wenn wir mit Fackel und Schwert angreifen, sollen wir eine böse Überraschung erleben. Ich könnte mir gut vorstellen, daß der Feind glaubt, unseren Feldzug hier auf einen Streich beenden zu können.«
Der Priester lachte rauh, so daß sein Atem nebelig vor seinem Gesicht tanzte. »Aber wir werden nicht angreifen.«
»Richtig. Wir werden nicht angreifen. Mit Eurer Magie werden wir die Hügel der Skorpione in Staub verwandeln, und je mehr Krieger die Affen dort verborgen haben, desto besser für uns und unser weiteres Vorankommen.«
»Ruhm und Ehre dem wilden Gott Senchak und der weisen Königin Thada.«
»Ruhm und Ehre der Königin Thada und allen Göttern, die ihr gewogen sind.«
Der General und der Zauberer maßen sich mit Blicken und grinsten beide dabei. Sie würden sich nie vollkommen verstehen, der Kriegshandwerker und der Glaubenskrieger, aber Senchak war der Gott der Waffen und der Schlachten, und das ermöglichte es ihnen, zusammenzustehen gegen die Bestien des Nordostens.
Sie erreichten die Beobachtungslinie. Ein ›Weitauge‹, eine der neuesten Erfindungen aus den Rüstkammern Aldavas, wurde an den General weitergereicht. Er kniff ein Auge zusammen und spähte mit dem anderen durch das armlange Rohr. In einem kreisrunden Ausschnitt konnte er nun den »Skorpionhaufen« von Nahem betrachten und seinen Blick unbemerkt schweifen lassen.
»Sie verrichten ihr Tagwerk«, kommentierte der General. »Tollen im Schnee herum. Schnuppern an den Weibchen. Sieht nicht so aus, als würden sie mit uns rechnen.« Der milde Geruch von Honig stieg ihm in die Nase, und er wandte sich um. Da war er wieder, der eigentümlichste unter den Magiern, mit seinen gelben Haaren und dem alterslosen Gesicht. Nur eine einzige Biene umkreiste heute morgen sein Haupt.
»Erlaubt Ihr mir, daß ich etwas zu bedenken gebe?« fragte der Magier höflich.
Der General seufzte. »Es würde mich verblüffen, wenn Ihr es einmal unterlassen würdet. Wo drückt Euch diesmal der Schuh, Bienenbändiger?«
»Wenn Ihr davon ausgeht, der ›Skorpionhaufen‹ könnte eine Falle sein – wäre es dann nicht auch denkbar, daß die Bewohner mit einem Einsatz unserer Magier rechnen und sich entsprechend gewappnet haben?«
»Was! Denkt Ihr, wir werden nichts ausrichten können mit unserer Magie?«
»Ich denke, daß alles Denkbare und Undenkbare passieren kann vermittels der Magie.«
Der General ließ sein ›Weitauge‹ sinken und hustete. »Das sind doch nur Tiere! Ihr glaubt doch nicht allen Ernstes, daß die sich auf Magie verstehen?«
»Sie kleiden sich, bauen sich Behausungen, sprechen eine Sprache und sind organisiert genug, unserem Heer nicht einfach ins offene Messer zu rennen, sondern uns langsam auszubluten. Ich vermute schon seit Wochen, daß es hinter den Affenmenschen eine uns unbekannte lenkende Kraft gibt, die ihnen Anweisungen erteilt, wie sie unserem Feldzug am geschicktesten begegnen können.«
»Das ist doch Unsinn«, mischte sich der Senchak-Priester barsch ein. »Es gibt keinerlei Hinweise auf einen König der Affenmenschen, noch auch nur auf einen General. Sie verehren nicht mal einen einheitlichen Gott! Die Affenmenschen sind in Sippen und Stämme zerfallen, ähnlich wie unser Kontinent vor der Vereinigung durch König Rinwe. Jede Sippe betet ihren eigenen Fetisch an und verfolgt ihre eigene Kriegsstrategie. Sie haben einfach nicht genug Hirn im Schädel, um sich abzusprechen.«
Der gelbhaarige Magier blieb unbewegt. »Dennoch haben sie uns bis hierher durchkommen lassen, als ob sie das gewollt hätten.«
»Und was soll an diesem Ort so besonders sein?« fragte der General mit Spott in der Stimme.
»Ich weiß es nicht. Ich habe meine Bienen ausgesandt, und sie sagten, der Ort war gestern und ist heute so wenig, als sei er gar nicht vorhanden, aber seine Zukunft sei wie ein blendendes Licht.«
Wieder spuckte der General aus. »Seine Zukunft! Die Zukunft dieses Ortes endet genau heute! Schluß jetzt mit diesem albernen Geschwätz – ich will die Sache hinter mich bringen, bevor der nächste Fieberschub mich schwächt. Hauptmann!«
Der junge Offizier trat vor. »General?«
Mit vor Anstrengung geröteten Augen legte der General dem Hauptmann eine Hand auf die Schulter, mehr um sich zu stützen als zum Zeichen des Vertrauens. »Hauptmann, ich will, daß Ihr die Hälfte der Männer mitsamt allen Verwundeten und Entkräfteten zurückführt bis tausend Schritt hinter unserer Lagerlinie, denn eigentlich gibt es nur zwei Möglichkeiten, was hier vorne passieren kann. Entweder geht alles glatt, dann werde ich nur wenige Männer brauchen, um die schwelende Asche des Skorpionhaufens mit meinen Stiefeln platt zu treten, oder aber es geht etwas schief, und dann ist es besser, wenn wir noch eine zweite Linie in Reserve halten. Ihr übernehmt das Kommando über diese zweite Abteilung. Kontakt halten wir über Feldläufer und über ein ›Weitauge‹, das Ihr mitnehmt.«
»Verstanden, General. Die andere Hälfte der Männer schicke ich zu Euch nach vorne?«
»So ist es, mein Junge. Sie sollen leise vorrücken, mit leichtestem Gepäck. Den Rest tragen Eure Leute nach hinten.«
»Verstanden.« Der junge Hauptmann salutierte und wandte sich zum Gehen, doch dem General fiel noch etwas ein. Er hielt den Hauptmann zurück, indem er ihn beim Namen nannte.
»Hauptmann Gayo?«
»Ja, General?«
»Vergeßt nicht: Mit diesem Kommando übernehmt Ihr auch die Verantwortung für das weitere Vorgehen und das Überleben unserer Männer, sollte das Fieber mich fertigmachen.«
»Das ist mir klar, General. Aber so weit wird es nicht kommen.«
Der junge Hauptmann stapfte durch den Schnee davon.
Der General betrachtete den gelbhaarigen Magier. »Und Ihr, mein honigfarbener Freund? Wollt Ihr Euch lieber mit Hauptmann Gayo zurückziehen oder Euch weiterhin in meiner Nähe der Gefahr einer Ansteckung aussetzen?«
»Ich fürchte, mir bleibt keine Wahl, General. Meine Magie ist ein wichtiger Bestandteil unseres Plans.«
»Dann macht es Euch hier vorne gemütlich. Wir fangen bald an.«
Es verging noch fast eine halbe Stunde. Dem General war ein Schemel gebracht worden, auf den er sich setzen konnte. Ein Soldat tupfte ihm Schweiß aus dem Gesicht, ein anderer reichte ihm heiße klare Suppe, die er aus einem Krug schlürfte.
Die Magier meldeten ihre Vorbereitungen als abgeschlossen. Ein Feldläufer von Hauptmann Gayos Abteilung meldete, daß Gayos Männer die angewiesene Rückzugslinie erreicht hatten. Die restlichen Soldaten, noch beinahe sechshundert, verbargen sich links und rechts des Generals unter schneebeladenen Bäumen und Buschwerk.
Der Senchak-Priester kam handschuhreibend von seinem letzten Rundgang zurück. »Die Magier warten nur noch auf Euer Kommando, General. Einige sind schon regelrecht in verzückter Entrücktheit begriffen. Die Macht, die wir ausgießen werden über diese Brutstätte des Unglaubens, wird ohne Beispiel sein.«
Der General nickte und nahm einen weiteren Schluck Suppe. »Das bedeutet, ich kann auf das ›Weitauge‹ verzichten und dennoch etwas sehen?«
»Ihr werdet das nicht übersehen können, General.«
»Na, dann los. Entfesselt, meine Magier, was ihr alles zu entfesseln habt.«
Der Senchak-Priester verbeugte sich, kreuzte die Arme vor der Brust und schloß die Augen, das Gesicht dem ›Skorpionhaufen‹ zugewandt.
Die Soldaten, und mit ihnen auch der General, hielten den Atem an.
Dann detonierten vor ihnen die Hügel in einer weißen, aufwärts fließenden Kaskade aus Licht, die brüllend anschwoll und sich kreisförmig ausdehnte. Der General sah Felsen zerplatzen wie überreifes Obst. Sah Schnee schmelzen, aufkochen und als Dampf zerstieben innerhalb eines einzigen Augenblicks. Sah Bäume sich biegen wie Grashalme, dann zu Flammen werden, zu Asche und schließlich zu einer Erinnerung an Rauch. Sah das grellweiße Tosen auf sich und seine Männer zurasen wie eine Flutwelle, die jedes Begreifen überstieg. Er sah das Entsetzen im Gesicht des Senchak-Priesters, dann, wie dieses sich in winzige Fetzen auflöste, die ein unzähmbarer Sturmwind vor sich herpeitschte.
Der letzte Gedanke des Generals, bevor ihm das Fleisch von den Knochen gerissen wurde und diese Knochen dann verglühten, war: Dies ist ein angemessenes Ende.
Ein schneeweißes Blenden, so vollkommen wie das Dunkel, das es bringt.
1
Nicht von hier
Der Sturm treibt den Schnee fast waagerecht über die weiße Gletscherebene.
Zwischen den großen, zusammengesunkenen Leibern der Mammuts regt sich nur noch ein Jungtier, das verzweifelt die Stirn gegen die Flanke der Mutter drückt, um diese wieder aufzurichten. Da ist kein Licht mehr in den dunklen Augen der Mutter. Schneeflocken verkleben die Wimpern. Speere ragen aus dem Leib wie Stacheln.
Die Jäger kommen näher, vier zottelige Schemen im Schnee, Speere und Stangen und Steinschleudern schwenkend. Es sind Zweibeiner, die die Felle von Mammuts tragen.
Einer der Jäger entdeckt das Jungtier zwischen den liegenden Mammuts, ruft und winkt und wirft mit Steinen. Das Mammut läßt von seiner Mutter ab und schnaubt mit drohend erhobenem Rüssel. Es hat noch nicht die majestätischen, zum Kreis gebogenen Stoßzähne der Großen, aber als es jetzt losläuft, stampfend im Neuschnee, weicht der Jäger zurück, ohne den Kampf zu suchen.
Das kleine Mammut blickt sich um, sieht das verzierte Rohr, das der vorderste der Jäger in den Händen hält. Bis auf eine letzte sind jetzt alle Richtungen verwehrt. Das Mammut trompetet und rennt dorthin, wo das Feld noch frei ist. Tief sinkt es ein in den knarzenden Schnee, kämpft sich mit der Brust voran, aber auch die Verfolger sind nicht schneller.
Die Verfolgung währt nur kurz, denn dort endet diese Welt. Ein klaffender Abgrund, in den der Schnee in weiten Spiralen hinunterfegt, ohne jemals Halt zu finden.
Erneut wendet das Mammut sich um. Heiß dampft sein Atem aus dem Rüssel und dem Maul.
Dort kommen die Menschen, Eiszapfen in Haaren und Bart. Der mit dem Rohr setzt es an den Mund und deutet mit dem anderen Ende auf das Mammut.
Das letzte Mammut senkt den Kopf.
Der Sturm geht in ein Bersten über.
Rodraegs Kopf ruckte hoch. Es dauerte einen Moment, bis er sich orientiert hatte.
Eingeschlafen. Über der Schreibarbeit. Im Rathaus.
Er blickte zum kleinen Fenster hinüber. Draußen war es dunkel, mitten in der Nacht. Mit Sicherheit war er jetzt ganz allein im Gebäude. Auch der eifrige Kepuk war schon längst nach Hause gegangen.
Rodraeg streckte sich, rieb sich das Gesicht und warf einen Blick auf das Blatt, das vor ihm auf dem Schreibtisch lag. Der Beginn eines von ihm verfaßten Vorschlages, wie der Bauer Tlech seinen Kuhmist weiterhin verwerten konnte, ohne daß sich sein Grundstücksnachbar, der Seidenmaler Lendely, welcher seinen Morgentee in seinem Garten einzunehmen pflegte, über die Geruchsbelästigung bei Westwind beschweren würde. Niemand sonst im Rathaus wollte sich mit so etwas befassen. »Legt es auf Rodraegs Tisch« war hier ein gefügeltes Wort geworden. Und so landeten sie alle in diesem Zimmer: die kleinen Sorgen und Nöte, die den Leuten in Kuellen ihr ansonsten beschauliches Leben erschwerten.
Rodraeg beschloß, sich selbst einen Tee zu kochen, wenn er sich schon mit den Teegewohnheiten des Seidenmalers herumschlagen mußte. Er stand auf, verließ seinen kleinen, würfelförmigen, mit Dokumenten aller Art vollgestopften Schreibraum und ging im weichen Licht der sorgfältig verteilten Wandöllampen hinüber in die Schreiberküche. Während er auf der Ofenstelle Trinkwasser in einem Topf erhitzte, suchte er unter verschiedenen Teeblattsammlungen eine möglichst anregende heraus und schnupperte an dem Päckchen. Grüne Entgegnung aus Diamandan. Eine Erinnerung an die Sonnenfelder seiner Kindheit durchströmte ihn, und – genau entgegengesetzt und wahrscheinlich genau deshalb – eine Erinnerung an seinen Traum.
Was für ein seltsamer Traum. Mammuts im Schneetreiben, zur Strecke gebracht von Jägern, die kaum zu erkennen gewesen waren.
Wieso Mammuts? Er hatte noch nie von Mammuts geträumt. So viel er wußte, waren sie schon lange ausgestorben. Er hatte eine Zeichnung gesehen, das war noch nicht lange her, hier, im Rathaus, als er einen der Prachtbände in der Bibliothek durchgeblättert hatte, auf die der Bürgermeister so stolz war. Das Bild mußte unterbewußt in ihm fortgearbeitet haben, anders konnte er sich diesen Traum nicht erklären.
Geduldig sah Rodraeg dem Wasser beim Aufkochen zu. Er nahm die schöne Glaskanne aus Fairai, schüttete behutsam dunkelgrüne Teespitzen in den ebenfalls gläsernen Siebeinsatz, und füllte die Kanne mit kochendem Wasser. In Gedanken zählte er die drei Sandstriche, die er den Tee ziehen lassen durfte, entnahm dann das Glassieb und schnupperte befriedigt brummend an seinem gelungenen Werk. Er nahm sich ein Täßchen vom Regal und kehrte mit der vollen Kanne in seine Stube zurück.
Seufzend blätterte er die anderen Notizen durch, die er heute nacht noch bearbeiten wollte. Der Bauer Pargo Abim hatte schon wieder ein Maulswurfsproblem. Wie jedes Jahr. Wie jedes Jahr war auch in diesem Jahr der beste Mann, dieses Problem zu lösen, Jerik Trinz aus der Ortschaft Findel. Findel lag zwei Tagesreisen entfernt. Wie jedes Jahr verlangte Jerik Trinz eine Entschädigung für seine insgesamt viertägige Reise nach Kuellen und zurück, und wie jedes Jahr fragte Bauer Pargo Abim im Rathaus nach, ob der Schulze nicht bereit sei, im Interesse Kuellens einen Teil dieser Entschädigung aus der Stadtkasse beizusteuern. Wie jedes Jahr bestand Rodraegs Aufgabe nun darin, die Bitte des Bauern abschlägig zu bescheiden, ohne den Bürgermeister allzu knauserig wirken zu lassen. Außerdem lagen hier noch eine Notiz vom jungen Schreiber Reyren, der die Unterlagen über den letztjährigen Brückenbau nicht finden konnte, mit der Bitte, ob Rodraeg sie ihm nicht auf das Pult legen könne, eine Mahnung vom Händler Hinnis, der zum wiederholten Male darauf hinwies, daß seine letzte Lieferung von Tonblumentöpfen ans Rathaus immer noch nicht bezahlt worden war, sowie eine Anfrage vom Kjeer-Tempel zu Warchaim, ob Kuellen im Frühjahr an einer rituellen Ackersegnung interessiert sei. Zu guter Letzt wollte die Wirtin vom Treuen Eselchen einen Vers für ihre Textsammlung bekommen, vom Bürgermeister eigenhändig gedichtet. Wie jedes Jahr würde sie ein Gedicht aus Rodraegs Feder erhalten, mit Müh und Not gereimt, aber vom Bürgermeister schwungvoll unterzeichnet.
Rodraeg goß sich eine Tasse Grüne Entgegnung ein und beschloß, das leidige Dichten auf morgen oder übermorgen zu verschieben. Ebenso die Mahnung des Tonkrughändlers. Erledigen konnte er in dieser Nacht allenfalls den Kuhmist, den emsigen Maulwurf und die Kjeer-Priester. Für solche Riten hatte der Bürgermeister nie Geld übrig, Kuellen war während seiner Amtszeit ein von den Göttern regelrecht verlassenes Örtchen geworden.
Zuerst aber sollte er für Reyren die Brückenbau-Unterlagen suchen, so lange er zumindest noch eine ungefähre Ahnung hatte, wo sie stecken konnten. Für alles, was mit dem Fluß Larnus und seinen drei Quellen zusammenhing, die dem Ort Kuellen seinen überlieferten Namen gaben, war der Schreiber Yornba zuständig, und der greise Yornba pflegte aufgrund seiner Unbeweglichkeit alle möglichen Unterlagen in seiner Stube zu horten, ohne sie wieder an ihren eigentlichen Platz zurückzubringen.
Rodraeg nahm die Tasse einfach mit. In Yornbas Stube forstete er eine gute Viertelstunde nach der Brückenmappe und fand sie schließlich unter einem Stapel von Larnwaldkarten. Zwischendurch genehmigte er sich den Tee und spürte, wie er langsam wieder munterer wurde.
Auf dem Rückweg zu seiner Stube kam ihm ein Gedanke. Mit der leeren Tasse in der Hand und der Brückenmappe unterm Arm durchquerte er das nächtlich stille Gebäude, ging die hölzerne Treppe ins Obergeschoß hinauf und betrat die kleine Bibliothek.
Hier stellte er die Tasse auf einen Tisch, legte die Brückenmappe daneben, entzündete mit einem langen Schwefelholz die drei Kerzen eines Leuchters und ging mit dem Leuchter in der Hand auf die Suche nach der Bebilderthen Encyclica unserer Thierwelt. Er fand das Buch und beschloß, es in seine Stube mitzunehmen, um bei einem weiteren Täßchen Tee darin zu stöbern. Er sammelte seine Sachen zusammen, pustete die Kerzen aus und ging wieder nach unten. Unterwegs überprüfte er, ob Kepuk die Haupteingangstür auch abgeschlossen hatte. Rodraeg legte die Brückenmappe auf Reyrens Stehpult und ging dann in seine Stube zurück.
Mit einer zweiten Tasse Tee suchte er dann in der Encyclica nach den Mammuts.
Die Encyclica war ein aufwendig gedrucktes Exemplar, Auflage zweihundert Stück. Die Bilder waren schwarz-weiße Zeichnungen, reproduziert in einem Verfahren, das nach Rodraegs Kenntnis erst vor etwa zwanzig Jahren erfunden worden war. Jedenfalls ein äußerst wertvolles Exemplar, berechtigterweise Augenstern des Bürgermeisters.
Die Tierwelt des Kontinents war hier alphabetisch geordnet. Ganz vorne standen Affen, gefolgt von den Affenmenschen, von denen einige behaupteten, sie seien Menschen ähnlicher als Tieren, könnten sprechen und würden Kleidung tragen und herstellen. Aber die Bilder in der Encyclica wiesen sie als wilde, reißzahnbewehrte Ungeheuer aus. Danach gab es etliche Seiten über Bären wie den gewaltigen Ogerbären, über die verschiedenen Drachenarten, von denen Rodraeg auf seinen Reisen einen Federflügeldrachen und einen Glutdrachen sogar schon mit eigenen Augen gesehen hatte, mehrere Seiten über Echsen und eine besonders schön bebilderte über ein gepanzertes, kräftiges Einhorn. Danach kamen Fische, Flederwesen, Grufträuber, Höhlentiere, Hunde, Insekten, Katzenartige, Kobolde, Krakenmonster, Krebse, Lurche und Mammuts.
Hier stand als erstes: Ausgestorben.
Der Text war nicht sehr ergiebig. Man hatte Skelette gefunden und zwei vollständig erhaltene, mumifizierte Mammuts in einer Teergrube im Wald von Thost, viel mehr wußte man nicht. Aber die Zeichnung war großartig: Ein gewaltiges, zottiges Tier mit Rüssel und Stoßzähnen, die zu beinahe geschlossenen Kreisen gewachsen waren; um seine Füße herum rannte lachhaft und unbedeutend eine kleine Horde von Jägern mit Speeren.
Dieses Bild hatte Rodraeg geträumt, wenn auch nicht ganz. Er hatte vor allem ein Jungtier gesehen, ein Mammutkind, das hier nirgendwo verzeichnet war. Auch hatten die Jäger in seinem Traum anders ausgesehen. Einer von ihnen hatte etwas Merkwürdiges in Händen gehalten, aber Rodraeg konnte sich nicht mehr erinnern. Je fester er den Traum zu fassen suchte, desto mehr verflüchtigte er sich.
Er trank den letzten Schluck aus seiner Tasse. Gedankenverloren blickte er vor sich hin. Nur langsam stellte sich sein Blick ein auf das Fenster, auf die Spiegelung des Schreibleuchters darin, auf sein eigenes vor dem Dunkel der Nacht schwebendes Gesicht – und die vermummte Gestalt dahinter.
Rodraeg fuhr herum.
Hinter ihm in der Schreibstubentür stand jemand. Eine zierliche Gestalt in einem langen dunklen Mantel, das Gesicht von einer Kapuze vollständig überschattet. Das konnte doch nicht sein! Die Tür war abgeschlossen gewesen!
»Entschuldigt bitte, ich wollte Euch nicht erschrecken. Ihr seid Rodraeg Talavessa Delbane, nicht wahr?«
Rodraeg war völlig überfordert. Zu viele Eindrücke auf einmal stürmten auf ihn ein. Die Stimme der Gestalt war weiblich, wohlklingend und freundlich, was der Situation immerhin die Bedrohlichkeit nahm. Das erklärte jedoch noch nicht, wie die junge Frau hier hereingekommen war, geschweige denn, woher sie Rodraegs zweiten Vornamen kannte, den er – soweit er sich entsinnen konnte – hier in Kuellen noch nie jemandem genannt hatte.
Ihm ging durch den Kopf, etwas so Törichtes zu sagen wie: »Im Moment ist im Rathaus keine Sprechstunde«, aber es war ziemlich unwahrscheinlich, daß dies der Frau nicht bewußt war. Statt dessen waren die ersten Worte, die er an sie richtete: »Ihr seid nicht von hier?«
»Das ist richtig«, sagte die junge Frau und streifte ihre Kapuze zurück. »Mein Name ist Naenn, und ich komme ursprünglich aus dem Schmetterlingshain.«
Sie war jung, vielleicht zwanzig. Weizenfeldfarbene Haare, dunkle, große Augen. Bleich und ernst. Von einer Schönheit, die nicht viel Aufhebens machte darum, daß sie selten war.
Ein Schmetterlingsmädchen. Rodraeg hatte viel von den Schmetterlingsmenschen gehört, lebten sie doch auch hier, im großen, dunklen Wald von Larn, an dessen südöstlichen Ausläufern der Larnus entsprang und die Gründer von Kuellen sich angesiedelt hatten. Die Schmetterlingsmenschen waren eine Legende, ein Märchen. Man sagte, sie könnten zaubern und auf Sonnenstrahlen wandeln. Sie seien schön und voller Poesie, und das Herz eines Jünglings, der vom Weg abkam und einem Schmetterlingsmädchen begegnete, sei auf immer verloren. Man sagte, es gäbe mittlerweile nur noch wenige von ihnen, vielleicht einhundert, verborgen und verbunden mit der Unergründlichkeit des großen, dunklen Waldes von Larn.
Man sagte auch, sie hätten die Schwingen von Schmetterlingen, die Stimmen von Singvögeln und die Macht, Gedanken wahr zu machen.
Rodraeg brachte im Moment nicht mehr als ein verlegenes Schmunzeln zustande. »Ich … kann Euch einen Tee anbieten. Er ist nicht mehr ganz heiß, aber ich könnte auch einen neuen machen.«
»Ich nehme gern von dem hier, wenn es keine Umstände macht.«
»Gut, dann … setzen wir uns doch draußen in die Wartehalle. Hier drin ist es zu ungemütlich.«
»Es ist eigentlich eine schöne Idee, daß nachts im Rathaus so viele Lampen brennen. Man kann das Gebäude von draußen leicht finden.«
»Ja.« Rodraeg räusperte sich, legte die Encyclica auf seinen Schreibtisch, nahm Glaskanne und Tasse und ging an ihr vorbei aus dem Raum. Naenn duftete ähnlich den Wildrosen im Privatgarten des Bürgermeisters. Rodraeg war froh, ein harmloses Thema zum Plaudern angeboten zu bekommen. »Die offizielle Version lautet, daß der Bürgermeister wünscht, daß das Rathaus nachts leuchtet, damit die Bürger von Kuellen sehen können, daß hier Tag und Nacht zu ihrem Wohl gearbeitet wird. Die Wahrheit jedoch ist, daß der Bürgermeister nicht wünscht, daß ein schlaftrunkener, überarbeiteter Schreiber hier nachts mit einem Kerzenleuchter aus Versehen die Wandteppiche in Brand steckt, die überall herumhängen.«
»Verstehe.« Sie lächelte freundlich.
Rodraeg schlüpfte in die Schreiberküche, angelte sich eine zweite Tasse und ging dann voran zur Eingangstür. Hier war die Empfangshalle des Rathauses, auch nicht besonders gemütlich, aber es gab wenigstens mehrere Sessel, die man um Tische herum beliebig anordnen konnte. Die wirklich behaglichen Räume waren dem Bürgermeister und seinen handverlesenen Gästen vorbehalten und nachts selbstverständlich abgeschlossen.
Als Rodraeg ihr einschenkte, fiel sein Blick auf die Eingangstür.
»Sie war offen«, sagte Naenn, wie um seine Gedanken zu beantworten, und schaute ihn prüfend an.
»Schon möglich«, sagte er, und konzentrierte sich darauf, zwei Sessel so zu verschieben, daß sie sich bequem gegenübersetzen konnten. Natürlich war das nicht möglich. Er hatte erst wenige Sandstriche vorher kontrolliert, daß die Tür abgeschlossen war. Aber dies hier war ein Schmetterlingsmädchen, sie konnte auf Sonnenstrahlen wandeln und gewiß auch auf denen des Mondes durch ein Schlüsselloch.
Er fühlte sich gewöhnlich und unzulänglich, als sie seinen Tee kostete und auf höfliche Art und Weise anerkennend nickte.
Dann stellte sie die Tasse ab und kam mit großem Ernst zur Sache.
»Ich bin schon seit einiger Zeit auf der Suche, Herr Delbane. Ich habe den Auftrag erhalten, einen Mann oder eine Frau zu finden, der oder die in der Lage ist, eine schwierige und gefährliche Mission zum Wohle des gesamten Kontinents zu leiten. Eine Mission, die wahrscheinlich mehrere Jahre dauert und nicht besonders gut entlohnt wird.«
»Aha.«
»Es geht darum, eine Gruppe von Menschen zu bilden und anzuführen, die in verschiedenen Brennpunkten kontinentaler Ereignisse eingreifen kann und versucht, eine Art Gleichgewicht wiederherzustellen, das im Begriff ist, verlorenzugehen.« Sie stutzte. »Das hört sich alles sehr geschwollen und undurchsichtig an, nicht wahr?«
»Keine Ahnung«, gab Rodraeg unumwunden zu. »Kann es sein, daß es noch einen anderen Rodraeg Talavessa Delbane gibt, und Ihr hier vor dem Falschen sitzt?«
»Wie kommt Ihr darauf?«
»Durch alles, was Ihr sagt. Ihr seid auf der Suche nach einem Helden mit unbegrenzter Zeit, der noch dazu Menschen führen und von frischer Luft leben kann. Nichts von alledem trifft auf mich zu. Ich bin kein Held, bin beruflich vollständig eingebunden, bin lieber ein Gehilfe als ein großer Anführer und brauche einen Mindestlohn, um mich über Wasser halten zu können. Ihr könnt unmöglich mich meinen, das glaube ich nicht.«
Das Schmetterlingsmädchen schloß die Augen und atmete tief durch. »Aber Ihr seid der letzte, der noch übrig ist.«
»Der letzte, der noch übrig ist? Wovon?«
»Von den Personen auf meiner Liste. Wenn Ihr es nicht seid, müßte ich wieder von vorne anfangen, und dazu habe ich – ehrlich gesagt – die Kraft nicht mehr und auch nicht mehr die Zeit.«
»Das ergibt noch immer keinen Sinn für mich.«
»Ich weiß. Vergebt mir. Ich bin müde und – hoffentlich – am Ende einer langen Reise. Ich falle mit der Tür ins Haus und verschrecke Euch dadurch, Eure Reaktion ist sehr verständlich. Vielleicht gestattet Ihr mir, langsam zu erzählen, Punkt für Punkt, um klarzustellen, wie ich auf Euch gekommen bin.«
»Ja, das wäre hilfreich.«
Sie holte erneut tief Luft. Sie tat ihm leid jetzt, sah tatsächlich müde aus, wie ein Kind mit Sorgenfalten auf der Stirn. Wer hatte sie bloß losgeschickt mit einer solchen Bürde?
»Ich wurde beauftragt«, begann sie, »in der Hauptstadt, von einer geheimen Organisation, die sich selbst Der Kreis nennt. Mein Auftrag lautete: Finde eine Person, der wir die Leitung einer Einsatzgruppe anvertrauen können. Da ich selbst aus der Abgeschiedenheit des Schmetterlingshains stamme, hatte ich natürlich keinerlei Anhaltspunkte, wer da in Frage kommen würde oder an wen ich mich hätte wenden können. Deshalb gab Der Kreis mir eine Liste mit fünf Namen. Fünf Kandidaten, die Der Kreis für vielversprechend hielt. Ich erhielt genügend Taler und drei Monde Zeit, um die fünf Personen auf dieser Liste aufsuchen und fragen zu können.
Begonnen habe ich mit den beiden Personen, die in der Hauptstadt wohnen. Die erste war ein in den Ruhestand gegangener General der königlichen Armee, der sich in seiner aktiven Zeit einen Namen gemacht hatte dadurch, daß er vermeidbare Kampfhandlungen tatsächlich vermied und ein viel größeres Augenmerk auf Diplomatie und Bündnisfähigkeit legte, als dem damaligen König recht war. Leider mußte ich feststellen, daß dieser General mittlerweile zu alt und auch zu krank geworden war, um noch mit einer dermaßen schwierigen Aufgabe betraut werden zu können.
Die zweite Person war jemand, den Ihr gut kennt: Baladesar Divon.«
»Baladesar!«
Naenn vermerkte das Aufleuchten in Rodraegs Augen. »Herr Divon lehnte die Aufgabe bedauerlicherweise aus familiären Gründen ab.«
»Das kann ich mir gut vorstellen. Da ist er eisern. Wie geht es ihm denn?«
»Habt Ihr denn keinen regelmäßigen Kontakt?«
Rodraeg kratzte sich das Kinn. »Naja – wie das nun einmal so ist: Ich arbeite als Schreiber, da kommt man privat nicht viel zum Schreiben. Das finde ich ja großartig. Baladesar war auf Eurer Liste.«
»Ja. Wegen seiner politischen Aktivitäten.«
»Ich weiß. Sein Ehrgeiz, der Königin und ihrem Beraterstab noch so etwas wie einen vom Volk gewählten Senat zuzuordnen. Eine Idee, die anfangs verrückt klang, aber im Laufe der Jahre immer mehr an Hand und Fuß gewann. Aber er würde nicht mehr losziehen, um die Welt zu retten, das stimmt. Er hat eine wunderbare Frau, zwei wunderbare Töchter und ein wunderbares Haus.«
»Ich war dort. Die Architekur ist sonnenfeldisch.«
»Wir stammen von dort.«
»Jedenfalls war er der einzige auf meiner Liste, der mein Gesuch ablehnte.«
»Der General nicht?«
»Nein.« Sie senkte beschämt den Kopf. »Ich habe ihm gar nicht alles erzählt, als ich seinen Zustand sah. Es hätte keinen Sinn gehabt. Nun ja. Um die Sache etwas kürzer zu machen: Die dritte Person auf meiner Liste war ein junger Bergführer aus dem Targuzwall. Er wurde mir von einem der Mitglieder des Kreises ausdrücklich ans Herz gelegt. Leider stellte sich heraus, daß dieser Bergführer weitaus mehr an mir interessiert war als an dem, was ich ihm erzählte. So kann man natürlich nicht arbeiten.«
Rodraeg straffte sich unwillkürlich. »Natürlich nicht.«
»Bei Person Nummer Vier hatte ich ebenfalls kein gutes Gefühl. Sie war eine Frau, eine Verfasserin von Elendsviertelberichten aus der Hafenstadt Chlayst. Sehr klug, sehr energisch, sehr organisationsbegabt und wortgewandt – leider aber vollkommen königinnentreu. Sie schiebt alle Probleme des Kontinents den vergangenen Königen in die Schuhe und hält unsere jetzige Königin für von den Göttern gesandt. Sogar den geplanten Feldzug gegen die Affenmenschen befürwortete sie! Da hat es doch gar keinen Sinn … mit ihr eine Gruppe zu gründen, die unter Umständen auch einmal gegen Gebote der Königin verstoßen muß, um Ergebnisse zu erzielen.«
»Hm. Schade. Und da wäre auch mit Kompromissen nichts zu machen gewesen?«
»Die Frau, von der ich spreche, wirkt ziemlich kompromißlos. Das kann eine gute Eigenschaft sein, in unserem Falle hilft sie uns allerdings nicht weiter. Was haltet Ihr eigentlich von dem Affenmenschenfeldzug?«
Rodraeg lachte auf. »Oha. Wenn ich jetzt mit tiefer Stimme antworte: ›Dieses Affengeschmeiß muß weg!‹, dann ist unsere Unterredung blitzschnell beendet, stimmt’s?«
Zum ersten Mal zeigte sich auch auf Naenns Zügen die Andeutung eines Lächelns, das nicht nur Höflichkeit war. »Gut möglich.«
»Dann laßt mich wahrheitsgemäß antworten: Ich erlaube mir in dieser Angelegenheit kein Urteil. Ich weiß, daß menschliche Siedler in den Grenzgebieten der Felsenwüste immer wieder von marodierenden Affenmenschenhorden überfallen werden. Ich weiß aber auch, daß es menschliche Räuberbanden gibt, die in die Gebiete der Affenmenschen vordringen, um dort vermeintlich leichte Beute zu machen. Wenn ich auf eine Landkarte schaue, sehe ich, daß das Gebiet der Affenmenschen ungeheuer groß ist, und ich kann mir vorstellen, daß die Königin dies als störend empfindet. Wenn es also ein Konflikt ist, der lediglich um Land oder um Ruhm geführt wird oder um Rechthaberei oder darum, welcher Regent in seiner Zeit die schlagkräftigste Armee aufstellen konnte, dann habe ich keinerlei Sympathie für diesen Feldzug. Vielleicht geht es aber auch um mehr, um etwas, das meinen Kleinstadtaugen verborgen bleibt, und deshalb erlaube ich mir kein Urteil.«
Das Schmetterlingsmädchen ließ seine Worte auf sich wirken. »Eine gute Antwort. Kommen wir nun zu Euch.«
»Stimmt. Aus unerfindlichen Gründen muß meiner der fünfte Name auf Eurer Liste sein.«
Sie überraschte ihn mit einem: »Nein. Der fünfte und letzte Name auf meiner Liste lautete Dar Seaf, ein legendärer Abenteurer aus den Klippenwäldern. Ich habe seine Fährte und die Ruhmesspur seiner Taten beinahe zwei Monde lang verfolgt, bis ich erfuhr, daß Dar Seaf letztes Jahr bei einem Handgemenge in einem Stall in Fairai von einem Stallknecht totgeschlagen wurde. Eine kleine, unbedeutende Tragödie. Ich war zu spät gekommen. Betrübt kehrte ich in die Hauptstadt zurück, um dem Kreis mein Versagen einzugestehen. Auf dem Weg dorthin kam ich am Haus von Baladesar Divon vorbei. Einer plötzlichen Eingebung folgend, suchte ich ihn in seinem sonnendurchfluteten Innenhof auf und sagte ihm, daß er, da er der einzige von meiner Liste gewesen war, der von sich aus abgelehnt hatte, das Recht habe, jemand anderen nachzunominieren. Er überlegte kurz und erzählte mir dann die Geschichte von Rodraeg Talavessa Delbane.«
Rodraeg legte mit einer langsamen Bewegung die Hände vors Gesicht. Er ahnte, daß jetzt Lobhudeleien auf ihn zukommen würden, und er wollte verbergen, wie peinlich ihm das war.
Das Mädchen aus dem Schmetterlingshain brauchte keine Notizpergamente, um seine Lebensdaten aufzusagen. »Rodraeg Talavessa Delbane, geboren im Regenmond des Jahres 645 nach der Königskrone, also vor siebenunddreißig Jahren, als Sohn von Esair Delbane und seiner Frau Lanur im Dorf Abencan in einem Landstrich, den die Menschen die Felder der Sonne nennen. Der Vater Esair besaß Tabakpflanzungen und war einigermaßen wohlhabend, der Junge wurde deshalb von Privatlehrern unterrichtet und lernte Lesen, Schreiben, Rechnen, Musizieren, Fechten, Reiten, Malerei und Poesie. Mit zwanzig Jahren verließ Rodraeg das elterliche Gut und zog mit seinem Jugendfreund Baladesar Divon drei Jahre lang als freier Abenteurer durch den Kontinent, bis beide in der Hauptstadt Aldava in einer kleinen Kanzlei als Gehilfen anfingen. Die Kanzlei hatte sich auf die Vertretung von nicht sehr wohlhabenden Bürgern vor dem königlichen Gerichtshof spezialisiert, und Rodraeg und Baladesar erhielten hier eine umfangreiche Ausbildung, wurden Schreiber, Sekretär, Buchhalter, Notar, Ermittler – alles in einem. Rodraeg blieb sechs Jahre in Aldava, bis ihn ein Brief seines Vaters heimrief in die Sonnenfelder. Dort hatte es inzwischen drei Jahre hintereinander eine große Trockenheit gegeben, und den Tabakpflanzungen der Familie Delbane drohte der Ruin. Rodraeg kehrte heim, verwaltete und verkaufte nach und nach den Familienbesitz, bis zwar die Felder nicht mehr den Delbanes gehörten, seinen Eltern jedoch zumindest ein sorgenfreies Leben im Alter gewährleistet war. Alles in allem verbrachte Rodraeg so noch einmal zwei Jahre in den Sonnenfeldern. Dann, mit nunmehr einunddreißig Jahren, wollte Rodraeg nicht mehr nach Aldava zurück. Baladesar hatte mittlerweile geheiratet und war Vater geworden, Rodraeg dagegen zog es wieder in die Unbestimmtheit. Er nahm an einem großen Ritterturnier in Endailon teil, arbeitete eine Zeitlang als Schreiblehrer für Kinder und Erwachsene in der Provinz Hessely und fand schließlich Anstellung im Rathaus von Kuellen, sozusagen als rechte Hand des Bürgermeisters. Diesen Beruf übt er zwar jetzt seit über fünf Jahren aus, aber er wohnt immer noch in einem Gasthaus, dem Quellenhof. Soweit alles richtig?«
»Naja, bis auf ein paar geschönte Formulierungen. Die drei Jahre, die Baladesar und ich als ›freie Abenteurer‹ verbrachten, bestanden im großen und ganzen aus Frieren, Hungern, Stallausmisten, Kühemelken und Weglaufen vor irgendwelchen Straßenräubern und Untieren. Die ›umfangreiche Ausbildung‹, die uns der selige Advokat Hjandegraan hat angedeihen lassen, lautete: ›Seht zu, daß ihr euch nützlich macht, ihr Hundejungs.‹ Das große Ritterturnier in Endailon war für mich eine Abfolge von spektakulären Stürzen und spektakulärem Verdroschenwerden. Über meine Zeit als Dorflehrer will ich nie mehr sprechen. Das war einfach nur schrecklich. Und daß ich die ›rechte Hand‹ des Bürgermeisters bin, würde den Schreiber Kepuk wohl sehr treffen, denn eigentlich ist er der Hauptschreiber hier und somit die ›rechte Hand‹ des Meisters.«
Naenn lächelte mitfühlend. »Jedenfalls: Nachdem der Herr Divon mir dies alles erzählt hatte, stand mir ein recht deutliches Bild vor Augen: das Bild eines Mannes, der über viele Fertigkeiten verfügt. Der Menschen für sich einnehmen kann, ohne sich dabei in den Mittelpunkt zu drängen. Der schwierige Aufgaben in Angriff nimmt und löst. Der gerne für andere da ist, wenn sie ihn brauchen. Der aber immer noch unstet ist, weil er das Richtige, die eine Aufgabe, die ihn voll und ganz in Anspruch nehmen und all seinen Eigenschaften und Talenten das höchste abverlangen würde, nie gefunden hat. Der an seinen spärlichen freien Tagen in den Larnwald geht und dort mit seinem alten Säbel herumfuchtelt, um nicht aus der Übung zu geraten. Das hat mir die Wirtin vom Treuen Eselchen erzählt, als ich heute abend dort abgestiegen bin und sie gefragt habe, ob sie Euch kennt. Und sie hat auch gesagt: ›Der Herr Delbane, das ist jener wertvolle Mensch, der seit fünf Jahren jedes Jahr ein schönes Gedicht für meine Sammlung verfaßt und es vom Bürgermeister unterschreiben läßt, damit ich nicht merke, daß der Bürgermeister nichts weiter als ein Aufschneider ist‹. Und sie hat mir das letzte Gedicht gezeigt, das Ihr für sie geschrieben habt.«
»Ach, du meine Güte!«
»Es war tatsächlich unglaublich schlecht.«
Sie sahen sich an – und mußten dann beide lachen. Naenn wurde schnell wieder ernst, als befürchtete sie, daß ein Lachen ihrer schweren Mission nicht angemessen wäre.
»Ihr seid kein Dichter, Herr Delbane. Ihr seid auch kein Schreiber, kein Sekretär, kein Abenteurer und kein Turnierritter. Ihr seid etwas Besonderes, und ich bin froh, daß ich Euch endlich gefunden habe.«
Rodraeg fühlte sich mittlerweile sehr unwohl. Für seine Begriffe wurde hier deutlich zuviel Aufhebens um seine Person gemacht. »Ihr«, begann er stockend, »Ihr dürft mir nicht zuviele Leistungen gutschreiben, die ich gar nicht erbracht habe. Die Sache mit den Gedichten ist einfach nur mein Beruf. Für so etwas werde ich hier bezahlt. Und daß ich damals nach Hause mußte, um das Gut meines Vaters zu veräußern, das paßte mir gar nicht. Ich glaube, ich war zwei Jahre lang schlechter Laune und habe keine Gelegenheit ausgelassen, meine Eltern spüren zu lassen, daß sie mich mit ihren wirtschaftlichen Nöten von einer großartigen Laufbahn in der Hauptstadt abhielten.«
Naenn seufzte. Es war ein bezauberndes Seufzen. Rodraeg ärgerte sich augenblicklich über sich selbst. Sein Versuch, bescheiden zu wirken, war auch eine Form von Eitelkeit, weil er Naenn dadurch zwang, ihn immer weiter zu loben. Er strapazierte dieses Mädchen über Gebühr, und das tat ihm leid.
»Ich könnte noch einen frischen Tee kochen«, schlug er hilflos vor.
»Nein danke.« Sie hatte ihre Tasse gleich abgestellt und danach nicht mehr angerührt. »Es ist schon sehr spät. Oder früh, sollte man besser sagen. Ich denke, wir beide sind sehr müde. Hat dieses Rathaus eine Sonnenuhr?«
»Ja.«
»Dann treffen wir uns morgen vormittags um elf auf dem Rathausplatz.«
»Aber ich muß arbeiten.«
»Ich bitte Euch zu kommen. Ich akzeptiere kein einfaches ›Nein‹, Herr Delbane, denn ich möchte keine Schuld daran tragen, daß Ihr die größte Chance Eures Lebens einfach so verpaßt.«
Tausend Einwände gingen Rodraeg durch den Kopf. Der Kuhmist. Der Maulwurf. Die Priester. Die Mahnung des Tonkrughändlers. All das, was heute nacht unerledigt liegengeblieben war sowie das, was morgen dem Leitsatz ›Legt es auf Rodraegs Tisch‹ unterworfen werden würde. Ein neues Gedicht für die Wirtin. Ein neues schlechtes Gedicht für die Wirtin, die längst alles durchschaut hatte. »Also gut. Dann morgen um elf. Soll ich meinen alten Säbel mitbringen?«
»Das wird nicht nötig sein.« Naenn erhob sich, er tat es ihr nach. Artig gaben sie sich die Hand. Ihre Hand war klein und warm und fühlte sich wie Blütenblätter an. »Also, dann bis morgen, Herr Delbane. Ich wünsche Euch eine angenehme Nachtruhe.«
»Ich Euch auch.«
Sie ging zur Tür und öffnete sie. Tatsächlich nicht abgeschlossen. Rodraeg war sich sicher, daß sie abgeschlossen gewesen war, aber eine allzu große Rolle spielte das nun auch nicht mehr. »Ach, eines noch«, sagte sie mit der Klinke in der Hand. »Ihr habt vorhin von einem Mammut geträumt, nicht wahr?«
»Woher wißt Ihr das?«
»Wir aus dem Schmetterlingshain haben manchmal die Gabe, die Träume von Menschen zu sehen. Manchmal. Es gibt nicht mehr viele Menschen heutzutage, die von Mammuts träumen.«
»Ich habe ein Bild gesehen, in einem Buch. Aber mein Traum war anders als das Bild. Das Bild zeigt ein erwachsenes Mammut, ich jedoch träumte von einem Jungtier.«
Naenn lächelte rätselhaft. »Ihr habt von einem Kind geträumt. Von einem ausgestorbenen Kind. Ein Teil von Euch bedauert, daß es keine Mammuts mehr gibt. Ich freue mich darüber. Gute Nacht.«
Sie schloß die Tür, und Rodraeg blieb allein im Rathaus zurück.
»Gute Nacht«, sagte er zu den Lampen, den Sesseln und den Wandteppichen.
Wie seltsam es doch war, mit einer Fremden einen Traum zu teilen.
2
Quellen hell
In dieser Nacht fand Rodraeg kaum noch Schlaf. Je mehr er sich bemühte zu ermüden, desto wacher wurde er.
Wie unwirklich ihm alles vorkam. Traumähnlich. Vielleicht lag er in Wirklichkeit nicht im Bett seines Zimmers im Quellenhof, sondern saß immer noch vornübergesunken an seinem Schreibtisch im Rathaus und träumte von duftenden Schmetterlingsmädchen, die ihn bei der Hand nahmen und hineinführten in den tiefen unbekannten Wald.
Rodraeg dachte über sein Leben nach. Die vielen verpaßten Gelegenheiten.
Das Geschäft seines Vaters zu übernehmen und fortzuführen und ein wohlhabender Mann in den Sonnenfeldern zu werden. Dankend verzichtet, weil es ihm zu langweilig vorkam. Der Schmerz darüber, seinen Sohn weggehen zu sehen, hatte den Vater Delbane so schwer getroffen, daß er später der großen Dürre nichts mehr entgegenzusetzen hatte.
Dann die Abenteurerlaufbahn. Im Sande verlaufen, weil weder er noch Baladesar mutig und skrupellos genug gewesen waren, sich mit einer Waffe in der Faust ein eigenes Glück zu schmieden.
Der Beruf in der Hauptstadt. Bei der ersten sich bietenden Gelegenheit fallengelassen. Geflüchtet. Auch vor Baladesars sich anbahnendem Familienglück. Mehr Fesseln, mehr Ketten. Ihr habt von einem Kind geträumt, hatte Naenn gesagt. Das stimmte nicht. Das hatte er noch nie.
Statt dessen eine Flucht nach vorn: das Turnier von Endailon. Der Traum von einer wirklich großartigen Tat. Ein Versuch, alles niederzureißen und aus den Trümmern etwas Neues zu schaffen. Vorbereitungen wie ein Berufsgladiator. Das Wiederentdecken von Muskeln und Balance. Doch gescheitert, weil zu viele der anderen Träumer einfach stärker waren.
Die kurze Zeit als Lehrer. Kreischende Lausebengel und Erwachsene, die selbst des Sprechens kaum mächtig waren. Auf verlorenem Posten in einer vergessenen Gegend zwischen Kjeerklippen, Felsenwüste und den finstersten Schründen des Larnwaldes.
Schließlich Kuellen. Erträglich, weil überschaubar und dabei nie vollkommen vorhersehbar. Man konnte sich einarbeiten in ein immer wiederkehrendes Mühlrad aus Sorgen und Begehrlichkeiten und tatsächlich Ergebnisse erzielen, schon mit kleinen Tricks und Umgewichtungen. Die Tatsache, daß ein anderer für alles die Verantwortung trug und auch den Ruhm einheimste, war Rodraeg immer eher angenehm als lästig gewesen.
Und jetzt das. Ein Märchenwesen schwebte durch eine verschlossene Tür zu ihm hinein in die Nacht und wollte ihn entführen, auf eine Queste, die mehrere Jahre dauern würde, zum Wohle des gesamten Kontinents und – wenn es sein mußte – gegen die Königin. Worum es dabei eigentlich genau gehen sollte, hatte Naenn vergessen zu erwähnen. Oder absichtlich verschwiegen. Oder er hatte vergessen, danach zu fragen, viel zu sehr damit beschäftigt, die leuchtenden Farben abzuschwächen, in denen sie sein Leben malte.
Vielleicht hatte er auch gar kein Recht zu fragen. Er würde bezahlt werden und hätte seinen Auftrag zu erfüllen, ohne sich Gedanken zu machen, ohne zu hinterfragen. Rodraeg, der Söldner.
Die Bezeichnung der Auftraggeber als »Geheimorganisation«, die angestrebte Ausbildung von weiteren Mitstreitern sowie die seltsamen Kandidaten auf Naenns Liste – ein unbequemer General, eine Bezeugerin von Notständen, ein kraxelnder Naturbursche und ein unabhängiger Abenteurer – ließen auf so etwas wie einen gewaltsamen Umsturz schließen. Gegen die Königin. Zum Wohle des Kontinents.
Aber andererseits – Baladesar?
Baladesar würde niemals an heimlichtuerischen Gewaltakten mitwirken. Er trug immer alles, was er tat, ins volle Licht. Der geborene Advokat. Sein Auditorium war jeder, der bereit war zuzuhören.
Der Kreis mußte das wissen. Jemanden wie Baladesar würden sie für einen Direktangriff auf den Thron nicht haben wollen. Und auch nicht einen General, der den Frieden schätzte. Oder einen Bergführer. Oder einen Rathausschreiber aus Kuellen.
Vielleicht durfte Naenn gar nicht erklären, worum es ging.
Vielleicht konnte Rodraeg aber auch nicht verstehen, worum es ging, bevor er sich nicht darauf einließ, und sie wußte das.
Als der Morgen sein Zimmer im Quellenhof in Ahnungen von Licht tauchte, setzte Rodraeg sich auf die Bettkante und sah sich um.
Ein möbliertes Zimmer mit Bett, Schrank, Kommode, Tisch und Stuhl, in dem beinahe nichts ihm selbst gehörte. Kleidungsstücke, die in einen einzigen Seesack passen würden. Sein Säbel mit der abgewetzten Scheide. Ein Notizpergamentbuch mit verworfenen Tagebuchskizzen, ein paar Gedichten und Schilderungen einiger Larnwaldwanderungen. Zwei echte Bücher, mehr nicht, weil das Rathaus über eine recht gute Bibliothek verfügte. Das Schwert im Baum, der Lebensroman eines Abenteurers namens Korengan, der im Wald von Thost aufgewachsen war und später den ganzen Kontinent durchwandert hatte. Und ein schmales Lyrikbändchen mit dem Titel Je weiter das Wasser – Gedichte von einem jungen Aldavaer Poeten namens Jit Ellnend. Darunter Rodraegs Lieblingsgedicht:
Erinnerst du dich noch
an alles
was anklang?
War alles
von echtem Belang?
Es nähert sich doch
jedes Ende
dem Anfang,
je weiter
du folgst
dem Gesang.
Außerdem besaß er noch Rasierzeug, ein Messer, ein Kästchen mit einem Zündstein und Zunder sowie ein Säckel mit angesparten Talern, 85 an der Zahl. Das war es auch schon. Die Summe seines Lebens. Bis jetzt.
Er konnte all das nehmen und gehen. Der Bürgermeister würde ihn vermissen. Der eine oder andere Kuellener vielleicht. Aber niemand so sehr, daß die Zeit ihn nicht trösten würde. Er konnte auch bleiben und so weitermachen, und das wäre ebenfalls in Ordnung. Er brauchte keiner Geheimorganisation zu beweisen, was für ein toller Kerl er war. Er brauchte nicht irgendwo anders zu kämpfen, zu fallen und zu verrecken, um seinem Leben einen Sinn zu geben.
Er konnte genau so gut eine Münze werfen.
Oder sich dem Mädchen aus dem Schmetterlingshain anvertrauen.
Ihr näherte sich jeder Gedanke.
Kurz bevor er zur Arbeit mußte, wurde er endlich so müde, daß er hätte einschlafen können. Aber dazu war es jetzt zu spät.
Er zog sich um, wusch sich, frühstückte hastig in der Schankstube Weißbrot mit Brombeermarmelade, Milch und zwei Stück Rosinenkuchen vom Vortag und eilte durch die breiten und sauberen Gassen der kleinen Stadt zum Rathaus. Wenn er um elf schon Feierabend machen wollte, mußte er in den Stunden bis dahin einiges wegschaffen. Dennoch gönnte er sich auf dem Rathausvorplatz einen Rundumblick. Es war zwar noch Taumond, das neue Jahr erst sechzehn Tage alt, aber das Wetter war mild und der Platz bereits mit Kübeln voller frühblühender Blümchen geschmückt. Die Fachwerkhäuser waren hell und freundlich, das Rathaus selbst war reich verziert und mit einer umlaufenden Ahnenreihe der bereits verstorbenen ehemaligen Bürgermeister bemalt. Eines Tages würde auch der jetzige Bürgermeister dort verewigt sein, freundlich und einnehmend wie im Leben, und es ärgerte ihn wahrscheinlich täglich, daß er das nicht mehr selbst würde erleben können.
In nordwestlicher Richtung konnte Rodraeg die dunkelgrünen Hänge des Larnwaldes sich gegenseitig überbieten sehen. Ein Wanderer würde gute zwölf Tage brauchen, um diesen gewaltigen Wald in gerader Linie von Kuellen bis zu den Ausläufern der Kjeerklippen zu durchqueren. Ein Reich der immerwährenden Schatten, Pilze, Moose und Nadelhölzer. Heimat der gefährlichen Flechtenwölfe, Baumspinnen, Wurmdrachen und – Schmetterlingsmenschen.
Im Rathaus war bereits Betrieb. Kepuk schlug sich schon mit einem Abgesandten aus Somnicke herum. Der alte Yornba, der ohnehin nie lange schlief und deshalb morgens meistens als erster aufkreuzte, saß in seiner Schreibstube und kritzelte mürrisch Kopien.
Rodraeg setzte sich an seinen Tisch. Die Encyclica lag immer noch dort. Er widerstand der Versuchung, sich das Mammut noch einmal anzusehen und machte sich an die Arbeit.
In den folgenden Stunden erledigte er die Ablehnung einer Kostenbeteiligung an Pargo Abims Maulwurfsproblem, formulierte eine ausgesprochen höfliche Absage an die Kjeer-Priester, begann damit, nicht nur die Mahnung des Tontopfhändlers Hinnis, sondern auch noch die ausstehenden Posten anderer Händler zu sammeln und zu ordnen, und vollendete seinen Bericht über das Kuhmistproblem unter Berufung auf einen Präzedenzfall von vor drei Jahren. Der Bauer durfte seinen Kuhmist auf seinem Feld verteilen, so oft er wollte, denn schließlich war er Landwirt. Dem Seidenmaler dagegen stand ein kleiner Anteil des auf dem kuhmistgedüngten Feld geernteten Ertrags zu, denn schließlich war er der Leidtragende. Erfahrungsgemäß würde Bauer Tlech nun alleine schon aus Geiz sparsamer düngen.
Gegen die immer wieder aufwallende Müdigkeit schüttete Rodraeg Unmengen des dunkelstmöglichen Tees in sich hinein. Der junge Reyren schaute vorbei, bedankte sich für die Brückenmappe und fragte, ob Rodraeg die letztjährige Abgabenmappe irgendwo gesehen hatte. Kepuk schaute vorbei und legte Rodraeg zwei neue Aufgaben auf den Tisch: eine Überprüfung der zu erwartenden Unkosten für das bevorstehende Arisp-Fest sowie die mit schwer zu entziffernder Handschrift und äußerst erfinderischer Rechtschreibung verfaßte Anfrage eines Waldläufers, der seine Dienste als Flechtenwolfjäger anbot.
Rodraeg machte sich zuerst ans Dichten für die Wirtin, aber ihm fiel überhaupt nichts ein. Sein Geist war wie leergefegt, fühlte sich aber gleichzeitig an wie zum Zerreißen gespannt. Mehrmals schlenderte Rodraeg möglichst unbeteiligt durch den Haupteingang, um einen Blick auf die Sonnenuhr zu werfen, und schlenderte anschließend wieder zurück.
Der Bürgermeister schaute vorbei und wollte die Aufstellung der Arisp-Fest-Kosten sehen. Rodraeg vertröstete ihn auf den Nachmittag. Reyren klopfte an und sagte, er hätte die Abgabenmappe gefunden, suche aber jetzt eine handschriftliche Notiz des örtlichen Bäckergildenvorstands. Ein Junge brachte neue Tinte. Jedesmal zuckte Rodraeg zusammen.
Dann war es endlich elf.
Rodraeg brauchte sich nicht abzumelden, es war nicht ungewöhnlich, daß ein Schreiber während seiner Arbeitszeit etwas außerhalb des Rathauses zu erledigen hatte.
Er sah Naenn sofort. Sie stand in ihrem Kapuzenmantel zwischen den Schmuckkübeln und aß einen gelben Apfel.
»Ich freue mich. Guten Morgen«, sagte sie freundlich.
»Ebenfalls«, nickte Rodraeg. Er fror jetzt mehr als am nachtkühlen Morgen, wußte nicht, wohin mit seinen Händen und vermißte seine warme Winterjacke mit den geräumigen Seitentaschen. »Leider gibt es in Kuellen nicht viel zu sehen, außer den Quellen, die dem Ort seinen Namen gaben.«
»Gehen wir.«
Wie Eis schimmerte es in der Tiefe. Bläulich, grünlich, irisierend. Da war nicht nur eine sanfte Strömung, die unabänderlich von hier ausging, sondern tatsächlich ein Leuchten, ein Ursprung magischer Energie.
Rodraeg und Naenn standen am mit kunstvollen Schnitzereien verzierten Holzgeländer, das die Hauptquelle des Larnus umrahmte. Es gab hier noch vier weitere solcher Quellen, außerdem kristallklare Rinnsale von östlichen Hügelkuppen und aus der taufeuchten Finsternis des Waldes, doch dies hier war die größte. Hier entsprang Larnus, einer der drei großen Flüsse des Kontinents: Larnus, Anera und Epheret. Vor Urzeiten war hier ein Tempel angelegt worden, ein Tempel des Wassergottes Delphior, doch irgend etwas war mit den Priestern geschehen, sie waren nicht mehr hier. Schon vor Jahrhunderten hatte der Larnwald das von Säulen getragene Gebäude übernommen, Mauern durch Wurzeln gesprengt und das helle Gestein mit Flechten und Moosen verkleidet, bis es fast unsichtbar wurde – auch, wenn man genau davorstand.
Rodraeg war in seinem ersten Kuellener Jahr oft hiergewesen. Später hatte ihn gestört, daß viele Reisende hierherkamen, überall mit ihrem Proviant herumtrampelten und -krümelten, während lustlose, vom Rathaus bezahlte Fremdenführer für ein Kupferstück pro Person ein paar Angaben herunterspulten, über den Larnus, über Kuellen und über den Bürgermeister.
Jetzt, da das Jahr noch so jung war, war außer ihnen niemand hier. Die Drohung von Schnee und Regen hing noch zu spürbar in der Luft, und die Wege hier herauf mit ihren ausgetretenen Stufen waren steil und glatt.
»Der Kontinent verändert sich«, sagte Naenn leise. »Noch ist er wild und ungezähmt und voller herrlicher und gefahrvoller Wesen, aber die Menschen haben sich fast überallhin ausgebreitet und beginnen, ihren Zugriff fester zu schrauben. In den Städten entstehen sogenannte Fabrikationen, in denen sich Menschen zusammenschließen, um Erfindungen zu machen und vielen weiteren Menschen Lohn und Arbeit zu geben. Ein goldenes Zeitalter für die Menschen ist im Werden, aber alle anderen haben darunter zu leiden. An vielen Stellen wird geschürft, gegraben, getaucht und gerodet. Es wird geerntet, ohne daß vorher gesät wurde. Das Gleichgewicht zwischen der allem innewohnenden Magie und dem verarbeitbaren Wert des Materials beginnt zu wanken. Der Feldzug gegen die Affenmenschen des Nordostens hat zu einer furchtbaren Katastrophe geführt. Man weiß nichts Genaues, der königliche Hof läßt nichts verlauten, aber einige unabhängige Magier und Seher sprechen von der Verwüstung eines ganzen Landstriches, von einem Eingriff in das natürliche Kräftegefüge des Kontinents, der einen gewaltigen Schock auf astraler Ebene durchs Land rasen ließ.
Bei uns Schmetterlingsmenschen gibt es einen Text, der seit Jahrtausenden mündlich überliefert wird. Er lautet folgendermaßen:
Die Kraft des Gleichgewichtes ist es, dank der Himmel und Erde zusammenwirken, dank der die vier Jahreszeiten, die vier Elemente und die vier Oberen Götter in Harmonie kommen, dank der Sonne und Mond scheinen, dank der die Sterne ihre Bahnen ziehen und uns mit ihrem unendlichen Licht Magie gewähren, dank der die drei großen Ströme fließen, dank der alle Dinge gedeihen, dank der Gut und Böse und Licht und Dunkel geschieden werden, dank der Freude und Zorn den angemessenen Ausdruck finden, dank der die Unteren gehorchen, dank der die Oberen erleuchtet sind, dank der alle Dinge trotz ihrer Veränderungen nicht in Verwirrung kommen. Weicht man vom Gleichgewicht ab, so geht alles zugrunde. Erhält und ehrt man das Gleichgewicht, so lautet der Name des Kontinents: Vollkommenheit.
Der Kreis ist ein Zusammenschluß von Menschen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, das Gleichgewicht zu ehren und zu erhalten und dort einzugreifen, wo der Kontinent geschädigt wird. Das Land kann nicht für sich selbst sprechen. Es gibt keine Advokaten für Flüsse, Bäume, Berge und Tiere. Wir selbst müssen diese Advokaten sein, und wir müssen sie sein, bevor es zu spät ist.«
»Aber wie wollen Menschen beurteilen können, was das Land will und braucht?«
»Früher sagte man, der Kontinent spricht zu uns durch die Götter. Doch die Götter haben sich zurückgezogen, seit Jahrhunderten schon. In einigen Städten gibt es zwar noch Tempel, aber dort wird Brauchtum verwaltet und magische Energie. Die Stimmen der Götter sind in der Entfernung verhallt.
Also sind wir auf uns allein gestellt. Mehr noch: Der Kontinent ist uns überlassen worden, unserer Verantwortung. Ob das zum Guten oder zum Schlechten führt, liegt ganz allein an uns.
Um Urteilskraft zu erlangen, um erkennen zu können, was zum Guten und was zum Schlechten führt, setzt sich der Kreis aus Vertretern verschiedener Völker zusammen. Ein Schmetterlingsmensch aus dem Larnwald, ein Untergrundmensch aus dem Targuzwall, ein Magier aus der Hauptstadt und eine alte Frau, die ihr ganzes Leben lang als Bäuerin Zwiesprache mit dem Land hielt. Geplant war ursprünglich auch, einen Affenmenschen dazuzubitten, einen Riesen aus dem Wildbartgebirge und einen Spinnenmenschen aus dem östlichen Regenwald – aber das scheiterte daran, daß Affenmenschen, Riesen und Spinnenmenschen nicht durch den Kontinent reisen können, ohne wegen ihrer Andersartigkeit von furchtsamen Dörflern erschlagen zu werden. Deshalb versucht der Kreis wenigstens Kontakt zu diesen drei Völkern zu halten, um auch deren Meinungen zu hören, bevor etwas entschieden wird.«
Rodraeg nickte. »Das klingt ungewöhnlich und vernünftig zugleich.«
»Der Kreis ist ein guter Kopf, ein gutes Herz, aber was ihm fehlt, ist ein starker Arm. Deshalb wird nun diese Gruppe gebildet, die Ihr leiten sollt. Sie wird ihre Heimstatt in Warchaim aufschlagen. Wir werden aber nicht larnusabwärts nach Warchaim reisen, sondern zuerst zur Hauptstadt, wo Ihr den Kreis kennenlernen sollt und der Kreis Euch, und dann nach Warchaim.«
»Warum Warchaim?«
»Drei Gründe. Erstens: Warchaim liegt genau in der Mitte des Kontinents, die Hauptstadt Aldava dagegen zu weit im Westen. Zweitens: Warchaim ist außer Aldava die einzige Stadt, in der es noch Tempel aller zehn Götter gibt. Der Kreis ist der Meinung, daß das Wissen und die Überlieferungen sämtlicher Priester immer noch Schlüssel und verborgene Hinweise zum Verständnis des Kontinents enthalten, die wir auf keinen Fall unterschätzen oder mißachten dürfen. Und drittens: der Name Warchaim bedeutet in der alten Sprache das ›wahre Heim‹. Ein guter Ort, um Wurzeln zu schlagen.«
»Und Eure Rolle bei dem ganzen Unternehmen? Seid Ihr der Schmetterlingsmensch des Kreises?«
»Oh nein.« Naenn wirkte verlegen. »Ich bin vom Schmetterlingsmenschen des Kreises dazu auserkoren worden, eines Tages …« Sie stockte. »Eines Tages …«
»Eines Tages …?«
»… eines Tages den Kontakt mit den Göttern wiederherzustellen. Ich gelte innerhalb meines Volkes als herausragendes magisches Talent, habe aber mein wirkliches Potential noch nicht ausgebildet. Bis dahin soll ich mit Euch nach Warchaim gehen, mit der Gruppe im Haus zusammenleben und die Verbindung zwischen dem Kreis und der Einsatzgruppe aufrechterhalten.«
»Das klingt nach einer großen Verantwortung, die Euch da aufgebürdet wurde.«
Sie starrte hinunter ins ruhige Brodeln des klaren Quells. »Ja.«
»Das finde ich gut«, sagte Rodraeg freundlich. »Dann bin ich nämlich nicht der Einzige, der sich ein wenig überfordert fühlt. Ich habe noch nie eine Kommandotruppe ausgebildet und angeführt. Und noch nie mit einem Untergrundmenschen zu Abend gegessen. Ich hoffe, gemeinsam stehen wird das durch.«
»Dann ist es jetzt endgültig beschlossene Sache?«
»Das ist es.«
»Ich freue mich sehr.«
»Ich werde den Rest des heutigen Tages brauchen, um meine Angelegenheiten hier in Kuellen zu ordnen, aber von mir aus können wir morgen früh aufbrechen. Vielleicht kann ich sogar einen Händler auftreiben, der mit seinem Wagen Richtung Hauptstadt fährt, dann bräuchten wir nicht zu Fuß zu gehen.«
»Großartig. Ich kümmere mich um Proviant und Wasserflaschen. Braucht Ihr Tragetaschen und Decken für die Reise?«
»Ich habe noch meinen alten Seesack beim Wirt im Keller gelagert. Aber zwei leichte Decken wären nicht schlecht, für unterwegs.«
Gemeinsam gingen sie über feuchtglänzende Steinstufen und nadelbedeckte Wege in den Ort zurück und verabredeten sich für den folgenden Tag um sieben auf dem Rathausplatz.
Mittlerweile war es die zweite Stunde nach Mittag. Im Rathaus herrschte Hochbetrieb. Sogar der Waldläufer war persönlich vorstellig geworden, um sich zu erkundigen, ob er als Flechtenwolfjäger angeheuert werden könnte oder nicht. Es handelte sich um einen jungen Burschen mit langen Haaren und markantem Kinn, bekleidet mit einer Fellmütze und unterschiedlichen Tierhäuten. Rodraeg nahm ihn beiseite und erklärte ihm, daß der Bürgermeister von Kuellen traditionsgemäß kein Geld ausgäbe und es deshalb keinen Sinn habe, im Rathaus nachzufragen. Auch hätte es in den letzten Jahren hier in der Gegend keine Flechtenwölfe gegeben. »Ich habe aber welche gesehen«, beharrte der Waldläufer. »Sie ziehen nach Süden, um den Larnwald zu verlassen.«
»Warum sollten sie das tun?«
»Sie haben Angst. Ein Werwolf ist über die Kjeerklippen gekommen. Nördlich davon hat er Menschenkinder gerissen und sogar große Wollrinder. Jetzt ist er im Larn.«
»Vielleicht solltest du dich anheuern lassen, diesen Werwolf zu jagen.«
Der Waldläufer lächelte. »Ich kann nicht gut Lesen und Schreiben, aber ich weiß, wie man überlebt: indem man Teufeln aus dem Wege geht.«
»Hm. Danke für die Warnung.«
Nachdenklich ging Rodraeg in seine Schreibstube. Die zwei neuen Aufträge, die Kepuk ihm inzwischen auf den Tisch gelegt hatte, nahm er gleich auf und legte sie zusammen mit dem Brief des Waldläufers auf Reyrens Stehpult. Der junge Schreiber war nicht in seiner Stube, wahrscheinlich suchte er wieder etwas in Yornbas Pergamenttürmen.
Rodraeg brachte die Encyclica wieder in die Bibliothek zurück. Bevor er sie im Regal einräumte, betrachtete er noch einmal das Mammut und die Affenmenschen, und dann auch, weit hinten im Buch, den Werwolf. Theorien. Vergilbtes Pergament. Aber alle hatten sie sich innerhalb der letzten vierundzwanzig Stunden zu Wort gemeldet, und er ahnte, daß dies nun schon bald sein Alltag werden würde: sich mit Wesen zu befassen, die, wie Naenn es ausgedrückt hatte, »herrlich und gefahrvoll« waren. Hoffentlich gab es in Warchaim auch ein Exemplar der Encyclica. Hoffentlich machte der Werwolf aus den Klippenwäldern nicht ausgerechnet Jagd auf entflohene Rathausschreiber.
Ende der Leseprobe