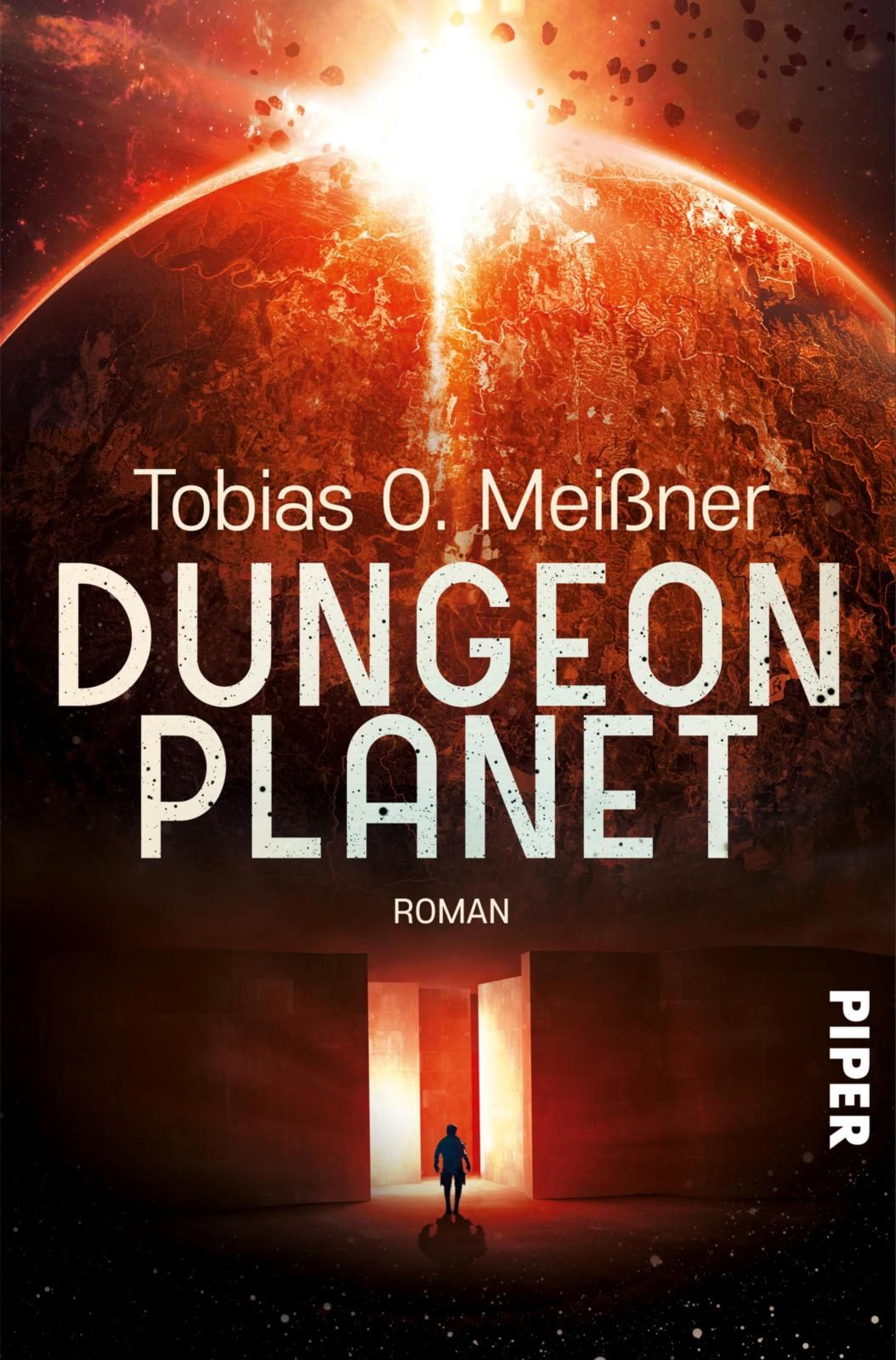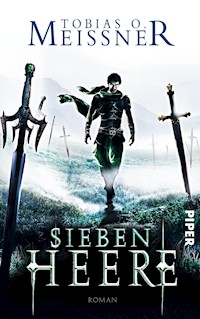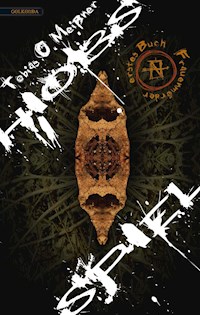
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Golkonda Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Hiobs Spiel
- Sprache: Deutsch
Das riskanteste und schwärzeste literarische Projekt deutscher Sprache, vergleichbar nur mit "Die 120 Tage von Sodom" des Marquis de Sade. Es ist ein Schrecken ohne Ende. Hiobs Spiel ist die Geschichte eines Mannes, der sich auf eine unglaubliche Geschichte eingelassen hat eine Wette um das Schicksal der Welt. Gewinnt er, kann er die Welt retten. Verliert er, fällt sie dem Bösen anheim. Um die Welt vom Bösen zu befreien, muss er ihre entsetzlichsten Schauplätze aufsuchen, muss tief in die Abgründe der menschlichen Existenz hinabsteigen, und er muss auch selbst betrügen, morden, quälen und vernichten. Der Inhalt ist so maßlos wie das gesamte, auf mehrere Bände und fünfzig Jahre angelegte Projekt vermessen. "Hiobs Spiel" ist ein Romanzyklus der Extreme, der Schrankenlosigkeit, des Absoluten. Das gesamte Arsenal an Genres, Formen und Jargons, das dem Autor während seiner Arbeit an den Texten begegnet, soll in "Hiobs Spiel" einfließen. Nicht Belletristik, Maletristik nennt Meißner dabei sein Metier, für das er auch beim Schreibprozess die Schleusen des Verdrängten und Unbewussten öffnet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 584
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Impressum
Die Erstausgabe erschien 2002 im Eichborn Verlag, Berlin.
Bei der vorliegenden Neuausgabe handelt es sich um die erste vollständige, exakt den Intentionen des Autors folgende Fassung – den »Writer’s Cut« also. Sämtliche Kürzungen und andersgearteten Eingriffe in das Manuskript, die dem Erstdruck vorausgingen, wurden rückgängig gemacht. Der gesamte Text wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Autor durchgesehen.
© 2013 by Tobias O. Meißner
Mit freundlicher Genehmigung des Autors
© dieser Ausgabe 2013 by Golkonda Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Hannes Riffel
Korrektorat: Catherine Beck
Technische Unterstützung: Robert Schröder
Gestaltung: s.BENeš [www.benswerk.de]
E-Book-Erstellung: Hardy Kettlitz
Golkonda Verlag
Charlottenstraße 36 | 12683 Berlin
[email protected] | www.golkonda-verlag.de
ISBN: 978-3-942396-54-7 (Druckausgabe)
ISBN: 978-3-942396-58-5 (E-Book)
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben werden.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von §44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Ansprechpartner für ProduktsicherheitEuropa Verlage GmbHMonika RoleffJohannisplatz 1581667 Mü[email protected]+49 89 18 94 [email protected]
Inhalt
Titel
Impressum
Prolog
Prognosticon 1: Der begrabene Zirkus
a) Einsatz
b) Ciudad mugre
c) Glückhafter Ausgang
Prognosticon 2: Life ’n Perspectives of a genuine Crossover
a) Hampelmann
Meanwhile-Caption One.
Meanwhile-Caption Two.
b) Virtuosen
BONUS TRACK ONE
BONUS TRACK TWO
BONUS TRACK THREE
Manifestation 1 : Hinterkaifeck oder Der Heimkehrer
a) Was aus uns geworden ist
b) Der König von Ulm
c) Mühle
d) Lady und Gentleman: Die Schiedsrichter
Prognosticon 3: Ars Moriendi – Eine Liebesgeschichte
a) Kinder der Zeit
b) Lebendige Kunst
c) Fänge im Roggen
Genocide City
d) Genesis und Apokalypse
Prognosticon 4: Über Mädchen
Epilog
Phantastik im Golkonda Verlag
Prolog
»Ich selbst spiele in dieser Geschichte noch keine Rolle.«
Die Stimme eines Kindes, wie von weit her.
Es ist mitten in der Nacht, und das Theater ist menschenleer.
»Zumindest nicht im ersten Buch. Im zweiten tauche ich zum ersten Mal auf, wenn auch nur als Traum. Wirklich in Erscheinung trete ich wahrscheinlich erst im vierten oder fünften Band, mit Sicherheit kann jedoch niemand das wissen.«
Es ist ein kleines Theater, in einem Hinterhof gelegen. Ein rätselhaftes Stück mit Namen »Königin der Teilbarkeit« wird hier gegeben, und von den fünfzig Sitzen sind höchstens zehn besetzt.
Zu dieser Stunde gibt es hier nur das Mädchen und das eigenartige, wabernde Licht, das durch drei hohe Fenster hereinweht, von den Leuchtschriftzügen einiger Lokale und dem regelmäßigen An- und Ausgehen der Zimmerlichter des Hauses.
»Schon bald werdet ihr euch fragen: Was soll das alles? Was ist der Grund für eine Erzählung mit so viel Gewalt, so viel Entsetzlichkeit und Not? Ich kann das noch nicht erklären, nicht gleich zu Beginn. Nicht einmal die Hauptfiguren wissen zu Beginn, was sie eigentlich tun und warum. Aber sie lernen. Sie sind unter Schmerzen dabei, sinnliche und übersinnliche Erfahrungen zu sammeln. Und genau so wird es euch ergehen. ›Lohnt sich das?‹ werdet ihr fragen. Ich kann nur antworten: nicht für jeden.«
Das Mädchen steht alleine auf der dunklen Bühne.
Es sieht aus, als wäre es zehn oder elf Jahre alt, mit langen braunen Haaren und großen Augen. Seine Kleidung ist anders als das, was man in diesem Jahrhundert trägt, in diesem Land zu dieser Jahreszeit.
Einen Vorhang gibt es nicht. Ein paar Requisiten stehen oder liegen noch auf der Bühne herum, unter anderem ein großer bunter Ball und verschiedene schwarze Stühle.
»Vieles von dem, was hier verhandelt wird, ist wahr, ist zumindest bezeugt worden, und was nicht direkt wahr ist, wurde in Albträumen durchlebt. Niemand würde sich so etwas einfach nur ausdenken. Niemand, der noch nicht verloren ist.«
In den tiefen Schatten zwischen den Sitzreihen bildet sich undeutlich ein unruhiges Publikum heraus. Menschen. Tiere. Tiermenschen. Ein fünfundzwanzigjähriger Mann in der Maske eines Fünfundsiebzigjährigen. Eine Frau, die viele Frauen ist, aber alle sind sie schön, und viele von ihnen waren Schauspielerinnen in der Frühzeit der Filmgeschichte. Hinter ihr ein Mann oder ein Ungeheuer mit einer Krone oder Hörnern. Und seitlich, abseits von den anderen, ein blasser, fiebernder Zauberkünstler, mit Farbe beschmiert und Blut.
Die Schatten überlagern sich, löschen sich gegenseitig aus.
Das Mädchen lächelt.
»Ansonsten kann ich euch nichts mit auf den Weg geben. Es darf nicht zu einfach werden, das würde der Natur des Geschehens widersprechen. Ihr werdet verletzt werden, aber die meisten Verletzungen werden heilen. Ihr werdet herausgefordert werden und in dieser Herausforderung ein Spiel sehen können oder ein lebenslanges Ringen. Ihr werdet lernen müssen zu lachen, über Dinge, die eigentlich nicht zum Lachen sind. Ich empfinde Mitgefühl für euch, aber ich beneide euch auch, nun, da ihr alles noch vor euch habt.«
Sie legt ihre Handflächen über ihre Augen und tritt so weit nach vorne an den Bühnenrand, dass ihre Zehen keinen Halt mehr haben.
»Hier spielt man ein Spiel um die Seele der Welt,
wo Gott ist der Teufel, ein Irrer der Held.
Prinzessinnen werden ermordet und morden,
das Böse und Gute sind taumelnde Horden.
Gewalt und Gewalten umgarnen sich gierig,
den Sieger zu finden erweist sich als schwierig.
Es gibt einen Sinn hier und auch ein System,
und beides zu finden ist niemals bequem.
So lasst uns denn schaudern, mit Mut delirieren,
die Zeit unsres Lebens in Wahn investieren,
lasst staunen uns, kichern, erschrecken und weinen
und weiter noch wollen auf zittrigen Beinen,
lasst Märchen uns trinken wie Schweiß und wie Tränen
und unsere Sicherheit trügerisch wähnen,
lasst Wandlung und Vielfalt uns werden zum Ziel
– denn dergestalt tut sich uns kund Hiobs Spiel.«
Das Mädchen verbeugt sich tief und springt hinab ins Dunkel des Raums.
Es gibt keinen Applaus.
Prognosticon 1: Der begrabene Zirkus
a) Einsatz
Irgendein Priester wird lachen.
Wenn ich komme, um zu beichten.
(Hiob M.)
Der Arzt hieß Facundo. Facundo oder so ähnlich.
Er hatte kein freundliches Gesicht, eigentlich überhaupt kein Gesicht, aber er war so dick und violett und ädrig, und die Gummischlaufe an der Kehle war so hart, dass der mongoloide Junge ihn in den Mund nehmen musste und lutschen und saugen, während der Zwiebelpfleger dem Jungen roh den Klistierschlauch einführte. Walzer blecht im hellen Hintergrund.
Facundo grunzte und bewegte seine schlaffen Hüften, bis er den Rachen des Jungen ganz erstickte und dieser durch die Nase kaum noch Luft bekam, was herrlich anzuschauen und zu hören war. Er strich dem Jungen tauber werdend durch das volle Haar, und als Facundos Augen hinter den dicken Brillengläsern zuquollen, gab er dem Pfleger einen Wink. Der öffnete feixend den Hahn, und der Junge füllte sich innen mit sengenden Flammen, brüllte und riss sich zuckend aus den Schläuchen los. Am nassen, kalten Boden schlenkerte er und quoll auf, bis seine Haut fettrosa wurde wie eine Wurst und Risse bekam. Der Pfleger lachte seinen Zwiebelatem umher und drehte an der Einlaufdüse das kochende Öl ab. Ein Tenor belfert wie rückwärts durch die dicken tauben Steine.
Facundo war noch nicht gekommen, er war unzufrieden, wurde schrumpelig und schlaff. »Guillermo«, keuchte er dem Pfleger zu, der sehr viel Spaß hatte und bleckend lachte. »Lass uns in die Zelle da drüben gehen und diesmal richtig liederlich sein.«
Der Zwiebelpfleger nickte, packte die Schläuche unter den Wagen und schob ihn quietschend zur nächsten Tür. Ein Blick durch die Luke verriet die beiden Kinder, die dort im Unrat schliefen. Mädchen. Zwei Mädchen. Der Geruch ihrer Exkremente war berauschend. Facundo schwoll wieder an, und die beiden Onkels betraten nebeneinander den Ort, wo alles erlaubt war, und schlossen schwitzend hinter sich ab.
Facundo konnte wahnsinnig sein. Er bellte und jaulte wie ein Köter, zerriss sich den fleckigen Arztkittel und schmierte sein Gesicht mit Scheiße ein. Der Sänger walzert hängend immer wieder wieder wieder. Es ist Carneval Joselito.
Der Mongoloide lebte noch, in einer Pfütze aus geschmolzenem Fleisch. Er träumte von den Heiligen. Vom Karneval. Wieder. Wieder. Wied.
Hinter der dicken tauben Backsteinmauer des Krankenhauses Moabit begann ein routinierter Montag. Draußen war Januar, schneelos, die Sonne stach hinterlistig zwischen grauen Wolkenfetzen hervor, und hinter den aseptischen Glasschiebetüren wallte der monotone Straßenlärm heran. Der junge Mann, der am Donnerstag ohne Papiere in der Nazarethkirche mit apoplektischen Symptomen zusammengebrochen war, hatte am Sonnabend einer Aushilfsschwester den qualligen Kartoffelbrei ins Gesicht gedrückt und seinen asthmatischen Bettnachbarn mitsamt der Matratze aus dem Bett geworfen, um seine Gesundheit zu demonstrieren und seine Entlassung zu beschleunigen. Die Untersuchung durch den Ordnungsdienst am Sonntagmorgen ließ er nervös und fahrig über sich ergehen, gab seinen Namen einmal mit »Lutz Diddrich » und einmal mit »Richard Heilhecker« an, schenkte einem schnurrbärtigen jungen Uniformpolizisten seine baumwollene, blaukarierte Holzfällerjacke und konnte gehen.
Die Sonne warf ihn mit winterlicher Wucht fast wieder in die sich schließende automatische Tür zurück, aber mit dem linken Arm vorm Gesicht kam er am Pförtner vorbei, ohne allzu viel Aufsehen zu erregen. Er rannte die Birkenstraße hinunter, schlüpfte an streitenden jugendlichen Türken vorbei in die U-Bahnstation, kurz, bevor es draußen kalt zu regnen begann, fuhr drei Stationen schwarz bis zum Leopoldplatz, schaute dort kurz, ob die Linie nach Alt-Tegel gerade einlief, was aber nicht der Fall war, sprintete durch karstadttütenbehängte Wintermantelmütter hindurch die Treppen hinauf und rannte im gallert-öligen Platzregen an der pumpend immer noch vibrierenden Nazarethkirche vorbei die Müllerstraße bis zur Amsterdamer Straße hinauf, wo er sich schlüssellos gegen die Tür von Nummer 9 warf, bis sie aufknackte, und zu seiner Wohnung im Quergebäude hochlief. Mit nach chemischer Krankenhausseife riechendem Schweiß in den Augen trat er seine eigene unbezeichnete Wohnungstür ein und kam gerade noch rechtzeitig, um der felllos fleischigen Katze, die an seinem Fernseher hing, mit einem splinterigen Baseballschläger das Gehirn über die Mattscheibe zu dreschen und den röchelnden Kadaver an den Stromkreis der Modelleisenbahn anzuschließen, bis das Ding mit der Stimme von Kathleen Byron zu reden anfing.
»Guten Montag, guter Montag, mein hübscher Lieb-Haber«, schnarrte der rosafarbene, nackte Leib, »spielst du noch immer mit Weiß? Brauchst du ein Brett?«
Der junge Mann ließ sich nach hinten aufs ungemachte Bett fallen, strich sich durchs nasse Haar und gönnte sich die ersten Sekunden der Entspannung seit fünf oder sechs Tagen. »Ist dir nach Plaudern zumute, Widder? Du willst doch nur von der Tatsache ablenken, dass ich dich erwischt habe. Was wolltest du vom Fernseher? Kulenkampffs knistrige Seele rauslutschen?«
Das pulsierende Katzenaas lachte, bis ein paar offen liegende Schenkelsehnen rissen. Die Stimme wurde tiefer. »Ich wollte Porno-Kabel sehen. Hast du Porno-Kabel?«
»Denkst du, ich könnte mir das leisten? Niemand bezahlt mich.«
»Du und ich, wir könnten wieder Porno-Kabel werden. Würdest du wollen?«
Der Mann richtete sich auf die Ellenbogen auf. »Komm jetzt, Widder. Gib mir meine Karten.«
»Wie du willst, du süßer Scheißer. Versuch es in Barranquilla. Dort ist Carneval Joselito, o Mama, da ficken die Leute ü-ber-all!«
»Kolumbien? Eine Drogengeschichte?«
Die Katze lachte schmatzend. »Nein. Eine Gruselgeschichte. Sie schlachten dort Menschen und werfen sie weg, und man soll nie wegwerfen, was man noch brauchen könnte.«
»Shit.«
»Ja, genau. Bleib mir treu, mein Kleiner. Du weißt genau, dass nur ich dich wirklich glücklich machen kann.«
Mit der schmierigen Imitation eines Hundebellens wich alle Bewegung aus der Katze, und der junge Mann riss das Ding von den Schienen, wickelte es mitsamt ein paar übrigen Schafgarbenzweigen in Alufolie und presste es tief in den Mülleimer. Er löste vier orange-sprudelnde Vitamintabletten in einem einzigen gesprungenen Glas Wasser, kippte das künstliche Gesöff hinunter, dachte kurz nach, holte sein Kampfmesser unter dem toten Kohleofen hervor, pustete die Staubmäuse weg und stürmte aus der Wohnung zwei Etagen weiter nach oben.
Sie zog sich völlig aus und warf ihr dunkelblaues Spitzenhöschen von C&A verächtlich in den Bioabfallkanister zu den schimmelnden Orangen- und Bananenschalen.
Sie setzte sich nackt, mit weit gespreizten Beinen, auf den dunkelroten Alu-Stuhl mit Plastiksitzfläche und beobachtete sich selbst interessiert im Spiegel dabei, wie sie ihre Augen schwarz umrandete, die Wimpern mit Nacht verstärkte und die Lippen in weicher Implosion hellrot aufglühen ließ.
Sie vertuschte mit hautfarbenem Pickelpuder einen kleinen Mitesser unter ihrer linken Brust.
Sie war ein hübsches Mädchen mit hübschem, dunkelblonden Lockenhaar, sie onanierte jetzt ein wenig, aber nicht zu viel.
Sie stand auf, um den frischen Schweiß von ihren sorgsam rasierten Achselhöhlen und dem Schlüsselbein zu waschen. Sie benutzte dazu zusätzlich einen Deo-Roll-Stift, ein bisschen FCKW-freies Spray und jede Menge süßes Parfum mit leichter Moschus-Note.
Sie ging zur unauffällig unifarbenen Plastiktüte vom Wichser-Shop und holte das mattrote Bustier mit dem schwarzen Spitzenbesatz heraus und legte es sich an. Das Polyamid raschelte schmeichelnd an ihren Brustwarzen, die wie elektrisiert waren, sensitiv, atemlos erwartend.
Sie zwängte sich ohne Höschen, quietschend und schmatzend in den roten Lack-Mini aus der Plastiktüte und hockte sich in verschiedenen Posen darin hin, um den hautengen, saugenden Sitz zu gewährleisten.
Sie zog sich ihre alten, abgewetzten, kniehohen, dunkelbraunen Wildlederstiefel an und die schwarze Lederjacke mit den aufgesprungenen Schultern. Sie steckte sich ihr ganzes weniges Geld und ihr Flugticket in die Innentasche mit dem defekten Reißverschluss.
Sie drehte und wand sich vor dem Spiegel und schmollte und leckte sich selbst zu.
Sie sah aus und roch wie die billigste Nutte der Potsdamer Straße, eine total heruntergekommene, vielleicht sogar drogensüchtige Pollackin oder so, eine, die dich für einen Zwanziger ohne Gummi alles machen lässt, eine, die jeder haben kann und der es sogar noch Spaß macht.
Sie war zufrieden.
Wenn sie schon verrecken musste, dann mit viel, viel Stil.
Im Treppenhaus aufwärts roch es kalt nach Rouladen von gestern. Der junge Mann kam ungesehen zwei Stockwerke höher an und klingelte dann an der Wohnung von Ilse Rosenmacher. Es war nicht eigentlich ein Klingeln, mehr ein elektrisches Grinden, aber es erfüllte seinen Zweck. Nach dem siebten Mal ohne Antwort oder sonstige Reaktion von drinnen klemmte und splitterte der Mann mit seinem bulligen Messer das lächerliche Türschloss auf, schmiegte sich – schon wieder Schweißtropfen auf der Stirn – in den berosentapeteten Flur dahinter und drückte die Tür gerade noch rechtzeitig wieder zu, bevor das von oben die Treppen herabpolternde Kindergerenne und -gekreische die Rosenmacher-Wohnung passierte.
Es war klamm im Flur, fensterlos dunkel, irgendwie abgestanden und verbraucht, und irgendwie war da auch ein seltsames, bittersüßes Aroma. Der junge Mann tastete sich an einem nächtlichen Goldrahmenspiegel vorbei bis zur frontalen Hauptzimmertür und drückte sie gegen einen zähen Widerstand hin auf. Hier, im bürgerlich biederen und um den gängigen Seifenopernaltar herumdrapierten Wohnzimmer einer mindestens siebzig Jahre alten, allein lebenden Frau, die der junge Mann ab und zu im Treppenhaus sah, um ihr beim Wuchten von flaschenklirrenden Einkaufstüten oder beim Passieren der schwergängigen Quergebäudetür zu helfen, wollte er fleddern und schlitzen, bis er die greisen Ersparnisse gefunden hatte, die seiner Meinung nach jedes alte Weib irgendwo verborgen hielt, um beim mürrischen Hinunterfahren in der Kiste entweder vorher gleichgültigen Enkeln, irgendeiner dubiosen Wohlfahrtsorganisation oder einer an Fellausfall leidenden sterilisierten Hündin ein letztes Trinkgeld vermachen zu können. Womit der junge Mann nun wirklich nicht gerechnet hatte, war, dass Ilse Rosenmacher hinter der Tür auf dem hässlichen Woolworthteppich lag, nackt, halb wahnsinnig vor Hunger, Durst und Entkräftung und mit einem aus der Hüfte gesprungenen gebrochenen Bein.
Das Rambomesser in der Hand, ließ der junge Mann sich ächzend auf einen schmatzenden hellbraunen Ledersessel fallen und starrte auf das schrumpelige und schlaffe, vulgär ausgebreitete Bündel Greisenfleisch zu seinen Füßen, das sich jetzt, schmerzhaft zur Seite geschabt durch die geöffnete Tür, mit saugenden Atemzügen wieder zu rühren begann. Die Parallelen zur Hybridenkatze aus dem Wiedenfließ nervten ihn.
»Frau Rosenmacher – wo haben Sie Ihr Geld versteckt?«
»Um Gottes willen ... helfen Sie mir bitte ... ich halte das nicht mehr ... Wasser ... bitte, Herr Meinrad ... bitte ...«
»Je schneller Sie mir verraten, wo das Geld ist, desto schneller gebe ich Ihnen etwas zu trinken und desto schneller rufe ich einen Notarzt, das verspreche ich Ihnen.«
Frau Rosenmacher schloss mit feist werdenden Wangen wie ein Baby die Augen, und für einen Augenblick fürchtete der junge Mann, dass ihm das alte Mädchen aus reiner Scham wegsterben würde. Also rannte er in die fertiggerichtplastikdominierte Küche, pumpte ranziges Wasser aus dem wackligen Hahn in ein bereits benutztes Glas und flößte es halb der Rosenmacher, halb dem Teppich ein, der in seinem Dasein schon ganz anderes aufgesaugt hatte und Kummer gewöhnt schien.
Die Rosenmacher gluckste dröhnend, und ihr loses Bein verlagerte sich haltlos ein wenig auf dem Teppich.
»Sie müssen mir helfen, Herr Meinrad«, schnurrte sie mit nassem Mund.
Der junge Mann setzte sich wieder auf den leicht zurückruckenden Sessel und klatschte grinsend die Hände auf die Schenkel. »Tja, wenn ich’s nicht tue, tut es keiner, und man wird Sie in zwei oder drei Monaten als eingesunkenen Madenbrutkasten finden, Ma’am. Sehen Sie’s also als großes Glück an, dass ich hier bin. Wo ist der verdammte Zaster, hm?«
Ihr Atem rasselte, der untere Teil ihres fettfaltigen Bauches hustete. »Ihr Name ist gar nicht Meinrad, nicht?«, ächzte sie mit geschlossenen Augen.
»Und wenn schon. Das hier ist kein Fernsehquiz. Sie kriegen keine Punkte.«
»Ich ... hab mir schon lange gedacht, dass mit Ihnen was nicht stimmt. Die seltsamen Geräusche mitten in der Nacht ... und das rötlich flackernde Licht auf dem Hof. Sie sind kein Student oder so. Was sind Sie?«
»Was ich bin? Wollen Sie vor Schreck sterben, Oma? Hören Sie mir ...«
»Sie sind Kabbala, nicht wahr? Hab ich doch immer richtig vermutet – Sie sind Kabbala ...«
»Hören Sie: Ich kann natürlich auch die ganze schäbige Wohnung hier auseinandernehmen, Splitter für Splitter. Ich habe sehr viel Zeit. Die Frage ist, ob Sie noch so viel Zeit haben.«
Die Rosenmacher machte mit der zittrigen Linken Gesten über dem Boden, die der junge Mann stirnrunzelnd und schließlich amüsiert als kabbalistische Abwehrzeichen erkannte. Er seufzte.
»Okay, okay, Ma’am. Bevor Sie sich da in irgendetwas reinsteigern, was jetzt vielleicht zu viel für Sie sein könnte: Ich bin eher affa.«
»Affa!«, wiederholte die alte Frau, und ein Schaudern lief durch ihren entkräfteten Körper. »Aber wie kann jemand ... engelsgleich sein, der einbricht und stiehlt?«
Der junge Mann zuckte die Schultern und grinste traurig. »Es sind miese Zeiten, Ma’am. Ich kann nicht wählerisch sein.«
»Töten ... töten Sie auch?«
»Na klar. Das ist doch das Beste dran.«
Ein Schweigen entstand, wuchs, breitete feuchte Schwingen aus und hob schließlich ab.
»Sie lügen«, keuchte die alte Frau. »Affa bedeutet auch Leere oder nichts. Sie sind noch ein Anfänger. Ein Volontär.«
»Tja, was soll ich sagen? Auch NuNdUuN hat mal klein angefangen und sich dann hochgearbeitet.«
»Und sich hochgearbeitet.« Sie sah ihn an, und der junge Mann wich ihrem Blick aus. Diese Frau war nackt, sie war alt, schwach, verletzt, völlig hilflos und entkräftet, aber sie hatte verdammt noch mal beunruhigend viel Wissen.
»Das Geld ist auf dem Klo, unten in die Hohlräume der Klobrille geklebt. Aber es ist nicht viel. Wofür brauchen Sie es?«
»Ich muss nach Kolumbien fliegen. Heute noch.«
»Dafür wird es reichen. Seien Sie mein Gast, Affa.«
Schmunzelnd ging der junge Mann aufs Klo und fand an der angegebenen Stelle tatsächlich ein paar Fünfhundertmarkscheine in urinsteinbesprenkelten Plastiktütchen – ein originelles Versteck, wie er fand, eins, das es einem erlaubte, jeden Tag aufs Neue auf den verhassten Mammon zu scheißen.
Er klaubte die Scheine heraus, wusch sich die stinkenden Hände und schnitt sich selbst Grimassen im blitzsauberen Spiegel, der keinerlei Zahnpastaspritzer aufwies, da die dritten Zähne seiner einzigen Königin unterhalb leise im Reinigungsglas sich wiegten.
»Ich danke Ihnen sehr, Frau Rosenmacher«, rief er an der Tür zurück. »Wir werden uns sicher nie wiedersehen, also wünsche ich Ihnen alles Gute.«
»Vergessen Sie nicht, den Notarzt zu rufen«, krächzte ihm das tapfere alte Mädchen hinterher, aber da er beim Treppenhaus-Hinabspurten beinahe mit seinem republikanischen Hauswirt zusammenstieß und sich eine ihn doch irgendwie immer wieder aufs Neue ärgernde »Arbeitsscheuer Rotzlöffel!«-Schelte einhandelte, vergaß er es dummerweise doch.
Sie setzte sich im Taxi so hin, dass dem Fahrer – einem blassen, vollberuflich einsamen Philosophiestudenten – beinahe der Innenrückspiegel beschlug. Für einen Augenblick erwog sie, bereits hier in Berlin damit anzufangen, junge Männer mit Tod zu beschmieren – irgendetwas an den dunkelorangenen massiven Lederpolstern des dicken Daimlertaxis forderte sie mit einem Versprechen heraus –, aber schließlich riss sie sich doch zusammen. Eine Überschlagsrechnung, die davon ausging, dass sie für einen Stehfick etwa zehn Minuten brauchte inklusive Anmache und Abwimmeln, und dass sie etwa zehn bis zwölf Stunden durchhalten könnte – mit einigen Pinkel- und Snackpausen natürlich –, ließ die äußerst befriedigenden Zahlen »60« und »72« hinter ihren Augenbrauen auflachen. Berlin war zu klein für solche Sachen. Sie wollte Barranquilla.
Sylvie hatte ihr von Barranquilla erzählt, vom Karneval dort, der vier Tage und vier Nächte dauerte, in dem die Busfahrer der öffentlichen Linien gegen Marihuana jeden Fahrgast unterwegs mit Mädchen versorgten, in dem Touristen ausgeraubt oder mit Rasiermesser zerschnitten wurden für ein halbes Dutzend Centavos in ihren Portemonnaies, in dem Katzen, in Supermarkt-Einkaufswagen eingesperrt, zur Belustigung der Leute über offene Feuerchen geschoben und bei lebendigem Leibe gegrillt wurden, in dem die Leute auf den Straßen mit Plastikbeuteln voller Kot, Urin oder Sperma beworfen wurden, in dem Negerkinder aus den Slums mit Luftmatratzenpumpen aufgeblasen wurden, bis ihnen der Bauchnabel aufplatzte, in dem Polizisten lachend ihre Schlagstöcke ganz in Transvestiten verschwinden ließen und in dem frisierte Wagen auf parallelen Bürgersteigen ihre Laternenslalomrennen fuhren. Sylvie selbst hatte miterlebt, wie ein öliger Galan von ihr mitten aus einer tanzenden Stadtteilprozession herausgerissen und von einer jugendlichen Bande hau-ruck hau-ruck wie ein Partywitz über ein Brückengeländer geschmissen wurde. Sie hatte bei Sylvies Erzählung große Augen gemacht, wie ein kleines Mädchen das tut bei einer Erzählung von Einhörnern, Feen, Prinzen und einem verwunschenen Schloss, und sie hatte ganz tief in sich drin ein Gefühl gehabt wie beim Anblick von schwellenden, pumpenden Muskeln. Jetzt, seit einer Woche, wusste sie, wie sie die Fabel von Barranquilla zu mehr nutzen konnte als nur zu einer Eselsbrücke während einer schlaffen Blind-Date-Abschlussnummer. Alles passte zusammen. Die Karibik, die Exotik und der ganze Scheiß. Dunkle Haut und Augen eben.
Beim Aussteigen ließ sie einen vorbeitrottenden zottigen Schäferhundrüden an sich schnuppern und spreizte noch extra im Rock die Beine, damit das arme, dumpfe Vieh das Himmelreich nicht nur riechen, sondern auch kurzsichtig und wenigstens grau in grau sehen konnte. Der Köter reagierte so, dass ein Pavlov seine helle Freude gehabt hätte, wenn ein Pavlov zu so etwas fähig gewesen wäre. Sie genoss die biologischen, rein instinktiven, unsteuerbaren und unaufhaltsamen Wirkungsmechanismen, die ihr Körper nur einfach aufgrund seines physischen und chemischen Daseins selbst bei den unterschiedlichsten Ausprägungen des vermeintlich starken Geschlechts in Gang setzte. Sie hatte Macht, ungeheure Macht. Und sie würde diese Macht über den Zenit hinaus weiterstoßen und nicht, wie der kümmerliche Versager Sisyphos, kurz vorm Höhepunkt schlappmachen.
Sie überließ den geröteten, erbärmlichen Taxifahrer ihrem Trinkgeld und seinen peinigenden Phantasien und ging rasch durch die orchestral lärmende Flughafenhalle Tegels zum Terminal durch. Berlin war für diese Aufmachung zu kalt oder aber sie doch noch nicht heiß genug, jedenfalls wollte sie sich nicht die Blase verkühlen und dadurch ihre Soll-Rechnung gefährden. Die Lufthansa-Maschine, die sie erst einmal nach Frankfurt bringen sollte, stand schon bereit, Flug 2426 in der vulkanverseuchten, flammroten Abenddämmerung. Das Dröhnen der Motoren, des Windes und der Zuträgerfahrzeuge ließ ihre Haare wehen, und sie erlebte sich selbst rauschartig als Königin Pest aus der modernen Fassung eines Klassikers. Ihr Lächeln hatte die süße Schärfe einer Dextrose-Infusion, und hinter ihren vollen Lippen war eine dicke braune Soße aus Verdauung und Verrat.
Sie blinzelte, irritiert von diesen in den Sand gesetzten inneren Bildern, und passierte grüßend die dumm lächelnde, barbiehafte Stewardess.
Sie fragte sich distanziert, ob der Tod bereits begann, in ihrem Hirn zu wühlen, bevor er ihren Körper nahm.
Obwohl der junge Mann keine Reservierung hatte, war es ihm möglich, eine Passage zu finden, die ihn so schnell wie möglich zum Ort des Grauens brachte: mit dem Flugzeug nach Frankfurt, von dort aus mit einem anderen Flugzeug nach Bogotá und wiederum von dort aus mit etwas, das sich ebenfalls Flugzeug nannte, aber mehr Ähnlichkeit mit einem Dreirad hatte, nach Barranquilla. Er hatte eine Hin- und Rückflugkarte gebucht und dafür fast das gesamte Geld der Rosenmacher hinblättern müssen. Vorher hatte er noch überlegt: War es überhaupt ratsam, nach Berlin zurückzukehren? Sollte er nicht besser nach Irland gehen oder ins Landesinnere von Spanien? Aber während der U-Bahn-Schwarzfahrt Richtung Tegel war ein Musiker zugestiegen und hatte auf einer zerstoßenen Klampfe gegen ein paar Groschen alte Dylan-Songs zum Besten gegeben, und auf einem Bretterzaun am Flugfeldrand klebte ein Konzertankündigungsplakat für Faith No More, und der junge Mann hatte nicht anders gekonnt, als sich einzugestehen, dass seine Gefühle für diese Stadt dem nahe kamen, was andere Menschen Liebe nannten. Also hin und zurück. Und dazwischen eingeklemmt, wenn alles glattging, das Nehmen einer weiteren Hürde auf dem Weg nach unten, oder das endgültige Verspielen von Seele.
Der Flug nach Frankfurt war bei Weitem nicht so langweilig wie erwartet, denn im hinteren Teil der niedrigen Preisklasse masturbierte eine gutaussehende Blondine mit einem lauwarmen Wiener Würstchen, und der junge Mann begann schon fast, sich schier den Hals verrenkend, an gute Vorzeichen zu glauben, bis er jedoch auch einmal auf ihr Gesicht achtete, das verzerrt und angeekelt war wie bei jemandem, der Abfall durchwühlt, weil er seinen Ring verloren hat.
Frankfurt war glücklicherweise so gut geheizt, dass er seine Jacke nicht vermisste. Am Flughafenkiosk gab es nicht einmal richtige Cola, nur Pepsi, und sogar die war noch lauwarm, aber er stürzte sie gierig hinunter und registrierte nicht ohne freudige Überraschung, dass von den bisherigen Mitfliegern außer ihm und einem aknegesichtigen Yuppie auch das mysteriöse blonde Nuttchen mit Kolumbiens nationaler Fluglinie Avianca weiterflog. Sie wirkte auf den ersten Blick wie eine, die auch zum Karneval wollte, und zwar, um einen reinzumachen, aber der junge Mann glaubte keinem ersten Blick mehr, seit er im Wiedenfließ gewesen war.
Er vertrieb sich die Zeit bis zum Weiterflug damit, dass er, auf einem Hydrokulturkasten sitzend, die noch verbleibende Lebensspanne der vorüberhastenden Banker und Geschäftsleute errechnete. Es kam ein Durchschnittswert von 22 oder so heraus. Die Rosenmacher fiel ihm plötzlich wieder ein. Scheiße. Aber von hier aus konnte er nichts mehr machen. Er hatte nicht mal Kleingeld zum Telefonieren. Und zum Betteln war er nicht geschaffen.
Es ging weiter. Stotternd und röchelnd und Schadstoffe absprühend über die Karibik runter nach Kolumbien. Der Yuppie mit seinen hohlen Augen und dem leeren, unreflektierten Habitus eines Geldanbeters baggerte öde an der Blonden herum und wurde ärgerlicherweise nicht einmal auf die Ränge verwiesen. Sie fütterte ihn vielmehr mit Fisch.
Ansonsten bot der Clipper von Avianca wenig Neues außer dem Anblick von Smog von oben, einer niederländisch untertitelten Fassung von Hec Babencos verhunztem Ironweed und gelbem Kaffee. Das blinde graue Blau des Atlantik, in dessen unermesslichen Tiefen die Natur Fehlschläge wie den Pelikanaal Saccopharynx lavenbergi verwahrte, erinnerte den jungen Mann irgendwie an das plattgewalzte Wrack eines BMW, das er mal auf einer Autobahn liegen gesehen hatte, schwimmend in der roten Korona, die noch Minuten vorher vier junge, lachende Menschen gewesen waren.
Er saß ziemlich weit vorne und versuchte mit wachsender, manischer Verzweiflung, sich einen Plan zurechtzulegen für Barranquilla. Er rezitierte Rimbaud, um das Aufwallen des Nervenfiebers, die sanften Treuebekundungen seiner verdammten hochmodischen Narkolepsie abzuschütteln. Er dachte an die erste Liebesnacht mit Widder/Aries, sie im Fleisch der dreißigjährigen Faye Dunaway, er im Taumel, Druckrausch, Whiteout. Der Pakt, mit Proben all seiner Körperflüssigkeiten unterzeichnet. Der schreckliche, widerwärtige, aber glücklicherweise rasch vergehende Zuneigungsschmerz. Bewunderung und Ehrfurcht für NuNdUuN, der-die-Hirnräder-dreht-und-zählt. Den Herrn im Reiche Wiedenfließ.
Bogotá war kurz und schmerzlos und fast so warm wie Frankfurt. Das Dreirad lauerte schon grinsend. Der Yuppie trieb die Blonde schwatzend vor sich her. Der letzte Flug ging ruckartig über Urwälder und Sümpfe. Aus der fruchtbaren äquatorialen Ursuppe, dem biologischen Vaginalschleim der Großen Mutter, tentakelten blinde Passagiere astral – paranoid – nach unsrem jungen Mann.
Abwärts. Zeitverschiebung schlägt erst jetzt: sechs Stunden nach vorn. Das albatrosbreite Aufsteigen des Magens in den Mund und darüber hinaus. Eine dunkle Flugbegleiterin, mit gebreiteten Nüstern angewidert lächelnd, hilft ihm freundlich plaudernd beim Abwischen. Auf-Setzen.
Der Name der blonden jungen Frau ist Diana Frahm. Sie ist nach Barranquilla gekommen, weil sie positiv ist. Sie ist positiv, weil der kolumbianische Austauschstudentenkumpel ihrer Freundin Sylvie ihr im Schlafzimmer einer langweiligen Laberparty seinen aidsverseuchten Schwanz in die Möse gesteckt und schon nach drei Stößen seine todbringende Säure in sie reingepumpt hat, bevor sie überhaupt eine Chance hatte, zur Besinnung zu kommen.
Einer, ein alter Mann mit einem konkaven Gesicht, sieht nach oben, reißt sich den Kittel vom Leib und bedeckt schreiend sein Gesicht damit. Als die fette Louisa und der Zwiebelpfleger Guillermo ihn packen und mit Gummischläuchen peitschen und ihn anschreien, was denn los sei, flennt er, dass der kindische Engel herabgekommen ist, um auf sie alle draufzukotzen.
Barranquilla. Auch: die Perle am Rio Magdalena. Auch: Kolumbiens größter Hafen. Auch: Heimat von einer Million Menschen. Auch: La Ciudad Loca, die verrückte Stadt. Auch: Ciudad Mugre, die Stadt des Mülls und der Fliegen. Auch Karneval. Auch Carne-Wahl. Auch Schauplatz einer Manifestation, eines Prognosticons. Austragungsort eines merkwürdigen und geheim zu haltenden Spiels. Auch hier und jetzt.
Eine andere, deren Netzhäute bereits gegen gute amerikanische Dollars heruntergeschnitten wurden, strauchelt plötzlich auf ihrem vertrauten Weg zum Fäkalien-Sammeltrog, zeigt mit bleichem Arm in Richtung der Sümpfe hinter den Mauern und sagt in makellosem Deutsch die Worte: »Da rührt sich etwas, etwas lebt.« Sie hat diese Sprache nie gelernt, und auch keiner der anderen im Trog, sodass sie unerhört verstummt.
Der Name
des jungen Mannes
ist Hiob,
Hiob Montag.
Er ist nach Barranquilla gekommen,
um das Monster
abzutreiben.
b) Ciudad mugre
Wenn es wahr ist, dass eine psychatrische Anstalt wie ein trubelnder Zirkus ist, den man tief begraben hat, um vor ihm sicher zu sein, dann hütet euch vor dem Mann mit dem Spaten.
(Facundo)
Der überwältigendste Eindruck, den all das hysterische Treiben in den Straßen der expandierten Hafenstadt vermittelte, war der, dass es unter den Menschen dieser Welt keine aufrichtigen, uneigennützigen Gefühle, keine Liebe mehr gab, was der Wahrheit näher kommt als so manches andere – vorausgesetzt, Hiob Montags Theorien sind richtig, und es gibt überhaupt eine Wahrheit.
In seine Einzelteile zerlegt war der Karneval von Barranquilla ein schlechter Trip aus gnadenlos kommerzieller Stimmungs-Samba, schmerzhaft bunten Kostümchen und Konfetti, Zellulitis-Titten, sich lächerlich machenden herumspringenden geilen alten Böcken, forcierter Fröhlichkeit, Drogenkonsum, Alkoholverschüttungen, gelangweilter und vulgärer Durchbrechung biologischer und ethischer Tabus, dissonantem Getanze und Gesinge, wahnwitziger Verschwendung von anderweitig dringend benötigten Geldern, Stakkato-Hupen, auseinanderbrechenden Umzugswagen, lobotomierten Touristen, deplatzierten Körperausscheidungen, gebrochenen Versprechen, wild entschlossener Ignoranz, gnadenloser Veröffentlichung, Sündenbockspringen, kulinarischem Junkie-Habitus, Sehenswürdigkeitenentwürdigung, labyrinthischem Auseinanderentwickeln und Verzweigen von Zueinandersuchenden, katalysierender Hitze und Feuchtigkeit, perspirationsverregneter Gewalt, Hybris, Krankheitsaustreibung und -durchdringung, karibischem Azur, Wegwerfmaterial, koitalem Kryptizismus, stufenloser Beschleunigung und desillusionierender Gesamtquerschnittslähmung. Damit bot er schon wieder ein interessantes metaphorisches Spektrum der Verhaltensmuster der bisherigen menschlichen Phylogenese, und Diana Frahm konnte in ihm wie in einem gigantischen hedonistischen Rettungsboot unter- und aufgehen, während Hiob Montag, der seinen Fixpunkt in der Welt dadurch gesichert hatte, dass er mit einer Art Satan um eine Art Seele einer Art Gott spielte, durch dieses Kaleidoskop stolperte wie ein Dürstender in der Wüste, der die ideelle Natur seines Zieles kennt, nicht aber dessen konkreten Ort und Beschaffenheit.
Wenn dies alles hier eine neue Edition des Buches Hiob werden soll, ein Buch, das diesmal nicht von Ergebenheit und Leidensfähigkeit und Beugung vor etablierten Machtprinzipien, sondern von Wut und Aufbegehren handelt, dann ist dies ein guter Punkt, um den Widerhaken einzuschlagen. Hiob Montag in Barranquilla, in den Stunden, bevor er die Irrenanstalt Término Venturoso – Glückhafter Ausgang – in den Hügeln Richtung Ciénaga entdeckt und den Sumpf und den Müllpfuhl dahinter. Und da Hiobs Geschichte in dieser Stadt, in dieser Noch-Eröffnungs-Phase seines Spiels, eng mit dem Schicksal der verzweifelten Todeshure Diana verbunden ist, beginnen wir bei ihr.
Sie ist seit fast drei Stunden hier, drei Stunden seit Corfisso – dem Flughafen –, und dies ist Freier 12. Freier 12 hat bereits AIDS, und er weiß es auch, aber sie weiß es nicht und ahnt deshalb auch nicht, dass ihr schmerzvolles Schuften umsonst ist. Sie spürte, wie die zarten Innenwände ihres Mastdarms blutige Haarrisse bekamen. Sie konnte diesen Prozess sogar sehen: Wie bei einer glatten, spiegelnden Computergraphik konnte sie hellrot die Risse in ihrem Inneren sich ausbreiten sehen, Risse, die bald ihren ganzen Körper durchziehen würden wie den einer uralten Porzellanfigur. Das schmerzverzerrte Gesicht gegen die hochmütig kühle und feuchte Wellblechwand gepresst, hörte sie Frau Doktor Annemarie Schult vom Gesundheitsamt Kreuzberg wie ein Springteufelchen aus einem klaffenden Sarg schnellen und mit überarbeiteter, vorwurfsvoller Stimme sagen: »Hören Sie Fräulein Frahm dass Sie HIV-positiv sind bedeutet ja noch nicht dass die Krankheit AIDS bei Ihnen wirklich ausbricht Es gibt Menschen die schon seit Jahrzehnten mit dem Virus leben und kerngesund sind Das Einzige worauf Sie jetzt halt achten müssen ist dass Sie jetzt leider eine Überträgerin sind und dass Sie deshalb Ihr Verhalten ganz besonders Ihr Sexualverhalten in Zukunft dahingehend verändern müssen.« – »Genau das habe ich getan!«, keuchte Diana, während der bullige, nach Rum und Rülpsschleim stinkende Analfetischist hinter ihr sie mehr und mehr zerfetzte und ihre Achselhöhlen sich mit einer schmierigen Salzlauge füllten. Sie erinnerte sich an die kläglichen und nicht einmal ansatzweise Lust erzeugenden drei Stöße, die der kolumbianische Partygast benötigt hatte, um ihr den Goldenen Schuss zu setzen, und Kettensägen-Leatherface hier rüttelte nun schon seit Minuten an ihr herum und schien dabei in ihr immer größer zu werden wie ein Kaktus, der mit heißem Senfgas aufgeblasen wurde.
Sie schlug mit den Ellenbogen rückwärts nach ihm, wand sich, jaulte und schrie, aber er riss ihr fast beide Schulterblätter auseinander mit seinen tätowierten Armen, presste sie so fest gegen das raue Blech, dass sie bei jeder Bewegung wie über Sandpapier schleifte, und wurde grunzend immer schneller. Diana spürte, wie ihr Gesicht vor Tränen aufweichte und aufquoll. Sie war ein normales Mädchen gewesen in Berlin, ein braves Mädchen sogar, sie hatte studiert, Kunstgeschichte, an der HdK, im vierten Semester, bis zu jenem Abend auf der Party und der routinemäßigen Diagnose eine Woche später, die ein neuer Freund achselzuckend und ist-doch-nichts-Besonderes-dabei-lächelnd von ihr verlangt hatte, bevor er mit ihr schlafen wollte, und sie aus süßer doofer Jungmädchenliebe ihm zuliebe dorthin gegangen war und noch wusste, wie sie gedacht hatte: Das ist ein Vorsichtiger, der bleibt mir bestimmt treu. Jetzt konnte sie sich nicht einmal mehr an seinen Namen erinnern, geschweige denn an sein Gesicht.
Mit einem saugenden Schmerz, der sie in den Knien einknicken und sabbernd an der endlosen Ausbrecherfeile nach unten schrammen ließ, wurde Freier 12 hart aus ihren Eingeweiden gerissen, knurrte verblüfft, dröhnte metallisch, schnaubte rasselnd Blut pferdeartig durch die Nase und rauschte krachend rückwärts in den Gassenmüll, blieb liegen. Diana, hockend, Blutfäden ausscheidend, sah mit einem regelrecht verschüchternden Blick einen jungen Burschen mit einer gebogenen Eisenstange über ihr stehen. Sie erkannte ihn sogar. Er war mit ihr in allen drei Flugzeugen gewesen, hatte sich bei der dritten und letzten Landung vollgereihert und trug nun ein neues, schlabbriges Baumwollhemd, das er sich wohl hier gekauft hatte. Er reichte ihr die Hand, ohne zu lächeln. Freier 12 lag hinten auf dem Bauch – sie hoffte, dass er sich beim Sturz den fetten Schwanz abgebrochen hatte.
Mehrere anerzogene oder neu konditionierte Verhaltensprogramme konkurrierten in ihr: die Blöße bedecken (aus der behüteten Zeit, lächerlich, vergeblich), Dankbarkeit (aus der romantischen Zeit, veraltet), den Neuen als Nummer 13 begreifen und ihm die blutigen Wunden rausstrecken (aus der Zeit der Rache, merkwürdig unangemessen bei diesem hier), Hilflosigkeit (ein erschreckend wohliges Gefühl ebenfalls aus der romantischen Zeit, Prinz und Bettelmädchen und so), Angst (Angst? Wovor?). Die Konkurrenz bewirkte eine beinahe vollständige gegenseitige Aufhebung mit einem Resterzeugnis Wut.
Der Junge sprach. »Ein Kumpel von mir sagte mal, dass Berliner Mädchen sich im Ausland von allem bespringen lassen, das dunkle Haut hat und nicht aus der Türkei kommt. Da scheint verdammt noch mal was Wahres dran zu sein.«
»Ich hab um kein Kindermädchen gebeten.«
»Ach nein? Schlagen, Heulen und Brüllen ist kein Bitten? Dann entschuldige, ich weck ihn wieder auf für dich.«
»Lass den Scheiß. Hilf mir lieber hoch.« Sie hatte das Gefühl, nie wieder aufrecht stehen zu können.
Er half ihr, betrachtete dabei mit unbewegtem Gesichtsausdruck ihre Blößen. »Du solltest zu einem Arzt gehen deswegen.«
Diana lachte bitter auf. »Bei einem Arzt hat all das hier angefangen, Süßer. Hast du ein Zimmer oder so was, wo ich mich ein bisschen hinlegen kann?«
»Wenn ich eine Kajüte hätte, würde ich ja wohl kaum an Deck dieses Narrenschiffes durch die Schatten wanken.«
»Ich hab Geld. Irgendwo werden wir schon unterkommen. Was wird aus ihm hier?«
»Oh. Wenn er auf anal steht, wird er in der Ausnüchterungszelle seinen Spaß haben.« Er warf die Stange – Teil eines entsorgten Wagenhebers oder so was – auf den haarigen Hintern des liegenden Titanen drauf.
Sie musste lächeln, während sie sich ihren nassen Lederrock wieder umschlang und den Reißverschluss runterzog.
»Ich bin Diana«, sagte sie schließlich zu ihrer neuen Eroberung.
Der Junge strich sich seine langen Haare aus dem Gesicht. »Diana. Wie die einsame Prinzessin. Nun, mein Name ist Hiob. Meine Eltern waren zwar beide bekloppt, aber ihr pessimistisches Weltbild war voll korrekt.«
Nachdem sie sich schlingernde Wege durch rutschige, rhythmisch vibrierende und mit Girlandenmüll versiffte Straßen voller Besoffener und Terpentinschnüffler gebahnt hatten, kamen sie für ein paar Pesos mehr in einem Bumshotel mit Namen Ocaso – Sonnenuntergang – unter, mit zwei Flaschen Weißwein und drei Schachteln Zigaretten für die einsame Prinzessin. Von ferne, von überall, orgelte gequält der Karneval herein. Diana saß auf dem Bett und rauchte hastig, um die Hexen ihres Innens auszuräuchern, Hiob saß unter dem Fenster auf dem schlierigen Boden und spielte mit einer toten Kakerlake.
»Was ist eigentlich aus dem Yuppie aus dem Flugzeug geworden. Vielleicht hättest du dich besser an ihn halten sollen, so blöd das auch klingt.«
»Das habe ich auch. Wir haben gevögelt, und dann war Schluss.«
»Was? Du hast’s mit dieser Nullnummer getrieben? Das kann doch nicht wahr sein, so tief kann doch keine sinken. Und dann auch noch dieser Spinatmatrose aus der Gasse, innerhalb von ein paar Stunden. Du musst total verrückt sein, Mädchen.«
»Ich habe mit zwölf Kerlen gevögelt in diesen paar Stunden, du Blödmann. Und ich hätte weitergemacht, wenn du nicht gekommen wärst.«
»Mann, was ist los mit dir? Willst du auch für Olympia Werbung machen? Ist dir eigentlich klar, dass es scheiße ist, was du da tust? Ich hätte echt Grund, persönlich auf dich sauer zu sein.«
»Wenn du mich haben willst, dann nimm mich doch«, schlug sie nörgelnd vor. Ihr Restabfall Wut war einer dumpfen Enttäuschung gewichen.
Er winkte ab. »Darum geht’s nicht. Jeder Typ, den du infizierst und der daran krepiert, bedeutet eine Figur mehr auf SEINER Seite. Ich kann das echt nicht gebrauchen, es ist schon so schwer genug.« Hiob machte eine kurze Pause und sagte dann wütend: »Ich kann diese ganzen Serienkiller und Psychopathen und selbstmitleidverheulten Killernutten und Kriegstreiber nicht dulden.« Er funkelte sie an; seine türkisfarbenen Augen lauerten hinter Haarsträhnen hervor. »Also entweder du hörst auf mit dem Scheiß, oder ich muss dich aus dem Verkehr ziehen.«
Dianas Enttäuschung gab einer träge funktionierenden Verblüffung nach, jedoch nicht endgültig, und auch nicht deutlich genug, um sie beim Weiterrauchen zu behindern.
»Woher weißt du, dass ich ansteckend bin?«
Hiob schnitt eine seltsame Grimasse. »Du bist jung, du siehst gut aus, und du hast noch vier Jahre zu leben. Da deine Flussspur gegen Ende hin verbleicht, ist klar, dass du nicht an einem Schizofreier draufgehst, sondern dass du langsam von einer üblen Krankheit ausgewrungen wirst. A Four-Letter-Word, Babe. AIDS. Das coolste amerikanische Patent seit dem Neutronen-Bonbon.«
»He, was bist du, ein Tischerücker oder Pendelschwinger oder so? Kristallkugeljockey, was? Kommst dir wohl sehr gut vor. Für dich ist das alles nur ein Joke.«
»Ich bin kein Wahrsager. Ich bin Spieler. Berufsspieler. Einfach nur das. Wenn ich gut spiele, bin ich zur Belohnung Maler und kann ein bisschen Schotter einfahren. Leider ist mein Gegenspieler Falschspieler, da hat man nicht mehr allzu viel Spaß.«
»Häh?« Jetzt musste Diana doch lachen. Irgendwas war komisch an dem Typen und der gedrechselten Art und Weise, wie er daherredete. Sie wurde nicht schlau aus ihm. Außerdem musste sie immer dringender aufs Klo, hatte aber Angst vor den Schmerzen.
Die Stille in dem kleinen Raum wurde nur von Dianas glucksendem Trinken und dem Gedudel und Gegackere aus einem der anderen Zimmer angereichert.
»Ich verstehe immer noch nicht, wie du es mit dem Yuppie treiben konntest. Kolumbianer – okay. Wie mein Kumpel schon sagte. Aber so ein blöder Börsenstrizzi ... no, Man, ich versteh’s nicht.«
»Ich wollte auch nur Eingeborene nehmen. Wenn ich Deutsche gewollt hätte, hätte ich in Berlin bleiben können. Aber Deutsche könnte ich nicht mal genug hassen, um das hier zu tun. Deutsche sind einfach ...« – sie suchte mit rudernden Armen, die Flasche schwappend, nach einer besonders bösen Beleidigung – »... Deutsche halt. Aber der da, Bernd, der Bankkaufmann – weißt du, der war ein so blöder Wichser und hatte so schlechte Haut und so üblen Mundgeruch und so überhaupt nichts zu melden, dass ich mit ihm eine Ausnahme gemacht habe. Ich hab ihn gefickt, und ich hoffe, er fickt zu Hause seine konservative, toupierte Dirndlbraut, und sie wirft ihm lauter tote Krüppel. Jah!« Sie nahm wieder zwei Schlucke, die erste Flasche war leer. Hiob grinste, die Yuppiesache gefiel ihm schließlich doch. Um nicht zuzulassen, dass ihm noch mehr anfing zu gefallen, wurde er noch eine Spur grober.
»Du bist auf dem Selbstmitleidtrip, hm? Irgendein südamerikanischer Bolero hat dir das große Tabu angehängt, und jetzt willst du ihn und dich selbst strafen. Mädchen, das ist ein Scheiß-Motiv. Aus der Rutschbahn in die Hölle ragen viel zu viele rostige Nägel, um Genugtuung zu bringen.«
»Und was ist mit dir, Blödmann? Du hast doch auch nur Scheiß-Motive! Bist hier, um abzuzocken, was? Den großen Jackpot zu knacken. Noch’n bisschen Karamel oder Kakao zum Nachtisch, und ab geht’s zurück nach Dahlem oder Charlottenburg oder Reinickendorf, stimmt’s? Berufsspieler! Fühlst dich wohl noch als Held oder so was in der Art? Dabei hast du in der Gasse selber nur ’nen preiswerten Stehfick gesucht, gib’s doch zu!«
»Ich habe eine Quelle gesucht.«
»Eine Quelle. Eine Piss-Quelle, das meinst du wohl. Du bist ein Natursekt-Wichser, das ist es. He, gib’s doch zu. Wenn du drauf stehst, kannst du von Mama auch das bekommen, Kleiner.«
»Man erkennt doch ’ne echte Dame, wenn man eine sieht.«
»Oder du stehst auf kleine Jungs – das isses, das isses, was mit dir nicht stimmt. Kleine kaffeebraune Jungs, die in Berlin viel zu teuer ...« Hiob war plötzlich aufgesprungen, hatte ihr die leere Flasche und die brennende Zigarette aus der Hand geschlagen und prügelte sie mehrmals mit Handrücken und Knöcheln ins Gesicht. Dabei riss er sie an den Haaren hin und her, bis sie – keuchend, jammernd und mit knallrotem Gesicht – unter ihm auf dem Bett zu liegen kam. »Jetzt hörst du mir mal zu, du dumme Schlampe. Ich hab überhaupt keine Zeit, mit dir hier rumzuhocken und mich von dir beleidigen zu lassen. Ich bin ein Magier, und ich versuche eine Quelle zu finden, die ich anzapfen kann, um das üble Teil abzuschalten, das hier in dieser Stadt am Werden ist. Und da ich in dieser durchgeknallten Miststadt nichts finden kann, was mir weiterhilft, wirst du eben meine Quelle sein, kannst du das begreifen? Einzig deshalb habe ich dich vor diesem Arschficker gerettet! Von mir aus könntest du tot sein, und in spätestens vier Jahren wirst du es sein, also erspar mir deine jämmerlichen Säufermonologe, sie interessieren mich nicht, du vulgäre Kuh.« Er verpasste ihr noch eine schallende Ohrfeige, stieß sie federnd tiefer in die Matratze und erhob sich dann wieder von ihr. Diana war viel zu erschrocken, um zu weinen. Außerdem wurden die Schmerzen in ihrem Bauch stärker als die im Gesicht. Sie spuckte aus, einfach gegens Kissen. Sämig, rosa, wie bei Zahnfleischbluten im Zahnpastaschaum.
Hiob monologisierte weiter. »Wenn ich jemandem begegnen würde, der kleine Kinder fickt, würde ich ihm das Rückenmark durchschneiden, also pass auf, was du sagst. Ich bin nicht irgendein Passant, also erspar mir deine abgewrackten Neckereien. Ich will, dass du mir ein paar Worte nachsprichst, das wird dir ja wohl nicht allzu schwerfallen. Danach werde ich ein wenig von deinem Blut trinken, und wir haben einen Energietransfer. Das ist dann alles, und ich verschwinde wieder. Wirst du mir helfen?«
Diana fing wieder an zu lachen. Es dauerte lange, sie konnte sich gar nicht mehr einkriegen. Hiob stand währenddessen am Fenster und sah hinab auf zwei Prostituierte, die einen bewusstlos getrunkenen Nordamerikaner abschleppten. Der fast weiße, leichte Mantel des Ohnmächtigen wehte dramatisch im schwülen Lusthauch der Stadt.
»Jetzt versteh ich langsam«, japste Diana zwischen den nervösen Lachkrämpfen, »du bist ein Freier auf dem Dracula-Trip. Du bist ein Magier. Jetzt versteh ich. Mein Maaa-gier. Ich wurde von Merlin genagelt. Ein Zauberer raubte mir die Unschuld und verwandelte sie in ein Karnickel.« Sie lachte noch immer.
Hiob wartete ab.
»Und was passiert, wenn ich Nein sage?« kicherte Diana. »Verprügelst du mich dann so richtig, mit eiserner Faust? Oder zerfällst du einfach zu Staub? ›Ich habe vierhundert Jahre auf diesen Augenblick gewartet, Baby. Ich habe Ozeane der Zeit durchquert, um dich zu finden.‹ Darauf fährst du ab, ja?« Mit Mühen wurde sie ernster. Jetzt musste sie sich zusammenreißen, um nicht zu heulen. Sie würde vor diesem Mistkerl nicht heulen. Sie würde ihn töten, wie all die anderen auch. Und dann auf seine Leiche draufscheißen. »Na, dann komm, du Meister der mystischen Mächte«, stieß sie schluchzend hervor. »Gib mir deinen Zauberstab.«
Hiob sah weiterhin aus dem Fenster, merkte sich die Gasse, in der die Nutten mit ihrem Opfer verschwanden, trank die zweite Flasche Wein halb leer, stellte sie dann ab, wischte sich über den Mund. »Die Worte sind KARIMJIEL ULDUUR KARIMJEDD HAAD. Du musst das wiederholen. KARIMJIEL ULDUUR KARIMJEDD HAAD. KARIMJIEL ULDUUR KARIMJEDD HAAD. Los, versuch es.«
Schmollend zog Diana sich den Reißverschluss ihres Rockes auf. »Ich bin keine Nutte, du Mistkerl. Ich bin ein anständiges Mädchen.«
»KARIMJIEL ULDUUR KARIMJEDD HAAD.«
»Karamel Odol Krimsekt Haaaaaad.«
»Reiß dich zusammen. Das ist kein Spaß. KARIMJIEL ULDUUR KARIMJEDD HAAD. Und lass deinen Scheiß-Rock an, verdammt.«
»Karimmjell ulduuuur karimmmich haaaaad.«
»KARIMJIEL ULDUUR KARIMJEDD HAAD.«
»Karimmjell ulduuur karimjett haaaad.«
Hiob drehte sich zu ihr hin um. »Noch mal! Noch mal!«
»Karimmjell ulduuur karimjett haaaaaaad. Und was jetzt? Soll ich mich auf den Bauch legen?«
Hiob breitete die Arme aus, schloss die Augen und sagte ruhig: »Dies hier. Barranquilla. In der da. Diana. Jetzt.«
Die Stadt war in ihr, plötzlich, Betondetonation, breitete sich aus, wuchs, wurde be- und übervölkert, feierte Karneval, zog Fliegen an und Hunde, trieb Schornsteine durch Milz und Leber, Hafendocks in der Blase, geschäftig, ausbeuterisch, Sakramente und Manifeste hundertstimmig orchestral in ihrem Kopf, pressenpressenpressen, die Schließmuskeln öffnen sich für Conquistadores in verbeult spiegelnden Panzern, das Straßennetz akupunktiert, Plaza San Nicolas mit Kirchen und Kolumbus wuchert juckend zwischen ihren Brüsten, darunter blutigtief die Kanalisation, darüber drumrum durch die Nase in den Mund in Endloswarteschleifen-die-Flugzeuglinien-und-Autobahnbrücken-Vogelschwarmrouten, Unfälle, Geburten und Tode gleichzeitig, Müll, Sumpf, Tonnen, Müll, Fluss, Hinterland, Reifen und Kanister, Mörder aus aller Welt, weitersuchen, noch mal Müll, Diana schreit, schreiiiiiiiiiiiii
kehrt wieder, wieder, widder, Subwayschleifen um das Herz, blinkt Attraktionen, tionen, zonen, Fliegenschwärme summen grinsend immer um den Baum herum, es riecht wie als sie noch alleines Baby war, ein Baby, jemand schreit ganz furchtbar, in einer zwanzigseitigen Zelle, die rollt und rollt, Hiob ist über ihr, ruhig arbeitend, ein Vampir mit einer Weißweinflaschenscherbe in der Hand und ihrem Handgelenk und er schlürft Blut wie als weil und ganz nicht einen Lippenstift an und spricht mit ihr und seine Stimme ist wie WO WO IST ES ES und ganz am Rand der nassen Labyrinthe ihres Leibes geht ein Licht auf und zeigt WO WO ES IST IST für einen buchsbaumstäblichen Augenblick blickt sie mit seinen Augen und jetzt weiß sie wie es ist weder blau noch grün sondern beides in die Welt zu blicken sie fühlt sich müde ein und schläft.
Erst am nächsten Morgen schlug sie die Augen wieder auf. Trotz des langen Schlafes fühlte sie sich irgendwie matt und erschöpft, trotz ihrer sicheren Lage auf der Matratze und dem Kissen war ihr schwindlig. Sie schmulte ins rötliche Dämmerlicht unter der Zudecke: Ihr Rock war weg, ihr Unterleib nackt und weiß, ihr Bustier intakt, die Geborgenheit gebende Lederjacke hatte sie immer noch an. Um ihr linkes Handgelenk eine behelfsmäßige Kompresse aus Kleenex. Sie pulte sie ab. Ein verschorfter Querschnitt darunter, der jetzt, einmal entdeckt, schmerzhaft zu buckern begann.
Hiob saß in der Ecke auf einem Schemel und beobachtete ihr Erwachen. Er trug einen weißgrauen, dünnen Leinenmantel, den er gestern noch nicht gehabt hatte.
»Hast ... du ... also wirklich mein ... Blut getrunken, du Schwein. Hast du mich wenigstens auch gefickt, während ich weg war?«
»Damit das ein für alle Mal aus der Welt ist, Mädchen: Ich könnte gar nicht mit dir schlafen, selbst wenn ich es wollte. Du solltest die Sogwirkung deiner primären Geschlechtsmerkmale nicht überschätzen. Es gibt ein Mädchen in meinem Leben, dem ich treu sein muss. Bin ich es nicht – Gehe ins Gefängnis, begib dich sofort dorthin, gehe nicht über Los und ziehe nicht 4000 Mark ein. Nur härter.«
»Wo ist mein Rock? Was hast du mit meinem Rock gemacht?«
»Er hängt im Bad am Ende des Flurs über einer Schnur. Ich musste ihn waschen, du hast dich entleert während der Fusion.«
Entleert? Verwirrt, liegend taumelnd forschte sie in sich herum. Stimmt, sie erinnerte sich noch vage, dass sie dringend kacken musste, bevor die Geisterbahn losging, und jetzt – nichts mehr. Und fast traumhaft, gazeartig verschwommen erinnerte sie sich an sanfte, streichelnde Bewegungen an den Innenseiten ihrer Schenkel. Sie blickte noch einmal unter der Decke an sich herab und sank kreiselnd wieder aufs Kissen zurück. Sie war sauber. Er hatte sie gewaschen. Er hatte die Widerwärtigkeiten von ihr gewaschen. Seit sie ein Baby gewesen war, hatte das keiner mehr für sie getan. Ihr schien sogar, dass er ihre wunden Öffnungen eingecremt hatte, weiß der Teufel womit, aber es war kühl und angenehm, die fransigen Schmerzen von gestern gelindert. Ihr Blick zellteilte sich, sie blinzelte die Tränen weg und zog ihren Körper ratsuchend um das Kissen zusammen. Dieser Mann dort drüben hatte das Ekelhafteste von ihr gesehen und war immer noch da. Auch ihr Geld hätte er längst nehmen können und verschwinden. Was wollte er? Mehr Blut? Konnte sie noch mehr entbehren? Sie wünschte sich weg, zurück, in den Schlaf. Der Gedanke, dass ihre Körperausscheidungen seit Neuestem giftig und todbringend waren, durchzuckte sie schmerzlich. Trotzdem hatte Hiob sie abgewischt, berührt. Die Unreine berührt. Die Unreine. Auf viele erdenkliche Arten.
»Was bist du eigentlich für einer? Was für ein Spiel spielst du?«
»Ich töte, ich rette Leben. Ich rette mein Leben, meistens.«
»Du ... hast schon getötet? Ich meine ... Menschen?«
Hiob wunderte sich langsam, warum gerade diese Frage seinen Gesprächspartnern in letzter Zeit immer so wichtig war. Er hatte das Töten immer für eine sozialhistorische Grundkonstante in zwischenmenschlichen Verhaltensmustern gehalten.
»Menschen?« Hiob lachte leise. »Ja. Auch. Aber das meine ich eigentlich nicht. Ich töte ... nein, das kann ich dir nicht sagen. Wozu auch? Du würdest es ohnehin entweder nicht glauben oder nicht verstehen.«
»Versuch es doch. Du sagst, ich muss bald sterben ...«
»Vier Jahre noch. Das ist eine lange Zeit. Ich wünschte, ich hätte so viel.«
»Also, was hast du zu verlieren? Erklär mir, wer du bist!«
Hiob veränderte unbehaglich seine Sitzhaltung. Wie Honig suppten morgendliche Sonnenstrahlen durch das Fenster auf den Boden. »Ich habe keine Zeit mehr, Diana. Ich muss los. Eigentlich wollte ich nur warten, bis du wieder zu dir kommst, um zu sehen, ob du die Recherche gut überstanden hast.«
»... Warum ...?«
»Ich habe dich in diese Situation gebracht. Ich bin schuld an deiner Schwäche. Und es tut mir leid, dass ich dich geschlagen habe. Ich bin zurzeit ziemlich runter mit den Nerven.«
»Nein, ich meine, warum musst du gehen? Warum bleibst du nicht bei mir? Versuch es mir auszureden. Rette mein Leben.«
»Genau deshalb muss ich los, Mädchen.« Er erhob sich ächzend vom Schemel. »Wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja wieder. Vorausgesetzt, du gehst nicht wieder raus und vögelst dich zu Tode.«
Ich bin verwundet, wie ein Soldat nach einer Schlacht, dachte Diana.
Ich bin müde, mein Leib ist kaltes Blei.
Ich bin so fern, fern von zu Haus.
Ich kam hierher, um mich zu rächen. Es war zu viel, mein Hass zu schwach.
Ich werde sterben, mein Blut ist Gift, mit jeder Sekunde vermehrt sich und wuchert mein herzloser Feind in mir.
Dieser verrückte Vampir hier ist alles, was mir geblieben ist.
»Mein Blut ist Gift, du verrückter, blödsinniger Kerl. Ich habe AIDS. Du trinkst mein Blut. Du wirst verrecken.«
Hiob lachte leise, nahe bei der Tür stehend, dicht davor, ihr Leben zu verlassen. »Das wäre Pech, Mädchen. Das wäre wirklich Pech.«
Sie warf sich wild herum, deckte sich auf, krümmte sich wütend ihm entgegen, von weinerlicher, verzweifelter Kraft durchspült. »Willst du noch mehr? Ich hab noch mehr, du brauchst es nur zu nehmen. Trink mich aus, knüll mich zusammen und wirf mich weg. Bitte!«
»Adieu.« Die Tür ging zwischen ihnen zu.
»Bitte!«, flehte sie. Sich genug aus ihr zu machen, um auf sie wütend zu werden und sie zu schlagen, sie zu trinken, sie abzuwischen, auf ihr Aufwachen zu warten, das war so nah an Liebe ohne Mitleid dran, wie sie jemals wieder erfahren würde, während sie verfiel, mit 24 Jahren zu unnützem Unrat verkam, nichts weiter als ein Routinejob für eine vom Ende der Nachtschicht träumende Krankenschwester oder nicht mehr als Kummer, Ekel, Angst, Besorgnis in den Augen Sylvies oder der vorwurfsvollen Eltern Frahm. Sie schrie und heulte, bäumte sich auf dem quietschenden und rasselnden Bett auf, zerkratzte sich die Brüste unter dem quälend dünnen Stoff, warf den Kopf hin und her, riss und zog am Schorf des Handgelenkschnitts und lutschte ihr eigenes, schales, nach Blech schmeckendes Blut, das nicht mehr warm genug war, um zu wärmen. Sie war so stark gewesen in Berlin, so tapfer bei Engel Annemarie Schult, so kalt bei der Planung und im Reisebüro, jetzt schrie sie, schrie und wand sich blutig, und betete zu allen Gesichtern, an die sie sich noch erinnern konnte, dass der Hotelbesitzer auftauchte und ihr einen borkigen Holzpflock durch den Pickel über ihrem Herzen oder durch den hartgeschrumpften Magen oder durchs Maul ins Hirn trieb, nur schnell, schnell musste es gehen und keine Reue dulden.
Tatsächlich ging die Tür auch wieder auf, aber es war nicht der rasende Abschaum von der miesen Rezeption. Es war Hiob, ruhig, kopfschüttelnd. Er warf ihr den gleißendroten Rock aufs Bett.
»Hier. Zieh dich an. Und tu mir den Gefallen und hör auf zu schreien. Ich kann jetzt wirklich keine Policia-Geschichten haben. Erst recht nicht in Kolumbien.« Als er sah, dass ihre Handschlagader wieder blutete, saugte er zischend Luft ein, stapfte runter zum Portier, ließ sich die dritte Packung Kleenex auf die Rechnung setzen, lief wieder hoch, setzte die schon angezogen im goldenen Fenster schwankende Diana auf das verschmierte Bett zurück und verband sie von Neuem mit einer improvisierten Druckkompresse und ein paar Lagen reinem Tuch.
Sie atmete gegen sein Haar, versuchte störrisch, ihn zu umarmen, sich beim Aufstehen an ihn zu hängen. Er ließ es geschehen. »Hast du Geld?«, fragte er. Sie nickte. Mit dem freien Arm rupfte er das blutige Laken vom Bett, schmiss die Zudecke über den kalten Urinfleck und nahm das Laken zusammengeknüllt mit raus. Diana bezahlte das Zimmer für den angebrochenen zweiten Tag, die Kleenex-Packungen, das Laken, das Hiob mürrisch auf den Tresen warf, den Tip für ein gutes Frühstückslokal. Der Rezeptionist stellte keine Fragen. Er hatte schon genug Paare erlebt, von denen nur die eine Hälfte wieder auf eigenen Beinen rausging.
Fliegen surrten durchs winzige Foyer, krepierten schmelzend an den gelben Klebestreifen, Fliegen wallten auch draußen wie Heuschrecken zwischen den Häusern herum, wo am Horizont der Straße schon wieder Rumba-Gepfeife und -Getöse erwuchs, denn der Karneval ging weiter, war noch nicht satt, hatte noch nicht genügend Tote gefordert, war immer noch, zwar schon mit Schmerzen, aber zwanghaft-mechanisch, mit nichts anderem zu tun, geil.
»Eigentlich komisch«, stellte Diana fest, im Sonnenlicht blinzelnd und ihre Sonnenbrille vermissend, die in Berlin in einem ihrer früher so gern getragenen eleganten Blazer steckte, »wir haben im Zimmer nicht eine einzige Fliege gehabt. Die sind sonst überall.«
»Fliegen mögen mich nicht«, stellte Hiob sachlich fest. »Fliegen, Hunde und Raben stehen auf SEINER Seite.«
»Wo gehst du jetzt eigentlich mit mir hin?«
»Wir suchen eine Irrenanstalt namens Término Venturoso. Du kannst mir helfen, die Verantwortlichen abzulenken, während ich mir einen Weg durch all die kleinen und großen Monster bahne, um König Karneval zu stoppen.«
»Du bist wirklich total übergeschnappt, nicht wahr? Du bist noch viel verrückter, als ich es je sein werde.«
»Klar.« Er grinste. »Ich bin Hiob. Was hast du erwartet? Gott straft mich halt für meine Reinheit.«
Wenn es wahr ist,
dass eine psychiatrische Anstalt
wie ein trubelnder Zirkus ist,
den man tief begraben hat,
um vor ihm sicher zu sein,
dann hütet Euch
vor dem Mann
mit dem Spaten
c) Glückhafter Ausgang
Glück? Toll!
Glücksmoment? Tollkühn.
Glücksgefühl? Tolldreist.
Glückssache? Tollkirsche.
Glückskind? Tollwut!
Glückhaft? Tollhaus! Tollhaus! TOLLHAUS!!!
(Lagrima)
Während Barranquilla sich, die verschwitzte Stirn walartig nach vorne gewölbt, die fast methylblinden Augen zu roten Falten zerkniffen, unbelehrbar voranschleppte, vom Kater und der inneren Austrocknung zermürbt und gepeinigt, aber dennoch nicht bereit aufzugeben, auf allen wundgewetzten vieren vorankroch in einen weiteren Tag des brüllenden Glücks und der spasmischen Schussfahrten, mit stetig lauter werdendem Stöhnen unter Aufbietung aller ganzjährlich gesammelten Kräfte sich robbend weiter in den weichen, heißen Karneval hineinschraubte und -quetschte, während die Stadt also unterwegs war auf der Flucht vor sich selbst, kehrten Hiob und Diana in eine sirupartig klebende Cantina ein, in der Tageslichtleichen in Barhockern festgeklemmt auf das Herunterdimmen der Sonne warteten, um dann ihre langen, spirligen und Fäden ziehenden Gliedmaßen zu entfalten und sich im Tanzschritt ins Neon hechten zu können. Hiob bestellte tinto, den schwarzen, landesüblich zuckerknirschenden Kaffee, und Diana wollte Tee mit viel, viel Rum.
Beim Anheben und Ansetzen vibrierte der tinto in Hiobs Tasse wie eine dicke, ledrige, frierende Haut, und Hiobs Gesicht war beim Trinken geradezu schmerzverzerrt. Seine Stirn war weiß wie Papier und strahlte Hitze aus, die Haare vorm Gesicht zitterten.
Diana schüttete die bereits abgetrunkenen Teeschlucke in ihrer Tasse mit dem aguardiente auf und beobachtete den Mann, dem zu folgen sie jetzt bereit war, als müsste sie bei näherem Betrachten ein Motiv für ihre eigenen Gefühle erkennen können.
»Sag mal, was ist denn eigentlich mit dir los. Du wirkst auch nicht gerade gesund.«
Hiob versuchte zu grinsen, während der Kaffee ihm wie eine entrollte Lakritzschnecke die Speiseröhre hinabhing. »Ich hab so was Ähnliches wie du, auch so eine Art Immunschwäche. Ich fange mir dauernd die merkwürdigsten Sachen ein. In Berlin zum Beispiel habe ich erst letzte Woche während einer Incubus-Messe eine Art narkoleptische Herzattacke ...«
»Was ist eine Incubus-Messe?«
»Eine Incubus-Messe ist eine Art Schwarze Messe, die du während einer Weißen Messe abhältst, das heißt, du gehst zu einem normalen Gottesdienst und verkehrst heimlich, still und leise, oder auch flüsternd, alles, was der theologische Schwätzer von der Kanzel herab verbreitet, ins korrekte Gegenteil. Ist ein bisschen wie Industriesabotage, du versteht schon. Na, jedenfalls bin ich weggekippt wie ein herzkranzverfetteter Trainingsanzugproletarier vor der Glotze, wenn Silvia Kristel zum achten Male wiederholt wird, und kam prompt ins Krankenhaus. Da hatte ich dann Verstopfung, aber das ist im Krankenhaus ja wohl eher normal.« Er kratzte sich am Kopf und betrachtete dann missbilligend die Hautschuppen unter seinen Fingernägeln. »Weißt du, der biblische Hiob hat einen total üblen, stinkenden Hautausschlag am ganzen Körper gehabt, einen von der Sorte, die jeden Samariter zum Kotzen bringt. Bei mir läuft das ein bisschen anders. Ich hab mal dicke Pusteln zwischen den Schulterblättern, dann krieg ich schweißige Fieberanfälle beim Einkaufen oder auch schon mal einen elektrischen Schlag, wenn ich einen hölzernen Salzstreuer berühre, ganz so, als würde ich mit einem nicht isolierten Schraubenzieher in einer Steckdose herumfummeln. Der Hit jedoch ist eine ulkige Form von Skorbut, die ich jetzt schon dreimal für jeweils etwa ’ne Woche bekommen habe, ganz gleich, wie viele Orangen ich fresse. Zahnfleischbluten, als wenn mir jemand einen Schlagring ins Maul gehauen hätte, und Mundgeruch wie von Schering. Ich bin wohl wirklich noch’n ganzes Stück unappetitlicher als der übelste Typ, mit dem du je abgehangen hast. Wahrscheinlich hab ich beim Paktieren irgendeine mistige kleingedruckte Klausel übersehen.«