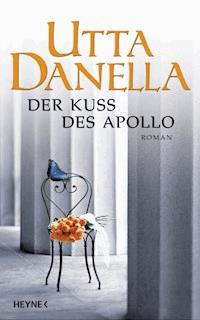9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2020
Eine leidenschaftliche Begegnung und ein geheimnisvoller Mord
Frank Seibold hat alles verloren: Seine Arbeit, seine Frau und seine Wohnung. Als er eine Stelle als Verwalter einer Plantage angeboten bekommt - auf einer abgelegenen Insel bei Schanghai -, nimmt er kurzerhand an. Auf der Reise kehrt er in einem Hotel ein, wo er einer geheimnisvollen Frau begegnet. Zwischen ihnen entbrennt Leidenschaft – doch nach einer gemeinsamen Nacht ist die Fremde fort. Auf der Plantage angekommen, erwartet Seibold großer Aufruhr: Der Plantagenbesitzer wurde in der vergangenen Nacht ermordet! Alles deutet daraufhin, dass die Gattin die Tat begangen hat, doch sie ist spurlos verschwunden …
Dramatisch, leidenschaftlich und packend erzählt Utta Danella in diesem bislang unveröffentlichten Roman eine Liebesgeschichte und eine Kriminalgeschichte zugleich. Der Fund dieses in ihrem Nachlass entdeckten Manuskript wird zahlreiche Danella-Leserinnen und –Leser begeistern.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 386
Ähnliche
Das Buch
Shanghai in den späten 1930er-Jahren. Frank Bender hat alles verloren: seine Arbeit, seine Frau und seine Wohnung. Als man ihm eine Stelle als Verwalter einer Plantage auf einer abgelegenen Insel anbietet, nimmt er kurzerhand an. Auf der Reise kehrt er in einem Hotel ein, wo er einer geheimnisvollen Frau begegnet. Zwischen ihnen entbrennt Leidenschaft – doch nach einer gemeinsamen Nacht ist die Fremde fort. Und auf der Plantage angekommen, erwartet Seibold eine erschütternde Nachricht: Der Plantagenbesitzer wurde in der vergangenen Nacht getötet. Die Hauptverdächtige ist dessen Ehefrau, die seit dem vergangenen Abend nicht mehr gesehen wurde …
Dramatisch, leidenschaftlich und packend erzählt Utta Danella in diesem bislang unveröffentlichten Roman eine Liebesgeschichte und eine Kriminalgeschichte zugleich. Das Manuskript wurde in ihrem Nachlass gefunden und wurde posthum publiziert.
Die Autorin
Utta Danella war eine der erfolgreichsten deutschsprachigen Schriftstellerinnen. Geboren und aufgewachsen in Berlin, begeisterte sie sich früh für Theater, Oper und Musik und nahm neben der Schule Schauspielunterricht, Tanz- und Gesangsstunden. Nach dem Abitur schrieb sie Beiträge für Zeitungen und den Rundfunk. 1956 veröffentlichte sie ihren ersten Roman »Alle Sterne vom Himmel«, dem viele weitere Bestseller folgten. Sie verfasste insgesamt 43 Romane und gehört mit über 70 Millionen verkauften Büchern zur Topriege der Bestsellerautoren. Utta Danella lebte bis zu ihrem Tod im Juli 2015 in München und auf Sylt.
Utta Danella
Begegnung in der Nacht
Roman
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Verlagsgruppe Random House FSC® N001967
Originalausgabe 05/2020
Copyright © 2020 dieser Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Birgit Bramlage
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock.com (Sanmongkhol, Dang Thach Hoang, Ganni)
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN: 978-3-641-26352-2V001
www.heyne.de
Vorwort
Was Sie vorneweg interessieren könnte…
Ein neues Buch von Utta Danella? Das wundert Sie möglicherweise und Sie graben in Ihrer Erinnerung. Wie soll das gehen, ist sie nicht längst gestorben? Und Sie haben Recht. Utta Danella ist 2015 gestorben und es ist eine Überraschung, dass wir noch ein neues Buch herausbringen können. Das Buch, das Sie in Händen halten, ist ein Fundstück, quasi aus einer Schatzkiste gefischt, auf die man unverhofft stößt. Sie denken jetzt sicher: Nun kommt die Sache mit dem Karton auf dem Dachboden. Ja, fast genauso ist es. Da stand noch dieser große, verstaubte Umzugskarton unter vielen anderen Kartons, die ich aus Uttas Nachlass in meinen Keller verfrachtet hatte. 5 Jahre nach ihrem Tod in der Schwabinger Jugendstilwohnung in München, in der sie seit den Siebzigerjahren gewohnt hatte, tauchte dieses Manuskript auf, eng beschrieben, auf leicht vergilbten Seiten, mit Schreibmaschine getippt, übrigens praktisch ohne Tippfehler.
Wir wollten es den Lesern nicht vorenthalten, vor allem nicht Uttas Fans, die ihr immer noch die Treue halten. Und der Anlass passt perfekt: Utta Danella wäre 2020 100 Jahre alt geworden.
Sie würde mich jetzt tadelnd anschauen, denn ihr tatsächliches Geburtsdatum hielt sie ihr Leben lang unter Verschluss. Über Jahrzehnte stand sie im Rampenlicht, immer elegant gekleidet, selbstbewusst und attraktiv, die Grande Dame der Belletristik, die in jedem Mann den Kavalier weckte. Eine charmante Gesprächspartnerin, eloquent und mit scharfem Verstand hinter strahlend blauen Augen, die sich alles zu merken schienen. Sie schrieb sich in die Herzen von Millionen meist weiblicher Leser. Kistenweise Leserbriefe zeugen noch heute davon.
Hier präsentieren wir Ihnen, posthum, eine tatsächlich neue Danella, die vielleicht für einige ihrer begeisterten Leser zu spät kommt. Veröffentlicht zu ihrem hundertsten Geburtstag, um an eine der erfolgreichsten Autorinnen Deutschlands zu erinnern und an die Zeit, in der für sie alles seinen Anfang nahm, in den Dreißigerjahren. Schon als Teenager begann sie mit dem Schreiben und hörte erst mit über 80 Jahren wieder damit auf. Dieses Buch ist eine Begegnung mit einer anderen, unbekannten Danella. Es ist kein dicker Roman, der sich erzählerisch in aller Tiefe das menschliche Schicksal vornimmt, nein. Hier stellt sie ihr Können in einem anderen Genre unter Beweis. Es ist ein Kriminalroman, der in den Dreißigerjahren des letzten Jahrhunderts spielt, soviel will ich verraten.
Gerne würde ich Utta fragen, wieso er nicht veröffentlicht wurde. Ihre verblüffte Antwort wäre vermutlich gewesen: »Ich wusste gar nicht mehr, dass ich den geschrieben habe. Sieh mal einer guck!« Ein typisch berlinerischer Ausdruck Uttas, den ich seit meiner Kindheit von ihr kenne.
Sie hat sogar regelrecht herumexperimentiert mit dem Stoff dieses Romans, wie wir heute wissen. In besagtem Karton fanden sich außer dem Romanmanuskript diverse, inhaltlich leicht veränderte Exposés und sogar eine unseres Wissens nach unveröffentlichte Hörspielfassung davon.
Nach mehr als 40 Romanen, die in den Sechzigerjahren bereits eine Millionenauflage und in den Neunzigern weltweit eine Auflage von rund 80 Millionen erreicht hatten, verlor Utta manchmal den Überblick über das, was sie in all den Jahren geschrieben hatte. Oft saß sie auf der Samtcouch mit einem Glas Wein und las mit großem Interesse ihre eigenen Bücher. Da hatte sie die 90 bereits überschritten und sich aus dem Literaturbetrieb, den Lesereisen, Interviews endgültig zurückgezogen. Sie lebte mit ihrem Hund in ihrer geräumigen Wohnung und tat, was sie zu Hause am liebsten tat: lesen.
Ihre schriftstellerische Leistung ist einzigartig in der Literaturgeschichte Deutschlands. Ihre Bücher, die auch digital verfügbar sind, teilweise verfilmt wurden und nach wie vor, in TV-Romanzen verwandelt, im Fernsehen ausgestrahlt werden, erinnern an ihr unermüdliches Schaffen. Sie wurde in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts zum Star der Unterhaltungsliteratur, die elegante und eloquente Bestsellerautorin, geschätzt und auch gefürchtet als Interviewpartnerin, weil sie nie ein Blatt vor den Mund nahm. Sie sagte jedem, ohne Rücksicht auf Rang und Ansehen, ihre Meinung – charmant, humorvoll, intelligent und schlagfertig. Eine Selfmade-Frau, die in einer Zeit, als die Männer noch über das Schicksal einer Frau bestimmten, ihren »Mann« stand, auf höchst frauliche Weise: einerseits ganz die alte Schule, andererseits modern und unabhängig. Sie lebte ein durch und durch emanzipiertes Leben, quasi bevor die Emanzipation in den Siebzigern neu erfunden wurde.
Unabhängig sein, das wollte sie schon immer. Sie war eine selbstbewusste und trotz des Krieges unerschrockene junge Frau, die in Berlin ausgebombt wurde, nach München kam und bei der Tante mit ihrer verwitweten Mutter und ihrem 9 Jahre jüngeren Bruder aufgenommen wurde. Es war eng im Haus, das Geld war knapp und Utta fand nur auf dem Dachboden Ruhe zum Schreiben. In München begann ihr kometenhafter Aufstieg und dort blieb sie bis zu ihrem Tod. Sie schrieb schon in den Kriegsjahren in Berlin heimlich und allein, auf einer Parkbank sitzend und erträumte und erschrieb sich eine bessere Welt. In München vollendete sie auch ihren ersten Roman »Alle Sterne vom Himmel«. Gleichzeitig schrieb sie unter verschiedensten Pseudonymen Theaterstücke, Kurzgeschichten für Zeitungen, Zeitschriften und den Rundfunk. Sie las alles, was sie in die Finger bekam, ging ins Theater und ins Kino. Sie bewarb sich sogar als Sekretärin und lebte das Nachkriegsleben einer jungen Frau, die selbst für ihr Auskommen sorgen musste. Sie heiratete schließlich, weil es sich so gehörte und ihr Leben vereinfachte, aber ihre Ehe hielt nicht lange. Sie fand einen Mäzen und Verleger, der ihre Karriere in Schwung brachte – Franz Schneekluth. Sie schrieb sich in den folgenden Jahren in die Bestsellerlisten.
Das Schreiben ist ein Beruf, der viel Disziplin erfordere, wie sie stets sagte, und sich mit einem Ehemann oder gar Kindern nicht vereinbaren lasse. Ihre Bücher, ihr Hund und ihr Pferd, das waren ihre Kinder. Sie liebte ihre Unabhängigkeit und unsere Familie und eine Handvoll Freunde genügten ihr vollauf. Sie erzog mich kräftig mit und prägte mein Leben von klein auf. Seit ich lesen kann, las ich alles, was sie schrieb und freue mich, dass ich 2020 zu ihrem hundertsten Geburtstag mit diesem späten Fund an sie erinnern kann. Kein Grab erinnert an sie, so war es ihr Wunsch. Ihre Bücher tun es, veröffentlicht unter Sylvia Groth, Stephan Dohl und hauptsächlich unter dem (ihrem Mädchennamen, Denneler, entlehnten) Pseudonym Utta Danella.
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen.
Mein persönlicher Dank:
An dieser Stelle möchte ich mich bei der Literaturagentur AVA, insbesondere bei Herrn Hocke und Herrn Michalek bedanken, die das Buch mit auf den Weg gebracht haben. Mein Dank gilt auch dem Münchner Heyne Verlag, der dieses letzte und vielleicht erste Buch von Utta Danella verlegt. Dort sind im Laufe der Jahre alle Taschenbücher von ihr erschienen, teilweise als Originalausgabe, wie auch dieser Jubiläumsband. Rolf Heyne, der im Jahr 2000 verstorben ist, war ihr langjähriger Verleger und guter Freund. Er hätte sich darüber sicher sehr gefreut.
Katja Sauermann
Nichte und Nachlassverwalterin von Utta Danella
1
Shanghai, späte Dreißigerjahre
In erstaunlich hohem Tempo steuerte William den Wagen durch den dichten Verkehr, scherte aus stockenden Autoschlangen aus, schlug einen Bogen und fädelte sich ein Stück weiter vorn wieder ein.
Sie sprachen kein Wort auf dieser Fahrt zum Hafen. Mit einem anderen Menschen zu schweigen konnte zur Herausforderung werden, aber mit William war es einfach und vertraut.
Frank starrte stur vor sich hin wie ein Pferd mit Scheuklappen. Kein Abschiedsblick nach links oder rechts streifte die vertrauten Straßen. Das bunte, atemberaubende Bild dieser Stadt, einst erträumt, dann bestaunt und bewundert, war ihm längst gleichgültig und zur Selbstverständlichkeit geworden. In letzter Zeit hatte er nur noch Überdruss empfunden, wenn er gezwungen gewesen war, in einem der Viertel unterwegs zu sein.
Eine Stadt wie andere auch, hatte er gedacht, sonst nichts. Womöglich war diese sogar noch gefräßiger, unbarmherziger und verlogener als andere. Glanz und Elend drängten sich wie ungleiche Zwillingsbrüder aneinander, verschwenderischer Luxus protzte ungeniert neben bitterster, lebensbedrohlicher Armut. Wem es nicht gelang, sich hier einen Platz an der Sonne zu erobern und sich auf ihm zu halten, der glitt ab und geriet unaufhaltsam in Not.
In gewisser Weise war ein Europäer, der seine privilegierte Stellung verloren hatte, sogar noch übler dran als ein Chinese, denn der gefallene Einwanderer wurde von beiden Seiten verachtet – von der Bevölkerung ebenso wie von den anderen Einwanderern. Zum wirtschaftlichen Niedergang gesellte sich der gesellschaftliche und menschliche Ruin. Kein Europäer wollte einen solchen Unglücksvogel mehr kennen, die Einheimischen verhöhnten ihn hinter vorgehaltenen Händen, und einen Weg zurück gab es nicht.
Unwillkürlich versteifte sich Franks Nacken. Nun, wenigstens ganz so weit hatte er es nicht kommen lassen. Nicht einmal in seinem engsten Bekanntenkreis hatte auch nur ein Mensch von der Ausweglosigkeit seiner Lage gewusst. Er hatte sein Gesicht gewahrt, wie die Chinesen sagten, und jetzt war er also wieder unterwegs, um von vorne anzufangen.
Zum wievielten Mal eigentlich schon? Er war nicht mehr in der Lage, die einzelnen Neuanfänge zu zählen, die sich in der Erinnerung kaum voneinander zu unterscheiden schienen. Nur war er inzwischen so unendlich müde geworden, hatte die Hoffnung verloren, die ihm in jüngeren Jahren so viel Schwung verliehen hatte, und verspürte meist nichts mehr als lähmende Gleichgültigkeit.
Das war das Schlimmste – die Gleichgültigkeit und das Fehlen jeglicher Hoffnung. Er hatte keine Wünsche und erst recht keine Träume mehr, und alles, was ihm einst Freude bereitet hatte, ja Lebensinhalt war, schien jetzt nicht länger der Mühe wert: seine Arbeit allem voran, seine Freunde, die Liebe einer Frau. Nichts davon kam ihm wichtig genug vor, um sich danach umzublicken. Er ließ all das hinter sich. Wie ein krankes Tier hegte er kein anderes Verlangen mehr, als sich in der Einsamkeit irgendeiner Höhle zu verkriechen.
Hätte ihn jemand gefragt, was er durch diesen Neuanfang zu finden hoffte, so hätte er über die Antwort nachdenken müssen. Eine Tätigkeit, die Gefühle und Gedanken betäubte, vielleicht. Ansonsten nichts als Ruhe und Leere. Das Wichtigste war ihm, dass er rasch genug von hier fortkam, dass er nicht endgültig zu Boden ging, ehe er den neugierigen, spöttischen Blicken all dieser Leute, die ihn zu kennen glaubten, entronnen war.
Dieselben Blicke hatten seinen rasanten Aufstieg und sein Glück verfolgt. Frank machte sich nichts vor: Er war sich stets bewusst gewesen, wie schnell sich die Haltung seiner Umwelt ihm gegenüber veränderte und neuen Verhältnissen anpasste. Auf kühles, distanziertes Abwarten war verhaltene Anerkennung gefolgt, schließlich echte Achtung vor seinen Fähigkeiten und vor seiner Persönlichkeit. Ein Hauch davon mochte selbst dann noch erhalten geblieben sein, als sein Glück ihn verließ. Schließlich war für jeden, der ein wenig Einblick hatte, klar ersichtlich, dass er seinen Ruin nicht selbst verschuldet hatte.
Im Grunde könnten sie mir ruhig ein bisschen Bewunderung zollen, dachte er. Ich habe mich zwar weder geschäftlich noch privat darauf verstanden, das verdammte Glück festzuhalten, aber ich trage mein Päckchen immerhin, ohne öffentlich in die Knie zu gehen.
Deshalb verließ er Shanghai. Damit niemand zu sehen bekam, wie er unwiderruflich stürzte und ihn mit Mitleid oder Spott bei dem Versuch beobachten konnte, seinen Kopf über Wasser zu halten. Es gab eine Handvoll Leute, die ihm Hilfe angeboten hatten, doch er hatte sie alle abgewiesen. Wenn jemand ihm half, dann er sich selbst. Dazu musste er fort von hier, irgendwohin, wo er allein sein konnte.
Von dem, was er vorhatte, wusste kein Mensch außer William, der mit ruhiger Souveränität den Wagen aus der Enge der Stadt lenkte. Jeder andere hätte ihm händeringend davon abgeraten, und auch William hatte anfangs keinen Hehl daraus gemacht, dass er von dem Plan nichts hielt. Wie es aber seine Art war, hatte er sein Missfallen ein einziges Mal in klare Worte gefasst und anschließend zu dem Thema geschwiegen. Mit derselben Konsequenz hatte er zu der ganzen Affäre nichts gesagt. So war eben das Holz beschaffen, aus dem dieser Kerl geschnitzt war: William war für Frank da, ganz egal, ob ihm gefiel, was dieser tat oder ließ.
Dass er auch jetzt noch für ihn da war, glich einer Wohltat. Flucht in die Wüste hatte er den Aufbruch seines Freundes genannt, doch das bedeutete nicht, dass er ihm Steine in den Weg gelegt hätte. Im Gegenteil. Wie eh und je saß er fast reglos hinter dem Steuer, eine stumme Präsenz, ohne die Frank womöglich den Verstand verloren hätte.
»Ich fahre, weil ich mir von der Einsamkeit, Ruhe und Arbeit Hilfe verspreche«, hatte Frank sich ihm zu erklären versucht. »Hilfe und vielleicht sogar eine Art von Heilung.«
»Du bist mir keine Erklärung schuldig«, hatte William erwidert. »Wenn du meinst, du musst fahren, dann bringe ich dich ans Schiff.«
Somit waren sie jetzt unterwegs – ein jeder für sich, nicht gezwungen, Worte auszutauschen, und doch nicht mutterseelenallein.
Noch nicht.
Flüchtig schob Frank eine seiner unsichtbaren Scheuklappen zurück und sandte dem anderen einen Seitenblick. Williams Mundwinkel, der sich zu einem halben Grinsen verzog, gab ihm Antwort. Eine Welle von Wärme durchwogte Franks Körper.
Von dem Mundwinkel abgesehen blieb sein langes, grob geschnittenes Gesicht mit der großen Nase und der ein wenig vorgeschobenen, skeptisch wirkenden Unterlippe unbewegt. Es strahlte dieselbe Ruhe aus wie Williams kräftige, sehnige Hände, die mit ruhiger Sicherheit den Wagen lenkten. Sein Gesicht war in Shanghai nicht unbekannt, und wer je mit ihm zu tun gehabt hatte, der wusste, wie viel Energie hinter der gelassenen Miene steckte, welche blitzschnelle Auffassungsgabe und was für ein unbestechliches Urteil.
Nur wenige – und zu diesen wenigen gehörte Frank Bender – hatten jedoch eine Ahnung von Williams Güte.
Ja, dachte Frank beinahe verwundert, auch wenn William selbst es vermutlich höchst energisch abstreiten würde: Dieser kühle Engländer, den seine Geschäftspartner als glasharten Taktiker am Verhandlungstisch und die Frauen als emotionslosen Zyniker kannten, ist im Grunde seines Herzens ein guter Mensch. Mit großem Geschick und wachsendem Erfolg vertrat William in Shanghai eine englische Firma, traute niemandem über den Weg, machte sich keinerlei Illusionen und war imstande, einen Saal voller Männer unter den Tisch zu trinken, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken.
Unter der Fassade aber lebte noch etwas anderes, das der Freund perfekt zu verbergen wusste.
Habe ich tatsächlich »Freund« gedacht?, durchfuhr es Frank.
Es war eins dieser Worte, die er aus seinem Vokabular gern gestrichen hätte. Nichtsdestotrotz traf es zu: William war sein Freund. Er war es so viel mehr als jener andere, den Frank freimütig und geradezu mit Stolz als seinen Freund bezeichnet hatte. William bedauerte zweifellos, dass er Shanghai verließ, aber er erwähnte es mit keinem weiteren Wort und versuchte nicht, ihn abzuhalten, weil er dem Wunsch seines Freundes in dieser Frage mehr Bedeutung zumaß als seinem eigenen.
Sie schwiegen noch, als sie das letzte der halbwegs akzeptablen südlichen Wohnviertel hinter sich ließen und in die Gegend um den Hafen eintauchten. Das Gelände war riesig, zeigte eindrucksvoll, was für ein Umschlagplatz diese Stadt an der Ostküste Chinas inzwischen geworden war und wie viele ihrer Mitbewerberinnen sie überflügelt hatte.
»Du kannst mich hier rauslassen«, sagte Frank, als sie in den Bereich einfuhren, in dem die kleineren Frachter lagen. Solche Schiffe kreuzten in diesen Gewässern massenweise, liefen die umliegenden Inseln an und belieferten sie mit den Waren der Pflanzer und Geschäftsleute. »Den Rest gehe ich zu Fuß.«
»Unsinn«, kam es von William zurück. »Ich habe gesagt, ich bringe dich an Bord, also bringe ich dich auch dorthin. Jede Diskussion darüber ist verschwendeter Atem.«
Er parkte den Wagen vor einer Reihe niedriger Gebäude mit Wellblechdächern, und die beiden Männer stiegen aus. Die Luft war erfüllt von Lärm, Gepolter und Geschrei. Letzte Waren wurden im Abendlicht verladen, Händler hofften, auf die Schnelle noch ein einträgliches Geschäft abzuschließen. Menschen aller Nationen und Hautfarben wimmelten durcheinander, und Kinder, Ratten, Diebe und Hunde flitzten zwischen ihnen hindurch, um zu ergattern, was abfiel oder nicht allzu scharf bewacht wurde.
Schweigend bahnten sich William und Frank ihren Weg zu dem schmutzigen kleinen Schiff. Lediglich ein einzelner Matrose in zerschlissenem Pullover stand bei der Rampe und warf nicht mehr als einen trüben, gelangweilten Blick auf die Papiere, die Frank zur Mitreise auf dem Frachter berechtigten. Auch hatte der Bursche nichts dagegen einzuwenden, dass William ihn an Bord begleitete. Vermutlich hätte ihn selbst eine Bombe, die jemand vor seinen Augen auf das traurige Gefährt geschleppt hätte, nicht dazu gebracht, Protest anzumelden.
»Es ist wirklich nicht nötig«, sagte Frank zu William.
»Nicht nötig ist dieses Gerede«, erwiderte William. »Zum letzten Mal: Ich habe gesagt, ich bringe dich an Bord, also brauchen wir wohl nicht alle paar Schritte von Neuem darüber zu debattieren.«
Sie gingen an Deck, suchten sich nebeneinander einen Platz an der Reling und steckten sich Zigaretten an. Abschiedszigaretten. Ein wenig wie die, die Todeskandidaten am Abend vor ihrer Hinrichtung angeboten bekamen, als würde der Rauch ihnen helfen, von der Welt und von sich selbst Abschied zu nehmen.
Sie hatten beide die Gesichter dem Hafen zugewandt, in dem noch immer tosender Betrieb herrschte. Dieses Treiben würde die ganze Nacht hindurch nicht verebben, und doch kam es Frank vor, als stünden sie, umhüllt von ihren Rauchschwaden, als die einzigen Menschen weit und breit auf diesem kümmerlichen alten Schiff.
Ein Gefühl der Unwirklichkeit überwältigte ihn. Er blickte über die Hafengebäude hinweg in Richtung Stadt, und es schien ihm nicht länger vorstellbar, dass tatsächlich er es gewesen war, der fünf Jahre lang hier gelebt hatte, der hier Tage voller Arbeit und Sorge, voller Mühen und Freuden, voller Erfolge und Triumphe und schließlich voller Niederlagen und Enttäuschungen verbracht hatte.
So vieles hatte er erlebt in dieser Stadt, und jetzt schien auf einen Schlag das alles ausgelöscht, bedeutungslos, vergangen und vergessen wie der Schnee vom letzten Winter. Verwundert fragte er sich, wie das möglich war. Die Jahre waren ereignisreich gewesen, bewegt, zuweilen erregend – sie konnten nicht jetzt auf einmal für sein Leben keinerlei Relevanz mehr besitzen.
Frank fand keine Antwort. Lediglich eine Ahnung dämmerte ihm, das unbestimmte Gefühl, dass trotz aller Arbeit, aller Betriebsamkeit, des vielen Geldes, das er verdient und wieder verloren hatte, und der Menschen, denen er begegnet war, seinem Leben ein eigentlicher Sinn und Gehalt gefehlt habe. Die Stadt, mit ihrem wilden, fordernden, gewaltsamen Wesen hatte ihm nicht gestattet, zu sich selbst zu finden, und er hatte niemanden bei sich gehabt, der ihm dabei hätte helfen können.
Oder doch, unterbrach er seinen Gedankenfluss. Er hatte jemanden bei sich gehabt, von dem er zumindest erhofft hatte, dass sie sich gegenseitig helfen würden, zu sich zu finden, dass sie dabei auch zueinanderfinden und ein Band schaffen würden, das haltbar und verlässlich war. Er hatte sich einen ruhenden Pol, einen Mittelpunkt für sein Dasein gewünscht, aber jener Mensch – seine Frau – war selbst zu ruhe- und schwerelos gewesen, um eine solche Rolle auszufüllen.
Andere, die sich in ihren Gedanken weniger differenziert oder auch kompliziert ausdrückten, hätten vermutlich gesagt: Es hatte ihr an Liebe gefehlt.
Und ihm wohl ebenso.
Von heute aus betrachtet, war es müßig, sich zu fragen, wer die Schuld daran trug – seine Frau, er selbst oder der Mann, den er für seinen Freund gehalten hatte, die dem Wahnsinn verfallene Stadt oder das Leben selbst. Das Ergebnis blieb immer dasselbe: eine Bilanz, die auf der negativen Seite abgeschlossen wurde und damit auch all das ins Negative zog, was er womöglich einmal als positiv empfunden hatte.
Alles, bis auf den Mann an seiner Seite.
William aus Norfolk, England.
Hätte es eine Prüfung gegeben, die Freunde auf ihre Robustheit, ihr Material, ihre Haltbarkeit testete wie Autoreifen, dann hätte dieser Mann sie bestanden.
Im Hintergrund, verborgen von allem, was sich auf der bewegten, hektisch sich drehenden Vorbühne abgespielt hatte, hatte sich diese wortkarge Freundschaft zwischen zwei Männern entwickelt, und jetzt, wo Frank Shanghai verließ, war eben diese die einzige gute Erinnerung, die er mitnahm.
Eine war besser als keine.
William wandte sich ihm zu, als hätte Frank laut gedacht. Er blies Rauch aus, scharf vorbei an Franks Gesicht. Die Frage: Was denkst du?, stellte er nicht in hörbaren Worten, aber Frank vernahm sie trotzdem.
»Es kocht eine ganze Menge Zeug hoch bei so einer Abreise«, brummte er. »Zeug, das man lieber ganz tief unten belassen hätte.«
»Was für Zeug?«
»Gedanken. Bilanzen. Die nicht zu leugnende Tatsache, dass die Summe, die ich aus den vergangenen fünf Jahren mitnehmen kann, eher kläglich ist.«
»Dafür ist die Summe der Erfahrungen, die du gemacht hast, beträchtlich«, brummte William zurück.
So miteinander brummen konnte nur ein Mann mit einem anderen, mit dem er sich in völligem Einklang befand. Für einen Außenstehenden klang es vermutlich, als würden sie überhaupt nichts sagen.
»Das ist schon richtig«, nahm Frank den Faden wieder auf. »Aber um all diese Erfahrungen reicher zu sein bedeutet eben auch, dass ich um die entsprechende Anzahl Hoffnungen ärmer bin. So leergelaufen und hoffnungslos bin ich mir nicht vorgekommen, als ich vor zwölf Jahren aus Deutschland aufgebrochen bin.«
»Du bist jetzt ja auch zwölf Jahre älter«, erwiderte William gleichmütig. »Da löst sich ein Schiff nicht mehr so leicht vom Hafen.«
Wieder schwiegen sie eine Weile, bis beide Zigaretten aufgeraucht waren.
»Jetzt häng den Kopf nicht so tief«, sagte William und sah der Kippe nach, die er im Bogen ins Meer geworfen hatte. »Ansonsten klemm ich dich unter den Arm und nehm dich wieder mit zurück.«
Frank versuchte zu lachen, was gründlich misslang. »Du weißt, dass das keine gute Idee wäre.«
»Nein, weiß ich nicht, aber das spielt keine Rolle, wenn du es zu wissen meinst«, entgegnete William. »Gib dir ein bisschen Mühe, auf dich aufzupassen, hörst du? Die Umstellung dürfte mehr als drastisch sein.«
»Genau das ist ja das Gute daran«, erwiderte Frank.
»Wir werden sehen.« Zweifelnd wiegte der Engländer seinen schweren Kopf. »Du bist nicht daran gewöhnt, im Freien zu arbeiten. Wenn du mich fragst, bist du mit Leib und Seele ein Großstadtmensch. Außerdem fordern sieben Jahre Weltenbummelei und fünf Jahre Shanghai durchaus ihren Tribut. Allzu widerstandsfähig wirst du auch nicht mehr sein.«
»Sehr schmeichelhaft, wie du über mich redest.« Frank straffte die Schultern, die zumindest in der Breite nichts zu wünschen übrig ließen. Sein Haar mochte an den Schläfen grau werden, und die feinen Linien in den Augenwinkeln löschte auch eine Nacht mit gutem Schlaf nicht mehr aus, aber sein Körper hatte seines Wissens noch nichts von seiner Spannkraft eingebüßt. »Sehe ich vielleicht schwächlich aus? Mache ich auf dich den Eindruck von einem, den das bisschen Urwald aus den Latschen kippt?«
»Das bisschen Urwald hat schon ganz andere aus den Latschen gekippt«, konterte William. »Und deine Augen sehen für mich zumindest aus, als hätten sie schon ziemlich lange keine Latschen mehr gesehen. Deine Blicke sind unstet und ziellos geworden, Frank, sie wabern ins Ungewisse. In der Stadt mag das gehen. Im Urwald ist es Gift.«
»Und du hältst es für völlig ausgeschlossen, dass dein Urteil über meine Augen deiner Einbildung entspringt?« Selbst sein Grinsen fiel schwach aus.
»Halte ich«, bestätigte William. »Wenn ich noch im Zweifel gewesen wäre, hätte mich spätestens deine sinnlose Grübelei überzeugt. Der Wurm bei dir sitzt im Innern. Natürlich ist es denkbar, dass dir gerade deshalb das härtere Leben guttun wird. Aber dazu musst du zu dir selbst zurückfinden und dich wieder auf deine Arbeit konzentrieren. Dann funktioniert der Urwald am Ende womöglich als eine Art Sanatorium: Du erholst dich, hast die Einsamkeit in absehbarer Zeit satt und kehrst zu uns zivilisierten Menschen zurück. Ich jedenfalls habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass du dich doch nicht bis ans Ende deiner Tage im Dschungel verkriechen willst.«
»Mir fiele im Augenblick nichts ein, das mich zurücklocken könnte«, bekannte Frank. »Aber angeblich soll man ja nie nie sagen.«
Der Matrose, der vorhin so desinteressiert seine Papiere kontrolliert hatte, schlich sich zu ihnen heran. »In zehn Minuten laufen wir aus«, knurrte er. »Ihr Bekannter macht also besser, dass er von Bord kommt.«
»Der Bekannte ist praktisch schon weg«, behauptete William. Dann gab er dem Mann mit einer Handbewegung zu verstehen, er solle verschwinden.
»Gewöhn dir nicht das Saufen an«, sagte er zu Frank, sobald der Matrose außer Hörweite war. »Bei Männern, die in einer Stimmung wie der deinen in den Urwald gehen, passiert das alle naselang.«
»Ich dachte, du kennst mich besser«, erwiderte Frank ein wenig gekränkt. »Hätte ich das Saufen anfangen wollen, hätte ich es längst getan. Etwas anderes als den Rest von Selbstachtung, den ich noch immer in mir habe, gab es ja nicht, um mich abzuhalten.«
»Der Dschungel bleibt der Dschungel«, beharrte William. »Da herrschen andere Gesetze.«
»Ach was, Dschungel«, wehrte Frank ab. »Findest du nicht, dass du übertreibst? Eine moderne Plantage ist weder Urwald noch Wildnis, sondern selbst im Innern des Landes eine zivilisierte und völlig gefahrlose Angelegenheit. Bis zur Küste ist es nicht mehr als eine knappe Tagesfahrt, und die Autostraße soll ziemlich grandios sein. Mein altes Auto habe ich ja schon rüberschiffen lassen. Viel taugt es nicht mehr, aber zäh ist es noch immer. Das hat es mit mir gemeinsam. Falls ich mich langweilen sollte, hindert mich also nichts, mich auf den Weg in die Stadt zu machen.«
»Freut mich für dich«, bemerkte William trocken.
Wiederum schweigend und ein wenig verwundert sahen sie einander an. In ihrer gesamten Bekanntschaft hatten sie nicht so viele Worte am Stück gewechselt wie in der letzten Viertelstunde.
»Eins noch.« Williams Stimme klang belegt, als kämpfe er gegen einen Klumpen im Hals. »Ich habe gestern mit dem alten Miller gesprochen. Zufällig. Er hat erwähnt, dass er Brandon gut kennt und dass er ihn für einen der reichsten Männer hier im Osten hält.«
»Damit dürfte er richtigliegen.«
»Er soll mehr als ein Dutzend Plantagen haben«, fuhr William fort. »Gummi, Zucker, Tabak, Hanf, Kopra, was immer das Herz begehrt. Und ein gerissener Geschäftsmann soll er noch obendrein sein.«
»Um die Plantagen kümmert er sich aber kaum mehr selbst«, wandte Frank ein. »Er kommt nur gelegentlich, um sie zu inspizieren. Deshalb braucht er ja Leute wie mich.«
»Genau«, sagte William. »Deshalb braucht er Leute wie dich, die zuverlässig und selbstständig genug sind, um seine Plantagen für ihn zu leiten. Was ihn persönlich betrifft, hat Miller allerdings kein Blatt vor den Mund genommen: Dieser Brandon soll ein mehr als nur unangenehmer Besitzer sein, einer, vor dem man sich besser in Acht nimmt.«
Frank zuckte die Schultern. Es war nicht das erste Mal, dass er solche Gerüchte über seinen künftigen Arbeitgeber hörte. »Ich denke nicht, dass ich viel mit ihm zu tun haben werde«, sagte er leichthin. »Nach allem, was ich weiß, lässt er sich wirklich nicht öfter als ein- oder zweimal im Jahr zur Inspektion auf der Plantage blicken. Was sein gutes Recht ist, denn es geht schließlich um seinen Besitz.«
»Sein Recht macht ihm ja niemand streitig«, brummte William. »Wenn du ankommst, triffst du dich mit ihm, richtig?«
»Ja, natürlich«, antwortete Frank. »Er muss mich ja einweisen. Ich treffe ihn auf der Plantage.«
William sah aus, als wollte er noch etwas sagen, schluckte es im letzten Augenblick jedoch herunter. »Ich denke, ich gehe dann besser«, sagte er. »Unser Freund lehnt da hinten an der Reling, als wäre er entschlossen, mich über Bord zu stoßen, falls ich beim Ablegen noch hier sein sollte.«
Er sah Frank ins Gesicht, und der bemerkte geradezu verblüfft, wie blau seine Augen waren. Im Vorbeigehen schlug ihm der Freund auf den Rücken. »Dann mach es mal gut, mein Alter. Lass dich von keinem Tiger fressen und von keiner Schlange beißen. Als wären das die größten Gefahren, die diese Wildnis für uns bereithält. Bring deine Nerven in Ordnung, und lass dich wieder blicken, verstanden? Ich erwarte noch beachtliche Taten von dir, ob du das glaubst oder nicht.«
Noch einmal versuchte Frank zu lachen, hatte aber kaum mehr Erfolg als beim ersten Mal. »Ich gebe mir Mühe. Und William – wo ich bin, geht niemanden etwas an, in Ordnung? Schon gar nicht Peggy oder …« Er ließ den Namen unausgesprochen und den Rest des Satzes in der Luft hängen. Stattdessen setzte er neu an: »Die Vergangenheit soll endlich begraben sein.«
»Begraben wir sie«, stimmte William zu. »Ich bin das Grab, das schweigt, von mir erfährt niemand ein Wort.«
»Danke, William.«
Der Freund hatte fast die Stiege erreicht, die hinunter an die Rampe führte, da lief Frank ihm noch einmal hinterher und packte ihn am Arm. »Ich bin nicht gut in solchen Sachen«, sagte er. »Und nach allem, was mir letzthin passiert ist, bin ich vermutlich noch schlechter geworden. Aber du hast dich großartig benommen und bist mehr als dein Gewicht in Gold wert. Wirklich. Dafür, dass du mir durch diese gottverdammte, dreckige Zeit geholfen hast, werde ich dir nie genug danken können.«
»Quatsch«, unterbrach William ihn knapp. »Über solchen Unsinn brauchen wir doch wohl nicht zu reden.«
»Nein. Natürlich nicht.«
Sie brauchten über gar nichts mehr zu reden, sondern hatten alles gesagt, was sich sagen ließ.
Kurz schüttelten sie sich die Hände und tauschten noch einen Blick. Sie waren einander nicht ähnlich, vom Charakter so wenig wie von Herkunft und Lebensgeschichte, und dennoch hatten sie einander in diesem Strudel bunter Gestalten und wesenloser Schemen gefunden, weil etwas sie einte.
Etwas, das sich mit Worten kaum beschreiben ließ. Menschlichkeit war vielleicht ein Begriff dafür, Streben nach einem Glück, einer Art von Erfüllung, die auf dieser vielgestaltigen und vielgesichtigen Erde so schwierig zu finden war.
Frank wusste es nicht, und es strengte ihn schmerzhaft an, noch länger darüber nachzudenken. Er boxte William gegen den Arm. »Mach, dass du runterkommst. Um ersäuft zu werden, bist du zu schade.«
Er sah der eindrucksvollen Gestalt des Freundes nach, bis er ihn aus dem Blick verlor. Dann wandte er sich heftig ab, ohne noch einen weiteren Blick auf Stadt und Hafen zu werfen, als könne er damit seine Vergangenheit hinter sich lassen.
Irgendwo auf diesem traurigen Kahn muss sich eine Bar befinden, in der ein Mann etwas zu trinken bekommt, sagte er sich, riss sich zusammen und begab sich auf die Suche danach.
2
Die Reise auf dem kleinen Schiff bot so gut wie überhaupt keine Abwechslung. Damit ließ sie einem Mann, der in die Einsamkeit reiste, zu viel Zeit zum Nachdenken, und das tat ihm nicht gut.
Die ohnehin kümmerlichen Reste von Unternehmungsgeist und Tatkraft, die Frank in den letzten Tagen vor seinem Aufbruch beflügelt hatten, schmolzen in der lähmenden Hitze wie Butter dahin. Es gab nichts, womit er sich beschäftigen konnte. In den Stunden der unerträglichsten Hitze lag er zwischen Dösen und Grübeln in einem Deckstuhl, wanderte, sobald es ein wenig kühler wurde, auf dem kurzen Deck endlos auf und ab und verbrachte halbe Nächte, in denen er keinen Schlaf fand, in der trostlosen, verdreckten Bar, wo er Whisky trank und Kette rauchte.
Dem Gespräch mit den wenigen Mitreisenden wich er aus, so gut er konnte. Er wollte allein sein, doch zugleich litt er unter seiner Einsamkeit schlimmer als ein Hund. Monatelang hatte er sich danach gesehnt, hatte diese Stellung auf der Brandon-Plantage nur angenommen, weil sie ihm nahezu völlige Einsamkeit versprach, doch jetzt stellte er mit Schrecken fest, dass er sie kaum ertrug.
Das geschäftige Leben in der Stadt und der schon verlorene Kampf um seinen Betrieb waren ihm wie ein Weg durch die Hölle erschienen, doch jetzt musste er feststellen, dass er lediglich eine Vorhölle durchschritten hatte. Er war verzweifelt, zornig, ohnmächtig gewesen, hatte verhandelt, gestritten und gewütet, war auch zusammengebrochen und den Tränen nah gewesen, aber das alles erwies sich als das kleinere Übel im Vergleich mit seinem jetzigen Zustand. Nun war er ohne Unterbrechung sich selbst und seinen Gedanken überlassen.
Das Alleinsein taugte für glückliche, ausgeglichene Menschen. Für einen Mann, der unglücklich und gescheitert war, entwickelte es jedoch Gefahren, die denen von Rauschgift nicht nachstanden. In der von der Hitze diesigen Luft, die das Atmen schwer machte, sah er sein ganzes bisheriges Leben vor seinen Augen zerfließen. Es zerrann ihm zwischen den Fingern wie eine der Figuren aus feuchtem Sand, die Kinder am Meeresufer bauten und die sich in nichts auflöste, sobald die Sonne den Sand trocknete.
Nichts blieb zurück, nichts milderte die erschreckende Erkenntnis.
Mit leeren Händen stand er da und musste wie damals, als junger Spund von zwanzig Jahren, noch einmal ganz von vorn anfangen. Nur fehlte ihm der Mut, der ihn zu jener Zeit über jede Hürde, jeden Stolperstein hinweggetragen hatte. Er war nicht mehr zwanzig, sondern wurde gerade heute doppelt so alt.
Für einen Mann ist das doch kein Alter, hätten ihm zweifellos die meisten Leute erklärt. Du stehst noch mitten im Leben, weshalb soll dir also nicht noch mal ein Neubeginn gelingen?
Weil ich nicht weiß, wofür, hallte ihm das Echo seiner Gedanken entgegen.
Durch die dunstigen Schwaden zog sein Leben als ein Strom von Bildern an ihm vorbei:
Es hatte harmonisch, ja geradezu privilegiert begonnen. Seine Kindheit war schön und sorglos gewesen. Er hatte eine sorgfältige Erziehung genossen und von seinen Eltern jede Möglichkeit erhalten, Geist und Verstand zu bilden. Dann war der Weltkrieg gekommen. Anfangs war Frank zu jung gewesen, und wie viele hatte er gehofft, der Krieg werde vorüber sein, ehe er die Altersgrenze überschritt, doch so viel Glück war ihm versagt geblieben. Zwei Jahre lang hatte er kämpfen müssen, er hatte es zum Offizier gebracht und war zuerst im Südosten, dann in Frankreich eingesetzt worden.
Auch dabei schien jedoch ein Schutzengel über ihn zu wachen: Er trug lediglich eine leichte Verwundung davon und sah sich nie gezwungen, etwas zu tun, das sein noch junges Gewissen in unerträglicher Weise belastet hätte. Aus der Niederlage und allen Erkenntnissen, die daraus folgten, ging er gereift und entschlossener hervor.
Das Deutschland, in das er zurückkam, war nicht mehr das, was er verlassen hatte. Das völlig neue politische System kämpfte um Anerkennung, mit den Reparationen aus dem verlorenen Krieg würde das Land auf Jahrzehnte hinaus verschuldet sein, und die Menschen litten bittere Not. All das entmutigte Frank jedoch nicht. Im Gegenteil. Mit Feuereifer stürzte er sich in sein Studium des Ingenieurswesens, wohl in der Hoffnung, die Chance des Zusammenbruchs zu nutzen, anzupacken und etwas ganz Neues aufzubauen.
Als er seinen Abschluss in der Tasche hatte, herrschte in Deutschland jedoch eine Arbeitslosigkeit von nie gekanntem Ausmaß. Er fand keine Stellung, die auch nur im Mindesten seinen Fähigkeiten entsprach, und wie den meisten jungen Menschen fehlte es ihm an Geduld. Tatenlos abzuwarten und die Hände im Schoß zu falten war seine Sache nicht, auch wenn seine Familie ihn unterstützt hätte. Kurz entschlossen kappte er in seiner Heimat alle Verbindungen und machte sich ohne festgelegtes Ziel ins Ausland auf.
So hatten die Jahre seiner Wanderung begonnen. Leicht war ihm das Emigrantenleben anfangs wahrlich nicht gefallen. Er hatte all seine jugendlichen Kräfte und seinen Mut zusammennehmen müssen, um nicht zu straucheln und in den nächstbesten Graben zu stürzen. Von den Dingen, die er sich aufzubauen versuchte, misslang so manches, anderes aber machte er zum Erfolg. Die Welt war groß, und in diesen frühen Jahren schien sie ihm trotz allem zu Füßen zu liegen, ihm für jeden Weg, der sich verschloss, hundert neue zu bieten.
Er war jung, hatte seinen Beruf gründlich erlernt, und er war keiner, der sich leicht unterkriegen ließ. Wenn er in seinem eigentlichen Feld als Bauingenieur keine Stellung fand, die ihm passte, probierte er sich in einem anderen aus und sammelte auf diese Weise wertvolle Erfahrungen.
In einer solchen flauen Periode hatte er schon einmal eine Arbeit auf einer Plantage angenommen. Damals hatte er in Hinterindien gelebt und sich eine Zeit lang ganz ordentlich geschlagen, bis ihm Dschungel und Urwaldeinsamkeit zu viel wurden und er sich wieder nach menschlicher Gesellschaft sehnte. Der Wunsch, wieder in einer Stadt zu leben und in seinem angestammten Beruf zu arbeiten, hatte ihn damals nach Shanghai gebracht.
Anfangs hatte er geglaubt, die Stadt sei wie für ihn geschaffen, denn zum ersten Mal hatte er echtes Glück. Er lernte auf Anhieb die richtigen Leute kennen, fand Männer, die an ihn glaubten und sich bereit erklärten, ihm Geld zur Verfügung zu stellen, und wagte den Schritt, als Bauingenieur seine eigene Firma zu gründen. Ideen hatte er wie Sand am Meer, und er schien damit in der wimmelnden Metropole einen Nerv zu treffen. Sein Geschäft blühte, binnen Kurzem machte er sich einen Namen und verdiente Summen, von denen er zuvor nicht einmal zu träumen gewagt hatte.
Zur selben Zeit brach in Deutschland die geschundene, in ihren letzten Atemzügen hechelnde Demokratie zusammen, und die Nationalsozialisten übernahmen die Macht. Vereinzelten Meldungen zufolge, die Frank in Shanghai zu Ohren kamen, stabilisierten sich in der Heimat die Verhältnisse. Es gab wieder Arbeit, Geld für Investitionen, und so mancher Deutsche, der seiner Heimat in den Krisenjahren den Rücken gekehrt hatte, erwog jetzt eine Rückkehr.
Für Frank selbst kam das jedoch nicht infrage. Er war ein freies, unabhängiges Leben gewohnt, hatte es sich nie verbieten lassen, seine Meinung zu sagen, und die neuen Machthaber in Deutschland waren ihm zutiefst verhasst. Um nichts in der Welt hätte er sich in ihr diktatorisches Staatsgefüge einordnen wollen, schließlich war er glücklich dort, wo er war. Seine klare Haltung gegen die Regierung in Deutschland verschaffte ihm in Shanghai Sympathien unter den Angehörigen sämtlicher Nationen. Eine Zeit lang erschien es ihm beinahe, als werde alles, was er in die Hände nahm, zu Gold.
Und dann war auf einmal Heinz in Shanghai aufgetaucht und hatte ein Stück Heimat in die Fremde gebracht. Heinz war sein Freund seit Studientagen, ein freier, unbändiger Geist wie er selbst, dazu einer, der vor Energie und Ideen sprühte. Unter das Joch der Nazis hatte dieser Bursche sich unmöglich fügen können, und binnen Kurzem fand er sich in einem ihrer berüchtigten Gefängnisse wieder. Als er mit mehr Glück als Verstand noch einmal in Freiheit gelangte, zögerte er nicht, sondern verließ Deutschland noch am selben Tag. Eine Zeit lang hielt er sich bei Verwandten in Österreich auf, zog dann in die Schweiz und nach Frankreich weiter, doch es gelang ihm nicht, irgendwo Fuß zu fassen.
Das war der Moment, in dem er sich seines Freundes in Shanghai besann. Frank war mehr als glücklich, ihn in seiner neuen Heimat zu begrüßen, und innerhalb kürzester Zeit machte er ihn zum Teilhaber in seiner Firma.
Damals war ihm sein Leben perfekt erschienen, geordnet, gesichert und erfüllt von Glück. Er besaß eine gut gehende Firma, die beständig wuchs, er verfügte über ein ansehnliches Kapital, war ein angesehenes Mitglied der Gesellschaft und hatte darüber hinaus einen echten Freund an seiner Seite.
Und er hatte Peggy.
Wundervolle, unvergleichliche, angebetete Peggy.
Schmal und zierlich, mit langen Beinen und einem Schopf voller wirbelnder kupferroter Locken war dieses unglaubliche Mädchen in sein Leben getanzt und hatte sich im Handumdrehen den wichtigsten Platz darin erobert. Ihr Vater war einer seiner Geldgeber gewesen, ein beleibter Holländer, dem im Geschäftsleben so schnell keiner ein X für ein U vormachte und der den Osten der Welt kannte wie andere ihre Westentasche. In Shanghai lebte er bereits seit etlichen Jahren, und seine Tochter hatte fast ihre gesamte Jugend hier verbracht.
Für ihren Vater war Peggy die Krone der Schöpfung. Dem entsprach die Erziehung, die er ihr hatte angedeihen lassen, und wenn Frank es nüchtern betrachtete, war das, was aus ihr geworden war, vermutlich eine direkte Folge davon. Ihr Vater hatte die Mittel und Möglichkeiten gehabt, sie maß- und hemmungslos zu verwöhnen, und genau das hatte er getan. Ihr hatte alles zur Verfügung gestanden, was ihrer Entwicklung zu einer gebildeten, kultivierten Frau zuträglich war, doch die Heranbildung von Herzenswärme war darüber versäumt worden.
Das Wesen, zu dem sie schließlich herangewachsen war, mochte von der Verwöhnung im Elternhaus ebenso geformt worden sein wie von ihrer eigenen gefährlichen Veranlagung und der eigentümlichen Atmosphäre der Stadt.
Äußerlich war sie ganz die wohlerzogene junge Dame aus gutem Hause, die ihre Umwelt gern in ihr sehen wollte. Sie besaß Charme und geschliffene Umgangsformen, wusste sich in der Gesellschaft zu bewegen und anmutig zu plaudern, tanzte hinreißend und verfügte über einen erlesenen Geschmack. In dieser auf Hochglanz polierten Schale steckte jedoch ein vollkommen haltloses und trotz ihrer Jugend bereits durch und durch verwahrlostes Geschöpf.
Frank hatte davon anfangs nicht das Geringste geahnt. Er lief ihr bei allen möglichen gesellschaftlichen Anlässen über den Weg, traf sie beim Reiten und auf dem Tennisplatz, sah sie am Steuer ihres eleganten Zweisitzers, in Tanzlokalen und Bars und war jedes Mal aufs Neue fasziniert vom Zauber dieser Frau, von ihrem sprühenden Temperament, ihrer Lebensgier und ihrer Art zu kokettieren, die vollkommen unschuldig wirkte. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er kaum Gelegenheit gehabt, sich um Begegnungen mit dem weiblichen Geschlecht zu kümmern, geschweige denn sie zu vertiefen. Der harte Kampf um eine Existenz, um Boden unter den Füßen hatte ihm dazu weder Zeit noch Energie gelassen.
Sein Herz war ausgehungert.
Ausgehungert nach Liebe, Wärme, Vertrauen und Zweisamkeit.
So war es nicht weiter verwunderlich, dass er sich Hals über Kopf verliebte, ohne seinen Verstand und die im Lauf der Jahre erworbene Menschenkenntnis zurate zu ziehen. Als ihm zu dämmern begann, wer Peggy wirklich war, war es zu spät, denn da trug sie bereits seinen Ring am Finger.
Ungläubig musste er feststellen, dass dort, wo er ein zartes, unerfahrenes, vor Lebenshunger brennendes Mädchen vermutet hatte, eine Frau stand, die mit mindestens ebenso vielen Wassern gewaschen war wie ihr Vater, die ihn an Gewieftheit und Raffinesse vermutlich um Längen übertraf und die das, was man die Waffen einer Frau nannte, auszuspielen vermochte wie selten eine zweite.
Nachdem er den ersten Schock überwunden hatte, glaubte er, sich damit abfinden zu können. Sie war eben genauso ausgehungert wie ich, sagte er sich, wild auf Liebe, wild auf mich, zu allem bereit, um sich den Mann ihres Herzens zu erobern. In gewisser Weise gefiel ihm die Vorstellung. Der Gedanke an eine Peggy, die sämtliche Register zog, um ihn für sich zu gewinnen, machte ihn glücklich, und die Sache hatte nur einen Haken:
Peggy besaß gar kein Herz. Zumindest nicht in dem metaphorischen Sinn, in dem der Begriff für gewöhnlich benutzt wurde.
Was für sie zählte, war ihr Körper. Seinen Begierden, seinen Launen und seiner makellosen Schönheit war sie bereit alles andere zu opfern und unterzuordnen.
Bereits in der Hochzeitsnacht hatte sie den gewiss nicht prüden Frank sprachlos gemacht, indem sie scheinbar völlig unbefangen begonnen hatte, ihm in sämtlichen grafischen Einzelheiten von ihren sexuellen Erfahrungen zu erzählen. Er gab sich Mühe, es erregend zu finden, sagte sich, dass vermutlich der überwiegende Teil seiner Bekannten ihn um die Frau mit dem Kindergesicht glühend beneidet hätte, doch er konnte nicht verhindern, dass er sich von Aspekten ihrer Berichte erschüttert, wenn nicht sogar abgestoßen fühlte.
Noch immer wehrte er sich dagegen, sich ernüchtern zu lassen. Von dieser Ehe hatte er geträumt, und er war entschlossen, alles dranzugeben, damit sie ein Traum blieb. Also predigte er sich selbst, er dürfe sich nicht als Moralapostel aufspielen. Vielmehr müsse er sich bemühen, Peggy in der Tiefe ihres Wesens zu verstehen, müsse Mitgefühl mit einem Mädchen entwickeln, dem zwar sein Vater jeden Wunsch von den Augen abgelesen hatte, das aber ohne Mutter in einer Stadt aufgewachsen war, in der alles größer geschrieben wurde als Ethik und Menschlichkeit. Ihr hatte das weibliche Geleit gefehlt, das Vorbild, dem sie hätte nacheifern und das ihr mit Rat und Anleitung hätte helfen können.
In den entscheidenden, prägenden Jahren war Peggy ein armes, reiches Mädchen gewesen, das mit materiellen Gütern überschüttet wurde, um dessen Seele sich jedoch kein Mensch bemüht hatte.
Frank war fest entschlossen, ebendies nachzuholen. Er wollte sie behüten, wollte sie vor den schädlichen Wegen bewahren, die sie bisher bedenkenlos eingeschlagen hatte, und ihr die Augen für die wirklichen Werte des Lebens öffnen. Peggy mit ihrem beweglichen Geist und ihrer ausgeprägten Selbstgefälligkeit war gerührt und fühlte sich durch den Ernst, mit dem er sein Vorhaben in die Tat umsetzte, geschmeichelt. Nie zuvor war es passiert, dass ein Mann nicht um die unübersehbaren Reize ihres Körpers, sondern um ihre verborgene Seele warb. Für sie war es eine Art neues Spiel, das ihre Langeweile dämpfte und ihr Vergnügen bereitete. Sie spielte es mit. Und eine Weile lang schien Franks Plan aufzugehen.
In dieser Zeit war er glücklich gewesen. Vielleicht nicht so unbeschwert glücklich, wie er es am Tag seiner Hochzeit gewesen war, aber damit konnte er fertigwerden. Er war kein sternenäugiges Jüngelchen mehr, sondern ein gestandener Mann, der wusste, dass das Leben nicht aus Träumen bestand. Er fühlte sich mit seiner selbst gestellten Aufgabe wohl, hegte keinerlei Zweifel daran, dass er das Richtige tat, und freute sich über jeden kleinen Fortschritt, den es in ihrem Zusammensein zu geben schien. Seine Geschäfte liefen gut, er kannte keine finanziellen Sorgen. Wie also hätte er nicht glücklich sein sollen in dieser flüchtigen Zeit, die ihm heute, im Rückblick betrachtet, wie ein Rausch erschien?