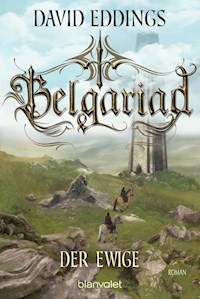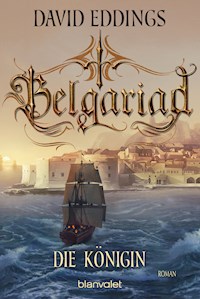9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Belgariad-Saga
- Sprache: Deutsch
Der Fantasy-Klassiker endlich wieder verfügbar – in überarbeiteter Neuausgabe.
Je mehr der junge Garion über die Mission, die seine Gefährten und er übernommen haben, erfährt, desto mehr empfindet er sich als Belastung. Seine Freunde sind große Krieger, geschickte Diebe, mächtige Zauberer – und er ist scheinbar nur ein einfacher Junge vom Land. Mit Garion erschuf der New-York-Times-Platz-1-Bestsellerautor David Eddings in den 80er-Jahren eine neue Art des Fantasy-Helden: der vermeintlich einfache Junge, dessen Schicksal es ist, die Welt zu retten. Damit ebnete er Autoren wie Christopher Paolini, Trudi Canavan und Jonathan Stroud den Weg zum Erfolg und ermöglichte so der Fantasy die Öffnung für eine breite Leserschaft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 467
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Buch
Garion und seine Gefährten kommen dem Dieb vom Auge Aldurs immer näher. Der Erfolg ihrer Mission wird greifbar. Doch gleichzeitig bricht für den jungen Garion die Welt zusammen, als er herausfindet, dass seine Tante Pol gar nicht seine Tante ist. Außerdem sind seine »Freunde« alles mächtige Männer, die unmöglich an einem einfachen Jungen vom Lande wie ihm interessiert sein können. Er flüchtet sich in Trotz und Wut – und merkt nicht einmal, wie nah sein Schicksal vor der Erfüllung steht.
Autor
David Eddings wurde 1931 in Spokane im US-Bundesstaat Washington geboren. Während seines Dienstes für die US-Streitkräfte erwarb er einen Bachelor of Arts und einige Jahre darauf einen Master of Arts an der University of Washington. Bevor er 1982 seinen ersten großen Roman, Belgariad – Die Gefährten, veröffentlichte, arbeitete er für den Flugzeughersteller Boeing. Im Jahr 2009 starb er in Caron City, Nevada.Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvaletund www.twitter.com/BlanvaletVerlag
DAVID EDDINGS
DER BLINDE
ROMAN
DEUTSCH VON IRMHILD HÜBNER
Für Dorothy, die den Eddings-Männern nach wie vor gewogen ist – und für Wayne, aus Gründen, die wir beide kennen,aber nie benennen könnten
PROLOG
Ein Bericht über die Suche des Gorims nach einem Gott für sein Volk und wie er auf dem heiligen Berg Prolgu schließlich UL begegnete
– nach dem Buch von Ulgo und anderen Fragmenten
Im Anbeginn aller Zeiten schufen die sieben Götter die Welt aus der Dunkelheit, und sie erschufen Tiere und Vögel, Schlangen und Fische und zuletzt den Menschen.
Nun lebte in den Himmeln ein Geist, der UL genannt wurde. Er nahm keinen Anteil an dieser Schöpfung, und da er seine Macht und seine Weisheit zurückhielt, war so manches, das geschaffen wurde, unvollkommen oder verunstaltet. Viele Geschöpfe waren abstoßend und seltsam. Die jüngeren Götter wollten diese Schöpfungen wieder rückgängig machen, auf dass die Welt voll Schönheit sei.
Aber UL streckte seine Hand aus und sprach: »Was ihr erschaffen habt, sollt ihr nicht ungeschehen machen. Ihr habt den Frieden und das Gefüge des Himmels zerrissen, um diese Welt zu erschaffen als Spielzeug zu eurer Unterhaltung. Aber wisset, was immer ihr erschafft, und sei es auch noch so ungeheuerlich, soll leben als Mahnung für eure Torheit. An dem Tag, an dem ihr eine eurer Schöpfungen ungeschehen macht, wird alles ungeschehen sein.«
Die jüngeren Götter waren erzürnt. Zu jedem ungeheuerlichen oder hässlichen Wesen, das sie geschaffen hatten, sagten sie: »Geh zu UL und lass ihn dein Gott sein.« Dann wählte unter den Völkern der Menschen jeder Gott das eine, das ihm gefiel. Und als es dann noch Völker gab, die keinen Gott hatten, trieben die Götter sie fort und sprachen: »Geht zu UL, denn er soll euer Gott sein.« Und UL sprach kein Wort.
Lange und bittere Jahre wanderten die Gottlosen umher, und ihre Klagen verhallten ungehört in den Ödlanden und der Wildnis des Westens.
Dann erschien unter ihnen ein redlicher und rechtschaffener Mann namens Gorim. Er sammelte die Menge um sich und sprach: »Wir welken und fallen wie Blätter von den Bäumen durch die Unbilden unserer Wanderung. Unsere Kinder und unsere Alten sterben. Es ist besser, wenn nur einer stirbt. Deshalb sollt ihr hierbleiben auf dieser Ebene. Ich werde den Gott namens UL suchen, auf dass wir ihn anbeten können und einen Platz in dieser Welt haben.«
Zwanzig Jahre lang suchte Gorim nach UL, doch vergebens. Die Jahre vergingen, sein Haar wurde grau, und er wurde seiner Suche müde. In seiner Verzweiflung stieg er auf einen hohen Berg und rief mit mächtiger Stimme zum Himmel empor: »Nicht mehr länger! Ich werde nicht länger suchen. Die Götter sind nur Hohn und Täuschung, und die Welt ist eine trostlose Leere. Es gibt keinen UL, und ich bin der Trübsal und des Fluches meines Lebens überdrüssig.«
Der Geist UL hörte ihn und antwortete: »Warum zürnst du mir, Gorim? Deine Erschaffung und deine Verstoßung waren nicht mein Werk.«
Gorim fürchtete sich und fiel auf die Knie. Und wieder sprach UL: »Erhebe dich, Gorim, denn ich bin nicht dein Gott.«
Doch Gorim erhob sich nicht. »Oh mein Gott«, rief er, »verbirg dich nicht länger vor deinem Volk, das so tiefen Kummer hat, denn es ist verstoßen und hat keinen Gott, der es beschützt.«
»Erhebe dich, Gorim«, wiederholte UL, »und verlasse diesen Ort. Such dir woanders einen Gott und lass mich in Frieden.«
Noch immer erhob sich Gorim nicht. »Oh mein Gott«, sagte er, »ich werde bleiben. Dein Volk hungert und dürstet. Es braucht deinen Segen und einen Ort, an dem es leben kann.«
»Dein Gerede ermüdet mich«, sagte UL und verschwand. Gorim blieb auf dem Berg, und die Tiere des Feldes und die Vögel der Luft brachten ihm Nahrung. Länger als ein Jahr blieb er. Dann kamen die ungeheuerlichen und hässlichen Wesen, die die Götter erschaffen hatten, und setzten sich ihm zu Füßen und beobachteten ihn.
Der Geist UL war beunruhigt. Schließlich erschien er Gorim erneut. »Harrst du noch immer aus?«
Gorim fiel auf die Knie und sprach: »Oh mein Gott, dein Volk ruft dich an in seiner Not.«
Der Geist UL floh. Aber Gorim harrte ein weiteres Jahr aus. Drachen brachten ihm Fleisch, und Einhörner gaben ihm Wasser. Und UL kam zu ihm und fragte: »Harrst du noch immer aus?«
Wieder fiel Gorim auf die Knie. »Oh mein Gott«, rief er, »dein Volk geht zugrunde ohne deine Fürsorge.« Und UL floh vor diesem rechtschaffenen Mann.
Ein weiteres Jahr verging, in dem namenlose, nie gesehene Wesen ihm Speise und Trank brachten. Und der Geist UL kam zu dem hohen Berg und befahl: »Erhebe dich, Gorim.«
Auf Knien flehte Gorim: »Oh mein Gott, hab Gnade.«
»Erhebe dich, Gorim«, wiederholte UL. Er streckte die Hand aus und hob Gorim auf. »Ich bin UL – dein Gott. Ich befehle dir aufzustehen vor mir.«
»Dann willst du mein Gott sein?«, fragte Gorim. »Und der Gott meines Volkes?«
»Ich bin dein Gott und der deines Volkes.«
Gorim blickte von der Höhe hinab und sah all die hässlichen Kreaturen, die während seiner Mühsal für ihn gesorgt hatten.
»Was ist mit diesen, oh mein Gott? Willst du auch Gott sein für den Basilisken und den Minotaurus, den Drachen und die Chimäre, das Einhorn und das Wesen ohne Namen, für die geflügelte Schlange und das nie gesehene Wesen? Denn diese sind gleichermaßen verstoßen. Und doch ist Schönheit in jedem von ihnen verborgen. Wende dich nicht von ihnen ab, oh mein Gott, denn der Wert jedes Einzelnen von ihnen ist groß. Sie wurden von den jüngeren Göttern zu dir geschickt. Wer wird ihr Gott sein, wenn du sie ablehnst?«
»Es geschah gegen meinen Willen«, sagte UL. »Diese Wesen wurden zu mir geschickt, um mir Schande zu bereiten, weil ich die jüngeren Götter getadelt habe. Ich will keinesfalls Gott sein für Ungeheuer.«
Die Wesen zu Gorims Füßen wehklagten. Gorim setzte sich und sprach: »Dann will ich ausharren, oh mein Gott.«
»Harre aus, wenn es dir beliebt«, sagte UL und verschwand.
Alles war wie zuvor. Gorim harrte aus, und die Kreaturen versorgten ihn. Und angesichts der Heiligkeit Gorims bereute der Große Gott seine Worte und erschien ihm erneut: »Erhebe dich, Gorim, und diene deinem Gott.« UL streckte die Hand aus und hob Gorim auf. »Bring zu mir die Wesen, die zu deinen Füßen sitzen, und ich werde sie begutachten. Wenn jedes Schönheit und Wert besitzt, wie du sagst, dann bin ich bereit, auch ihr Gott zu sein.«
Daraufhin brachte Gorim die Wesen zu UL. Sie ließen sich vor dem Gott nieder und baten um seinen Segen. UL wunderte sich, dass er die Schönheit in jedem Wesen früher nicht erkannt hatte. Er hob die Hände und segnete sie mit den Worten: »Ich bin UL und erkenne in jedem von euch Schönheit und Wert. Ich will euer Gott sein, und ihr sollt gedeihen, und Friede soll herrschen unter euch.«
Gorim war frohen Herzens und nannte den Ort, an dem dies alles geschehen war, Prolgu,das heißt »Heiliger Ort«. Dann ging er und kehrte zurück zu der Ebene, um sein Volk zu seinem Gott zu führen. Aber sie erkannten ihn nicht, denn die Hände ULs hatten ihn berührt, und alle Farbe war von ihm gewichen, und sein Haar und seine Haut waren weiß wie Schnee geworden. Die Menschen fürchteten sich und warfen mit Steinen nach ihm.
Gorim rief UL an: »Oh mein Gott, deine Berührung hat mich verändert, und mein Volk kennt mich nicht mehr.«
UL hob die Hand, und alle Menschen wurden so farblos wie Gorim. Der Geist UL aber sprach mit mächtiger Stimme zu ihnen: »Höret die Worte eures Gottes. Dies ist der, den ihr Gorim nennt, und er hat mich bewogen, euch als mein Volk anzunehmen, über euch zu wachen, für euch zu sorgen und euer Gott zu sein. Von nun an sollt ihr UL-Go heißen in Erinnerung an mich und als Zeichen seiner Heiligkeit. Ihr sollt tun, was er befiehlt, und gehen, wohin er euch führt. Jeden, der ihm nicht gehorcht oder ihm nicht folgt, werde ich verdammen, auf dass er verblüht und vergeht und nicht mehr ist.«
Gorim befahl seinem Volk, seine Habe zu packen, das Vieh zusammenzutreiben und ihm in die Berge zu folgen. Aber die Älteren aus seinem Volk glaubten ihm nicht, und auch nicht, dass es die Stimme ULs gewesen war. Stattdessen sprachen sie zu Gorim: »Wenn du der Diener des Gottes UL bist, dann vollbringe ein Wunder zum Beweis dafür.«
Gorim antwortete: »Seht eure Haut und euer Haar. Ist das nicht Wunder genug für euch?«
Sie waren beunruhigt und gingen davon. Aber dann kamen sie wieder zu ihm und sagten: »Dieses Zeichen an uns ist eine Seuche, die du von einem unreinen Ort mitgebracht hast, und kein Beweis für die Gunst ULs.«
Gorim hob die Hände, und die Wesen, die ihn versorgt hatten, kamen zu ihm wie die Lämmer zu ihrem Hirten.
Die Älteren fürchteten sich und gingen eine Zeitlang fort. Aber bald kamen sie zurück und sagten: »Die Kreaturen sind ungeheuerlich und hässlich. Du bist ein Dämon, der die Menschen ins Verderben lockt, kein Diener des Großen Gottes UL. Wir haben noch immer keinen Beweis für die Gunst ULs gesehen.«
Nun hatte Gorim genug von ihnen. Er rief mit tönender Stimme: »Ich sage dem Volk, dass es die Stimme ULs gehört hat. Ich habe viel für euch gelitten. Jetzt kehre ich nach Prolgu zurück, an den heiligen Ort. Wer mir folgen will, soll es tun; wer nicht, der soll bleiben.« Dann wandte er sich um und schritt auf die Berge zu.
Einige wenige kamen mit ihm, aber der größte Teil des Volkes blieb zurück und schmähte Gorim und jene, die ihm folgten: »Wo bleibt das Wunder, das die Gunst ULs beweist? Wir folgen und gehorchen Gorim nicht, und doch verblühen und vergehen wir nicht.«
Gorim sah sie mit tiefer Traurigkeit an und sprach zum letzten Mal zu ihnen: »Ihr habt ein Wunder von mir verlangt. Dann nehmt dieses Wunder: So wie die Stimme ULs es euch geweissagt hat, werdet ihr verdorren wie der abgetrennte Ast eines Baumes. Wahrlich, mit dem heutigen Tag beginnt euer Untergang.« Dann führte er die wenigen, die mit ihm kommen wollten, in die Berge und nach Prolgu.
Die Mehrzahl seines Volkes aber verspottete ihn und kehrte zu ihren Zelten zurück, um über die Torheit derjenigen zu lachen, die ihm folgten. Ein Jahr lang lachten und spotteten sie. Dann lachten sie nicht mehr, denn ihre Frauen waren unfruchtbar und gebaren keine Kinder mehr. Die Zahl des Volkes war im Schwinden, und mit der Zeit starb es aus und war nicht mehr.
Diejenigen, die Gorim folgten, kamen mit ihm nach Prolgu. Dort erbauten sie eine Stadt. Der Geist ULs war mit ihnen, und sie lebten in Frieden mit den Wesen, die Gorim versorgt hatten. Gorim lebte viele Menschenalter; und nach ihm wurde jeder Hohepriester ULs Gorim genannt und lebte lange Zeit. Tausend Jahre lang war der Frieden ULs mit ihnen, und sie glaubten, es würde für immer so bleiben.
Aber der böse Gott Torak stahl das Auge, das der Gott Aldur geformt hatte, und der Krieg von Menschen und Göttern begann. Torak benutzte das Auge, um die Erde zu spalten und das Meer in das Land eindringen zu lassen, und das Auge verbrannte ihn entsetzlich. Und er floh nach Mallorea.
Die Erde war wahnsinnig vor Schmerz über ihre Verwundung, und die Wesen, die in Frieden mit dem Volk der Ulgoner gelebt hatten, wurden ebenfalls wahnsinnig. Sie erhoben sich gegen die Gefolgschaft von UL und rissen die Städte nieder und mordeten die Menschen, bis nur noch wenige übrig waren.
Diejenigen, die entkamen, flohen nach Prolgu, wohin die Wesen ihnen nicht zu folgen wagten aus Furcht vor dem Zorn ULs. Laut waren die Klagen und das Wehgeschrei des Volkes. UL war besorgt und enthüllte ihnen die Höhlen, die unter Prolgu lagen. Das Volk stieg hinab in die heiligen Höhlen und lebte fortan dort.
Nach einiger Zeit führte Belgarath, der Zauberer, den König der Alorner und dessen Söhne nach Mallorea, um das Auge wiederzuerlangen. Als Torak sie verfolgen wollte, trieb ihn der Zorn des Auges zurück. Belgarath übergab das Auge dem ersten Rivanischen König und verkündete, solange einer seiner Nachkommen das Auge besäße, sei der Westen sicher.
Nun teilten sich die Alorner und drängten nach Süden in neue Länder. Und die Völker der anderen Götter wurden durch den Krieg der Götter und Menschen aufgeschreckt und flohen, um andere Länder in Besitz zu nehmen, denen sie seltsame Namen gaben. Aber ULs Volk hielt an den Höhlen von Prolgu fest und hatte nichts mit ihnen zu schaffen. UL schützte und verbarg es, und die Fremden wussten nicht, dass dort ein Volk lebte. Jahrhundert um Jahrhundert nahm das Volk ULs keine Notiz von der Welt draußen, selbst dann nicht, als die Welt durch die Ermordung des letzten Rivanischen Königs und seiner Familie erschüttert wurde.
Aber als Torak plündernd nach Westen kam und eine mächtige Armee durch die Länder der Kinder ULs führte, sprach der Geist ULs mit dem Gorim. Und der Gorim führte sein Volk bei Nacht heimlich hinaus in die Welt. Es fiel über die schlafende Armee her und richtete verheerenden Schaden an. So wurde die Armee Toraks geschwächt und von den Armeen des Westens an einem Ort mit Namen Vo Mimbre geschlagen.
Dann rüstete der Gorim sich und ging, um Rat zu halten mit den Siegern. Und er brachte die Kunde mit zurück, dass Torak schwer verwundet sei. Obwohl der Körper des dunklen Gottes gestohlen und versteckt worden war von seinem Schüler Belzedar, hieß es, dass Torak in einem todesgleichen Schlaf gefangen liege, bis dereinst wieder ein Nachkomme des Hauses Riva auf dem Rivanischen Thron säße – und das bedeutete niemals, denn es war bekannt, dass kein Nachkomme dieser Linie mehr lebte.
So erschreckend der Besuch der Außenwelt für den Gorim auch gewesen war, so hatte er ihm doch keinen Schaden zugefügt. Die Kinder ULs gediehen weiter unter der Fürsorge ihres Gottes, und das Leben ging fast so weiter wie zuvor. Nur wurde festgestellt, dass der Gorim anscheinend weniger Zeit damit verbrachte, Das Buch von Ulgo zu studieren, und sich mehr mit brüchigen alten Pergamentrollen mit Berichten über Prophezeiungen beschäftigte. Aber eine gewisse Eigenheit konnte man von jemandem, der die Höhlen von UL verlassen und zu anderen Völkern gewandert war, ja wohl erwarten.
Da erschien ein seltsamer alter Mann am Eingang zu den Höhlen und verlangte den Gorim zu sprechen. Und die Kraft seiner Stimme war derart, dass der Gorim herbeigerufen wurde. Dann wurde zum ersten Mal, seit das Volk in den Höhlen Zuflucht gesucht hatte, jemand eingelassen, der nicht zu dem Volke ULs gehörte. Der Gorim nahm den Fremden mit in seine Kammer und blieb dort tagelang mit ihm eingeschlossen. Und anschließend kam der seltsame alte Mann mit dem weißen Bart und den zerlumpten Kleidern in langen Abständen wieder und wurde von dem Gorim willkommen geheißen.
Einst hatte sogar ein Knabe berichtet, dass ein großer grauer Wolf bei dem Gorim sei. Doch das war wahrscheinlich nur ein Fiebertraum, obwohl der Junge sich weigerte, zu widerrufen.
Das Volk aber passte sich der Eigenart seines Gorims an und akzeptierte sie. Und die Jahre vergingen, und das Volk dankte seinem Gott in dem Bewusstsein, dass es das auserwählte Volk des Großen Gottes UL war.
TEIL EINSMARAGOR
KAPITEL 1
Ihre Kaiserliche Hoheit, Prinzessin Ce’Nedra, Juwel des Hauses Borune und lieblichste Blume des tolnedranischen Kaiserreichs, saß mit gekreuzten Beinen auf einer Seekiste in der eichengetäfelten Kabine im Heck von Kapitän Greldiks Schiff, kaute nachdenklich auf einer Strähne ihres kupferroten Haares und sah zu, wie Lady Polgara den gebrochenen Arm Belgaraths des Zauberers verarztete. Die Prinzessin trug eine kurze blassgrüne Dryadentunika. Auf ihrer rechten Wange ruhte ein Ascheflöckchen. Vom Deck über sich hörte sie das rhythmische Schlagen der Trommel, die den Takt für Greldiks Ruderer angab, während sie stromaufwärts aus der ascheverhangenen Stadt Sthiss Tor ruderten.
Alles war absolut grässlich, entschied sie. Was ihr wie ein harmloser weiterer Zug in dem endlosen Spiel um Autorität und Auflehnung erschienen war, das sie mit ihrem Vater, dem Kaiser, schon spielte, solange sie sich zurückerinnern konnte, war nun tödlicher Ernst geworden. Sie hatte nie beabsichtigt, die Dinge so weit zu treiben, als sie mit Meister Jeebers in der Nacht vor so vielen Wochen aus dem Kaiserpalast in Tol Honeth geschlichen war. Jeebers hatte sie schon bald darauf verlassen – er war sowieso nur kurzfristig von Nutzen gewesen –, und jetzt war sie an diese seltsame Gruppe von grimmig dreinschauenden Leuten aus dem Norden gefesselt, die sich auf irgendeiner Suche befanden, deren Zweck sie nicht im Geringsten verstand. Lady Polgara, deren Name allein schon der Prinzessin einen Schauder verursachte, hatte sie im Wald der Dryaden ziemlich barsch darüber in Kenntnis gesetzt, dass Schluss sei mit den Spielchen. Keinerlei Ausflüchte, Schmeicheleien oder Überredungskünste könnten etwas an der Tatsache ändern, dass sie, Prinzessin Ce’Nedra, sich an ihrem sechzehnten Geburtstag in der Halle des Rivanischen Königs einfinden würde – wenn nötig, in Ketten.
Ce’Nedra wusste mit absoluter Gewissheit, dass Polgara dies auch genau so meinte, und sie sah sich schon vorwärts geschleppt, in klirrenden Ketten, um völlig gedemütigt in dieser düsteren Halle zu stehen, während Hunderte bärtiger Alorner über sie lachten. Das musste sie um jeden Preis verhindern. Und so hatte sie beschlossen, diese Leute zu begleiten – vielleicht nicht ganz freiwillig, aber sich auch nie offen auflehnend. Das stählerne Funkeln in den Augen Lady Polgaras erinnerte sie an Handschellen und rasselnde Ketten, und diese ständige Mahnung rang der Prinzessin weit mehr Gehorsam ab als alle kaiserliche Macht ihres Vaters es jemals vermocht hatte.
Ce’Nedra hatte nur eine vage Ahnung, was diese Leute eigentlich taten. Sie schienen irgendjemandem oder irgendetwas zu folgen, und die Spur hatte hierher in die schlangenverseuchten Sümpfe Nyissas geführt. Irgendwie waren auch Murgos in die Sache verwickelt, die ihnen Furcht einflößende Hindernisse in den Weg legten, und Königin Salmissra interessierte sich ebenfalls so sehr dafür, dass sie sogar so weit gegangen war, den jungen Garion zu entführen.
Ce’Nedra unterbrach ihre Grübeleien, um den Jungen auf der anderen Seite der Kabine zu betrachten. Warum wollte die Königin von Nyissa ihn wohl haben? Er war ja sehr nett, mit glattem sandfarbenem Haar, das ihm immer in die Stirn fiel, sodass es sie in den Fingern juckte, es zurückzustreichen. Er hatte auch ein ganz hübsches Gesicht – auf eine einfache Art –, und sie konnte mit ihm reden, wenn sie sich allein oder verängstigt fühlte. Außerdem war er auch jemand, mit dem sie streiten konnte, wenn sie sich ärgerte, denn er war nur wenig älter als sie selbst. Aber er weigerte sich entschieden, sie mit dem Respekt zu behandeln, der ihr zustand – wahrscheinlich wusste er nicht einmal, wie er das hätte anstellen sollen. Warum dieses Interesse an ihm? Es konnte einem wirklich auf die Nerven gehen. Sie grübelte und betrachtete ihn nachdenklich.
Da, sie tat es schon wieder. Ärgerlich riss sie den Blick von ihm los. Warum beobachtete sie ihn nur immer? Jedes Mal, wenn ihre Gedanken umherwanderten, suchte ihr Blick automatisch sein Gesicht, und so aufregend waren seine Züge nun auch wieder nicht. Sie hatte sich sogar dabei ertappt, wie sie vor sich selbst Entschuldigungen fand, um sich so zu setzen, dass sie ihn beobachten konnte. Es war zu dumm!
Ce’Nedra kaute an ihrer Haarsträhne und dachte nach und kaute weiter, bis der Blick ihrer Augen sich erneut auf Garions Züge heftete.
»Wird er wieder ganz gesund?«, brummte Barak, der Graf von Trellheim, und zupfte nervös an seinem mächtigen roten Bart, während er Polgara dabei zusah, wie sie letzte Hand an Belgaraths Verband legte.
»Es ist nur ein einfacher Bruch«, antwortete sie nüchtern und legte ihr Verbandszeug beiseite. »Und bei dem alten Narren heilen Verletzungen schnell.«
Belgarath stöhnte, als er seinen frisch geschienten Arm bewegte. »Du hättest nicht so grob zu sein brauchen, Polgara.« Seine rostbraune alte Tunika wies mehrere dunkle Schmutzflecken auf und einen neuen Riss, beredte Zeugnisse seines Zusammenstoßes mit einem Baum.
»Der Arm musste gerichtet werden, Vater«, erwiderte sie. »Du willst doch nicht, dass er schief zusammenwächst, oder?«
»Ich glaube, du hattest auch noch Spaß dabei«, beschuldigte er sie.
»Nächstes Mal kannst du ihn selbst richten«, erwiderte sie kühl und glättete ihr graues Kleid.
»Ich brauche etwas zu trinken«, brummte Belgarath und sah Barak an. Der Graf von Trellheim ging zu der schmalen Tür. »Könntest du einen Krug Bier für Belgarath bringen lassen?«, fragte er den draußen wartenden Seemann.
»Wie geht es ihm?«
»Er ist schlecht gelaunt«, antwortete Barak. »Und das wird wahrscheinlich noch schlimmer, wenn er nicht bald etwas zu trinken bekommt.«
»Ich gehe sofort.«
»Kluge Entscheidung.«
Dies war noch etwas, das Ce’Nedra verwirrte. All die Edelleute in ihrer Gruppe behandelten diesen schäbig aussehenden alten Mann mit enormem Respekt; aber soweit sie wusste, besaß er nicht einmal einen Titel. Sie konnte mit größter Präzision den genauen Unterschied zwischen einem Baron und einem General der Kaiserlichen Legionen bestimmen, zwischen einem Großherzog von Tolnedra und einem Kronprinzen von Arendien, zwischen dem Rivanischen Hüter und dem König von Cherek, aber sie hatte keinerlei Vorstellung, wo Belgarath einzuordnen war. Ihr materiell orientierter tolnedranischer Verstand weigerte sich, die Existenz von Zauberern zu akzeptieren. Es stimmte schon, dass Lady Polgara, mit Titeln fast aller Königreiche des Westens ausgestattet, die am meisten respektierte Frau der Welt war, doch Belgarath schien einfach nur ein Vagabund zu sein, ein Landstreicher – und recht häufig sogar ein öffentliches Ärgernis. Und Garion, rief sie sich in Erinnerung, war sein Enkel.
»Es wird Zeit, dass du uns erzählst, was geschehen ist, Vater«, sagte Polgara zu ihrem Patienten.
»Ich würde lieber nicht darüber reden«, antwortete er kurz angebunden.
Sie wandte sich an Prinz Kheldar, den merkwürdigen kleinen drasnischen Edelmann mit dem scharf geschnittenen Gesicht und dem sardonischen Witz, der auf einer Bank lag und eine freche Miene aufgesetzt hatte. »Nun, Silk?«, fragte sie.
»Sicher verstehst du meine Lage, alter Freund«, entschuldigte sich der Prinz mit allen Anzeichen tiefsten Bedauerns bei Belgarath. »Wenn ich versuche, dein Geheimnis zu bewahren, wird sie mich zwingen zu reden – auf sehr unerfreuliche und schmerzhafte Art, wie ich mir vorstellen kann.«
Belgarath sah ihn mit steinerner Miene an, dann schnaubte er verächtlich.
»Es ist nicht so, dass ich es erzählen wollte,verstehst du. Wirklich nicht.«
Belgarath wandte sich ab.
»Ich wusste, du würdest es verstehen.«
»Die Geschichte, Silk!«, drängte Barak ungeduldig.
»Es ist wirklich sehr einfach«, sagte Kheldar.
»Aber du wirst es schon kompliziert machen, nicht wahr?«
»Erzähl uns einfach, was geschehen ist, Silk«, sagte Polgara.
Der Drasnier setzte sich auf seiner Bank auf. »Es ist wirklich keine große Geschichte«, begann er. »Wir haben Zedars Spur gefunden und folgten ihr vor ungefähr drei Wochen nach Nyissa hinein. Dabei hatten wir ein paar Zusammenstöße mit nyissanischen Grenzwachen – nichts Ernstes. Jedenfalls, die Spur des Auges führte in Richtung Osten, kaum dass wir über der Grenze waren. Das war eine Überraschung für uns. Zedar war so zielstrebig nach Nyissa geeilt, dass wir beide angenommen hatten, er hätte irgendeine Vereinbarung mit Salmissra getroffen. Vielleicht wollte er, dass wir das glaubten. Er ist sehr schlau, und Salmissra ist berüchtigt dafür, sich in Dinge einzumischen, die sie nichts angehen.«
»Um sie habe ich mich schon gekümmert«, sagte Polgara grimmig.
»Was ist geschehen?«, fragte Belgarath.
»Das erzähle ich dir später, Vater. Weiter, Silk.«
Silk zuckte die Schultern. »Da gibt es nicht viel mehr zu erzählen. Wir sind Zedars Spur gefolgt bis in eine der Ruinenstädte nahe der alten Grenze zu Maragor. Belgarath hatte dort einen Besucher – zumindest hat er das behauptet. Ich habe niemanden gesehen. Jedenfalls sagte er mir, dass etwas geschehen sei, das unsere Pläne änderte, und dass wir umkehren und flussabwärts nach Sthiss Tor müssten, um euch wieder zu treffen. Er hatte keine Zeit, viel mehr zu erklären, denn der Dschungel wimmelte plötzlich von Murgos – entweder auf der Suche nach uns oder Zedar, das haben wir nicht feststellen können. Seitdem sind wir sowohl den Murgos als auch den Nyissanern ausgewichen – Reisen bei Nacht, Verstecken, und so weiter. Einmal haben wir einen Boten geschickt. Ist er durchgekommen?«
»Vorgestern«, antwortete Polgara. »Er hatte allerdings Fieber, und es hat eine Weile gedauert, bis wir eure Botschaft aus ihm herausbekommen haben.«
Kheldar nickte. »Jedenfalls, da waren die Grolim mit den Murgos, die versuchten, uns mit ihrem Geist aufzuspüren. Belgarath hat etwas getan, damit sie uns so nicht mehr ausfindig machen konnten. Was immer es auch war, es muss sehr hohe Konzentration erfordert haben, weil er kaum noch auf den Weg achtete. Heute am frühen Morgen führten wir die Pferde durch ein Sumpfgebiet. Belgarath stolperte so vor sich hin, in Gedanken mit etwas anderem beschäftigt, und da fiel der Baum auf ihn drauf.«
»Ich hätte es mir denken können«, sagte Polgara. »Meinst du, es steckte irgendjemand dahinter?«
»Das glaube ich nicht. Vielleicht war es eine alte Falle, aber ich bezweifle es. Der Baum war von innen verrottet. Ich habe versucht, Belgarath zu warnen, aber er ist einfach weitergegangen, ohne auf mich zu hören.«
»Ja, ja«, sagte Belgarath.
»Ich habe versucht, dich zu warnen.«
»Hör auf, darauf herumzureiten, Silk.«
»Ich möchte nicht, dass sie denken, ich hätte es nicht versucht«, beharrte Silk.
Polgara schüttelte den Kopf und sagte vorwurfsvoll: »Vater!«
»Lass gut sein, Polgara«, erwiderte Belgarath.
»Ich habe ihn unter dem Baum rausgezogen und so gut ich konnte zusammengeflickt«, fuhr Silk fort. »Dann habe ich das kleine Boot gestohlen, und wir sind stromabwärts gefahren.«
»Was habt ihr mit den Pferden gemacht?«, fragte Hettar.
Ce’Nedra fürchtete sich ein wenig vor diesem großen, schweigsamen algarischen Grafen mit dem rasierten Schädel, seiner schwarzen Lederkleidung und der wehenden schwarzen Skalplocke. Er schien niemals zu lächeln, und der Ausdruck auf seinem habichtähnlichen Gesicht, wenn das Wort »Murgo« auch nur erwähnt wurde, war hart wie Stein. Das Einzige, was ihn ein bisschen menschlicher machte, war seine überwältigende Liebe zu Pferden.
»Ihnen geht es gut«, versicherte ihm Silk. »Ich habe sie dort angebunden, wo die Nyissaner sie nicht finden werden. Sie sind gut aufgehoben, bis wir sie wieder holen.«
»Als du an Bord kamst, hast du gesagt, dass Ctuchik jetzt das Auge hat«, sagte Polgara zu Belgarath. »Wie ist das geschehen?«
Der alte Mann zuckte die Schultern. »Beltira hat keine Einzelheiten erzählt. Er hat nur gesagt, dass Ctuchik schon wartete, als Zedar über die Grenze nach Cthol Murgos kam. Zedar gelang es zu fliehen, aber er musste das Auge zurücklassen.«
»Hast du mit Beltira gesprochen?«
»Mit seinem Geist.«
»Hat er gesagt, warum unser Meister will, dass wir ins Tal kommen?«
»Nein. Wahrscheinlich ist es ihm gar nicht in den Sinn gekommen, danach zu fragen. Du weißt ja, wie Beltira ist.«
»Das wird uns Monate kosten, Vater«, wandte Polgara mit gerunzelter Stirn ein. »Es sind siebenhundertfünfzig Meilen bis ins Tal.«
»Aldur wünscht, dass wir dorthin gehen«, antwortete er. »Nach all den Jahren werde ich jetzt nicht anfangen, mich seinen Wünschen zu widersetzen.«
»Und in der Zwischenzeit bringt Ctuchik das Auge nach Rak Cthol.«
»Es wird ihm nichts nützen, Pol. Torak selbst könnte sich das Auge nicht gefügig machen; er hat es über zweitausend Jahre lang versucht. Ich weiß, wo Rak Cthol ist; Ctuchik kann es nicht vor mir verbergen. Er wird mit dem Auge dort sein, und wenn der Augenblick gekommen ist, werde ich dorthin gehen und es ihm abnehmen. Ich weiß, wie ich mit dieser Art von Magier fertigwerde.« Er sprach das Wort »Magier« mit hörbarer Verachtung aus.
»Was wird Zedar in der Zwischenzeit tun?«
»Zedar hat seine eigenen Probleme. Beltira sagt, dass er Torak von dem Ort, an dem er ihn versteckt hatte, fortgebracht hat. Ich glaube, wir können darauf vertrauen, dass er Toraks Körper so weit wie möglich von Rak Cthol wegbringt. Eigentlich haben sich die Dinge ganz gut entwickelt. Ich hatte jedenfalls allmählich die Lust verloren, Zedar zu jagen.«
Ce’Nedra fand das alles etwas verwirrend. Warum nur waren sie alle so interessiert an den Unternehmungen zweier Angarak-Zauberer mit fremd klingenden Namen und an diesem geheimnisvollen Edelstein, den anscheinend jeder unbedingt besitzen wollte? Für sie war ein Edelstein wie der andere. In ihrer Kindheit war sie von so viel Luxus umgeben gewesen, dass sie schon lange aufgehört hatte, besonderen Wert auf Schmuck zu legen. Im Augenblick trug sie als einzige Schmuckstücke ein Paar winziger goldener Ohrringe in Form von Eicheln, und ihre Vorliebe für sie rührte weniger daher, dass sie aus Gold waren; sie liebte sie, weil die geschickt ersonnenen Klöppel im Innern bei jeder Bewegung ihres Kopfes leise klingelten.
Im Grunde klang das Ganze in ihren Ohren wie einer der alornischen Mythen, die sie vor Jahren von einem Geschichtenerzähler am Hofe ihres Vaters gehört hatte. Auch in der Geschichte damals war ein magischer Edelstein vorgekommen, wie sie sich nun erinnerte. Er war von Torak, dem Gott der Angarakaner, gestohlen und von einem Zauberer und einigen alornischen Königen zurückerobert worden, die ihn auf einem Schwert befestigten, das im Thronsaal von Riva aufbewahrt wurde. Irgendwie sollte er den Westen vor einem schrecklichen Unglück schützen, das jedoch eintreten würde, sobald er verloren ging. Komisch – der Name des Zauberers in der Legende war Belgarath, genauso wie der des alten Mannes hier.
Aber das würde bedeuten, dass er Tausende von Jahren alt war, und das war lächerlich! Gewiss war er nach dem Helden dieses alten Mythos benannt worden – oder er hatte den Namen angenommen, um die Leute zu beeindrucken.
Wieder wanderte ihr Blick zu Garion hinüber. Der Junge saß still in einer Ecke der Kabine, mit ernstem Blick und ebenso ernster Miene. Sie überlegte, dass es vielleicht seine Ernsthaftigkeit war, die ihre Neugier weckte und sie immer wieder zu ihm hinübersehen ließ. Die Jungen, die sie gekannt hatte – Edle und die Söhne von Edlen –, hatten versucht, charmant und geistreich zu sein, aber Garion versuchte niemals zu scherzen oder kluge Dinge zu sagen, um sie zu amüsieren. Sie war sich nicht ganz sicher, was sie davon halten sollte. War er so ein Tölpel, dass er nicht wusste, was von ihm erwartet wurde? Oder vielleicht wusste er es, aber es lag ihm nicht genug an ihr, um sich auch nur ein wenig Mühe zu geben. Er könnte es wenigstens versuchen – wenn auch nur ab und zu. Wie konnte sie überhaupt mit ihm Umgang pflegen, wenn er sich schlicht weigerte, sich ihretwegen wenigstens ein klein wenig zum Narren zu machen?
Sie ermahnte sich streng, dass sie wütend auf ihn war. Er hatte gesagt, dass Königin Salmissra die schönste Frau sei, die er je gesehen habe, und es war noch viel, viel zu früh, um ihm eine solch unverschämte Bemerkung zu vergeben. Für diesen Lapsus würde sie ihn auf jeden Fall noch ein Weilchen schmoren lassen. Ihre Finger spielten mit einer der Locken, die ihr Gesicht umrahmten, und ihr Blick heftete sich erneut auf Garion.
Am nächsten Tag hatte der Ascheregen, der von einem riesigen Vulkanausbruch in Cthol Murgos herrührte, so weit nachgelassen, dass das Schiffsdeck wieder benutzbar wurde. Der Dschungel längs des Ufers war noch immer teilweise in dem staubigen Dunst verborgen, aber die Luft war klar genug zum Atmen, und Ce’Nedra entfloh erleichtert der stickig-heißen Kabine unter Deck.
Garion saß an seinem gewohnten, geschützten Platz im Bug des Schiffes und war in ein Gespräch mit Belgarath vertieft. Ce’Nedra stellte mit einem gewissen Befremden fest, dass er heute Morgen sein Haar nicht gekämmt hatte. Sie unterdrückte den impulsiven Wunsch, Kamm und Bürste zu holen, um ihre Anwesenheit zu rechtfertigen. Stattdessen schlenderte sie mit künstlicher Gelassenheit zu einer Stelle an der Reling, von wo aus sie bequem lauschen konnte, ohne dass es zu offenkundig war.
»… war es schon immer da«, sagte Garion gerade zu seinem Großvater. »Es hat immer mit mir geredet – mir gesagt, wenn ich kindisch oder dumm war oder so etwas. Ich habe den Eindruck, es lebt in einer Ecke meines Geistes für sich allein.«
Belgarath nickte und kratzte sich geistesabwesend mit seiner gesunden Hand den Bart. »Es scheint völlig losgelöst von dir zu existieren«, stellte er fest. »Hat die Stimme in deinem Kopf je tatsächlich etwas getan? Außer mit dir zu sprechen, meine ich?«
Garions Miene wurde nachdenklich. »Ich glaube nicht«, sagte er dann. »Sie sagt mir, wie ich etwas tun soll, aber ich glaube, ich bin derjenige, der es tun muss. Als wir in Salmissras Palast waren, hat sie mich aus meinem Körper herausgeholt, um Tante Pol zu suchen.« Er runzelte die Stirn. »Nein«, verbesserte er sich. »Wenn ich richtig darüber nachdenke, hat sie mir erklärt, wie ich es tun muss, aber in Wirklichkeit habe ich es selbst getan. Als wir erst draußen waren, konnte ich es neben mir spüren – es war das erste Mal überhaupt, dass wir voneinander getrennt waren. Aber ich konnte es eigentlich nicht sehen. In der Zeit hat es mich wohl tatsächlich einige Minuten lang kontrolliert, glaube ich. Es hat mit Salmissra geredet, um sie von dem, was wir taten, abzulenken.«
»Du warst ziemlich beschäftigt, seit Silk und ich euch verlassen haben, nicht wahr?«
Garion nickte verdrossen. »Meistens war es ziemlich schrecklich. Ich habe Asharak verbrannt. Wusstest du das?«
»Deine Tante hat mir davon erzählt.«
»Er hat sie ins Gesicht geschlagen«, berichtete Garion. »Ich wollte mit meinem Messer auf ihn losgehen, aber die Stimme hat mir gesagt, ich sollte es anders machen. Ich habe ihn mit meiner Hand geschlagen und gesagt ›brenne‹. Das war alles. Einfach ›brenne‹ – und er fing Feuer. Ich wollte es löschen, bis Tante Pol mir sagte, dass er meine Mutter und meinen Vater getötet hat. Daraufhin habe ich das Feuer heißer gemacht. Er hat mich angefleht, dass ich es lösche, aber ich habe es nicht getan.« Er schauderte.
»Ich habe versucht, dich davor zu warnen«, erinnerte Belgarath ihn sanft. »Damals habe ich dir gesagt, es würde dir nicht gefallen, wenn es vorbei wäre.«
Garion seufzte. »Ich hätte auf dich hören sollen. Tante Pol sagt, wenn man einmal die …« Er brach ab, suchte nach dem richtigen Wort.
»Macht?«, schlug Belgarath vor.
»Gut«, stimmte Garion zu. »Sie sagt, wenn man die Macht einmal benutzt hat, vergisst man nie mehr, wie es geht, und man tut es immer wieder. Ich wünschte, ich hätte doch mein Messer genommen. Dann wäre dieses Ding in mir niemals entfesselt worden.«
»Das stimmt nicht, und das weißt du«, sagte Belgarath ruhig. »Schon seit einigen Monaten stehst du kurz vor dem Ausbruch. Du hast sie, ohne es zu wissen, mindestens ein halbes Dutzend Mal gebraucht, soweit ich weiß.«
Garion starrte ihn ungläubig an.
»Erinnerst du dich an den verrückten Mönch, kurz nachdem wir nach Tolnedra gekommen waren? Als du ihn berührtest, hast du so viel Lärm gemacht, dass ich einen Moment lang dachte, du hättest ihn getötet.«
»Du hast gesagt, Tante Pol hätte es getan.«
»Ich habe gelogen«, gab der alte Mann gleichmütig zu. »Das tue ich ziemlich oft. Der Punkt ist aber doch, dass du schon immer diese Fähigkeit hattest. Sie musste früher oder später ans Tageslicht kommen. Ich wäre nicht zu unglücklich über das, was du mit Chamdar gemacht hast. Es war vielleicht ein wenig exotisch – nicht ganz so, wie ich es vermutlich getan hätte –, aber es lag doch schließlich eine gewisse Rechtfertigung darin.«
»Dann wird es also immer da sein?«
»Immer. So ist es nun einmal, fürchte ich.«
Prinzessin Ce’Nedra war recht stolz auf sich. Belgarath hatte gerade etwas bestätigt, das sie selbst Garion schon gesagt hatte. Wenn der Junge nur nicht so stur wäre, könnten seine Tante, sein Großvater und natürlich sie selbst – die alle viel besser wussten, was gut und richtig für ihn war, als er – sein Leben ohne oder mit nur geringen Schwierigkeiten zu ihrer Zufriedenheit formen.
»Wir wollen noch einmal auf diese Stimme in dir zurückkommen«, schlug Belgarath vor. »Ich muss mehr darüber wissen. Ich möchte nicht die ganze Zeit einen Feind in deinem Geist mit uns herumschleppen.«
»Es ist kein Feind«, protestierte Garion. »Er ist auf unserer Seite.«
»Vielleicht scheint es so«, meinte Belgarath, »aber die Dinge sind nicht immer, was sie scheinen. Ich würde mich sehr viel wohler fühlen, wenn ich genau wüsste, wer oder was es ist. Ich liebe keine Überraschungen.«
Prinzessin Ce’Nedra war jedoch bereits wieder in Gedanken versunken. In einer Ecke ihres komplizierten kleinen Verstandes begann eine Idee, Gestalt anzunehmen – eine Idee mit sehr interessanten Möglichkeiten.
KAPITEL 2
Sie brauchten fast eine Woche, um die Stromschnellen des Schlangenflusses zu überwinden. Obwohl es noch immer drückend heiß war, hatten sie sich alle inzwischen wenigstens teilweise an das Klima gewöhnt. Prinzessin Ce’Nedra verbrachte die meiste Zeit mit Polgara an Deck und ignorierte Garion. Hin und wieder warf sie jedoch einen Blick in seine Richtung, um festzustellen, ob es irgendwelche Anzeichen dafür gab, dass er unter ihrer Nichtbeachtung litt.
Da ihr Leben völlig in den Händen dieser Leute lag, verspürte Ce’Nedra das dringende Bedürfnis, sie für sich einzunehmen. Belgarath stellte kein Problem dar. Ein reizendes Klein-Mädchen-Lächeln, ein bisschen Wimperngeklimper und ein spontan wirkender Kuss oder zwei, und schon würde sie ihn um den Finger wickeln können. Diese Taktik konnte nach Belieben eingesetzt werden, aber bei Polgara sah die Sache anders aus. Zum einen schüchterte Ce’Nedra die außerordentliche Schönheit der Dame ein. Polgara war makellos. Selbst die weiße Locke in ihrem nachtschwarzen Haar war weniger ein Mangel als ein Akzent – ein persönliches Zeichen. Am meisten irritierten die Prinzessin Polgaras Augen. Abhängig von ihrer Stimmung wechselte ihre Farbe von Grau zu Tiefblau, und sie schienen alles zu durchdringen. Vor diesem ruhigen, steten Blick war keinerlei Verstellung möglich. Immer, wenn die Prinzessin in diese Augen sah, vermeinte sie, das Klirren von Ketten zu hören. Mit Polgara musste sie sich auf jeden Fall gutstellen.
»Lady Polgara?«, fragte die Prinzessin eines Morgens, als sie zusammen an Deck saßen und der dampfende graugrüne Dschungel am Ufer vorbeiglitt und die Seeleute an ihren Rudern schwitzten.
»Ja, Liebes?« Polgara blickte von Garions Tunika hoch, an der sie gerade einen Knopf wieder annähte. Sie trug ein blassgraues Gewand, das sie der Hitze wegen am Hals geöffnet hatte.
»Was ist Zauberei? Man hat mir immer gesagt, dass es so etwas nicht gibt.« Es schien ihr ein guter Anfang für ein Gespräch zu sein.
Polgara lächelte ihr zu. »Die Erziehung in Tolnedra ist etwas einseitig.«
»Ist es irgendein Trick?«, beharrte Ce’Nedra. »Ich meine, ist es so, als wenn man den Leuten mit der einen Hand etwas zeigt und dabei mit der anderen Hand etwas verschwinden lässt?« Sie spielte mit den Riemen ihrer Sandalen.
»Nein, Liebes. Es hat überhaupt nichts damit zu tun.«
»Was kann man denn alles damit tun?«
»Wir haben noch nie die Grenzen erforscht«, antwortete Polgara, deren Nadel wieder geschäftig durch den Stoff glitt.
»Wenn etwas getan werden muss, tun wir es. Wir denken nicht darüber nach, ob wir es können oder nicht. Trotzdem sind verschiedene Leute auch in unterschiedlichen Dingen gut. So, wie der eine ein besserer Zimmermann ist und ein anderer ein besonders guter Steinmetz.«
»Garion ist ein Zauberer, nicht wahr? Wie viel kann er tun?« Warum hatte sie nun gerade das gefragt?
»Ich habe mich schon gefragt, worauf du hinauswolltest«, sagte Polgara und sah das zierliche Mädchen durchdringend an.
Ce’Nedra errötete leicht.
»Kau nicht auf deinen Haaren herum, Kleines«, befahl Polgara. »Sonst spalten sich die Enden.«
Rasch zog Ce’Nedra eine Locke zwischen ihren Zähnen hervor.
»Wir sind noch nicht sicher, was Garion kann«, fuhr Polgara fort. »Es ist noch viel zu früh, um das beurteilen zu können. Er scheint Talent zu haben. Jedenfalls macht er jede Menge Lärm, wenn er etwas tut, und das ist ein recht gutes Zeichen, was sein Potenzial betrifft.«
»Dann wird er wahrscheinlich einmal ein sehr mächtiger Zauberer sein.«
Ein leichtes Lächeln huschte über Polgaras Gesicht. »Vermutlich«, erwiderte sie. »Immer vorausgesetzt, er lernt, sich unter Kontrolle zu halten.«
»Nun«, erklärte Ce’Nedra energisch, »dann müssen wir ihm eben beibringen, sich unter Kontrolle zu halten, nicht wahr?«
Polgara sah sie einen Moment an, dann begann sie zu lachen. Ce’Nedra kam sich etwas einfältig vor, lachte aber mit.
Garion, der in ihrer Nähe stand, sah sich um. »Was gibt es so Lustiges?«
»Nichts, das du verstehen würdest, Lieber«, antwortete Polgara.
Er sah beleidigt drein und stapfte hochaufgerichtet davon, einen entschlossenen Zug um den Mund. Ce’Nedra und Polgara lachten wieder.
Als Kapitän Greldiks Schiff an einem Punkt angelangt war, wo Felsen und Strudel ein Weiterkommen unmöglich machten, vertäuten sie das Schiff an einem großen Baum am Nordufer des Flusses und machten sich bereit, an Land zu gehen. Barak stand schwitzend im Kettenhemd neben seinem Freund Greldik und beobachtete Hettar, der das Entladen der Pferde beaufsichtigte. »Wenn du zufällig meine Frau sehen solltest, grüße sie von mir«, bat der rotbärtige Mann.
Greldik nickte. »Wahrscheinlich werde ich irgendwann im kommenden Winter in der Nähe von Trellheim sein.«
»Du musst ihr nicht unbedingt erzählen, dass ich von ihrer Schwangerschaft weiß. Vermutlich will sie mich mit meinem Sohn überraschen, wenn ich heimkomme. Ich möchte ihr die Freude nicht verderben.«
Greldik sah ihn überrascht an. »Ich dachte, du würdest ihr jederzeit gerne mit Freuden etwas verderben, Barak.«
»Vielleicht ist es an der Zeit, dass Merel und ich Frieden schließen. Unser kleiner Krieg war unterhaltsam, als wir noch jünger waren, aber vielleicht sollten wir ihn allmählich beilegen – schon allein um der Kinder willen.«
Belgarath kam an Deck und gesellte sich zu den beiden bärtigen Cherekern. »Geh nach Val Alorn«, bat er Kapitän Greldik. »Und sag Anheg, wo wir sind und was wir tun. Er soll den anderen Bescheid geben. Richte ihnen aus, ich verbiete, dass sie zum jetzigen Zeitpunkt einen Krieg mit den Angarakanern beginnen. Ctuchik hat das Auge nach Rak Cthol geschafft, und wenn es Krieg gibt, lässt Taur Urgas die Grenzen von Cthol Murgos schließen. Es wird auch so schon schwierig genug für uns werden.«
»Ich werde es ihm ausrichten«, antwortete Greldik zweifelnd. »Aber ich glaube nicht, dass es ihm gefallen wird.«
»Es muss ihm auch nicht gefallen«, sagte Belgarath trocken. »Er muss sich nur danach richten.«
Ce’Nedra, die nicht weit entfernt stand, war etwas verblüfft, als sie hörte, wie der schäbig aussehende alte Mann derart entscheidende Befehle äußerte. Wie konnte er so zu souveränen Königen sprechen? Und was, wenn Garion, als Zauberer, eines Tages eine ähnliche Autorität besaß? Sie wandte sich um und starrte den jungen Mann an, der Durnik dem Schmied half, ein aufgeregtes Pferd zu beruhigen. Er wirkte gar nicht gebieterisch. Sie nagte an ihrer Unterlippe. Irgendein Gewand könnte helfen, überlegte sie, und vielleicht so etwas wie ein Zauberbuch in der Hand, und eventuell ein kleiner Bart. Ihre Augen wurden schmal, während sie ihn sich vorzustellen versuchte – mit Gewand, Buch und Bart.
Garion, der offenbar ihren Blick auf sich ruhen fühlte, sah rasch in ihre Richtung und blickte sie fragend an. Er war so normal. Die Vorstellung von diesem schlichten, offenen Jungen in der Kostümierung, die sie für ihn ersonnen hatte, kam ihr plötzlich lächerlich vor, und unwillkürlich begann sie zu kichern. Garion wurde rot und wandte ihr beleidigt den Rücken zu.
Da die Stromschnellen des Schlangenflusses jede weitere Schifffahrt stromaufwärts unmöglich machten, war der Pfad, der in die Hügel führte, recht ausgetreten; ein deutliches Zeichen dafür, dass die meisten Reisenden von hier aus den Landweg wählten. Im Morgensonnenschein ritten sie das Tal hinauf und durchquerten rasch den dichten Dschungel, der den Fluss säumte. Dann kamen sie in einen Laubwald, der weit mehr nach Ce’Nedras Geschmack war. Auf dem Kamm des ersten Hügels wehte sogar ein leichter Wind, der die drückende Hitze und den Gestank von Nyissas verpesteten Sümpfen hinwegzufegen schien. Ce’Nedras Stimmung hob sich sogleich. Sie erwog, neben Prinz Kheldar zu reiten, aber der döste im Sattel vor sich hin, und außerdem hatte Ce’Nedra ein klein wenig Angst vor dem spitznasigen Drasnier. Sie hatte sofort erkannt, dass der zynische, kluge kleine Mann wahrscheinlich in ihr lesen konnte wie in einem offenen Buch, und diese Vorstellung behagte ihr nicht sonderlich. Stattdessen ritt sie also an der Gruppe vorbei nach vorn zu Baron Mandorallen, der wie immer die Vorhut bildete. Zum Teil wurde sie von dem Wunsch gelenkt, so schnell so weit wie möglich von dem dampfenden Fluss wegzukommen, aber das war es nicht allein. Ihr war eingefallen, dass es eine ausgezeichnete Gelegenheit sein könnte, den arendischen Edelmann über etwas auszufragen, das sie sehr interessierte.
»Eure Hoheit«, grüßte der gepanzerte Ritter respektvoll, als sie ihr Pferd neben sein riesiges Schlachtross lenkte, »haltet Ihr es für klug, Euch dergestalt zur Vorhut zu gesellen?«
»Wer wäre schon so töricht, den tapfersten Ritter der Welt anzugreifen?«, fragte sie mit gespielter Unschuld.
Die Miene des Barons verfinsterte sich, und er seufzte.
»Weshalb der tiefe Seufzer, edler Ritter?«, neckte sie ihn.
»Es ist nicht von Belang, Eure Hoheit«, antwortete er.
Sie ritten schweigend im Schatten der Bäume weiter, wo Insekten summten und kleine Krabbeltiere durch das Gebüsch neben dem Pferd huschten. »Sag mir«, fragte die Prinzessin schließlich, »kennst du Belgarath schon lange?«
»Mein ganzes Leben, Eure Hoheit.«
»Wird er in Arendien hoch geschätzt?«
»Hoch geschätzt? Der Heilige Belgarath ist der geachtetste Mann der Welt! Sicherlich wisst Ihr das, Prinzessin?«
»Ich stamme aus Tolnedra, Baron Mandorallen«, erklärte sie. »Unser Wissen über Zauberer ist begrenzt. Würde ein Arendier Belgarath als Mann von edler Herkunft bezeichnen?«
Mandorallen lachte. »Eure Hoheit, die Geburt des Heiligen Belgarath ist so verloren in den nebligen Regionen der Vergangenheit, dass Eure Frage keinerlei Bedeutung hat.«
Ce’Nedra runzelte die Stirn. Sie konnte es nicht leiden, wenn man sie auslachte. »Ist er nun ein Edelmann oder nicht?«, drängte sie.
»Er ist Belgarath«, erwiderte Mandorallen, als ob das alles erklärte. »Es gibt Hunderte von Baronen, etliche Fürsten und Grafen ohne Zahl, aber es gibt nur einen Belgarath. Alle Menschen stehen hinter ihm zurück.«
Sie strahlte ihn an. »Und was ist mit Lady Polgara?«
Mandorallen blinzelte, und Ce’Nedra merkte, dass sie zu schnell für ihn vorgegangen war. »Lady Polgara wird vor allen anderen Frauen geehrt«, sagte er etwas verwirrt. »Hoheit, könnte ich nur das Ziel Eurer Befragung erkennen, so würde ich Euch mit Freuden eine zufriedenstellendere Antwort geben.«
Sie lachte. »Mein lieber Baron, es ist nichts Wichtiges oder Ernstes – nur Neugier, und der Versuch, uns auf unserem Ritt die Zeit zu vertreiben.«
Durnik der Schmied kam in dem Moment herangetrabt, und die Hufe seines Braunen klapperten auf der festgestampften Erde des Pfades. »Herrin Pol bittet euch, einen Moment zu warten.«
»Stimmt etwas nicht?«, fragte Ce’Nedra.
»Nein. Aber sie hat in der Nähe des Pfades einen Strauch entdeckt. Sie möchte einige Blätter davon sammeln – ich glaube, sie haben eine heilende Wirkung. Angeblich sind sie sehr selten und wachsen nur in diesem Teil Nyissas.« Das offene, einfache Gesicht des Schmiedes war respektvoll, wie immer, wenn er von Polgara sprach. Ce’Nedra hatte ihre eigenen Vermutungen über Durniks Gefühle für die hohe Herrin, aber sie behielt sie für sich. »Oh«, fuhr er fort, »sie bat mich, euch vor dem Strauch zu warnen. Es könnten noch andere hier wachsen. Er ist ungefähr einen halben Meter hoch und hat stark glänzende Blätter und eine kleine dunkelrote Blüte. Und er ist tödlich giftig; eine Berührung genügt.«
»Wir werden nicht vom Weg abweichen, Freund«, beruhigte Mandorallen ihn, »aber wir werden hier warten, bis die Herrin Erlaubnis gibt weiterzureiten.«
Durnik nickte und ritt wieder zurück.
Ce’Nedra und Mandorallen führten ihre Pferde in den Schatten eines weit ausladenden Baumes und warteten. »Wie würde ein Arendier Garion einordnen?«, fragte sie unvermittelt.
»Garion ist ein braver Bursche«, antwortete Mandorallen leicht verwirrt.
»Aber nicht von Adel«, meinte sie.
»Hoheit«, erklärte Mandorallen taktvoll, »ich fürchte, Eure Erziehung hat Euch irregeleitet. Garion stammt von Belgarath und Polgara ab. Obwohl er keinen Titel hat wie Ihr oder ich, ist sein Blut das edelste der Welt. Ich würde ihm ohne Frage jederzeit den Vortritt lassen, wenn er es von mir verlangte – was er aber niemals tun würde, denn er ist bescheiden. Während wir am Hofe König Korodullins von Vo Mimbre weilten, wurde er von einer beharrlichen jungen Gräfin verfolgt, die Rang und Ansehen durch eine Heirat mit ihm gewinnen wollte.«
»Wirklich?«, fragte Ce’Nedra mit leichter Schärfe in der Stimme.
»Sie war auf eine Verlobung erpicht und hat ihm Fallen gestellt, mit unverhohlenen Einladungen zu Tändelei und süßem Geschwätz.«
»Eine schöne Gräfin?«
»Eine der größten Schönheiten des Reiches.«
»Ich verstehe«, sagte Ce’Nedra frostig.
»Habe ich Euch beleidigt, Hoheit?«
»Es ist nicht wichtig.«
Mandorallen seufzte wieder.
»Was ist denn nun schon wieder?«, fuhr sie ihn an.
»Mir ist bewusst, dass ich viele Fehler habe.«
»Und ich dachte, du würdest als der perfekte Mann gelten.« Sie bereute die Bemerkung sofort.
»Nein, Hoheit. Ich habe mehr Fehler, als Ihr Euch vorstellen könnt.«
»Vielleicht bist du ein bisschen undiplomatisch, aber das ist kein großer Makel – bei einem Arendier.«
»Doch Feigheit ist es sehr wohl, Eure Hoheit.«
Sie lachte bei der Bemerkung laut auf. »Feige? Du?«
»Ich musste feststellen, dass ich mit diesem Fehler behaftet bin«, gestand er.
»Sei nicht albern«, spottete sie. »Wenn überhaupt, liegt dein Fehler in der entgegengesetzten Richtung.«
»Es ist schwer zu glauben, ich weiß«, erwiderte er. »Und es beschämt mich. Aber ich versichere Euch, dass die kalte Hand der Furcht sich um mein Herz gekrampft hat.«
Ce’Nedra war bestürzt über das traurige Geständnis des Ritters. Sie suchte verzweifelt nach einer passenden Entgegnung, als plötzlich, ein paar Schritte entfernt, etwas mit einem lauten Krachen aus dem Unterholz brach. Von plötzlicher Panik ergriffen, raste ihr Pferd davon. Sie erhaschte nur aus dem Augenwinkel heraus einen Blick auf etwas Großes, Gelbbraunes, das aus dem Gebüsch auf sie zusprang – groß, gelb und mit weitaufgerissenem Maul. Verzweifelt versuchte sie, sich mit einer Hand am Sattel festzuhalten und mit der anderen Hand das verängstigte Pferd unter Kontrolle zu bringen. In seiner panischen Flucht rannte das Pferd jedoch unter einem tiefhängenden Ast hindurch, der sie aus dem Sattel fegte und sie reichlich unelegant mitten auf dem Weg landen ließ. Sie rappelte sich auf und erstarrte, als sie sich dem Tier, das so plump aus seiner Deckung herausgebrochen war, gegenübersah.
Sofort erkannte sie, dass der Löwe noch sehr jung war. Er war zwar bereits ausgewachsen, aber seine Mähne war noch kurz. Offensichtlich war es ein Jungtier, noch ungeübt im Jagen. Er brüllte vor Enttäuschung, als er das fliehende Pferd den Pfad hinunter verschwinden sah, und sein Schwanz peitschte hin und her. Einen Moment lang war sie leicht amüsiert – er war so jung, so unbeholfen. Dann wich ihre Belustigung dem Zorn über dieses ungeschickte junge Tier, das dafür verantwortlich war, dass sie so unelegant vom Pferd gefallen war. Sie kam auf die Füße, klopfte sich den Staub ab und blickte den Löwen streng an. »Kusch!«, sagte sie und wollte ihn fortscheuchen. Immerhin war sie eine Prinzessin, und er nur ein Löwe – ein sehr junger und dummer Löwe noch dazu.
Dann jedoch richtete sich der Blick seiner gelben Augen auf sie, und sie verengten sich zu schmalen Schlitzen. Der peitschende Schwanz verharrte und wurde plötzlich ganz still. Die Augen des jungen Löwen strahlten mit einer schrecklichen Intensität, dann duckte er sich, den Körper dicht am Boden. Seine Oberlippe zog sich zurück und entblößte seine langen weißen Zähne. Langsam kam er einen Schritt auf sie zu, seine großen Pfoten machten kaum einen Laut.
»Wage es ja nicht!«, befahl sie empört.
»Bleibt ganz ruhig, Hoheit«, warnte Mandorallen sie mit tödlich ruhiger Stimme.
Aus dem Augenwinkel heraus sah sie ihn aus dem Sattel gleiten. Der Löwe funkelte ihn zornig an.
Behutsam, Schritt um Schritt, kam Mandorallen näher, bis er seinen gepanzerten Körper zwischen den Löwen und die Prinzessin gebracht hatte. Der Löwe beobachtete ihn aufmerksam, ohne recht zu begreifen, was sich da abspielte, bis es zu spät war. Dann, um eine weitere Mahlzeit geprellt, wurden die Augen der Raubkatze trüb vor Wut. Mandorallen zog bedächtig sein Schwert und reichte es Ce’Nedra. »Damit Ihr ein Mittel zu Eurer Verteidigung habt«, erklärte der Ritter.
Zweifelnd griff Ce’Nedra mit beiden Händen nach dem riesigen Schwert. Als Mandorallen seinen Griff jedoch löste, sank die Schwertspitze sofort zu Boden. Egal, wie sehr sie sich bemühte, Ce’Nedra konnte das mächtige Schwert nicht hochheben.
Schnaubend duckte sich der Löwe noch tiefer. Sein Schwanz fuhr einen Augenblick lang wütend hin und her, dann versteifte er sich. »Mandorallen, pass auf!«, schrie Ce’Nedra, die sich noch immer mit dem Schwert abmühte.
Der Löwe sprang.
Mandorallen breitete seine stahlgeschützten Arme weit aus und trat dem Angriff der Katze entgegen. Sie trafen mit einem lauten Krachen aufeinander, und Mandorallen schloss seine Arme um den Körper des Tieres. Der Löwe schlang seine mächtigen Pranken um Mandorallens Schultern, und seine Krallen verursachten ein ohrenbetäubendes Kreischen, als sie auf dem Stahl der Ritterrüstung abglitten. Seine Zähne knirschten und mahlten, als er versuchte, in Mandorallens behelmten Kopf zu beißen. Mandorallen verstärkte seine tödliche Umarmung.
Ce’Nedra krabbelte aus dem Weg, das Schwert hinter sich her schleifend, und verfolgte den erbitterten Kampf mit vor Furcht weit aufgerissenen Augen.
Das Strampeln des Löwen wurde verzweifelt, und lange, tiefe Kratzer erschienen auf Mandorallens Rüstung, während der Mimbrer unerbittlich seine Arme zusammenpresste. Aus dem Brüllen wurde Schmerzensgeheul, und der Löwe kämpfte jetzt nicht mehr, um zu töten, sondern ums Überleben. Er wand sich, trat um sich und versuchte zu beißen. Seine Hinterpfoten kratzten wütend an Mandorallens gepanzertem Rumpf, und sein Geheul wurde schriller, von Panik erfüllt.
Mit übermenschlicher Anstrengung presste Mandorallen seine Arme fest zusammen. Ce’Nedra hörte deutlich, wie Knochen knackten, und plötzlich schoss ein Blutstrom aus dem Maul der Raubkatze. Der Körper des jungen Löwen erbebte, der Kopf fiel nach hinten. Mandorallen lockerte seine Arme, und das tote Tier glitt schlaff zu Boden.
Wie betäubt starrte die Prinzessin den gewaltigen Mann an, der in seiner blutbeschmierten und zerkratzten Rüstung vor ihr stand. Sie war gerade Augenzeugin des Unmöglichen geworden. Mandorallen hatte den Löwen allein mit seinen mächtigen Armen getötet, ohne jede Waffe – nur für sie! Ohne zu wissen warum, jubelte sie vor Freude. »Mandorallen!« Sie sang seinen Namen. »Du bist mein Ritter. Mein Ritter!«
Noch keuchend vor Anstrengung, hob Mandorallen sein Visier. Seine blauen Augen waren groß, als hätten ihn ihre Worte mit betäubender Wucht getroffen. Dann sank er vor ihr auf die Knie. »Eure Hoheit«, sagte er mit erstickter Stimme, »ich schwöre Euch hier, im Angesicht der toten Bestie, Euer treuer und aufrechter Ritter zu sein, bis zu meinem letzten Atemzug.«
Tief in ihrem Innern spürte Ce’Nedra ein vernehmliches Klicken – als ob zwei Dinge, die seit Anbeginn der Zeit füreinander bestimmt waren, endlich zusammengefunden hätten. Irgendetwas war soeben hier auf dieser sonnendurchfluteten Lichtung geschehen – sie wusste nicht genau, was, aber es war etwas Wichtiges.