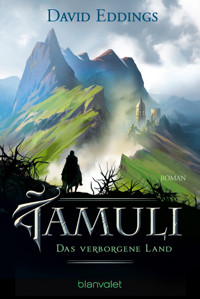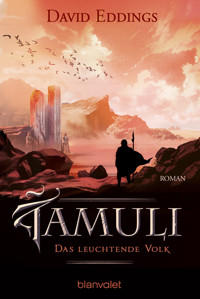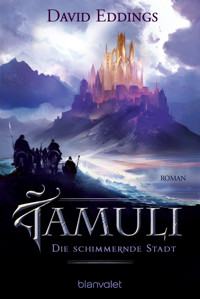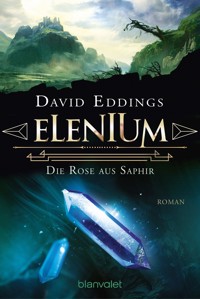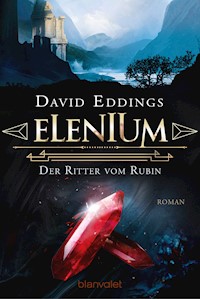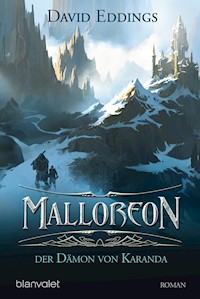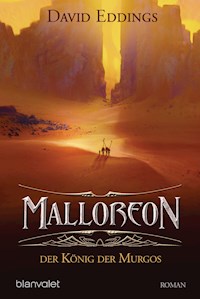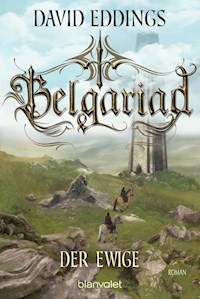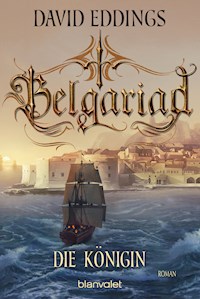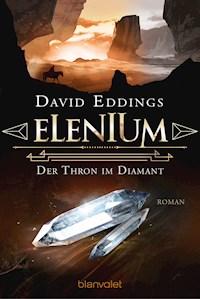
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Elenium-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Tapfere Ritter, mutige Königinnen, Götter und Magie – der Auftakt der Elenium-Trilogie von Bestsellerautor David Eddings.
Ritter Sperber folgt dem Ruf von Königin Ehlana und kehrt in seine Heimat zurück. Denn die neue Königin hat seine Verbannung aufgehoben, damit er seinen Platz als ihr Beschützer vor den Verschwörern bei Hofe einnehmen kann. Doch Sperber ist zu spät: Ehlana liegt im Sterben, und nur Magie hält sie noch am Leben. Nun versammelt der Ritter alte Freunde und neue Gefährten um sich, um ein Heilmittel zu finden. Er muss sich beeilen, denn der Preis der Magie, die Ehlana bislang beschützt, ist hoch und wächst mit jedem Tag. Sperber ist bereit, alles Menschenmögliche zu tun, um seine Königin zu retten – doch die Verschwörer, die ihren Tod wollen, sind bereit, sogar noch weiter zu gehen.
Die Elenium-Trilogie bei Blanvalet:
1. Der Thron im Diamant
2. Der Ritter vom Rubin
3. Die Rose aus Saphir
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 642
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Buch
Ritter Sperber folgt dem Ruf von Königin Ehlana und kehrt in seine Heimat zurück. Denn die neue Königin hat seine Verbannung aufgehoben, damit er seinen Platz als ihr Beschützer vor den Verschwörern bei Hofe einnehmen kann. Doch Sperber ist zu spät: Ehlana liegt im Sterben, und nur Magie hält sie noch am Leben. Nun versammelt der Ritter alte Freunde und neue Gefährten um sich, um ein Heilmittel zu finden. Er muss sich beeilen, denn der Preis der Magie, die Ehlana bislang beschützt, ist hoch und wächst mit jedem Tag. Sperber ist bereit, alles Menschenmögliche zu tun, um seine Königin zu retten – doch die Verschwörer, die ihren Tod wollen, sind bereit, sogar noch weiter zu gehen.
Autor
David Eddings wurde 1931 in Spokane im US-Bundesstaat Washington geboren. Während seines Dienstes für die US-Streitkräfte erwarb er einen Bachelor of Arts und einige Jahre darauf einen Master of Arts an der University of Washington. Bevor er 1982 seinen ersten großen Roman, »Belgariad – Die Gefährten«, veröffentlichte, arbeitete er für den Flugzeughersteller Boeing. Den Höhepunkt seiner Autorenkarriere erreichte er, als der Abschlussband seiner Malloreon-Saga Platz 1 der »New York Times«-Bestsellerliste erreichte. Im Jahr 2009 starb er in Caron City, Nevada.
Von David Eddings bei Blanvalet:
1. Die Gefährten
2. Der Schütze
3. Der Blinde
4. Die Königin
5. Der Ewige
Die Malloreon-Saga:
1. Die Herren des Westens
2. Der König der Murgos
3. Der Dämon von Karanda
4. Die Zauberin von Darshiva
5. Die Seherin von Kell
Die Elenium-Trilogie:
1. Der Thron im Diamant
2. Der Ritter vom Rubin
3. Die Rose aus Saphir
Besuchen Sie uns auch auf www.instagram.com/blanvalet.verlag und www.facebook.com/blanvalet.
David Eddings
Elenium
Der Thron im Diamant
Roman
Deutsch von Lore Strassl
Die Originalausgabe erschien 1989 unter dem Titel »The Diamond Throne. bei Del Rey, New York.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Copyright der Originalausgabe © 1989 by David Eddings
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2022 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Waltraud Horbas
Umschlaggestaltung und Artwork: © Isabelle Hirtz, Inkcraft unter Verwendung mehrerer Motive von Shutterstock.com
HK · Herstellung: sam
Satz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, München
ISBN 978-3-6412-9365-9V001
www.blanvalet.de
Inhalt
Prolog
ERSTERTEIL
ZWEITERTEIL
DRITTERTEIL
Für Eleanor und Ralph,für Mut und Treue.Vertraut mir.
Prolog
GHWERIGUNDDERBHELLIOM
(Aus der Sage der Trollgötter)
Zu Anbeginn der Zeit, lange ehe die Urväter von Styrikum in Felle gehüllt und mit Keulen bewaffnet aus den Bergen und Wäldern von Zemoch auf die Ebenen von Mitteleosien zogen, hauste in einer Höhle, tief unter dem ewigen Schnee Thalesiens, ein zwergenwüchsiger, missgestalteter Troll namens Ghwerig. Sein Volk hatte ihn seiner ungeheuren Habgier und auch seiner Hässlichkeit wegen verstoßen, und so rackerte er sich allein in den Tiefen der Erde ab, auf der Suche nach Gold und kostbaren Edelsteinen, die er auf seinen argwöhnisch gehüteten Hort häufte. Schließlich kam der Tag, an dem er in einen Stollen tief unter der froststarren Erdoberfläche vordrang und im flackernden Schein seiner Fackel einen leuchtend blauen Edelstein in die Wand gebettet entdeckte, größer als seine Faust. Vor Aufregung an allen knorrigen, krummen Gliedern zitternd, kauerte er sich auf den Boden des Gangs und stierte gierig auf den riesigen Edelstein. Die Erkenntnis übermannte ihn, dass dessen Wert den seines gesammelten Horts übertraf, den er in Jahrhunderten mühsamer Arbeit zusammengetragen hatte. Mit allergrößter Vorsicht begann er, das Gestein rundum herauszumeißeln, Splitter um Splitter, um den wertvollen Stein aus dem Felsen zu befreien, in dem er seit Erschaffen der Welt geruht hatte. Und als immer mehr vom Juwel zum Vorschein kam, erkannte er dessen ungewöhnliche Form, und ihm kam ein Gedanke. Wenn es ihm gelang, ihn unbeschädigt zu bergen, wäre er imstande, durch behutsames Schleifen und Polieren diese Form noch zu vervollkommnen und dadurch seinen Wert um ein Tausendfaches zu erhöhen.
Nachdem es ihm schließlich geglückt war, den Stein aus seinem felsigen Bett zu brechen, trug er ihn geradewegs zu der Höhle, in der sich seine Werkstatt und sein Hort befanden. Gleichmütig spaltete er einen Diamanten von unschätzbarem Wert und fertigte aus den Stücken Werkzeuge, mit denen er seinen kostbaren Fund bearbeiten konnte.
Jahrzehntelang schliff und polierte Ghwerig den Stein mit unendlicher Geduld im Licht rußiger Fackeln und murmelte dazu unentwegt Anrufungen und Zaubersprüche, die das unbezahlbare Juwel mit all der Macht des Guten oder Bösen der Trollgötter erfüllen sollte. Als er den Schliff vollendet hatte, besaß der Stein, der von tiefstem Saphirblau war, die Form einer Rose. Er gab ihm den Namen Bhelliom, Blumenstein, und er glaubte, dass die Kraft dieser edlen Saphirrose jeden Wunsch zu erfüllen vermochte.
Doch obwohl der Bhelliom von der Macht der Trollgötter durchdrungen war, wollte der Stein sie nicht auf seinen missgestalteten und hässlichen Besitzer übertragen. In rasendem Zorn hämmerte Ghwerig mit den Fäusten auf den Felsboden seiner Höhle. Er beschwor seine Götter und brachte ihnen Gold und Silber als Opfergaben dar. Da taten sie ihm kund, dass es einen Schlüssel gebe, die Macht des Bhelliom freizusetzen, damit nicht ein jeder sich dieser Kraft bedienen könne, wenn ihn danach gelüste. Dann offenbarten die Trollgötter Ghwerig, was er zu tun habe, um die Herrschaft über seinen Stein zu gewinnen. Der Troll nahm die Splitter, die beim Schliff der Saphirrose unbemerkt in den Staub zu seinen Füßen gefallen waren, und fertigte ein Paar Ringe. Aus feinstem Gold schmiedete er sie und besetzte jeden mit einem polierten, ovalen Splitter des Bhelliom. Als die Ringe vollendet waren, streifte er sie über seine Ringfinger und hob die Saphirrose mit beiden Händen empor. Das tiefe, glühende Blau der Splitter des Bhelliom floh in den Mutterstein zurück, und die Steine in den Ringen, die er an den knorrigen Händen trug, waren nunmehr so bleich wie Diamanten. Und als er den Blumenstein jetzt hielt, spürte er die Größe seiner Macht, und das Wissen, dass dieses von ihm erschaffene Kleinod bereit war, ihm untertan zu sein, erfüllte ihn mit Glückseligkeit.
Groß waren die Wunder, die Ghwerig im Lauf unzähliger Jahrhunderte mit der Macht des Bhelliom wirkte. Doch schließlich kamen die Styriker in das Land der Trolle. Als die Älteren Götter von Styrikum vom Bhelliom erfuhren, begehrte ein jeder von ihnen den Stein seiner Macht wegen. Doch Ghwerig war schlau; er versiegelte die Eingänge zu seiner Höhle mit Zaubern, die alle ihre Bemühungen, den Bhelliom an sich zu bringen, zunichtemachten.
Dann aber kam jene Zeit, da sich die Jüngeren Götter von Styrikum berieten, denn die Macht, welche der Bhelliom auf jedweden Gott übertragen könnte, der ihn in seinen Besitz brächte, beunruhigte sie, und sie entschieden, dass eine solche Kraft nicht auf Erden freigesetzt werden dürfe. So beschlossen sie, dem Stein die Macht zu nehmen. Für diese Aufgabe wählten sie die zierliche Göttin Aphrael aus ihren Reihen. Aphrael reiste sodann gen Norden, und dank ihrer zierlichen Erscheinung gelang es ihr, durch einen Felsspalt zu schlüpfen, der so schmal war, dass Ghwerig es nicht für nötig gehalten hatte, ihn zu versiegeln. Kaum hatte sie die Höhle erreicht, hob Aphrael die Stimme zu einem Lied. So süß sang sie, dass sie Ghwerig damit bezauberte und ihre Anwesenheit ihn nicht misstrauisch machte. Also lullte Aphrael ihn ein. Als der Trollzwerg mit verträumtem Lächeln die Augen schloss, zog sie ihm den Ring von der Rechten und tauschte ihn gegen einen Reif mit einem gewöhnlichen Brillanten. Ghwerig fuhr hoch, als er die Berührung spürte, doch als er auf seine Hand blickte, steckte nach wie vor ein Ring an seinem Finger. Er entspannte sich wieder und erfreute sich abermals am Gesang der Göttin. Nachdem ihm aufs Neue die Augen in süßer Gelöstheit zugefallen waren, zog die behände Aphrael den Ring von seiner Linken und ersetzte auch ihn durch einen mit einem Brillanten. Wieder wurde Ghwerig aus dem Schlummer gerissen, starrte erschrocken auf seine linke Hand, doch der Anblick des Rings beruhigte ihn, denn dieser sah so aus wie der zweite von jenem Paar, das er mit den Splittern des Blumensteins verziert hatte. Aphrael sang weiter für ihn, bis er schließlich in tiefen Schlaf sank. Da stahl sich die Göttin davon und nahm die Ringe mit sich, die der Schlüssel zur Macht des Bhelliom waren.
An einem späteren Tag holte Ghwerig den Bhelliom aus seinem kristallenen Behältnis, um sich seiner Macht zu bedienen, doch die vertauschten Ringe erwiesen sich als nutzloser Tand. Der Zorn Ghwerigs überstieg jedes Maß. Er suchte landein, landaus nach der Göttin Aphrael, um sich seine Ringe zurückzuholen, doch er fand sie nicht, obgleich er sich jahrhundertelang darum mühte.
Und daran änderte sich nichts, solange Styrikum über die Berge und Ebenen von Eosien herrschte. Doch dann kam die Zeit, da aus dem Osten die Elenier herbeiritten und in dieses Land einfielen. Nach Jahrhunderten des Umherstreifens gelangten einige auch in den hohen Norden von Thalesien, wo sie die Styriker und ihre Götter vertrieben. Und als die Elenier von Ghwerig und seinem Bhelliom hörten, suchten sie in ihrer Gier nach dem sagenhaften und unschätzbar kostbaren Edelstein, suchten überall in den Bergen und Tälern von Thalesien nach den Eingängen zur Höhle des Trollzwergs. Sie wussten jedoch nur vom unermesslichen Wert des Bhelliom, nicht aber von der Macht in seinen azurblauen Tiefen.
Schließlich fiel es Adian von Thalesien zu, dem mächtigsten und listigsten Helden des Altertums, das Rätsel zu lösen. Trotz der Gefahr für seine Seele suchte er Rat bei den Trollgöttern; er brachte ihnen Opfer dar, und schließlich ließen sie sich erweichen und offenbarten ihm, dass Ghwerig zu bestimmten Zeiten auf der Suche nach der Göttin Aphrael von Styrikum durch das Land streifte, um ein Ringpaar wieder an sich zu bringen, das sie ihm entwendet hatte. Doch verrieten sie ihm nicht die wahre Bedeutung dieser Ringe. Sodann reiste Adian in den hohen Norden, wo er ein halbes Dutzend Jahre lang in jeder Morgendämmerung darauf wartete, dass sich Ghwerig sehen ließe.
Als der Trollzwerg schließlich erschien, trat Adian in Verkleidung an ihn heran und behauptete, er wisse, wo Aphrael zu finden sei, und dass er ihm den Aufenthalt der Göttin für einen Helm feines Gelbgold verraten würde. Ghwerig ließ sich täuschen und führte Adian geradewegs zum verborgenen Haupteingang seiner Höhle. Dann nahm er des Helden Helm, ging in seine Schatzkammer und füllte ihn bis zum Rand mit feinem Gold. Nachdem er damit die Höhle verlassen hatte, versiegelte er den Eingang wieder. Er gab Adian das Gold, und der Mann täuschte ihn erneut und behauptete, Aphrael hielte sich in der Provinz Horset an der Westküste von Thalesien auf. Ghwerig eilte nach Horset, um die Göttin aufzusuchen. Und wieder brachte Adian seine Seele in Gefahr, indem er die Trollgötter anflehte, Ghwerigs Zauberversiegelung zu brechen, damit er in die Höhle eindringen könne. Die launischen Götter erfüllten ihm den Wunsch.
Als das Morgenrot die Eisfelder des Nordens aufflammen ließ, trat Adian mit dem Bhelliom in der Hand aus Ghwerigs Höhle. Mit dem Kleinod reiste er auf schnellstem Weg nach Emsat, der Hauptstadt seines Reiches, wo er eine Krone für sich anfertigte und diese mit dem Bhelliom schmückte.
Der Zorn Ghwerigs war grenzenlos, als er mit leeren Händen in seine Höhle heimkehrte und feststellte, dass er nicht nur die Schlüssel zur Macht des Bhelliom verloren hatte, sondern dass ihm nun auch noch der Blumenstein selbst gestohlen worden war. Von da an lauerte er immerfort des Nachts in den Wiesen und Wäldern vor der Stadt Emsat auf eine Gelegenheit, seinen Schatz zurückzuholen, doch die Nachfahren Adians hüteten das Kleinod wohl und verhinderten, dass Ghwerig auch nur in seine Nähe kam.
Nunmehr trug es sich jedoch zu, dass Azash, ein Älterer Gott von Styrikum, der lange schon auf den Bhelliom und die Ringe zur Erschließung seiner Macht begierig war, seine Horden aus Zemoch ausschickte, um die Kleinode mit Waffengewalt an sich zu bringen. Die Könige des Westens taten sich mit den Rittern der Kirche zusammen, um den Armeen Othas von Zemoch und seines finsteren styrischen Gottes Azash Einhalt zu gebieten. Und König Sarak von Thalesien begab sich mit einigen seiner Vasallen an Bord eines Schiffes und stach von Emsat südwärts in See. Er hinterließ den königlichen Befehl, dass seine Grafen ihm folgen sollten, sobald ganz Thalesien zu den Waffen gerufen worden war. Doch es war König Sarak nicht vergönnt, das große Schlachtfeld auf den Ebenen von Lamorkand zu erreichen – ein zemochischer Speer hatte ihm bei einem unbedeutenden Scharmützel nahe dem Vennesee in Pelosien das Leben geraubt. Obwohl selbst tödlich verwundet, nahm ein getreuer Vasall die Krone seines gefallenen Monarchen an sich und kämpfte sich zum sumpfigen Ostufer des Sees durch. Hart bedrängt und dem Tod nahe, warf er dort die Krone in das dunkle, morastige Wasser des Sees, während Ghwerig, der seinem verlorenen Kleinod gefolgt war, aus seinem Versteck im nahen Sumpf hilflos zusehen musste.
Die Zemocher, die König Sarak getötet hatten, machten sich sogleich daran, in den braunen Tiefen zu stochern, um die Krone zu bergen und sie Azash im Triumphzug zu überbringen.
Ihre Suche wurde jedoch durch einen Trupp alzionischer Ritter unterbrochen, die von Deira herangezogen kamen, um an der Schlacht von Lamorkand teilzunehmen. Die Alzioner stürzten sich auf die Zemocher und töteten sie bis auf den letzten Mann. Den getreuen Vasallen des thalesischen Königs bestatteten sie ehrenvoll, sodann ritten sie weiter, ohne zu ahnen, dass die sagenhafte Krone Thalesiens im Schlamm unter den schmutzigen Wassern des Vennesees begraben lag.
In Pelosien verstummten seither die Gerüchte nicht, dass in mondlosen Nächten die schattenhafte Gestalt des Trollzwergs an den sumpfigen Ufern zu sehen wäre. Da es Ghwerig seiner missgestalteten Gliedmaßen wegen nicht wage, in die dunklen Tiefen des Sees vorzudringen, krieche er am Ufer entlang und schreie sein Verlangen nach dem Bhelliom hinaus oder tanze heulend vor Verzweiflung, weil ihm die Saphirrose nicht antwortete.
ERSTERTEIL
CIMMURA
1
Es nieselte. Ein leichter, silbriger Regen rieselte aus dem nächtlichen Himmel, wob Schleier um die trutzigen Wachttürme von Cimmura, ließ die Fackeln zu beiden Seiten des breiten Stadttors zischen und verlieh den Pflastersteinen der Straße, die zur Stadt führte, schwarzen Glanz. Ein einsamer Reiter näherte sich dem Tor. Er war in einen dunklen, schweren Reiseumhang gehüllt und saß auf einem hochbeinigen, zottigen Fuchs mit langer Nase und wilden Augen. Der Reiter war ein großer Mann mit dichtem schwarzem Haar, schwerem Knochenbau und kräftigen Muskeln, doch ohne eine Spur überschüssigen Fetts. Seine Nase war irgendwann einmal gebrochen worden. Er saß mit der typischen Wachsamkeit des erfahrenen Kriegers im Sattel.
Er hieß Sperber und war zehn Jahre älter, als er aussah, weil die Jahre sich weniger im furchigen Gesicht spiegelten, sondern sich in gut einem halben Dutzend kleiner Gebrechen und Beschwerden bemerkbar machten. Zudem wies sein Körper mehrere breite, bläuliche Narben auf, die immer bei feuchtem Wetter schmerzten. Heute spürte er sein Alter und wünschte sich nichts als ein warmes Bett in der sogenannten Herberge, die sein Ziel war. Endlich kam Sperber nach Hause – nach einem Jahrzehnt, in dem er ein anderer mit anderem Namen in einem Land gewesen war, in dem es fast nie regnete, wo die Sonne auf einen gebleichten weißen Amboss aus Sand und Felsen hämmerte, wo die Häuserwände dick und weiß waren, um ihren Schlägen zu widerstehen, und wo anmutige Frauen im Silberlicht des frühen Morgens mit großen Tonkrügen auf den Schultern und schwarzen Schleiern vor dem Gesicht zum Brunnen gingen.
Der große Fuchs schüttelte den Regen aus dem zottigen Fell und kam vor dem Wachthaus am Tor im rötlichen Lichtkreis der Fackeln zum Stehen.
Ein bartstoppeliger Wächter in rostbeflecktem Harnisch und Helm und einem mit Flicken besetzten Umhang, den er nachlässig über eine Schulter geworfen hatte, stolperte heraus und baute sich schwankend vor Sperber auf.
»Brauch Euren Namen«, sagte er mit weinschwerer Stimme.
Sperber blickte ihn durchdringend an, dann öffnete er seinen Umhang, damit der Mann das schwere Silberamulett sehen konnte, das an einer Kette um seinen Hals hing.
Der nicht mehr ganz nüchterne Wächter riss die Augen auf und wich einen Schritt zurück. »Oh!«, murmelte er. »Verzeiht, Herr. Ihr dürft passieren.«
Ein anderer Wächter streckte den Kopf aus dem Wachthaus. »Wer ist es, Raf?«, fragte er.
»Ein pandionischer Ritter«, antwortete der Gefragte nervös.
»Was will er in Cimmura?«
»Pandionern stellt man keine Fragen, Bral«, antwortete Raf. Er lächelte unterwürfig zu Sperber hoch. »Ein Neuer«, erklärte er als Entschuldigung und deutete mit dem Daumen über die Schulter auf seinen Kameraden. »Wird es auch noch lernen. Können wir Euch irgendwie behilflich sein?«
»Nein, danke«, erwiderte Sperber. »Seht lieber zu, dass Ihr aus dem Regen kommt, wenn Ihr Euch nicht erkälten wollt.«
Er warf dem Mann mit dem grünen Umhang eine Münze zu und ritt in die Stadt ein. Das Klappern der eisenbeschlagenen Hufe seines Fuchses auf dem Kopfsteinpflaster der Straße hallte von den Hauswänden wider.
Das Viertel ums Stadttor war eine ärmliche Gegend mit heruntergekommenen, dicht aneinandergedrängten Häusern, deren erste Stockwerke über die nasse, schmutzige Straße ragten. Primitive Schilder baumelten an rostigen Haken knarrend im Nachtwind und machten auf diesen oder jenen, inzwischen längst geschlossenen Laden aufmerksam. Ein dürrer Straßenköter trottete mit triefnassem Fell und dünnem, eingezogenem Schwanz übers Pflaster. Ansonsten war die dunkle Straße verlassen.
An der Ecke einer Querstraße flackerte eine Fackel. Eine ausgezehrte Dirne in einem fadenscheinigen blauen Umhang stand hoffnungsvoll darunter wie ein bleiches, ängstliches Gespenst. »Möchtet Ihr Euch vergnügen, Herr?«, fragte sie mit dünner, flehender Stimme. Die Augen in dem eingefallenen, ausgehungerten Gesicht waren groß und scheu.
Sperber hielt an, beugte sich aus dem Sattel und schüttete ein paar kleinere Münzen in ihre schmutzige Hand. »Geh heim, kleine Schwester«, sagte er freundlich. »Es ist spät und nass, es werden sich heute Nacht keine Kunden mehr einfinden.« Dann richtete er sich wieder auf, ritt weiter, und sie starrte ihm staunend und dankbar hinterher. Er bog in eine Seitengasse ein, sah huschende Schemen vor sich, hörte eilige Schritte in der regnerischen Dunkelheit und vernahm Flüstern in den tiefen Schatten auf der linken Seite.
Der Fuchs schnaubte und legte die Ohren zurück.
»Ruhig, ruhig, kein Grund zur Aufregung«, flüsterte Sperber sanft. Seine Stimme war von jener Art, die andere Menschen unwillkürlich aufhorchen ließ. Dann sagte er laut zu den beiden Straßenräubern, die im Dunkeln lauerten: »Ich würde Euch ja gefällig sein, Nachbarn, aber es ist spät und ich bin nicht in Stimmung für derlei Abwechslung. Plündert lieber einen betrunkenen jungen Laffen aus, und nutzt die Chance, ein bisschen länger am Leben zu bleiben.« Um seinen Worten Nachdruck zu verleihen, riss er den nassen Umhang auf, damit der lederumwickelte Griff seines schmucklosen Breitschwerts an seiner Seite zu sehen war.
Eine fast greifbare Stille setzte ein, die alsbald vom hastigen Trappeln fliehender Füße durchbrochen wurde.
Der große Fuchs schnaubte abfällig.
»Du hast ja so recht«, bestätigte Sperber und zog den Umhang wieder enger um sich. »Wollen wir unseren Weg fortsetzen?«
Sie gelangten auf einen großen Marktplatz mit zischenden Fackeln ringsum; an den meisten der schreiend bunten Buden waren die Vorhänge inzwischen heruntergezogen. Nur noch wenige unbeirrbare Händler boten ihre Ware lautstark den achtlos Vorübereilenden an, die nichts anderes wollten, als aus dem Regen nach Hause zu gelangen. Sperber zügelte sein Pferd, als eine Gruppe betrunkener junger Edler aus der Tür einer verrufenen Schenke torkelte und grölend und lärmend den Platz überquerte. Sperber wartete ruhig, bis sie in einer Nebenstraße verschwunden waren; dann blickte er sich um, mehr wachsam denn misstrauisch.
Hätten sich mehr Leute auf dem fast leeren Platz aufgehalten, wäre Krager möglicherweise sogar Sperbers scharfen Augen entgangen. Der Mann war mittelgroß und ungepflegt; sein nasses, fast farbloses Haar klebte am schmalen Schädel, den weinroten Umhang hatte er schlampig am Hals zugezogen, und seine Stiefel waren schmutzig. Er schlurfte über den Platz, und seine wässrigen Augen blinzelten kurzsichtig durch den Regen.
Sperber zog scharf den Atem ein. Er hatte Krager seit jener Nacht in Cippria vor fast zehn Jahren nicht mehr gesehen. Der Mann war stark gealtert, sein Gesicht noch grauer, die Tränensäcke und Hängebacken waren noch schlaffer geworden, doch es war ohne Zweifel Krager.
Da eine rasche Bewegung Aufmerksamkeit erregt hätte, saß Sperber langsam ab und führte sein großes Pferd zum grünen Stand eines Lebensmittelhändlers, wobei er darauf achtete, das Tier zwischen sich und dem Kurzsichtigen im weinroten Mantel zu halten.
»Guten Abend, werter Herr«, sagte er mit bedrohlich ruhiger Stimme zu dem braun gewandeten Krämer. »Ich muss etwas erledigen. Passt auf mein Pferd auf, ich bezahle Euch dafür.«
Die Augen des bartstoppeligen Krämers leuchteten auf.
»Denkt nicht einmal daran!«, warnte Sperber. »Das Pferd würde Euch nicht folgen, egal, was Ihr versucht – ich dagegen schon, und das würde Euch ganz sicher nicht gefallen. Begnügt Euch mit dem Geld, und verschwendet keinen Gedanken mehr daran, das Pferd zu stehlen!«
Der Händler starrte ins düstere Gesicht des großen Mannes, schluckte schwer und verbeugte sich zittrig. »Euer Wunsch ist mir Befehl, Herr«, beeilte er sich, hastig zu versichern. »Ich schwöre Euch, dass Euer edles Ross bei mir sicher ist.«
»Edles was?«
»Edles Ross – Euer Pferd.«
»Oh! Wie freundlich von Euch.«
»Kann ich sonst noch etwas für Euch tun, Herr?«
Sperber blickte über den Platz auf Kragers Rücken. »Habt Ihr vielleicht ein Stück Draht, ungefähr so lang …« Er maß etwa drei Fuß mit den ausgebreiteten Armen ab.
»Wäre möglich, Herr. Die Heringsfässer sind mit Draht zusammengebunden. Lasst mich nachsehen.«
Sperber verschränkte die Arme, lehnte sich an den Sattel des Fuchses und beobachtete Krager über den Pferderücken hinweg. Die Bilder der vergangenen Jahre, Bilder von sengender Sonne und Frauen, die im ersten Mondlicht zum Brunnen gingen, schwanden, und er sah sich plötzlich im Viehhof von Cippria wieder, roch den Gestank von Mist und Blut an sich, kostete den Geschmack von Furcht und Hass im Mund und spürte die Schmerzen, die ihn schwächten, als seine Verfolger mit gezückten Schwertern nach ihm suchten.
Er verdrängte die Bilder der Vergangenheit und konzentrierte sich auf die Gegenwart. Er hoffte sehr, dass der Krämer ein Stück Draht finden würde. Für das, was er vorhatte, war Draht gut geeignet. Lautlos und sauber, und mit ein bisschen Geschick konnte er es wie das Werk eines Styrikers oder Pelosiers aussehen lassen. Es ist nicht so sehr Krager selbst, dachte er, während die Erregung in ihm wuchs. Krager war für Martel nie viel mehr als ein unbedeutendes Werkzeug gewesen, genau wie Adus nie mehr als eine Waffe in seiner Hand gewesen war. Es zählte nur, was Kragers Tod für Martel bedeuten würde.
»Das ist das Beste, was ich finden konnte, mein Herr.« Der Krämer kehrte aus der hinteren Abtrennung seiner Zelttuchbude zurück und streckte ihm ein Stück rostigen, biegsamen Draht entgegen. »Tut mir leid, aber ein längeres Stück habe ich nicht.«
»Ist schon gut.« Sperber nahm den Draht und spannte ihn zwischen den Händen. »Das ist genau das Richtige.« Dann drehte er sich zu seinem Pferd um. »Bleib du hier, Faran.«
Der Fuchs entblößte als Antwort die Zähne. Sperber lachte leise und machte sich daran, in einigem Abstand hinter Krager den Platz zu überqueren. Wenn der Kurzsichtige irgendwo in einem dunklen Hauseingang gefunden würde, wie ein Bogen nach hinten gespannt, den Draht um Hals und Fußgelenke geschlungen und die Augen aus einem blauen Gesicht hervorquellend oder mit dem Gesicht im Becken eines öffentlichen Bedürfnishauses – ja, das würde Martel erschüttern, ihn schmerzen, ihm vielleicht sogar Angst einjagen. Und möglicherweise reichte es aus, um ihn aus seinem Bau zu locken. Sperber hatte jahrelang auf eine Gelegenheit gewartet, an Martel heranzukommen. Unter dem Umhang glätteten seine Finger vorsichtig die geknickten und verdrehten Stellen im Draht, während er sich an sein Opfer heranpirschte.
Seine Sinne waren nun fast übernatürlich geschärft. Deutlich hörte er das Zischen des Nieselregens in den Flammen der Fackeln, die den Platz umgaben, und sah die orangefarbene Spiegelung ihres flackernden Lichts in den Pfützen auf dem Kopfsteinpflaster. Aus irgendeinem Grund erschien ihm dieses funkelnde Glühen beeindruckend schön. Sperber fühlte sich gut – vielleicht besser als irgendwann in den letzten zehn Jahren.
»Herr Ritter? Ritter Sperber? Seid Ihr es wahrhaftig?«
Verärgert und lautlos fluchend drehte Sperber sich rasch um. Sorgfältig geringelte Löckchen rahmten das mit Wangenrot geschminkte Gesicht des Mannes ein, der ihn angesprochen hatte. Er trug ein safrangelbes Wams, ein lavendelfarbenes Beinkleid, einen apfelgrünen Umhang und weinrote, spitze Schuhe. Der zierliche, nutzlose Degen an seiner Seite und der breitkrempige Hut mit der flaumigen Federzier wiesen ihn als Höfling aus, als einen der kleinen Hofbeamten und Schmarotzer, die sich wie Ungeziefer im Schloss eingenistet hatten.
»Wieso seid Ihr nach Cimmura zurückgekehrt?« Entrüstung lag in der hohen, schrillen Stimme des Gecken. »Ihr wurdet verbannt!«
Sperber warf einen raschen Blick zu dem Mann hinüber, den er verfolgte. Krager näherte sich einer Seitenstraße und würde jeden Augenblick außer Sichtweite gelangen. Es war jedoch immer noch möglich, ihn zu fassen. Ein rascher, kräftiger Hieb konnte diesen papageienbunten Laffen in den Schlaf schicken, dann wäre Krager durchaus noch einzuholen. Aber gallenbittere Enttäuschung stieg in Sperber auf, als ein Wachttrupp mit schweren Schritten auf den Marktplatz marschierte. Die Chance war dahin, sich dieses aufdringlichen Stutzers zu entledigen, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Er bedachte den wie in Wohlgerüchen Gebadeten mit drohendem Blick.
Der Höfling wich erschrocken zurück, sah rasch zu den Soldaten, die nun an den Buden entlangschritten und die Verschlüsse der heruntergezogenen Zelttuchbehänge überprüften. »Ich bestehe darauf, dass Ihr mir sofort sagt, weshalb Ihr zurückgekehrt seid!« Er bemühte sich um einen gebieterischen Tonfall.
»Ihr besteht darauf?« Sperbers Verachtung war unverkennbar.
Erneut blickte der andere hastig auf die Soldaten, was ihm offenbar ein Gefühl der Sicherheit verlieh, denn er richtete sich hochmütig auf. »Ich nehme Euch fest, Sperber. Ich verlange, dass Ihr mir Rechenschaft ablegt!« Er griff nach Sperbers Arm.
»Rührt mich nicht an!«, knurrte Sperber und schlug die Hand des Gecken zur Seite.
»Ihr habt mich geschlagen!«, keuchte der Höfling und umklammerte die schmerzende Rechte mit der Linken.
Sperber packte den Laffen mit einer Hand an der Schulter und zog ihn zu sich heran. »Wenn Ihr mich noch einmal anrührt, reiße ich Euch die Eingeweide aus dem Leib! Und nun geht mir aus dem Weg!«
»Ich rufe die Wache!«, drohte der Laffe.
»Und wie lange, glaubt Ihr, werdet Ihr danach noch leben?«
»Ihr könnt mir nicht drohen. Ich habe mächtige Freunde!«
»Aber sie sind nicht hier, oder? Ich dagegen schon.« Sperber schob ihn verächtlich zur Seite, drehte sich um und ging.
»Ihr Pandioner könnt euch diese Unverschämtheiten nicht mehr leisten! In Elenien herrschen jetzt Gesetz und Ordnung!«, schrie ihm der Herausgeputzte schrill nach. »Ich eile sogleich zu Baron Harparin und teile ihm mit, dass Ihr nach Cimmura zurückgekommen seid und mich geschlagen und bedroht habt!«
»Gut«, brummte Sperber, ohne sich umzudrehen oder im Schritt innezuhalten. »Tut das.«
Sein Grimm und seine Enttäuschung steigerten sich so sehr, dass er die Zähne zusammenbeißen musste, um seine Selbstbeherrschung zu bewahren. Da kam ihm eine Idee. Sie mochte zwar läppisch, ja kindisch sein, aber er fand sie recht passend. Er blieb stehen, straffte die Schultern und murmelte etwas auf Styrisch, während seine Finger verschlungene Zeichen in die Luft schrieben. Er stockte, als ihm das Wort für Karbunkel nicht einfiel. Schließlich benutzte er stattdessen Eierbeule und beendete seine Beschwörung. Dann drehte er sich leicht, blickte auf seinen Quälgeist und richtete den Zauber auf ihn.
Lächelnd setzte er seinen Weg über den Platz fort. Gewiss, es war kindisch, das wusste er selbst, aber so war er manchmal eben.
Er gab dem Krämer eine Münze fürs Pferdehüten, schwang sich in Farans Sattel und ritt im Nieselregen über den Platz – ein breitschultriger Mann in grobem, wollenem Umhang auf einem gefährlich dreinblickenden Fuchs.
Die Straßen außerhalb des Platzes waren menschenleer und dunkel, nur an den Kreuzungen zischelten rußige Fackeln im Regen und warfen ihren schwachen orangeroten Schein aufs Pflaster. Farans Hufe klapperten laut auf den verlassenen Straßen. Unmerklich ruckte Sperber im Sattel. Das Gefühl, das sich in ihm regte, war nur ganz schwach, kaum mehr als ein Prickeln der Haut um Schultern und Nacken, doch er vermochte es sogleich zu deuten. Jemand beobachtete ihn, jemand, der keine guten Absichten hegte. Wieder rutschte Sperber leicht im Sattel und bemühte sich, diese Bewegung als normales Unbehagen eines sattelmüden Reiters erscheinen zu lassen. Seine Rechte war nun jedoch unter dem Umhang verborgen und legte sich um den Schwertgriff. Das drückende Gefühl von Bösem verstärkte sich, und schließlich sah er im flackernden Fackelschein an der nächsten Kreuzung eine dunkelgrau vermummte Gestalt, die so sehr mit den Schatten und dem Nieselregen verschmolz, dass sie kaum zu erkennen war.
Der Fuchs spannte die Muskeln und zuckte mit den Ohren.
»Ich sehe ihn, Faran«, versicherte Sperber ihm ruhig.
Weiter klapperten die Hufe über das Kopfsteinpflaster der Straße. Sie ritten durch den Fackelschein an der Kreuzung. Sperbers Augen passten sich wieder der Dunkelheit an, doch der Vermummte war bereits in einem Durchgang oder hinter einer der schmalen Türen in der Häuserfront verschwunden und mit ihm Sperbers Gefühl, beobachtet zu werden. Die Straße barg momentan keine Gefahr mehr. Faran trottete weiter mit klappernden Hufen über die nassen Kopfsteine.
Sperbers Ziel, die Herberge, befand sich in einer abgelegenen Gasse hinter einem Hof mit festem Eichentor und erstaunlich dicken und hohen Mauern. Eine schwach glimmende Laterne hing neben einem verwitterten Holzschild, das bedrohlich knarrte, während es im regenschweren Wind hin und her schwang. Sperber lenkte Faran dicht an das Tor, lehnte sich im Sattel zurück und trat mit einem gespornten Fuß mehrmals kräftig auf die von Nässe dunklen Planken. Seine Tritte erfolgten in einem ganz bestimmten Takt.
Er wartete.
Alsbald öffnete das Tor sich knarzend nach innen, und die schattenhafte Gestalt des schwarz gewandeten Pförtners blickte hinaus. Der Mann, ebenfalls Ordensritter, nickte kurz und riss das Tor weiter auf, um Sperber einzulassen.
Der große Pandioner ritt in den nass glänzenden Hof und saß ab. Der Pförtner schloss und verriegelte das Tor hinter ihm, dann schlug er die Kapuze über dem stählernen Helm zurück und verbeugte sich. »Willkommen, Herr Ritter«, begrüßte er Sperber förmlich.
»Für Förmlichkeiten ist die Nacht zu weit vorangeschritten, Kamerad«, entgegnete Sperber mit einer knappen Verneigung.
»Förmlichkeit ist die Seele der Höflichkeit, Herr Sperber«, erwiderte der Pförtner ironisch. »Ich übe mich darin, wann immer sich die Gelegenheit ergibt.«
»Wie Ihr meint.« Sperber zuckte mit den Schultern. »Kümmert Ihr Euch um mein Pferd?«
»Selbstverständlich. Euer Knappe, Kurik, ist hier.«
Sperber nickte und löste die zwei schweren ledernen Satteltaschen.
»Ich bringe sie Euch hinauf, Kamerad«, erbot sich der Pförtner.
»Nicht nötig. Wo ist Kurik?«
»Im Obergeschoss, erste Tür, gleich neben der Treppe. Möchtet Ihr noch etwas essen?«
Sperber schüttelte den Kopf. »Nur ein Bad und ein warmes Bett.« Er wandte sich seinem Pferd zu, das eingenickt war, wobei es ein Hinterbein leicht angezogen hatte, sodass der Huf auf der Spitze ruhte. »Wach auf, Faran!«, sagte er.
Der Fuchs öffnete die Augen und starrte ihn unfreundlich an.
»Geh mit diesem Ritter«, wies ihn Sperber an. »Und lass dich nicht hinreißen, ihn zu beißen oder zu treten oder ihn an die Wand des Stalles zu drücken – und steig ihm auch nicht auf die Füße!«, sagte er streng.
Der große Fuchs legte für einen Moment die Ohren zurück, dann seufzte er wie ein Mensch.
Sperber lachte. »Gebt ihm ein paar Möhren«, bat er den Pförtner.
»Wie haltet Ihr es mit diesem übellaunigen Biest nur aus, Sperber?«
»Wir passen gut zusammen«, entgegnete Sperber. »Es war ein feiner Ritt, Faran«, wandte er sich wieder an das Tier. »Danke, und angenehmen Schlaf.«
Der Fuchs drehte ihm den Rücken zu.
»Haltet die Augen offen«, warnte Sperber den Pförtner. »Jemand beobachtete mich, als ich hierherritt, und ich hatte das Gefühl, dass es etwas mehr als müßige Neugier war.«
Die Züge des Pförtners wurden hart. »Ich kümmere mich darum.«
»Gut.« Sperber drehte sich um, überquerte die nass glänzenden Steine des Hofs und stieg die Stufen hinauf, die zu der überdachten Galerie rings um das Obergeschoss der Herberge führte.
Diese Herberge war ein wohlgehütetes Geheimnis, das nur wenige in Cimmura kannten. Obgleich sie sich scheinbar nicht von den Dutzenden ähnlichen in der Stadt unterschied, wurde sie von den pandionischen Rittern betrieben und erwies sich als sichere Zuflucht für jeden aus ihren Reihen, der aus dem einen oder anderen Grund nicht die Annehmlichkeiten ihres hiesigen Ordenshauses am Ostrand der Stadt nutzen wollte.
Oben angekommen blieb Sperber vor der nächsten Tür stehen und tippte mit den Fingerspitzen dagegen. Nach einem Moment öffnete sie ein kräftiger Mann mit eisengrauem Haar und kurz gestutztem und dennoch struppigem Bart. Seine lange Weste, das Beinkleid sowie die Stiefel waren aus schwarzem Leder, ebenso der Gürtel, von dem ein schwerer Dolch hing. Kräftige Muskeln schwollen an den nackten Armen und Schultern. Er war kein schöner Mann, und seine Augen wirkten hart wie Achat. »Du kommst spät«, sagte er statt einer Begrüßung.
»Es gab einige Schwierigkeiten unterwegs«, antwortete Sperber lakonisch und trat in die warme, von Kerzen und offenem Feuer erhellte Stube.
Der Breitschultrige schloss die Tür hinter ihm und schob den Riegel scharrend vor. Sperber betrachtete ihn. »Ich hoffe, es ging dir gut, Kurik«, sagte er zu dem Mann, den er seit zehn Jahren nicht gesehen hatte.
»So einigermaßen. Zieh den nassen Umhang aus.«
Sperber grinste, stellte die Sattelbeutel auf dem Boden ab und öffnete die Spange seines triefenden Wollumhangs. »Wie geht es Aslade und den Jungen?«
»Sie wachsen«, brummte Kurik und nahm den Umhang. »Meine Söhne wachsen in die Höhe und Aslade in die Breite. Das Leben auf dem Land tut ihr gut.«
»Du magst doch rundliche Frauen, Kurik«, erinnerte Sperber seinen Knappen und alten Freund. »Deshalb hast du sie doch geheiratet, oder?«
Wieder brummte Kurik und musterte die hagere Gestalt des Ritters. »Du hast dir wohl nie Zeit zum Essen genommen, Sperber«, stellte er anklagend fest.
»Versuch nicht, mich zu bemuttern, Kurik!« Sperber ließ sich in einen schweren Eichenstuhl plumpsen und schaute sich um. Boden und Wände der Stube waren aus Stein, dicke, rußige Balken stützten die niedrige Decke. Unter dem Steinboden des Kamins prasselte Feuer und füllte den Raum mit Licht und tanzenden Schatten. Zwei Kerzen brannten auf dem Tisch, und an zwei gegenüberliegenden Wänden standen schmale Pritschen. Doch als Erstes wanderte Sperbers Blick zu dem schweren Ständer, der neben dem Fenster stand, dessen blaue Vorhänge zugezogen waren. Von diesem Ständer hing eine vollständige, schwarz emaillierte Paraderüstung, daneben lehnte ein großer schwarzer Schild mit dem Wappen seines Geschlechts an der Wand: ein in Silber gearbeiteter Sperber mit gespreizten Schwingen, der einen Speer in den Krallen hielt. Neben dem Schild stand in seiner Scheide ein schweres Breitschwert, dessen Griff mit Silberdraht umwickelt war.
»Du hast vergessen, es einzuölen, ehe du fortgegangen bist«, beklagte sich Kurik. »Ich habe eine ganze Woche gebraucht, um den Rost wegzukriegen. Streck deinen Fuß her.« Er bückte und plagte sich, Sperber erst den einen, dann den anderen Reitstiefel auszuziehen. »Warum musst du immer durch den tiefsten Schlamm spazieren?«, knurrte er, während er die Stiefel neben den Kamin warf. »Ich habe in der Kammer nebenan ein Bad für dich vorbereitet. Schlüpf aus deinem Zeug. Ich wollte mir ohnehin deine Verwundungen ansehen.«
Sperber seufzte müde und stand auf. Mit der erstaunlich sanften Hilfe seines barschen Waffengefährten entkleidete er sich.
»Du bist ja nass bis auf die Haut!«, bemerkte Kurik und berührte den klammen Rücken seines Schutzherrn behutsam mit seiner schwieligen Hand.
»Das bringt der Regen manchmal mit sich.«
»Bist du mit den Wunden jemals zu einem Feldscher gegangen?«, fragte Kurik vorwurfsvoll und tupfte behutsam auf die breiten bläulichen Narben, die Sperbers Schultern und die linke Seite der Brust bedeckten.
»Ein Heiler hat sie sich angesehen. Ein Feldscher war nicht zu finden, also ließ ich der Natur ihren Lauf.«
Kurik nickte. »Das merkt man . Steig jetzt in die Wanne! Ich hole dir etwas zu essen.«
»Ich bin nicht hungrig.«
»Spielt keine Rolle! Du siehst ja aus wie ein Gerippe! Aber nun, da du zurück bist, werde ich dich nicht in diesem Zustand umherwandeln lassen!«
»Willst du mir sagen, was ich zu tun habe? Wer gibt dir das Recht?«
»Mein Zorn! Du hast mich halb zu Tode erschreckt! Zehn Jahre warst du fort, und man hat kaum etwas von dir gehört – und das Wenige war unerfreulich genug!« Kuriks Blick wurde plötzlich sanftmütig, und er umfasste Sperbers Schultern so kraftvoll, dass es einen anderen in die Knie gezwungen hätte. »Willkommen zu Hause!«, sagte er mit belegter Stimme.
Sperber umarmte seinen alten Freund mit rauer Herzlichkeit. »Danke, Kurik. Es ist gut, zurück zu sein.«
»So«, Kuriks Gesicht war wieder hart, »aber jetzt marsch ins Bad! Du stinkst!« Er drehte sich um und verließ die Stube.
Sperber lächelte und ging in die angrenzende Kammer. Er stieg in die hölzerne Wanne und ließ sich behaglich in das dampfende Wasser sinken. Er war so lange ein anderer Mann mit einem anderen Namen gewesen – Mahkra hatte man ihn genannt –, dass kein Bad diese andere Identität hätte wegwaschen können, aber es tat gut, sich zu entspannen und vom heißen Wasser und der körnigen Seife den Staub der trockenen, sonnenverbrannten Küste von der Haut lösen zu können. Während er seine hageren, narbigen Gliedmaßen schrubbte, zog sein Leben als Mahkra in der Stadt Jiroch in Rendor vor seinem inneren Auge vorbei. Er entsann sich des kleinen, kühlen Ladens, in dem Mahkra als einfacher Bürger Messingkrüge, Süßwaren und exotische Duftwässer verkauft hatte, während die dicken weißen Wände auf der gegenüberliegenden Straßenseite den grellen Sonnenschein blendend zurückgeworfen hatten. Er erinnerte sich an die Stunden endlosen Plauderns in der kleinen Weinstube an der Ecke, wo Mahkra den sauren rendorischen Weißwein geschlürft und heimlich Informationen gesammelt hatte, die er dann an seinen Freund und Mitpandioner Voren weiterleitete – Informationen über die neue eshandistische Gesinnung in Rendor, über geheime Waffenlager in der Wüste und über die Tätigkeiten der Agenten Kaiser Othas von Zemoch. Er dachte an die schwülen, dunklen Nächte und den Duft von Lillias, Mahkras schmollmundiger Liebsten, und an den Beginn jedes neuen Tages, an dem er ans Fenster getreten war, um zuzusehen, wie die Frauen im Morgengrauen zum Brunnen gegangen waren. Er seufzte. »Und wer bist du jetzt, Sperber?«, fragte er sich leise. »Ganz gewiss kein Händler mehr, der Messing, kandierte Datteln und Duftstoffe verkauft, sondern wieder ein pandionischer Ritter? Ein Zauberer? Streiter der Königin? Nun, vielleicht nicht. Vielleicht nichts weiter als ein arg mitgenommener und müder Mann, der ein paar Jahre und Narben zu viel besitzt und viel zu viele Gefechte hinter sich hat.«
»Bist du denn überhaupt nicht auf den Gedanken gekommen, deinen Kopf vor der Sonne zu schützen, während du in Rendor warst?«, fragte Kurik. Er stand mit vorwurfsvoller Miene in der Tür und hielt einen Morgenmantel und ein raues Badetuch in den Händen. »Wenn einer erst anfängt, Selbstgespräche zu führen, ist es ein sicheres Zeichen, dass er zu lange in der Sonne war!«
»Ich habe nur laut nachgedacht, Kurik. Ich war lange von zu Hause fort, und es wird ein paar Wochen dauern, bis ich mich wieder eingelebt habe.«
»Ein paar Wochen hast du aber vielleicht nicht. Hat dich jemand erkannt, als du in die Stadt gekommen bist?«
Sperber erinnerte sich an den Gecken auf dem Marktplatz und nickte. »Einer von Harparins Speichelleckern hat mich auf dem Platz beim Westtor gesehen.«
»Da haben wir’s schon! Du wirst morgen im Schloss deine Aufwartung machen müssen, sonst wird Lycheas auf seiner Suche nach dir jeden Stein in Cimmura umdrehen!«
»Lycheas?«
»Der Prinzregent – ein unehelicher Sohn von Prinzessin Arissa und vermutlich irgendeines besoffenen Seemanns oder ungehenkten Taschendiebs.«
Sperber richtete sich plötzlich auf und blickte ihn hart an. »Ich glaube, du solltest mir erst einmal einiges erklären, Kurik!«, sagte er. »Ehlana ist die Königin. Wieso braucht ihr Reich einen Prinzregenten?«
»Wo warst du denn, Sperber? Auf dem Mond? Ehlana ist vor einem Monat erkrankt.«
»Sie ist doch nicht tot?« Ein schwerer Klumpen drückte auf seinen Magen, als er daran dachte, dass der jungen Frau etwas zugestoßen sein könnte, an die er sich als bleiches, wunderschönes kleines Mädchen mit ernsten grauen Augen erinnerte, dessen Kindheit er miterlebt und das er auf seltsame Weise geliebt hatte, obwohl es erst acht gewesen war, als König Aldreas Sperber ins Exil nach Rendor verbannt hatte.
»Nein«, antwortete Kurik, »nicht tot, obwohl sie es genauso gut sein könnte.« Er hob das große, raue Badetuch. »Steig aus der Wanne. Ich erzähle es dir, während du isst.«
Sperber nickte und stand auf. Kurik rubbelte ihn trocken, dann half er ihm in den weichen Morgenmantel. Auf dem Tisch in der Stube wartete eine Platte mit dampfenden Bratenscheiben, die in Soße schwammen, ein halber Laib dunkles Bauernbrot, ein Riesenstück Käse und ein Krug gekühlter Milch. »Iss!«, befahl Kurik.
»Was war hier los?«, fragte Sperber heftig, als er sich an den Tisch setzte und zu essen anfing. Er staunte selbst, als er bemerkte, welch gewaltigen Hunger er mit einem Mal hatte. »Fang ganz am Anfang an!«
»Na gut.« Kurik zog den Dolch aus der Scheide und schnitt dicke Scheiben vom Laib. »Du weißt, dass die Pandioner nach deiner Abreise im Mutterhaus zu Demos bleiben mussten?«
Sperber nickte. »Ich hörte es. König Aldreas mochte uns nie sehr.«
»Das war die Schuld deines Vaters. Aldreas mochte seine Schwester sehr, und dann zwang ihn dein Vater, eine andere zu heiraten. Das trug nicht dazu bei, seine Gefühle für den pandionischen Orden zu heben.«
»Kurik«, rügte Sperber, »so spricht man nicht vom König.«
Kurik zuckte mit den Schultern. »Er lebt nicht mehr, also kann es ihn nicht kränken, und was er für seine Schwester empfand, weiß doch jeder. Die Diener im Schloss ließen sich von jedem bestechen, der sehen wollte, wie Arissa splitternackt durch die oberen Korridore zum Schlafgemach ihres Bruders ging. Aldreas war ein schwacher König, Sperber. Er stand völlig unter dem Einfluss von Arissa und dem Primas Annias. Nachdem die Pandioner in Demos festgesetzt worden waren, hatten Annias und seine Unterpriester die Dinge ziemlich in der Hand. Du kannst froh sein, dass du während dieser Jahre nicht hier warst.«
»Möglich«, brummte Sperber. »Woran ist Aldreas gestorben?«
»An der Fallsucht, behauptet man. Ich glaube eher, dass ihn die Freudenmädchen überanstrengten, die ihm Annias nach dem Tod seiner Gemahlin heimlich ins Schloss schleppte.«
»Kurik, du bist ja schlimmer als eine Klatschbase!«
»Ich weiß«, gab der Knappe gleichmütig zurück. »Das ist eines meiner Laster.«
»Und dann wurde Ehlana zur Königin gekrönt?«
»Richtig. Von da an änderten sich die Dinge. Annias war überzeugt gewesen, dass er sie beherrschen könnte wie zuvor Aldreas, doch da hatte er sich getäuscht. Sie rief den Hochmeister Vanion aus dem Mutterhaus in Demos zu sich und ernannte ihn zu ihrem persönlichen Berater. Danach befahl sie Annias, sich bereit zu machen, in ein Kloster zu gehen, um über die für einen Kirchenmann schicklichen Tugenden zu meditieren. Annias kochte natürlich vor Wut und begann sofort, Komplotte zu schmieden. Ständig waren Boten zwischen hier und der Abtei unterwegs, in die Prinzessin Arissa gesteckt worden war. Arissa und Annias sind alte Freunde und hatten gewisse gemeinsame Interessen. Jedenfalls schlug Annias vor, Ehlana sollte sich mit ihrem unehelichen Vetter Lycheas vermählen, doch sie lachte dem Primas ins Gesicht.«
»Das kann ich mir bei ihr gut vorstellen.« Sperber lächelte. »Ich habe sie selbst erzogen und sie gelehrt, was sich schickt. An welcher Krankheit leidet sie denn?«
»Offenbar der gleichen, an der ihr Vater starb. Sie hatte einen Anfall und erlangte ihr Bewusstsein nicht wieder. Die Hofärzte sagten alle, dass sie die Woche nicht überleben würde, doch da griff Vanion ein. Er erschien mit Sephrenia und elf anderen Pandionern am Hof – alle in voller Rüstung und mit geschlossenen Visieren. Sie wiesen die Ärzte und das Gefolge der Königin aus dem Krankengemach, hoben Ehlana aus dem Bett, kleideten sie in ihr Throngewand und setzten ihr die Krone auf ihr Haupt. Dann trugen sie sie in den Audienzsaal, setzten sie auf den Thron und versperrten die Tür. Niemand weiß, was sie in dem Saal gemacht haben, doch als sie die Tür wieder öffneten, saß Ehlana in Kristall gehüllt auf dem Thron.«
»Wa…as?«, rief Sperber.
»Es ist so klar wie Glas. Man kann jede Sommersprosse auf ihrem Näschen sehen, aber man kann sie nicht berühren. Der Kristall ist härter als Diamant. Annias ließ fünf Tage lang Männer mit Hammer und Meißel daran arbeiten, doch sie brachten nicht einmal einen Kratzer zuwege!« Kurik blickte scharf Sperber an. »Könntest du es schaffen?«
»Ich? Kurik, ich wüsste nicht einmal, wie ich es anfangen müsste. Wir hatten zwar eine Grundausbildung bei Sephrenia, aber mehr auch nicht. Verglichen mit ihr sind wir unwissend.«
»Nun, was immer Sephrenia auch getan hat, es hält die Königin am Leben. Man kann ihr Herz schlagen hören – wie eine Trommel hallt es durch den Thronsaal. Während der ersten Wochen kamen die Leute in Scharen herbei, nur um es zu hören. Man sprach sogar von einem Wunder und dass der Thronsaal zur heiligen Stätte erklärt werden sollte. Annias verschloss jedoch die Tür, berief den Bastard Lycheas nach Cimmura und ernannte ihn zum Prinzregenten. Das war vor etwa zwei Wochen. Dann ließ er alle seine Feinde verhaften. Die Verliese unter dem Dom quellen schier über von ihnen. So stehen momentan die Dinge. Du hast dir für die Rückkehr die richtige Zeit ausgesucht!« Er machte eine Pause und blickte seinen Schutzherrn an. »Was ist in Cippria passiert, Sperber? Die Nachrichten, die hier ankamen, waren nicht sehr ergiebig.«
Sperber zuckte die Achseln. »Nichts Besonderes. Erinnerst du dich an Martel?«
»Der Renegat, dem Vanion die Ritterschaft absprach? Der mit dem weißen Haar?«
Sperber nickte. »Er kam mit zwei Knechten nach Cippria, wo sie zur Verstärkung fünfzehn oder zwanzig Meuchler anheuerten. In einer dunklen Straße stellten sie mir einen Hinterhalt.«
»Daher deine Narben?«
»Ja.«
»Aber du bist entkommen.«
»Wie du siehst. Rendorische Halunken sind ein bisschen empfindlich, wenn das Blut auf dem Pflaster und an den Wänden ihr eigenes ist. Nachdem ich etwa ein Dutzend Angreifer niedergestreckt hatte, verlor der Rest den Mut. Ich entkam ihnen und gelangte zum Stadtrand. Ich zog mich in ein Kloster zurück, bis meine Wunden verheilt waren. Dann nahm ich Faran und schloss mich einer Karawane nach Jiroch an.«
Kurik blickte ihn nachdenklich an. »Wäre es möglich, dass Annias etwas mit dem Überfall zu tun hatte? Er hasst deine Familie, weißt du? Und es ist ziemlich sicher, dass er es war, der Aldreas überredete, dich zu verbannen.«
»Mir kam hin und wieder der gleiche Gedanke. Annias und Martel standen schon früher in Verbindung. Jedenfalls finde ich, dass der teure Primas und ich über so allerlei reden müssen!«
Die Betonung ließ Kurik aufblicken. »Du bringst dich in Schwierigkeiten!«, warnte er.
»Sie werden nicht so schlimm sein wie die, die Annias erwarten, falls ich herausfinde, dass er hinter dem Überfall steckte.« Sperber richtete sich auf. »Ich muss mit Vanion reden. Ist er noch hier in Cimmura?«
Kurik nickte. »Im Ordenshaus am Ostrand der Stadt, aber dorthin kannst du jetzt nicht, sie schließen das Osttor bei Sonnenuntergang. Jedenfalls solltest du gleich morgen früh deine Aufwartung im Schloss machen. Annias wird nämlich bestimmt nicht lange zögern, dich zum Gesetzlosen zu erklären, weil du unerlaubt aus der Verbannung zurückgekehrt bist. Es ist ratsamer, du tust selbst den ersten Schritt, ehe sie dich wie einen gewöhnlichen Verbrecher vorführen lassen. Du wirst dir etwas Überzeugendes einfallen lassen müssen, um nicht ebenfalls in den Verliesen zu enden!«
»Das glaube ich nicht«, widersprach Sperber. »Ich habe ein Dokument mit dem Siegel der Königin, in dem meine Rückkehr genehmigt wird.« Er schob seinen Teller zur Seite. »Die Schrift ist zwar etwas kindlich und von Tränen verwischt, aber gültig dürfte es trotzdem sein.«
»Sie weinte? Das habe ich ihr gar nicht zugetraut!«
»Sie war damals erst acht, Kurik, und aus irgendeinem Grund mochte sie mich sehr.«
»Du hast diese Wirkung auf so manchen Menschen.« Kurik blickte auf Sperbers Teller. »Bist du satt?«
Sperber nickte.
»Dann sieh zu, dass du ins Bett kommst. Du hast einen anstrengenden Tag vor dir!«
Es war viel später in dieser Nacht. Die Stube war schwach von den orangerot glühenden Kohlen im Kamin beleuchtet, und von der Pritsche an der anderen Wand drang der regelmäßige Atem Kuriks an Sperbers Ohren. Das hartnäckige Schlagen eines losen Fensterladens ein paar Straßen entfernt reizte irgendeinen dummen Hund zum Bellen, und Sperber wartete schlaftrunken, dass der Köter nass oder seiner ruhestörenden Beschäftigung müde genug wurde, sich in seine Hütte zurückzuziehen.
Dass Sperber Krager auf dem Marktplatz gesehen hatte, musste nicht mit Sicherheit bedeuten, dass Martel sich in Cimmura aufhielt. Krager war sein Laufbursche und des Öfteren einen halben Kontinent von seinem Herrn entfernt. Hätte der brutale Adus den regennassen Platz überquert, bestünde kein Zweifel, dass Martel sich in der Stadt aufhielt. Aus zwingendem Grund musste Adus fest an der Leine gehalten werden.
Es würde nicht schwierig sein, Krager zu finden. Er war ein schwacher Mann mit den üblichen Lastern und der üblichen Berechenbarkeit schwacher Männer. Krager würde leicht aufzuspüren sein, und Krager würde wissen, wo Martel zu finden war. Diese Information ließ sich leicht aus ihm herausholen.
Sperber bewegte sich ganz leise, um seinen Getreuen nicht aufzuwecken, als er die Beine aus dem Bett schwang, ans Fenster trat und in den Regen starrte, der schräg auf den von Laternen beleuchteten Hof fiel. Abwesend legte Sperber die Hand um den silberumwickelten Griff des Breitschwerts, das neben seinem Paradepanzer stand. Er fühlte sich gut an – wie der Händedruck eines guten alten Freundes.
Vage, wie immer, ging ihm die Erinnerung an den Klang von Glocken durch den Kopf. Den Glocken war er in jener Nacht in Cippria nachgegangen. Erschöpft, verwundet und allein war er in der nach Mist stinkenden Nacht im Viehhof dem Klang der Glocken gefolgt und schließlich beinahe darauf zugekrochen. Dann endlich hatte er die Mauer erreicht und sich an den alten Steinen entlanggetastet, bis er zum Tor gelangte. Dort war er zusammengebrochen.
Sperber schüttelte den Kopf. Das lag lange zurück. Merkwürdig, dass er sich noch so deutlich an die Glocken zu erinnern vermochte. Mit der Hand um den Schwertgriff starrte er hinaus in die letzten Nachtstunden, beobachtete den Regen und entsann sich des Glockenklangs.
2
Sperber hatte seine Paraderüstung angelegt und schritt rasselnd im Kerzenschein der Stube hin und her, um sich wieder daran zu gewöhnen. »Ich hatte völlig vergessen, wie schwer sie ist«, gestand er.
»Du bist verweichlicht«, rügte Kurik. »Du brauchst mindestens einen Monat auf dem Übungsfeld, um wieder in Form zu kommen! Bist du sicher, dass du sie heute tragen willst?«
»Es ist ein formeller Besuch, Kurik, und formelle Anlässe erfordern formelle Kleidung. Außerdem möchte ich keinen falschen Eindruck erwecken. Ich bin der Streiter der Königin, und die Etikette verlangt, dass ich Paradepanzer trage, wenn ich ihr meine Aufwartung mache.«
»Sie werden dich nicht zu ihr vorlassen«, prophezeite Kurik und reichte seinem Schutzherrn den Helm.
»Nicht lassen?«
»Tu nichts Törichtes, Sperber. Du bist ganz auf dich gestellt!«
»Gehört Graf von Lenda noch dem Rat an?«
Kurik nickte. »Er ist alt und hat nicht viel zu sagen, doch bringt man ihm immer noch zu große Hochachtung entgegen, als dass Annias es wagte, ihn abzusetzen.«
»Dann habe ich zumindest einen Freund dort.« Sperber nahm Kurik den Helm ab und stülpte ihn über den Kopf. Das Visier schob er hoch.
Kurik ging zur Fensterbank, um Sperbers Schwert und Schild zu holen. »Der Regen lässt nach«, stellte er fest, »und es wird hell.« Er kam zurück, legte Schwert und Schild auf den Tisch und griff nach dem silberfarbenen Wappenrock. »Streck die Arme aus«, wies er Sperber an.
Sperber spreizte die Arme, und Kurik drapierte den Wappenrock über Sperbers Schultern, dann schnürte er die Seiten. Alsdann wickelte er den langen Schwertgürtel zweimal um die Hüfte seines Schutzherrn.
Sperber langte nach dem Schwert in der Scheide. »Hast du es geschärft?«, fragte er.
Kurik antwortete mit einem finsteren Blick.
»Entschuldige.« Sperber befestigte die Scheide an den schweren Stahlknöpfen des Gürtels und schob sie auf die linke Seite.
Kurik hängte das lange schwarze Cape an die Schulterplatten der Rüstung, dann machte er ein paar Schritte zurück und musterte Sperber von oben bis unten. »Na ja, es geht«, brummte er. »Ich bringe dir den Schild. Beeil dich lieber. Im Schloss steht man früh auf. Dadurch gewinnt man Zeit, Komplotte zu schmieden.«
Sie verließen die Stube und stiegen die Treppe zum Herbergshof hinunter. Der Regen hatte nachgelassen, nur der böige Morgenwind peitschte vereinzelte Schauer aufs Pflaster. Noch zogen Wolkenfetzen über den grauen Himmel, aber im Osten breitete sich bereits ein Streifen bleiches Gelb aus.
Der Pförtnerritter holte Faran aus dem Stall und half Sperber mit Kuriks Unterstützung in den Sattel.
»Sei im Schloss vorsichtig, mein Gebieter«, mahnte Kurik. »Die Wächter der königlichen Leibgarde werden wahrscheinlich nicht Partei ergreifen, aber Annias hat auch einen Trupp Kirchensoldaten im Schloss stationiert. Du musst davon ausgehen, dass alle Rotuniformierten Feinde sind.« Er reichte den kunstvoll gehämmerten schwarzen Schild hinauf.
Sperber schnallte den Schild fest. »Du siehst im Ordenshaus nach Vanion?«, fragte er seinen Knappen.
Kurik nickte. »Sobald das Osttor geöffnet wird.«
»Ich werde wahrscheinlich dort hinreiten, sobald ich im Schloss fertig bin. Komm trotzdem hierher zurück und warte auf mich.«
»Riskiere nicht zu viel, mein Gebieter.«
Sperber nahm vom Pförtner die Zügel entgegen. »Habt Dank, Herr Ritter. Wenn Ihr mir nun auch noch das Tor öffnen würdet, werde ich dem Bastard Lycheas meine Aufwartung machen.«
Der Pförtner lachte und schwang das Tor auf.
Faran trat mit stolzem, elegantem Schritt hinaus und setzte die Hufe in übertrieben klapperndem Stakkato auf. Das große Pferd hatte einen eigenartigen Hang, auf sich aufmerksam zu machen, ganz besonders dann, wenn Sperber in voller Rüstung auf ihm ritt.
»Werden wir nicht beide ein bisschen zu alt für dieses Getue?«, fragte Sperber trocken.
Faran achtete nicht darauf, sondern stolzierte wie ein Paradepferd weiter.
So früh am Morgen waren in Cimmura nicht viele Leute unterwegs – nur ein paar eilige Handwerker und noch schläfrige Händler. Die Straßen waren glatt, und der Wind spielte mit den bunt bemalten Schildern über den Geschäften, dass sie knarrend hin und her schwangen. Die meisten Fensterläden waren noch geschlossen, lediglich hinter ein paar offenen deutete goldenes Kerzenlicht auf Frühaufsteher hin.
Sperber bemerkte, dass seine Rüstung bereits zu riechen angefangen hatte – es war diese alte vertraute Geruchsmischung von Stahl, Öl und dem Lederharnisch, der jahrelang den Schweiß aufgesogen hatte. Dieser Geruch, den Sperber in den sonnenglühenden Straßen und Gewürzläden von Jiroch so gut wie vergessen hatte, überzeugte ihn fast mehr als der vertraute Anblick von Cimmura, dass er wieder zu Hause war.
Hin und wieder rannte ein Hund auf die Straße und bellte Ross und Reiter an, während sie vorüberritten, doch Faran blickte nur verächtlich auf die Kläffer hinab und stolzierte unbeirrt über das Kopfsteinpflaster.
Das Schloss lag im Zentrum der Stadt. Es war ein beeindruckendes Bauwerk, das die Häuser ringsum weit überragte, mit hohen Türmen, an deren Spitzen vor Nässe schwere, bunte Fahnen träge im Wind schlugen. Eine Mauer mit Brustwehr riegelte das Schloss von der Stadt ab. Vor langer Zeit hatte einer der elenischen Könige die Mauer außen mit weißem Kalkstein verkleiden lassen. Das hiesige Klima und die dicke Rauchdecke, die zu manchen Jahreszeiten auf die Stadt drückte, hatten diese Verkleidung mit streifigem, schmutzigem Grau überzogen.
Das Tor der Schlossmauer war breit und wurde von einem halben Dutzend Posten in der dunkelblauen Uniform der Leibgarde bewacht.
»Halt!«, befahl einer der Männer, als Sperber näher kam. Der Posten stellte sich in die Mitte des Eingangs und streckte seine Pike aus.
Sperber tat, als hätte er ihn nicht gehört, und Faran trottete geradewegs auf den Gardisten zu.
»Ich sagte, Ihr sollt anhalten, Herr Ritter!«, befahl der Posten erneut. Da sprang einer seiner Kameraden auf ihn zu, packte ihn am Arm und zerrte ihn aus dem Weg. »Das ist der Streiter der Königin!«, riet er dem Kameraden eindringlich. »Stell dich ihm nie in den Weg!«
Auf dem Innenhof saß Sperber ab, etwas schwerfällig wegen der unbequemen Rüstung und des großen Schilds. Ein Posten kam mit vorgestreckter Pike auf ihn zu.
»Guten Morgen, werter Herr«, grüßte Sperber ruhig.
Der Gardist zögerte.
»Passt auf mein Pferd auf«, wies Sperber ihn an. »Ich komme bald zurück.« Er drückte dem Soldaten Farans Zügel in die Hand und stieg die breite Freitreppe zum Schlosseingang hinauf.
»Herr Ritter!«, rief ihm der Posten nach.
Ohne sich umzudrehen, ging Sperber weiter die Stufen empor. Vor der Flügeltür standen zwei Blauuniformierte, ältere Männer, die er zu kennen vermeinte. Die Augen des einen weiteten sich, und er grinste plötzlich. »Willkommen zu Hause, Ritter Sperber«, rief er erfreut und öffnete dem schwarzgerüsteten Ritter die Tür.
Sperber dankte ihm mit einem freundlichen Nicken und betrat das Schloss. Der stählerne Schuhschutz und die Sporen klirrten auf den polierten Fliesen. Nahe der Tür stieß er auf einen Höfling mit pomadesteifen Löckchen und weinfarbenem Wams.
»Ich will mit Lycheas sprechen«, sagte Sperber schroff. »Führt mich zu ihm.«
»Aber …« Der Mann war leicht erblasst, doch jetzt richtete er sich straff auf und sagte mit hochmütiger Miene: »Wie seid Ihr …«
»Habt Ihr mich nicht verstanden, guter Mann?«, fragte Sperber scharf.
Der Laffe im weinroten Wams zuckte zurück. »S…sofort, Ritter Sperber«, stammelte er. Er drehte sich um und ging den breiten Mittelkorridor voraus. Seine Schultern zitterten merklich. Sperber fiel auf, dass der Höfling ihn nicht zum Thronsaal führte, sondern zu der Ratskammer, in der sich König Aldreas gewöhnlich mit seinen Ratgebern besprochen hatte. Ein schwaches Lächeln huschte über die Lippen des breitschultrigen Ritters, als er daran dachte, dass die Anwesenheit der jungen Königin, ganz in Kristall gehüllt, eine dämpfende Wirkung auf die Ambitionen ihres Vetters haben musste, selbst den Thron zu besteigen.
Die Tür zur Ratskammer wurde von zwei Posten in der roten Uniform der kirchlichen Truppe bewacht – Soldaten des Primas Annias. Automatisch überkreuzten die beiden ihre Piken, um den Eintritt zu verwehren.
»Der Streiter der Königin möchte dem Prinzregenten einen Besuch abstatten«, sagte der Höfling mit schriller Stimme zu ihnen.
»Wir haben keine Anweisungen, den Streiter der Königin einzulassen«, entgegnete einer der Posten.
»Ihr habt sie jetzt«, sagte Sperber. »Öffnet die Tür!«
Der Mann im weinroten Wams wollte davoneilen, doch Sperber hielt ihn am Arm zurück. »Ich habe nicht gesagt, dass Ihr gehen könnt, guter Mann!« Dann blickte er wieder den Posten an. »Öffnet die Tür!«, wiederholte er.
Einen Augenblick herrschte drückende Stille, während die beiden Soldaten erst Sperber und dann einander nervös anstarrten. Schließlich schluckte einer schwer, zog seine Pike zurück und langte nach der Türklinke.
»Ihr müsst mich melden!«, wandte sich Sperber an den Höfling, den er noch mit den eisenbehandschuhten Fingern am Arm hielt. »Wir möchten doch niemanden überraschen, nicht wahr?«
Mit verstörter Miene trat der Mann an die jetzt offene Tür und räusperte sich. »Der Streiter der Königin«, meldete er mit sich überschlagender Stimme. »Der pandionische Ritter, Herr Sperber.«
»Danke, guter Mann«, sagte Sperber. »Ihr dürft jetzt gehen.«
Der Höfling eilte davon.
Die Ratskammer war sehr groß. Ein blauer Teppich dämpfte die Schritte, und die Vorhänge waren vom gleichen Blau. Kerzen brannten in Leuchtern entlang den Wänden und auch auf dem langen, polierten Ratstisch, der in der Mitte des Raums stand. Drei Männer saßen an diesem Tisch, auf dem Schriftstücke ausgebreitet waren, ein vierter hatte sich halb erhoben.
Letzterer war Primas Annias. Der Kirchenmann war in den vergangenen zehn Jahren hagerer geworden, und sein Gesicht wirkte grau und ausgezehrt. Das im Nacken zusammengehaltene Haar war nun mit silbernen Strähnen durchzogen. Er trug ein langes schwarzes Obergewand, und der mit Edelsteinen besetzte Anhänger, das Zeichen seines Amts als Primas von Cimmura, hing von einer dicken Goldkette um seinen Hals. Seine weit aufgerissenen Augen verrieten sein Erschrecken, als er Sperber erkannte.
Der Graf von Lenda, ein weißhaariger Herr in den Siebzigern, der ein weiches graues Wams trug, grinste offen, und seine strahlend blauen Augen im furchigen Gesicht blitzten erfreut. Die Miene des berüchtigten Knabenfreundes, Baron Harparin, war vor Überraschung erstarrt. Seine Kleidung war in schreienden, einander kaum verträglichen Farben gehalten. Neben ihm saß ein unförmiger dicker Mann in Rot, den Sperber nicht kannte.
»Sperber!«, rief Annias scharf, nachdem er sich von seinem Schrecken erholt hatte. »Was wollt Ihr hier?«
»Ich hörte, Ihr habt nach mir suchen lassen, Exzellenz«, entgegnete Sperber. »Ich dachte, ich erspare Euch die weitere Mühe.«
»Ihr habt Eure Verbannung gebrochen, Sperber!«, sagte Annias zornig.
»Das ist einer der Punkte, über die wir sprechen müssen. Ich hörte, dass der Bastard Lycheas als Prinzregent eingesetzt sei, bis die Königin wieder genesen ist. Lasst ihn rufen, damit wir das Ganze nicht zweimal durchgehen müssen.«
Erneut weiteten sich Annias’ Augen, diesmal vor Schock und Entrüstung.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: