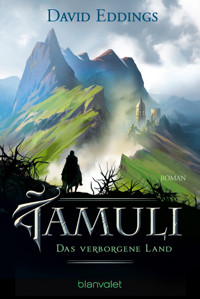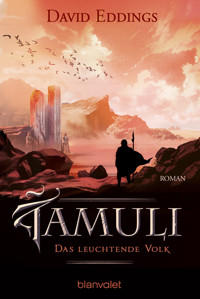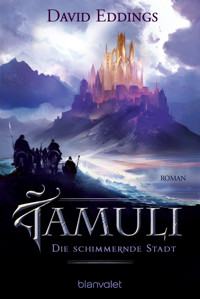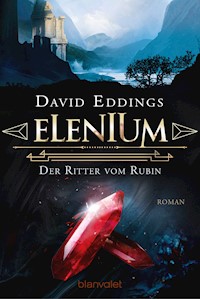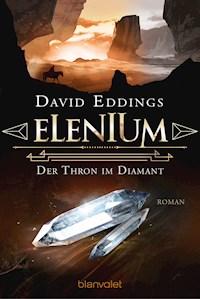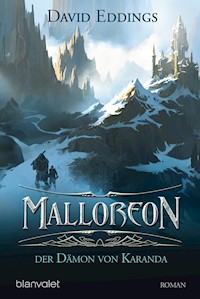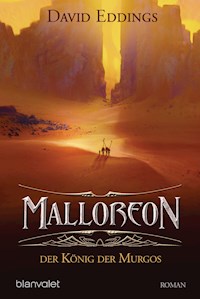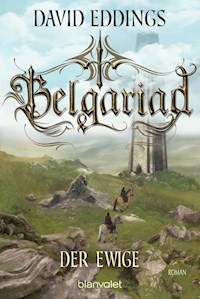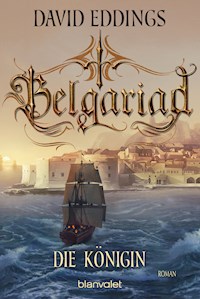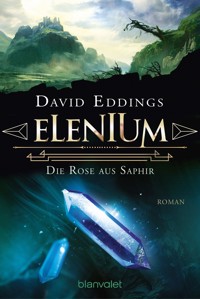
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Elenium-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Tapfere Ritter, mutige Königinnen, Götter und Magie – das Finale der Elenium-Trilogie von Bestsellerautor David Eddings.
Endlich hält Ritter Sperber das Mittel in der Hand, mit dem er Königin Ehlana vor dem sicheren Tod bewahren kann – die Rose aus Saphir. Doch mit ihrer Rettung ist seine Aufgabe noch nicht abgeschlossen. Der Verräter, der Ehlana vergiftet hat, hat noch längst nicht aufgegeben. Da ihm die weltliche Macht durch Ehlanas Genesung verwehrt bleibt, greift er nach dem höchsten religiösen Amt. Damit wäre er nicht nur der Befehlshaber der riesigen Ordensheere, er wäre auch der direkte Vorgesetzte von Ritter Sperber selbst. Dieser muss ihn aufhalten – besonders als Sperber erkennt, dass selbst sein mächtiger Feind nur der Handlanger eines viel größeren Übels ist.
Die Elenium-Trilogie bei Blanvalet:
1. Der Thron im Diamant
2. Der Ritter vom Rubin
3. Die Rose aus Saphir
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 832
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Buch
Endlich hält Ritter Sperber das Mittel in der Hand, mit dem er Königin Ehlana vor dem sicheren Tod bewahren kann – die Rose aus Saphir. Doch mit ihrer Rettung ist seine Aufgabe noch nicht abgeschlossen. Der Verräter, der Ehlana vergiftet hat, hat noch längst nicht aufgegeben. Da ihm die weltliche Macht durch Ehlanas Genesung verwehrt bleibt, greift er nach dem höchsten religiösen Amt. Damit wäre er nicht nur der Befehlshaber der riesigen Ordensheere, er wäre auch der direkte Vorgesetzte von Ritter Sperber selbst. Dieser muss ihn aufhalten – besonders als Sperber erkennt, dass selbst sein mächtiger Feind nur der Handlanger eines viel größeren Übels ist.
Autor
David Eddings wurde ١٩٣١ in Spokane im US-Bundesstaat Washington geboren. Während seines Dienstes für die US-Streitkräfte erwarb er einen Bachelor of Arts und einige Jahre darauf einen Master of Arts an der University of Washington. Bevor er ١٩٨٢ seinen ersten großen Roman, »Belgariad – Die Gefährten«, veröffentlichte, arbeitete er für den Flugzeughersteller Boeing. Den Höhepunkt seiner Autorenkarriere erreichte er, als der Abschlussband seiner Malloreon-Saga Platz ١ der »New York Times«-Bestsellerliste erreichte. Im Jahr ٢٠٠٩ starb er in Caron City, Nevada.
Von David Eddings bei Blanvalet:
Die Belgariad-Saga:
١. Die Gefährten
٢. Der Schütze
٣. Der Blinde
٤. Die Königin
٥. Der Ewige
Die Malloreon-Saga
١. Die Herren des Westens
٢. Der König der Murgos٣. Der Dämon von Karanda٤. Die Zauberin von Darshiva٥. Die Seherin von Kell
Die Elenium-Trilogie:
١. Der Thron im Diamant٢. Der Ritter vom Rubin٣. Die Rose aus Saphir
Besuchen Sie uns auch auf www.instagram.com/blanvalet.verlag und www.facebook.com/blanvalet.
David Eddings
Elenium
Die Rose aus Saphir
Roman
Deutsch von Lore Strassl
Die Originalausgabe erschien 1991 unter dem Titel »The Sapphire Rose. The Elenium-Trilogy 3« bei Del Rey, New York.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright der Originalausgabe © 1991 by David Eddings
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2023 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Gerhard Seidl / textinform
Umschlaggestaltung und Artwork: © Isabelle Hirtz, Inkcraft unter Verwendung mehrerer Motive von Hare Krishna/Shutterstock.com
HK · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-29367-3V001
www.blanvalet.de
Anmerkung des Verfassers
Meine Frau hat gesagt, sie würde gern die Widmung für dieses Buch schreiben.
Da sie viel zu dem Werk beigetragen hat, finde ich, dass es ihr zusteht.
Du hast zum Himmel gegriffen und das Feuer herabgeholt.
Alles Liebe von mir.
Prolog
Otha und Azash
Auszug aus: Abriss der Geschichte von Zemoch.
Zusammengestellt von der Fakultät für Geschichte der Universität zu Borrata.
Nach der Invasion der elenisch sprechenden Völker aus den Steppen Mitteldaresiens im Osten wanderten die Elenier westwärts und verdrängten die Styriker, die den eosischen Kontinent dünn besiedelt hatten. Jene Stämme, die sich in Zemoch niederließen, waren Nachzügler, die ihren westlichen Vettern entwicklungsmäßig nicht das Wasser reichen konnten. Ihre Wirtschafts- und Gesellschaftsstruktur war primitiv, und verglichen mit den aus dem Boden schießenden Städten der im Westen entstehenden Reiche waren ihre Ortschaften archaisch. Zudem konnte man Zemochs Klima bestenfalls als unfreundlich bezeichnen, und die Lebensgrundlage war äußerst dürftig. Ein derart karges und raues Land bot wenig Anreiz für die Kirche, und so waren die Gemeinden mit ihren schlichten Gotteshäusern zum größten Teil ohne Seelenhirten, sodass die Zemocher schließlich einen religiösen Sonderweg beschritten. Da es in dieser Region nur wenige elenische Priester gab, die bei einer Verbrüderung mit den heidnischen Styrikern den Kirchenbann hätten verhängen können, kam es zur Vermischung religiöser Vorstellungen. Die einfachen elenischen Bauern erkannten, dass ihre styrischen Nachbarn durch ihre geheimen Künste beachtliche Vorteile erzielten. So war es nicht verwunderlich, dass die Zahl der Abtrünnigen ungeheuerlich zunahm. Ganze elenische Ortschaften traten zum styrischen Pantheismus über. Tempel wurden für lokale Gottheiten errichtet, und die finsteren styrischen Kulte erlebten einen ungeahnten Aufschwung. Mischehen zwischen Eleniern und Styrikern wurden alltäglich, und gegen Ende des ersten Jahrtausends konnte Zemoch in keiner Weise mehr als rein elenische Nation betrachtet werden. Sogar die elenische Sprache hatte sich in Zemoch so sehr verändert, dass westliche Elenier sie kaum noch verstanden.
Es war im elften Jahrhundert, als ein junger Ziegenhirt aus dem Bergdorf Ganda in Mittelzemoch ein eigenartiges und wahrhaft welterschütterndes Erlebnis hatte. Während er in den Bergen nach einer verirrten Ziege suchte, stolperte der Junge, dessen Name Otha war, über einen verborgenen, völlig überwucherten Altar, der im Altertum von Anhängern einer der zahlreichen styrischen Kulte errichtet worden war. Auf dem Altar stand ein verwittertes Idol, dessen Züge kaum noch erkennbar waren. Als Otha sich von der anstrengenden Kletterei ausruhte, hörte er eine hohle Stimme, die ihn in der Sprache der Styriker fragte: »Wer bist du, Junge?«
»Ich heiße Otha«, antwortete der Junge stockend, während er sich an seine Styrischkenntnisse zu erinnern versuchte.
»Und du bist hierhergekommen, um mir zu huldigen, vor mir niederzuknien und mich anzubeten?«
»Nein«, entgegnete Otha mit ungewohnter Ehrlichkeit. »Ich bin hier, weil ich eine verlaufene Ziege suche.«
Nach einer langen Pause ertönte die hohle, erschreckende Stimme aufs Neue: »Was muss ich dir geben, damit du mir huldigst und mich anbetest? Seit fünftausend Jahren kam keiner deiner Art mehr zu meinem Altar. Ich hungere nach Anbetung – und nach Seelen.«
Otha war inzwischen überzeugt, dass die Stimme die eines anderen Ziegenhirten war, der sich über ihn lustig machen wollte. So beschloss er, den Spieß umzudrehen. »Oh«, sagte er gleichmütig, »ich möchte der König der Welt sein, ewig leben, tausend mannbare junge Mädchen haben, die alles tun, was ich von ihnen verlange, und einen Berg von Gold möchte ich – oh ja, und meine Ziege will ich auch wiederhaben.«
»Und bist du willens, mir für das alles deine Seele zu geben?«
Otha überlegte. Falls dies wirklich kein dummer Streich eines anderen Hirten, sondern ein ernsthaftes Angebot war, folgerte er, würde der Pakt ungültig sein, falls auch nur eine seiner unmöglichen Bedingungen nicht erfüllt würde.
»Na gut«, erklärte er sich mit einem Schulterzucken einverstanden. »Aber zuerst möchte ich, sozusagen als Vertrauensbeweis, meine Ziege sehen.«
»So wende dich denn um, Otha«, wies die Stimme ihn an, »und erschaue, was verloren war.«
Otha drehte sich um, und wahrhaftig, da stand die verirrte Ziege. Sie kaute müßig an den Blättern eines Busches und blickte Otha wie fragend an.
Otha war ein derber, zuweilen recht übler Bursche, der Gefallen daran fand, hilflosen Geschöpfen Schmerzen zuzufügen, boshafte Streiche zu spielen, zu stehlen und sich einsame Hirtenmaiden gefügig zu machen, wann immer sich eine gefahrlose Möglichkeit bot. Er war habgierig und verschlagen und hatte eine allzu hohe Meinung von seiner Klugheit.
Seine Gedanken überschlugen sich, während er die Ziege an den Busch band. Wenn diese geheimnisvolle styrische Gottheit eine verirrte Ziege herbeiwünschen konnte, wozu war sie sonst noch imstande? Dies war eine Gelegenheit, wie er sie nie mehr bekommen würde. »Also gut«, sagte er und täuschte Einfalt vor, »ein Gebet jetzt gleich, weil du die Ziege zurückgebracht hast. Über Seelen und Imperien und Reichtum und Unsterblichkeit und Frauen können wir uns später unterhalten. Aber zeig dich und sag mir deinen Namen!«
»Ich bin Azash, der mächtigste der Älteren Götter. Wenn du bereit bist, mir zu dienen und andere zu meiner Anbetung zu gewinnen, gewähre ich dir viel mehr, als du dir gewünscht hast. Ich werde dich erheben, und unvorstellbarer Reichtum soll dein sein. Du wirst die schönsten aller Maiden bekommen, ewig leben und Macht über die Welt der Geister haben, wie noch kein Mensch vor dir. Als Preis verlange ich deine Seele, Otha, und die Seelen jener anderen, die du mir bringen wirst. Erschaue nun mein Antlitz und erzittere.«
Die Luft um das Idol schimmerte, und Otha sah die wahre Form Azashs. Von Grauen erfüllt wich er vor dieser unerwarteten Erscheinung zurück und warf sich untertänig vor ihr zu Boden, denn im Grunde seines Herzens war Otha ein Feigling.
»Bete, Otha!«, forderte das Idol. »Meine Ohren hungern nach deiner Verehrung!«
»Oh, mächtiger … äh … Azash? Gott der Götter und Herr über die Welt, höre mein Gebet und empfange meine demütige Verehrung. Ich bin nichts als Staub vor deinen Füßen, und du erhebst dich wie ein Berg vor mir. Ich bete dich an, ich lobpreise dich und danke dir aus tiefstem Herzen, dass du mir diese elende Ziege zurückgebracht hast – die ich prügeln werde, bis sie nicht mehr stehen kann, wenn ich erst daheim bin.« Zitternd hoffte Otha, dass dieses Gebet Azash zufriedenstellte – oder ihn zumindest so weit ablenkte, dass er entkommen konnte.
»Ein gutes Gebet, Otha«, sagte das Idol, »für den Anfang. Mit der Zeit wirst du hoffentlich fantasievoller werden. Geh jetzt deines Weges und kehre am morgigen Tage zurück, dann werde ich dir Weiteres offenbaren.«
Als Otha mit seiner Ziege heimwärts zog, schwor er sich, nie mehr hierherzukommen, doch in der Nacht wälzte er sich schlaflos auf dem Strohsack in seiner schmutzigen Hütte herum, und vor seinem inneren Auge leuchteten Bilder von Reichtum und unterwürfigen jungen Frauen, mit denen er sich nach Belieben vergnügen könnte. »Schauen wir doch erst mal, wohin das führt«, murmelte er zu sich, als das Morgengrauen die ruhelose Nacht beendete. »Wenn es sein muss, kann ich immer noch weglaufen.«
Und so wurde ein schlichter zemochischer Ziegenhirt zum Jünger des Älteren Gottes Azash, eines Gottes, dessen Namen Othas styrische Nachbarn nicht einmal auszusprechen wagten, so groß war ihre Angst.
In den folgenden Jahrhunderten erkannte Otha, wie ungeheuerlich seine Versklavung war. Azash formte ihn geduldig vom demütigen Anbeter zum Meister ruchloser Riten und schließlich zum entmenschlichten Werkzeug. Der zuvor muntere, wenngleich häufig unfreundliche Ziegenhirt wurde mürrischer und finsterer, je mehr die gefürchtete Gottheit von seinem Geist und seiner Seele Besitz ergriff. Obwohl ihm ein halbes Dutzend Lebensalter und mehr beschieden waren, wurden seine Glieder dürr, während Wanst und Schädel anschwollen, sein Haar ausfiel und die Haut durch seine Abneigung gegen die Sonne fahlweiß welkte. Sein Reichtum wuchs unermesslich, doch er fand keine Freude daran. Er hatte ungezählte hingebungsvolle Konkubinen, doch ihre Reize ließen ihn kalt. Abertausende von Geistern und Kobolden und Kreaturen der Finsternis harrten seiner Worte, bereit, ihm jeden Wunsch zu erfüllen, aber er brachte nicht einmal genügend Interesse auf, sie zu rufen. Zeuge von Qual und Tod zu sein, wurde sein einziges Vergnügen, und er genoss es, wenn seine Knechte zu seiner Ergötzung Schwachen und Hilflosen auf schreckliche Weise das Leben raubten.
Anfang des dritten Jahrtausends, nach Ablauf seines neunhundertsten freudlosen Lebensjahres, befahl Otha seinen unmenschlichen Knechten, den schlichten Altar Azashs zur Stadt Zemoch im nordöstlichen Hochland zu schaffen. Ein riesiges Abbild des Gottes wurde über diesem Altar errichtet und drum herum ein gewaltiger Tempel erbaut. Neben diesem Tempel – und durch ein labyrinthartiges Netz von Gängen mit ihm verbunden – stand Othas Palast, ganz mit Blattgold überzogen, mit Mosaiken aus Perlen, Onyx und Chalzedon verziert und von Säulen getragen, deren Kapitelle aus kunstvoll geschliffenen Rubinen und Smaragden bestanden. Dort ernannte er sich selbst zum Kaiser von ganz Zemoch. Die donnernde, wenngleich ein wenig spöttische Stimme Azashs schallte bestätigend aus dem Tempel und wurde vom schrillen Jubelgeheul unzähliger Dämonen begrüßt.
Eine grauenvolle Schreckensherrschaft nahm in Zemoch ihren Lauf. Sämtliche anderen Kulte wurden gnadenlos ausgerottet. Tausende von Neugeborenen und von Jungfrauen wurden Azash als Blutopfer dargebracht und Elenier wie Styriker gleichermaßen mit dem Schwert zu seiner Anbetung bekehrt. Otha und seine Schergen benötigten etwa ein Jahrhundert, um in den Untertanen auch den letzten Hauch von Lauterkeit auszulöschen. Blutdurst und ausschweifende Grausamkeit wurden zur Alltäglichkeit, und die Riten, die man in den Tempeln und vor den Altären Azashs ausführte, wurden immer abscheulicher.
Im fünfundzwanzigsten Jahrhundert schien es Otha an der Zeit, sich dem letztendlichen Ziel seines ruchlosen Gottes zu widmen. Er sammelte seine menschlichen Armeen und ihre dämonischen Verbündeten an Zemochs westlicher Grenze und sandte sie schließlich auf die Ebenen von Pelosien, Lamorkand und Cammorien. Es ist unmöglich, die Schrecken dieser Invasion der zemochischen Horden in all ihrer Grausamkeit zu beschreiben. Die ungeheuren Gräueltaten der Dämonen, welche die einfallenden Armeen begleiteten, sind zu grässlich, sie in Worte zu fassen. Menschenschädel wurden zu Bergen gehäuft, Gefangene lebend gebraten und verschlungen, und Kreuze, Galgen und Pfähle säumten Straßen und Wege. Der Himmel war schwarz von Geier- und Rabenschwärmen, und die Luft stank nach verbranntem und verwesendem Fleisch.
Othas Armeen zogen siegessicher in die Schlacht, überzeugt, dass ihre dämonischen Verbündeten mühelos jeglichen Widerstand zerschlagen könnten. Doch sie hatten nicht mit den Kräften der Ordensritter gerechnet. Auf der Ebene von Lamorkand, unmittelbar südlich des Randerasees, kam es zur Entscheidungsschlacht.
Schon der physische Kampf war gewaltig, doch der übernatürliche übertraf ihn bei Weitem. Unvorstellbare geistige Mächte tobten Tag und Nacht. Wogen vollkommener Finsternis und Schichten farbigen Lichts rasten über das Schlachtfeld. Feuerbringende Blitze schossen aus dem Himmel. Ganze Truppenverbände wurden von der Erde verschlungen oder von plötzlich lodernden Flammen zu Asche verbrannt. Unaufhörlich krachte Donner; Erdbeben rissen den Boden auf, und die Lava ausbrechender Vulkane vernichtete Legionen. Tagelang währte die unvorstellbare Schlacht, ehe die Zemocher endlich Schritt um Schritt zurückgedrängt wurden. Die abscheulichen Kreaturen, die Otha gegen den Feind schickte, wurden eine nach der anderen durch die geballten Kräfte der Ordensritter zurückgeschlagen. Der langsame, widerwillige Rückzug der Zemocher wurde schließlich zur Flucht, als die entmutigte Horde auseinanderstob und zur zweifelhaften Sicherheit der Grenze floh.
Es war ein triumphaler Sieg der Elenier, doch er hatte sie viele Opfer gekostet. Gut die Hälfte der Ordensritter blieb auf dem Schlachtfeld zurück, und die Armeen der elenischen Könige waren um Tausende von Kriegern dezimiert worden. Die Sieger waren zu erschöpft und zahlenmäßig zu schwach, die flüchtenden Zemocher über die Grenze hinweg zu verfolgen.
Der aufgedunsene Otha, dessen geschrumpfte Beine nicht mehr imstande waren, sein Gewicht zu tragen, wurde auf einer Trage durch das Labyrinth in Zemoch zum großen Tempel gebracht, wo er den Zorn Azashs über sich ergehen lassen musste. Er warf sich vor dem Idol seines Gottes zu Boden und flehte um Gnade.
Endlich sprach Azash: »Ein letztes Mal, Otha.« Die Stimme des Gottes klang bedrohlich ruhig. »Einmal, ein einziges Mal, lasse ich mich erweichen. Ich will den Bhelliom haben, und du wirst ihn mir beschaffen. Gelingt dir das nicht, ist es aus mit meiner Großmut. Dann werde ich dich durch Qualen meinem Willen beugen! Gehe, Otha! Suche den Bhelliom und bringe ihn hierher, auf dass ich meine Ketten sprengen kann und mein Mannestum zurückgewinne. Solltest du mich enttäuschen, wirst du sterben, und dein Tod wird Millionen Jahre währen.«
Otha floh und plante, noch während seine Armeen ihre Wunden leckten, einen letzten Angriff auf die elenischen Reiche im Westen, einen Angriff, der die Welt an den Rand der Vernichtung bringen sollte.
Erster Teil Die Basilika
1
Endlos toste der Wasserfall in den Abgrund, der Ghwerig verschlungen hatte, und sein donnernder Widerhall füllte die Höhle mit einem tiefen Ton, dem Nachhall einer riesigen Glocke gleich. Sperber kniete gebannt am Rand des Abgrunds, den Bhelliom fest in der Hand. Das Licht der sonnenbeschienenen Wassersäule, die in die schwarze Tiefe stürzte, blendete seine Augen, und ihr Brausen erfüllte seine Ohren.
Die Feuchtigkeit in der Höhle hatte ihren eigenen Geruch. Der Sprühnebel des Wasserfalls benetzte das Gestein wie mit Tautropfen, dass es im verglühenden Licht von Aphraels gleißender Spur schimmerte.
Allmählich senkte Sperber die Augen, um den Stein in seiner Hand zu betrachten. Obwohl er zart, ja zerbrechlich wirkte, spürte er, dass die Saphirrose so gut wie unzerstörbar war. Aus der Tiefe ihres blauen Herzens drang ein pulsierendes Glühen empor. Es war strahlend blau an den Spitzen ihrer Blütenblätter, wurde auf die Mitte zu dunkler und schließlich zu einem funkelnden Mitternachtsblau. Seine Hand begann zu schmerzen, und irgendetwas in seinem Innern warnte ihn schrill, als er in die Tiefe des Juwels blickte. Erschaudernd riss er den Blick von seinem lockenden Feuer los.
Der pandionische Recke blickte sich um und klammerte sich für einen Augenblick wie ein Ertrinkender an den verblassenden Schimmer ringsum an den Steinen der Trollzwergenhöhle, als könne er ihn festhalten, als vermöchte die Kindgöttin Aphrael ihn vor dem Juwel zu beschützen, das er so lange gesucht hatte und vor dem er sich nun fürchtete. Doch es war mehr als das. Unbewusst wollte Sperber dieses schwache Licht für immer festhalten, um das Wesen dieser kleinen, wundersamen Göttin in seinem Herzen zu bewahren.
Sephrenia seufzte und erhob sich langsam. Sie sah müde, aber glücklich aus. So mühevoll es auch gewesen war, diese feuchte Höhle in den Bergen Thalesiens zu erreichen, nun war sie mit diesem wundervollen Augenblick belohnt worden, da sie ins leuchtende Antlitz ihrer Göttin hatte blicken dürfen. »Wir müssen die Höhle sofort verlassen, meine Lieben«, sagte sie betrübt.
»Können wir denn nicht wenigstens noch ein paar Minuten bleiben?«, fragte Kurik, und aus seiner Stimme klang eine für ihn ungewöhnliche Sehnsucht.
»Es ist besser, uns auf den Weg zu machen. Verweilen wir zu lange, kann es geschehen, dass wir einen Vorwand finden, noch länger zu bleiben. Und vielleicht wollen wir dann überhaupt nicht mehr fort.« Die zierliche, weiß gewandete Styrikerin blickte voll Abscheu auf den Bhelliom. »Bitte, Sperber, steckt ihn ein und befehlt ihm zu ruhen. Seine Kraft hat einen schlimmen Einfluss auf uns alle.« Sie nahm das Schwert, das Gareds Geist ihr an Bord von Kapitän Sorgis Schiff überreicht hatte, in die andere Hand, und murmelte einen styrischen Spruch. Der Zauber ließ die Schwertspitze hell erglühen, und das Licht wies ihnen den Weg zurück zur Oberfläche.
Sperber schob die Edelsteinblume in seinen Kittel und bückte sich nach König Aldreas’ Speer. Dabei stieg ihm der Geruch seines Kettenhemds in die Nase, der so widerlich war, dass er sich am liebsten sofort davon befreit hätte.
Kurik hob die eisenbeschlagene Steinkeule auf, mit welcher der grässlich missgestaltete Trollzwerg vor seinem tödlichen Sturz in den Abgrund auf sie eingedroschen hatte. Er schwang die barbarische Waffe ein paarmal; dann warf er sie gleichmütig ihrem Besitzer hinterher in die Tiefe.
Sephrenia hielt das glühende Schwert über den Kopf, und die drei traten über den edelsteinbestreuten Boden von Ghwerigs Schatzhöhle zu dem wendeltreppenähnlichen Gang, der zur Oberfläche führte.
»Glaubt Ihr, dass wir sie je wiedersehen werden?«, fragte Kurik wehmütig.
»Aphrael? Schwer zu sagen. Sie war schon immer unberechenbar«, antwortete Sephrenia.
Schweigend folgten sie eine Zeit lang den Windungen des Gangs. Sperber verspürte eine eigenartige Leere, je höher sie kamen. Als sie hinabstiegen, waren sie zu viert gewesen, jetzt waren sie nur noch drei. Sie hatten die Kindgöttin jedoch nicht zurückgelassen, sie alle trugen sie in ihrem Herzen. Etwas anderes beunruhigte ihn.
»Können wir diese Höhle für immer verschließen, wenn wir draußen sind?«, fragte er seine Lehrerin.
Sephrenia blickte ihn nachdenklich an. »Es ist möglich, wenn Ihr es möchtet, aber warum wollt Ihr es?«
»Ich bin mir nicht sicher, aber …« Er runzelte die Stirn und versuchte, sich selbst darüber klar zu werden. »Wenn irgendein thalesischer Bauer in diese Höhle stolpert, wird er auf Ghwerigs Hort stoßen, nicht wahr?«
»Falls er lange genug herumirrt, ja.«
»Und danach wird es nicht mehr lange dauern, bis die Höhle voll von Thalesiern ist.«
»Warum beunruhigt es Euch so? Was macht es schon aus, wenn Thalesier sich hier umsehen?«
»Es ist ein ganz besonderer Ort, Sephrenia.«
»Auf welche Weise?«
»Er ist heilig«, antwortete Sperber ein wenig gereizt über ihre Hartnäckigkeit. »Eine Göttin hat sich uns hier offenbart! Ich möchte nicht, dass die Höhle durch eine Meute trunkener, habgieriger Schatzsucher entweiht wird. Es wäre für mich nicht anders, als würde eine elenische Kirche entweiht.«
»Lieber Sperber«, rief Sephrenia und umarmte ihn impulsiv. »Ist es Euch so schwergefallen, einzugestehen, dass Aphrael eine Göttin ist?«
»Eure Göttin war sehr überzeugend, Sephrenia«, erwiderte er. »Sie hätte sogar die Überzeugungen der elenischen Hierokratie ins Wanken gebracht. Können wir es tun? Die Höhle unzugänglich machen, meine ich?«
Sie öffnete den Mund, um zu antworten, dann aber hielt sie stirnrunzelnd inne. »Wartet hier«, bat sie. Sie lehnte Ritter Gareds Schwert an die Wand des Wendelgangs und ging ein Stück zurück. Am Rand des Lichtscheins, der von der glühenden Schwertspitze ausging, blieb sie nachdenklich stehen. Nach kurzer Zeit kehrte sie zurück.
»Ich werde Euch ersuchen, etwas Gefährliches zu tun, Sperber«, sagte sie ernst. »Aber ich glaube, dass Euch nichts Schlimmes geschehen kann. Die Erinnerung an Aphrael ist noch stark in Euch, und das müsste Euch schützen.«
»Was soll ich tun?«
»Wir werden den Bhelliom benutzen, um die Höhle zu verschließen. Es gäbe auch andere Möglichkeiten, aber wir müssen uns vergewissern, dass der Stein Eure Autorität anerkennt. Ich glaube, dass es der Fall sein wird, aber wir sollten uns davon überzeugen. Ihr solltet Euch wappnen, Sperber, denn der Bhelliom wird sich zu wehren wissen.«
»Es wäre nicht das erste Mal, dass ich gegen Sturheit anzukämpfen hätte.«
»Nehmt es nicht auf die leichte Schulter, Sperber. Er besitzt eine viel größere Macht als alles, was ich je beherrscht habe. Aber gehen wir weiter.«
Je höher sie kamen, desto schwächer war das Tosen des Wasserfalls aus Ghwerigs Schatzhöhle zu vernehmen. In dem Augenblick, als sie am Rand der Hörweite angelangten, schien der Laut sich zu ändern, schien der eine, endlose Ton zu zersplittern und zu einem komplexen Akkord zu werden – was vielleicht am wechselnden Widerhall in der Höhle lag. Mit der Veränderung dieses Tons änderte sich auch Sperbers Stimmung. Zuvor hatte ihn Befriedigung erfüllt, weil sie ihr lange erstrebtes Ziel erreicht hatten, vermischt mit einer wundersamen Ehrfurcht über die Offenbarung der Kindgöttin. Jetzt aber erschien ihm die dunkle, modrige Höhle unheimlich, bedrohlich. Sperber empfand etwas, das er seit seiner frühen Kindheit nicht mehr verspürt hatte: Angst vor der Dunkelheit. In den Schatten außerhalb des Lichtkreises, den die glühende Schwertspitze warf, schien Furchterregendes zu lauern, gesichtslose Wesen voll grausamer Bösartigkeit. Er blickte gehetzt über die Schulter. Ihm war, als bewege sich etwas weit hinter ihnen, außerhalb des Lichtscheins, eine flüchtige Bewegung nur. Als er versuchte, direkt darauf zu blicken, konnte er dieses Etwas nicht mehr sehen, doch kaum wandte er den Kopf seitwärts, war es da – vage, formlos, unmittelbar am Rand seines Blickfelds. Es erfüllte ihn mit instinktivem Grauen.
Es war bereits Nachmittag, als sie in den Sonnenschein traten, der ihnen nach der Dunkelheit in der Höhle schmerzhaft grell vorkam. Sperber holte tief Atem und griff in seinen Kittel.
»Noch nicht, Sperber«, mahnte Sephrenia. »Wir wollen doch nicht unter herabstürzenden Felsen begraben werden. Steigen wir erst zu unseren Pferden hinunter und lassen den Zauber von dort aus wirken.«
»Ihr müsst mich noch den Spruch lehren«, sagte Sperber, während sie die Mulde mit dem Dorngestrüpp vor dem Höhleneingang durchquerten.
»Es gibt keinen Spruch. Ihr habt den Stein und die Ringe, Ihr braucht lediglich den Befehl zu geben. Wie, zeige ich Euch, sobald wir unten sind.«
Sie kletterten die steinige Klamm hinunter zur grasigen Hochebene, auf der sie die Nacht zuvor gelagert hatten. Gegen Sonnenuntergang erreichten sie die zwei Zelte und die angepflockten Pferde. Faran legte die Ohren zurück und fletschte die Zähne, als Sperber sich ihm näherte.
»Was hast du denn?«, fragte Sperber sein Streitross.
»Er wittert den Bhelliom«, erklärte Sephrenia. »Er mag ihn nicht. Bleibt Faran eine Zeit lang fern.« Sie blickte die Klamm hinauf, aus der sie eben gekommen waren. »Hier ist es sicher genug«, meinte sie. »Holt den Bhelliom hervor, und haltet ihn so in den Händen, dass beide Ringe ihn berühren.«
»Muss ich mit dem Gesicht zur Höhle stehen?«
»Nein. Der Bhelliom wird wissen, was Ihr ihn zu tun heißt. Stellt Euch nur das Innere der Höhle vor – das Aussehen, die Atmosphäre, den Geruch. Stellt Euch vor, wie die Decke herabstürzt. Die Steine werden sich lösen und herabfallen. Das Donnern wird ungeheuerlich sein. Aus dem Höhleneingang wird eine gewaltige Staubwolke quellen. Der Kamm über der Höhle wird einsacken, wenn die Höhlendecke nachgibt, und wahrscheinlich werden Gerölllawinen herabdonnern. Ihr dürft Euch davon nicht ablenken lassen. Behaltet das Bild fest im Kopf.«
»Das ist ein wenig komplizierter als ein üblicher Zauber, nicht wahr?«
»Ja. Aber genau genommen ist es kein Zauber. Ihr werdet elementare Magie entfesseln. Konzentriert Euch, Sperber. Je klarer Eure Vorstellung, desto stärker die Wirkung des Bhelliom. Wenn Ihr alles deutlich vor Euch seht, dann befehlt dem Stein, es geschehen zu lassen.«
»Muss ich mich in Ghwerigs Sprache verständigen?«
»Das weiß ich nicht. Versucht es zunächst mit Elenisch.«
Sperber stellte sich den Höhleneingang vor, die Vorhöhle dahinter und den langen Wendelgang, der zu Ghwerigs Schatzkammer führte. »Soll ich die Decke auch über dem Wasserfall einstürzen lassen?«
»Lieber nicht. Der Fluss kommt möglicherweise irgendwo an seinem Unterlauf an die Oberfläche. Wenn Ihr ihn dämmt, fällt es vielleicht auf, dass er nicht mehr fließt, und dann könnte jemand nach dem Grund dafür suchen. Außerdem ist diese Höhle etwas Besonderes, nicht wahr?«
»Oh ja!«
»Dann wollen wir sie für immer schützen.«
Sperber stellte sich vor, wie die Höhlendecke mit einem gewaltigen, mahlenden Krachen und einer ungeheuren Staubwolke einstürzte. »Was soll ich sagen?«, fragte er.
»Sagt Blaurose. So hat Ghwerig den Stein genannt. Vielleicht erkennt er diesen Namen.«
»Blaurose«, befahl Sperber, »bringe die Höhle zum Einsturz!«
Die Saphirrose färbte sich augenblicklich dunkel, und tief in ihrer Mitte zuckten grellrote Blitze.
»Sie leistet Euch Widerstand«, erklärte Sephrenia. »Sie ist in der Höhle geboren und will sie nicht zerstören. Zwingt sie, Sperber.«
»Gehorche, Blaurose!«, donnerte Sperber und konzentrierte seine ganze Willenskraft auf den Stein in seinen Händen. Plötzlich spürte er ungeheure Macht aufwallen, und der Saphir schien zu pulsieren. Ein leises, dumpfes Grollen erklang unter der Oberfläche, und die Erde erbebte. Das Gestein tief unter ihnen krachte, als das Beben Schicht um Schicht auseinanderriss. Hoch oben in der Klamm begann der Felsvorsprung nachzugeben, der über den Höhleneingang ragte, und in die Dornmulde zu stürzen. Das Krachen des einstürzenden Felsens war selbst aus dieser Entfernung ohrenbetäubend. Eine gigantische Staubwolke wallte von dem Schutt auf, und der Wind trieb sie nordostwärts. Und dann bewegte sich etwas, wie zuvor in der Höhle, am Rand von Sperbers Blickfeld – etwas Finsteres voll boshafter Neugier.
»Wie fühlt Ihr Euch?«, fragte Sephrenia ihn angespannt.
»Ein wenig seltsam«, gestand er. »Und aus irgendeinem Grund sehr stark.«
»Lasst Euch nicht davon beeinflussen! Konzentriert Euch auf Aphrael. Denkt nicht an den Bhelliom, bis sich dieses Gefühl gelegt hat. Steckt ihn wieder ein. Blickt ihn nicht an.«
Sperber schob den Saphir in den Kittel zurück.
Kurik blickte die Klamm hinauf zu dem riesigen Schutthaufen, der die gesamte Mulde vor dem Höhleneingang füllte. »Das sieht alles so endgültig aus«, sagte er bedauernd.
»Das ist es auch«, erwiderte Sephrenia. »Die Höhle ist jetzt sicher.«
Kurik straffte die breiten Schultern und sah sich um. »Ich mache ein Feuer«, sagte er. Er stapfte in Richtung Klamm zurück, um Reisig und anderes Brennmaterial zu sammeln, während Sperber in den Satteltaschen nach dem Kochgeschirr und etwas Geeignetem für das Abendessen kramte.
Nachdem sie gegessen hatten, saßen sie mit verschlossenen Mienen um das Feuer.
»Wie war es, Sperber?«, fragte Kurik schließlich. »Als du den Bhelliom benutzt hast, meine ich.« Er blickte Sephrenia an. »Wir können doch jetzt darüber reden, oder?«
»Das wird sich herausstellen. Erzählt es ihm, Sperber.«
»Ich habe noch nie zuvor dergleichen erlebt«, sagte der Ritter nachdenklich. »Mir war plötzlich, als wäre ich hundert Fuß groß und es gäbe nichts auf der Welt, was ich nicht tun könnte. Ich ertappte mich sogar dabei, dass ich mich umsah, ob ich ihn nicht für irgendetwas anderes benutzen könnte – vielleicht, um einen Berg einzuebnen.«
»Sperber! Hört auf!«, mahnte Sephrenia scharf. »Der Bhelliom versucht Eure Gedanken zu beeinflussen. Er will Euch verführen, ihn einzusetzen, denn mit jedem Mal, da Ihr Euch seiner bedient, wächst seine Macht über Euch. Denkt an etwas anderes.«
»An Aphrael?«, schlug Kurik vor. »Oder ist auch sie gefährlich?«
Sephrenia lächelte. »Oh ja, sehr gefährlich. Sie erobert Eure Seele sogar noch schneller, als es der Bhelliom vermag.«
»Eure Warnung kommt ein wenig zu spät, Sephrenia. Ich fürchte, sie hat sie bereits erobert. Ich vermisse sie, wisst Ihr.«
»Das braucht Ihr nicht. Sie ist immer noch bei uns.«
Er blickte sich um. »Wo?«
»Im Geiste, Kurik.«
»Das ist nicht ganz dasselbe.«
»Wir müssen sofort etwas gegen die Kraft des Bhelliom unternehmen«, sagte sie nachdenklich. »Die Macht über seinen Träger ist größer, als ich befürchtet hatte.« Sie erhob sich und trat zu der Satteltasche mit ihrer persönlichen Habe. Nach kurzer Suche brachte sie einen kleinen Leinenbeutel, eine große Nadel und einen Strang rotes Garn zum Vorschein. Mit dem Garn stickte sie ein merkwürdig unsymmetrisches Muster auf den Beutel. Ihr Gesicht wirkte im roten Feuerschein angespannt, und ihre Lippen bewegten sich während des Stickens unentwegt.
»Es passt nicht zusammen, kleine Mutter«, machte Sperber sie aufmerksam. »Diese Seite ist anders als die andere.«
»So soll es auch sein. Bitte lenkt mich jetzt nicht ab, Sperber. Ich muss mich konzentrieren.« Sie stickte noch eine Zeit lang weiter, dann steckte sie die Nadel in ihren Ärmel, hielt den Beutel über das Feuer und sprach dabei styrische Worte. Die Flammen flackerten und wiegten sich im Rhythmus der Beschwörung. Plötzlich loderte das Feuer auf. Es sah aus, als wolle es den Beutel füllen.
»Jetzt, Sperber!« Sephrenia hielt den Beutel auf. »Gebt den Bhelliom hier hinein. Wappnet Euch! Er wird versuchen, Euch davon abzubringen.«
Verwirrt langte Sperber in seinen Kittel, holte den Stein hervor und wollte ihn in den Beutel fallen lassen. Ein wütender Schrei schrillte in seinen Ohren, und der Stein wurde heiß in seiner Hand. Sperber hatte das Gefühl, den Bhelliom gegen ein unüberwindliches Hindernis zu drücken. Seine Gedanken wirbelten und schrien, dass sein Vorhaben unmöglich sei. Er biss die Zähne zusammen und verstärkte den Druck. Mit fast hörbarem Wimmern glitt die Saphirrose in den Beutel. Sephrenia zog rasch die Beutelschnur zusammen und knüpfte einen komplizierten Knoten; dann griff sie nach der Nadel und flocht rotes Garn durch diesen Knoten. »Da«, sie biss den Faden ab, »das müsste helfen.«
»Was habt Ihr getan?«, wollte Kurik wissen.
»Es ist eine Art Gebet. Aphrael kann zwar die Macht des Bhelliom nicht mindern, wohl aber bannen, sodass der Stein uns nicht beeinflussen oder Gewalt über andere gewinnen kann. Es ist nicht vollkommen sicher, doch wir sind in Eile. Später werden wir uns der Sache gründlicher annehmen. Achtet darauf, dass Euer Kettenhemd sich stets zwischen dem Beutel mit dem Stein und Eurer Haut befindet. Aphrael hat einmal erwähnt, dass der Bhelliom die Berührung von Stahl nicht erträgt.«
»Übertreibt Ihr mit Eurer Vorsicht nicht etwas, Sephrenia?«, fragte Sperber zweifelnd.
»Ich weiß es nicht, Sperber. Ich bin noch nie zuvor einer Macht wie der des Bhelliom begegnet. Ich kann mir das volle Ausmaß seiner Kräfte gar nicht vorstellen. Ich weiß aber, dass er jeden zu beeinflussen vermag – sogar den elenischen Gott und die Jüngeren Götter von Styrikum.«
»Alle, außer Aphrael«, warf Kurik ein.
Sephrenia schüttelte den Kopf. »Selbst Aphrael geriet in Versuchung, als sie den Bhelliom aus dem Abgrund zu uns emportrug.«
»Warum hat sie ihn dann nicht einfach behalten?«
»Aus Liebe. Meine Göttin liebt uns alle, deshalb überließ sie uns den Stein. Der Bhelliom versteht nichts von Liebe. Vielleicht wird die Liebe sich als unser einziger Schutz vor ihm erweisen.«
Sperber schlief in dieser Nacht sehr unruhig. Immer wieder wälzte er sich in seinen Decken herum. Kurik hatte seinen Posten nahe dem Rand des Feuerscheins bezogen, so blieb Sperber allein mit seinen Albträumen. Er vermeinte, den Saphir vor seinen Augen in der Luft hängen zu sehen, und sein tiefblaues Glühen leuchtete lockend. Aus der Tiefe dieses Glühens drang Musik – ein Lied, das sein Innerstes aufwühlte. Und um ihn herum, so dicht, dass sie beinahe seine Schultern berührten, schwebten mehrere Schatten. Sie schienen von einem Hass erfüllt, der Wut und Hilflosigkeit entsprang. Hinter dem glühenden Bhelliom stand das abscheulich groteske Lehmabbild Azashs, das er auf Burg Ghasek zerschmettert hatte, jenes Abbild, dem Bellina ihre Seele verschrieben hatte. Das Gesicht des Idols bewegte sich, verzog sich zu abstoßenden Fratzen der niedersten Gefühlsregungen – Lust und Gier und Hass und einer alles beherrschenden Verachtung, die dem Bewusstsein entsprang, absolute Macht zu besitzen.
Sperber wehrte sich in seinem Traum. Der Bhelliom, Azash und die grauenvollen Schatten versuchten, sich seiner zu bemächtigen.
Als er zu schreien versuchte, erwachte er. Er setzte sich auf. Er war schweißüberströmt und fluchte grimmig. Ein Schlaf, der nur Albträume brachte, konnte die Erschöpfung nicht lindern, die ihm in allen Knochen steckte. Doch er brauchte Schlaf!
Aber es begann von Neuem. Wieder kämpfte er im Traum gegen den Bhelliom, gegen Azash, gegen die grauenvollen Schatten, die hinter ihm lauerten.
»Sperber«, sagte da eine helle, vertraute Stimme in seinem Ohr. »Lass dich nicht von den Schatten erschrecken. Sie können dir nichts anhaben. Sie versuchen nur, dir Angst einzujagen.«
»Warum tun sie das?«
»Weil sie Angst vor dir haben.«
»Das ist Unsinn, Aphrael. Ich bin nur ein Sterblicher.«
Ihr Lachen klingelte wie Silberglöckchen. »Du bist manchmal so naiv, Vater. Du bist anders als alle Menschen, die ich kenne. In gewisser Weise bist du mächtiger als die Götter. Aber schlaf jetzt. Ich werde dafür sorgen, dass sie dir nichts anhaben können.«
Sperber spürte einen sanften Kuss auf der Wange, und zierliche Arme schlangen sich auf eigentümlich mütterliche Weise um seinen Kopf. Die grässlichen Albtraumbilder verloren ihre Kraft und verblassten.
Stunden schienen vergangen zu sein, als Kurik ins Zelt kam und ihn wachrüttelte.
»Wie spät ist es?«, fragte Sperber seinen Knappen.
»Um Mitternacht«, antwortete Kurik. »Wirf dir den Umhang über, es ist ziemlich kalt.«
Sperber stand auf, zog Kettenhemd und Kittel an und schnallte sich den Schwertgurt um. Dann schob er den Leinenbeutel unter den Kittel und griff nach seinem dicken Reiseumhang. »Schlaf gut«, wünschte er seinem Freund, ehe er das Zelt verließ.
Die Sterne glitzerten am Himmel, und die Mondsichel ging über der gezackten Bergkette im Osten auf. Sperber wandte der erlöschenden Glut des Lagerfeuers den Rücken zu, sodass seine Augen sich an die Dunkelheit gewöhnen konnten. Sein Atem dampfte in der frischen Gebirgsluft.
Sein Traum beunruhigte ihn immer noch, doch die Erinnerung schien allmählich zu schwinden. Eingeprägt hatte sich ihm nur die Berührung von Aphraels Lippen auf seiner Wange. Entschlossen schlug er die Tür der Kammer zu, in die er seine Albträume verbannte, und beschäftigte sich mit anderen Gedanken.
Ohne die kleine Göttin und ihre Fähigkeit, sich die Zeit untertan zu machen, würden sie wahrscheinlich eine Woche bis zur Küste brauchen. Und dort mussten sie erst ein Schiff finden, das sie zur deiranischen Seite der Straße von Thalesien brachte. Inzwischen hatte König Wargun zweifellos alle elenischen Reiche von ihrer Flucht unterrichtet. Sie würden auf der Hut sein müssen, um eine Festnahme zu vermeiden, doch sie mussten nach Emsat, um Talen zu holen.
Die Nachtluft in diesen Bergen war sogar im Sommer empfindlich kalt, und Sperber zog fröstelnd seinen Umhang enger. Die Ereignisse des vergangenen Tages prägten noch immer seine Stimmung. Er war kein wirklich religiöser Mensch. Er war von Anfang an dem Pandionischen Orden verbunden, was für ihn jedoch nicht gleichbedeutend mit dem elenischen Glauben war. Die wichtigste Aufgabe der Kirchenritter bestand darin, die Welt sicher für andere, nichtkriegerische Elenier zu machen, damit diese jenen religiösen Zeremonien nachgehen konnten, welche die Geistlichkeit für gottgefällig erachtete. Sperbers Gedanken befassten sich selten mit Gott. Gestern jedoch hatte er einige zutiefst religiöse Erlebnisse gehabt. Er gestand sich zerknirscht ein, dass ein zum vernunftbestimmten Handeln neigender Mensch wie er nie wirklich auf dergleichen vorbereitet war. Plötzlich tasteten seine Finger nach dem Ausschnitt seines Kittels, als handelten sie ohne sein Zutun. Entschlossen zog Sperber sein Schwert, stieß die Spitze in den Grasboden und legte beide Hände fest um den Griff. Genug der Gedanken an Religion und Übernatürliches.
Jetzt würde es nicht mehr lange dauern. Die Zeit, die seine Königin noch im lebenserhaltenden Kristall verweilen musste, konnte nun in Tagen gezählt werden. Sperber und seine Freunde waren durch den ganzen eosischen Kontinent gezogen, um diesen Stein zu finden – das einzige Mittel, das sie zu heilen vermochte. Und nun trug er den Bhelliom in einem Leinenbeutel unter seinem Kittel. Mit diesem Stein in seiner Hand konnte ihn nichts mehr aufhalten. Er könnte mit der Saphirrose ganze Armeen vernichten, wenn es sein müsste. Entschlossen schob er diese Gedanken von sich.
Er verzog das narbige Gesicht. Sobald seine Königin in Sicherheit war, würde er sich Martel, den Primas Annias und jeden einzelnen ihrer Helfer bei diesem Hochverrat vorknöpfen. In Gedanken stellte er die Liste jener zusammen, die sich schuldig gemacht hatten. Das war eine angenehme Beschäftigung, die nächtlichen Stunden zu verbringen. Diese Gedanken hielten seinen Verstand wach und bewahrten ihn vor gefährlichen Einflüsterungen.
In der Abenddämmerung, sechs Tage später, blickten sie von einer Hügelkuppe hinunter auf die rauchigen Fackeln und kerzenhellen Fenster der thalesischen Hauptstadt. »Bleibt Ihr lieber hier«, wandte Kurik sich an Sperber und Sephrenia. »Wargun hat inzwischen zweifellos Beschreibungen von Euch beiden in jeder eosischen Stadt verbreiten lassen. Ich reite hinunter und hole Talen. Dann werde ich mich nach einem Schiff umsehen.«
»Wird Euch das nicht in Gefahr bringen?«, fragte Sephrenia besorgt. »Wargun könnte auch Eure Beschreibung verbreitet haben.«
»König Wargun ist von hoher Geburt. Edelleute achten nicht auf Diener.«
»Du bist kein Diener«, sagte Sperber sanft.
»So stuft man mich aber ein, Sperber, und so hat wohl auch Wargun mich gesehen – wenn er nüchtern genug war, überhaupt etwas zu sehen. Ich werde irgendeinem Reisenden auflauern und mir seine Kleidung ausleihen. Das dürfte mir helfen, in Emsat nicht aufzufallen. Gib mir etwas Geld mit, falls ich jemanden bestechen muss.«
»Elenier!«, seufzte Sephrenia, als Sperber sich mit ihr ein Stück von der Straße entfernte und Kurik zur Stadt hinunterritt. »Wie bin ich nur unter so bedenkenlose Menschen geraten?«
Die Nacht setzte ein, und die harzigen Nadelbäume verschwammen zu hohen Schatten. Sperber band Faran, das Packpferd und Ch’iel, Sephrenias weißen Zelter, an. Dann breitete er seinen dicken Umhang über einen moosigen Buckel für sie.
»Was quält Euch, Sperber?«, fragte Sephrenia.
»Vielleicht nur die Müdigkeit.« Er zuckte mit den Schultern. »Und dieses Gefühl der Leere – wie immer, wenn man etwas beendet hat.«
»Aber es ist noch ein bisschen mehr, nicht wahr?«
Er nickte. »Ich war nicht wirklich vorbereitet auf das, was in der Höhle geschehen ist. Es kam mir irgendwie so … direkt, so persönlich vor.«
Sie nickte. »Es soll keine Beleidigung sein, Sperber, aber die elenische Religion ist zur Institution geworden, und es fällt schwer, eine Institution zu lieben. Die Götter von Styrikum haben eine viel persönlichere Beziehung zu ihren Gläubigen.«
»Ich bin froh, dass ich Elenier bin. Es ist einfacher. Persönliche Beziehungen zu Göttern sind ziemlich aufwühlend.«
»Aber liebt Ihr Aphrael denn nicht – wenigstens ein bisschen?«
»Natürlich liebe ich sie. Doch als sie noch Flöte war, habe ich mich in ihrer Gesellschaft viel wohler gefühlt. Dennoch liebe ich sie.« Er verzog das Gesicht. »Ihr bringt mich an den Rand der Häresie, kleine Mutter.«
»Aber nein. Vorerst will Aphrael nur Eure Liebe. Sie hat keine Verehrung von Euch verlangt – noch nicht.«
»Dieses ›noch nicht‹ beunruhigt mich. Aber meint Ihr nicht auch, dass dies weder der geeignete Ort noch die richtige Zeit für einen theologischen Diskurs ist?«
In diesem Moment erklang Hufklappern auf der Straße, und die Reiter, die sie nicht sehen konnten, hielten ihre Pferde unweit von Sperbers und Sephrenias Versteck an. Sperber sprang lautlos auf und legte die Hand um den Schwertgriff.
»Sie müssen irgendwo in der Nähe sein«, ertönte eine raue Stimme. »Das war ihr Mann, der eben in die Stadt ritt!«
»Ich weiß nicht, was ihr zwei davon haltet«, erklang eine andere Stimme, »aber ich bin gar nicht so versessen darauf, ihn zu finden.«
»Wir sind immerhin zu dritt!«, erklärte die erste Stimme kampfesdurstig.
»Glaubst du, das macht ihm was aus? Er ist Ordensritter! Er wird mit uns dreien fertig, ohne dass er auch nur ins Schwitzen kommt. Und wenn wir tot sind, haben wir nichts von der Belohnung.«
»Das stimmt«, fiel eine dritte Stimme ein. »Am besten, wir spüren ihn erst einmal auf, ohne dass wir selbst gesehen werden. Wenn wir wissen, wo er ist und wohin er will, können wir ihm eine Falle stellen. Mit einem Pfeil im Rücken sind auch Ordensritter nicht mehr gefährlich. Suchen wir weiter. Die Frau reitet einen Schimmel. Der ist auch aus größerer Entfernung zu erkennen.«
Die Pferde trabten wieder an, und Sperber schob sein halb gezogenes Schwert zurück in die Scheide.
»Sind das Warguns Männer?«, flüsterte Sephrenia.
»Unwahrscheinlich«, murmelte Sperber. »Wargun ist zwar unberechenbar, aber er würde gewiss keine bezahlten Meuchler ausschicken. Er würde mir höchstens die Meinung sagen und mich vielleicht ein paar Tage in ein Verlies werfen. Dass er so wütend wäre, mich ermorden zu lassen, kann ich mir nicht vorstellen.«
»Also jemand anderes?«
»Das ist anzunehmen.« Sperber runzelte die Stirn. »Ich kann mich allerdings nicht erinnern, in letzter Zeit jemanden in Thalesien beleidigt zu haben.«
»Annias hat einen langen Arm, Lieber«, erinnerte sie ihn.
»Das könnte es sein, kleine Mutter. Bleiben wir in unserem Versteck und halten die Ohren offen, bis Kurik zurückkehrt.«
Nach etwa einer Stunde hörten sie schwerfälligen Hufschlag die Straße von Emsat näher kommen. Auf der Hügelkuppe hielt der Reiter an. »Sperber?« Die gedämpfte Stimme klang vage vertraut.
Sperbers Hand legte sich um den Schwertgriff. Er wechselte einen raschen Blick mit Sephrenia.
»Ich weiß, dass Ihr hier irgendwo seid, Sperber. Ich bin es, Tel! Kurik hat gesagt, dass Ihr nach Emsat wollt, und Stragen hat mich gesandt, Euch zu holen.«
»Wir sind hier drüben«, rief Sperber. »Wartet, wir kommen gleich.« Er und Sephrenia führten ihre Pferde auf die Straße zu dem flachsblonden Räuber, der sie auf ihrem Weg zu Ghwerigs Höhle bis zur Stadt Heid geleitet hatte. »Könnt Ihr uns in die Stadt bringen?«, fragte Sperber.
»Nichts leichter als das.« Tel zuckte mit den Schultern.
»Wie kommen wir an den Torposten vorbei?«
»Wir reiten einfach durch. Die Torwächter arbeiten für Stragen. Das macht es uns einfacher. Reiten wir los.«
Emsat war eine Stadt des Nordens. Die Bauweise der Häuser mit ihren steilen Satteldächern deutete auf strenge Winter mit starken Schneefällen hin. Die Straßen waren eng und gewunden und fast menschenleer. Dennoch schaute Sperber sich wachsam um. Er hatte die drei gedungenen Meuchler auf der Straße am Hügel nicht vergessen.
»Behandelt Stragen wie ein rohes Ei, Sperber«, riet Tel, als sie in die heruntergekommene Hafengegend ritten. »Er ist der außereheliche Sohn eines Grafen und ziemlich empfindlich, was seine Herkunft angeht. Er hört es gern, mit ›Durchlaucht‹ angeredet zu werden. Es ist lachhaft, aber er ist ein guter Führer, deshalb tun wir ihm den Gefallen.« Tel deutete auf eine schmutzige Nebenstraße. »Hier müssen wir abbiegen.«
»Wie kommt Talen zurecht?«
»Er hat sich beruhigt, aber er war sehr wütend auf Euch, als wir ihn hierherbrachten. Er hat Euch mit Schimpfnamen bedacht, die selbst mir zuvor fremd gewesen waren.«
»Ich kann es mir vorstellen.« Sperber beschloss, den Räuber einzuweihen. Er kannte Tel und war ziemlich sicher, ihm zumindest in dieser Hinsicht trauen zu können. »Ein paar Männer ritten an unserem Versteck vorbei, kurz bevor Ihr gekommen seid«, sagte er. »Sie suchten uns. Waren das Leute von Euch?«
»Nein«, versicherte ihm Tel. »Ich kam allein.«
»Diese Kerle redeten davon, mich mit Pfeilen zu spicken. Könnte Stragen etwas damit zu tun haben?«
»Ganz bestimmt nicht, Sperber!«, entgegnete Tel überzeugt. »Ihr und Eure Freunde habt bei uns das Diebesasylrecht, und Stragen hält sich daran. Ich werde mit ihm darüber reden. Er wird dafür sorgen, dass diese umherstreifenden Bogenschützen Euch kein Haar krümmen. In Emsat schneidet niemand jemandem die Gurgel durch oder stiehlt auch nur ein Kupferstück ohne Stragens Genehmigung. Er nimmt es da sehr genau.« Der blonde Räuber führte sie zur Rückseite eines mit Brettern vernagelten Lagerhauses am Ende der Straße. Sie saßen ab und wurden von zwei stämmigen Räubern eingelassen, die vor der Tür Wache hielten.
Das Innere des Lagerhauses strafte die schäbige Fassade Lügen. Es war hier kaum weniger prunkvoll als in einem Palast. Rote Vorhänge verdeckten die Fenster, dicke blaue Teppiche die knarrenden Dielen und kostbare Gobelins die groben Bretterwände. Eine Wendeltreppe aus poliertem Holz führte in den ersten Stock, und ein kristallener Lüster warf weiches Licht über den Eingang.
»Entschuldigt mich einen Moment«, bat Tel. Er betrat eine Kammer, aus der er alsbald in cremefarbenem Wams und engem blauen Beinkleid zurückkehrte. An seiner Hüfte hing ein kostbarer Degen.
»Elegant«, bemerkte Sperber.
»Noch eine von Stragens seltsamen Ideen«, schnaubte Tel. »Ich bin Arbeiter, keine Kleiderstange. Aber gehen wir hinauf, dann stelle ich Euch Durchlaucht vor.«
Das obere Geschoss war noch prunkvoller ausgestattet als das untere. Der Parkettboden war ein Meisterwerk, und die Wände waren mit makellos poliertem Holz getäfelt. Breite Korridore führten zur Rückseite; Lüster und Armleuchter tauchten den riesigen Saal in goldenes Licht. Offenbar fand ein Ball statt. Ein Quartett mittelmäßiger Musiker malträtierte in einer Ecke Instrumente, und vornehm gewandete Diebe und Freudenmädchen wiegten sich im gezierten Schritt des neuesten Modetanzes im Kreis. Obgleich ihre Kleidung elegant war, waren die Bartstoppeln der Männer ebenso unverkennbar wie das ungepflegte Haar und die schmutzigen Gesichter der Frauen – ein befremdlicher Gegensatz, der durch die schrillen, gewöhnlichen Stimmen und das raue Gelächter noch verstärkt wurde.
Der Mittelpunkt des Trubels war ein dünner Mann mit kunstvollen Ringellocken, die über seine Halskrause wogten. Er trug weißen Satin, und sein hoher Sessel ähnelte einem Thron. Die Miene des Mannes war spöttisch, und aus seinen tief liegenden Augen sprach eigenartiger Schmerz.
Tel blieb am Kopfende der Treppe stehen und sprach flüchtig zu einem greisen Taschendieb in eleganter scharlachroter Livree, der einen langen Stab in der Hand hielt. Der Weißhaarige drehte sich um, klopfte mit dem Stab auf den Boden und meldete mit donnernder Stimme: »Durchlaucht, Marquis Tel ersucht, Euch Ritter Sperber vom Orden der Pandioner und Streiter der Königin von Elenien vorstellen zu dürfen.«
Der dünne Mann erhob sich und klatschte scharf in die Hände. Die Musiker unterbrachen ihre Darbietung. »Wir haben hohe Gäste, liebe Freunde«, wandte er sich an die Tanzenden. Seine Stimme war sehr tief und gekonnt moduliert. »Erweisen wir dem unerschrockenen Ritter Sperber, der unsere Heilige Mutter Kirche beschützt, die ihm gebührende Ehre. Ich bitte Euch, Ritter Sperber, tretet herbei, auf dass wir Euch begrüßen und willkommen heißen dürfen.«
»Eine hübsche Rede«, wisperte Sephrenia.
»Kein Wunder«, murmelte Tel säuerlich. »Wahrscheinlich hat er die letzte Stunde damit zugebracht, sie zu formulieren.« Der flachshaarige Räuber führte sie durch die Reihen der Männer und Frauen, die ihren Tanz unterbrochen hatten und sich ein wenig unbeholfen verbeugten oder knicksten, sobald Sephrenia und Sperber an ihnen vorbeikamen.
Als sie den Mann in Weiß erreichten, verbeugte sich Tel. »Durchlaucht«, sagte er. »Ich habe die Ehre, Euch Ritter Sperber, den Pandioner, vorstellen zu dürfen. Ritter Sperber, Durchlaucht Stragen.«
Stragen verneigte sich. »Ihr ehrt mein bescheidenes Haus, Herr Ritter.«
Auch Sperber verbeugte sich. »Es ist mir eine Ehre, Durchlaucht.« Er nahm sich eisern zusammen, nicht über das Gebaren dieses eingebildeten Gecken zu lächeln.
»So lernen wir uns denn endlich kennen, Herr Ritter«, sagte Stragen. »Euer junger Freund Talen hat uns mit aufregenden Berichten Eurer heldenhaften Abenteuer unterhalten.«
»Talen neigt manchmal zur Übertreibung, Durchlaucht.«
»Und die Dame ist …?«
»Sephrenia, meine Lehrerin in den Geheimnissen.«
»Liebe Schwester«, bat Stragen in tadellosem Styrisch, »erlaubt Ihr mir, Euch zu begrüßen?«
Falls Sephrenia staunte, dass dieser Fremde ihre Sprache beherrschte, ließ sie es sich nicht anmerken. Sie streckte die Hände aus, und Stragen küsste ihre Handteller. »Es ist eine Überraschung, Durchlaucht, einen kultivierten Herrn inmitten einer Welt voller elenischer Wilder kennenzulernen«, sagte sie.
Er lachte. »Ist es nicht amüsant, festzustellen, Sperber, dass selbst unsere makellosen Styriker ihre kleinen Vorurteile haben?« Der blonde Pseudoaristokrat blickte sich im Saal um. »Aber meine Mitarbeiter lieben diese Frivolitäten. Ziehen wir uns zurück, damit sie sich wieder ungestört ihrem Vergnügen hingeben können.« Er hob die klangvolle Stimme ein wenig und wandte sich an die eleganten Gauner. »Liebe Freunde, bitte entschuldigt uns. Wir werden unsere Besprechung woanders führen, denn wir möchten euch auf keinen Fall länger um eure Unterhaltung bringen.« Er machte eine Pause, dann blickte er scharf auf ein hinreißendes dunkelhaariges Mädchen. »Ich darf annehmen, dass Ihr Euch an unser Gespräch nach dem letzten Ball erinnert, Gräfin«, sagte er nachdrücklich. »Obgleich ich Eure Geschäftsinstinkte zu würdigen weiß, sollte doch die Ausführung der Abmachungen privat stattfinden, nicht mitten auf der Tanzfläche. Es war sehr unterhaltend – ja sogar lehrreich –, aber es behinderte doch den Tanz.«
»’s ist bloß eine andere Weise zu tanzen, Stragen«, entgegnete sie mit ordinärer, nasaler Stimme.
»Ah, ja, Gräfin, aber vertikal zu tanzen, ist zurzeit en vogue. Die horizontale Form ist noch nicht bis in die modebewussten besseren Kreise vorgedrungen, und wir wollen doch mit der Mode gehen, nicht wahr?« Er wandte sich Tel zu. »Eure Dienste heute Abend, mein teurer Marquis, waren vortrefflich. Ich weiß nicht, ob ich je imstande sein werde, sie angemessen zu belohnen.« Lässig hob er ein parfümiertes Spitzentuch zur Nase.
»Dass ich Euch von Diensten sein konnte, Durchlaucht, ist mir Lohn genug«, entgegnete Tel mit einer tiefen Verbeugung.
»Sehr gut, Tel«, lobte Stragen. »Vielleicht erhebe ich Euch noch in den Grafenstand.« Er drehte sich um und führte Sperber und Sephrenia aus dem Ballsaal. Kaum befanden sie sich auf dem Korridor, veränderte sein Gehaben sich abrupt. Die Tünche gelangweilter Vornehmheit fiel ab, und seine Augen wurden wachsam und hart. Es waren die Augen eines außerordentlich gefährlichen Mannes. »Verwundert Euch unsere kleine Farce, Sperber?«, fragte er. »Vielleicht seid Ihr der Ansicht, dass Leute unseres Gewerbes in Domizile wie Platimes Keller in Cimmura oder auf Melands Dachboden in Azie gehören?«
»Das ist zumindest üblicher, Durchlaucht«, erwiderte Sperber vorsichtig.
»Wir können das ›Durchlaucht‹ weglassen, Sperber. Es ist eine Affektiertheit – jedenfalls zum Teil. Das Ganze hat jedoch einen ernsteren Grund, als nur eine persönliche Marotte zu befriedigen. Edelleute verfügen über weit größere Reichtümer als einfache Bürger, deshalb bilde ich meine Mitarbeiter aus, sich bei den Reichen und Müßiggängern zu bedienen, statt bei den Armen und Fleißigen. Es ist auf die Dauer lohnender. Meine gegenwärtige Gruppe, fürchte ich, hat noch viel zu lernen. Tel macht sich bereits recht gut, aber ich bezweifle, dass ich aus der Gräfin je eine Dame machen kann. Sie hat die Seele einer Hure und diese Stimme …« Er schauderte. »Jedenfalls ermutige ich meine Leute, sich falscher Titel zu bedienen, und bilde sie aus, sich entsprechend zu benehmen, als Vorbereitung für ernsthaftere Geschäfte. Wir sind selbstverständlich nach wie vor Diebe, Huren und Mörder, aber wir befassen uns mit einem besseren Kundenkreis.«
Sie betraten ein großes, gut beleuchtetes Gemach, in dem Kurik und Talen nebeneinander auf einem Diwan saßen.
»Hattet Ihr eine angenehme Reise, Herr Ritter?« Eine Spur Groll schwang noch in der Stimme des Jungen mit. Er trug Wams und enges Beinkleid, und zum ersten Mal, solange Sperber ihn kannte, war er ordentlich gekämmt. Er erhob sich und verbeugte sich weltmännisch vor Sephrenia. »Kleine Mutter«, grüßte er sie.
»Ich sehe, Ihr habt Euch unseres ungeratenen Jungen angenommen, Stragen«, bemerkte sie.
»Seine Hoheit war noch etwas ungeschliffen, liebe Lady«, erklärte ihr der elegante Gauner. »Ich nahm mir die Freiheit, ihm etwas Schliff zu geben.«
»Seine Hoheit?«, fragte Sperber neugierig.
»Ich habe gewisse Vorteile, Sperber.« Stragen lachte. »Wenn die Natur – oder Lady Zufall – jemanden mit einem Titel ausstattet, hat sie keine Möglichkeit, den Charakter des Empfängers zu beurteilen und die Würde entsprechend zu verleihen. Ich andererseits kann das wahre Wesen des Betreffenden erkennen und den angemessenen Rang auswählen. Ich erkannte sogleich, dass der junge Talen ein außergewöhnlicher Jüngling ist, so verlieh ich ihm die Herzogswürde. Hätte ich die Gelegenheit, noch drei Monate mit ihm zu arbeiten, könnte ich ihn ohne Weiteres am Hof vorstellen.« Er ließ sich in einem bequemen Sessel nieder. »Bitte, meine Freunde, nehmt doch Platz und lasst mich wissen, wie ich Euch noch behilflich sein kann.«
Sperber rückte einen Sessel für Sephrenia zurecht, dann setzte auch er sich. »Was wir dringend benötigen, Nachbar, ist ein Schiff, das uns zur Nordküste von Deira bringt.«
»Genau das ist es, worüber ich mit Euch sprechen wollte, Sperber. Von unserem großartigen jungen Dieb hier erfuhr ich, dass Euer endgültiges Ziel Cimmura ist. Er erwähnte auch, dass Euch in den nördlichen Königreichen möglicherweise einige Unannehmlichkeiten erwarten. Unser dem Wein sehr zugetaner Monarch hat einen dringenden Bedarf an Freunden und hegt bitteren Groll gegen jene, die sich ihm entziehen. So, wie ich es sehe, zürnt er Euch momentan. Alle möglichen, wenig schmeichelhaften Beschreibungen werden gegenwärtig im westlichen Eosien verbreitet. Wäre es nicht schneller – und sicherer –, direkt nach Cardos zu segeln und Euch von dort aus nach Cimmura zu begeben?«
Sperber überlegte. »Ich hatte vor, an einem abgelegenen Küstenstreifen in Deira an Land zu gehen und durch die Berge südwärts zu reiten.«
»Das dürfte sich als ziemlich anstrengend erweisen – und als sehr gefährlich für jemanden auf der Flucht. Einsame Strände gibt es an jeder Küste. Ich bin sicher, dass wir in der Nähe von Cardos einen passenden für Euch finden können.«
»Wir?«
»Ich glaube, ich werde Euch begleiten, Sperber, obwohl wir uns eben erst kennengelernt haben. Ich möchte ohnehin etwas Geschäftliches mit Platime besprechen.« Er erhob sich. »Ich werde im Morgengrauen ein Schiff im Hafen bereitstehen haben. Jetzt lasse ich Euch allein. Ihr seid gewiss müde und hungrig nach Eurem Ritt, und ich kehre besser in den Ballsaal zurück, bevor unsere allzu eifrige Gräfin ihr Gewerbe wieder mitten auf der Tanzfläche betreibt.« Er verbeugte sich vor Sephrenia. »Ich wünsche Euch eine angenehme Nachtruhe, liebe Schwester«, sagte er auf Styrisch. Er nickte Sperber zu und verließ das Gemach.
Kurik stand auf, ging zur Tür und lauschte. »Ich fürchte, der Mann ist nicht ganz bei Verstand, Sperber«, sagte er leise.
»Oh, an seinem Verstand ist nichts auszusetzen«, widersprach Talen. »Er hat einige seltsame Ideen, aber manche sind vielleicht sogar durchführbar.« Er trat vor Sperber. »Also gut. Lasst ihn mich sehen.«
»Was sehen?«
»Den Bhelliom. Ich habe mehr als einmal mein Leben aufs Spiel gesetzt, um mitzuhelfen, ihn zu stehlen. Und dann hat man mich im letzten Augenblick abgeschoben! Ich finde, es steht mir wenigstens zu, einen Blick auf den Stein zu werfen.«
»Ist es ungefährlich?«, wandte Sperber sich an Sephrenia.
»Ich weiß es nicht, Sperber. Die Ringe werden ihn in Schach halten – teilweise jedenfalls. Also gut, lasst Talen einen kurzen Blick darauf werfen.«
Sperber zog den Leinenbeutel aus dem Kittel, öffnete den Knoten und schüttelte die leuchtende blaue Rose auf seine rechte Handfläche. Wieder sah er aus den Augenwinkeln etwas Dunkles zucken, und es lief ihm eiskalt über den Rücken. Aus irgendeinem Grund machte der zuckende Schatten den Albtraum wieder lebendig, und er konnte die Anwesenheit der drei bedrohlichen verschwommenen Gestalten beinahe spüren, die ihn vor einer Woche im Schlaf gequält hatten.
»Oh Gott!«, entfuhr es Talen. »Das ist unglaublich!« Er starrte das Juwel für einen Moment an, dann schüttelte er sich. »Steckt ihn wieder ein, Sperber. Ich will ihn nicht mehr ansehen.«
Sperber schob den Bhelliom zurück in den Leinenbeutel.
»Eigentlich müsste der Stein blutrot sein«, sagte Talen düster. »Denkt nur an all jene, die seinetwegen sterben mussten!« Er blickte Sephrenia an. »War Flöte wirklich eine Göttin?«
»Kurik hat es dir also erzählt. Ja, sie war – und ist – eine der Jüngeren Götter von Styrikum.«
»Ich habe sie gemocht«, gestand der Junge. »Wenn sie eine Göttin ist, könnte sie sich für jedes Alter entscheiden, und für jede Gestalt, oder nicht?«
»Natürlich.«
»Warum hat sie dann ausgerechnet Alter und Gestalt eines Kindes gewählt?«
»Die Menschen sind zu Kindern ehrlicher.«
»Das ist mir eigentlich nie aufgefallen.«
»Aphrael ist liebenswerter als du, Talen.« Sephrenia lächelte. »Das ist vielleicht der wahre Grund für ihre Wahl. Sie braucht Liebe – alle Götter brauchen Liebe, sogar Azash. Und Menschen heben niedliche kleine Mädchen gern auf den Arm und küssen sie. Aphrael genießt es, wenn sie geküsst wird.«
»Mich hat niemand viel geküsst.«
»Das kommt vielleicht noch, Talen – wenn du dich benimmst.«
2
Das Wetter war auf der thalesischen Halbinsel ebenso unbeständig wie in allen anderen nördlichen Ländern. Am nächsten Morgen nieselte es, und dicke graue Wolken trieben vom Deirameer her über die Straße von Thalesien.
»Ein prächtiger Tag für eine Seereise«, bemerkte Stragen trocken, während er und Sperber durch ein lückenhaft mit Brettern vernageltes Fenster auf die regennasse Straße hinunterblickten. »Ich verabscheue Regen. Ob ich es wohl in Rendor zu etwas bringen könnte?«
»Ich würde Euch Rendor nicht empfehlen«, entgegnete Sperber und erinnerte sich an eine von der Sonne versengte Straße in Jiroch.
»Unsere Pferde sind bereits an Bord«, sagte Stragen. »Wir können aufbrechen, sobald Sephrenia und die anderen bereit sind.« Nach kurzer Pause fragte er: »Ist Euer Fuchs am Morgen immer so störrisch? Meine Männer haben mir gemeldet, dass er auf dem Weg zum Schiff drei von ihnen gebissen hat.«
»Ich hätte sie warnen müssen. Faran ist nicht gerade das gutmütigste Pferd.«
»Warum behaltet Ihr ihn dann?«
»Weil er das verlässlichste Streitross ist, das ich je hatte. Außerdem mag ich ihn.«
Stragen beäugte Sperbers Kettenhemd. »Das braucht Ihr jetzt wirklich nicht zu tragen.«
»Reine Gewohnheit.« Sperber zuckte die Achseln. »Es gibt momentan zu viele übel gesinnte Leute, die es auf mich abgesehen haben.«
»Es stinkt grauenvoll, wisst Ihr.«
»Ihr werdet Euch daran gewöhnen.«
»Eure Laune scheint mir heute Morgen nicht die beste zu sein. Stimmt etwas nicht?«
»Ich bin sehr lange unterwegs, habe so manches erlebt, worauf ich nicht vorbereitet war, und muss das alles erst noch verarbeiten.«
»Vielleicht erzählt Ihr mir einmal davon, wenn wir einander besser kennen.« Stragen fiel offenbar etwas ein. »Ach, übrigens, Tel hat mir von diesen drei Schurken erzählt, die Euch gestern gesucht haben. Jetzt suchen sie Euch nicht mehr.«
»Danke.«
»Es war eine persönliche Angelegenheit. Sie hätten zuerst meine Erlaubnis einholen müssen. Bedauerlicherweise konnten wir jedoch nicht viel von ihnen erfahren. Sie wurden von jemandem außerhalb Thalesiens beauftragt – so viel erfuhren wir von dem einen, der noch zu reden imstande war.«
Fünfzehn Minuten später wartete vor dem Hintereingang des ehemaligen Lagerhauses eine vornehme Kutsche auf sie. Als alle darin Platz genommen hatten, wendete der Kutscher sein Zweigespann geschickt in der engen Gasse und lenkte es auf die Straße.
Im Hafen rollte die Kutsche auf einen Kai und hielt neben einem Schiff, das wie ein Küstenfahrer aussah. Die gerefften Segel wiesen Flicken auf, und seine wuchtige Reling war mehrmals beschädigt und ausgebessert worden. Der Rumpf war geteert und ohne Namen.
»Es ist ein Korsar, nicht wahr?«, fragte Kurik Stragen, als sie aus der Kutsche stiegen.
»Das stimmt«, bestätigte Stragen. »Ich habe mehrere dieser Schiffe im Einsatz. Woran habt Ihr das erkannt?«
»An seiner Bauweise. Es ist auf Schnelligkeit ausgelegt, Durchlaucht«, erwiderte Kurik. »Für ein Frachtschiff ist es zu schmal, und die Verstärkung um die Masten verrät, dass mehr Segel gesetzt werden können, als für einen Küstenfahrer üblich sind. Es wurde erbaut, um andere Schiffe zu jagen.«
»Oder vor ihnen zu fliehen, Kurik. Seeräuber führen ein aufregendes Leben. Es gibt allerlei Leute, denen es ein Bedürfnis zu sein scheint, Piraten allein um des Prinzips willen aufzuhängen.«
Sie stiegen die Laufplanke hinauf. Stragen führte sie zu ihren Kabinen auf dem Unterdeck. Die Seeleute kappten die Trossen, und das Schiff lief in langsamer Fahrt aus dem Hafen. Doch kaum hatten sie die Landzunge hinter sich und tieferes Gewässer erreicht, wurden weitere Segel gesetzt, und das abenteuerliche Schiff jagte krängend über die Straße von Thalesien auf die deiranische Küste zu.
Gegen Mittag ging Sperber an Deck und erblickte Stragen an der Bugreling, wo er missmutig über die graue regengekräuselte See starrte. Er trug einen dicken braunen Umhang, und von der Hutkrempe tropfte Wasser auf seinen Rücken.
»Ich dachte, Ihr mögt Regen nicht«, bemerkte Sperber.
»Es ist so muffig unten in der Kabine«, klagte der Räuber. »Ich brauchte frische Luft. Wie schön, dass Ihr mir Gesellschaft leistet, Sperber. Es ist schwer, mit Piraten eine kultivierte Unterhaltung zu führen.«
Eine Zeit lang lauschten sie dem Knarren der Takelung, dem Ächzen der Spanten und dem schwermütigen Platschen des Regens auf der Wasseroberfläche.
»Wie kommt es, dass Kurik so viel über Schiffe weiß?«, fragte Stragen schließlich.
»Er ist als junger Bursche zur See gefahren.«
»Das erklärt es natürlich. Ihr möchtet wohl nicht über die Angelegenheiten sprechen, die Euch nach Thalesien geführt haben?«
»Nein. Eine Kirchensache, wisst Ihr.«
Stragen lächelte. »Ah, ja. Unsere schweigsame Heilige Mutter Kirche. Manchmal glaube ich, dass sie diese Geheimniskrämerei halb so ernst nimmt wie unsereiner.«
»Es gehört für uns eben zum Glauben, davon auszugehen, dass die Kirche weiß, was sie tut.«
»Für Euch, Sperber, weil Ihr Ordensritter seid. Ich habe keine derartigen Schwüre geleistet, deshalb kann ich mir gewisse Zweifel erlauben. Allerdings will ich nicht verheimlichen, dass ich in jüngeren Jahren durchaus mit dem Gedanken spielte, Priester zu werden.«