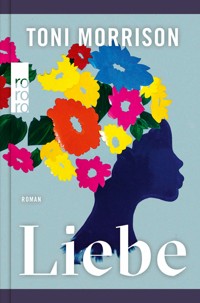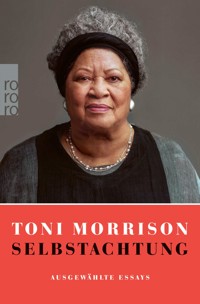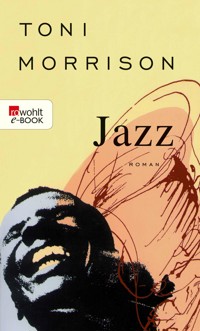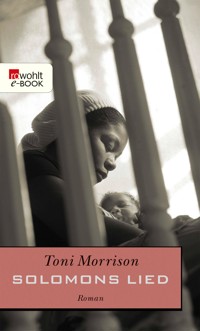24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Toni Morrisons bekanntester Roman in Neuübersetzung von Tanja Handels. Beloved, Toni Morrisons bekanntestes Werk und einer der wichtigsten Romane des 20. Jahrhunderts (The New York Times), erzählt mit den Mitteln des magischen Realismus von den grauenhaften Auswirkungen der Versklavung auf das Leben einer Familie. Sethe lebt seit Langem in einem kleinen Haus am Rande von Cincinnati, wo sie die Vergangenheit auszulöschen versucht. Auf der Flucht von der Plantage mit dem zynischen Namen «Sweet Home» hat sie einst ihr Leben riskiert, ihren Mann verloren und ein Kind begraben müssen, hat unvorstellbares Leid ertragen und dennoch nicht den Verstand verloren. Doch der Schrecken des Erlebten verfolgt sie: In der Bluestone Road 124 treibt ein Spuk sein Unwesen, der widerspenstige Geist von Sethes Tochter will nicht vergessen werden. Das Kleinkind, dessen Tod Sethe nicht verwinden kann, starb namenlos; sein Grab trägt allein das Wort Beloved. Als eines Tages Paul D. vor Sethes Tür steht, den sie noch von der Plantage kennt, reißt er alte Wunden wieder auf – und setzt so einen schmerzhaften Heilungsprozess in Gang.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 541
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Toni Morrison
Beloved
Roman
Mit einem Nachwort von Bernardine Evaristo
Über dieses Buch
Beloved, Toni Morrisons bekanntestes Werk und einer der wichtigsten Romane des 20. Jahrhunderts (The New York Times), erzählt mit den Mitteln des magischen Realismus von den grauenhaften Auswirkungen der Versklavung auf das Leben einer Familie.
Sethe lebt seit langem in einem kleinen Haus am Rande von Cincinnati, wo sie die Vergangenheit auszulöschen versucht. Auf der Flucht von der Plantage mit dem zynischen Namen «Sweet Home» hat sie einst ihr Leben riskiert, ihren Mann verloren und ein Kind begraben müssen, hat unvorstellbares Leid ertragen und dennoch nicht den Verstand verloren. Doch der Schrecken des Erlebten verfolgt sie: In der Bluestone Road 124 treibt ein Spuk sein Unwesen, der widerspenstige Geist von Sethes Tochter will nicht vergessen werden. Das Kleinkind, dessen Tod Sethe nicht verwinden kann, starb namenlos; sein Grab trägt allein das Wort Beloved. Als eines Tages ein Mann vor Sethes Tür steht, reißt er alte Wunden wieder auf - und setzt so einen schmerzhaften Heilungsprozess in Gang.
Vita
Toni Morrison wurde 1931 in Lorain, Ohio, geboren. Sie studierte an der renommierten Cornell University Anglistik und hatte an der Princeton University eine Professur für afroamerikanische Literatur inne. Zu ihren bedeutendsten Werken zählen «Sehr blaue Augen», «Solomons Lied», «Menschenkind», «Jazz», «Paradies» und diverse Essaysammlungen. Sie war Mitglied des National Council on the Arts und der American Academy of Arts and Letters. Ausgezeichnet mit zahlreichen Preisen, u. a. mit dem National Book Critics' Circle Award und dem American-Academy-and-Institute-of-Arts-and-Letters Award für Erzählliteratur. 1993 erhielt sie den Nobelpreis für Literatur, und 2012 zeichnete Barack Obama sie mit der Presidential Medal of Freedom aus. Toni Morrison starb am 5. August 2019.
Tanja Handels, geboren 1971 in Aachen, lebt und arbeitet in München, übersetzt zeitgenössische britische und amerikanische Literatur, unter anderem von Zadie Smith, Bernardine Evaristo, Anna Quindlen und Charlotte McConaghy, und ist auch als Dozentin für Literarisches Übersetzen tätig. 2019 wurde sie mit dem Heinrich Maria Ledig-Rowohlt-Preis ausgezeichnet.
Impressum
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel Beloved 1987 bei Alfred A. Knopf, Inc., New York.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, November 2024
Copyright «Menschenkind» © 1989 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
Copyright «Beloved» © 2024 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Copyright «Beloved» © 1987 by Toni Morrison
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Satz aus der Adobe Garamond Pro bei CPI books GmbH, Leck
Druck und Bindung GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-498-00509-2
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Sechzig Millionen
und mehr
I will call them my people,
which were not my people;
and her beloved,
which was not beloved.
Romans, 9:25 (King James Bible)
Ich will das mein Volk heißen,
das nicht mein Volk war,
und meine Liebe,
die nicht meine Liebe war.
Brief an die Römer 9, 25 (Luther-Bibel)
VORWORT
1983 verlor ich meine Stelle – beziehungsweise verließ sie. Vielleicht das eine, vielleicht das andere, vielleicht auch beides. Ich arbeitete ohnehin seit Längerem nur noch in Teilzeit, kam einen Tag pro Woche in den Verlag, um die Briefwechsel-Telefonate-Besprechungen zu erledigen, die mit zum Beruf gehören, und lektorierte meine Manuskripte zu Hause.
Es war aus gleich zwei Gründen eine gute Idee zu gehen. Erstens hatte ich bereits vier Romane geschrieben, und offenbar war allen klar, dass das Schreiben meinen Arbeitsschwerpunkt bildete. Mir selbst erschien die Frage nach den Prioritäten – wie schaffst du es bloß, gleichzeitig zu lektorieren und zu schreiben – ebenso eigentümlich wie vorhersehbar; sie klang mir doch sehr nach: «Wie schafft man es, gleichzeitig zu unterrichten und kreativ zu sein?» «Wie schafft es eine Malerin, eine Bildhauerin, eine Schauspielerin, ihre Arbeit zu tun und gleichzeitig andere anzuleiten?» Aber aus Sicht vieler barg die Kombination aus Lektorieren und Schreiben Konflikte.
Der zweite Grund war weniger zwiespältig. Die Bücher, die ich lektorierte, brachten nicht gerade Tonnen von Geld ein, auch als «Tonnen» noch nicht ganz das bedeutete, was es heute bedeutet. Ich selbst fand meine Liste spektakulär: ungeheuer talentierte Autorinnen und Autoren (Toni Cade Bambara, June Jordan, Gayl Jones, Lucille Clifton, Henry Dumas, Leon Forrest); Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen mit völlig neuen Ideen und konkreter Recherche (Shenfan von William Hinton, They Came Before Columbus von Ivan Van Sertima, Sexist Justice von Karen DeCrow, The West and the Rest of Us von Chinweizu); Prominente mit dem Wunsch, die Dinge richtigzustellen (Angela Davis, Muhammad Ali, Huey Newton). Und wenn es einmal ein Buch gab, von dem ich fand, es müsse geschrieben werden, suchte ich mir eine Person, die es tat. Mein Enthusiasmus, den manche teilten, wurde angesichts der mäßigen Verkaufszahlen von anderen gedämpft. Mag sein, dass ich mich da täusche, aber selbst Ende der Siebzigerjahre war es schon bei Weitem wichtiger, Autorinnen und Autoren mit sicherem Bestsellerpotenzial einzukaufen als an Manuskripten zu arbeiten oder diejenigen zu unterstützen, die noch am Anfang oder bereits am Ende ihrer Karriere standen. Kurzum, ich hatte mir eingeredet, dass es an der Zeit sei, wie eine erwachsene Autorin zu leben: nur von Tantiemen und vom Schreiben. Ich weiß nicht mehr genau, aus welchem Comicheft ich diese Vorstellung hatte, aber ich hielt daran fest.
Wenige Tage nach meinem letzten Arbeitstag saß ich auf dem Steg vor meinem Haus, der auf den Hudson hinausgeht, und verspürte Unruhe statt des erwarteten Seelenfriedens. Ich ging mein inneres Problemregister durch, fand aber nichts Neues oder Dringliches. Mir war schleierhaft, was mich an einem so vollkommenen Tag mit Blick auf einen so ruhigen Fluss derart aus dem Nichts belasten sollte. Ich hatte keine Verpflichtungen, würde nicht einmal das Telefon hören, falls es klingelte. Mein Herz allerdings hörte ich, es galoppierte in meiner Brust wie ein wildes Fohlen. Ich ging zum Haus zurück, um diesem Aufruhr, der fast schon an Panik grenzte, auf den Grund zu gehen. Wie Angst sich anfühlte, wusste ich; das hier war etwas anderes. Dann schlug es mir förmlich ins Gesicht: Ich war glücklich und frei auf eine Weise, wie ich es nie zuvor gewesen war, niemals. Und das war das sonderbarste Gefühl überhaupt. Kein Rausch, keine Genugtuung oder ein Übermaß an Freude oder Stolz auf die eigene Leistung. Es war ein sehr viel reineres Vergnügen, eine diebische Vorfreude voller Gewissheit. Auftritt Beloved.
Ich glaube, die Erschütterung des eigenen Befreitseins hat mich zum Nachdenken darüber gebracht, was «Freisein» für Frauen eigentlich bedeutet. In den Achtzigerjahren tobten die Debatten noch heftig: gleiche Löhne, Gleichbehandlung, Zugang zu allen Berufen und Studienfächern … und Entscheidungsfreiheit ohne Stigma. Für oder gegen die Ehe. Für oder gegen Kinder. Diese Gedanken führten mich zwangsläufig zu der sehr anderen Geschichte Schwarzer Frauen in diesem Land – einer Geschichte, die Ehen verhinderte, sie unmöglich oder ungesetzlich machte; die zwar dazu verpflichtete, Kinder zu gebären, sie dann aber zu «haben», für sie verantwortlich – mit anderen Worten: ihnen Eltern zu sein, ebenso ausschloss wie die Freiheit. Unter Bedingungen, wie sie der Logik institutionalisierter Versklavung entsprachen, war das Geltendmachen der eigenen Elternschaft ein Verbrechen.
Die Idee fesselte mich sofort, ihr Hintergrund allerdings überforderte mich. Figuren erstehen zu lassen, in denen sich sowohl die Geisteskraft als auch der Ingrimm manifestieren würden, die eine solche Logik hervorrief, das überstieg so lange meine Vorstellungskraft, bis mir ein Buch einfiel, das ich herausgebracht hatte, als ich noch Lektorin war. Ein Zeitungsartikel aus The Black Book resümierte die Geschichte von Margaret Garner, einer jungen Mutter, die ins Gefängnis gekommen war, weil sie, selbst aus der Versklavung geflohen, eins ihrer Kinder getötet (und die anderen zu töten versucht) hatte, um sie nicht erneut dem Plantagenbesitzer auszuliefern. Sie wurde zum Präzedenzfall im Kampf gegen die Sklavenfluchtgesetze, die vorschrieben, dass Flüchtige ihren sogenannten Besitzern grundsätzlich zurückgegeben werden mussten. Zurechnungsfähig und ohne jede Reue erregte sie sowohl unter abolitionistischen Gruppierungen Aufsehen als auch in den Zeitungen. Sie war unbestreitbar ein redlicher Mensch, und nach ihren Aussagen zu urteilen besaß sie genau die Geisteskraft, den Ingrimm und den Willen, alles für das aufs Spiel zu setzen, was sie unter unerlässlicher Freiheit verstand.
Die historische Margaret Garner ist faszinierend, für eine Romanautorin aber auch sehr einschränkend. Für meine Zwecke blieb da zu wenig Raum für die Vorstellungskraft. Und so erfand ich ihre Gedanken und lotete sie nach Subtexten aus, die im Kern zwar historisch wahr blieben, streng genommen aber nicht den Tatsachen entsprachen, um ihre Geschichte mit aktuellen Fragen nach Freiheit, Verantwortung und dem «Platz» der Frau in Beziehung setzen zu können. Meine Protagonistin sollte für die kompromisslose Akzeptanz von Scham und Angst stehen; die Konsequenzen dafür tragen, dass sie den Kindsmord wählte; ihre eigene Freiheit für sich beanspruchen. Das Gelände der Versklavung war gewaltig und unerschlossen. Mein Publikum (und mich selbst) in diese abstoßende Landschaft (verborgen, aber doch nicht ganz; bewusst begraben und doch nicht vergessen) zu bitten, das hieß, ein Zelt auf einem von hochgradig lautstarken Geistern bewohnten Friedhof aufzuschlagen.
Ich setzte mich auf die Veranda, schwang sacht in meiner Hollywoodschaukel und schaute zu den riesigen aufgetürmten Steinen hin, die die sporadischen Faustschläge des Flusses abfangen sollten. Oberhalb der Steine führt ein Pfad über den Rasen, dazwischen ein Gartenpavillon aus Hainbuchenholz, der unter einer Baumgruppe errichtet wurde, tief im Schatten.
Sie kam aus dem Wasser, erklomm die Steine und lehnte sich an den Pavillon. Hübscher Hut.
Von Anfang an war sie also da, und außer mir wussten es alle (Figuren) – dieser Satz wurde später zu «Das wussten die Frauen im Haus». Die zentrale Figur der Geschichte, das musste sie sein, die Ermordete, nicht die Mörderin, sondern die, die alles verloren und dabei keinerlei Mitspracherecht gehabt hatte. Sie konnte sich nicht draußen herumtreiben; sie musste ins Haus hinein. Ein richtiges Haus, keine Hütte. Ein Haus mit einer Adresse, eines, in dem ehemals versklavte Menschen allein für sich lebten. Dieses Haus würde keinen Vorraum haben, und es würde auch keine «Einführung» geben, weder in das Haus noch in den Roman. Ich wollte, dass das Publikum gekidnappt würde, als erster Schritt eines gemeinsamen Erlebens mit dem Figurenpersonal, erbarmungslos mitten in eine fremde Umgebung hineingeworfen würde – so wie die Figuren dem einen Ort entrissen und an einen anderen gebracht wurden, von jedem beliebigen Ort an einen anderen, ohne Vorbereitung oder Gegenwehr.
Es war wichtig, diesem Haus einen Namen zu geben, allerdings keinen, wie ihn «Sweet Home» oder andere Plantagen tragen. Adjektive, die auf Gemütlichkeit, Größe oder den Anspruch auf eine unmittelbare, aristokratische Vergangenheit verwiesen, durfte es nicht geben. Nur Zahlen bezeichneten das Haus und hoben es gleichzeitig von einer Straße oder einer Stadt ab – benannten die Art, wie es sich von den Häusern anderer Schwarzer Menschen in der Gegend unterschied; ließen einen Anflug der Überlegenheit spüren, des Stolzes, den ehemals Versklavte empfinden mussten, wenn sie eine eigene Adresse hatten. Und doch ein Haus, das ganz buchstäblich eine Persönlichkeit besitzt – eines, von dem wir sagen, es «spuke» dort, wenn diese Persönlichkeit sich allzu offensichtlich aufdrängt.
Indem ich versuchte, das Erleben von Versklavung intimer zu machen, würde, so hoffte ich, der durchgehend überzeugende Eindruck entstehen, dass die Dinge sowohl unter Kontrolle als auch jeder Kontrolle entzogen sind; dass die Ordnung und Stille des Alltagslebens vom Chaos bedürftiger Toter gewaltsam gestört, die Herkulesaufgabe des Vergessens ständig von Erinnerungen bedroht wird, die mit aller Macht lebendig bleiben wollen. Soll Versklavung zur persönlichen Erfahrung werden, darf die Sprache nicht im Weg stehen.
Ich bewahre mir diesen Moment auf dem Steg, den trügerischen Fluss, das plötzliche Bewusstsein von Möglichkeit, das laut galoppierende Herz, die Einsamkeit, die Gefahr. Und die junge Frau mit dem hübschen Hut. Und dann das Wesentliche.
Beloved
I
Die 124 war boshaft. Ganz erfüllt vom Giften eines Kleinkinds. Das wussten die Frauen im Haus, und die Kinder wussten es auch. Jahrelang gingen alle auf ihre je eigene Art mit der Bosheit um, aber 1873 fielen ihr nur noch Sethe und ihre Tochter Denver zum Opfer. Baby Suggs, die Großmutter, war tot, und die Söhne, Howard und Buglar, waren davongelaufen, sobald sie dreizehn waren – als der Spiegel schon barst, wenn man bloß hineinsah (das war das Zeichen für Buglar); als sich zwei kleine Handabdrücke im Kuchen zeigten (das war’s für Howard). Keiner der Jungs wartete ab, bis er noch mehr zu sehen bekam, noch einen Haufen dampfender Kichererbsen, der sich aus dem Kessel auf den Boden ergoss, noch eine Spur aus zerkrümelten Crackern, gleich vor der Türschwelle ausgestreut. Und keiner wartete die nächste Ruhephase ab: die Wochen, sogar Monate, in denen nichts durcheinanderging. Nein. Beide ergriffen umgehend die Flucht – kaum dass das Haus ihnen die eine Kränkung angetan hatte, die sich kein zweites Mal ertragen oder mitansehen ließ. Mit zwei Monaten Abstand, im tiefsten Winter, ließen sie ihre Großmutter Baby Suggs, ihre Mutter Sethe und Denver, ihre kleine Schwester, ganz allein in dem grauweißen Haus an der Bluestone Road zurück. Eine Hausnummer hatte es damals noch nicht, weil Cincinnati so weit nicht reichte. Ohio selbst konnte sich seit gerade einmal siebzig Jahren einen Staat nennen, als erst der eine Bruder und dann der andere sich den Hut mit Wollresten polsterte, die Schuhe in die Hand nahm und sich davonschlich, fort von der lebhaften Bosheit, die das Haus für ihn hegte.
Baby Suggs sah nicht einmal auf. Von ihrem Krankenlager aus hörte sie beide sich davonmachen, das war aber nicht der Grund, warum sie still lag. Ein Wunder eigentlich, dass ihren Enkeln nicht früher aufgegangen war, dass nicht jedes Haus so zu sein brauchte wie das an der Bluestone Road. Auf halbem Weg zwischen der Abscheulichkeit des Lebens und der Garstigkeit der Toten hatte sie nicht einmal mehr Sinn dafür, das Leben zu lassen oder zu leben, geschweige denn für die Ängste zweier fortschleichender Jungs. Ihre Vergangenheit war wie ihre Gegenwart gewesen – unerträglich –, und weil sie wusste, dass auch der Tod kein Vergessen bringen würde, nutzte sie das bisschen Tatkraft, das ihr blieb, für die Betrachtung von Farben.
«Bring mir was Lavendelblaues rein, wenn du hast. Und wenn nicht, dann was Rosanes.»
Und Sethe erfüllte ihr den Wunsch mit allem, vom Stofffetzen bis zu ihrer Zunge. Wenn man nach Farben hungerte, war der Winter in Ohio besonders streng. Dramatik bot allenfalls der Himmel, und es grenzte an Leichtsinn, sich auf den Horizont von Cincinnati zu verlassen, wenn es um die höchste Freude im Leben ging. Und so taten Sethe und die kleine Denver für Baby Suggs alles, was sie konnten und was das Haus zuließ. Gemeinsam führten sie einen halbherzigen Kampf gegen sein empörendes Benehmen, gegen jeden umgekippten Nachttopf, jeden Schlag aufs Hinterteil, jeden säuerlichen Schwall Luft. Denn sie kannten ja den Ursprung der Empörung, so gut, wie sie wussten, wo das Licht herkam.
Kurz nachdem die Brüder verschwunden waren, starb Baby Suggs, ohne irgendwie Anteil an deren Abschied oder ihrem eigenen zu nehmen, und gleich danach beschlossen Sethe und Denver, den Anfeindungen ein Ende zu machen und den Geist herauszufordern, der ihnen so zusetzte. Eine Unterredung, dachten sie, ein Meinungsaustausch oder etwas in der Art würde vielleicht helfen. Und so fassten sie sich an den Händen und riefen: «Komm herbei. Komm herbei. Nun komm doch schon herbei.»
Die Anrichte tat einen Schritt nach vorn, sonst aber tat sich nichts.
«Bestimmt hält Grandma Baby es ab», sagte Denver. Sie war zehn und immer noch böse auf Baby Suggs, weil sie gestorben war.
Sethe machte die Augen auf. «Glaub ich nicht», sagte sie.
«Und warum kommt es dann nicht?»
«Du darfst nicht vergessen, wie klein es noch ist», sagte ihre Mutter. «Keine zwei war sie, als sie starb. Viel zu klein, um zu begreifen. Viel zu klein, um groß was zu sagen.»
«Vielleicht will sie nicht begreifen», sagte Denver.
«Kann sein. Aber wenn sie herkäme, könnte ich’s ihr erklären.» Sethe ließ die Hand ihrer Tochter los, und gemeinsam schoben sie die Anrichte zurück an die Wand. Draußen trieb ein Karrenfahrer sein Pferd mit der Peitsche in den Galopp, den die Leute aus der Gegend für nötig hielten, wenn sie an der 124 vorbeikamen.
«Ganz schön mächtiger Zauber für ein kleines Kind», sagte Denver.
«Auch nicht mächtiger als meine Liebe zu ihr», erwiderte Sethe, und alles war wieder da. Die einladende Kühle unbehauener Grabsteine; der, den sie sich ausgesucht hatte, an den sie sich dann lehnte, auf Zehenspitzen, die Beine so weit geöffnet wie jedes Grab. Rosa wie ein Fingernagel, mit glitzernden Splittern gespickt. Zehn Minuten, hatte er gesagt. Gib mir zehn Minuten, dann mach ich’s gratis.
Zehn Minuten für sieben Buchstaben. Ob sie mit noch mal zehn ein «Dearly» dazubekommen hätte? Sie war gar nicht darauf gekommen, ihn zu fragen, und bis heute quälte es sie, dass es vielleicht möglich gewesen wäre – dass sie für zwanzig Minuten oder auch eine halbe Stunde alles hätte haben können, jedes Wort, das sie den Pfarrer bei der Totenfeier hatte sagen hören (und mehr gab es ja auch nicht zu sagen), eingraviert auf den Grabstein ihres Kindes: Dearly Beloved. Aber was sie dann bekommen, womit sie sich begnügt hatte, war das eine Wort, das zählte. Sie fand, es müsse genug sein, da zwischen den Gräbern mit dem Steinhauer zu rammeln, während sein jugendlicher Sohn zusah; so alt der Zorn in seinem Gesicht, die Gier darin umso neuer. Das musste doch wirklich genug sein. Genug, um sich vor einem weiteren Priester zu verantworten, einem weiteren Abolitionisten und einer Stadt voller Abscheu.
Aber im Vertrauen auf die Stille der eigenen Seele hatte sie nicht an die andere gedacht: die Seele ihres kleinen Mädchens. Wer rechnete auch damit, dass so ein mickriges Kleinkind derart viel Wut in sich bergen konnte? Es war nicht genug, vor den Augen des Steinhauersohns zwischen den Gräbern zu rammeln. Nicht nur musste sie ihr weiteres Leben in einem Haus fristen, das vom Zorn des Kindes über seine durchschnittene Kehle gelähmt war, die zehn Minuten, die sie an einen morgenrotfarbenen, mit Sternensplittern gesprenkelten Stein gedrückt verbracht hatte, die Beine weit offen wie das Grab, waren auch länger als das Leben, lebendiger, pulsierender als das Kinderblut, das ihr wie Öl über die Finger geflossen war.
«Wir könnten umziehen», hatte sie ihrer Schwiegermutter einmal vorgeschlagen.
«Wozu soll das gut sein?», fragte Baby Suggs. «Gibt schließlich im ganzen Land kein Haus, das nicht bis unter die Dachsparren vollgepackt wär mit dem Schmerz von irgendwelchen toten Schwarzen. Wir haben noch Glück, dass unser Geist ein Kleinkind ist. Wenn jetzt der Geist von meinem Mann hier wieder umgehen würde? Oder von deinem? Hör mir auf. Du hast Glück. Du hast noch drei übrig. Drei, die dir hier am Rockzipfel hängen, und bloß eins, das uns von drüben die Hölle heißmacht. Sei mal was dankbar. Ich hatte acht. Und jedes einzelne ist weg von mir. Vier weggeholt, vier erlegt, und alle, schätz ich, treiben sie irgendwo ein Haus ins Elend.» Baby Suggs rieb sich die Brauen. «Meine Älteste. Von der weiß ich nichts mehr, außer, wie gern sie es hatte, wenn das Brot unten angebrannt war. Das schlag mal. Acht Kinder, und das ist alles, was ich noch weiß.»
«Das ist alles, was du dich noch wissen lässt», sagte Sethe damals zu ihr, aber sie hatte schließlich selbst nur noch das eine – genauer gesagt, das eine lebendige –, das tote hatte ja die Jungs verscheucht, und ihre Erinnerungen an Buglar schwanden schnell. Howard hatte zumindest diesen Kopf, dessen Form man nicht so schnell vergaß. Was den Rest anging, arbeitete sie hart daran, dem Nicht-Erinnern so nahe zu kommen, wie sie gefahrlos konnte. Aber ihr Hirn war leider hinterhältig. Da konnte sie über ein Feld laufen, regelrecht rennen, um bloß rasch zur Wasserpumpe zu kommen und sich die Kamillenpollen von den Beinen zu spülen. Sie hatte an nichts anderes gedacht. Das Bild von den Männern, die kamen, um sie zu melken, war so leblos wie die Nerven an ihrem Rücken, wo die Haut wie ein Waschbrett gewellt war. Es war auch kein bisschen Tinte zu riechen, nichts von dem Kirschbaumharz und der Eichenrinde, aus denen sie angerührt wurde. Nichts. Nur leiser Wind, der Sethe das Gesicht kühlte, während sie nach Wasser eilte. Und dann die Kamille abwusch, mit dem Wasser aus der Pumpe und ein paar Lumpen, ihr ganzer Kopf darauf gerichtet, noch das letzte Restchen Pollen abzukriegen – darauf, wie leichtsinnig es gewesen war, die Abkürzung übers Feld zu nehmen, um eine halbe Meile zu sparen, und erst daran zu denken, wie hoch die Pflanzen bereits gewachsen waren, als ihr die Beine längst bis zu den Knien juckten. Dann irgendwas. Das Platschen des Wassers, der Anblick ihrer Schuhe und Strümpfe kreuz und quer auf dem Weg, wo sie sie hingeworfen hatte; vielleicht auch Here Boy, der aus der Pfütze zu ihren Füßen schlabberte, und plötzlich war Sweet Home wieder da, rollte, rollte, rollte sich aus vor ihren Augen, und obwohl es auf der ganzen Farm nicht ein Blatt gab, das ihr keine Schreie entlockt hätte, entrollte sie sich jetzt in schamloser Schönheit vor ihr. Nie hatte sie so schrecklich ausgesehen, wie sie war, und das führte Sethe zu der Überlegung, ob vielleicht auch die Hölle ein schöner Ort war. Feuer und Schwefel, sicher, aber in den lieblichsten Hainen verborgen. Jungs, die von den schönsten Maulbeerbäumen der Welt baumelten. Sie schämte sich – weil sie sich an die prächtigen, rauschenden Bäume klarer erinnerte als an die Jungs. So sehr sie sich auch bemühte, die Maulbeerbäume siegten jedes Mal über die Kinder, und das konnte sie ihrer Erinnerung nicht vergeben.
Als das letzte bisschen Kamille abgewaschen war, ging sie wieder ums Haus herum und sammelte unterwegs Schuhe und Strümpfe auf. Wie um sie noch mehr für ihr schreckliches Gedächtnis zu strafen, saß auf der Veranda, keine vierzig Fuß von ihr weg, Paul D, der letzte von den Männern aus Sweet Home. Und obwohl sie sein Gesicht niemals mit einem anderen verwechselt hätte, fragte sie ihn: «Bist du’s?»
«Was noch übrig ist.» Er stand auf, lächelte. «Was treibst du so, girl, außer barfuß laufen?»
Sie lachte, und es klang jung und gelöst. «Hab mir da hinten die Beine eingesaut. Mit Kamille.»
Er verzog das Gesicht, als hätte er einen Löffel Bitteres gekostet. «Da will ich gar nichts weiter hören. Was hab ich das Zeug immer gehasst.»
Sethe knüllte ihre Strümpfe zusammen und stopfte sie in die Rocktasche. «Komm doch rein.»
«Veranda tut’s auch, Sethe. Hier ist es kühl.» Er setzte sich wieder und schaute zur Wiese auf der anderen Straßenseite, weil er wusste, sein Begehren würde ihm in den Augen stehen.
«Achtzehn Jahre», sagte sie leise.
«Achtzehn», wiederholte er. «Und ich kann dir sagen, ich war jedes einzelne davon auf den Füßen. Was dagegen, wenn ich’s auch so mach wie du?» Mit dem Kopf deutete er auf ihre Füße und machte sich daran, sich die Schuhe aufzuschnüren.
«Willst du sie vielleicht baden? Ich hol dir eine Schüssel Wasser.» Sie kam ihm näher, um ins Haus zu gehen.
«Nee, lass mal. Füße darf man nicht verhätscheln. Die müssen noch ne ganze Strecke weiterlaufen.»
«Du kannst aber nicht gleich wieder gehen, Paul D. Du musst schon noch was bleiben.»
«Na, auf jeden Fall lang genug, um Baby Suggs zu sehen. Wo ist sie denn?»
«Tot.»
«O nein. Seit wann?»
«Acht Jahre jetzt. Fast neun.»
«War’s schwer? Ich hoffe, sie hatte keinen schweren Tod.»
Sethe schüttelte den Kopf. «Weich wie Sahne. Am Leben sein, das war das Schwere. Aber mir tut’s leid, dass du sie verpasst hast. Bist du deswegen hergekommen?»
«Teilweise deswegen. Und sonst wegen dir. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, geh ich inzwischen überall hin. Hauptsache, ich kann mich mal setzen.»
«Gut siehst du aus.»
«Das macht der Teufel. Solang’s mir dreckig geht, lässt der mich gut aussehen.» Er schaute sie an, und das Wort «dreckig» bekam mit einem Mal noch einen anderen Sinn.
Sethe lächelte. So waren sie immer gewesen – damals. Auf diese sanfte, brüderliche Art hatten sie alle mit ihr geschäkert, die Männer aus Sweet Home, vor Halle und nach ihm, so verhalten, dass man regelrecht danach graben musste.
Abgesehen von sehr viel mehr Haar und etwas Abwartendem im Blick sah er noch genau so aus wie in Kentucky. Haut wie ein Pfirsichkern, gerader Rücken. Für ein ungerührtes Männergesicht war seins erstaunlich schnell bereit zu lächeln, Zorn oder Mitleid zu zeigen. Als müsste man einfach nur von ihm bemerkt werden, schon stellte sich bei ihm das Gefühl ein, das man selbst empfand. Sein Gesicht änderte sich schneller als ein Wimpernschlag – alles Bewegliche lag darunter.
«Ich würd gewiss nicht nach ihm fragen müssen, stimmt’s? Wenn’s was zu sagen gäbe, würdest du’s mir sagen?» Sethe schaute auf ihre Füße, sah wieder die Maulbeerbäume.
«Klar. Klar würd ich dir das sagen. Aber ich weiß nicht mehr, als ich damals wusste.» Nur das mit dem Butterfass, dachte er, und das brauchst du nicht zu wissen. «Du glaubst bestimmt, er ist noch am Leben.»
«Nein. Ich glaube, er ist tot. Am Leben hält ihn nur, dass ich’s nicht sicher weiß.»
«Was hat denn Baby Suggs geglaubt?»
«Auch das, aber wenn man sie reden hörte, sind ihre Kinder alle tot. Sie hat immer behauptet, sie hätte jedes dahingehen fühlen, auf Tag und Stunde genau.»
«Was hat sie gesagt, wann Halle gegangen ist?»
«Achtzehnhundertfünfundfünfzig. An dem Tag, als ich mein Kind bekommen hab.»
«Dann hast du dieses Kind wirklich gekriegt? Hätt ich ja nicht gedacht, dass du das schaffst.» Er lachte leise. «Hochschwanger weglaufen.»
«Musste ich. Länger warten ging nicht.» Sie ließ den Kopf sinken und dachte, genau wie er, wie unwahrscheinlich es war, dass sie es geschafft hatte. Und wenn die junge Frau auf der Suche nach Samt nicht gewesen wäre, dann hätte sie es auch nicht geschafft.
«Und auch noch ganz allein.» Er spürte Stolz auf sie und Unmut über sie. Stolz, weil es ihr gelungen war; Unmut, weil sie weder ihn noch Halle dafür gebraucht hatte.
«Fast allein. Nicht ganz. Ne junge Weiße hat mir geholfen.»
«Und damit auch sich selbst, Gott segne sie.»
«Du könntest über Nacht bleiben, Paul D.»
«Klingt nicht, als wärst du dir sehr sicher mit dem Angebot.»
Sethe schaute über seine Schulter hinweg zu der geschlossenen Haustür. «Oh, ich mein’s schon ernst. Ich hoffe nur, du störst dich nicht an meinem Haus. Komm doch mit rein. Du redest mit Denver, und ich koch dir was.»
Paul D band seine Schuhe an den Schnürsenkeln zusammen, hängte sie sich über die Schulter und folgte Sethe durch die Tür, mitten hinein in eine Lache aus wogendem, rotem Licht, das ihn an Ort und Stelle bannte.
«Besuch?», flüsterte er mit gerunzelter Stirn.
«Immer mal wieder», sagte Sethe.
«Herrgott.» Er ging rückwärts wieder zur Tür hinaus, zurück auf die Veranda. «Was hast du da bloß Böses drinnen?»
«Es ist nicht böse, nur traurig. Na komm. Geh einfach durch.»
Da sah er sie sich genauer an. Genauer als in dem Moment, als sie mit nassen, glänzenden Beinen ums Haus herumgekommen war, die Schuhe und Strümpfe in der einen, den gerafften Rock in der anderen Hand. Halles Mädchen – die mit den eisernen Augen und dem dazu passenden Rückgrat. Ihre Haare hatte er in Kentucky nie zu Gesicht bekommen. Und auch wenn ihr Gesicht jetzt achtzehn Jahre älter war als beim letzten Mal, wirkte es weicher. Wegen der Haare. Ein Gesicht, stiller, als einem lieb sein konnte; Augen von der Farbe ihrer Haut, die ihn in diesem stillen Gesicht früher immer an eine Maske denken ließen, der gnädigerweise die Augen ausgeschlagen waren. Halles Frau. Jedes Jahr schwanger, auch in dem Jahr, als sie sich zu ihm ans Feuer setzte und ihm sagte, sie werde weglaufen. Ihre drei Kinder hatte sie schon in einen Wagen mit anderen gepackt, einer Karawane aus Schwarzen, die den Fluss überqueren wollte. Sie sollten bei Halles Mutter in der Nähe von Cincinnati bleiben. Nicht einmal da, in der kleinen Hütte, wo sie sich so dicht zum Feuer beugte, dass man die Hitze an ihrem Kleid roch, fingen ihre Augen auch nur ein Flackern ein. Sie waren wie zwei Brunnen, er hatte Mühe, hineinzuschauen. Selbst ausgeschlagen gehörten sie eigentlich verdeckt, verschlossen, mit irgendeinem Hinweis versehen, der vor dem warnte, was sich in dieser Leere fand. Und so schaute er stattdessen ins Feuer, während sie ihm alles erzählte, weil ihr Mann nicht da war, um ihr zuzuhören. Mr. Garner war tot, seine Frau hatte eine Geschwulst am Hals, groß wie eine Süßkartoffel, und konnte nicht mehr sprechen. Sethe beugte sich so dicht zum Feuer, wie sie mit ihrem Schwangerenbauch nur konnte, und erzählte es ihm, Paul D, dem letzten von den Männern aus Sweet Home.
Sie hatten zu sechst zur Farm gehört, Sethe die einzige Frau unter ihnen. Mrs. Garner heulte wie ein kleines Kind, als sie seinen Bruder verkaufte, um die Schulden abzuzahlen, die sich offenbarten, kaum dass sie Witwe geworden war. Danach kam Schoolteacher, der Lehrer, um die Dinge zu regeln. Aber was er tat, ließ drei weitere Männer aus Sweet Home zerbrechen, und Sethe trennte es das glitzernde Eisen aus den Augen und ließ dort bloß zwei offene Brunnenschächte zurück, in denen sich kein Feuerschein mehr spiegelte.
Jetzt war das Eisen wieder da, ihr Gesicht aber, weicher durch das Haar, gab ihm genug Vertrauen in sie, um durch die Tür zu treten, hinein in die Lache aus pochendem, rotem Licht.
Sie hatte recht. Es war nur traurig. Als er hindurchging, tränkte auch ihn eine Welle von Trauer, so gründlich, dass er weinen wollte. Der Weg bis zum normalen Licht rund um den Tisch schien weit, aber er schaffte ihn – mit Glück und trockenen Augen.
«Du hast doch gesagt, sie wär weich gestorben. Weich wie Sahne», erinnerte er sie.
«Das ist nicht Baby Suggs», sagte sie.
«Wer sonst?»
«Meine Tochter. Die, die ich mit den Jungs vorausgeschickt hatte.»
«Sie lebt nicht mehr?»
«Nein. Ich hab jetzt nur noch die, mit der ich schwanger war, als ich weggelaufen bin. Die Jungs sind auch längst weg. Haben sich beide davongemacht, kurz bevor Baby Suggs gestorben ist.»
Paul D besah sich die Stelle, an der ihn die Trauer durchtränkt hatte. Das Rot war weg, aber wo es gewesen war, hing etwas wie ein Weinen in der Luft.
Ist wohl das Beste so, dachte er. Solang ein Schwarzer Beine hat, muss er sie auch benutzen. Sitzt er zu lange, finden die doch noch nen Weg, ihn festzubinden. Allerdings … wenn ihre Söhne beide weg waren …
«Kein Mann? Bist du hier ganz allein?»
«Denver und ich», sagte sie.
«Und das willst du so haben?»
«Das will ich so haben.»
Sie sah sein Zweifeln und fuhr fort. «Ich koch in einem Restaurant in der Stadt. Und mach noch Näharbeiten nebenbei.»
Da lächelte Paul D, weil ihm das Hochzeitsbettkleid wieder einfiel. Sethe war mit dreizehn nach Sweet Home gekommen, schon da mit eisernen Augen. Sie war als Geschenk für Mrs. Garner gedacht, zur rechten Zeit, denn die hatte gerade Baby Suggs verloren, weil ihr Mann so hochfliegende Prinzipien hatte. Die fünf Männer aus Sweet Home schauten sich das neue Mädchen an und beschlossen, es in Frieden zu lassen. Sie waren jung, und der Mangel an Frauen machte sie so krank, dass sie zu Kälbern griffen. Aber das Mädchen mit den Eisenaugen ließen sie in Frieden, und so lag die Wahl bei ihr, obwohl jeder von ihnen die anderen windelweich geprügelt hätte, um sie zu kriegen. Sie brauchte ein Jahr zum Wählen – ein langes, hartes Jahr, in dem sie sich auf ihren Pritschen wälzten und sich in Träumen von ihr verzehrten. Ein Jahr voller Verlangen, in dem ihnen Vergewaltigung erschien wie ein Himmelsgeschenk. Möglich wurde die Mäßigung, die sie sich auferlegten, nur, weil sie die Männer aus Sweet Home waren – mit denen Mr. Garner immer prahlte, während die Besitzer anderer Gehöfte nur warnend den Kopf über den Ausdruck schüttelten.
«Ihr habt doch nur Burschen», erklärte er. «Junge Burschen, alte Burschen, schwierige Burschen, Draufgänger-Burschen. Aber meine niggers hier auf Sweet Home, das sind Männer, allesamt. So hab ich sie gekauft, so hab ich sie erzogen. Männer, allesamt.»
«Einspruch, Garner. Niggers sind keine Männer.»
«Stimmt, wenn man Angst vor ihnen hat.» Garner grinste breit. «Aber wenn man selbst ein Mann ist, will man auch, dass die eigenen niggers Männer sind.»
«Also, ich würd ja keine nigger-Männer bei meiner Frau in der Nähe dulden.»
Solche Reaktionen liebte Garner und hatte nur darauf gewartet. «Ich auch nicht», sagte er dann. «Ich auch nicht», und jedes Mal dauerte es einen Augenblick, bis der Nachbar, der Fremde, der Krämer, der Schwager oder wer es gerade war, begriff, wie er das meinte. Dann folgte ein erbitterter Streit, manchmal auch eine Prügelei, und Garner kehrte verbeult und hochzufrieden nach Hause zurück, weil er wieder einmal bewiesen hatte, was ein echter Kentuckier war: einer, der hart, aber auch klug genug war, um Männer aus seinen niggers zu machen und sie auch so zu bezeichnen.
Und das waren sie dann: Paul D Garner, Paul F Garner, Paul A Garner, Halle Suggs und Sixo, der Rasende. Alle um die zwanzig und frauenlos, fickten sie Kühe, träumten vom Vergewaltigen, wälzten sich auf ihren Pritschen, rieben sich die Schenkel und warteten auf das Mädchen – die Neue, die den Platz von Baby Suggs eingenommen hatte, nachdem Halle sie mit fünf Jahren Sonntagsarbeit freigekauft hatte. Vielleicht hatte das Mädchen ja deswegen ihn gewählt. Ein zwanzigjähriger Mann, der seine Mutter so sehr liebte, dass er fünf Jahre lang den Feiertag drangab, um zu erleben, dass sie sich zur Abwechslung mal hinsetzen konnte, das sprach ernsthaft für ihn.
Sie wartete ein Jahr. Und die Männer aus Sweet Home schändeten Kühe und warteten mit ihr. Sie wählte Halle, und für das erste Mal mit ihm nähte sie sich nebenbei ein Kleid.
«Willst du nicht was länger bleiben? Achtzehn Jahre kann kein Mensch an einem Tag aufholen.»
Aus dem Dämmer des Zimmers, in dem sie saßen, führte eine weiße Treppe zu der blauweißen Tapete im ersten Stock hinauf. Paul D sah nur die Anfänge der Tapete; verhaltene Fleckchen Gelb in einen Sturm aus Schneeglöckchen getupft und alles von Blau umgeben. Das strahlende Weiß von Geländer und Stufen zog immer wieder seinen Blick an. Jeder Sinn, den er besaß, sagte ihm, dass die Luft oberhalb dieser Treppe verzaubert war und äußerst dünn. Das Mädchen allerdings, das jetzt aus dieser Luft nach unten trat, war rundlich und braun, mit dem Gesicht einer aufgeweckten Puppe.
Paul D sah erst das Mädchen an, dann Sethe, die lächelnd sagte: «Da ist sie ja, meine Denver. Honey, das ist Paul D, aus Sweet Home.»
«Guten Morgen, Mr. D.»
«Garner, Kindchen. Paul D Garner.»
«Ja, Sir.»
«Schön, dich mal zu Gesicht zu kriegen. Das letzte Mal hast du deiner Mama noch vorn das Kleid ausgebeult.»
«Macht sie immer noch.» Sethe lächelte. «Sofern sie überhaupt reinpasst.»
Denver blieb auf der untersten Stufe stehen, mit einem Mal erhitzt und verlegen. Es war lange her, dass irgendwer (bemühte Weiße, Pastor, Politiker oder Reporter) bei ihnen am Tisch gesessen hatte und die Abscheu im Blick die mitfühlende Stimme Lügen strafte. Zwölf Jahren schon, lange vor Grandma Babys Tod, war kein Besuch mehr dagewesen, erst recht kein freundschaftlicher. Keine Schwarzen. Und erst recht kein Haselnussmann mit viel zu langen Haaren und ganz ohne Notizbuch, ohne Zeichenstift, ohne Orangen, ohne Fragen. Einer, mit dem ihre Mutter reden wollte, bei dem es ihr anscheinend sogar denkbar schien, barfuß mit ihm zu reden. Und dabei nicht nur auszusehen, sondern sich auch noch zu benehmen wie ein junges Mädchen, nicht wie die ruhige, königliche Frau, die Denver schon ihr Leben lang kannte. Die niemals wegschaute, die nicht weggeschaut hatte, als direkt vor Sawyer’s Restaurant ein Mann von einer Stute zu Tode getrampelt worden war; und wenn eine Sau die eigenen Ferkel fraß, schaute sie auch nicht weg. Und als der Geist des Kleinkinds nach Here Boy griff und ihn so fest gegen die Wand schleuderte, dass es ihm zwei Beine brach und ein Auge ausschlug, so fest, dass ihn Krämpfe befielen und er sich die Zunge zerbiss, auch da hatte ihre Mutter nicht weggeschaut. Sie hatte einen Hammer genommen, den Hund bewusstlos geschlagen, ihm Blut und Sabber abgewischt, ihm das Auge wieder in die Höhle gedrückt und die Beinknochen gerichtet. Er kam durch, stumm und schwankend zwar, mehr des unzuverlässigen Auges als der krummen Beine wegen, und winters wie sommers, bei Hagel oder Hitze konnte ihn nichts dazu bewegen, je wieder das Haus zu betreten.
Jetzt saß sie da, die Frau mit der Geistesgegenwart, einen vor Schmerzen wildwütigen Hund wiederherzustellen, wackelte mit den gekreuzten Knöcheln und schaute weg vom Körper ihrer eigenen Tochter. Als könnte kein Blick dessen Umfang ertragen. Und weder sie noch der Mann hatten Schuhe an. Erhitzt und verlegen fühlte sich Denver jetzt auch allein. So viel Abschied: erst ihre Brüder, dann ihre Großmutter – schwere Verluste, zumal es ja auch keine Kinder gab, die im Spiel einen Kreis um sie bilden oder kopfüber von der Brüstung ihrer Veranda baumeln wollten. Aber nichts davon hatte eine Rolle gespielt, solange ihre Mutter nicht so weggeschaut hatte, wie sie es gerade tat, sodass Denver sich sehnte, regelrecht sehnte nach einem Zeichen von Bosheit seitens des Gespensterkinds.
«Ansehnliche junge Dame ist sie», sagte Paul D. «Sehr ansehnlich. Und mit der sanften Miene von ihrem Daddy.»
«Sie kennen meinen Vater?»
«Früher. Früher hab ich ihn gut gekannt.»
«Stimmt das, Ma’am?» Denver kämpfte den Drang nieder, ihre Zuneigung völlig neu zu verteilen.
«Aber sicher kannte er deinen Daddy. Ich sag dir doch, er ist aus Sweet Home.»
Denver setzte sich auf die unterste Stufe. Sonst konnte sie nirgends mit Anstand hin. Sie bildeten eine Einheit, diese zwei, sagten «dein Daddy» und «Sweet Home» auf eine Art, die klarmachte, dass beides ihnen gehörte und nicht ihr. Das Fehlen ihres Vaters war nicht ihres. Erst hatte sein Fehlen Grandma Baby gehört – ein Sohn, tief betrauert, weil er es war, der sie da rausgekauft hatte. Dann war er der fehlende Mann ihrer Mutter. Und jetzt war er der fehlende Freund dieses haselnussbraunen Fremden. Nur die, die ihn kannten («gut gekannt hatten») durften sein Fehlen für sich beanspruchen. So wie nur die, die auf Sweet Home gelebt hatten, sich daran erinnern durften, den Namen flüstern und dabei wissende Blicke tauschen. Wieder wünschte sie sich das Gespensterkind herbei – jetzt entzückte sie sein Zorn, der sie früher nur zermürbt hatte. So zermürbt.
«Wir haben hier ein Gespenst», sagte sie, und es klappte. Jetzt waren sie keine Einheit mehr. Ihre Mutter hörte auf, mit den Füßen zu wackeln, und spielte nicht mehr junges Mädchen. Und das Erinnern an Sweet Home wich aus den Augen des Mannes, für den sie das junge Mädchen gespielt hatte. Rasch schaute er die blitzweiße Treppe hinter ihr hinauf.
«Hab ich schon gehört», sagte er. «Aber ein trauriges, sagt deine Mama. Kein böses.»
«Nein, Sir», sagte Denver, «böse nicht. Aber auch nicht traurig.»
«Sondern?»
«Gescholten. Einsam und gescholten.»
«Ist das so?» Paul D wandte sich wieder Sethe zu.
«Einsam, ich weiß ja nicht», sagte Denvers Mutter. «Wütend, das kann sein, aber ich wüsste nicht, wie es einsam sein sollte, wo es doch jede Minute mit uns verbringt.»
«Dann habt ihr wohl was, das es möchte.»
Sethe zuckte die Achseln. «Ist ja nur ein kleines Kind.»
«Meine Schwester», sagte Denver. «Sie ist hier im Haus gestorben.»
Paul D kratzte sich die Stoppeln unterm Kinn. «Erinnert mich an die kopflose Braut damals, hinter Sweet Home. Weißt du noch, Sethe? Die streifte da regelmäßig durch die Wälder.»
«Wie könnt ich das vergessen? Gruselig …»
«Wie kommt das eigentlich, dass alle, die aus Sweet Home weggelaufen sind, dauernd darüber reden? Wenn’s wirklich so ein süßes Zuhause war, dann hättet ihr doch auch bleiben können.»
«Was redest du denn da, Kind?»
Paul D musste lachen. «Stimmt schon. Sie hat ja recht, Sethe. Süß war dort nichts, und es war auch kein Zuhause.» Er schüttelte den Kopf.
«Aber wir waren nun mal da», sagte Sethe. «Alle zusammen. Das kommt immer wieder, auch wenn wir’s gar nicht wollen.» Sie schauderte leicht. Ein kleines Kräuseln der Haut an ihrem Arm, das sie liebevoll wieder in den Schlaf streichelte. «Denver», sagte sie, «feuer den Ofen an. Wenn ein Freund vorbeischaut, muss man ihm zu essen geben.»
«Mach mal kein Aufhebens wegen mir», sagte Paul D.
«Brot ist kein Aufhebens. Sonst hab ich alles von der Arbeit mitgebracht. Wenn ich schon von früh bis mittags koche, kann ich auch Essen mit nach Hause nehmen. Hast du was gegen Hecht?»
«Wenn der nichts gegen mich hat, hab ich auch nichts gegen ihn.»
Geht das schon wieder los, dachte Denver. Mit dem Rücken zu ihnen stieß sie die Scheite um, dass das Feuer fast ausging. «Bleiben Sie doch bis morgen früh, Mr. Garner. Dann können Sie die ganze Nacht mit Ma’am über Sweet Home reden.»
Sethe war mit zwei schnellen Schritten am Herd, bevor sie Denver aber am Kragen packen konnte, sackte das Mädchen zusammen und fing an zu weinen.
«Was ist bloß los mit dir? Ich hab noch nie erlebt, dass du dich derart aufführst.»
«Lass sie doch», sagte Paul D. «Für sie bin ich ein Fremder.»
«Das ist es ja. Bei Fremden hat sie keinen Grund, sich so aufzuführen. Was hast du denn, baby? Ist was passiert?»
Aber Denver schlotterte und schluchzte jetzt und bekam kein Wort heraus. Die Tränen, die sie neun Jahre lang zurückgehalten hatte, machten ihr die viel zu fraulichen Brüste nass.
«Ich kann’s nicht mehr. Ich kann’s nicht mehr.»
«Was denn? Was kannst du nicht mehr?»
«Hier leben. Ich weiß nicht, wo ich hin und was ich machen soll, aber hier kann ich nicht mehr leben. Niemand redet mit uns. Niemand kommt vorbei. Die Jungs mögen mich nicht. Und die Mädchen auch nicht.»
«Honey, honey!»
«Wie meint sie das, dass niemand mit euch redet?», fragte Paul D.
«Das liegt am Haus. Die Leute wollen nicht …»
«Nein! Das liegt nicht am Haus! Es liegt an uns! An dir!»
«Denver!»
«Lass sie, Sethe. Fürn junges Mädchen ist es eben schwer, in einem Spukhaus zu leben. Leicht kann das auch nicht sein.»
«Leichter als manch anderes.»
«Überleg doch mal, Sethe. Ich bin ein erwachsener Mann, für den’s nichts Neues mehr zu sehen und zu erleben gibt, und ich sag dir, leicht ist das nicht. Vielleicht zieht ihr einfach um. Wem gehört denn das Haus?»
Über Denvers Schulter hinweg war Sethes Blick auf ihn wie Schnee. «Was kümmert dich das?»
«Lassen sie euch nicht weg?»
«Nein.»
«Sethe.»
«Kein Umzug. Kein Abschied. Es ist gut so, wie es ist.»
«Du sagst mir, es ist gut, wo das Kind hier halb von Sinnen ist?»
Im Haus wappnete sich etwas, und Sethe sprach hinein in die lauschende Stille.
«Ich habe einen Baum auf dem Rücken und einen Spuk im Haus und dazwischen nichts als die Tochter hier in meinen Armen. Weggelaufen wird nicht mehr – vor gar nichts. Nie wieder lauf ich hier auf dieser Welt vor etwas weg. Eine Reise, die hab ich gemacht und meinen Preis dafür bezahlt, aber ich sag dir, Paul D Garner: Der war zu hoch! Hast du gehört? Der Preis war zu hoch. Und jetzt setz dich hin und iss mit uns oder lass es bleiben.»
Paul D angelte einen kleinen Tabakbeutel aus seiner Jacke – war ganz gebannt von dessen Inhalt und den verknoteten Schnüren, während Sethe Denver in die Kammer führte, die von dem großen Zimmer wegging, in dem er saß. Er hatte kein Zigarettenpapier, und so befingerte er den Beutel und hörte durch die offene Tür zu, wie Sethe ihre Tochter beruhigte. Als sie zurückkam, mied sie seinen Blick und ging direkt zu einem kleinen Tisch am Ofen. Sie wandte ihm den Rücken zu, und er konnte Haare sehen, so viel er wollte, ohne dass ihr Gesicht ihn ablenkte.
«Was für nen Baum hast du denn auf dem Rücken?»
«Hm.» Sethe stellte eine Schüssel auf das Tischchen und griff zum Mehl darunter.
«Was für nen Baum hast du auf dem Rücken? Wächst dir was auf dem Rücken? Ich seh da nichts auf deinem Rücken wachsen.»
«Ist aber trotzdem da.»
«Wer hat dir das erzählt?»
«Die Weiße. Sie hat’s so genannt. Ich hab das nie gesehen und werd’s wohl auch nie. Aber sie hat gesagt, so sieht das aus. Wie ein Traubenkirschbaum. Mit Stamm und Ästen, sogar mit Blättern. Winzig kleine Traubenkirschblätter. Aber das war vor achtzehn Jahren. Jetzt sind vielleicht auch Früchte dran, was weiß denn ich.»
Mit dem Zeigefinger nahm Sethe etwas Spucke von ihrer Zungenspitze. Rasch und leicht fasste sie an den Ofen. Dann glitt sie mit den Fingern durch das Mehl, teilte es, trennte kleine Hügel und Firste ab, schaute nach Milben. Als sie keine fand, schüttete sie sich Salz und Natron in die hohle Hand und warf beides in das Mehl. Dann griff sie in einen Kanister und hob eine Handvoll Schmalz heraus. Geschickt knetete sie es ins Mehl, sprenkelte mit der Linken Wasser darüber und formte den Teig.
«Ich hatte Milch», sagte sie. «Ich war schwanger mit Denver, aber ich hatte auch Milch für mein kleines Mädchen. Hab sie ja noch gestillt, als ich sie mit Howard und Buglar vorausgeschickt habe.»
Sie rollte den Teig jetzt mit dem Nudelholz aus. «Jeder roch mich schon lange, bevor er mich sah. Und sah er mich dann, sah er auch die Flecken vorn an meinem Kleid. Da konnt ich gar nichts gegen machen. Ich wusste nur, ich muss mit meiner Milch zu meiner Kleinen. Niemand würde sie stillen, so wie ich. Niemand wär so schnell damit bei ihr und nähme sie ihr wieder weg, wenn sie satt wäre und das selbst nicht merken würde. Niemand wüsste, dass sie nicht aufstoßen kann, wenn man sie an die Schulter nimmt, nur, wenn sie auf meinen Knien liegt. Das wusste ja niemand außer mir, und niemand außer mir hatte die Milch für sie. Das hab ich den Frauen auf dem Wagen auch gesagt. Gesagt hab ich ihnen, sie sollen ein Tuch mit Zuckerwasser tränken, damit sie daran nuckeln kann und mich, wenn ich auch käme in ein paar Tagen, nicht gleich vergessen hätte. Dann wär die Milch wieder da und ich mit ihr.»
«Männer wissen ja nicht viel», sagte Paul D und schob den Beutel zurück in die Jackentasche, «aber sie wissen schon, dass ein Säugling nicht lange weg sein kann von seiner Mutter.»
«Dann wissen sie auch, wie es ist, die eigenen Kinder wegzuschicken, wenn die Brüste voll sind.»
«Wir hatten von nem Baum geredet, Sethe.»
«Als ich von dir weg bin, sind diese Kerle reingekommen und haben mir die Milch genommen. Nur dafür sind sie da rein. Sie haben mich festgehalten und sie mir genommen. Ich hab’s dann Mrs. Garner erzählt. Sie hatte ja diesen Knoten und konnte nicht mehr sprechen, aber aus ihren Augen kamen Tränen. Die Kerle haben rausgefunden, dass ich sie verpfiffen hatte. Den einen hat Schoolteacher auf meinen Rücken losgelassen, und als der dann wieder zuging, wurde ein Baum daraus. Der wächst da immer noch.»
«Sie haben dir die Peitsche übergezogen?»
«Und mir die Milch genommen.»
«Du warst schwanger, und sie haben dich ausgepeitscht?»
«Und mir die Milch genommen!»
Die dicken weißen Teigkreise lagen aufgereiht in der Pfanne. Noch einmal hielt Sethe den feuchten Zeigefinger an den Ofen. Sie öffnete das Rohr und schob die Pfanne mit den Biscuits hinein. Als sie wieder hochkam, fort von der Hitze, spürte sie hinter sich Paul D und seine Hände unter ihren Brüsten. Sie richtete sich auf und wusste, konnte es nur nicht fühlen, dass er die Wange in die Zweige ihres Traubenkirschbaums drückte.
Ganz ohne sein Zutun war er die Art von Mann geworden, der in ein Haus trat und die Frauen dort zum Weinen brachte. Weil sie es konnten, bei ihm, in seiner Gegenwart. In seinem Wesen lag etwas Begnadetes. Die Frauen sahen ihn an und wollten weinen – ihm sagen, wie sehr es in ihrer Brust schmerzte und auch in den Knien. Starke Frauen, weise Frauen sahen ihn und erzählten ihm, was sie sonst nur einander erzählten: dass ihr Verlangen weit nach der Lebensmitte plötzlich gewaltig war, gierig und wilder als damals mit fünfzehn, dass sie sich dafür schämten und es sie traurig machte; dass sie sich insgeheim den Tod herbeiwünschten – um davon erlöst zu sein – und der Schlaf ihnen wertvoller war als jeder durchwachte Tag. Junge Mädchen schlichen sich zu ihm, um ihm zu beichten oder zu beschreiben, wie gut gekleidet die Erscheinung gewesen war, die ihnen noch immer folgte, direkt ihrem Traum entsprungen. Und auch wenn er nicht begriff, woher das kam, war er doch nicht weiter erstaunt gewesen, als Denvers Tränen ins Ofenfeuer tropften. Auch nicht, dass keine Viertelstunde später ihre Mutter ebenfalls weinte, nachdem sie ihm von der gestohlenen Milch erzählt hatte. Von hinten, zu ihr geneigt, sein ganzer Körper ein liebevoller Bogen, hielt er ihre Brüste in seinen Händen. Er rieb die Wange an ihrem Rücken und lernte so ihren Kummer kennen, seine Wurzeln, den breiten Stamm, die verästelten Zweige. Als er die Finger an die Haken ihres Kleides hob, wusste er, ohne sie zu sehen, ohne auch nur ein Seufzen zu hören, dass die Tränen stetig flossen. Und als das Oberteil des Kleides ihr um die Hüften hing und er das Relief sah, zu dem ihr Rücken geworden war, wie das Liebhaberstück eines Schmieds, zu leidenschaftlich, um es auszustellen, da konnte er nur denken und nicht sagen: «Aw, Lord, girl.» Und er fand keinen Frieden mehr, bis er nicht jede Rinde und jedes Blatt mit dem Mund berührt hatte, wovon Sethe gar nichts spürte, denn die Haut an ihrem Rücken war seit Jahren taub. Sie wusste nur, dass die Verantwortung für ihre Brüste endlich in anderen Händen lag.
Ob wohl, überlegte sie, ein wenig Raum sein würde, ein wenig Zeit, eine Möglichkeit, die Ereignisse aufzuhalten, alles Geschäftige in die Zimmerecken zu verbannen und einfach ein, zwei Minuten so dazustehen, nackt vom Schulterblatt bis zur Taille, vom Gewicht ihrer Brüste befreit, ganz bei der gestohlenen Milch, die sie wieder roch, und dem Genuss des Brotbackens? Vielleicht konnte sie ja dieses eine Mal einfach mitten im Kochen stillhalten – nicht einmal vom Ofen wegtreten – und die Versehrtheit spüren, die eigentlich ihr Rücken spüren sollte. Vertrauen, sich erinnern, weil der letzte der Männer aus Sweet Home da war, um sie aufzufangen, wenn sie darin versank?
Der Ofen ruckelte nicht, als er sich auf die Hitze einstellte. Denver rührte sich nicht im Zimmer nebenan. Das pochende rote Licht war nicht zurückgekehrt, und Paul D hatte seit 1856 nicht mehr gezittert, dafür damals dreiundachtzig Tage am Stück. Weggesperrt und angekettet bebten ihm die Hände so heftig, dass er nicht mehr rauchen, sich nicht einmal mehr richtig kratzen konnte. Jetzt zitterte er wieder, nur waren es diesmal die Beine. Er brauchte einige Zeit, bis ihm klar wurde, dass seine Beine nicht bebten, weil er sich sorgte, sondern wegen der Bodendielen, und dass der knirschende, buckelnde Boden längst nicht alles war. Das ganze Haus kippte. Sethe glitt zu Boden und mühte sich, ihr Kleid wieder hochzuziehen. Und während sie sich, wie um ihr Haus an seinem Platz zu halten, auf alle viere stemmte, stürmte Denver aus der Kammer herein, Angst in den Augen, auf den Lippen aber den Anflug eines Lächelns.
«Verflucht noch mal! Gib Ruhe!», brüllte Paul D im Fallen, nach einem Anker suchend. «Lass dieses Haus in Frieden! Scher dich hier raus, zum Teufel!» Ein Tisch raste auf ihn zu, und er packte ihn am Bein. Irgendwie gelang es ihm, sich schräg, aber aufrecht zu halten, und er fasste den Tisch an zwei Beinen und schlug damit um sich, verwüstete alles, brüllte ein auf das brüllende Haus. «Komm her, wenn du kämpfen willst! Verflucht noch mal! Sie hat auch ohne dich schon genug. Sie hat genug!»
Die Erschütterungen verklangen zum gelegentlichen Schlingern, Paul D aber hörte erst auf, den Tisch zu schwingen, als alles totenstill war. Schwitzend und keuchend lehnte er sich dort an die Wand, wo die Anrichte gewesen war. Sethe kauerte immer noch neben dem Ofen, die geretteten Schuhe an die Brust gedrückt. Alle drei, Sethe, Denver und Paul D, atmeten im selben Rhythmus, wie ein müder Mensch. Und müde war auch ein anderer Atem.
Es war fort. Denver wanderte durch die Stille bis zum Ofen. Sie warf Asche aufs Feuer, zog die Pfanne mit den Biscuits heraus. Der Einmachschrank lag auf dem Rücken, sein Inhalt durcheinander in der Ecke des untersten Fachs. Sie nahm ein Glas heraus, und als sie sich nach einem Teller umsah, fand sie einen halben neben der Tür. Das alles nahm sie mit hinaus auf die Veranda und setzte sich dort auf die Stufen.
Die zwei waren nach oben gegangen. Mit leisen, leichtfüßigen Schritten waren sie die weiße Treppe hinaufgestiegen und hatten sie unten zurückgelassen. Denver löste den Draht oben am Glas, dann den Deckel. Darunter war ein Stück Stoff und darunter wiederum eine dünne Schicht Wachs. Sie entfernte alles und lotste das Kompott auf die eine Hälfte des halben Tellers. Sie nahm sich einen Biscuit, drehte die verkohlte obere Hälfte ab. Von der weichen, weißen Innenseite stieg Dampf empor.
Sie vermisste ihre Brüder. Buglar und Howard mussten jetzt zweiundzwanzig und dreiundzwanzig sein. Und obwohl sie während der Ruhezeiten sehr höflich zu ihr gewesen waren und ihr die ganze obere Betthälfte überließen, wusste sie doch noch, wie es vorher gewesen war: wie viel Freude sie hatten, wenn sie dicht aneinandergedrängt auf der weißen Treppe saßen – sie zwischen Howards oder Buglars Knien – und sich Hexengeschichten ausdachten, mit den bewährten Methoden, ihr den Garaus zu machen. Und Baby Suggs, die ihr in der Kammer so viel erzählte. Tagsüber roch sie wie Baumrinde und nachts wie die Blätter, denn Denver wollte nicht mehr in ihrem alten Zimmer schlafen, nachdem ihre Brüder fortgelaufen waren.
Jetzt war ihre Mutter oben mit dem Mann, der die einzige Gesellschaft verscheucht hatte, die ihr noch blieb. Denver tauchte ein Stück Brot ins Kompott. Langsam, gründlich und unglücklich aß sie es auf.
Ohne große Eile, aber auch ohne Zeit zu verlieren, stiegen Sethe und Paul D die weiße Treppe hinauf. Vom schieren Glück, ihr Haus gefunden zu haben und sie darin, ebenso überwältigt wie von der Gewissheit, gleich mit ihr zu schlafen, ließ Paul D fünfundzwanzig Jahre seiner jüngeren Erinnerung fahren. Eine Stufe vor ihm ging der Ersatz für Baby Suggs, das Mädchen, die Neue, von der sie nachts geträumt, wegen der sie im Morgengrauen Kühe gefickt hatten, während sie darauf warteten, dass sie ihre Wahl traf. Als er die schmiedeeiserne Skulptur an ihrem Rücken küsste, hatte bloß das schon das Haus ins Wanken gebracht, ihm abverlangt, alles kurz und klein zu schlagen. Nun würde er mehr tun.
Sie führte ihn die Treppe ganz hinauf, wo das Licht direkt aus dem Himmel kam, denn im oberen Stockwerk waren die Fenster nicht an den Wänden, sondern ins Giebeldach des Hauses eingelassen. Zwei Zimmer gab es dort, und sie nahm ihn mit in eines und hoffte, dass es ihn nicht stören würde, wie unvorbereitet sie war; dass sie zwar noch wusste, was Verlangen war, aber nicht mehr, wie das alles ging, das hilflose Fassenwollen, das in den Händen wohnte, wie blind man plötzlich wurde, bis nur noch jeder Ort ins Auge sprang, der zum Hinlegen einlud, und alles andere – Türgriffe, Träger, Haken, die Traurigkeit, die in den Ecken kauerte, und die verstreichende Zeit – bloß störte.
Sie schafften es kaum aus den Kleidern, da war es schon wieder vorbei. Halb angezogen und außer Atem lagen sie Seite an Seite und grollten einander und dem Oberlicht im Dach. Er hatte zu lange von ihr geträumt, vor zu langer Zeit. Sie krankte daran, selbst nie geträumt zu haben. Jetzt tat es beiden leid, und sie waren zu verlegen zum Reden.
Sethe lag auf dem Rücken, den Kopf von ihm weggedreht. Aus dem Augenwinkel sah Paul D ihre Brüste wogen, und sie missfielen ihm, diese ausufernden, platten Wölbungen, auf die er wahrhaftig verzichten konnte, auch wenn er sie unten noch umfasst gehalten hatte wie den kostbarsten Teil seiner selbst. Und das schmiedeeiserne Labyrinth, das er in der Küche noch erforscht hatte, so wie ein Goldsucher sich durch die Erde wühlt, war bloß noch ein widerwärtiger Klumpen Narben. Kein Baum, wie sie behauptete. Die Form mochte er vielleicht haben, sonst aber hatte er nichts mit irgendeinem Baum gemein, den Paul D kannte, denn Bäume waren einladende Wesen; man konnte ihnen vertrauen und ihnen nahe sein, mit ihnen reden, wenn man das wollte, so, wie er es häufig tat, schon seit der Zeit, als er noch auf den Feldern von Sweet Home sein Mittagessen verzehrte. Immer am selben Platz, wenn’s irgend ging, und sich diesen Platz auszusuchen war gar nicht leicht gefallen, denn Sweet Home hatte viel mehr schöne Bäume als alle umliegenden Farmen. Den erwählten nannte er Brother und setzte sich immer darunter, manchmal allein, manchmal mit Halle oder den anderen Pauls, häufiger aber mit Sixo, der damals noch ein sanfter Mensch war und Englisch redete. Indigoschwarz, mit feuerroter Zunge, probierte Sixo mit über Nacht gegarten Kartoffeln herum, wollte herausfinden, wann genau er die glühheißen Steine ins Loch füllen, die Kartoffeln darauf legen und das Ganze dann mit Zweigen abdecken musste, damit, wenn sie ihre Essenspause begonnen und die Tiere abgespannt hatten, das Feld verließen und zu Brother kamen, die Kartoffeln gerade den Gipfel der Vollkommenheit erreicht hatten. Mitunter stand er mitten in der Nacht auf, ging den ganzen Weg dorthin und baute den Erdofen bei Sternenlicht, oder er ließ die Steine nicht ganz so heiß werden und legte die Kartoffeln für den nächsten Tag gleich nach dem Essen darauf. Ganz gelang es ihm nie, trotzdem aßen sie seine halbgaren, verkochten, schrumpeligen oder noch rohen Kartoffeln, sie lachten, spuckten aus und gaben ihm gute Ratschläge.
Natürlich konnte es ihm gar nicht gelingen, denn die Zeit verging niemals so, wie Sixo glaubte. Einmal plante er einen Weg von dreißig Meilen bis auf die Minute genau, um eine Frau zu treffen. Samstags, als der Mond genau da stand, wo er ihn haben wollte, ging er los, erreichte ihre Hütte am Sonntag, kurz vor der Messe, und hatte gerade noch Zeit, ihr Guten Morgen zu sagen, dann musste er sich schon wieder auf den Rückweg machen, um am Montagmorgen rechtzeitig auf dem Feld zu sein. Siebzehn Stunden lang war er gelaufen, hatte sich für eine Stunde hingesetzt, dann wieder umgedreht und war noch einmal siebzehn Stunden gelaufen. Halle und die Pauls hatten den ganzen Tag damit zu tun, Sixos Erschöpfung vor Mr. Garner zu verbergen. An dem Tag aßen sie keine Kartoffeln, weder die süßen noch die weißen. Beim Essen schlief Sixo wie ein Toter, lang hingestreckt neben Brother, die feuerrote Zunge verborgen, das indigoschwarze Gesicht ganz verschlossen. Das war mal ein Mann gewesen, das war mal ein Baum. Er hier in diesem Bett und der «Baum» da neben ihm waren ein müder Abklatsch.