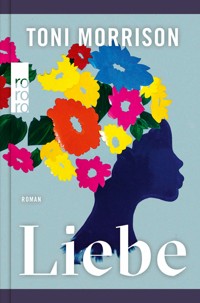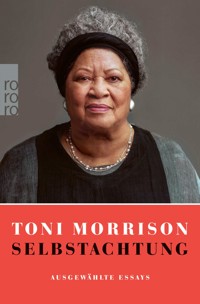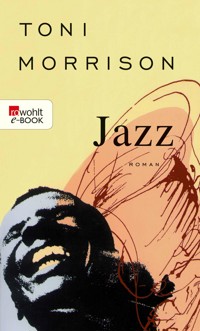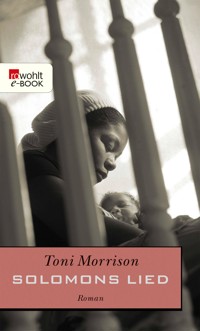14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwei Mädchen, die zu Frauen heranwachsen. Zwei Freundinnen, die zu schlimmsten Feindinnen werden: Die fügsame Nel und die Rebellin Sula sind als junge Mädchen unzertrennlich, als sie in ärmlichen Verhältnissen in einer Kleinstadt in Ohio aufwachsen, die ausgerechnet «Bottom» heißt. Während Nel dort eine Familie gründet, flieht Sula zu den fortschrittlichen Idealen der Großstadt. Als sie nach zehn Jahren zurückkehrt, hat sich zwischen den beiden alles verändert. Nel und Sula müssen sich mit den Folgen ihres Handelns und dem schrecklichen Geheimnis aus ihrer Kindheit auseinandersetzen. Erschreckend, komisch und tragisch – «Sula» ist ein Buch voller Liebe und Leben, Freundschaft und Verrat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 255
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Toni Morrison
Sula
Roman
Überarbeitet und sprachlich aktualisiert von Mirjam Nuenning
Über dieses Buch
Für mich war Sula immer durch und durch Schwarz, eine Schwarze der Neuen Welt, eine Frau der Neuen Welt, die Aussichtslosigkeit in Aussicht verwandelt und auf Gefundenes mit Erfindungsreichtum reagiert. Die improvisiert. Die wagemutig, zerstörend, einfallsreich, modern, selbstständig, ausgestoßen, nicht herrschend und nicht beherrschbar ist. Eine gefährliche Frau. Eine Frau, die eine Wahl hat. Toni Morrison
Vita
Toni Morrison wurde 1931 in Lorain, Ohio, geboren. Sie studierte an der renommierten Cornell University Anglistik und hatte an der Princeton University eine Professur für afroamerikanische Literatur inne. Zu ihren bedeutendsten Werken zählen «Sehr blaue Augen», «Solomons Lied», «Menschenkind», «Jazz», «Paradies» und diverse Essaysammlungen. Sie war Mitglied des National Council on the Arts und der American Academy of Arts and Letters. Ausgezeichnet mit zahlreichen Preisen, u. a. mit dem National Book Critics Circle Award und dem American Academy of Arts and Letters Award für Erzählliteratur. 1993 erhielt sie den Nobelpreis für Literatur, und 2012 zeichnete Barack Obama sie mit der Presidential Medal of Freedom aus. Toni Morrison starb am 5. August 2019.
Impressum
Die amerikanische Originalausgabe erschien 1974 unter dem Titel «Sula» als Borzoi Book im Verlag Alfred A. Knopf, Inc., New York.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Januar 2024
Copyright © 1980, 1984, 2004 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«Sula» Copyright © 1974 by Toni Morrison
Übersetzung des Vorworts Mirjam Nuenning
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung Tracy Murrell
ISBN 978-3-644-01865-5
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Es ist ein reiner Glücksfall, wenn uns jemand fehlt, lange bevor er uns verlässt.
Dieses Buch ist für Ford und Slade, die mir fehlen, obwohl sie mich nicht verlassen haben.
Nobody knew my rose of the world
but me … I had too much glory.
They don’t want glory like that
in nobody’s heart.
The Rose Tattoo
Vorwort
In den fünfziger Jahren, als ich Studentin war, war der Ruf, als politische Autorin zu gelten, mit so viel Scham behaftet, die Angst vor spöttischer Kritik, die die literarische Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Verhältnissen nach sich ziehen würde, so groß, dass ich mich fragte: Warum diese Panik? Die Flucht vor dem Vorwurf, schreibend ein politisches Bewusstsein zu zeigen, lenkte meine Aufmerksamkeit auf die Quelle dieser Panik und die Mittel, mit denen Schriftsteller*innen sie zu lindern versuchten. Was konnte so schlimm daran sein, in der Literatur einen wachen Blick auf die Gesellschaft und politisches Bewusstsein zu zeigen? Der landläufigen Meinung nach kann politische Literatur keine Kunst sein; solche Werke hätten weniger ästhetischen Wert, da Politik – in jeder Form – eine Agenda verfolge und somit den ästhetischen Schaffensprozess verunreinige.
Diese Weisheit, die Chaucer, Dante, Catullus, Sophokles, Shakespeare oder Dickens offenbar nicht besaßen, begleitet uns bis heute und belastete im Jahr 1969 afroamerikanische Schriftsteller*innen besonders stark. Ganz gleich, ob sie an Politik jeglicher Art völlig uninteressiert waren oder ob sie politisch motiviert, bewusst oder aggressiv waren, die Tatsache, dass sie oder ihre Figuren Schwarz waren, verdammte sie zu einer «rein politischen» Bewertung der Relevanz ihrer Werke. Wenn Phillis Wheatley «Der Himmel ist blau» schrieb, war die zentrale Frage, was ein blauer Himmel für eine Schwarze Sklavin bedeuten könne. Wenn Jean Toomer «Das Eisen ist heiß» schrieb, wurde gefragt, wie genau oder unzureichend er die Fesseln der Versklavung ausdrückte. Diese Bürde lastete nicht nur auf den Kritiker*innen, sondern auch auf den Leser*innen. Wie positionieren sich Leser*innen, unabhängig von ihrer Herkunft, um sich der Welt einer Schwarzen Autorin oder eines Schwarzen Autors anzunähern? Schwingt beim Lesen nicht immer ein gewisses Unbehagen mit, was über sie selbst offenbart oder entlarvt werden könnte?
Als ich 1970 Sula zu schreiben begann, hatte ich bereits die deprimierende Erfahrung gemacht, Rezensionen meines ersten Romans, «Sehr blaue Augen», von Schwarzen und weißen Kritiker*innen zu lesen, die – mit zwei Ausnahmen – wenig aussagekräftig waren, da die Bewertung gerade die Kriterien der «reinen Ästhetik», für die sie plädierten, ignorierten. Wenn der Roman für gut befunden wurde, dann deshalb, weil er einer bestimmten politischen Haltung treu war; wurde er für schlecht befunden, dann deshalb, weil er dieser Haltung nicht treu war. Die Beurteilung basierte darauf, ob «Schwarze Menschen so sind – oder nicht». Dieses Mal revanchierte ich mich für das Kompliment, ignorierte die Oberflächlichkeit derartiger Einschätzungen und verwurzelte die Erzählung erneut in einer Landschaft, die bereits durch ihre bloße Existenz befleckt ist. Nur wenige Menschen, so glaubte ich, würden an einem breiteren Ansatz interessiert sein – weniger als die winzige Fraktion der fünfzehnhundert, die das erste Buch gekauft hatte. Doch der Akt des Schreibens war mir persönlich zu wichtig, um ihn aufzugeben, nur weil die Aussichten, ernst genommen zu werden, düster waren. Es mag heute schwer vorstellbar sein, wie es sich anfühlte, als Problem betrachtet zu werden, das es zu lösen, anstatt als Autorin, die es zu lesen galt. James Baldwin, Ralph Ellison, Richard Wright, Zora Neale Hurston – sie alle waren gebeten worden, einen Essay zu schreiben über das «Problem», ein*e «Schwarze*r» Autor*in zu sein. In dieser Situation, in der ich es niemandem recht machen konnte – diejenigen, die eine politisch repräsentative Leinwand suchten, würden meine Texte für nicht authentisch, ja sogar unverantwortlich halten; diejenigen, die den Wert danach beurteilten, wie «moralisch» meine Figuren waren, würden mich herabsetzen –, blieb mir nur die Treue zu meinem eigenen Empfinden. Die weitere Erforschung meiner Interessen, Fragen und Herausforderungen. Und da mein Empfinden hochpolitisch und leidenschaftlich ästhetisch war, würde es meine Arbeit kompromisslos beeinflussen. Ich weigerte mich, das «Problem» als irgendetwas anderes zu erklären oder anzuerkennen als ein künstlerisches Problem. Andere Fragen waren wichtiger. Wie sieht Freundschaft zwischen Frauen aus, wenn sie nicht von Männern beeinflusst wird? Welche Möglichkeiten stehen Schwarzen Frauen zur Verfügung, die von ihrer eigenen Community nicht akzeptiert werden? Welche Risiken birgt Individualismus in einer dezidiert individualistischen, aber in Bezug auf Race homogenen und sozial stagnierenden Gemeinschaft?
Weibliche Freiheit bedeutet immer sexuelle Freiheit, selbst wenn – oder gerade wenn – sie durch das Prisma der wirtschaftlichen Freiheit betrachtet wird. Die sexuelle Freiheit von Hannah Peace war mein Einstieg in die Geschichte, konstruiert aus Erinnerungsfetzen daran, wie die Frauen bei uns eine bestimmte Art von Frau betrachteten – Neid, gepaart mit amüsierter Billigung. Ihren eher bescheidenen Ansprüchen auf persönliche Freiheit stehen konventionelle und anarchische gegenüber: Eva opfert ihren Körper für ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit; Nel passt sich an, um den Schutz der Ehe zu erlangen; Sula verweigert sich sowohl der Aufopferung als auch der Anpassung. Hannahs Ansprüche werden von der Gemeinschaft akzeptiert, da sie nicht finanzieller Art und nicht bedrohlich sind; sie stört und vermindert die Ressourcen der Familie nicht. Da sie von Eva, einer anderen Frau, abhängig ist, die sowohl Geld als auch Autorität besitzt, konkurriert sie mit niemandem. Sula hingegen, obwohl sie nichts so Schreckliches tut wie Eva, wird von den Menschen in der Stadt nicht nur als Konkurrenz, sondern auch als auch vereinnahmend und böse gesehen. Nel, mit ihren bescheidenen Ansprüchen, ist der verhaltene Maßstab.
Hannah, Nel, Eva und Sula waren Punkte eines Kreuzes – jede von ihnen die Wahl einer Figur, die durch Geschlecht und Race gebunden ist. Der Nexus dieses Kreuzes wäre eine schwer zu erreichende Verbindung von Verantwortung und Freiheit, ein Kampf unter Frauen, von denen angenommen wird, dass sie am wenigsten in der Lage sind, ihn zu gewinnen. Um die Arme des Kreuzes wickelten sich Drähte anderer Kämpfe – der Kriegsveteran, die Waisen, der Ehemann, die Arbeiter, sie alle werden von denselben Mächten, die den Kampf angeordnet haben, in einem Dorf gefangen gehalten. Und der einzige mögliche Triumph liegt in der Vorstellungskraft.
Meine Aufgabe bestand natürlich darin, diese Wahrnehmungen in einer Sprache heraufzubeschwören, die sie zu vermitteln vermag. Sula forderte mich heraus, Sprache zu manipulieren, glaubwürdig und möglicherweise sogar elegant mit einem diskreditierten Wortschatz zu arbeiten. Die Sprache der Menschen, ihren Dialekt, auf eine Art zu verwenden, die weder exotistisch noch komisch wirkt, weder minstrelartig noch mikroskopisch analysierend. Ich wollte die politischen, kulturellen und künstlerischen Urteile, die afroamerikanischen Schriftsteller*innen auferlegt werden, umlenken und neu definieren.
Während ich Sula schrieb, lebte ich in Queens, pendelte zu einem Bürojob in Manhattan, ließ meine Kinder im Herbst und Winter von Tagesmüttern und dem Schulsystem betreuen und im Sommer von meinen Eltern, und war so knapp bei Kasse, dass der lähmende Stress meiner Lage mich in Heiterkeit ausbrechen ließ. Jede Mietzahlung war ein Ereignis; jeder Einkauf ein Triumph der Vorsicht über den leichtsinnigen Kauf eines Grundnahrungsmittels. Das Beste daran war, dass so das Leben aller anderen alleinerziehenden/getrennt lebenden weiblichen Elternteile aussah, die ich kannte. Was haben wir nicht alles ausgetauscht! Zeit, Essen, Geld, Kleidung, Lachen, Erinnerungen – und Kühnheit. Vor allem aber Kühnheit, denn in den späten Sechzigern, als so viele tot oder inhaftiert waren oder zum Schweigen gebracht wurden, gab es kein Zurück mehr, einfach weil es kein «Zurück» gab. Wir befanden uns in einem frei schwebenden Zustand, konnten uns Dinge ausdenken, Dinge ausprobieren, auf Erkundung gehen. Das Bekannte und Bewährte nutzen und das Unbekannte erforschen. Ein Stück schreiben, eine Theatergruppe gründen, Kleidung entwerfen, Bücher schreiben, unbelastet von den Erwartungen anderer Leute. Niemand schenkte uns Aufmerksamkeit, also schenkten wir uns selbst Aufmerksamkeit. In dieser Atmosphäre des «Was würdest du tun oder denken, wenn es keinen Blick oder keine Hand gäbe, die dich aufhält?» begann ich darüber nachzudenken, wie diese Art von Selbstermächtigung für Schwarze Frauen vierzig Jahre zuvor ausgesehen haben könnte. Wir wurden ermutigt, uns selbst als unsere eigene Rettung zu betrachten, unsere eigenen besten Freundinnen zu sein. Was könnte das 1969 bedeuten, was es in den 1920er Jahren nicht bedeutet hatte? Das Bild einer Frau, die einerseits beneidet und vor der andererseits gewarnt wird, kam mir in den Sinn.
An anderer Stelle (in meinem Essay Das unausgesprochene Unaussprechliche) habe ich meine Gedanken zur Entwicklung der Struktur von Sula erläutert. «Ursprünglich begann Sula mit dem Satz ‹Mit Ausnahme des Zweiten Weltkriegs störte nichts je den Nationalen Selbstmordtag›. Nach einiger Ermunterung erkannte ich, dass dieser Satz ein falscher Anfang war.»[1] Falsch bedeutet in diesem Fall abrupt. Es gab keinen Raum, in den die Leser*innen hätten eintreten können, bevor sie in die Welt der Figuren eingeführt wurden. Wie ich in dem Essay schrieb: «Die Schwelle zwischen den Leser*innen und dem auf Schwarzen Themen basierenden Text muss nicht die der einladenden, sicheren Lobby sein, die dieser Roman, wie ich mir damals einredete, zu brauchen schien. Ich hätte diese Lobby am liebsten zerstört. Von all meinen Büchern hat nur Sula diesen ‹Zugang›. Die anderen verweigern sich einer ‹Präsentation›; sie verweigern sich der Verführung eines sicheren Hafens; der Demarkationslinie zwischen (…) ihnen und uns. Im Grunde weigern sie sich, den heruntergeschraubten Erwartungen der Leser*innen zu entsprechen oder sie in ihrem Unbehagen zu beschwichtigen, das durch die emotionale Last verstärkt wird, die sie in den auf Schwarzen Themen basierenden Text tragen. (…) Obwohl der größte Teil des Anfangs, den ich schließlich schrieb, von der Community handelt, zeigt der Blick auf sie keine Innensicht (…), sondern ist der eines Fremden, des ‹Mannes aus dem Tal›, der in dieser Gegend vielleicht etwas zu erledigen hat, der aber offensichtlich nicht dort lebt und für den das alles überaus seltsam, wenn nicht exotisch ist. (…) (In) meinem neuen ersten Satz führe ich Leser*innen von außerhalb in den Kreis ein. Ich übersetze das Anonyme in das Spezifische, mache aus einem ‹Ort› eine ‹Gemeinschaft› und lasse einen Fremden ein, durch dessen Augen das alles betrachtet werden kann.» Diese Fügsamkeit dem «weißen» Blick gegenüber war das einzige Mal, dass ich mich mit dem «Problem» auseinandersetzte.
Hätte ich, wie ursprünglich geplant, mit Shadrack begonnen, hätte ich die sanfte Begrüßung übergangen und die Leser*innen sofort mit seinem verwundeten Geist konfrontiert. Dies hätte die Aufmerksamkeit stärker auf die traumatische Verdrängung gelenkt, die dieser höchst verschwenderische, kapitalistische Krieg für Schwarze Menschen bedeutete, und ihre verzweifelten und verzweifelt kreativen Überlebensstrategien in den Fokus gerückt. In der überarbeiteten Eröffnung habe ich versucht, sowohl die diskriminierende, strafende rassistische Unterdrückung darzustellen als auch die Bemühungen der Community, stabil und gesund zu bleiben: Die Nachbarschaft wurde fast vollständig von kommerziellen Interessen (einem Golfplatz) weggefegt, doch die Überreste dessen, was sie genährt hat (Musik, Tanzen, Handwerk, Religion, Ironie, Esprit) sind das, was der «Mann aus dem Tal», der Fremde, sieht – oder hätte sehen können. Sie bilden eine einladendere Geste der Umarmung als Shadracks geordneter, öffentlicher Wahnsinn – sie helfen, die Nachbarschaft zu vereinen, bis Sulas Anarchie sie herausfordert.
Geächtete Frauen sind faszinierend – nicht immer aufgrund ihres Verhaltens, sondern weil Frauen historisch als von Natur aus störend betrachtet wurden und ihr Status von Geburt an illegal ist, wenn sie sich nicht unter der Herrschaft von Männern befinden. In der Literatur führte die Flucht einer Frau aus der männlichen Herrschaft oft zu Reue, Elend bis hin zur völligen Katastrophe. In Sula wollte ich die möglichen Folgen einer solchen Flucht erforschen, nicht nur für eine konventionelle Schwarze Gesellschaft, sondern auch für die Freundschaft zwischen Frauen. Im Jahr 1969 in Queens schien es verlockend, nach der Freiheit zu greifen. Einige von uns waren erfolgreich; einige starben. Wir alle bekamen einen Vorgeschmack auf sie.
Aus dem Englischen von Mirjam Nuenning
Erster Teil
Wo sie die Nachtschattenstauden und das Brombeergestrüpp herausgerissen haben, um Platz zu schaffen für den Golfplatz von Medallion City, dort standen einst Häuser. Die Siedlung zog sich von den Hügeln oberhalb der Talstadt Medallion bis zum Fluss hinunter. Heute wird die Gegend als Stadtrand bezeichnet, aber als Schwarze Menschen dort lebten, wurde sie «Bottom» genannt. Nur eine einzige Straße, beschattet von Buchen, Eichen, Ahornbäumen und Kastanien, verband ihn mit dem Tal. Die Buchen sind inzwischen verschwunden und ebenso die Birnbäume, in denen Kinder saßen und hinunterschrien durch die Blüten, wenn Leute vorbeigingen. Großzügige Mittel sind bewilligt worden, um die ausgeschlachteten und heruntergekommenen Gebäude, die sich unordentlich an der Straße von Medallion hinauf zum Golfplatz drängen, dem Erdboden gleichzumachen. Sie wollen die Time and a Half Pool Hall abreißen, wo einst Füße in langen gelbbraunen Schuhen von Stuhlsprossen nach unten zeigten. Eine Dampfwalze wird Irenes Kosmetikpalast in Trümmer legen, wo Frauen ihre Köpfe in Waschbecken zurücklehnten und dösten, während Irene ihnen Nu Nile ins Haar rieb. Männer in Khaki-Arbeitsanzügen werden mit dem Brecheisen die Stäbe von Rebas Grill lösen, wo die Besitzerin immer mit dem Hut auf dem Kopf kochte, weil sie sich ohne Hut nicht an die Zutaten erinnern konnte.
Es wird nichts übrig bleiben von Bottom (die Fußgängerbrücke über den Fluss ist schon weg), aber vielleicht ist das nicht weiter schlimm, weil es doch keine richtige Stadt war: nur eine Siedlung, aus der die Leute in den Talhäusern an ruhigen Tagen manchmal Singen, manchmal Banjos hörten, und wenn ein Mann aus dem Tal geschäftlich in den Hügeln dort oben zu tun hatte – Miete oder Versicherungsbeiträge kassieren –, sah er vielleicht eine dunkle Frau in einem geblümten Kleid ein paar Schritte Cakewalk tanzen, ein paar Schritte Blackbottom, ein bisschen «herumschäkern» zu den schwungvollen Klängen einer Mundharmonika. Und ihre nackten Füße wirbelten den safrangelben Staub auf, der herabschwebte auf den Overall und die an den Ballen aufgeplatzten Schuhe des Mannes, der die Musik in seine Mundharmonika hineinatmete und aus ihr heraussog. Die Schwarzen Leute, die ihr zusahen, lachten und rieben sich die Knie, und es konnte leicht geschehen, dass der Mann aus dem Tal das Gelächter hörte und den erwachsenen Schmerz nicht bemerkte, der irgendwo unter den Augenlidern ruhte, irgendwo unter ihren Kopftüchern und unter den weichen Filzhüten, irgendwo in der Handfläche, irgendwo hinter den zerfransten Jackenaufschlägen, irgendwo in der Muskelwölbung. Er hätte einmal hinten in der großen Saint-Matthew-Kirche stehen und sich von der Stimme des Tenors in Seide hüllen lassen müssen oder die Hände der Löffelschnitzer berühren (die seit acht Jahren nicht mehr gearbeitet hatten) und sich von den Fingern, die auf Holz tanzten, die Haut küssen lassen. Sonst nähme er den Schmerz nicht wahr, obwohl doch das Gelächter Teil des Schmerzes war.
Ein schallendes, knieschlagendes, nassäugiges Gelächter, das sogar beschreiben und erklären konnte, wie es kam, dass sie waren, wo sie waren.
Ein Witz. Ein nigger-Witz. So hatte es angefangen. Nicht mit der Stadt natürlich, sondern mit dem Teil der Stadt, wo die Schwarzen lebten, dem Teil, den sie Bottom nannten, obwohl er oben in den Hügeln war. Nur ein nigger-Witz. Von der Art, wie ihn weiße Leute erzählen, wenn die Fabrik zumacht und sie irgendwo nach ein wenig Trost suchen. Von der Art, wie ihn Schwarze Leute über sich selbst erzählen, wenn kein Regen kommt oder wenn es wochenlang regnet und sie irgendwie nach ein wenig Trost suchen.
Ein guter weißer Farmer versprach seinem Sklaven die Freiheit und ein Stück Land im Tal, wenn er einige sehr schwierige Aufgaben verrichten würde. Als der Sklave die Arbeit vollbracht hatte, bat er den Farmer, zu seinem Teil der Abmachung zu stehen. Freiheit war einfach – dagegen hatte der Farmer nichts einzuwenden. Aber er wollte kein Land abgeben. Darum erklärte er dem Sklaven, es tue ihm sehr leid, dass er ihm Talland geben müsse. Er habe gehofft, er könne ihm ein Stück vom Bottom geben. Der Sklave zwinkerte mit den Augen und sagte, er habe gedacht, Talland sei Bottomland. Der Master sagte: «O nein! Siehst du die Hügel dort? Das ist Bottomland, üppig und fruchtbar.»
«Aber es ist hoch oben in den Hügeln», sagte der Sklave.
«Von uns aus ist es hoch oben», sagte der Master. «Aber wenn Gott hinunterschaut, ist es unten, der Boden. Darum nennen wir es so. Es ist der Boden des Himmels – das beste Land, das es gibt.»
Der Sklave bestürmte seinen Herrn, doch zu versuchen, ein Stück für ihn aufzutreiben. Er ziehe es dem Tal vor. Und so geschah es. Der nigger kriegte das Hügelland, wo das Bepflanzen zermürbend war, wo der Boden abrutschte und die Saat mitriss und wo der Wind den ganzen Winter über nicht wich.
Was erklärte, warum weiße Leute den üppigen Talboden bewohnten in jener kleinen Flussstadt in Ohio und die Schwarzen die Hügel über dem Tal besiedelten, wobei es ihnen nur ein schwacher Trost war, dass sie Tag für Tag buchstäblich hinunterschauen konnten auf die Weißen.
Und doch war es wunderschön oben in Bottom. Als die Stadt wuchs und aus dem Ackerland ein Dorf wurde und aus dem Dorf eine Stadt und die Straßen von Medallion heiß und staubig waren vor Fortschritt, waren die ausladenden Bäume, die die Hütten oben in Bottom beschirmten, wunderschön anzusehen. Und die Jäger, die manchmal dort hinaufkamen, fragten sich im Stillen, ob nicht vielleicht der weiße Farmer doch recht gehabt habe. Vielleicht war es der Bottom des Himmels.
Die Schwarzen Leute wären anderer Meinung gewesen, aber sie hatten keine Zeit, darüber nachzudenken. Sie waren viel zu sehr in Anspruch genommen von irdischen Dingen – und voneinander: Sie fragten sich schon 1920, was Shadrack im Schilde führte, was das kleine Mädchen Sula, das in ihrer Stadt zu einer Frau heranwuchs, im Schilde führte, und was sie selbst im Schilde führten, dort oben, versteckt in Bottom.
1919
Mit Ausnahme des Zweiten Weltkriegs hatte nichts je die Feier des Nationalen Selbstmordtages gestört. Seit 1920 fand er an jedem dritten Januar statt, wenn auch Shadrack, sein Gründer, für viele Jahre der Einzige war, der ihn feierte. Von berstenden Geschossen gezeichnet und für alle Zeiten von Staunen erfüllt über die Ereignisse des Jahres 1917, war er nach Medallion zurückgekehrt, gut aussehend, aber gezeichnet, und sogar die herablassendsten Leute in der Stadt ertappten sich manchmal beim Nachsinnen darüber, wie er vor ein paar Jahren gewesen sein mochte, bevor er in den Krieg zog. Als junger Mann von kaum zwanzig, mit nichts im Kopf und dem Geschmack von Lippenstift noch im Mund, sah er sich eines Tages im Dezember 1917 plötzlich mit seinen Kameraden über ein Feld in Frankreich laufen. Es war seine erste Begegnung mit dem Feind, und er wusste nicht, ob seine Kompanie auf den Gegner zu- oder von ihm fortlief. Sie waren mehrere Tage marschiert, immer nahe einem Fluss entlang, der an den Rändern gefroren war. An einer Stelle überquerten sie den Fluss, und er hatte den Fuß kaum auf die andere Seite gesetzt, als der Tag aus den Fugen geriet vor Geschrei und Explosionen. Granatfeuer überall um ihn herum, und obwohl er wusste, dass dies das war, was man es nannte, konnte er nicht die richtige Empfindung aufbringen, die Empfindung, die Raum für es hatte. Er erwartete, entsetzt zu sein oder angeregt – irgendetwas sehr stark zu empfinden. Tatsächlich empfand er nur den stechenden Schmerz von einem Nagel in seinem Stiefel; der Nagel bohrte sich ihm in den Ballen, wann immer er auftrat. Der Tag war so kalt, dass er seinen Atem sehen konnte, und einen Augenblick lang wunderte er sich über die Reinheit und Weiße seines Atems inmitten der schmutzigen, grauen Explosionen. Er rannte mit aufgepflanztem Bajonett tief in dem großen Trupp von Männern, die über das Feld stürmten. Der Schmerz in seinem Fuß ließ ihn zusammenzucken; er wandte den Kopf ein wenig nach rechts und sah das Gesicht eines Soldaten in seiner Nähe in die Luft fliegen. Bevor er Zeit hatte, entsetzt zu sein, verschwand der Rest vom Kopf des Soldaten unter dem einer umgedrehten Suppenterrine ähnlichen Helm. Aber eigensinnig und ohne Anweisungen vom Gehirn entgegenzunehmen, lief der Körper des kopflosen Soldaten weiter, mit Kraft und Anmut und ohne sich im Geringsten um die Gehirnmasse zu kümmern, die ihm den Rücken hinuntertropfte und -rutschte.
Als Shadrack die Augen öffnete, lag er aufgestützt in einem schmalen Bett. Vor ihm, auf einem Tablett, befand sich ein großer, in drei Dreiecke unterteilter Blechteller. In einem Dreieck war Reis, in einem anderen Fleisch, und im dritten waren gedünstete Tomaten. Eine kleine runde Vertiefung fasste eine Tasse mit einer weißlichen Flüssigkeit. Shadrack starrte auf die gedämpften Farben, die diese Dreiecke füllten: das klumpige Weiß der Reiskörner, die zitternden Bluttomaten, das graubraune Fleisch. Das Abstoßende des Ganzen wurde in Schach gehalten von der ordentlichen Ausgewogenheit der Dreiecke – eine Ausgewogenheit, die ihn einlullte, etwas von ihrem Gleichgewicht auf ihn übertrug. Auf diese Weise beruhigt, dass das Weiß, das Rot und das Braun da bleiben würden, wo sie waren – nicht explodieren oder aus ihrem begrenzten Bereich ausbrechen würden –, spürte er plötzlich Hunger und sah sich nach seinen Händen um. Seine Blicke waren zuerst behutsam, denn er musste sehr vorsichtig sein – alles konnte überall sein. Dann entdeckte er zu beiden Seiten seiner Hüften zwei Erhebungen unter der beigefarbenen Decke. Mit äußerster Vorsicht hob er einen Arm und stellte zu seiner Erleichterung fest, dass seine Hand an seinem Handgelenk saß. Er versuchte es mit der anderen Hand und fand auch sie. Langsam führte er eine Hand zur Tasse, und gerade als er im Begriff war, die Finger zu spreizen, fingen sie an, wie eine Wunderbohne wild in alle Richtungen über Tablett und Bett zu wachsen. Mit einem schrillen Schrei schloss er die Augen und stopfte seine wachsenden Riesenhände unter die Decke. Erst einmal außer Sicht, schienen sie wieder auf ihren normalen Umfang zusammenzuschrumpfen. Aber der Schrei hatte einen Pfleger auf die Beine gebracht.
«Private? Wir werden doch heute keine Scherereien machen, oder? Oder, Private?»
Shadrack sah auf zu einem Mann mit beginnender Glatze, der mit grüner Baumwolljacke und -hose bekleidet war. Sein Haar war tief an der rechten Seite gescheitelt, sodass etwa zwanzig oder dreißig gelbe Haare taktvoll die Nacktheit seines Kopfes bedecken konnten.
«Na los. Nehmen Sie den Löffel da in die Hand. Nehmen Sie ihn schon, Private. Keiner wird Sie ewig füttern.»
Schweiß rann Shadrack von den Achselhöhlen über die Seiten. Er könnte es nicht ertragen, seine Hände wieder wachsen zu sehen, und er fürchtete sich vor der Stimme im apfelgrünen Anzug.
«Nehmen Sie ihn in die Hand, hab ich gesagt. Es hat doch keinen Zweck …» Der Pfleger griff unter der Decke nach Shadracks Handgelenk, um die grässliche Hand hervorzuziehen. Shadrack riss sie zurück und warf das Tablett um. In panischem Schrecken erhob er sich auf die Knie und versuchte, seine schrecklichen Finger abzuschütteln und fortzuwerfen, schaffte es aber nur, den Pfleger in das Bett nebenan zu stoßen.
Als sie Shadrack in eine Zwangsjacke steckten, war er sowohl erleichtert als auch dankbar, denn nun waren seine Hände endlich verhüllt und auf den Umfang beschränkt, welcher auch immer es sein mochte, den sie angenommen hatten.
Eingeschnürt und stumm versuchte er in dem schmalen Bett, die Gedankenfetzen, die ihm durch den Kopf gingen, miteinander zu verbinden. Er wünschte sich verzweifelt, sein Gesicht zu sehen und eine Verbindung herzustellen zwischen seinem Gesicht und dem Wort «Private» – so hatte der Pfleger (und die anderen, die halfen, ihn festzubinden) ihn genannt. «Private», glaubte er, sei etwas Geheimes, und er fragte sich, warum sie ihn anschauten und dann ein Geheimnis nannten. Aber wenn seine Hände sich schon so benahmen, wie sie sich benommen hatten – was konnte er da von seinem Gesicht erwarten? Die Angst und das Verlangen waren zu viel für ihn, darum begann er, an andere Dinge zu denken. Das heißt, er ließ seine Gedanken in jeden beliebigen Eingang zu den Höhlen seiner Erinnerung schlüpfen.
Er sah ein Fenster, das auf einen Fluss hinausging, von dem er wusste, dass er voller Fische war. Jemand sprach leise gerade vor der Tür …
Shadracks Gewalttätigkeit und eine Verlautbarung der Krankenhausverwaltung, in der es um die Verteilung von Patienten auf Abteilungen für besonders schwere Fälle ging, fielen zusammen. Es wurde eindeutig Platz gebraucht. Die Dringlichkeit oder die Gewalttätigkeit brachten Shadrack seine Entlassung ein, 217 Dollar in bar, einen kompletten Anzug und einige sehr amtlich aussehende Schreiben.
Als er aus der Krankenhaustür trat, überwältigten ihn die Anlagen: die gestutzten Sträucher, die eingefassten Rasenflächen, die wie mit dem Lineal gezogenen Gehwege. Shadrack schaute auf die Betongeraden: Jede von ihnen führte zielbewusst zu irgendeinem vermutlich wünschenswerten Bestimmungsort. Es gab keine Zäune, keine Verbotstafeln, überhaupt keine Hindernisse zwischen Beton und grünem Gras, man konnte also den ordentlichen Steinstreifen mühelos ignorieren und eine andere Richtung einschlagen – eine selbst gewählte Richtung.
Shadrack stand am Fuße der Treppe zum Krankenhaus und beobachtete, wie die Kronen der Bäume hin und her schwankten, wehmütig, aber harmlos, weil ihre Stämme zu tief im Boden verwurzelt waren, als dass sie ihn bedrohen könnten. Nur die Wege beunruhigten ihn. Er verlagerte sein Gewicht und fragte sich, wie er zur Pforte gelangen könne, ohne den Beton zu betreten. Während er seinen Weg plante – wo er einen Sprung machen müsste, wo eine Gruppe von Büschen umgehen –, schreckte ihn plötzlich ein schallendes Gelächter auf. Zwei Männer gingen die Treppen hinauf. Und dann stellte er fest, dass viele Menschen in seiner Nähe waren und dass er sie erst jetzt sah oder aber dass sie erst eben Gestalt angenommen hatten. Es waren schmächtige Figürchen, wie Ausschneidepuppen, die die Wege hinunterschwebten. Einige saßen in Stühlen mit Rädern und wurden von anderen Papierfiguren von hinten geschoben. Alle schienen zu rauchen, und ihre Arme und Beine krümmten sich in der Brise. Ein schöner starker Wind würde sie hoch- und fortblasen, und sie würden vielleicht in den Baumkronen landen.
Shadrack wagte es. Vier Schritte, und er war auf dem Gras, in Richtung Pforte. Er hielt den Kopf gesenkt, weil er es vermeiden wollte, die Papiermenschen hin und her schwanken und sich krümmen zu sehen, und er kam von seinem Weg ab. Als er aufsah, stand er neben einem niedrigen roten Gebäude, das vom Hauptgebäude durch einen überdachten Gehweg getrennt war. Von irgendwo kam ein süßlicher Geruch, der ihn an etwas Peinvolles erinnerte. Er sah sich nach der Pforte um und stellte fest, dass er auf seiner komplizierten Reise über das Gras genau in die entgegengesetzte Richtung gegangen war. Direkt links von dem niedrigen Gebäude befand sich eine mit Kies bestreute Auffahrt, die aus dem Grundstück hinauszuführen schien. Er stapfte rasch auf sie zu und verließ, endlich, einen Ort, der ihm über ein Jahr ein Zufluchtsort gewesen war, eine Zeit, von der er sich nur acht Tage ganz ins Gedächtnis zurückrufen konnte.
Sobald er auf der Straße war, wandte er sich nach Westen. Der lange Aufenthalt im Krankenhaus hatte ihn geschwächt, er war zu schwach, um festen Schrittes auf dem Kiesbankett der Straße zu marschieren. Er schlurfte, wurde schwindelig, blieb stehen, um Atem zu schöpfen, setzte sich wieder in Bewegung, stolpernd und schwitzend, wollte sich aber die Schläfen nicht wischen, weil er sich noch immer davor fürchtete, seine Hände anzuschauen. Insassen von dunklen, eckigen Autos verschlossen die Augen vor dem, was sie für einen betrunkenen Mann hielten.
Die Sonne stand schon direkt über ihm, als er zu einer Stadt kam. Einige wenige Blocks schattiger Straßen, und er war schon im Zentrum einer hübschen, unauffällig regulierten Innenstadt.
Erschöpft, seine Füße nur noch schmerzende Klumpen, setzte er sich an der Bordsteinkante hin, um sich die Schuhe auszuziehen. Er schloss die Augen, damit er vermied, seine Hände zu sehen, und fummelte mit den Schnürbändern der schweren hohen Schuhe. Der Pfleger hatte sie zu einem Doppelknoten gebunden, wie man es bei Kindern macht, und Shadrack, seit Langem nicht mehr gewohnt, komplizierte Dinge zu handhaben, konnte sie nicht lösen. Unkoordiniert rissen seine Nägel an den Knoten herum. Er kämpfte gegen eine aufsteigende Hysterie, die nicht nur aus dem ängstlichen Bestreben nach Befreiung seiner schmerzenden Füße bestand – sein ganzes Leben hing vom Lösen der Knoten ab. Plötzlich und ohne die Lider zu heben, begann er zu weinen. Zweiundzwanzig Jahre alt, geschwächt, erhitzt, eingeschüchtert, voller Angst, sich einzugestehen, dass er nicht einmal wusste, wer oder was er war … ohne Vergangenheit, ohne Sprache, ohne Sippe, ohne Ursprung, ohne Adressbuch, ohne Kamm, ohne Bleistift, ohne Uhr, ohne Taschentuch, ohne Decke, ohne Bett, ohne Dosenöffner, ohne eine verblichene Postkarte, ohne Seife, ohne Schlüssel, ohne Tabaksbeutel, ohne schmutzige Unterwäsche, und nichts, nichts, nichts zu tun … er war sich nur einer Sache sicher: der nicht überprüften Ungeheuerlichkeit seiner Hände. Er weinte lautlos auf der Bordsteinkante einer Kleinstadt im Mittleren Westen und fragte sich, wo das Fenster sei und der Fluss und wo die leisen Stimmen gerade vor der Tür …