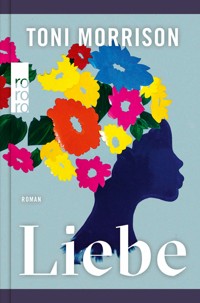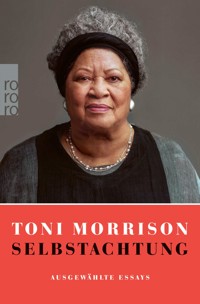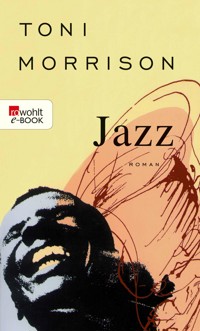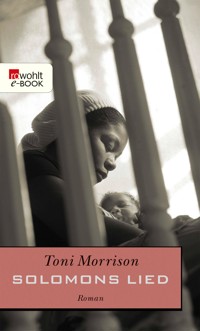9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die bekannte und hochaktuelle Essaysammlung der Nobelpreisträgerin in neuer Form: überarbeitet und sprachlich aktualisiert. Mit einem Nachwort von Sharon Dodua Otoo. Überarbeitet und sprachlich aktualisiert von Mirjam Nuenning. «Im Dunkeln spielen» ist ein herausragendes Werk der Literaturkritik, das ein neues Kapitel im Dialog über Rassismus aufschlug – und verspricht, auch heute noch die Art und Weise zu verändern, wie wir Literatur lesen. Eine glanzvolle Essaysammlung, in der Nobelpreisträgerin Toni Morrison die amerikanische Literatur einer augenöffnenden Analyse unterzieht. Morrison zeigt, wie sehr die Themen Freiheit und Individualismus, Männlichkeit und Unschuld von der Existenz einer Schwarzen Bevölkerung abhängen, die offenkundig unfrei war – und die weißen Autor:innen als Gegenpol ihrer eigenen Identität diente. Laut der Chicago Tribune entwirft Morrison «die Möglichkeit Amerikas neu, sie zeichnet sie neu». Ihre brillanten Erörterungen der «afrikanistischen» Präsenz in den Romanen von Poe, Melville, Cather und Hemingway führen zu einer dramatischen Neubewertung der wesentlichen Merkmale literarischer Tradition. Geschrieben mit der künstlerischen Vision, die der außergewöhnlichen Autorin Toni Morrison einen herausragenden Platz in der modernen Literatur eingebracht hat, ist diese Essaysammlung eine wertvolle Lektüre in Zeiten, in denen der Rassismusdiskurs auch in Deutschland hochaktuell ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 139
Veröffentlichungsjahr: 2023
Sammlungen
Ähnliche
Toni Morrison
Im Dunkeln spielen
Weiße Perspektiven und literarische Imagination. Mit einem Nachwort von Sharon Dodua Otoo
Essays
Überarbeitet und aktualisiert von Mirjam Nuenning
Über dieses Buch
In ihrer augenöffnenden Analyse der amerikanischen Literatur zeigt Toni Morrison, wie sehr die Themen Freiheit und Individualismus, Männlichkeit und Unschuld von der Existenz einer Schwarzen Bevölkerung abhängen, die offenkundig unfrei war – und die weißen Autor*innen als Gegenpol ihrer eigenen Identität diente. Ihre brillanten Erörterungen der «afrikanistischen» Präsenz in den Romanen von Poe, Melville, Cather und Hemingway führen zu einer dramatischen Neubewertung der wesentlichen Merkmale literarischer Tradition. Geschrieben mit der künstlerischen Vision, die der außergewöhnlichen Autorin Toni Morrison einen herausragenden Platz in der modernen Literatur eingebracht hat, ist diese Essaysammlung eine wertvolle Lektüre in Zeiten, in denen der Rassismusdiskurs auch in Deutschland hochaktuell ist.
Vita
Toni Morrison wurde 1931 in Lorain, Ohio, geboren. Sie studierte an der renommierten Cornell University Anglistik und hatte an der Princeton University eine Professur für afroamerikanische Literatur inne. Zu ihren bedeutendsten Werken zählen «Sehr blaue Augen», «Solomons Lied», «Menschenkind», «Jazz», «Paradies» und diverse Essaysammlungen. Sie war Mitglied des National Council on the Arts und der American Academy of Arts and Letters und wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, u. a. mit dem National Book Critics Circle Award und dem American Academy and Institute of Arts and Letters Award für Erzählliteratur. 1993 erhielt sie den Nobelpreis für Literatur, und 2012 zeichnete Barack Obama sie mit der Presidential Medal of Freedom aus. Toni Morrison starb am 5. August 2019.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 1992 unter dem Titel «Playing in the Dark. Whiteness and the Literary Imagination» bei der Harvard University Press, Cambridge, Mass., und London.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Juli 2023
Copyright © 1994 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg «Playing in the Dark» Copyright © 1992 by Toni Morrison
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung Katy Grannan
ISBN 978-3-644-01619-4
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Vorwort
Vor einigen Jahren, ich glaube, es war 1983, las ich Marie Cardinals Les Mots pour le dire[1]. Mehr noch als die Begeisterung der Person, die mir das Buch empfahl, überzeugte mich der Titel: fünf Wörter – entlehnt von Boileau –, die das gesamte Programm und eindeutige Ziel einer Autorin oder eines Autors von Romanen zum Ausdruck bringen. Marie Cardinals Vorhaben hatte allerdings keinen fiktionalen Charakter; vielmehr sollte es ihren Wahnsinn, ihre Therapie und den komplizierten Prozess ihrer Heilung dokumentieren, und dies sprachlich so präzise und plastisch wie nur möglich, um sowohl die Erfahrung selbst als auch ihr Verständnis davon fremden Menschen begreiflich zu machen. Die Geschichten, in deren Form sich das Leben zu gießen scheint, kommen bei bestimmten Arten der Psychoanalyse mit enormer Kraft an die Oberfläche, und Cardinal erweist sich als die ideale Autorin, diesen «Tiefenaspekt» ihrer Lebensgeschichte wiederzugeben. Sie hat mehrere Bücher geschrieben, den Prix International gewonnen, Philosophie unterrichtet und bekennt im Verlauf ihrer Reise in die Gesundheit, dass sie schon immer vorhatte, eines Tages darüber zu schreiben.
Es ist ein faszinierendes Buch, und obwohl ich seiner Klassifizierung als «autobiografischer Roman» anfangs sehr skeptisch gegenüberstand, wird rasch deutlich, wie genau diese Bezeichnung trifft. Es ist angelegt wie die meisten Romane: Szenen und Dialoge folgen aufeinander und sind so angeordnet, dass sie die üblichen an eine Erzählung geknüpften Erwartungen erfüllen. Es gibt Rückblenden, gut platzierte beschreibende Passagen, ein sorgfältig bemessenes Handlungstempo und Entdeckungen zur rechten Zeit. Die Überlegungen der Autorin, ihre Strategien und ihr Bemühen, dem Chaos einen Zusammenhang zu geben, sind Autorinnen und Autoren von Romanen wohlvertraut.
Von Anfang an drängte sich mir eine Frage immer wieder auf: Wann genau merkte die Autorin, dass sie in Schwierigkeiten steckte? Welcher Augenblick in ihrer Geschichte, welche aufschlussreiche, vielleicht sogar spektakuläre Szene überzeugte sie davon, dass ihr der Zusammenbruch drohte? Knapp vierzig Seiten nach Beginn des Buches beschreibt sie diesen Moment, ihre «erste Begegnung mit der SACHE»:
«Meinen ersten Angstanfall hatte ich in einem Konzert von Louis Armstrong. Ich war neunzehn oder zwanzig … Armstrong mit seiner Trompete wird improvisieren. Er wird ein Stück aufbauen, in dem jede einzelne Note für sich und für den Gesamtzusammenhang wichtig war. Ich wurde nicht enttäuscht. Die Atmosphäre heizte sich schnell auf. Es erhoben sich Töne zu einem wunderbaren Gebäude. Wie Gerüste und Eckpfeiler stützten die übrigen Jazzinstrumente Armstrongs Trompete, schufen ausreichenden Raum für die Exposition des Themas, für die Durchführung und für das Finale. Die Töne drängten sich dicht aneinander, vermischten sich, prallten aufeinander und bildeten den musikalischen Grundstock. Aus diesem Schoß wurde eine einzigartige Note geboren. Es tat fast weh, ihrem Klang zu folgen, so bezwingend waren ihre Schwingungen und Dauer. Dieser Ton zerrte an den Nerven der gespannten Zuhörer.
Ich bekomme heftiges Herzklopfen, das bald die Musik zu übertönen scheint. Mein Herz rüttelt am Gitter meines Brustkorbs, schwillt an, drückt meine Lungen so sehr zusammen, dass ich kaum noch Luft bekomme. Und plötzlich erfasst mich Panik: die Vorstellung, hier zu krepieren, inmitten dieser Krämpfe, dem Gestampfe und Gejohle der Menge. Wie eine Besessene rase ich auf die Straße.»[2]
Ich erinnere mich daran, wie ich beim Lesen lächeln musste, teils aus Bewunderung für die Deutlichkeit ihrer Erinnerung an die Musik – ihre Unmittelbarkeit –, teils weil mir durch den Kopf schoss: Was, um alles in der Welt, hatte Louie an diesem Abend gespielt? Was war an seiner Musik, das dieses empfindsame junge Mädchen hyperventilierend hinaus auf die Straße trieb, wo die Schönheit und die Verheerung einer Kamelie sie so beeindruckte, «grazil von Erscheinung, aber innerlich zerrissen»?
Diesen Vorfall in Worte zu fassen, war entscheidend für den Beginn ihrer Therapie, aber die Bildersprache, die als Katalysator für ihren Angstanfall wirkte, bleibt unerwähnt – weder spricht sie selbst davon noch ihr Analytiker noch der berühmte Arzt Bruno Bettelheim, der sowohl das Vorwort als auch eine Nachbemerkung schrieb. Keiner interessiert sich dafür, was ihre starke Todesfurcht auslöste («Ich sterbe! Ich sterbe!», denkt sie und schreit es laut hinaus), was ihre Furcht davor, die Herrschaft über ihren Körper zu verlieren («Nichts kann mich beruhigen, und ich renne weiter»), und was endlich diese merkwürdige Flucht vor dem Improvisationsgenie, vor der erhabenen Ordnung, dem Gleichgewicht und der Illusion von Dauer. Die «einzigartige Note, deren Klang zu folgen fast wehtat, so bezwingend waren ihre Schwingungen und Dauer; dieser Ton, der an den Nerven der gespannten Zuhörerinnen und Zuhörer zerrte» [nicht denen von Armstrong offenbar. Hervorhebungen von der Autorin]. Unerträgliches Gleichgewicht und unerträgliche Dauer; nervenzerreißende Balance und Permanenz. Dies sind wunderbare Tropen für die Krankheit, die im Begriff ist, Cardinals Leben auseinanderzubrechen. Hätte ein Konzert von Édith Piaf oder eine Komposition von Dvořák die gleiche Wirkung gehabt? Gewiss hätte beides diese Wirkung haben können. Meine Aufmerksamkeit hingegen konzentrierte sich auf die Frage, ob die kulturellen Assoziationen zum Jazz genauso bedeutend für Cardinals «Besessenheit» waren wie deren intellektuelle Grundlagen. Mich interessierte, und zwar schon seit geraumer Zeit, wie Schwarze Menschen in literarischen Werken, die sie selbst nicht geschrieben haben, kritische Momente der Entdeckung oder des Wandels oder der Emphase auslösen können. Ich hatte sogar schon, ganz nebenbei und wie im Spiel, solche Fälle zu sammeln begonnen.
Louis Armstrong als Katalysator war ein neuer Beitrag zu dieser Kartei und ermutigte mich, über die Wirkungen des Jazz nachzudenken – darüber, wie er Instinkte, Gefühle und den Intellekt der Zuhörenden beeinflusst. Später wird in Cardinals Autobiografie noch ein anderer erhellender Moment beschrieben. Diesmal handelt es sich jedoch nicht um eine heftige physische Reaktion auf die Kunst eines Schwarzen Musikers; vielmehr geht es um eine begriffliche Antwort auf ein Schwarzes oder, genauer, nichtweißes Symbol. Die Autorin bezeichnet die Manifestation ihrer Krankheit – die halluzinatorischen Bilder von Furcht und Selbsthass – als die SACHE. Beim Rekonstruieren des Ursprungs der überaus abstoßenden Gefühle, die die SACHE auslöst, schreibt Cardinal: «Mir scheint, die SACHE hat in mir endgültig Wurzeln gefasst, als ich begriff, dass wir Algerien vernichteten. Denn Algerien war meine eigentliche Mutter. Ich trug es in mir wie ein Kind das Blut seiner Eltern.» Im Folgenden beschreibt sie den schmerzhaften Konflikt, den der Algerienkrieg in ihr – einem in Algerien geborenen französischen Kind – auslöste, und ihre Assoziation dieses Landes mit Kindheitsfreuden und keimender Sexualität. In bewegenden Bildern von Muttermord, dem weißen Abschlachten einer Schwarzen Mutter, findet sie den Ursprung der SACHE. Wieder wird eine innere Verwüstung mit einer von der Gesellschaftsordnung bestimmten Beziehung zu Race in Verbindung gebracht. Cardinal gehörte zu den Kolonialist*innen, ein weißes Kind, das die Araber*innen liebte und von ihnen geliebt wurde, aber vor Beziehungen zu ihnen, die über ein distanziertes und kontrolliertes Verhältnis hinausgingen, stets gewarnt wurde. In der Tat: eine weiße Kamelie, «grazil von Erscheinung, aber im Innern zerrissen».
In Cardinals Erzählung sind Schwarze oder People of Color und symbolische Darstellungen des Schwarzseins jeweils Symbole für das Wohlwollende und das Böse; für das Spirituelle (aufregende Geschichten von Allahs geflügeltem Pferd) und das Lüsterne; für «sündige», aber köstliche Sinnlichkeit, die mit Forderungen nach Reinheit und Zurückhaltung gepaart ist. Diese Symbole nehmen über die Seiten der Autobiografie hin Gestalt an, bilden Muster, treiben ihr Spiel. Eine von Cardinals frühesten Erkenntnissen im Verlauf der Therapie betrifft die vorpubertäre Sexualität. Als sie diesen Aspekt ihres Ichs versteht und nicht mehr verachtet, wagt es Marie Cardinal, aufzustehen und beim Verlassen der Praxis zu dem Arzt zu sagen: «Sie sollten diese Skulptur nicht in Ihrem Arbeitszimmer stehenlassen, sie ist schrecklich.» Und kommentiert dann: «Es war das erste Mal, dass ich ihn nicht wie eine Patientin anredete.» Den Durchbruch signalisierend und strategisch wichtig für seine Artikulation steckt dieses Symbol für Abscheu und Furcht in einer Skulptur, über die sie, die nunmehr befreite Patientin, eine gewisse Macht hat.
Viele andere Beispiele solcher erzähltechnischer Schaltstellen – Metaphern; Aufforderungen; rhetorische Gesten des Triumphs, der Verzweiflung und des Abschließens, die davon abhängig sind, ob die das Schwarzsein begleitende assoziative Sprache von Furcht und Liebe angenommen wird – sammelten sich in meiner Kartei. Beispiele, die ich für eine Kategorie von Quellen an Bilderreichtum hielt wie Wasser, Flucht, Krieg, Geburt, Religion und so weiter, die das Handwerkszeug eines Schriftstellers, einer Schriftstellerin ausmachen.
Solche Überlegungen zu Marie Cardinals Text sind an sich nicht unbedingt nötig, um das Buch würdigen zu können; sie sind einfach nur Beispiele dafür, wie unterschiedlich wir alle lesen, uns mitreißen lassen und dabei gleichzeitig das Gelesene noch beobachten. Ich nehme die Gedanken, die mir beim Lesen gerade dieses Werks kamen, hier mit auf, weil sie die Stadien meines Interesses zeigen, erstens an dem überall vorkommenden Gebrauch von Schwarzen Bildern und Schwarzen Menschen in expressiver Prosa; zweitens an den verkürzten, als selbstverständlich hingenommenen Voraussetzungen, die in ihrem Gebrauch liegen, und schließlich wegen des Themas, um das es in diesem Buch geht: die Quellen dieser Bilder und ihre Wirkung auf die literarische Imagination und ihr Produkt.
Der Hauptgrund dafür, dass mir diese Dinge so wichtig erscheinen, ist, dass ich nicht ganz denselben Zugang zu den traditionell so nützlichen Konstrukten des Schwarzseins habe. Weder Schwarzsein noch der Begriff «People of Color» stimuliert in mir Vorstellungen von exzessiver, grenzenloser Liebe, Anarchie oder Routine-Furcht. Auf diese metaphorischen Verkürzungen kann ich mich nicht einlassen, denn als Schwarze Schriftstellerin kämpfe ich mit einer und durch eine Sprache, die versteckte Anzeichen weißer Überlegenheit und kultureller Hegemonie sowie abfälliges Othering[3] von Menschen und ihrer Sprache – die in meinen Werken keineswegs Randerscheinungen oder schon gänzlich bekannt und leicht verständlich sind – machtvoll beschwören und noch verstärken kann. Meine Schwachstelle liegt eher darin, Schwarzsein zu romantisieren, anstatt es zu dämonisieren; eher darin, Weißsein zu verteufeln, anstatt es zu konkretisieren. Die Arbeit, die ich schon immer tun wollte, macht es erforderlich, dass ich lerne, Wege zu finden, um die Sprache von ihrer manchmal unheimlichen, oft trägen und fast immer voraussagbaren Verwendung von rassistisch geprägten und festgelegten Ketten zu befreien. (Die einzige Kurzgeschichte, die ich je geschrieben habe, Rezitativ, war ein Experiment, der Versuch, in einer Erzählung mit einer Schwarzen und einer weißen Figur, für die ihre mit ihrer Race verbundene Identität von grundlegender Bedeutung ist, alle rassifizierenden Codes wegzulassen.)
Schreiben und Lesen sind für Schreibende nicht ganz so verschieden. Beide Tätigkeiten verlangen, wach und bereit zu sein für unerklärliche Schönheit, für die komplizierte oder einfache Eleganz schriftstellerischer Vorstellungskraft, für die von der Fantasie heraufbeschworene Welt. Beide erfordern Achtsamkeit für die Stellen, wo die Vorstellungskraft sich selbst sabotiert, sich selbst die Türen verschließt, sich die Sicht verdirbt. Schreiben wie Lesen bedeutet, sich klar zu sein über die Vorstellungen der Schreibenden von Risiko und Sicherheit sowie darüber, wie Sinn und Ver-Antwort-lichkeit heiter gelassen erreicht oder schwitzend errungen werden.
Antonia S. Byatt hat in Besessen bestimmte Arten zu lesen beschrieben, die mir untrennbar verknüpft zu sein scheinen mit bestimmten Schreiberfahrungen, «wo das Wissen, dass wir den Text anders, besser oder genauer erkennen werden, jeder Möglichkeit vorauseilt zu sagen, was wir von ihm erkannt haben und wie wir es erkannt haben. Bei solchen Lektüren folgt dem Eindruck, dass der Text den Lesenden als etwas völlig Neues, nie Gesehenes erscheint, beinahe gleichzeitig der Eindruck, dass dieses Neue immer schon enthalten war, dass die Lesenden dies wussten und es immer schon gewusst haben, obwohl dieses Wissen sich in diesem Augenblick zum ersten Mal bemerkbar gemacht hat, erkannt worden ist.»
Die Imagination, die Werke hervorbringt, die ein Wiederlesen vertragen oder sogar dazu einladen, die nicht nur zu gegenwärtigen Leseerlebnissen auffordert, sondern auch zu zukünftigen, setzt eine mitteilbare Welt voraus und eine unendlich flexible Sprache. Lesende und Schreibende bemühen sich gleichermaßen um die Interpretation und Vorführung von mitteilbaren Vorstellungswelten innerhalb einer gemeinsamen Sprache. Und obwohl auf dieses Bemühen hin die Positionierung der Lesenden berechtigte Ansprüche hat, ist doch die Gegenwart des Autors oder der Autorin – seine oder ihre Absichten, Blindheit oder Sehfähigkeit – Teil der imaginativen Aktivität.
Aus Gründen, die an dieser Stelle keiner Erklärung bedürfen sollten, wurden die Leserinnen und Leser praktisch der gesamten amerikanischen Literatur bis vor sehr kurzer Zeit und unabhängig von der Race des Autors oder der Autorin als weiß angenommen. Mich interessiert, was diese Annahme für die literarische Imagination bedeutet hat und bedeutet. Wann bereichert «Unbewusstheit» oder Bewusstsein von Race die interpretative Sprache, und wann macht das eine oder andere sie ärmer? Welche Konsequenzen hat es in der durch und durch rassialisierten Gesellschaft, die die Vereinigten Staaten sind, wenn das schreibende Ich als frei von Race und alle anderen als einer Race zugehörig hingestellt werden? Was passiert mit der schriftstellerischen Imagination Schwarzer Autor*innen, die sich auf irgendeiner Ebene immer bewusst sind, dass sie ihre eigene Race (oder sich trotz ihrer Race) einer Race von Lesenden präsentieren, die sich selbst als «universell» oder ohne Race versteht? Mit anderen Worten, wie wird «literarisches Weißsein» und «literarisches Schwarzsein» erzeugt, und was ist die Folge dieser Konstruktion? Wie wirkt sich die fest verankerte Annahme einer rassifizierten (nicht rassistischen) Sprache im Unternehmen Literatur aus, das doch hofft und manchmal sogar behauptet, «humanistisch» zu sein? Wann ist dieses hochgesteckte Ziel einer Race-bewussten Kultur tatsächlich erreicht? Wann nicht und warum nicht? Das Leben einer Nation von Menschen, die beschlossen haben, dass ihre Weltsicht ein Programm für individuelle Freiheit und Mechanismen einer verheerenden rassistischen Unterdrückung vereint, bietet dem Schriftsteller oder der Schriftstellerin eine einzigartige Landschaft. Wenn diese Weltsicht als wirkende Kraft ernst genommen wird, dann bietet die Literatur, die innerhalb und außerhalb ihres Wirkungsfelds produziert wird, eine nie dagewesene Gelegenheit, die Spannkraft und Schwerkraft, die Unangemessenheit und die Schlagkraft des imaginativen Akts zu begreifen.
Das Nachdenken über diese Fragen hat mich als Schriftstellerin und als Leserin gefordert. Es hat beide Tätigkeiten schwerer und unendlich viel lohnender gemacht. Es hat auch mein Vergnügen an dem erhöht und geschärft, was Literatur unter dem Druck, den rassifizierte Gesellschaften auf den kreativen Prozess ausüben, zu leisten vermag. Immer wieder staune ich über den reichen Schatz, den die amerikanische Literatur darstellt. Wie unwiderstehlich ist doch das Studium jener Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die Verantwortung für alle