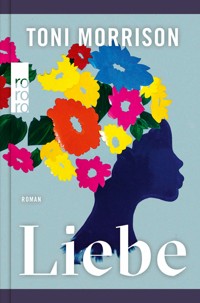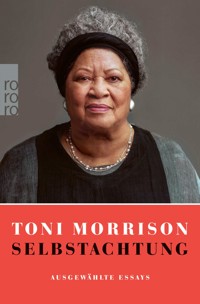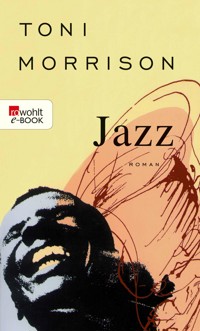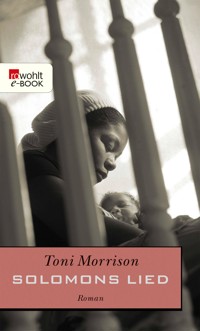17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine paradiesische Insel in der Karibik: In der Villa eines weißen Millionärsehepaars begegnen sich die schwarze Amerikanerin Jadine, Sorbonne-Absolventin, Kunsthistorikerin und Nichte des Butlerehepaars, und Son, ein abgerissener, gut aussehender Krimineller auf der Flucht, der alles verkörpert, was Jadine verabscheut und begehrt. Zwischen ihnen entspannt sich eine Affäre, die sich von der Karibik bis nach Manhattan und in den tiefen Süden der USA erstreckt. In ihrem unvergesslichen Roman untersucht Toni Morrison das Geflecht von Machtverhältnissen zwischen Schwarzen und Weißen, Herr:innen und Diener:innen, Frauen und Männern in allen Nuancen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 533
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Toni Morrison
Tar Baby
Roman
Überarbeitet und sprachlich aktualisiert von Marion Kraft
Über dieses Buch
Eine paradiesische Insel in der Karibik: In der Villa eines weißen Millionärsehepaars begegnen sich die Schwarze Amerikanerin Jadine, Sorbonne-Absolventin, Kunsthistorikerin und Nichte des Butlerehepaars, und Son, ein abgerissener, gut aussehender Krimineller auf der Flucht, der alles verkörpert, was Jadine verabscheut und begehrt. Zwischen ihnen entspannt sich eine Affäre, die sich von der Karibik bis nach Manhattan und in den tiefen Süden der USA erstreckt.
In ihrem unvergesslichen Roman untersucht Toni Morrison das Geflecht von Machtverhältnissen zwischen Schwarzen und Weißen, Herr:innen und Diener:innen, Frauen und Männern in allen Nuancen.
Mit einem bislang nie ins Deutsche übersetzten Vorwort der Autorin. Überarbeitet und sprachlich aktualisiert von Marion Kraft.
«Tar Baby ist auch ein Name, den die Weißen Schwarzen Mädchen gaben. Früher war eine Teergrube ein heiliger Ort, zumindest ein wichtiger Ort, weil man Teer zum Bauen brauchte. Für mich wurde das Tar Baby zu einer Schwarzen Frau, die alles zusammenhält.» Toni Morrison
Vita
Toni Morrison wurde 1931 in Lorain, Ohio, geboren. Sie ist eine der wichtigsten amerikanischen Schriftstellerinnen des 20. Jahrhunderts. Zu ihren bedeutendsten Werken zählen Sehr blaue Augen, Solomons Lied und Menschenkind und ihr essayistisches Schaffen. Sie war Mitglied des National Council on the Arts und der American Academy of Arts and Letters. 1993 erhielt sie den Nobelpreis für Literatur. 2012 zeichnete Barack Obama sie mit der Presidential Medal of Freedom aus. Toni Morrison starb am 5. August 2019.
Impressum
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel «Tar Baby» 1981 bei Alfred A. Knopf, Inc., New York.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Januar 2024
Copyright ©1982 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg «Tar Baby» Copyright © 1981 by Toni Morrison
Übersetzung des Vorworts: Marion Kraft
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung Tracy Murrell
ISBN 978-3-644-01864-8
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für
Mrs. Caroline Smith
Mrs. Millie MacTeer
Mrs. Ardelia Willis
Mrs. Ramah Wofford
Mrs. Lois Brooks
– und ihre Schwestern,
die alle ihr wahres Erbe
kannten.
Denn es ist vor mich gekommen,
liebe Brüder, durch die aus Cloes Gesinde
von euch, dass Zank unter euch sei.
1. Korinther 1.11
Vorwort
Mein Ohr ist so nah am Radio, dass ich weggeschrien werden muss, damit ich mir mein Gehör nicht für immer ruiniere. Oder ich sitze im Schneidersitz auf dem Linoleumboden, atme durch den Mund und beobachte gebannt, ob die Augen der Erwachsenen, während sie die Geschichte erzählt, schon etwas verraten. Jede Erzählung beginnt für mich mit Zuhören. Wenn ich lese, höre ich zu. Wenn ich schreibe, höre ich – Schweigen, Tonfall, Rhythmus, Pausen. Dann kommt die Vorstellung, das Bild von der Sache, die ich erfinden muss: die kopflose Braut im Hochzeitskleid; die Waldlichtung. Auch Performance kommt vor: «sss machte die Säge», begleitet von Gesten. Und Kadenz: «Alter Mann Simon Gillicutty, faaang mich.» Ich muss alles benutzen – Ton, Bild, Performance –, um die ganze Bedeutung der Geschichte zu erfassen. Denn man könnte mich auffordern, sie noch einmal zur Freude der Erwachsenen zu erzählen. Wie sie meine Interpretation beurteilen, ist entscheidend.
Es war einmal ein Farmer. Er legte sich einen Garten an …
Sie warten. Das Lächeln meiner Mutter zeigt ihre Vorfreude. Aber ich will vor allem meiner Großmutter gefallen.
Leckeres Essen, besondere Aufmerksamkeit, Spielfreude oder liebevolle Strenge – all diese Merkmale werden oft beschworen, um die Erinnerung an Großmütter zu versüßen. Die Beziehung zwischen Großmutter und Kind erscheint meist zärtlich und befriedigend, egal, ob dies der Wahrheit entspricht oder die Erinnerung von Zeit und Verlust gefiltert worden ist. So ist auch meine Erinnerung geschönt, doch so viel tiefer gehend als Befriedigung, dass ich sie nicht teilen will. Wie das gierige Kind, das dem Radio nicht nahe genug sein konnte, will ich das alles für mich allein. Sie erzählte uns Geschichten, um uns bei lästigen Arbeiten bei der Stange zu halten, wie etwa aus Körben voll mit wilden Trauben die zerquetschten auszusortieren; um uns von unseren Schmerzen und Windpocken abzulenken; um die triste Welt zu durchbrechen und eine verzauberte zu enthüllen.
Ich war nicht der Liebling meiner Großmutter. Dennoch war sie meiner. Ich sehe sie vor mir, wie sie Schmalz in den Teig für ihre Biscuits löffelt. Ich sehe sie Hand in Hand mit mir tanzen. Ich rieche die Terpentintropfen auf dem Teelöffel Zucker, den sie uns im Frühjahr gab. Sehe die Schulkleider, die sie für meine Schwester und mich nähte – kariert mit weißem Kragen; und einmal machte sie uns Bobby-Anzüge. Am bedeutendsten war, dass sie bei ihrem Zahlenglücksspiel meine Träume – und nur meine – wollte, um sie zu interpretieren. Sie waren ihr wichtig. Deshalb erinnerte ich mich an sie. Ich machte Geschichten aus ihnen, die – wie ihre eigenen – einer Interpretation bedurften.
Es war einmal ein Farmer. Er legte sich einen Garten an …
Sehr lustig, dann beängstigend, dann wieder lustig. Jedenfalls rätselhaft. An einem bestimmten Punkt forderte und bot die Geschichte vom Tar Baby, sie jenseits von «Vogelfreier Landmann überlistet erfinderischen Herrn mit Schlauheit und List» zu verstehen. Es ist klar, warum der Hase so viel Salat und Kohl, wie er nur kann, essen muss. Es ist klar, warum der Farmer ihn davon abhalten muss. Aber wozu die Figur aus Teer? Und warum ist sie (in der Version, die mir erzählt wurde) weiblich gekleidet? Versteht der Farmer den Hasen so gut, dass er sich auf dessen Neugier verlassen kann? Doch der Hase ist überhaupt nicht neugierig. Er geht an Tar Baby vorbei, nimmt ihre Anwesenheit mit einem beiläufigen «Guten Morgen» wahr. Doch dann ärgert er sich und wird wütend, weil er ignoriert wird und sie schlechte Manieren hat. Er droht ihr und schlägt sie dann. Jetzt ist er dumm. Wenn eine seiner Pfoten festklebt, warum es mit noch einer versuchen? Der erfindungsreiche Farmer hat gewonnen. Doch er lässt sich auf ein Bestrafungsritual ein. Hatte er die Motivation des Hasen zuvor noch so gut verstanden, so missversteht er sie nun völlig. Jetzt wird der dumme Hase clever. Er gibt vor, die schlimmste Bestrafung für ihn wäre, in sein eigenes soziales Umfeld zurückgeschickt zu werden. Er weiß, der Farmer würde das Zurückschicken in diese Verhältnisse als Höchststrafe erachten, schlimmer als der Tod. Also wird der Hase kurzerhand hämisch in das Dornengestrüpp geworfen – und freut sich darüber. Nachdem sie ihre Arbeit getan hat, fällt die Teerfigur aus der Handlung. Dennoch bleibt sie nicht nur das befremdliche schweigende Zentrum, sondern auch die klebrige Vermittlerin zwischen Master und Bauer, Plantagenbesitzer und Versklavtem. Vom Farmer konstruiert, um zu täuschen und zu verführen, wird ihre Trickserei zur Kunst. Die wesentliche Beziehung ist nicht auf den Hasen und den Farmer beschränkt. Sie besteht auch zwischen dem Hasen und der Teerfigur. Sie stellt ihm Fallen. Er weiß es und verschlimmert trotzdem seine Verstrickung. Dennoch besteht er auf seiner Freiheit. Eine Liebesgeschichte. Bis dahin. Eine schwierige, unempfängliche, aber verführerische Frau und ein cleverer, anarchischer Mann, beide mit Vorstellungen von Unabhängigkeit und Häuslichkeit, von Sicherheit und Gefahr, die aufeinanderprallen. Der Anfang des Romans weist auf diesen Konflikt hin: «Er glaubte, er wäre in Sicherheit.» «Glaubte» statt «dachte» als Marker für den Zweifel, Hinweis auf die Unsicherheit.
Allerdings war es das Bild des Teers, kunstvoll geformt, schwarz, verstörend und doch einladend, das mich zu afrikanischen Masken hinführte: uralt, lebendig und atmend, mit überbetonten Gesichtszügen und einer geheimnisvollen Macht. Eine schamlose Skulptur, die im Herzen des Folktales sitzt, wurde zum Kern der Erzählung. Alle Charaktere sind selbst Masken. Und wie afrikanische Masken verbindet der Roman das Ursprüngliche mit der Gegenwart, die Überlieferung mit der Realität. Eine Mischung, die sich als berauschend, ja sogar schwindelerregend erwies. Aber ich hielt den Handlungsstrang für solide und vertraut genug, um ein Schwindelgefühl bei Leser*innen zu vermeiden oder in Grenzen zu halten. Dann wäre die ursprüngliche Erzählung zu neuem Leben erweckt. Das bringt mich zurück zu den Frauen, die sich durch eine verschüttete Geschichte singen und sie erzählen, um die Welt zu verzaubern, in der ich «geboren und aufgewachsen bin».
Sie sagten, sie liege im Sterben. «Eiweiß» im Blut, meinte der gerufene Arzt. Sie dürfe kein Eiweiß essen. Das war die Diagnose und das Rezept. Medizinische Versorgung nach dem Zufallsprinzip, dem Glauben an Gottes Willen und mit der Überzeugung, dass Krankheiten meist ernährungsbedingt sind. (Eine ihrer Töchter war mit achtzehn gestorben − entweder weil sie auf feuchtem Gras gesessen und eine «Unterleibserkältung» bekommen hatte oder an dem Brombeerkuchen vom Vorabend. Jedenfalls wachte meine Großmutter auf und ihr liebes kleines Mädchen lag im eiskalten Schlaf neben ihr.) Was auch immer die Ursache gewesen sein mag, meine Großmutter wurde sehr krank. Alle, die verfügbar waren, kümmerten sich um sie. Irgendwann wurde ich in ihr Schlafzimmer geschickt, um ihr vorzulesen. Etwas aus der Bibel, sagten sie, um sie zu trösten. Ich las feierlich, ohne ein Wort zu verstehen. Stattdessen wollte ich ihr eine Geschichte erzählen – um sie aufzumuntern, vielleicht sogar, um sie zu heilen. Oder ich wollte ihr einen meiner Träume erzählen. Doch das wäre frivol gewesen – im Vergleich zur Bibel. Leise bewegte sie sich und drehte sich unruhig unter dem Laken von einer Seite auf die andere. Ich dachte, sie wolle weglaufen, weg von diesem dummen Enkelkind, das seine Aufgabe so ernst nahm und ihr dennoch nicht gewachsen war. Oder vielleicht wollte sie einfach gehen, das Leben verlassen, es loswerden. Sie und ihr Mann lebten ohne Einkommen abwechselnd bei einem ihrer Kinder und dann bei dem nächsten. Obwohl jede ihrer Töchter sie gerne bei sich hatte und sich mit großer Hingabe um sie kümmerte, war sie tatsächlich, genau wie ihr Ehemann, obdachlos. Die Abfolge von Betten, – von denen keins ihr eigenes war – muss verunsichernd, wenn nicht demütigend gewesen sein. Damals dachte ich, das wäre ein schönes Leben – von einer Stadt oder Gemeinden zur nächsten zu ziehen und Familienmitglieder zu besuchen. Aber ihr dabei zuzusehen, wie sie in ihren Bettlaken läuft, ihren Kopf auf dem Kissen hin und her wirft … Ich weiß nicht. Natürlich war sie krank. Eiweiß und all das … Aber sie konnte doch nicht einfach sterben oder sterben wollen. Ein paar Tage später, als sie mir sagten, dass sie tot war, dachte ich, dass nun niemand mehr nach meinen Träumen fragen werde. Keine Person wird mehr darauf bestehen, dass ich ihr eine Geschichte erzähle.
Es war einmal vor langer, langer Zeit …
Wir waren zu viert in dem Zimmer: ich, meine Mutter, meine Großmutter und meine Urgroßmutter. Die Älteste war maßlos in ihrer strengen unheimlichen Weisheit. Die Jüngste, ich, ein Schwamm. Meine Mutter begabt, gesellig, belastet von Erkenntnis. Meine Großmutter ein geheimer Schatz, dessen Gegenwart die beängstigende, verzauberte Welt verankerte. Drei Frauen und ein Mädchen, das nie aufgehört hat, zuzuhören, zu beobachten, den Rat dieser Frauen zu suchen, und das begierig auf ihr Lob war. Wir alle vier leben in der Geschichte von Tar Baby − als Zeugin, als Klägerin, als Richterin –, darauf bedacht, wie Geschichten verwendet und wie sie erzählt werden.
Doch nur eine von ihnen brauchte meine Träume.
Aus dem Englischen von Marion Kraft
Er glaubte, er wäre in Sicherheit. Er stand an der Reling der HMS Stor Konigsgaarten und sog in großen Zügen Luft in sich hinein; sein Herz schlug schneller, als er voller Erwartung auf den Hafen starrte. Queen de France errötete ein wenig in dem nachlassenden Licht und senkte vor seinem Blick die Lider. Sieben mädchenhaft weiße Segelschiffe schaukelten im Hafen, aber zwei oder drei Kilometer weiter, wenn man der Strömung folgte, war ein verlassener Pier. Betont ungezwungen ging er nach unten zu den Quartieren, die er mit den schon an Land gegangenen Kameraden teilte, und da er nichts besaß, was er hätte mitnehmen können – kein Briefmarkenalbum, kein Rasiermesser, keinen Schlüssel zu irgendeiner Tür –, schlug er nur noch einmal etwas exakter die Decke unter der Matratze seiner Koje ein. Er zog seine Schuhe aus und knotete die Schnürsenkel an der Gürtelschlaufe seiner Hose fest. Dann, nachdem er sich in aller Ruhe noch einmal umgeschaut hatte, ging er geduckt durch die Zwischendeckpassage und kehrte auf das Oberdeck zurück. Er schwang ein Bein über die Reling, zögerte und überlegte, ob er einen Kopfsprung machen sollte; da er seinen Füßen aber mehr vertraute als seinen Händen, machte er einfach einen Schritt weg vom Schiff. Das Wasser war so weich, dass er es erst wahrnahm, als es ihm schon bis zu den Achselhöhlen reichte. Rasch zog er die Knie an und schoss davon. Er war ein guter Schwimmer. Bei jedem vierten Schwimmstoß drehte er sich um und hob den Kopf, um sich zu vergewissern, ob er seinen Kurs parallel zur Küste auch beibehielt und ihr nicht zu nahe kam. Obwohl sich seine Haut kaum von dem dunklen Wasser unterschied, achtete er darauf, dass seine Arme nicht zu weit aus den Wellen tauchten. Der Pier kam näher, und er stellte zufrieden fest, dass seine Schuhe immer noch an seinen Hüften baumelten.
Nach einer Weile beschloss er, zum Land zu schwimmen – auf den Pier zu. Als er die Beine grätschte, um zu drehen, legte sich ein Ring aus Wasser um sie und zog ihn in einen weiten, leeren Tunnel. Er versuchte, sich daraus zu befreien, und wurde dreimal herumgewirbelt. Gerade als er unter Wasser hätte atmen müssen, wurde er wieder an die samtene Luft befördert und lag ausgestreckt auf der glatten Oberfläche des Meeres. Er trat ein paar Minuten lang Wasser und versuchte, gleichmäßig zu atmen, dann nahm er wieder Kurs auf den Pier. Wieder legte sich der Ring um seine Fußgelenke, und der nasse Schlund schluckte ihn. Er sank tiefer und tiefer, landete jedoch nicht, wie er erwartet hatte, auf dem Meeresboden, sondern wurde in einem Strudel herumgewirbelt. Sein einziger Gedanke war, ich bewege mich gegen den Uhrzeigersinn. Kaum hatte er das gedacht, beruhigte sich die See und spülte ihn nach oben. Wieder trat er Wasser, hustete, spuckte und schüttelte den Kopf, um seine Ohren vom Wasser zu befreien. Als er sich etwas ausgeruht hatte, beschloss er es im Schmetterlingsstil zu versuchen, um seine Füße vor dem Sog zu schützen, den er beide Male von rechts verspürt hatte. Als er jedoch die Wasserfläche vor sich aufriss, fühlte er einen sanften, beharrlichen Druck auf Brust und Bauch, bis hinunter zu den Schenkeln. Als bedränge ihn die Hand einer Frau, die nicht lockerließ. Er wehrte sich mit aller Kraft, aber es nützte nichts. Die Hand schob ihn immer weiter, weg vom Land. Er drehte den Kopf, um zu sehen, was hinter ihm lag. Er sah nur Wasser, das die Sonne, die wie ein blutendes Herz darin versank, purpurrot färbte. In weiter Ferne, zu seiner Rechten, lag die in ganzer Länge erleuchtete Stor Konigsgaarten.
Seine Kräfte ließen nach, und ihm war bewusst, dass er sie nicht im Kampf gegen die Strömung vergeuden durfte. Er beschloss, sich eine Weile treiben zu lassen. Vielleicht würde der Sog nachlassen. Zumindest konnte er neue Kräfte sammeln. Er trieb so gut er konnte im Wasser, das sich hob und senkte und in der nach Ammoniak riechenden Luft pulsierte und immer dunkler wurde. Er wusste, dass er sich in einem Teil der Welt befand, der keine Dämmerung kannte und nie kennenlernen würde und dass er jeden Augenblick in einem pechschwarzen Meer dem Horizont entgegentreiben könnte. In Queen de France gingen schon die ersten Lichter an, tropften wie Tränen aus einem weinenden Himmel, der von der scharfen Spitze eines frühen Sterns aufgerissen worden war. Die Wasserfrau hielt ihn immer noch in ihrer hohlen Hand und schubste ihn hinaus aufs Meer. Plötzlich sah er neue Lichter – vier an der Zahl – zu seiner Linken. Er konnte die Entfernung nicht abschätzen, aber er wusste, dass sie gerade eben auf einem kleinen Boot angegangen waren. Die Wasserfrau zog genauso plötzlich ihre Hand zurück, und der Mann schwamm auf das Boot zu, das im blauen, nicht im grünen Wasser ankerte.
Als er näher herankam, umkreiste er es. Er hörte nichts und sah niemanden. Auf der Hafenseite entdeckte er den Namen Seabird II und eine kurze, etwa einen Meter lange Strickleiter, die sacht gegen den Bug schlug. Er hielt sich an einer Sprosse fest und hievte sich an Bord des Schiffes. Keuchend kroch er über das Deck. Die Sonne war verschwunden, und seine Segeltuchschuhe hingen auch nicht mehr an seinem Gürtel.
Er schob sich seitlich über das Deck, presste sich gegen die Wand des Ruderhauses und schaute in die gewölbten Fenster. Niemand war zu sehen, aber er hörte von unten Musik, und es roch nach kräftig mit Curry gewürztem Essen. Er wusste nicht, was er sagen sollte, falls plötzlich jemand auftauchte. Es wäre besser, wenn er es nicht im Voraus plante, da solche Geschichten doch immer wie Lügen klangen, auch wenn sie noch so schlüssig waren. Er würde sich davon inspirieren lassen, ob diese Person ein Mann oder eine Frau war, ob sie groß oder klein war, wie sie sich verhielt.
Er ging zum Achterdeck und stieg vorsichtig eine kurze Treppe hinunter. Die Musik wurde lauter und der Currygeruch stärker. Die Tür am andern Ende stand offen, und aus ihr kamen das Licht, die Musik und der Currygeruch. In seiner Nähe befanden sich zwei geschlossene Türen. Er entschied sich für die erste; sie führte in einen dunklen Wandschrank. Er kroch hinein und schloss leise die Tür hinter sich. Es roch stark nach Zitrusfrüchten und Öl. Da er nichts erkennen konnte, hockte er sich einfach dort, wo er stand, auf den Boden und hörte der Musik zu, die aus einem Radio oder Plattenspieler zu kommen schien. Langsam streckte er die Hand im Dunkeln vor, sein ausgestreckter Arm stieß aber nirgends auf Widerstand. Als er nach rechts tastete, berührten seine Finger eine Wand. Er kroch darauf zu und setzte sich, mit dem Rücken zur Wand, auf den Boden.
Er wollte unter allen Umständen wach bleiben, aber die Wasserfrau fuhr ihm mit ihren knöchernen Fingern über die Lider, und er fiel wie ein Stein in Schlaf.
Der Motor weckte ihn nicht – er hatte jahrelang beim Geräusch stärkerer Motoren geschlafen. Und auch das Rollen des Schiffs machte ihm nichts aus. Stärker als die Geräusche des Motors war der ungewohnte Klang einer Frauenstimme – so ungewohnt und verheißungsvoll, dass sie seine Traumwelt zum Platzen brachte. Er wachte auf und dachte an eine kurze Straße mit gelben Häusern und offenen weißen Türen, in denen Frauen standen, die ihm zuriefen, «Komm rein, Süßer, komm», und ihr Gelächter breitete sich wie eine Daunendecke über den Befehl. In der Stimme dieser Frau lag jedoch nichts dergleichen.
«Ich bin nie einsam», sagte sie, «nie.»
Die Kopfhaut des Mannes juckte. Er fuhr sich mit der Zunge über die Lippen und schmeckte das Salz in seinem Schnurrbart.
«Nie?» Es war die Stimme einer andern Frau – heller, halb zweifelnd, halb bewundernd.
«Nein, nie», sagte die erste Frau. Ihre Stimme schien an den Rändern kalt, innen jedoch warm zu sein. Oder war es gerade umgekehrt?
«Ich beneide dich», sagte die zweite Stimme, aber sie klang schon ferner, nach oben entschwebend, begleitet von Schritten auf einer Treppe und dem Geräusch sich reibenden Stoffes – Kordsamt gegen Kordsamt oder Segeltuch gegen Segeltuch –, einem Geräusch, das nur Frauenschenkel machen können. Eine wundervolle Herbsteinladung, sich aus dem Regen an den häuslichen Herd zu flüchten und es sich dort bequem zu machen.
Der Mann konnte den Rest des Gespräches nicht verstehen – die Frauen waren inzwischen an Deck. Er lauschte noch eine Zeit und richtete sich dann langsam und vorsichtig auf und tastete nach dem Türknopf. Der Gang war hell erleuchtet – aber die Musik hatte aufgehört, der Currygeruch hatte sich verflüchtigt. Durch den Spalt zwischen Türrahmen und Tür sah er ein Bullauge, und in ihm spiegelte sich tiefe Nacht. Irgendetwas fiel aufs Deck, und einen Augenblick später rollte es auf die Türschwelle und blieb in dem fingerbreiten Lichtstreifen vor seinem Fuß liegen. Es war eine Flasche, auf deren Etikett er mit Mühe Bain de Soleil entziffern konnte. Er rührte sich nicht. Dachte an nichts, wartete nur. Er hatte niemanden die Treppe herunterkommen hören, aber plötzlich wurde eine Frauenhand sichtbar. Wunderbar geformte, rosa lackierte Fingernägel, elfenbeinfarbene Finger, Ehering. Sie hob die Flasche auf, und er hörte die Frau leise seufzen, als sie sich bückte. Sie richtete sich auf, und ihre Hand verschwand. Ihre Füße bewegten sich lautlos auf den Teakbohlen, aber kurz darauf hörte er, wie eine Tür – wahrscheinlich die Kombüsentür – auf- und zuging.
Er war der einzige Mann an Bord. Er fühlte es – irgendetwas fehlte, wie er erleichtert feststellte. Die zwei oder drei Frauen – er wusste nicht, wie viele es waren –, die das Schiff manövrierten, würden sicher bald an einer privaten Anlegestelle festmachen, wo es keinen Zollbeamten gab, der Stempel in die Pässe drückte und dabei bedeutsam die Brauen zusammenzog.
Das Licht vom Gang erlaubte es ihm, sich im Wandschrank umzusehen. Es war eine Abstellkammer mit Regalen, auf denen Taucherausrüstungen, Angelgeräte und sonstige Bootsutensilien lagen. Ein offener, auf dem Boden stehender Korb nahm den meisten Platz ein. In ihm standen zwölf winzige Orangenbäumchen, die alle Früchte trugen. Er riss eine der Miniaturorangen, die nicht größer war als eine Erdbeere, ab und aß sie. Das Fruchtfleisch war weich, faserfrei und bitter. Er aß noch eine. Und noch eine. Und während er aß, tat sich wie eine Wunde ein bohrender Hunger in ihm auf. Er hatte seit der letzten Nacht nichts mehr gegessen, aber der Hunger, der ihn jetzt durchschnitt, war ebenso unerklärlich wie plötzlich.
Das Boot war unterwegs, und er merkte sehr schnell, dass es auf die offene See zuhielt, nicht auf Queen de France. Aber es wird wohl nicht allzu weit davon entfernt sein, dachte er, Frauen mit lackierten Fingernägeln, die Sonnenöl brauchten, werden nicht in die Nacht hinausfahren, wenn sie einen weiten Weg vor sich haben. Er kaute weiter bittere Orangen, blieb im Wandschrank hocken und wartete ab. Als das Boot endlich anlegte und der Motor abgestellt wurde, war sein Hunger nicht mehr zu bändigen; er musste die Finger zu Fäusten ballen, um nicht aus dem Wandschrank in die Küche zu stürzen. Aber er wartete, bis die leichten Schritte nicht mehr zu hören waren. Dann ging er auf den Gang, auf den an zwei Stellen Mondlicht fiel. Vom Deck aus sah er zwei Gestalten, die dem Lichtstrahl einer starken Taschenlampe folgten. Als er den Motor eines Autos aufheulen hörte, ging er wieder nach unten. Er fand sofort die Kombüse, aber da das Licht nicht ausreichte, tastete er die Anrichte nach Streichhölzern ab. Es waren keine da, und der Herd war elektrisch. Er öffnete einen kleinen Kühlschrank und fand eine Flasche Mineralwasser und eine halbe Limone. Irgendwo im schwachen Licht des Kühlschranks machte er noch einen Topf Dijon-Senf ausfindig, aber von dem Curryessen war offenbar nichts übrig geblieben. Die Teller und der weiße Behälter waren abgewaschen. Die Frauen hatten nicht selbst gekocht – sie hatten ein Fertiggericht mit an Bord gebracht und heiß gemacht. Der Mann fuhr mit dem Finger in die Ecken des weißen Behälters und an den Kanten entlang. Sie mussten die Reste an die Möwen verfüttert haben. Er schaute in die Schränke: Gläser, Tassen, Teller, ein Mixer, Kerzen, Plastikstrohhalme, bunte Zahnstocher und schließlich eine Packung norwegisches Fladenbrot. Er bestrich das Brot mit Senf, aß es und trank das Mineralwasser aus, bevor er wieder oben an Deck ging. Er sah die Sterne und tauschte lange Blicke mit dem Mond aus; aber er konnte kaum etwas von der Küste sehen, und das war auch besser so, denn er starrte auf die Küste einer Insel, bei deren Anblick vor dreihundert Jahren eine ganze Schiffsladung Versklavter mit Blindheit geschlagen worden war.
1
Wie es sich herausstellte, war das Ende der Welt nichts weiter als eine Ansammlung herrlicher Winterhäuser auf der Isle des Chevaliers. Als die von Haiti importierten Arbeiter das Land rodeten, waren Wolken und Fische überzeugt, dass es mit der Welt vorbei sei, dass das meergrüne Grün des Meeres und das himmelblaue Blau des Himmels nun bald nicht mehr da sein würden. Die wilden Papageien, die vor den Steinen der hungrigen Kinder aus Queen de France geflüchtet waren, stimmten ihnen zu, und es gab ein Riesenspektakel, als sie wegflogen, um sich wieder ein neues Refugium zu suchen. Nur die Riesenolearia blieben heiter und gelassen. Schließlich und endlich waren sie Teil eines schon zweitausend Jahre alten und für die Ewigkeit bestimmten Regenwaldes; also ignorierten sie die Männer und wiegten weiterhin die Diamantklapperschlangen, die in ihren Armen schliefen. Erst der Fluss konnte sie davon überzeugen, dass sich die Welt tatsächlich geändert hatte. Dass der Regenwald nie wieder so sein würde wie früher, und als sie es schließlich einsahen und ihre Wurzeln tiefer in den Boden senkten, sich an der Erde festklammerten wie heimkehrende verlorene Söhne, war es bereits zu spät. Die Männer hatten schon Hügel aufgeworfen, wo es keine Hügel gegeben hatte, und Täler gegraben, wo keine Täler gewesen waren. Und das erklärt auch das Geschick des Flusses. Er staute sich, verlor seinen Lauf und schließlich den Kopf. Vertrieben von dem Platz, an dem er gelebt hatte, und in unbekanntes Terrain gezwungen, konnte er nicht mehr seine Tümpel und Wasserfälle bilden und rannte in alle Richtungen. Die Wolken zogen sich zusammen, standen still und beobachteten, wie der Fluss über den Waldboden eilte, kopfüber gegen die Hüften der Hügel prallte, ohne eine Vorstellung zu haben, wohin es ging, bis er erschöpft, krank und kummervoll kaum zwanzig Meilen vom Meer entfernt zum Stillstand kam.
Die Wolken sahen sich an und stoben verwirrt auseinander. Die Fische hörten, wie ihre Hufe über den Himmel donnerten, um den Gipfeln der Riesenolearia und der Hügel die Neuigkeit von dem kopflos gewordenen Fluss zu erzählen. Es war jedoch zu spät. Die Männer hatten so lange an den Bäumen genagt, bis diese mit aufgerissenen Augen und schreiend auseinanderbrachen und zu Boden stürzten. In der großen Stille, die ihrem Fall folgte, beugten sich spiralförmig Orchideen zu ihnen hinab.
Als alles vorbei war und an ihrer Stelle Häuser in den Hügeln wuchsen, träumten die verschont gebliebenen Bäume noch jahrelang von ihren Kameraden, und ihr Alptraum-Gemurmel störte die Diamantklapperschlangen, die sie daraufhin verließen, um sich in den neu gewachsenen Pflanzen, an Stellen, die noch nie zuvor die Sonne gesehen hatten, ein Zuhause zu suchen. Dann veränderte sich der Regen, er war nicht mehr derselbe. Jetzt regnete es nicht mehr nur eine Stunde am Tag, immer um dieselbe Zeit, sondern es gab Regenzeiten, wodurch der Fluss noch mehr misshandelt wurde. Armer beleidigter Fluss mit dem gebrochenen Herzen. Armer verrückt gewordener Strom. Er hockte jetzt an ein und derselben Stelle, wie eine alte Frau, und wurde zu einem Sumpf, den die Haitianer Sein de Veilles nannten. Und er sah aus wie ein Altweiber-Busen: ein verschrumpeltes, in Nebel gehülltes Oval, aus einer sickernden, zähen, schwarzen Masse, die sogar die Moskitos mieden.
Aber hoch oben gab es Hügel und Täler, so üppige, dass die Besucher es müde wurden, sie zu betrachten: Bougainvillea, Avocado, Weihnachtssterne, Limonen, Bananen, Kokosnüsse und die letzten Könige des Regenwaldes. Von den Häusern, die dort gebaut worden waren, war L’Arbe de la Croix das älteste und eindrucksvollste. Es war von einem brillanten, mexikanischen Architekten entworfen worden, aber die haitischen Arbeiter hatten keine Gewerkschaft und konnten deshalb nicht zwischen Handwerk und Kunst unterscheiden; so passten die Fensterscheiben oft nicht in ihre Rahmen, während Fensterbänke und Türschwellen kunstvoll geschnitzt waren. Manchmal vergaßen oder ignorierten sie die Tatsache, dass Wasser grundsätzlich bergabwärts fließt, und die Toiletten und Bidets waren deshalb nicht immer in der Lage, einen gleichmäßig starken Strudel zu produzieren. Das Dach stand jedoch so weit vor, dass man selbst bei Gewitter die Fenster offen lassen konnte, ohne dass es hereinregnete – nur Wind, Gerüche und abgerissene Blätter kamen herein. Die Holzdielen waren gespundet, aber die handgefertigten Fliesen aus Mexiko, die wunderschön anzuschauen waren, lösten sich, wenn man sie berührte. Die Türen waren jedoch sehr kräftig und die Griffe, Scharniere und Schlösser so stabil wie der Panzer einer Schildkröte.
Es war ein wundervolles Haus. Geräumig, voller Licht und luftig. Da es zu einer Zeit gebaut worden war, in der man mit Baumaterialien noch verschwenderisch umging und an Sonne und natürliche Ventilation dachte, brauchte es keine Klimaanlage. Eine reizvoll gestaltete Umgebung ließ seine Schönheit beinahe unerträglich werden. Man hatte sehr viel Mühe darauf verwandt, es nicht «gestaltet» erscheinen zu lassen. Fast nichts fiel aus dem Rahmen, und die wenigen Dinge, die es taten, hatten Charme: kleine, für die Insel typische Details (ein Waschhaus, einen Küchengarten zum Beispiel), die praktisch waren. Zumindest nach der Meinung urteilsfähiger Besucher. Sie waren sich alle einig, dass es, abgesehen von seinem unglücklichen Namen, das «hübscheste und unorthodoxeste Haus in der Karibik war». Ein oder zwei Besucher hatten Vorbehalte – fragten sich, ob das einströmende Sonnenlicht nicht etwas zu grell wäre und ob der Besitzer mit dem Anbau eines Gewächshauses nicht doch etwas zu viel des Guten getan hätte. Valerian Street hörte sich zwar ihre Kritik an, aber sie glitt völlig von ihm ab. Seine grauen Augen wanderten über die Gesichter solcher Gäste wie ein Vier-Uhr-Schatten auf dem Weg zur Dämmerung. Sie erinnerten ihn an die Witwen aus Philadelphia, die, als sie hörten, dass er das ganze erste Jahr seines Ruhestandes in seiner Karibikvilla verbringen wollte, prophezeiten: «Sie werden zurückkommen. Sechs Monate, und Sie werden sich zu Tode langweilen.» Das war im Dezember vor vier Jahren gewesen, und das Einzige, was er hier vermisste, waren Hortensien und der Postbote. Das neue Gewächshaus machte es möglich, die Hortensien zu züchten, aber der Postbote war für immer für ihn verloren. Alles, was er sonst noch liebte, hatte er mitgebracht: ein paar Schallplatten, Gartenscheren, einen Kronleuchter mit vierundsechzig Birnen, ein hellblaues Tennishemd und die Allerschönste von Maine. Die Brüder Ferrara (Inland und Ausland) kümmerten sich um den Rest, und mithilfe von zwei Bediensteten, der Allerschönsten von Maine und einem Haufen gewissenhaft geführter Korrespondenz hatte er sich schließlich für ein Jahr auf einem Hügel eingerichtet, der hoch genug war, um auf drei Seiten das Meer sehen zu können. Nicht dass es ihn interessierte. Abgesehen davon, dass es die Wetterlage verkündete, von der es abhing, ob die Schiffe Post bringen konnten oder nicht, hatte er noch nie einen Gedanken an das Meer verschwendet. Und wann immer er nachdenken wollte, tat er es in seinem Gewächshaus in aller Stille. Spätnachmittags, wenn einem die Hitze wirklich zu schaffen machte, und am frühen Morgen war er dort. Lange bevor die Allerschönste ihre Schlafmaske entfernte, knipste er den Schalter an, der die Goldberg-Variationen ins Gewächshaus fließen ließ. Zuerst hatte er es mit Chopin und ein paar von den Russen versucht, aber die Magnum-Rex-Pfingstrosen, überwältigt von so viel Leidenschaft, weinten und kräuselten ihre Lippen. Er entschied sich schließlich für Bach zum Keimen, für Haydn und Liszt zum kräftigen Wachsen. Danach schienen alle Pflanzen zufrieden mit Rampals Rondo in D-Dur. Und wenn er seinen Frühstückskaffee zuckerte, hatten die Pfingstrosen, die Anemonen und all ihre Verwandten vierzig oder fünfzig Minuten lang Musik gehört, die sie wachsen und gedeihen ließ, jedoch Sydney, den Butler, nervös machte, obwohl er einige Spielarten davon vierzig Jahre lang jeden Tag gehört hatte. Was es jetzt erträglicher machte, war, dass die Musik auf das Gewächshaus beschränkt war und nicht durch das ganze Haus strömte, wie es früher in Philadelphia oft der Fall gewesen war. Er konnte sie jetzt nur noch schwach hören, während er mit einer weißen Serviette feuchte Perlen von einem Glas mit eisgekühltem Wasser wischte. Er setzte es nahe an die Tasse und Untertasse heran und bemerkte, wie viel blasser die Leberflecken auf der Hand seines Arbeitgebers geworden waren. Mr. Street dachte, es läge an der Tinktur, die er nachts einrieb, aber Sydney dachte, es läge an der natürlichen Bräunung der Haut hier auf der Insel, wohin sie alle vor drei Jahren gekommen waren.
Abgesehen von der Küche, die dauerhaft wirkte, hatte das Haus eher eine Hotelatmosphäre an sich, erweckte den Eindruck, dass man es früher oder später wieder verlassen würde: ein, zwei Bilder hingen zwar an einem günstigen Platz, aber keines war richtig befestigt oder beleuchtet; das wirklich feine Porzellan war immer noch in Kisten verpackt und wartete auf eine Entscheidung, die niemand zu treffen willens war. In einem solchen Provisorium ließ sich schlecht wirtschaften. Da kein Kristall vorhanden war (es war auch in Philadelphia zurückgeblieben), mussten ein paar wenige Silbertabletts für alles, vom Obst bis zu den Petits Fours, dienen. Ab und zu brachte die Allerschönste von einer ihrer kurzen Reisen in die Staaten einen Karton voller Sachen mit, um die Sydney gebeten hatte: den Mixer, den Mörser, zwei weitere Tischtücher. Diese Dinge mussten sorgfältig ausgewählt werden, da sie für andere Gegenstände ausgetauscht wurden, die sie unweigerlich mit zurück nach Philadelphia nahm. Auf diese Weise hielt sie die Illusion aufrecht, dass sie noch in den Staaten lebten und hier auf Dominika nur den Winter verbrachten. Ihr Mann bestärkte sie darin, indem er alle losen Fäden einer Unterhaltung mit der Bemerkung verknotete: «Das kann warten, bis wir wieder zu Hause sind.» Sechs Monate nachdem sie angekommen waren, meinte Sydney zu seiner Frau, das periodische Lüften der Schrankkoffer in der Sonne wäre mehr eine Angewohnheit als Absicht. Sie müssten schon das Gewächshaus abreißen, um ihn von der Insel wegzukriegen, denn solange es da wäre, würde auch er dableiben. Was zum Teufel treibt er nur darin, hatte sie ihn gefragt.
«Ruht sich ein bisschen aus, das ist alles. Nimmt ab und zu einen Schluck, liest und hört sich seine Platten an.»
«Es kann doch niemand drei Jahre lang Tag für Tag in einem Verschlag verbringen, wenn er nicht etwas im Schilde führt.»
«Es ist kein Verschlag», sagte Sydney, «es ist ein Gewächshaus, wie oft soll ich dir das noch sagen.»
«Nenn es, wie du willst.»
«Er züchtet Hortensien dort. Und Dahlien.»
«Wenn er Hortensien haben will, soll er nach Hause fahren. Er verschleppt uns alle an den Äquator, um Blumen zu züchten, die ein nördliches Klima brauchen?»
«Es ist noch was anderes. Erinnerst du dich, welchen Wert er zu Hause auf sein Arbeitszimmer legte? Das hier ist etwas Ähnliches, nur dass das Arbeitszimmer hier ein Gewächshaus ist.»
«Jemand, der am Äquator ein Gewächshaus baut, sollte sich schämen.»
«Hier ist nicht der Äquator.»
«Was du nicht sagst.»
«Wir sind nicht mal in seiner Nähe.»
«Glaubst du, es gibt auf unserm Planeten noch einen Ort, wo es heißer ist als hier?»
«Ich dachte, es gefällt dir hier.»
«Tut es auch.»
«Warum beklagst du dich dann?»
«Weil es mir hier gefällt, deshalb. Ich würde gern wissen, ob wir hier bleiben. So wie wir leben, kannst du gar nichts darüber sagen. Er könnte von einem Tag auf den andern abhauen und woanders hingehen.»
«Er wird hier bleiben, bis er stirbt», sagte Sydney zu ihr. «Es sei denn, dieses Gewächshaus brennt ab.»
«Dann werde ich darum beten, dass ihm nichts passiert», sagte sie, aber sie brauchte es nicht zu tun. Valerian passte sehr gut auf sein Gewächshaus auf, denn es war ein idealer Ort, um friedlich mit seinen Geistern Zwiesprache zu halten, während er Pflanzen versetzte, düngte, den Boden lockerte, Wurzeln eingrub, wässerte, entwässerte und ausdünnte. Er hatte einen kleinen Kühlschrank mit Blanc de Blancs und las Samenkataloge, während er an seinem Wein nippte. Manchmal starrte er durch die kleinen Gewächshausscheiben zum Waschhaus hin. Oder er blätterte in Katalogen und Broschüren und fing eine rege Korrespondenz an mit Gärtnereien von Tokio bis nach Newburgh, New York. Er las in dieser Zeit nur seine Post, Bücher hatte er aufgegeben, weil sich die Sprache in ihnen so sehr verändert hatte, durchsetzt war mit Rinnsalen der Unordnung und Bedeutungslosigkeit. Er liebte das Gewächshaus und die Insel, nicht jedoch seine Nachbarn. Glücklicherweise war da jedoch eine Nacht gewesen, vor drei Jahren, als er gerade anfing, sich in den Tropen einzuleben, eine Nacht, in der er mit so brutalen Zahnschmerzen aufwachte, dass es ihn aus dem Bett hob und auf die Knie zwang. Er kniete auf dem Boden, klammerte sich an den Billy-Blass-Laken fest und dachte, das muss ein Schlaganfall sein. Ein Zahn könnte mir das nicht antun. Direkt über den Wogen des Schmerzes strömten Tränen aus seinem linken Auge, während das rechte trocken wurde vor Wut. Er kroch zum Nachttisch und drückte den Knopf, der Sydney herbeirief. Als er kam, bestand Valerian darauf, dass man ihn sofort nach Queen de France brachte, aber es gab keine Möglichkeit, dorthin zu kommen. Um diese Tageszeit rührte sich noch kein Fischer, und das Passagierboot fuhr nur zweimal in der Woche. Sie selbst besaßen kein Boot, aber auch wenn sie eines gehabt hätten, hätte weder Sydney noch sonst jemand es handhaben können. Also rief der findige Butler die verhassten Nachbarn an und bekam beides: ein siebzehn Meter langes Boot, das den Namen Seabird II trug, und einen philippinischen Hausburschen, der sich damit auskannte. Nach einer waghalsigen Jeepfahrt durch die Nacht, einer endlosen Bootsfahrt und einer Taxifahrt, die allein schon unvergesslich war, standen sie um zwei Uhr morgens vor Dr. Michelins Tür. Sydney hämmerte dagegen, während sich der philippinische Hausbursche mit dem Taxifahrer unterhielt. Der Zahnarzt schrie aus dem Fenster im zweiten Stock. Er war aus Algerien verjagt worden und glaubte, seine Tür würde von einheimischen Schwarzen gestürmt, denen er nicht die Zähne reparieren wollte. Schließlich saß Valerian, erschöpft und ängstlich, im Zahnarztstuhl und überließ sich willenlos dem Franzosen. Dr. Michelin setzte Valerian eine Spritze an den Gaumen, schien es sich aber in letzter Sekunde anders zu überlegen, denn Valerian hatte das Gefühl, die Nadel steche genau ins Nasenloch bis in die Pupille und käme an der linken Schläfe wieder heraus. Er streckte die Hand nach der Hose des Doktors aus und hoffte, dass in seinem Todesgriff – einer von denen, die immer aufgebrochen werden mussten – die zerquetschten Eier eines Doktors med. dent. vorgefunden würden. Bevor er jedoch unter den karierten Bademantel greifen konnte, war der Schmerz verschwunden, und Valerian ließ seinen Tränen freien Lauf, dankbar für das Fehlen jeder Empfindung in seinem Kopf. Etwas anderes tat Dr. Michelin nicht. Er setzte sich hin, goss sich einen Drink ein und betrachtete schweigend seinen Patienten.
Diese Begegnung, die anfangs Gereiztheit und Hass ausgelöst hatte, endete in Zuneigung. Der gute Doktor ließ Valerian durch einen Strohhalm und gegen besseres Wissen ein bisschen von seinem Brandy trinken, und Valerian erkannte einen Mann, der seinen Hippokrates-Eid ernst nahm. Sie mochten sich und tranken zusammen in dieser Nacht, und die Kombination von Novocain und Brandy machte Valerian mitteilsam wie seit Jahren nicht mehr. Sie besuchten sich gelegentlich, und immer, wenn Valerian an ihre erste Begegnung dachte, berührte er die Stelle, an der der Abszess gewesen war, und lächelte. Es hatte etwas von einem Comic an sich: zwei ältere Männer, die tranken und sich über Pershing stritten (dem Valerian tatsächlich begegnet war), und keiner von ihnen erwähnte je das Thema Exil oder Alter, obwohl es gerade das war, was sie gemeinsam hatten. Beide hatten das Gefühl, als wären sie aus ihrer Heimat vertrieben worden. Robert Michelin musste Algerien verlassen, Valerian Street war freiwillig von Philadelphia ins Exil gegangen.
Beide waren schon einmal verheiratet gewesen, und keiner hatte in den langen Jahren der zweiten Ehe die erste vergessen können. Die Erinnerung an diese kummervollen Jahre, die sie im Sog einer streitsüchtigen Frau verbracht hatten, war bei beiden noch lebendig. Michelin war ein Jahr nach seiner Scheidung wieder verheiratet, während Valerian lange Zeit Junggeselle blieb, mit voller Absicht, bis er dann an einem frostigen Wintertag in Maine nach dem Lunch einen Spaziergang machte, in der Hoffnung, die gereizte Langeweile loszuwerden, die er in Gesellschaft all der Vertreter aus der Lebensmittelindustrie empfunden hatte. Nach zwei Straßen war er auf der Hauptstraße gewesen und hatte sich mitten im Gedränge eines Karnevalszugs befunden. Zuerst sah er den Eisbären, und dann sah er sie. Der Bär stand auf seinen Hinterbeinen, die Vorderbeine hatte er wie segnend erhoben. Ein Mädchen mit rosigen Wangen hielt wie eine Braut die eine Vorderpfote des Bären fest. Der Plastik-Iglu hinter ihnen ließ ihren roten Samtmantel und den Hermelinmuff, mit dem sie der Menge zuwinkte, sehr effektvoll hervortreten. In dem Augenblick, als er sie erblickte, kniete etwas in ihm nieder.
Jetzt saß er in der Dezembersonne und schaute zu, wie sein Butler Kaffee in seine Tasse goss.
«Ist es gekommen?»
«Sir?»
«Das Postschiff.»
«Noch nicht.» Sydney riss eine kleine Schachtel mit Saccharintabletten auf und schob sie seinem Herrn zu.
«Sie lassen sich Zeit.»
«Die Post kommt nur noch zweimal wöchentlich, ich sagte es Ihnen schon.»
«Es ist einen Monat her.»
«Zwei Wochen. Tut es immer noch weh?»
«Im Augenblick nicht, aber es wird bald wieder anfangen.» Valerian streckte die Hand nach den Zuckerwürfeln aus.
«Sie sollten nicht so auf diesen Schuhen bestehen. Sandalen oder ein Paar hübsche huaraches über Tag würden Ihre entzündeten Ballen in Ordnung bringen.»
«Es sind nicht die Ballen. Es sind Hühneraugen.» Valerian ließ die Zuckerwürfel in seine Tasse fallen.
«Hühneraugen auch.»
«Wenn Sie Ihren Doktor machen, sagen Sie mir Bescheid. Hat Ondine das hier gebacken?»
«Nein. Mrs. Street brachte sie gestern mit.»
«Sie benutzt das Boot wie ein Fahrrad, hin und her, und hin und her.»
«Warum kaufen Sie sich nicht ein eigenes? Dieses Ding ist zu groß für sie. Man kann nicht Wasserski damit fahren. Man kann es nicht einmal in der Stadt am Kai festmachen. Sie müssen es woanders lassen und in ein kleines Boot umsteigen, wenn sie an Land wollen.»
«Warum sollte ich ihr ein Boot kaufen und es zehn Monate im Jahr ungenutzt herumstehen lassen. Wenn diese Schwachköpfe sie ihres nutzen lassen, habe ich nichts dagegen einzuwenden.»
«Vielleicht würde sie das ganze Jahr über bleiben, wenn sie eines hätte.»
«Unwahrscheinlich. Und ich würde es vorziehen, sie bliebe ihres Mannes wegen hier und nicht eines Bootes wegen. Sagen Sie jedenfalls Ondine, sie soll diese Dinger nicht mehr auf den Tisch bringen.»
«Sind sie nicht gut?»
«Mit am schlimmsten am Altwerden ist das Essen. Erst muss man einmal etwas finden, was man essen kann, und dann muss man aufpassen, dass man sich nicht über und über damit bekleckert.»
«Dessen war ich mir nicht bewusst.»
«Natürlich nicht. Sie sind ja auch eine Viertelstunde jünger als ich. Trotzdem, sagen Sie Ondine: nichts mehr von diesem Zeug. Sie sind zu blätterig. Egal wie man es anstellt, sie fliegen überallhin.»
«Croissants müssen so sein. So mürbe wie möglich.»
«Sagen Sie es ihr, Sydney, und damit basta.»
«Jawohl, Sir.»
«Und fragen Sie den Boy, ob er die Ziegelsteine in Ordnung bringen kann. Sie stehen überall hoch.»
«Er braucht Zement dazu, sagt er.»
«Nein. Keinen Zement. Er muss sie nur ordentlich runterdrücken, wenn er es richtig macht, bleiben sie auch im Boden.»
«Jawohl, Sir.»
«Ist Mrs. Street wach?»
«Ich glaube. Brauchen Sie noch etwas für die Feiertage?»
«Nein. Nur die Gänse. Ich werde zwar nichts davon essen können, aber ich möchte sie trotzdem auf dem Tisch sehen. Und noch etwas Thalidomid.»
«Soll Ihnen Yardman das Thalidomid mitbringen? Er kann das Wort nicht einmal aussprechen.»
«Schreiben Sie eine Notiz. Und sagen Sie ihm, er soll sie Dr. Michelin geben.»
«In Ordnung.»
«Und sagen Sie Ondine, dass halb Sanka, halb Kaffee scheußlich schmeckt. Scheußlicher als Sanka allein.»
«Okay, okay. Sie dachte nur, es würde Ihnen helfen.»
«Ich weiß, was sie dachte, aber die Hilfe ist schlimmer als das Problem.»
«Vielleicht ist es gar nicht dieses Problem, das Ihnen Schwierigkeiten macht.»
«Sie wollen mir unbedingt ein Magengeschwür anhängen. Ich habe keins. Sie haben ein Magengeschwür. Ich habe nur gelegentlich Beschwerden.»
«Ich hatte ein Magengeschwür. Es ist jetzt weg, und das verdanke ich dem Malzkaffee.»
«Freut mich. Sagten Sie, sie wäre wach?»
«Sie war wach. Vielleicht ist sie aber wieder eingeschlafen.»
«Was wollte sie?»
«Was sie wollte?»
«Ja, was wollte sie. Sie können doch nur wissen, dass sie wach war, weil sie nach Ihnen geklingelt hat. Was wollte sie?»
«Handtücher, frische Handtücher.»
«Sydney.»
«Wirklich. Ondine hatte vergessen –»
«Was war in den Handtüchern eingewickelt?»
«Warum glauben Sie das immer? Sie trinkt nicht mehr als das, was Sie sie trinken sehen. Etwas Wein zum Abendessen, das ist alles, und kaum mehr als ein Gläschen. Sie hat noch nie getrunken. Wenn jemand hier trinkt, dann sind Sie es. Warum wollen Sie unbedingt eine Trinkerin aus ihr machen?»
«Ich werde mit Jade reden.»
«Was könnte Jade wissen, was ich nicht weiß?»
«Nichts, aber sie ist die Ehrlichkeit in Person.»
«Hören Sie, Mr. Street, es ist die Wahrheit.»
Valerian hielt mit seiner Gabel ein Viertel der Ananas fest und zerteilte es in kleine Stücke.
«Okay», sagte Sydney, «ich will’s Ihnen sagen. Sie wollte, dass Yardman am Donnerstag, bevor er herkommt, noch beim Flughafen vorbeifährt.»
«Und weshalb, wenn ich fragen darf?»
«Wegen eines Koffers. Sie erwartet einen Koffer. Er ist schon aufgegeben worden, sagte sie, und müsste längst hier sein.»
«Idiotisch.»
«Sir?»
«Idiotisch. Idiotisch.»
«Mrs. Street, Sir?»
«Mrs. Street, Mr. Street, Sie, Ondine. Alle. Dies ist das erste Mal seit dreißig Jahren, dass ich dieses Haus genießen konnte. Wirklich darin leben konnte. Nicht nur für einen Monat oder für ein Wochenende, sondern für längere Zeit, und sie alle haben nichts anderes im Sinn, als mir das zu verderben. Ein ständiges Kommen und Gehen. Ich fange an, mich wie auf dem Bahnhof an der 30. Straße zu fühlen. Warum könnt ihr euch nicht zufriedengeben, euch entspannen und ein hübsches schlichtes Weihnachtsfest feiern. Nicht ein Haufen Menschen, sondern nur ein hübsches einfaches Festessen.»
«Ich nehme an, sie langweilt sich ein bisschen. Hat mehr Zeit, als sie braucht.»
«Verrückt. Jade ist hier. Sie sind wie die Schulmädchen zusammen – jedenfalls kommt es mir so vor. Oder irre ich mich?»
«Nein, das stimmt. Sie verstehen sich gut, sie mögen es, wenn sie beieinander sind, beide.»
«Aber wohl nicht genug, um es dabei zu belassen. Wir erwarten offenbar noch mehr Gesellschaft, und da ich nur der Besitzer und Manager dieses Hotels bin, hält man es nicht einmal für nötig, mich zu unterrichten.»
«Wollen Sie noch etwas Toast?»
«Und Sie! Sie haben mich völlig überrascht. Was haben Sie mir sonst noch verheimlicht?»
«Essen Sie Ihre Ananas.»
«Ich bin dabei.»
«Ich kann nicht den ganzen Morgen hier herumstehen. Sie haben Hühneraugen – ich habe entzündete Ballen.»
«Wenn Sie meinen Rat nicht annehmen, müssen Sie die Konsequenz tragen – Ballen.»
«Ich kenne meine Arbeit. Ich bin ein erstklassiger Butler, und in Slippern kann ich nicht erstklassig sein.»
«Sie kennen Ihre Arbeit, aber ich kenne Ihre Füße. Thom McAns werden Sie noch ins Grab bringen.»
«Ich habe in meinem Leben noch nie Thom McAns getragen. Nie. Auch 1929 habe ich keine getragen.»
«Ich erinnere mich genau an mindestens vier Paare anständiger Schuhe, die ich Ihnen gegeben habe.»
«Mir sind meine Ballen lieber als Hühneraugen.»
«In Ballyschuhen bekommt man keine Hühneraugen. Sie bewahren einen eher davor. Wenn man schwitzt, bekommt man welche. Wenn –»
«Sehen Sie? Sie sitzen in der Falle. Genau das meinte ich. Schuhe, die für Philadelphia gut sind, taugen nichts in den Tropen. Die Füße schwitzen nur in ihnen. Sie brauchen ein Paar hübsche huaraches. Das tut den Füßen gut. Lässt Luft an sie heran, sodass sie atmen können.»
«Ein Tag in huaraches ist für mich wie ein Tag in einer Zwangsjacke.»
«Wenn Sie weiter an Ihren Zehen mit einem Rasiermesser rumhacken, werden Sie noch um eine Zwangsjacke betteln.»
«Sie werden jedenfalls nichts davon mitkriegen, denn Ihre Thom-McAn-Ballen werden Sie für den Rest Ihres Lebens in einen Schaukelstuhl verbannen.»
«Ich habe nichts dagegen.»
«Ich auch nicht. Vielleicht finde ich dann jemand, der mir nicht alles verheimlicht. Mir nicht einen anständigen Topf Kaffee mit Malzkaffee und eine Zitronencreme mit Saccharin versaut. Und glauben Sie nur nicht, ich wüsste nicht, dass das Salz auch kein richtiges Salz ist.»
«Die Gesundheit ist das Wichtigste in Ihrem Alter, Mr. Street.»
«Keineswegs. Es ist das am wenigsten Wichtige. Ich habe nicht die Absicht, nur am Leben zu bleiben, um aufzuwachen, mich die Treppe runterzuschleppen und morgens eine Tasse Malzkaffee zu trinken. Sehen Sie mal im Schrank nach, und geben Sie mir etwas Medizin für dieses Zeug.»
«Cognac ist keine Medizin», Sydney ging auf das Buffet zu und bückte sich, um eine der Türen zu öffnen.
«Mit siebzig ist alles Medizin. Sagen Sie Ondine, sie soll damit aufhören. Es hilft mir überhaupt nicht.»
«Ihre Laune verbessert es wirklich nicht.»
«Richtig. Und nun sagen Sie mir bitte sehr ruhig und sehr schnell, wer das ist, dieser Gast, den wir erwarten.»
«Es ist kein Gast, Mr. Street.»
«Sie sollten netter sein zu einem alten Mann, der Malzkaffee trinken muss.»
«Es ist ihr Sohn. Michael ist kein Gast.»
Valerian stellte seine Tasse vorsichtig auf die Untertasse.
«Hat sie das gesagt? Dass Michael kommt?»
«Nein. Nicht ausdrücklich. Aber sie sagte, woher der Koffer käme und welche Farbe er hätte, damit ich Yardman Bescheid sagen konnte.»
«Dann kommt er aus Kalifornien.»
«Er kommt aus Kalifornien.»
«Und ist rot.»
«Und ist rot. Feuerrot.»
«Mit Dick-Gregory-for-President-Aufklebern an den Seiten.»
«Und einer aufgemalten Zielscheibe auf dem Deckel.»
«Und einem Schloss, das sich nur schließt, wenn man dagegen tritt und das man mit einer Haarnadel wieder öffnen muss, und der Schlüssel ist …» Valerian hielt inne und sah zu Sydney hoch. Sydney sah Valerian an.
Sie sagten es zusammen: «… auf dem Gipfel des Kilimandscharo.»
«Ein Witz», meinte Valerian.
«Nicht schlecht für einen Siebenjährigen.»
Sie schwiegen eine Zeitlang, Valerian kaute seine Ananas, Sydney lehnte sich gegen das Buffet. Dann sagte Valerian:
«Warum er wohl immer noch so an ihm hängt? Ein Ferienkoffer fürs Sommerlager aus seiner Kindheit!»
«Er kann seine Garderobe darin verstauen.»
«Töricht. Das Ganze. Der Koffer, er und dieser Besuch. Außerdem wird er nicht erscheinen.»
«Sie denkt, dieses Mal kommt er.»
«Sie denkt überhaupt nicht. Sie träumt, das arme Kind. Sind Sie sicher, dass nichts zwischen diesen Handtüchern war?»
«Hier kommt Madame. Fragen Sie sie selbst.»
Das leise Klicken auf den mexikanischen Fliesen wurde lauter.
«Wenn der Boy zum Flugplatz geht», flüsterte Valerian, «sagen Sie ihm, er soll auf dem Rückweg etwas Darmol mitbringen.»
«Oh, là, là», sagte er zu seiner Frau, «wer kommt denn da? Die Wunderfrau?»
«Bitte», sagte sie, «es ist zu heiß. Guten Morgen, Sydney.»
«Morgen, Mrs. Street.»
«Und was ist das zwischen deinen Augenbrauen?»
«Ein Fältchenpflaster.»
«Wie bitte?»
«Ein Fältchenpflaster.»
Sydney ging um den Tisch, neigte die Kanne und goss geräuschlos Kaffee in ihre Tasse.
«Hindert dich das, die Augenbrauen zusammenzuziehen?», fragte ihr Mann.
«Ja.»
«Und das hilft?»
«So sagt man.» Sie hielt die Tasse an ihre Lippen und schloss die Augen. Der Dampf stieg ihr ins Gesicht, während sie einatmete.
«Ich bin verwirrt. Nicht senil, keine Sorge. Nur verwirrt. Warum möchtest du denn die Augenbrauen runzeln?»
Margaret sog noch einmal den Kaffeedampf ein und öffnete dann langsam ihre Augen. Sie blickte ihren Mann an, mit der ganzen Abneigung, die ein Langschläfer für einen gutgelaunten Frühaufsteher empfindet.
«Ich möchte es ja gar nicht. Wenn man die Augenbrauen runzelt, kann man nicht die Stirn runzeln. Das wirkt den Folgen des Stirnrunzelns entgegen.»
Valerian öffnete den Mund, sagte jedoch einen Augenblick nichts. Dann: «Warum lässt du es dann nicht einfach? Dann brauchtest du dir auch keine Tesafilmstückchen ins Gesicht zu kleben.»
Margaret trank etwas Kaffee und stellte die Tasse wieder auf die Untertasse. Sie zog den Ausschnitt ihres Kleides nach vorn, blies sanft auf ihren Busen und betrachtete die blassen Ananas-Stückchen, die Sydney vor sie hingestellt hatte. Ondine hatte absichtlich die stachelige Schale unten drangelassen – nur um sie zu ärgern und zu verwirren. «Ich dachte, es gäbe … Mangos.» Sydney nahm die Frucht weg und eilte zur Schwingtür. «Was ist nur los? Jeden Morgen dasselbe!»
«Ich wollte Ananas haben. Wenn du keine magst, dann sag Sydney am Abend vorher Bescheid, was du am nächsten Morgen gern zum Frühstück hättest. Dann kann er …»
«Sie weiß, dass ich frische Ananas nicht ausstehen kann. Die Fasern bleiben mir in den Zähnen hängen. Aus Dosen mag ich sie. Ist das so schrecklich?»
«Ja. Schrecklich.»
«Sie bestimmen, was wir zu essen haben. Wer arbeitet hier eigentlich für wen?»
«Wenn du Ondine den Speisezettel für die ganze Woche gibst, dann wird sie sich genau danach richten.»
«Wirklich? Du hast das dreißig Jahre lang versucht und hast sie nicht einmal dazu gebracht, dass sie dir eine Tasse Kaffee macht. Sie lässt dich Malzkaffee trinken.»
«Das ist etwas anderes.»
«Natürlich.»
Sydney kam mit einer Schale zerstoßenem Eis zurück, aus der eine Mango ragte. Die Haut war in perfekten Rollen von der glänzenden Frucht abgezogen. Die Einschnitte im Fruchtfleisch waren kaum zu sehen. Valerian gähnte hinter der vorgehaltenen Faust und sagte: «Sydney, kann ich nun eine Tasse Kaffee haben oder nicht?»
«Jawohl, Sir. Natürlich.» Er stellte die Mango hin und füllte Valerians Tasse.
«Siehst du, Margaret. Da ist deine Mango. Vierhundertfünfundzwanzig Kalorien.»
«Und dein Croissant?»
«Hundertsiebenundzwanzig.»
«Du lieber Himmel.» Margaret schloss ihre Augen, ihre ach so blauen Augen, und legte die Gabel auf den Tisch.
«Iss eine Pampelmuse.»
«Ich will keine Pampelmuse. Ich will eine Mango.»
Valerian zuckte die Schultern. «Iss, was du willst. Obwohl du gestern Abend drei Portionen Creme gegessen hast.»
«Zwei, ich habe nur zweimal genommen. Jade hatte drei.»
«Also gut, nur zwei …»
«Wozu haben wir eigentlich einen Koch? Pampelmusen kann ich selbst zerteilen.»
«Um das Geschirr abzuwaschen.»
«Wer braucht Geschirr? Deiner Meinung nach brauche ich doch nur einen Teelöffel.»
«Den auch jemand abwaschen muss.»
«Und deine Schaufel.»
«Komisch. Sehr komisch.»
«Es stimmt aber.» Margaret hielt den Atem an und stieß die Gabel in die Mango. Sie atmete langsam aus, als die Zinken einen Teil davon aufspießten. Sie warf Valerian einen Blick zu, bevor sie das Stück in den Mund schob. «Ich habe noch nie erlebt, dass jemand so viel essen kann wie du und kein Gramm zunimmt – noch nie. Ich glaube, sie tut etwas in mein Essen hinein. Weizenkeime oder so etwas Ähnliches. Schleicht sich nachts mit einem von diesen intravenösen Dingern in mein Zimmer und pumpt mich voll mit Malzextrakt.»
«Niemand pumpt dich mit etwas voll.»
«Oder vielleicht mit Schlagsahne.»
Sydney hatte sie während ihrer Kaloriendiskussion verlassen und kam jetzt mit einem silbernen Tablett zurück, auf dem hauchdünne Scheiben Schinken mit einem verlorenen Ei in der Mitte in einem Toastkörbchen steckten. Er ging zum Buffet und hob sie auf die Teller. Auf den rechten Rand legte er etwas Petersilie, auf den linken zwei Tomatenscheibchen. Er schob die Schalen mit den Früchten zur Seite, vorsichtig, damit nichts von dem Eiswasser verschüttet wurde, und beugte sich dann mit der heißen Speise vor. Margaret runzelte die Stirn und winkte ab. Sydney ging zum Buffet zurück, stellte den verschmähten Teller ab und nahm den andern hoch. Valerian nahm ihn freudig in Empfang, und Sydney schob das Salz und die Pfeffermühle ein paar Zentimeter aus seiner Reichweite weg. «Ich nehme an, du dekorierst das Haus mit Weihnachtsgästen. Gib mir doch bitte das Salz.»
«Warum nimmst du das an?» Margaret streckte eine perfekt manikürte Hand aus und reichte ihm das Salz und den Pfeffer. Ihr kleiner Sieg mit der Mango stärkte sie genug, um sich auf das, was ihr Mann sagte, zu konzentrieren.
«Weil ich dich gebeten hatte, es nicht zu tun. Und daraus folgt, dass du dich darüber hinwegsetzen würdest.»
«Ganz wie du meinst. Lass uns die Feiertage nur allein im Keller verbringen.»
«Wir haben gar keinen Keller, Margaret. Du solltest dich einmal genauer hier umschauen. Vielleicht würde es dir sogar gefallen. Ich könnte mir vorstellen, dass du noch nie die Küche gesehen hast, stimmt’s? Wir haben zwei, zwei Küchen. Eine ist …»
«Valerian, bitte, sei still.»
«Aber es ist aufregend. Wir kommen erst seit dreißig Jahren hierher, und schon hast du das Esszimmer entdeckt. Das sind im ganzen drei Zimmer. Alle zehn Jahre eines. Zuerst entdecktest du das Schlafzimmer. Das heißt, ich nehme es an. Es ist schwer zu sagen, wenn eine Frau getrennt von ihrem Ehepartner schläft. Dann, 1965 war es, glaube ich, entdecktest du das Wohnzimmer. Erinnerst du dich daran? An die Cocktailpartys? Das waren gute Zeiten. Höhepunkte, würde ich sagen. Du kanntest nicht nur den Flugplatz und den Anlegeplatz und das Schlafzimmer, sondern auch das Wohnzimmer.»
«Ja, ich habe Gäste für Weihnachten.»
«Und dann das Speisezimmer. Was für eine Entdeckung! Dinner für zehn, zwanzig, dreißig Personen. Und bedenke, was für Möglichkeiten noch in einer Küche stecken, von zwei ganz zu schweigen. Wir können Hunderte, Tausende bewirten.»
«Michael kommt.»
«Ich würde es nicht mehr länger aufschieben an deiner Stelle. Wenn wir uns beeilen, können wir zu meinem achtzigsten Geburtstag ganz Philadelphia einladen.»
«Und ein Freund von ihm. Das ist alles.»
«Er wird nicht kommen.»
«Ich hatte nie mehr als zwölf Gäste in diesem Haus.»
«Sein Freund wird kommen, aber er nicht. Wie üblich.»
«Und ich bin keine Köchin, bin noch nie eine gewesen. Ich will die Küche nicht sehen. Ich mag Küchen nicht.»
«Warum machst du dir jedes Jahr wieder Hoffnungen? Du weißt, er wird dich enttäuschen.»
«Ich war noch ein Kind, als ich heiratete, erinnerst du dich? Bevor ich überhaupt Zeit fand, kochen zu lernen, stecktest du mich in ein Haus, das schon eine Küche hatte – und noch eine zweite hundert Kilometer von der Haustür entfernt.»
«Mir scheint, es ist nicht immer so gewesen. Wie ihr beiden, du und Ondine, zusammen in der Küche gekichert habt, ist eine meiner deutlichsten und liebsten Erinnerungen.»
«Warum sagst du das? Das sagst du immer.»
«Es stimmt. Ich kam nach Hause und du –»
«Nicht das! Das von Michael, meine ich. Dass er nicht kommen würde.»
«Weil er nie gekommen ist.»
«Er war noch nie hier. Hier in diesem Dschungel, wo er nicht weiß, was er anfangen soll. Wo es keine jungen Leute gibt. Kein Vergnügen, keine Musik …»
«Keine Musik?»
«Ich meine, Musik, die er mag.»
«Du überraschst mich.»
«Und damit er sich nicht zu Tode langweilt, habe ich einen Freund von ihm eingeladen –» Sie brach ab und drückte den Finger auf den Tesafilmstreifen zwischen ihren Augenbrauen. «Deinetwegen habe ich seit Jahren niemand hierher eingeladen. Du hasst doch alle.»
«Ich hasse nicht alle.»
«Das letzte Mal war vor drei Jahren. Was ist los mit dir? Willst du deinen eigenen Sohn nicht mehr sehen? Ich weiß, du willst niemanden sehen – aber deinen Sohn! Du widmest diesem dicken Zahnarzt mehr Aufmerksamkeit als Michael. Was versuchst du dir hier zu beweisen? Warum ziehst du dich von allem und allen zurück?»
«Ich erlebe gerade die sehr große Veränderung in meinem Leben, die man Sterben nennt.»
«Ruhestand ist nicht gleich Tod.»
«Ein nur nomineller Unterschied.»
«Nun, ich sterbe nicht. Ich lebe.»
«Ein Unterschied ohne Distinktion.»
«Und ich werde mit ihm zurückgehen.»
«Das klingt endgültig.»
«Ist es vielleicht auch.»
«Weihnachten ist nicht die beste Zeit für solche Entschlüsse, Margaret. Es ist ein sentimentales Fest, voll von törichten –»
«Hör zu. Ich werde mit ihm gehen.»
«Ich rate dir davon ab.»
«Das kümmert mich nicht.»
«Er ist kein kleiner Junge mehr. Ich weiß, sein Koffer ist zwar etwas irreführend, aber er wird bald dreißig, Margaret.»
«Na und?»
«Was verleitet dich zu der Annahme, dass er mit dir zusammenleben möchte?»
«Er möchte es.»
«Willst du mit ihm auf Reisen gehen? Schlangentänze besuchen?»
«Ich werde in seine Nähe ziehen, nicht zu ihm. Nur in seine Nähe.»
«Es wird nicht gutgehen.»
«Warum nicht?»
Valerian legte seine Hände links und rechts neben seinen Teller. «Er interessiert sich nicht sehr für uns, Margaret.»
«Für dich», sagte sie, «er interessiert sich nicht sehr für dich.»
«Wie du meinst.»
«Dann kann ich also fahren?»
«Wir werden sehen. Frag ihn, wenn er hier ist. Frag ihn, ob er will, dass seine Mutter in einer Eigentumswohnung neben dem Reservat lebt.»
«Das hat er hinter sich. Die Schule ist zu Ende. Er ist nicht mehr mit ihnen zusammen.»
«Oh! Die Hopis sind passé? Dann ist er zu den Choctaws übergegangen, nehme ich an? Nein, warte mal. C kommt vor H. Zu den Navajos, stimmt’s?»
«Er ist in überhaupt keiner Clique. Er studiert.»
«Und was, wenn ich fragen darf?»
«Irgendetwas mit Umwelt. Er will Anwalt für Umweltfragen werden.»
«Tatsächlich?»
«Ja.»