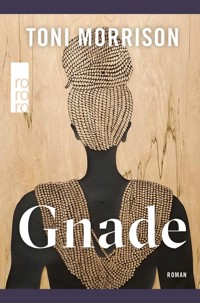
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nordamerikanische Kolonien, Ende des 17. Jahrhunderts: Die kleine Florens, nicht älter als sieben oder acht Jahre, wird zur Begleichung einer Schuld an den Farmer und Geldverleiher Jacob Vaark verkauft. In Florens' Leben ändert sich dadurch alles. Sie gehört nun zu Vaarks Haushalt, zusammen mit seiner Frau Rebekka, die nicht freiwillig in die Neue Welt gekommen ist, mit der indigenen Hausangestellten Lina, die als eine der wenigen ihres Dorfes die Pocken überlebt hat, und mit der geheimnisvollen Sorrow, die nach einem Schiffbruch gerettet wurde. Als Vaark stirbt, kämpfen die vier Frauen zusammen gegen die harsche Natur und die Rückkehr der Wildnis auf die Farm. Sie alle tragen ihre Geschichte mit sich, sie alle werden von den Geistern der Vergangenheit heimgesucht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 260
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Toni Morrison
Gnade
Roman
Überarbeitet und sprachlich aktualisiert von Mirjam Nuenning
Über dieses Buch
Delaware, 1682: Als der Farmer und Geldverleiher Jacob Vaark stirbt, bleiben vier Frauen zurück auf der Farm, im Kampf gegen die harsche Natur: Rebekka, seine Ehefrau, die nicht freiwillig über den Atlantik gekommen ist, die indigene Hausangestellte Lina, die die Pocken überlebt hat, Sorrow, die nach einem Schiffbruch gerettet wurde, und Florens, die zur Begleichung einer Schuld an Vaark verkauft wurde. Sie alle tragen ihre Geschichte mit sich, sie alle werden von den Geistern der Vergangenheit heimgesucht.
«Eine wundersame Geschichte voller Leid und Schönheit.» Oprah Winfrey
«Einer der besten Romane des 21. Jahrhunderts.» The New York Times
Vita
Toni Morrison wurde 1931 in Lorain, Ohio, geboren. Sie studierte an der renommierten Cornell University Anglistik und hatte an der Princeton University eine Professur für afroamerikanische Literatur inne. Zu ihren bedeutendsten Werken zählen «Sehr blaue Augen», «Solomons Lied», «Beloved», «Jazz», «Paradies» und ihr essayistisches Schaffen. Sie war Mitglied des National Council on the Arts und der American Academy of Arts and Letters. Sie wurde mit zahlreichen Preisen, u. a. dem National Book Critics Circle Award und dem American Academy of Arts and Letters Award für Erzählliteratur, ausgezeichnet. 1993 erhielt sie den Nobelpreis für Literatur, und 2012 zeichnete Barack Obama sie mit der Presidential Medal of Freedom aus. Toni Morrison starb am 5. August 2019.
Impressum
Die englische Originalausgabe erschien 2008 unter dem Titel «A Mercy» bei Alfred A. Knopf, New York.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Dezember 2025
Copyright © 2010 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg
«A Mercy» Copyright © 2008 by Toni Morrison
Covergestaltung Anzinger und Rasp, München
Coverabbildung Tracy Murrell
ISBN 978-3-644-02464-9
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für R.G.
für Jahrzehnte voller Urteilskraft, Scharfblick und Geist.
Danke!
Hab keine Angst. Was ich erzähle, kann dir nicht wehtun, trotz meiner Tat, und ich verspreche, ganz ruhig im Dunkeln zu liegen – vielleicht zu weinen oder dann und wann das Blut wieder vor Augen zu haben –, aber niemals wieder werde ich meine Glieder recken und mich erheben und die Zähne zeigen. Ich will erklären. Du kannst für eine Beichte halten, was ich dir erzähle, aber es ist eine Beichte voller Seltsamkeiten, wie man sie nur aus Träumen kennt oder von den Augenblicken, da der Dampf des Wasserkessels sich zum Umriss eines Hundeschädels formt. Oder wenn die Puppe aus Maisstroh, die eben noch auf dem Regalbrett sitzt, im nächsten Nu verrenkt in einer Zimmerecke liegt und klar ist, welcher böse Wille sie dorthin gestoßen hat. Merkwürdigeres geschieht, überall und immer wieder. Du weißt das. Ich weiß, dass du das weißt. Eine Frage lautet: Wer steckt dahinter?
Eine andere: Kannst du es lesen? Wenn ein Huhn nicht legen will, lese ich die Bedeutung rasch heraus, und natürlich sehe ich in dieser Nacht eine minha mãe, Hand in Hand mit ihrem kleinen Jungen, und meine Schuhe beulen die Taschen ihrer Schürze. Andere Zeichen erschließen sich nicht so schnell. Oft sind ihrer zu viele, oder ein leuchtendes Omen verdunkelt sich zu bald. Ich ordne sie und versuche, sie im Gedächtnis zu behalten, aber ich weiß, dass mir vieles entgeht, die Gartenschlange zum Beispiel, die bis an die Türschwelle kriecht, um dort zu sterben. Lass mich mit dem beginnen, was ich sicher weiß.
Am Anfang fängt es an mit den Schuhen. Als Kind kann ich es nicht ertragen, barfuß zu gehen, und immer bettle ich um Schuhe, egal von wem, selbst an den heißesten Tagen. Meine Mutter, minha mãe, runzelt die Stirn, ist wütend über das, was sie meine Putzsucht nennt. Nur die schlimmen Frauen gehen auf hohen Absätzen. Ich bin gefährlich, sagt sie, und wild, aber sie gibt nach und lässt mich die abgelegten Schuhe aus dem Haus der Senhora tragen, vorne zugespitzt, einer der erhöhten Absätze gebrochen, der andere abgetreten und über dem Spann eine Schnalle. Daher kommt es, sagt Lina, dass meine Füße nichts taugen, dass sie immer zu zart sein werden fürs Leben und nie die starken Sohlen haben werden, zäher als Leder, die das Leben verlangt. Und Lina hat recht. Florens, sagt sie, wir schreiben 1690. Wer sonst hat heutzutage die Hände einer Sklavin und die Füße einer portugiesischen Lady? Deshalb geben sie und die Mistress mir die Stiefel des Sirs, als ich aufbreche, um dich zu suchen, Stiefel, die für einen Mann gemacht sind und nicht für ein Mädchen. Sie stopfen sie mit Heu und klebrigen Maisblättern aus und sagen, ich soll den Brief in meinem Strumpf verstecken, auch wenn der Siegellack kratzt. Ich kann lesen, was Lina und Sorrow nicht können, aber ich schaue mir nicht an, was die Mistress schreibt. Ich weiß aber, was es denen sagen soll, die mich aufhalten wollen.
Mein Kopf ist wirr von zwei Dingen, die durcheinandergehen, dem Hunger nach dir und der Angst, mich zu verirren. Nichts jagt mir mehr Furcht ein als dieser Auftrag, und nichts ist größere Versuchung. Vom Tag deines Verschwindens an träume ich und schmiede Pläne. Wie ich erfahren kann, wo du bist, und wie ich dorthin gelange. Ich will der Wegspur folgen zwischen Ahornbäumen und Weißkiefern, aber ich frage mich, in welche Richtung. Wer wird es mir sagen? Wer lebt in der Wildnis zwischen dieser Farm und dir, und werden sie mir helfen oder mir etwas zuleide tun? Was ist mit den knochenlosen Bären im Tal? Du erinnerst dich? Wie ihr ganzes Fell wabbelt, wenn sie sich bewegen, so als wäre nichts Festes darunter. Ihr Geruch straft ihre Schönheit Lügen, und ihre Augen kennen uns aus der Zeit, da wir selbst wilde Tiere waren. Deshalb, so hast du mir erklärt, ist es gefährlich, ihnen ins Auge zu blicken. Dann kommen sie näher, laufen her zu uns, um zu spielen und gut Freund zu sein, was wir falsch verstehen und ihnen mit Angst und Abwehr vergelten. Auch riesige Vögel nisten da draußen, größer als Kühe, erzählt Lina, und nicht alle natives seien wie sie, also pass auf. Eine betende Wilde, so nennen sie die Leute aus der Nachbarschaft, denn sie geht zur Kirche, aber sie badet auch jeden Tag, was christliche Menschen nicht tun. Untendrunter trägt sie leuchtend blaue Perlen, und wenn der Mond schmal ist, tanzt sie heimlich im Morgengrauen. Mehr als die Bären, die gut Freund sein wollen, oder die Vögel, die größer sind als Kühe, fürchte ich die weglose Nacht. Wie, frage ich mich, soll ich dich finden in der Finsternis? Jetzt endlich zeigt sich ein Weg. Ich habe Weisungen. Vorbereitungen sind getroffen. Ich werde deinen Mund sehen und meine Finger hinunterwandern lassen. Du wirst dein Kinn in meinem Haar bergen, während ich in die Höhlung deiner Schulter atme, ein und aus, ein und aus. Ich bin glücklich, dass die Welt sich für uns öffnet, aber all das Neue macht mich zittern. Um zu dir zu gelangen, muss ich das einzige Zuhause verlassen, das ich kenne, die einzigen Menschen. Lina sagt, nach dem Zustand meiner Zähne zu schließen bin ich etwa sieben oder acht, als man mich hierher bringt. Achtmal kochen wir seitdem wilde Pflaumen ein für Aufstrich und für Kuchen, also muss ich jetzt sechzehn sein. Vor dieser Farm hier verbringe ich meine Tage mit dem Pflücken von Okraschoten und dem Ausfegen von Tabakscheunen und meine Nächte zusammen mit minha mãe auf dem Fußboden des Küchenhauses. Wir sind getauft und können glücklich sein, sobald wir dieses Leben hinter uns haben. Der ehrwürdige Vater erzählt uns das. Alle sieben Tage lernen wir lesen und schreiben bei ihm. Wir dürfen die Plantage nicht verlassen, deshalb verstecken wir uns, alle vier, wo das Sumpfland beginnt. Meine Mutter, ich, ihr kleiner Junge und der ehrwürdige Vater. Er darf nicht tun, was er tut, aber trotzdem unterrichtet er uns und sieht sich dabei immer nach bösen Männern aus Virginia und nach Protestanten um, die ihn fangen wollen. Wenn sie das tun, kommt er ins Gefängnis oder muss Geld bezahlen oder beides. Er hat zwei Bücher und eine Schiefertafel. Wir haben Stöcke, um Zeichen in den Sand zu ritzen, und kleine Kiesel, um auf flachen Steinen Wörter zu legen. Sobald die Buchstaben im Gedächtnis sitzen, bilden wir ganze Wörter daraus. Ich bin schneller als meine Mutter, und ihr kleiner Junge ist überhaupt nicht gut. Schon bald kann ich das Nizäische Glaubensbekenntnis hinschreiben, auswendig und mit allen Kommas. Die Beichte wird gesprochen, nicht geschrieben wie jetzt. Ich habe das meiste davon vergessen. Aber ich liebe das Reden. Lina redet, Steine können reden und sogar Sorrow. Am besten von allem ist es, wenn du redest. Als man mich hierher bringt, rede ich anfangs kein Wort. Alles, was ich höre, klingt anders als das, was Worte für minha mãe und mich bedeuten. Linas Worte sagen mir nichts, das ich kenne. Auch nicht die der Mistress. Es dauert, bis ein wenig Rede in meinem Mund ist und nicht auf dem Stein. Lina sagt, der Ort, wo ich auf Stein geredet habe, ist Marys Land, wo der Sir Geschäfte macht. Dort also sind meine Mutter und ihr kleiner Junge begraben. Oder sie werden dort begraben sein, wenn sie endlich bereit sind, zu ruhen. Mit ihnen auf dem Boden des Küchenhauses zu schlafen ist nicht so angenehm wie mit Lina in dem kaputten Schlitten. Wenn es kalt ist, schichten wir Bretter rund um unsere Ecke des Kuhstalls auf und schlingen unter den Fellen unsere Arme umeinander. Vom Kuhmist riechen wir nichts, denn der ist gefroren, und wir stecken tief unter dem Pelz. Wenn im Sommer die Stechmücken um unsere Hängematten schwirren, baut Lina aus Zweigen einen kühlen Schlafplatz. Du magst die Hängematte von jeher nicht und liegst lieber auf dem Boden, sogar bei Regen, wenn der Sir dich in den Lagerschuppen lässt. Sorrow schläft nicht mehr beim Kamin. Die Männer, die dir helfen, Will und Scully, sind nie über Nacht hier, weil ihr Master das nicht erlaubt. Weißt du noch, wie sie keine Befehle von dir entgegennehmen, bis der Sir sie dazu bringt? Er konnte das, weil die beiden Tauschgut sind für Land, das der Sir verpachtet. Lina meint, der Sir weiß ganz genau, wie er was kriegt, ohne was zu geben. Ich weiß, dass das stimmt, weil ich es wieder und wieder vor mir sehe: Ich beobachte, meine Mutter hört zu, ihren kleinen Jungen an der Hüfte. Der Senhor zahlt nicht die ganze Summe, die er dem Sir schuldet. Der Sir sagt, er nimmt stattdessen die Frau und das Mädchen, nicht den kleinen Jungen, und damit ist die Schuld beglichen. Minha mãe fleht nein, nicht. Ihr kleiner Junge liegt noch an ihrer Brust. Sie sagt, nehmt das Mädchen, sie sagt, nehmt meine Tochter. Mich. Mich. Der Sir ist einverstanden und schreibt den Schuldschein um. Sobald die Tabakblätter zum Trocknen aufgehängt sind, nimmt mich der Ehrwürdige Vater mit, erst auf einer Fähre, dann auf einem Segelboot, dann auf einem Schiff, immer eingezwängt zwischen seine Kisten mit Büchern und mit Essen. Am zweiten Tag wird es schneidend kalt, und ich bin froh, dass ich einen Umhang habe, wie dünn auch immer. Der Ehrwürdige Vater entschuldigt sich, er geht irgendwohin auf dem Schiff und sagt, ich soll mich nicht von der Stelle rühren. Eine Frau kommt zu mir und sagt, steh auf. Ich tue es, und sie zieht mir den Umhang von den Schultern. Und die Holzschuhe von den Füßen. Und geht weg. Der Ehrwürdige Vater läuft hellrot an, als er zurückkommt und hört, was passiert ist. Er geht überall herum und fragt wer und wo, aber er findet keine Antwort. Schließlich nimmt er Fetzen, Streifen von Segeltuch, die herumliegen, und wickelt meine Füße darin ein. Heute weiß ich, dass Priester, anders als beim Senhor, hier nicht geliebt sind. Ein Matrose spuckt ins Wasser, als der Ehrwürdige Vater ihn um Hilfe bittet. Der Ehrwürdige Vater ist der einzige freundliche Mensch, den ich kenne. Als ich hier ankomme, glaube ich, dass das der Ort ist, vor dem er immer warnt. Die Eiseskälte, die in der Hölle vor dem ewigen Feuer kommt, in dem die Sündigen für alle Zeiten schmoren und braten. Aber erst, sagt er, erst kommt das Eis. Und als ich es wie Dolche von den Dächern und Bäumen herabhängen sehe und spüre, wie die weiße Luft mein Gesicht versengt, bin ich sicher, dass das Feuer auch noch kommt. Da lächelt Lina, als sie mich anblickt und mich in etwas Wärmendes hüllt. Die Mistress schaut weg. Auch Sorrow freut sich nicht, mich zu sehen. Sie wedelt mit der Hand vor dem Gesicht herum, als würde sie von Bienen belästigt. Sie ist immer ganz komisch, und Lina sagt, sie hat wieder ein Kind im Bauch. Wer der Vater ist, weiß man noch nicht, und Sorrow schweigt dazu. Will und Scully lachen und leugnen. Lina glaubt, es ist vom Sir. Sie sagt, sie hat einen Grund, das zu glauben. Als ich nach dem Grund frage, sagt sie: Er ist ein Mann. Die Mistress sagt nichts. Ich auch nicht. Aber ich habe eine Sorge. Nicht, weil wir mehr Arbeit haben, sondern weil mir Mütter mit einem gierigen Säugling an der Brust Angst einjagen. Ich weiß, wie ihre Augen wandern, wenn sie wählen. Wie sie den Blick heben und mich streng ansehen und etwas sagen, was ich nicht hören kann. Wie sie mir etwas Wichtiges sagen, aber dabei halten sie die Hand ihres kleinen Jungen.
Der Mann schob sich durch die Brandung, watete vorsichtig über Kiesel und Sand ans Ufer. Der Nebel, der Atlantik und der faulige Geruch pflanzlichen Lebens hüllten die Bucht ein und bremsten seinen Schritt. Er konnte seine Stiefel durchs Wasser pflügen sehen, aber nicht seine Hände und seinen Ranzen. Als er die Brandung hinter sich hatte und seine Sohlen in den Schlick sanken, wandte er sich um und wollte den Männern in der Schaluppe zuwinken, aber der Mast war vom Nebel verschluckt, und er wusste nicht, ob sie noch vor Anker lagen oder es wagten weiterzusegeln – möglichst dicht unter Land in der Richtung, in der sie das Hafenbecken und die Lagerschuppen vermuteten. Anders als der Nebel in England, der ihm vertraut war, seit er laufen konnte, oder der Nebel im Norden, wo er jetzt lebte, war dieser hier von der Sonne befeuert und legte sich wie glühendes, zähes Gold über die Welt. Ihn zu durchdringen war, als kämpfe man sich durch einen Traum. Sobald der Schlick sich in Sumpfgras verwandelte, wandte er sich nach links, setzte vorsichtig Schritt vor Schritt, bis er auf Holzbohlen stieß, die strandaufwärts zur Siedlung führten. Von seinen Atemzügen und den Schritten abgesehen war die Welt ohne einen Laut. Erst als er bei den Lebenseichen angelangt war, geriet der Nebel in Bewegung, lichtete sich. Worauf er schneller ausschritt, sich besser orientieren konnte, aber auch das blendende Gold vermisste, durch das er gekommen war.
Immer sicherer, auf dem richtigen Weg zu sein, erreichte er schließlich die windschiefen Hütten, die sich zwischen die beiden großen Plantagen am Flussufer duckten. Dort wurde dem Stallknecht klargemacht, dass er auf ein Pfand verzichten konnte, wenn der Mann mit seiner Unterschrift bürgte: Jacob Vaark. Der Sattel war von minderer Güte, aber die Stute, Regina, erwies sich als ein gutes Pferd. Kaum aufgesessen, fühlte er sich besser, und er ritt sorglos und ein wenig zu schnell an der den Strand säumenden Häuserreihe entlang, bis er auf eine alte Wegspur der Lenape stieß. Hier gab es Grund zur Vorsicht, und er zügelte sein Pferd. In diesem Gebiet konnte er von niemandem wissen, ob Freund oder Feind. Vor einem halben Dutzend Jahren hatte sich ein Heer von Schwarzen, Indigenen, Weißen und mulattoes – Sklaven, Freigelassene und in Schuldknechtschaft Verdingte – gegen ihre Herrschaft erhoben, angeführt von einigen der Landbesitzer selbst. Als dieser «Volkskrieg» seine Hoffnungen an den Henker verlor, zeugten die Taten, die in ihm begangen worden waren – Massaker an widersetzlichen Nationen zählten dazu und die Vertreibung der Carolinas von ihrem Land – einen Wildwuchs an neuen Gesetzen, die Chaos schufen, um die Ordnung zu verteidigen. Indem sie die Freisprechung aus der Sklaverei, die Versammlungsfreiheit, die Rechte auf Freizügigkeit und Waffenbesitz Schwarze Menschen außer Kraft setzten; indem sie jedem Weißen das Recht einräumten, jeden Schwarzen aus jedem beliebigen Grund zu töten; indem sie den Besitzern verstümmelter oder totgeschlagener Sklavinnen und Sklaven Entschädigung zusicherten, schieden sie die Weißen für alle Zeit von allen anderen, schotteten sie von ihnen ab. Jegliches Einvernehmen zwischen Landbesitzern und Arbeitskräften, wie es sich vor und während der Rebellion gebildet hatte, wurde von einem Hammer zermalmt, der nur für die Profitinteressen der Grundherren geschmiedet worden war. In Jacob Vaarks Augen waren es gesetzlose Gesetze, geschaffen nicht, um dem Gemeinwohl oder der Gerechtigkeit zu dienen, sondern der Grausamkeit.
Kurz gesagt, man schrieb das Jahr 1682, und um Virginia stand es noch immer schlecht. Wer konnte den Überblick behalten in all den Kämpfen um Gott, König oder Land? Auch wenn ihm seine Hautfarbe einen gewissen Schutz gewährte, musste jemand, der allein unterwegs war, auf der Hut sein. Er wusste, dass er stundenlang keine andere Gesellschaft haben mochte als die Wildgänse, die über den Wasserwegen des Landesinneren dahinzogen, doch dann konnte plötzlich ein Deserteur mit einer Pistole hinter ein paar umgestürzten Bäumen hervorspringen, oder in einer Senke kauerte eine Familie von Flüchtigen, oder ein bewaffneter Wegelagerer trat ihm entgegen. Mit Münzen verschiedener Prägung versehen und nur mit einem Messer bewaffnet, war er ein lohnendes Opfer. Begierig, diese Kolonie hinter sich zu lassen und eine weniger gefährliche, wenn auch für ihn abstoßendere, zu erreichen, trieb Jacob seine Stute zu einer schnelleren Gangart an. Zweimal stieg er ab, das zweite Mal, um den blutigen Hinterlauf eines jungen Waschbären zu befreien, der unter einem gestürzten Stamm eingeklemmt war. Regina rupfte Gras am Wegrand, während er so schonend wie möglich zupackte, den Zähnen und Klauen des verängstigten Tiers zu entgehen versuchte. Als es geschafft war, humpelte der Waschbär davon, vielleicht zu seiner Mutter, die ihn hatte im Stich lassen müssen, wahrscheinlicher aber in die Klauen eines anderen Tieres.
Im Galopp ritt er weiter und schwitzte dabei so stark, dass ihm das Salz in den Augen brannte und die Haare an den Schultern klebten. Es war schon Oktober, doch Regina war schweißnass und röchelte. So was wie Winter gibt’s nicht hier unten, dachte er, genauso gut hätte er auf Barbados sein können, was er tatsächlich einmal erwogen hatte, auch wenn die Hitze dort, wie man hörte, weitaus lähmender war als hier. Aber das lag Jahre zurück, und sein Entschluss war hinfällig geworden, ehe er ihn in die Tat umsetzen konnte. Ein ihm völlig fremder Onkel aus dem Zweig der Familie, der ihn verstoßen hatte, war gestorben und hatte ihm ein bislang nicht ausgeübtes gutsherrliches Privileg über einen Grundbesitz von einhundertsechzig Tagwerk vermacht, gelegen in einem Landstrich, dessen Klima ihm sehr viel mehr zusagte. Wo man vier Jahreszeiten unterscheiden konnte. Dennoch konnte ihn diese Dunstglocke mit ihrer Hitze und ihren Stechmücken nicht entmutigen. Trotz der langen Überfahrt auf drei Schiffen und drei verschiedenen Gewässern und nun noch diesem anstrengenden Ritt auf dem Lenape-Pfad genoss er die Reise. Die Luft einer Welt zu atmen, die so neu war, fast erschreckend in ihrem Rohzustand, in ihren Versuchungen, verfehlte nie die Wirkung auf seine Lebensgeister. Als er das warme Gold der Bucht erst hinter sich hatte, sah er Wälder, die seit Noahs Zeiten von keinem Menschen betreten worden waren; Küstenpanoramen, so schön, dass sie zu Tränen rührten; wilde Früchte, die man nur zu greifen brauchte. Dass die Kompanie Lügenmärchen über die leichten Profite verbreitet hatte, die angeblich auf die Neuankömmlinge warteten, konnte ihn weder überraschen noch entmutigen. Es waren ja gerade die Anstrengungen und Abenteuer, die ihn lockten. Sein ganzes Leben war eine Abfolge von Gegnerschaften, Wagnissen, Versöhnungen. Und jetzt war er hier gelandet, aus dem armseligen Waisenkind war ein Grundbesitzer geworden, der aus einem Niemandsort einen Punkt auf der Landkarte machte, aus dem Vegetieren in der Wildnis ein wohlgefälliges Leben. Es war genau nach seinem Geschmack, nicht zu wissen, was auf ihn zukam, wer ihm begegnen würde und in welcher Absicht. Gewitzt, wie er war, empfand er ein höchst angenehmes Prickeln, wenn eine Krise, egal ob groß oder klein, rasches Handeln und frische Ideen erforderte. Auf dem zusammengeschusterten Sattel hin und her schwankend, behielt er, ohne den Kopf zu wenden, die Umgebung aus den Augenwinkeln im Blick. Die Gegend war ihm seit Jahren vertraut, noch aus der Zeit, als die Schweden hier siedelten, und später, als er Agent der Kompanie gewesen war. Und später noch, als die Holländer die Macht übernahmen. Zu Zeiten dieser Kämpfe und danach hatte es nie viel gebracht, sich zu vergewissern, wer diesen oder jenen Landstrich, diesen oder jenen Außenposten für sich reklamierte. Ließ man die Indigenen außer Acht, denen all dies eigentlich gehörte, so konnte jeder Flecken Erde von einem Jahr zum anderen von dieser Kirche oder jener Handelskompanie beansprucht oder einem Sohn oder Günstling eines Herrscherhauses als persönlicher Besitz geschenkt werden. Weil die Ansprüche auf Ländereien, abgesehen von den wenigen Fällen, da ein rechtmäßiger Kauf mit Brief und Siegel erfolgte, ein so flüchtiges Ding waren, belastete er sich nicht mit den alten und neuen Namen der Dörfer und befestigten Siedlungen: Fort Orange, Cape Henry, Nieuw Amsterdam, Wiltwyck. Eine Schildkröte hatte ein längeres Leben zu erwarten als so manche dieser Ansiedlungen, und so folgte er seiner eigenen Geographie, zog auf dem Lenape-Pfad von Algonquin über Chesapeake nach Sequehanna. Als er, über den South River kommend, die Chesapeake Bay erreicht hatte, ging er an Land, stieß bald auf ein Dorf und erkundete zu Pferd die Wegspuren der Indigenen, wobei er die Grenzen ihrer Maisfelder achtete, ihre Jagdgründe mit Vorsicht durchquerte und weder eine kleine Siedlung hier noch eine größere dort betrat, ohne vorher höflich um Erlaubnis zu fragen. Er tränkte sein Pferd an einem geeigneten Fluss und mied die Gefahren des Sumpflands, das sich vor den Kiefernwäldern erstreckte. Die Hänge bestimmter Hügel, ein Eichenwäldchen, eine verlassene Höhle, den plötzlichen Duft nach Baumharz wiederzuerkennen war nicht nur angenehm – es war unerlässlich. Als er den Kiefernwald am Rand des Sumpflands verließ, wusste Jacob auch in diesem ad hoc gebildeten Territorium, dass er sich nun endlich in Mary’s Land befand, das, jedenfalls im Augenblick, dem König unterstand. Zur Gänze.
Als er diesen in Privatbesitz befindlichen Landstrich betrat, beschlichen ihn gemischte Gefühle. Anders als die anderen Kolonien küstenauf- und -abwärts – die umstritten, umkämpft, ständigen Namenswechseln ausgesetzt und im Handel auf das Mutterland beschränkt waren, das sie jeweils gerade beherrschte –, gestattete die Provinz Maryland den Warenhandel mit fremden Märkten. Gut für die Pflanzer, noch besser für die Kaufleute, am allerbesten für die Zwischenhändler.
Doch dieses Eigentum eines Lords war römisch bis ins Mark. In den Siedlungen ließen Priester sich auf offener Straße blicken, ihre Tempel standen wie Menetekel an öffentlichen Plätzen, und ihre unseligen Missionsstationen sprossen an den Rändern der indigenen Dörfer empor. Gesetzgebung, Rechtsprechung und Handel waren fest in ihren Händen, und Frauen in reichen Kleidern und mit hohen Schuhen ließen sich in Wagen herumfahren, die von zehnjährigen negroes kutschiert wurden. Er fühlte sich abgestoßen von der verlogenen, prunksüchtigen Bauernschläue der Papisten. «Hütet euch vor der Hure Rom», die ganze Klasse hatte im Kindersaal des Armenhauses diesen Merkvers aus der Fibel auswendig gelernt, «und ihrem gotteslästerlichen Treiben./Trinkt nicht aus ihrem Sündenkelch/und folgt nicht ihren Geboten.» Was allerdings nicht ausschloss, Handel mit ihnen zu treiben, wobei es ihm oft genug gelungen war, den Vorteil auf seine Seite zu ziehen – vor allem hier, wo Tabak und Sklaven zwei Währungen in festem Tauschverhältnis waren. Krankheit oder ständige Misshandlung konnte dem einen wie dem anderen den Garaus machen, und in beiden Fällen schlug dies allen Beteiligten zum Nachteil aus, nur nicht dem Leihgeber.
Doch die Verachtung, so schwer sie zu bemänteln war, musste hintangestellt werden. Bei seinen bisherigen Verhandlungen mit dieser Plantage hatte er es mit dem Schreiber des Eigentümers zu tun gehabt, auf zwei Schemeln in der Schenke hatten sie gehockt. Jetzt war er aus irgendeinem Grund ins Herrenhaus geladen oder vielmehr hinzitiert worden, eine Pflanzerresidenz namens Jublio. Ein Kaufmann wurde von einem Gentleman zum Essen eingeladen? An einem Sonntag? Da musste etwas faul sein, dachte er bei sich. Nach Stechmücken schlagend und stets auf der Hut vor Schlangen im Morast, vor denen das Pferd scheuen konnte, erspähte er endlich das mächtige, schmiedeeiserne Tor von Jublio und lenkte Regina hindurch. Er hatte schon gehört, dass das Anwesen prachtvoll war, doch was er nun zu Gesicht bekam, überraschte ihn dennoch. Das Haus, aus honigfarbenem Stein errichtet, glich eher einem Palast, in dem Hof gehalten wurde. Hinter der eisernen Einfriedung sah er rechts in der Ferne, vom Nebel gedämpft, lange Reihen von Quartieren, menschenleer und still. Wahrscheinlich waren alle auf den Feldern, um den Schaden einzudämmen, den das feuchte Wetter der Ernte zuzufügen drohte. Der angenehme Duft von Tabakblättern, an Kaminfeuer und Ale servierende Frauen erinnernd, umhüllte Jublio wie ein Balsam. Der Weg mündete in einen gepflasterten Vorplatz, der einen stolzen Auftakt zur Veranda bildete. Jacob brachte sein Pferd zum Stehen. Ein Junge erschien, dem er, ein wenig ungelenk absteigend, die Zügel in die Hand drückte. «Nur tränken. Kein Futter», beschied er ihn.
«Ja, Sir», sagte der Junge, wendete die Stute und führte sie weg, wobei er beruhigend «braves Mädchen, braves Mädchen» murmelte.
Jacob Vaark stieg drei gemauerte Stufen empor und gleich wieder rückwärts hinunter, um zunächst das gesamte Bauwerk mit seinem Blick erfassen zu können. Zwei breite Sprossenfenster, jedes aus mindestens zwei Dutzend Scheiben gefügt, flankierten die Tür. Fünf weitere Fenster in dem weiträumigen Stockwerk darüber fingen das Licht der Sonne über dem Bodennebel ein. Er hatte noch nie ein Haus wie dieses gesehen. Die wohlhabendsten Männer, die er kannte, bauten nicht mit Mauerwerk, sondern mit Holz, zu Brettern gespalten, und sie brauchten keine großmächtigen Säulen, die einem Parlamentsgebäude gut angestanden hätten. Gewaltig, dachte er, aber auch leicht zu bauen in diesem Klima. Das weiche Holz des Südens, nachgiebiger Stein, nichts brauchte hier abgedichtet zu werden, alles war auf linde Lüfte abgestellt und nicht auf harschen Frost. Innen sicherlich ein langer Flur, viele wohlausgestattete Gemächer und Kammern … Leichte Arbeit, ein leichtes Leben, aber, bei Gott, die Hitze …
Er streifte seinen Hut herunter und wischte sich mit dem Ärmel den Schweiß am Haaransatz ab. Dann stieg er, an seinem schweißgetränkten Kragen fingernd, die Stufen wieder hinauf und stellte den eisernen Fußabstreifer auf die Probe. Noch ehe er klopfen konnte, öffnete ein kleingewachsener Mann der Widersprüchlichkeiten die Tür: alt und alterslos, ehrerbietig und spöttisch, weißes Haar und dunkles Gesicht.
«Einen schönen Nachmittag, Sir.»
«Mr. Ortega erwartet mich.» Über den Kopf des Alten hinweg überblickte Jacob den Raum.
«Gewiss, Sir. Euren Hut, Sir? Senhor D’Ortega erwartet Euch. Vielen Dank, Sir. Hier entlang, Sir.»
Schritte, laut und herrisch, gefolgt von D’Ortegas Stimme: «Genau zur rechten Zeit! Kommt nur, Jacob, kommt.» Er wies ihn zu einem der Zimmer.
«Guten Tag, Sir. Vielen Dank, Sir», erwiderte Jacob und staunte über den Überrock seines Gastgebers, über die Strümpfe, die aufwendige Perücke. Beschwerlich und beengend musste dieser Aufputz in der Hitze sein, und doch war D’Ortegas Haut trocken wie Pergament, während Jacob nicht aufhörte zu schwitzen. Der Zustand des Taschentuchs, das er hervorzog, war ihm ebenso peinlich wie die Notwendigkeit, es zu benutzen.
An einem kleinen Tisch, der von Götzenbildern umgeben war, nahm er Platz, trank bei geschlossenen Fenstern, die die glutheiße Luft aussperren sollten, gewürzte Sassafraslimonade, pflichtete der Meinung seines Gastgebers über das Wetter bei und tat die vorgebrachten Entschuldigungsfloskeln wegen des beschwerlichen Weges, der ihm zugemutet worden war, als unbegründet ab. Nach diesen Präliminarien kam D’Ortega unverzüglich zur Sache. Ein Unglück hatte ihn betroffen. Jacob hatte davon gehört, doch er lauschte höflich und nicht ohne das schuldige Mitgefühl zu zeigen der Version, die sein Kunde und Schuldner ihm nun servierte. D’Ortegas Schiff hatte einen vollen Monat lang eine Seemeile vor der Küste auf Reede gelegen und auf einen anderen Segler gewartet, der jeden Tag eintreffen und Ersatz für die Verluste bringen sollte, die die Fracht erlitten hatte. Ein Drittel der Ladung war ihm eingegangen, am Fleckfieber. Eine Strafe von fünftausend Pfund Tabak war ihm vom Magistrat Seiner Lordschaft aufgebrummt worden, weil die Leichen zu nah an der Bucht ins Wasser geworfen worden waren. Er hatte die Toten wieder rausfischen lassen müssen, soweit sie noch zu finden waren (wofür eigens Piken und Netze besorgt worden waren, schilderte D’Ortega, was schon allein zwei Pfund und sechs Schillinge gekostet hatte), und dann sollte er sie begraben oder verbrennen. Er musste zwei Karren beschaffen (sechzehn Schillinge), auf die sie geworfen und raus ins Marschland gekarrt wurden, wo Alligatoren und Salzwasserpflanzen den Rest besorgen würden.
Schreibt er seine Verluste ab und lässt sein Schiff nach Barbados weitersegeln? Weit gefehlt, dachte Jacob. Dieser verkommene Mensch, stur in seiner Verbohrtheit wie alle Römischen, liegt lieber einen Monat lang vor dem Hafen vor Anker und wartet auf ein Geisterschiff aus Lissabon, das genug Fracht übrig hat, um die Köpfe, die ihm verlorengegangen sind, zu ersetzen. Und während er wartet, dass er seinen Laderaum wieder bis an den Rand füllen kann, geht das Schiff unter, und er hat nicht nur seinen Segler und das ursprüngliche Drittel der Ladung verloren, sondern alles – ausgenommen die Mannschaft, die natürlich nicht angekettet war, und vier unverkäufliche Angolaner, deren Augen glühten vor Wut. Jetzt verlangte er einen weiteren Kredit und sechs zusätzliche Monate für die Rückzahlung der Schulden, die er bereits hatte.
Das Essen war eine öde Angelegenheit und wurde vollends unerträglich, weil Jacob sich so verlegen fühlte. Seine grobe Kleidung stand in heftigem Kontrast zu Seidenstickerei und Spitzenkragen. Seine sonst so geschickten Finger wurden schwerfällig im Umgang mit Geschirr und Besteck. Er hatte sogar noch eine Spur von Waschbärenblut an den Händen. Und so ging die Saat seines Grolls auf. Warum wurde hier an einem schläfrigen Nachmittag für einen einzigen Gast von deutlich niedrigerem Stand ein solches Theater veranstaltet? Da gab es einen Hintergedanken, sagte er sich. Ihm wurde etwas vorgespielt, um ihn zu demütigen, er sollte sich so klein fühlen, dass er sich D’Ortegas Wünschen fügen musste. Die Mahlzeit begann mit einem Gebet, geflüstert in einer Sprache, die er nicht verstand, und vorher wie nachher wurde bedächtig ein Kreuz geschlagen. Jacob schluckte seine Verärgerung hinunter und beschloss, sich trotz seiner schmutzigen Hände und der schweißtriefenden Haare dem Essen zu widmen. Doch sein beträchtlicher Hunger verging ihm, als er die überwürzten Speisen zu Gesicht bekam. Alles mit Ausnahme von Gurken und Rettichen war entweder weich gekocht oder gebraten. Der Wein, der mit Wasser verdünnt und für seinen Geschmack zu süß war, enttäuschte ihn ebenfalls, und die Tischgesellschaft bot immer weniger Trost. Die Söhne waren schweigsam wie die Gräber. D’Ortegas Frau entpuppte sich als





























