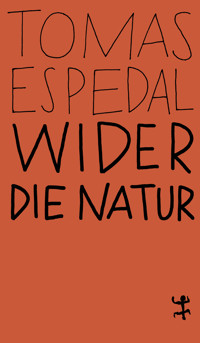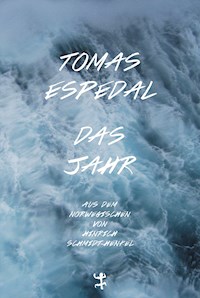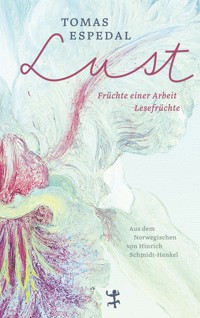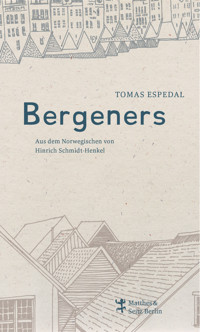
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Bergeners ist eine ungewöhnliche Liebeserklärung an den zwischen Bergen und Fjorden gelegenen Heimatort Tomas Espedals. Die Erzählung beginnt im extravagantenThe Standard Hotel in New York und endet im Berliner Askanischen Hof, denn immer wieder versucht Tomas zu fliehen: vor demTrubel um seine Person nach dem Erscheinen von Knausgårds Büchern, vor der Einsamkeit, nachdem seine Freundin ihn verließ, vor sich selbst. Jedes Mal kehrt er aber zurück zu dem Ort seiner Kindheit, dem Ort, der seine Erinnerungen konserviert. Meist sind es Erinnerungen an die Frauen,die der Autor einst liebte. So intim, so unmittelbar wie noch nie, erzählt er seinen Nächsten – und damit uns – von seinem wilden und poetischen Leben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 183
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
TOMAS ESPEDAL
Bergeners
Aus dem Norwegischen vonHinrich Schmidt-Henkel
Inhalt
Die Krankheit Liebe
De profundis
Pinturas negras
Die Tagebücher
Roma-Tage
Albergo del Sole
Lichtverhältnisse
Es war nur ein Gedanke, er währte nur einen Augenblick
Der Gast
Der Autor, der nicht schreibt
Das perfekte Zimmer
Bergeners
Die Hellemyrsleute
Von der Einsamkeit
Vom Reisen
Vom Schlafen
Von Schlüsseln
Von der Notwendigkeit einer Tür
Der Nachmittag des Schriftstellers
Liebe
Testament
Er
Sie
Exakt von der Stelle aus, wo die Gaula in einer langen Biegung um die Ortschaft Sygna herumfließt und sich taillenartig einschnürt, um als kraftvoller, breiter Wasserfall hinabzustürzen, so gewaltig und schäumend weiß, dass der Fluss nicht mehr wie Wasser aussieht, sondern wie ein fallender Berg, kann man den Storehesten sehen, einen hohen, stumpf zulaufenden Gipfel, als würde der Berg in ein und demselben Moment zusammenstürzen und sich erheben, eine Art optische Täuschung nur; man sieht den Gipfel durch die in der Luft zerstiebenden Wassersplitter hindurch. Der Junge steht auf den glatten Steinen direkt unter dem Wasserfall, der Wasserstaub stiebt ihm ins Gesicht und ins Haar, die kleinen Wasserperlen legen sich auf seine Jacke und die Hose, er steht in der Sonne und wird klitschnass. Ein dünner Regenbogen über dem herabstürzenden Wasser, über der Kaskade, die so laut brüllt, dass er keine anderen Stimmen hören kann als die Stimme des Wassers, sie ruft ihm zu. Dann und wann sieht er einen Lachs sich in hohem Bogen im Wasserfall hinanwerfen, in den Wasserfall hinein, als würde der Fisch nach einem Punkt darin suchen, an dem Stille herrscht, nach einer Stelle, an der er sich ausruhen kann.
Wo der Fisch sich ausruhen kann, bevor er sich weiter den Wasserfall emporwirft, bevor er dann endlich das stille Wasser des Flusses erreicht.
Es wirkt unmöglich.
Die Wassermassen spülen den Lachs gnadenlos hinab, wieder zum Grunde des Wasserfalls hinunter, in die geräumige Mulde, in der die Fische warten. Der Junge sieht, wie der Lachs es erneut versucht, ein neuer Sprung in die tobenden Wassermassen hinein.
Es wirkt unmöglich.
Der Junge fängt an zu weinen, will sich die Tränen mit dem nassen Jackenärmel wegwischen. Jetzt erst bemerkt er, dass er durchnässt ist, die Jacke, die Hose, bis auf die Haut. Er hatte nicht weinen wollen, er weint sonst nie, in keiner Situation, nicht einmal, wenn es ganz schlimm ist, nie, aber das stiebende Wasser läuft ihm aus den Haaren über die Stirn in die Augen.
New York City. The Standard Hotel. Zimmer Nummer 1103. Das schönste Hotelzimmer, das ich jemals gesehen habe. So durchsichtig, so offen, so weiß und streng. Wir standen in der Tür und blickten durch Glasscheiben, durch das Badezimmer und das Schlafzimmer und das Wohnzimmer und Fenster auf die Stadt und die Lichter in der Höhe, die reflektiert wurden durch die Glasscheiben und den Raum, in dessen Tür wir standen. Die Stadt war im Zimmer. Das Zimmer war in der Stadt wie ein durchsichtiger Kubus mit Glaswänden. Ein sechseckiges Zimmer mit Bett und Kissen und Bettdecken, so weich wie Wachs. Hellgelbe Gardinen. Ein mit dickem, grauem Wollstoff bezogenes Sofa. Ein brauner Ledersessel. Ein großer Spiegel. Eine dicke Glaswand zum Bad, darin eine Dusche und eine ovale Badewanne; eine eierschalenweiße Oberfläche, auch so rauh wie Eierschalen, sodass alles im Zimmer die Natur nachahmte, oder es war Natur, zusammengepresst zu einem Kubus inmitten anderer Kuben in der Stadt.
Die New-York-Natur.
Unter uns kreuz und quer die Straßen. Die 14th Street in gerader Linie bis zum Union Square, auf dem sich ein Blumenmarkt befand. Wir füllten das ganze Zimmer mit Blumen. Sie dufteten süß und schwer in der Dunkelheit, und wenn wir morgens aufwachten, das Fenster stand offen, hörten wir die Bienen im Zimmer summen.
Die New-York-Nacht.
So hell und milde. So schlaflos und still, wenn die Geräusche sich in der Stadt verteilt hatten und zu einem langen, tiefen Ton von Verkehr und Helikoptern wurden, von Sirenen und dem Pfeifen der Schiffe auf dem Hudson; wir hörten sie nicht.
Nachts, wenn Janne eingeschlafen war, setzte ich mich aufs Fensterbrett, die Beine nach außen, im elften Stock und rauchte Zigaretten. Plötzlich wurde ich von einem mächtigen Impuls übermannt; ich wollte mich hinauswerfen. Der Gedanke war so beherrschend und stark, ich musste mich zwingen, rückwärts vom Fenster wegzugehen, Schritt für Schritt rücklings zum Bett, mich neben Janne zu legen und ihre Hände über meine Brust zu ziehen. Ich fesselte mich an sie. Zog ihr Haar über mein Gesicht und flocht meine Beine mit ihren zusammen. Jetzt war ich gefesselt. Jetzt war ich in Sicherheit. Ich war an sie gefesselt. Ich spürte ihre ruhigen Atemzüge, mein Puls beruhigte sich, mein Herz schlug normal; ich konnte ausruhen. Aber in der Nacht darauf würde sich alles wiederholen, ich würde allein im Fenster sitzen und mich würde der Gedanke überfallen, dass ich nie ohne sie zurechtkommen würde.
Ich traute mich nicht, Janne zu sagen, dass ich unter Höhenangst litt. Dass ich sie von meiner Mutter geerbt hatte, aus dem elften Stock im Skyttervei, dass ich wieder in der Kindheitshöhe und in der Höhenangst meiner Mutter war und dass meine Mutter in mir lebte mit ihrer Angst, ihrer Furcht, dass ich sie mit mir herumtrug, das konnte ich nicht sagen.
Janne wollte auf die Spitze des Empire State Buildings. Sie wollte auf die Spitze des Rockefeller Centers. Wir nahmen den Fahrstuhl, mit rasender Geschwindigkeit ging es hinauf, ich aber fiel, ich fiel im Fahrstuhl auf den Boden. Ich schlang die Arme um die Japanerin neben mir; sie roch nach Ingwer und Salz.
Wir fuhren im Hotel mit dem Fahrstuhl in die achte Etage, um eine Lesung von Edmund White zu hören. Er erzählte von seinen Liebhabern und las aus seinem neuen Buch. Der Umschlag zeigte ein Foto des Autors als junger Mann. Er hatte dunkles, halblanges Haar und einen ausgeprägten Schnurrbart, er trug einen Hut à la Whitman. Wir waren beide enttäuscht, wie schwer und alt er war, wie dick und plump er war, wie wenig er seiner Darstellung von sich selbst glich.
Wir trafen Frode und Gunnhild, die auch beim New Yorker Literaturfestival waren. Frode ist ein echter Kosmopolit, wo auch immer er ist, wirkt er wie bei sich Zuhause. Er weiß, wie man sitzen muss und wann man aufstehen und gehen sollte. Er weiß, wie man reden muss und wie man schweigen muss. Gunnhild hat keinerlei Orientierungssinn und weiß nie, wo sie ist. Das ist entzückend, bis man auf sie warten muss, weil sie auf eigene Faust dickköpfig lange und weit in die falsche Richtung gegangen ist.
Ich meinerseits war völlig von Janne abhängig. Ohne sie traute ich mich nirgendwohin, und wenn wir zusammen durch die Stadt gingen, hielt ich mich dicht an ihrer Seite oder ich griff nach ihrer Hand, obwohl ich bemerkte, dass sie versuchte, ihre Hand zu verbergen, sie steckte sie in die Jackentasche, und manchmal legte sie sich die Hand auf seltsam gekünstelte Weise auf den Rücken.
Ich hatte Angst, ihr verloren zu gehen.
Sie fand die richtigen Straßen, die Gebäude, sie fand die Eingänge zur Subway und die Züge, die wir nehmen mussten, die Stationen, in denen wir aussteigen mussten, sie fand die Orte, die wir sehen wollten. Sie fand die Museen und die Buchhandlungen, und wenn sie hin und wieder einmal in ein Kleider- oder Schuhgeschäft wollte oder in ein Kaufhaus, so stand ich am Eingang und wartete auf sie.
Ich stand an Ort und Stelle, genau da und genau so lange, wie es zu warten galt.
Ich schloss die Augen, die Sonne schien, sie traf mein Gesicht. Ich stand auf der Ecke der West 15th Street und der 6th Avenue und wartete länger als eine Stunde auf sie.
Und siehe, da kam sie aus dem Geschäft. Jedes Mal geschah dasselbe; mich erfüllten eine unfassbare kindliche Freude, brausendes Glücksgefühl und tiefe Dankbarkeit; sie war meine Liebste. Und jedes Mal, wenn ich sie sah, nachdem ich von ihr getrennt war, nachdem ich auf sie hatte warten müssen, war ich kurz davor zu weinen, konnte es aber zurückdrängen, verstecken; sie kam aus dem Geschäft in einer neuen weißen Bluse, blauen Jeans und ihren alten, abgetretenen Sandalen.
Wir fuhren mit der Subway nach Brooklyn und suchten die Buchhandlung The Unnameable, die eine Freundin Janne empfohlen hatte. Der Laden war nicht groß, hatte aber die Bücher, die wir suchten. Janne fand endlich Nox von Anne Carson. Ich fand die Bücher von Jennifer Moxley, die ich brauchte. Ich stand ganz weit hinten im Laden und konnte die Augen nicht von Janne wenden. Ich bekam nie genug davon, sie anzusehen. Ich folgte ihr mit dem Blick. Ließ sie nicht aus den Augen. Sie versuchte, sich zu verstecken, verschwand hinter einem Bücherregal. Ich folgte ihr. Es ist schön, die Liebste zu sehen, wie sie zwischen Bücherregalen einhergeht und dieselben Bücher sucht wie man selbst.
Direkt am Union Square gibt es eine Buchhandlung namens The Strand, wo wir Bücher von Peter Gizzi und Stacy Doris, Bill Luoma und Lee Ann Brown kauften. Mein Lieblingsgedicht, wenn es denn ein Gedicht ist, ist Bill Luomas My Trip to New York City.
Die 14th Street verläuft in gerader Linie vom Standard Hotel zum Union Square. Wir gingen sie jeden Tag entlang, auf dem linken Bürgersteig hinauf und hinab auf dem rechten, in regelmäßigen Abständen von den Ampelkreuzungen an den Avenues unterbrochen. Die Fußgängerüberwege, ein eigener Rhythmus im Gehen, Fluss und Stockung, Lichter und Autos. Janne mit Sonnenbrille, sie sagte: Es sind so viele schöne Menschen auf der Straße. Sie bückte sich und streichelte einem Hund den Kopf. Die Ohren des Hundes waren unnatürlich kurz und spitz, als wären sie zurechtgeschnitten oder scharf geschliffen; ein Höllenhund. Mit einem Satz sprang er ihr ins Gesicht, verwickelte sich in ihr langes Haar, biss ins Haar, riss und zerrte an den langen Haaren. Sein Herrchen, ein Junge mit Baseballcap und Sneakers, zog hart an der Leine. Was ist das für eine Rasse, rief Janne ihm zu. Er zog den Hund mit aller Kraft zu sich: It’s a pitbull, sagte er.
Am Tag, nachdem wir Ground Zero besucht hatten, gab es auf dem Times Square eine große Menschenansammlung. Die Leute winkten mit Wimpeln und schwangen Fahnen, sie sangen und riefen hurra. Es war ein großes Fest: Soeben war bekannt gemacht worden, dass man Osama bin Laden in seinem Haus in Pakistan erschossen hatte.
Der Frühstücksraum des Hotels war groß und hell; ein ewiger Sommergarten mit Glaswänden und hellen Gardinen, durch die das Sonnenlicht mild auf die weißen Tischtücher fiel. Wir aßen Rührei mit Toast und geschmolzener Butter, tranken Kaffee und Orangensaft. Ein großer Blumenaufsatz stand auf dem Buffet, frische gelbe Osterglocken. Auf der Titelseite der Morgenzeitung war ein Foto von Osama bin Laden abgebildet, darunter stand in dicken schwarzen Buchstaben: May he rot in hell.
An dem Abend schafften wir es endlich ins Hotelrestaurant The Grill, es war voll, wie üblich, aber wir bekamen zwei Plätze an dem langen Tresen, der vor der Grillstation verlief; wir saßen mit dem Rücken zu den Gästen im Restaurant und blickten direkt in die Küche.
Die Hitze vom Grill war fast unerträglich.
Darin glomm ein starkes Feuer von Holzscheiten und Kohle, jedes Mal, wenn vom Grillrost Fett hinabtropfte, flackerte es auf. Sieben Männer arbeiteten in der Küche. Jeder hatte seine Aufgaben, angeleitet wurden sie von dem jungen Koch, der am Tresen stand und ihnen die Bestellungen zurief. Three cods. Two brass. Two octos. One lamb. Er war eine furchteinflößende Erscheinung, mit rasierter Glatze, Ohrringen, Hals und Arme waren tätowiert. Er sah aus, als hätte er sich kürzlich geprügelt, er hatte Blut am linken Ohr und unter dem Auge einen tiefen Schnitt auf dem Jochbein. Er schwitzte und brüllte. Besonders oft und laut brüllte er den Lehrling an dem großen Grill an, der Junge kämpfte mit dem Fisch, das fette Fischfleisch klebte am Grillrost fest, und er mühte sich ab, es mit einem Schaber abzulösen. Rasch ging der Chef in die Küche, stellte sich neben den Lehrling, griff mitten ins Feuer und drehte die Fischstücke mit den Fingern um. Er verbrannte sich, ließ aber die Hand zwischen den Flammen. Es war eine Art Demonstration, er wusste, dass wir ihm zuschauten. Jedes Mal, wenn ich den jungen Chef sah, verspürte ich eine unmittelbare Furcht, es war ein Instinkt, eine Anziehung, aber auch reine Angst, wie ich sie immer fühlte, wenn ich von jemandem angezogen war, der gefährlich war. Der Koch hielt die Hand in die Flammen. Er stand nur einen Meter von uns entfernt, wir tranken Wein, wir warteten auf unser Essen. Er drehte die Fischstücke mit den Fingern um, ließ sich Zeit dabei, wir konnten sehen, dass er sich verbrannte, seine Hand wurde rot. Wir rochen seine Hand, rochen, wie sich der Geruch von verbrannter Menschenhaut mit dem des Fisches mischte.
Wir hatten Lachs bestellt. Auf der Speisekarte stand gegrillter norwegischer Wildlachs. Wir tranken trockenen französischen Weißwein. Janne schwitzte. Sie zog sich die dünne Jacke aus. Der Schweiß rann über ihr Gesicht, sammelte sich in einer kleinen Grube unter dem Hals, über der Brust.
Eine eigenartige Vorstellung, sagte ich, dass der Fisch, den wir gleich essen werden, in einem norwegischen Fjord herumgeschwommen ist und sich vielleicht einen Wasserfall empor gekämpft hat, bevor er endlich in den Fluss gelangte, wo er gefangen wurde. Und jetzt landet er hier, in einem Restaurant in New York, auf unserem Tisch, sagte ich.
Janne sah mich an. In ihren Augen lag ein eigenartiger Glanz, als würde sie gleich weinen. Doch dann tupfte sie sich mit der Serviette das Gesicht ab, nahm einen Schluck Weißwein und richtete sich auf.
Tomas, sagte sie. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, es jetzt zu sagen. Ich warte schon lange auf die richtige Gelegenheit, auf den richtigen Zeitpunkt, aber dieser richtige Zeitpunkt kommt wohl nie und da du das mit dem Lachs sagst, sage ich es jetzt: Wenn wir nach Hause kommen, müssen wir uns trennen.
Jorge Luis Borges berichtet von einer Begegnung mit sich selbst. Der greise Borges liegt in einem Hotelzimmer und wartet auf den Tod. Der jüngere Borges meldet sich im selben Hotel an, nur um festzustellen, dass er bereits eingebucht ist; dieselbe Handschrift, derselbe Name. Er findet den alten in Zimmer Nummer 19, genau wie befürchtet. Der jüngere Borges fürchtet diese Zahl, neunzehn, er verbindet sie mit seiner Vergangenheit, also mit dem Tod, der auf ihn wartet.
In meinem Fall, der nicht so ernst ist und auch nicht literarisch und daher vielleicht langweiliger, ist es die Zahl elf, sie taucht ständig auf, als würde sie mich verfolgen und vielleicht etwas bedeuten, ich weiß nicht was. Ich bin im elften Monat geboren. Ich wuchs in der elften Etage in einem Wohnblock auf. Ich habe elf Bücher geschrieben. Sehr oft passiert es, dass man mir in einem Hotel ein Zimmer mit der Zahl elf in der Nummer zuteilt: Zimmer Nummer 211 jüngst in Tirana, Zimmer Nummer 1103 früher in New York, und, gleich mitten ins Schwarze, Zimmer Nummer 11 hier in Madrid. Als ich die Tür zu diesem Zimmer aufschloss, lag bereits eine Nachricht für mich auf dem Nachttisch, geschrieben auf einen der Briefbögen des Hotels. Hotel Embajada, Montag 14. Juni, vielleicht war die Nachricht nicht für mich:
We are invited to Kirsti tonight for dinner, at her house, please call me 0034 622 783 734 for further information, yours sincerely,Juan.
Ich kannte niemanden dieses Namens. Und auch keine Kirsti, überhaupt war es eigenartig, dass jemand von meinem Hiersein wusste, in diesem Hotel, in Madrid. Ich war einer spontanen Eingebung folgend nach Madrid gereist, um dem Theater rund um Knausgårds Bücher in Norwegen zu entfliehen. Er hatte meinen Namen in Verbindung mit einem unerfreulichen Zwischenfall in meiner Wohnung genannt, und jetzt stand mein Telefon nicht mehr still, jede Menge Journalisten, Presse, Boulevard, Rundfunk und Fernsehen. Ich wusste bei keinem, was ich sagen sollte, also sagte ich, ich sei auf Reisen. Es war sowohl eine Lüge als auch die Wahrheit, ich versteckte mich in Madrid.
Die angegebene Nummer rief ich nie an. Ich zog mich aus, öffnete das Fenster und legte mich ins Bett, um die Geräusche von der Straße vor dem Fenster zu hören, ich wohnte im Erdgeschoss. Abends wanderte ich ziellos durch die Straßen, geriet in eine Tränke mit langen Spiegeln an den Wänden des schmalen Lokals, wie ein Korridor, mit verschlissenen Samtsofas, kleinen Holztischen, weiß gekleideten Kellnern, zumeist männlichen Gästen, älteren Männern; ich beschloss, dies sollte mein Stammlokal in Madrid sein.
Ich hatte bald die Empfindung, dass ich hier in diesem Korridor verschwinden konnte unter all den alten Gesichtern, den schönen Holztischen, den blank gewetzten Sofas, den verspiegelten Wänden, in denen sich Rücken und Schultern der Männer reflektierten, die Bier tranken und Zigaretten rauchten. In dem Spiegel gegenüber von meinem Tisch erkannte ich deutlich, dass ich dabei war, so zu werden wie die anderen Männer in dem Lokal, ich war dabei, alle zu werden, ich meine, allmählich ähnelte ich einem beliebigen Mann, der an seinem Tisch sitzt und allein isst, allein trinkt, freilich bin ich nie allein, wenn ich dieses Gefühl von Zusammengehörigkeit habe, auch von Zugehörigkeit: Man findet seinen Platz, und dort verschwindet man, so unauffällig es geht.
»Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheueren Ungeziefer verwandelt.«
Ein junger Mann, er hat seinen Namen verloren oder er wurde ihm genommen, steht früh auf, es ist Freitag, die Sonne scheint, das ist ein gutes Zeichen. Er schläft in dem Zimmer neben dem Schlafzimmer seiner Mutter, das ist nicht natürlich, er müsste eine eigene Wohnung finden, sich eine Arbeit suchen, vielleicht eine Geliebte oder ein paar Freunde finden, aber er will nichts von alldem. Er will etwas anderes, er wünscht sich eine größere Veränderung. Er hat sich immer ein neues Gesicht gewünscht, einen anderen Körper und andere Kleidung, alles andere als das Gesicht und das Leben, mit denen er gezwungenermaßen herumläuft, doch jetzt befindet er sich endlich in Veränderung, er ist kurz davor, ein anderer zu werden.
Er wird den Körper bekommen, den er will, die Arme, die er will, er steht aus dem Bett auf und trinkt ein Glas Wasser, schluckt die Tabletten. Er braucht einen größeren, stärkeren Körper, einen härteren Körper, jetzt strafft sich die Haut in seinem Gesicht genau so, wie er es gewünscht und vorhergesehen hat.
Er ist dabei, er selbst zu werden.
Es ist eine ungeheure Verwandlung.
Es ist ihm gelungen, sein eigenes Gesicht zu erschaffen, seine eigene Nase und seinen eigenen Mund, seinen eigenen Blick. Er hat sich das Haar gebleicht, den Körper aufgebläht, er hat seine eigene Uniform genäht.
Er zieht sich an, gewöhnliche Kleider, er will kein Aufsehen erregen, nicht jetzt, nicht zu früh, erst später am Tag wird er zeigen, wer er geworden ist. Er faltet die Polizeiuniform zusammen und verstaut sie mühsam in einer Tasche. Eine Waffe und Munition in einem Koffer. Dann verlässt er leise das Haus.
Es hat sich bewölkt, eine schwere graue Wolkenschicht liegt über der Stadt, in der es jäh dunkler geworden ist.
Er setzt sich ins Auto, einen Lieferwagen. Eine Autobombe, er hat sie selbst gebaut. Wochenlang, monatelang hat er Tag und Nacht auf einem Bauernhof verbracht und Chemikalien vermischt. Er hat Kunstdünger getrocknet, Diesel aufgekocht und mit dem Pulver von zerstoßenen Kopfschmerztabletten vermischt. Er hat Dünger geschleppt und gemahlen. Er hat sich am Diesel vergiftet, trotz der Gasmaske. Er hat im Gesicht und am Körper Säureflecken und Beulen bekommen; er hat zu Gott gebetet, dass ihm die große Arbeit, die er vorhat, glücken wird.
Er hat den Sprengstoff in Behältnisse gefüllt und diese im Lieferwagen installiert, jetzt startet er den Wagen und fährt ins Stadtzentrum. Auf den Straßen, in den Geschäften und Büros sind schon viele Menschen, es ist ein ganz gewöhnlicher Julifreitag. Drückend heiß, bewölkt und schwül, bald wird es regnen.
Er parkt den Wagen im Herzen der Stadt, im Herzen all des Normalen, im Herzen des Alltäglichen; dann verlässt er den Wagen, er geht entspannt und so normal wie möglich, als wäre er ein ganz gewöhnlicher Mann in dieser Stadt, doch das ist er nicht.
Um fünf nach fünf steht der junge Mann in seiner Polizeiuniform auf einer Fähre. Eines der Opfer, das das Massaker auf der Insel überlebte, beschrieb ihn so: ein Mann im Kostüm.
Er steht auf der Fähre, den Koffer in der Hand. Das schwarze Kostüm mit weißen Reflexstreifen um Beine und Arme ist von Regen und Schweiß durchnässt. Er hat lange an seinem Kostüm genäht, und sobald er auf der Insel an Land geht, erweckt es Aufmerksamkeit und Misstrauen, vielleicht ähnelt er einer jener Figuren von Hamsun, so aufsehenerregend und unpassend an dem Ort, an den er kommt; aber es ist kein Geigenkasten, den der junge Mann trägt, in dem Koffer befinden sich eine Automatikwaffe und Munition. Er geht an Land. Es ist nicht Liebe, mit der er kommt, keine Mysterien oder eine rätselhafte Vergangenheit, er kommt mit reiner Gegenwart, mit reinem Hass, er kommt auf die Insel mit der Waffe.
Auf dem Weg vom Fähranleger zum Hauptgebäude auf der Insel erschießt er die Frau, die herauskommt, um ihn zu begrüßen.
Er erschießt den Wachmann, der aus dem Haus kommt.