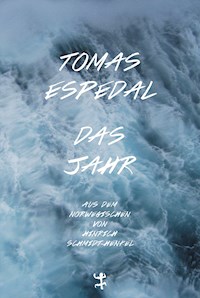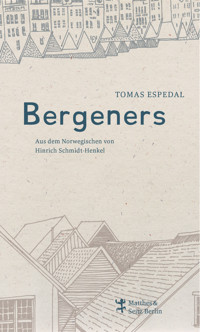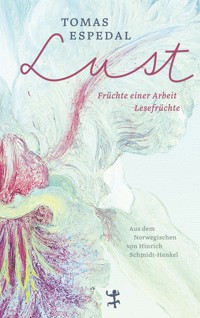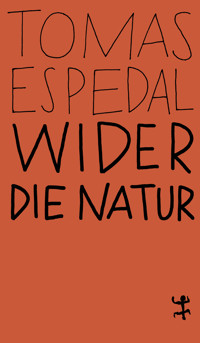
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Mann wird älter. Er verliebt sich in eine junge Frau. Sie beginnen eine Affäre. Die junge Frau verlässt den älteren Mann. Eine alte Geschichte, doch für Tomas Espedal bedeutet sie einen Riss in seinem Leben, der einen intensiven Erinnerungsprozess in Gang setzt: Seine Jugend, die erste Liebe, die Zeit mit seiner verstorbenen Frau, große Momente, schwere Stunden und Erfahrungen des Alltags ziehen an ihm vorbei. Die tragische Auflösung des Ich-Erzählers wird von der Auflösung der literarischen Form begleitet, die in einem Notizbuch mündet, das mit den unversöhnlichen Worten schließt: »Du sagst Ende, aber die Liebe wird nicht enden.« Ein erschütternd kompromissloses Buch. Ein Heilmittel gegen den Schmerz der Liebe. »Dieses Buch ist eine Offenbarung.« Stein Roll, Adresseavisen »›Wider die Natur‹ ist einfach eine Liebesgeschichte, sie zieht den Leser mit großer Kraft in ihren Bann und spricht direkt zu jedermann, der den Schmerz der Liebe einmal erlebt hat.« Ingunn Økland, Aftenposten »Tomas Espedals Bücher sind die Hauptschlagader der norwegischen Gegenwartsliteratur.« Jørn O. Mørch Larsen, Bergensavisen
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 179
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tomas Espedal
WIDER DIE NATUR
(Die Notizbücher)
Aus dem Norwegischen vonHinrich Schmidt-Henkel
Es gab eine Zeit, da glaubte ich in ihr eine naheVerwandte von mir zu sehen, eine Mutter, Schwester,Tochter, was weiß ich, vielleicht sogar eine Gattin, dieim Begriff war, mich wegzusperren.Samuel Beckett
Inhalt
DIE BIBLIOTHEK
DIE ARBEIT, DIE FABRIK
DIE LIEBESARBEIT
ARBEITSRAUM, LABORATORIUM
EIN KLEINES BUCH ÜBER DAS GLÜCK
DIE NOTIZBÜCHER
QUELLEN DER ZITATE
DIE BIBLIOTHEK
Ich werde allmählich alt; ich kenne mich selbst nicht mehr. Das hat mir immer gefallen, dieses Bild vom Altsein: der ältere Mann und die junge Frau. Ich weiß nicht, woran es mich erinnert, an ein Verbrechen vielleicht, oder an die Natur; an die Brutalität und Gewalt der Natur, ihre Unschuld. Man weiß nicht, wer der Schuldige ist, er, der auf dem Stuhl sitzt, oder sie, die über ihm sitzt, auf seinem Schoß, in einem schwarzen Abendkleid mit Ausschnitt.
Die weiße Haut und das nicht mehr junge Gesicht, grob und faltig, das an der nackten, jungen Brust lehnt.
Die festen, hellen Brüste werden von einem stramm sitzenden BH gehoben. Ein vollkommener Bogen. Der weiße Bogen von Hals und Brüsten; wie gut sein Gesicht an die weiße Haut passt. Er ruht aus. Er ist zufrieden. Er sitzt auf einem Stuhl. Sie sitzt auf seinem Schoß, sein Kopf ruht an der weißen Brust.
Sie sind auf einer Abendgesellschaft. Sitzen in einem abseits liegenden Zimmer, einer kleinen Bibliothek mit schwacher Beleuchtung. Durch die Wände sind die Geräusche des Festes zu hören; Stimmen, Lachen, Gläserklirren. Sie hat ihm den rechten Arm um die Schultern gelegt, zieht ihn an sich; er drückt den Mund auf ihre Brust. An der Wand sind Spiegel. Sie hat sich das Haar zu einem Pferdeschwanz oder einer Peitsche gebunden, die beim Sprechen und im Gehen wippt: In dem Augenblick, als er sie sah, hatte er sein eigenes Alter vergessen.
In dieser Begegnung gab es keinen Altersunterschied.
Der Altersunterschied kam später, als sie sich zurückzogen, in das Zimmer mit den Büchern und Spiegeln.
Sie sitzt auf seinem Schoß; er umarmt sie, als wäre sie seine Mutter. Sie können sich im Spiegel sehen. Mir fällt bei dem Anblick ein Bild von Velasquez ein: Die junge Frau wirkt noch schöner, wenn man sie neben einem Krüppel sieht.
In dem Augenblick, als er sie sah, hatte er sein eigenes Alter vergessen. Sie ging dort vorbei, wo er saß, von Freunden und Bekannten, Autoren und Studenten umringt, ihr Haar war zu einem Pferdeschwanz gebunden, der auf Rücken und Schultern schlug, während sie auf hochhackigen Schuhen vorbeistöckelte, wahrscheinlich war sie größer als er. Er stand auf, fast automatisch, und ging dahin, wo sie mit ein paar Freundinnen stand. Keinen Augenblick lang dachte er an sein eigenes Alter. Der Altersunterschied kam später, in der Bibliothek, als sie sich im Spiegel sahen. Ein beunruhigendes Bild; die beiden Gesichter, so ähnlich in all ihrer Verschiedenheit, wie Geschwister, wie Vater und Tochter, oder Mutter und Sohn, und vielleicht war es dies Naturwidrige, das Groteske und Malerische, ja, das Zeitlose an dem Bild im Spiegel, weswegen sie einander nicht loslassen wollten, sie wollten einander nicht loslassen.
Er ist achtundvierzig Jahre alt, er wirkt älter, an den Schläfen ergrautes Haar, kurzgeschnittener, grauer Bart. Ein breiter Mund, fleischige Lippen, da sind Schnitte in den Lippen und Narben um den Mund wie nach Kämpfen oder Verletzungen, er hat ein grobes, faltiges Gesicht. Es mag von Einsamkeit oder zu vielen Genüssen verwüstet sein, was genau in seinem Gesicht wohnt, lässt sich nicht sagen, aber das Verwüstete macht ihn schön; sie fand gleich, er hat ein verwüstetes und schönes Gesicht. Wenn sie ihn ansieht, aus der Nähe, jetzt, wo sie auf ihm sitzt und sich vorbeugt, um ihn zu küssen, spürt sie nichts als Angst. Es muss eine Angst sein, die sie braucht, denn sie drückt ihre Lippen auf seine und steckt ihm die Zunge in den offenen Mund. Was sucht sie? Vielleicht will sie ihn einfach als Liebhaber. Vielleicht will sie sich in etwas Gefährliches, Bedrohliches hinauswerfen, das sie von Grund auf verändert. Er sitzt auf dem Schreibtischstuhl, im schwarzen Anzug und weißen Hemd, den schwarzen Schlips hat er gelockert; sie setzt sich ihm auf den Schoß, als wären sie beide schon vertraut mit dem Bild, das sie im Spiegel erwartet: Der Tod und das Mädchen.
Es ist die Silvesternacht. Er schaut auf seine Armbanduhr, es ist zehn nach elf. Sie hören die Geräusche der Party in der übrigen Wohnung; er greift nach der Flasche auf dem Schreibtisch, er schüttelt sie ein wenig und drückt den Korken hoch, so dass er mit einem Knall zur Decke fliegt; sie zuckt zusammen, richtet sich ruckartig auf und schreit leise auf, der Schaum spritzt auf ihren Hals. Sie wird rot und verbirgt ihr Gesicht in den Händen, aber er hat gesehen, wie ihr das Blut zu Kopfe stieg. Er gießt Champagner in die beiden Gläser, setzt ihr das eine an die Lippen und schüttet ihn ihr in den Mund, sie kann nicht so schnell schlucken, Schaum rinnt ihr zwischen den Lippen heraus, er küsst sie.
Ich ersticke, sagt sie.
Er lacht.
Gib mir Champagner, sagt er.
Sie nimmt das volle Glas und gießt es ihm in den Mund, sie gießt, so schnell sie kann, aber er trinkt schneller, sie nimmt die Flasche und gießt ihm den Champagner direkt in den Mund, er trinkt rasch, wie bodenlos, denkt sie.
Sie trinken, nuckeln an der Flasche. Er zieht eine Maske aus der Jackentasche seines Anzugs, eine schwarze Stoffmaske mit zwei kleinen Augenlöchern, sie bedeckt die Stirn und fast das ganze Gesicht, nur Nase und Mund sind unter den blauen Augen zu sehen. Er sieht sie an, und jetzt fällt ihr auf, dass sein Blick alt ist. Als wären diese beiden Augen immer schon da gewesen, in der Dunkelheit, frei in der Luft schwebend, ohne Gesicht, ohne Hände, zwei Augen, die sie nie mehr loslassen werden, die sie nie mehr los wird; sie sind ein Teil von ihr, ist das ihr eigener Blick, der da vor ihr aufgehängt ist, zwei starrende, ovale Organe, die außen an ihr angewachsen sind, an ihren Körper gefesselt, wie ein künstlicher Finger, die Verlängerung eines Arms; sie macht die Augen zu. Ich fühl mich nicht so gut, sagt sie.
Er nimmt den Schlips ab, windet ihn ihr zweimal um Kopf und Haare. Eine straff sitzende Augenbinde, als hätte er sie sofort verstanden, ihren Wunsch nach Dunkelheit, nach Abwesenheit von Augen; sie schlingt ihm die Arme um den Kopf und zieht ihn an sich.
Er steht auf, lässt sie im Dunkeln sitzen. Er zieht ein Buch aus einem Regal, tut so, als ob er daraus vorlese: Ovid schreibt, Blindheit verstärkt den Tastsinn der Finger, sagt er. Er nimmt ein Tütchen aus der Innentasche seiner Jacke, ein durchsichtiges Plastiktütchen, er streut den weißen Stoff in zwei Streifen auf ein Blatt Papier, das auf dem Schreibtisch liegt, steckt ihr ein dünnes Röhrchen ins Nasenloch; saug auf, sagt er. Er zwingt ihren Kopf zum Schreibtisch hinunter, und sie atmet vorsichtig durch die Nase ein, erinnert sich unvermittelt daran, wie sie früher in den Schnee gedrückt wurde, wie der Schnee ihr Mund und Nase füllte, der kalte Schnee, sie atmet ihn ein und ist überrascht, wie heiß er ist, er brennt in der Nase und im Kopf, eine Flamme aus Schnee. Sie macht den Mund auf und will die Hitze ausspucken, die ihr Hals und Brust füllt. Sie spuckt ihm ins Gesicht.
Er beugt ihren Kopf nach hinten, sie legt den Oberkörper in einem Bogen gegen den Schreibtisch. Dann zieht er ihr das Kleid über die Schultern und den BH weg und streut eine Linie weißen Pulvers zwischen die Brüste. Er hält das Röhrchen zwischen ihre weißen Brüste und atmet kräftig ein.
Sie schwitzt auf der Stirn, kleine Schweißtröpfchen laufen an den Nasenflügeln hinab, eine dünne Schweißschicht in dem feinen Flaum über dem Mund; er küsst sie.
Du küsst wie eine Schlange, sagt sie.
Du hast eine Schlangenzunge.
Sie steckt ihm die Zunge in den Mund, und er dringt vorsichtig in sie ein; ein ununterbrochener Kreis, wie wenn die Schlange der Schlange in den Schwanz beißt und von der Schlange in den Schwanz gebissen wird, wie wenn er sich auf den Boden legt und sie sich auf ihn setzt; sie beugt sich vor und nimmt sein Geschlecht in den Mund, während er die Zunge in ihres steckt.
Sie stülpt die Lippen vor und führt sie über seinen Schwanz, sie lutscht fest daran. Sie legt Daumen und Zeigefinger in einem Ring um seinen Schaft und führt das enge Fingerloch auf und ab, mal langsam, mal schnell, ein wechselnder Rhythmus, während sie den geöffneten Mund auf der Eichel hat und sie mit der Zunge befeuchtet. Sie streckt die Zunge aus.
Er packt ihre Haare, den Pferdeschwanz, und zieht ihren Kopf so hart nach hinten, dass sie auf alle viere gehen muss. Wie ein Tier steht sie auf Knien und Ellbogen, das Kleid über die Hüften geschlagen, und er ist ein Tier, das von hinten in sie eindringt, während sie über den Boden kriecht. Sie kriecht blind bis zum Schreibtisch, legt beide Hände an die Tischkante und zieht sich hoch. Eine Schreibtischlampe, sie stürzt sie um. Stifte und Papier, sie schiebt alles weg, legt sich rücklings auf den Tisch und schürzt ihr Kleid.
Petrus Abaelard schreibt in seinem langen autobiografischen Brief von 1132, seiner Leidensgeschichte: »Es lebte damals in Paris ein junges Mädchen, Héloïse geheißen, die Nichte eines Kanonikers Fulbert; er liebte sie zärtlich und wollte darum nichts versäumen, was ihrer geistlichen Ausbildung förderlich war. Sie war eine anmutige Erscheinung; an den ersten Platz rückte sie ihre ausgedehnte Bildung.« Héloïse war sechzehn Jahre alt. Zweiundzwanzig Jahre jünger als Abaelard, der ihr Lehrer war, in den sie sich verliebte; er schreibt in dem Brief: »... war ich doch hochberühmt und jugendlich anmutig vor anderen und brauchte von keiner Frau eine Abweisung zu fürchten, wenn ich sie meiner Liebe würdigte.« Der selbstbewusste, arrogante und temperamentvolle Abaelard ging nach Paris, um Philosophie zu studieren und Bücher zu schreiben, er wollte Schriftsteller werden. Er lehrte und schrieb eine Reihe Bücher über Fragen der Logik, doch sein Rang in der Literaturgeschichte beruht vor allem auf seinen Briefen, in denen er über die Liebesgeschichte mit Héloïse schrieb: »Während der Unterrichtsstunden hatten wir vollauf Zeit für unsere Liebe; und wenn Liebende sich wohl nach einem stillen Fleck sehnen, wir brauchten uns dafür nur zur Versenkung in die Wissenschaften zurückzuziehen ... In unserer Gier genossen wir jede Abstufung des Liebens, wir bereicherten unser Liebesspiel mit allen Reizen, welche die Erfinderlust ersonnen. Wir hatten diese Freuden bis dahin nicht gekostet und genossen sie nun unersättlich in glühender Hingabe, und kein Ekel wandelte uns an.«
Das Zimmer, abseits gelegen, eine Bibliothek mit tiefroter Tapete, die glitzert, wo das durchs Fenster einfallende Licht auf sie trifft und silberne gestickte Rosen in der dunklen Wandbespannung offenbart. Ein bleigefasstes Fenster mit tiefer Laibung, in der man sitzen und lesen kann, in der Héloïse sitzt und liest. Regale, lederne Buchrücken an den Wänden, vom Boden bis zur Decke. Goldglänzende Messingplatten mit Talglichtern in Kerzenständern, ein auf der Spitze stehender rhombenförmiger Spiegel mit Bronzerahmen. Eine mit Decken belegte Bank, darauf orientalische Kissen. Die Kissen genauso gemustert wie die Teppiche auf dem Boden, mehrere Schichten, die lautlos nachgeben, wenn man darübergeht, wenn Abaelard darübergeht, er schließt die Tür hinter sich. Steht im Zwielicht hinter dem fast brusthohen Schreibpult; er trägt enge, moosgrüne Hosen, deren Beine unten in die spitz zulaufenden Lederschuhe gesteckt sind. Ein weißes Hemd. Ein orangefarbenes Samtwams, an der Hüfte mit einem dünnen Ledergürtel gebunden. Darin ein silbernes Messer, ein rosa Geldbeutel und ein Parfümfläschchen mit einem goldenen Herzen darauf; er ist unrasiert und hat eine schwarze runde Mütze auf dem Kopf, über das lange dunkle Haar gezogen. Héloïse sitzt lesend in der Fensternische. Sie trägt ein schwarzes Oberteil mit weißem Brusttuch, ein apfelsinenfarbenes langärmliges Kleid und ein besticktes Bruststück, das bis zur Leibesmitte reicht, wo der dicke Stoff des Kleides von einem breiten Gürtel mit roten Troddeln an den Enden gehalten wird. Eine Spange in dem sandfarbenen Haar, das lose über die Schultern fällt; Héloïse liest und hebt den Blick nicht von ihrem Buch: Glossuale super Porphyrium, Logica nostrorum petitione sucirum. Errötet sie? Abaelard zieht die Jacke aus, das weiße Hemd ist auf der Brust geöffnet; er hält ihr ein Schmuckstück hin, ein Geschenk für sie, für Héloïse, ein silbernes Halsband, eine versilberte Schlange; sie beißt sich in den Schwanz.
Abaelard legt es Héloïse um den Hals, schließt es im Nacken und küsst sie auf den Mund: Wer ein Geschenk macht, erwartet etwas zurück, was will er von ihr haben; sie gibt ihm vorsichtig ihre Zunge.
Sie hat noch nie jemanden geküsst. Sie reckt den Hals, schließt die eine Hand. Presst sich die langen Fingernägel in die Handfläche, bis die Haut nachgibt und aufspringt.
Sie hebt das Kinn und sieht, wie sich sein Gesicht über ihres legt; Augen, Nase, Mund, das Gesicht, es füllt ihr Gesichtsfeld ganz aus, und sie möchte ihn wegschieben. Sie küsst. Sie schiebt ihn weg und sieht, dass sie seine Wange mit ihrem Blut gerötet hat.
Er ist ihr Lehrer, ein Mann, zu dem sie aufblickt, den sie respektiert. Er ist Petrus Abaelardus, Autor logischer und philosophischer Schriften, ein Kleriker, der an der École du Cloistre Vorlesungen hält, der wichtigsten Lehrstätte von Paris. Er ist achtunddreißig Jahre alt, ehrgeizig und selbstsicher, wie es heißt, und ziemlich gutaussehend, findet sie, absolut nicht eingebildet und arrogant, nicht so von sich eingenommen, wie ihr erzählt wurde, vielmehr eigensinnig und ungezähmt, als lebte er eher mit der Natur als mit Büchern, eher im Wald als in der Schule, eher mit den Tieren als mit den Menschen; und erkennt sie sich nicht selbst in dieser Einsamkeit wieder? Das Haar hängt ihm frei über das schmale Gesicht, verbirgt die großen Ohren nur teilweise; sein Blick ist rastlos, die beiden schnellen Augen folgen ihr aufmerksam und hingebungsvoll, erinnert sein Aussehen sie nicht an ihre Hunde, an die Pferde, wie er geht und aufschreckt, als würde er nie ruhen, wäre immer auf der Hut? Sie steht Tieren näher als Menschen, den Hunden, ihrem Pferd. Jeden Tag nach dem Unterricht wandert sie mit den Hunden durch Feld und Wald; hat sie nicht von ihm fantasiert, auf ihn gewartet? Er hat ein sinnliches, attraktives Gesicht, findet sie; sagt nicht das Gerücht, er würde all sein Geld für Lustbarkeiten und Frauen ausgeben? Ist sie nicht vor ihm gewarnt worden, müsste sie sich nicht vor ihm hüten? Hat sie nicht gehört, dass er Mädchen mag, dass er Frauen verführt? Dass er Gedichte und Lieder über sie geschrieben hat, dass er besonders junge Frauen mag, dass man seine Lieder auf der Straße singt: Lai des Pucelles. Das Lied von den Jungfern.
Ist sie nicht auch eine von ihnen? Was hat sie mit ihm vor? Sie versucht, ihn auf Abstand zu halten, aber dann kommt er erregt und erwartungsvoll in das Zimmer, in dem sie liest, ja, wie ein Hund kommt er. Er legt den Kopf in ihren Schoß, er sitzt ihr zu Füßen. Er zieht ihr Schuhe und Strümpfe aus und küsst ihr die Beine. Sie lässt ihn gewähren.
Sie wandern lange durch Feld und Wald; hat sie auf ihn gewartet, nein, auf einen Jungen hat sie gewartet, der sie versteht und sie liebt. Einen Jungen, der ihre Eigenart versteht, ihre Einsamkeit und Stille. Sie hat auf einen Jungen gewartet, der ihr ähnlich ist, einen Bruder eigentlich, aber so einen Jungen gibt es vielleicht nicht, nicht in Paris, in ganz Frankreich nicht; sie träumt davon zu reisen, andere Länder kennenzulernen, sie fängt an zu lesen. Sie liest morgens und abends. Nachmittags reitet sie aus, durch Feld und Wald; manchmal lässt sie den Hund hinterherlaufen, das Windspiel, den schnellen, hochbeinigen Perceval, der ihr überallhin folgt. Sie hat auf einen Jungen gewartet, jetzt geht sie neben einem Mann, er könnte ihr Vater sein, und sie hat beschlossen, sich ihm hinzugeben.
Maiglöckchen. Blaustern. Anemone. Rittersporn. Weiße Waldhyazinthe. Kriechender Hahnenfuß. Gletscherhahnenfuß. Scharfer Hahnenfuß. Kresse und Marienfrauenschuh. Osterglocken, gelbe und weiße. Heidenelke und Klee. Und im Garten: Schneeglöckchen und Krokus.
Und im Garten:
eine Eiche
Ein Teich
Seerosen
Und Karpfen
schmale, ausgetretene Wege
Linden
kreuz und quer zwischen den Bäumen
Ulmen
und Büschen
Hagebutten und
Weißdorn
Von einer kleinen Anhöhe
Notre Dame
am Rand des Parks
die Kathedrale
Die Klänge, der Klang
Kirchenglocken
von Trompeten
Die Musiker in der
Sackpfeifen und Lauten
Rue des Ménestrels
Harfe und Gesang
Lai des Pucelles
Sie gehen in den Garten. Nebeneinander im Park, der hochgewachsene, langhaarige Abaelard und die junge Héloïse, die ihn an einer unsichtbaren Leine führt, einer spürbaren Kette, die um seinen Hals gebunden ist; dann und wann bläst der Wind ihm das dunkle Haar übers Gesicht und verbirgt die großen Augen, er hat einen rastlosen, scharfen Blick, zwei blaue Augen folgen ihr aufmerksam und hingebungsvoll, wie einer ihrer Hunde. Er schüttelt den Kopf und schleudert sich das Haar aus dem Gesicht. Dann blickt er sie an, um mitzubekommen, in welche Richtung sie gehen will, er folgt ihren Bewegungen und ihren Eingebungen, er ist hellwach für die geringste Veränderung ihrer Stimme, ihrer Stimmung, als würde er darauf warten, dass sie ihn plötzlich ruft oder ihn anweist, sich zu setzen.
Sie setzen sich in den Schatten unter eine Linde. Abaelard löst seinen blauen Umhang, legt ihn wie eine Decke auf die Wiese. Dann schlägt er eines der mitgebrachten Bücher auf, also sollte der Unterricht hier weitergehen; der Lehrer und seine Schülerin, er schlägt das Buch auf und liest aus Ovids Liebeskunst vor:
Doch jener alte Soldat liebt sachte
und mit Überlegung,
Und er erduldet auch viel, was ein Rekrut
nicht erträgt.
Ach, nur ein langsames Feuer verbrennt ihn
wie Heu, wenn es feucht ist,
Oder wie Holz, welches grad oben
im Bergwald man schlug.
Diese Liebe ist sichrer, nicht leicht,
doch ersprießlicher jene.
Pflückt drum die Früchte, die bald fallen,
mit eiliger Hand.
Ist ihr Gesicht wunderschön, so soll auf dem
Rücken sie liegen;
Die, deren Rücken gefällt, soll man vom
Rücken her sehn.
Die, deren lange Seite so hübsch ist, dass gern
man sie anschaut,
Drücke die Knie aufs Bett, biege den Hals
leicht zurück.
Sind ihre Schenkel jugendlich, makellos
auch ihre Brüste,
Stehe der Mann, während sie schräg übers
Lager sich streckt.
Tausend Spiele kennt Venus; sehr einfach ist’s, auch
wenig mühsam,
Liegt sie nach rechts geneigt da, halb auf den
Rücken gelehnt.
Bis in ihr innerstes Mark gelöst soll die Frau
alle Wonnen
Spüren; das Lustgefühl soll gleich groß für
beide dann sein.
Nicht sollen schmeichelnde Worte verstummen und
liebliches Flüstern,
Lockere Worte solln nicht aufhören mitten
im Spiel.
Schreibt dann auf jede Beute der Liebe: »Dies hat
Ovid mich gelehrt.«
Von dort, wo sie sitzen, unter der großen, schützenden Linde, deren Krone so ausgreifend und schwer ist, dass der Baum wirkt wie ein Gebäude, können sie das Haus sehen, in dem Héloïses Onkel wohnt; sie warten, dass er die Lichter löscht und die Treppe ins Obergeschoss hinaufgeht, zu seinem Schlafgemach, dann kommen sie aus ihrem Versteck und gehen zurück ins Haus, wo sie sich in der Bibliothek einschließen werden. Héloïse wird sich ausziehen, sie will nackend vor Abaelard stehen. Sie will ihn überraschen. Sie will zeigen, dass sie mehr ist als ein ahnungsloses, unerfahrenes Mädchen, mehr als seine Schülerin; eine junge Frau, die verführt werden will, von einem Verführer, nein, sie will mehr als das; sie will ihm die Macht aus den Händen nehmen, will sich als mutiger und stärker erweisen als er. So ist Héloïse. Sie sitzt auf dem Boden, zieht sich die Strümpfe aus. Sie knüpft den breiten Gürtel auf und öffnet das Kleid, ungeschickt, sie hat sich noch nie vor jemandem ausgezogen. Sie zieht sich das Zeug über den Kopf, es verfängt sich in den Haaren, sie reißt es los, will sich beeilen, es muss schnell passieren; sie will aus den Kleidern schlüpfen, über den Boden kriechen und seine Beine mit den Armen umschlingen. Sie will ihn zu Boden werfen. Sie will über ihn herkriechen, und dann wird sie verwandelt werden.
Héloïse weiß nicht mehr, wie sie sich verhalten soll, sie fällt förmlich über Abaelard her, stürzt ihn zu Boden und setzt sich auf ihn; wie zwei rangelnde Jungen. Sie legt ihn hin, drückt seine Hände auf den Boden. Sie küsst ihn und leckt ihm das Gesicht. Sie beißt ihm in die Lippe. Sie pustet ihm ins Ohr, ruft ihm seinen Namen ins Ohr, peitscht sein Gesicht mit ihrem Haar. Sie presst ihm die Hand auf den Mund, er bekommt keine Luft mehr. Sie reitet auf ihm, wie sie sich in ihrer Vorstellung auf einem Jungen, einem Mann reiten sah, einem Tier; sie packt mit beiden Händen seine langen Haare und reitet auf ihm, als wäre er ein Pferd, und sie schreit auf und ruft laut, als sie in die Luft geschleudert wird; sie stürzt und fällt, kullert kopfüber herum und wird an eine Wand geschleudert, an der ihre Kindheit zerbirst.
Neujahrsabend. Sie sitzen nebeneinander in der Bibliothek. Er schaut auf seine Uhr, es ist fast zwölf. Sie legt ihm den Arm um die Schulter, zieht ihn zu sich; sein Kopf ruht an ihrer nackten Brust.
Ich liebe dich, sagt er.
Es ist zu früh, so etwas zu sagen.
Rede keinen Unsinn, sagt sie.
Du bist die schönste Frau, die ich je kennengelernt habe.
Das sagst du sicher nicht zum ersten Mal.
Stimmt, aber das heißt nicht, dass es nicht wahr ist.
Wie viele Geliebte hast du gehabt?, fragt sie.
Er zuckt mit den Schultern.