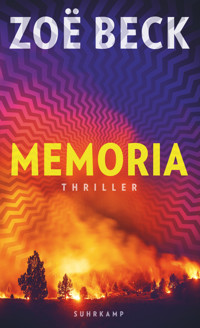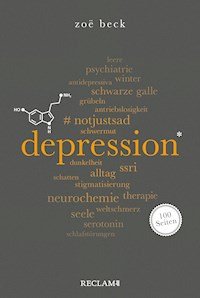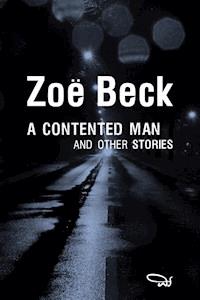9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CulturBooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
»Wozu die deutsche Kriminalliteratur in der Lage ist, zeigt der fantastische Band ›Berlin Noir‹. Besser kann man sich nicht durch Berlin führen lassen.« Thekla Dannenberg, Perlentaucher Ein spannendes literarisches Städteporträt und eine tiefschwarze Liebeserklärung an eine Stadt, die vor allem eines ist: keine Sekunde langweilig. 13 Kurzgeschichten, 13 Blickwinkel, 13 Stadtviertel – und 13 faszinierende Teile eines größeren Puzzles. Das Verbrechen zieht seine blutige Spur vom noblen Grunewald bis in den tiefsten Wedding, vom beschaulichen Altglienicke über das bunte Kreuzberg bis ins lebendige Friedrichshain, spürt den tödlichen Geheimnissen der Geschichte nach und setzt die Gegenwart als dunkel schimmerndes Kaleidoskop neu zusammen. Eine junge Frau aus gutbürgerlichem Zuhause endet in der Obdachlosenszene um den Bahnhof Zoo; eine Schießerei zwischen einem Ex-Bullen und einem Kleinganoven endet tödlich; die zarte Liebesgeschichte zwischen einer Boutiquebesitzerin und einem ehemaligen Kindersoldaten wird durch einen notwendigen Mord gestört – und wer weiß, was es mit der Leiche auf sich hat, die ein Barmann in der Kühltruhe einer Absturzkneipe findet … »Berlin Noir« – so vielfältig wie die Stadt. Unberechenbar, überraschend, tragisch und komisch. Ein substanzieller Baustein der Berlin-Literatur. Aktuell und originell, wie Berlin selbst.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 380
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Impressum
eBook-Ausgabe: © CulturBooks Verlag 2018
Gärtnerstr. 122, 20253 Hamburg
Tel. +4940 31108081, [email protected]
www.culturbooks.de
Licensed from © 2008 by Akashic Books, (www.akashicbooks.com)
Umschlaggestaltung: Magdalena Gadaj
eBook-Herstellung: CulturBooks
Erscheinungsdatum: März 2018
ISBN 978-3-95988-112-8
Über das Buch
13 Kurzgeschichten, 13 Blickwinkel, 13 Stadtviertel – und 13 faszinierende Teile eines größeren Puzzles. Ein spannendes literarisches Städteporträt aus extra für diese Anthologie geschriebenen Originalgeschichten etablierter Top-Autor/innen und aufregender Newcomer.
Das Verbrechen zieht seine blutige Spur vom noblen Grunewald bis in den tiefsten Wedding, vom beschaulichen Altglienicke über das bunte Kreuzberg bis ins lebendige Friedrichshain, spürt den tödlichen Geheimnissen der Geschichte nach und setzt die Gegenwart als dunkel schimmerndes Kaleidoskop neu zusammen.
Eine junge Frau aus gutbürgerlichem Zuhause rutscht in die Obdachlosenszene um den Bahnhof Zoo; eine Schießerei zwischen einem Ex-Bullen und einem Kleinganoven endet tödlich; die zarte Liebesge- schichte zwischen einer Boutiquebesitzerin und einem ehemaligen Kindersoldaten wird durch einen notwendigen Mord gestört – und wer weiß, was es mit der Leiche auf sich hat, die ein Barmann in der Kühltruhe einer Absturzkneipe findet …
»Berlin Noir« ist ein spannendes literarisches Städteporträt und eine tiefschwarze Liebeserklärung an eine unberechenbare Stadt, die vor allem eines ist: keine Sekunde langweilig.
Über den Herausgeber und die Reihe
Thomas Wörtche, geboren 1954, ist Publizist, Literaturwissenschaftler, Kritiker und Herausgeber. Der Erfinder der Krimireihe metro (Unionsverlag) setzt heute seine Arbeit als Krimi-Herausgeber beim Suhrkamp Verlag fort.
»Berlin Noir« ist nach »Paris Noir« der zweite Teil einer Reihe von internationalen Noir-Anthologien. Jedes Buch besteht aus exklusiven Storys namhafter Autorinnen und Autoren und talentierter Newcomer, und Jede Geschichte spielt in einem anderen Viertel einer Stadt. So entstehen packende literarische und geografische Porträts mit ungewöhnlichen, breit gefächerten Einblicken. Als nächstes erscheint:
Thomas Wörtche (HG.)
Berlin Noir
Inhaltsverzeichnis
Vorwort des Herausgebers
Berlin macht es dem Noir nicht leicht. Oder ganz leicht. Die Tradition ist beeindruckend, wirkmächtig und auch beängstigend.
Alfred Döblin, Christopher Isherwood, manche Stücke von Bertolt Brecht, die »Morgue«-Gedichte von Gottfried Benn, »M« von Fritz Lang und viele andere Narrative aus dem ersten Drittel des 20. Jahrhunderts, die allesamt einen tinge of noir haben, haben intellektuelle Maßstäbe gesetzt und literarisch-ästhetische Pflöcke eingerammt, an denen schwer vorbeizukommen ist. Möglicherweise hat deswegen nach dem Zweiten Weltkrieg Berlin als Schauplatz nennenswerter Kriminalromane kaum stattgefunden, von Ausnahmen wie Ulf Miehes »Ich hab noch einen Toten in Berlin« (1973) und anderen verstreuten Texten vielleicht abgesehen. Für angelsächsische Autoren war Berlin während des Kalten Krieges interessanter – John le Carré, Len Deighton, Ted Allbeury oder Ross Thomas wussten mit der geteilten Stadt wesentlich mehr anzufangen als die meisten deutschen Genre-Autoren, und selbst die heutige »historische« Berlin-Krimi-Welle vor Pappmaché-Kulissen der 1920er und 1930er Jahre hatte vor Jahrzehnten der Brite Philip Kerr begründet. Es dauerte bis weit in die Achtziger- und Neunzigerjahre, bis Berlin von AutorInnen wie Pieke Biermann, Buddy Giovinazzo oder D. B. Blettenberg wieder auf die kriminalliterarische Topografie des dann vereinigten Deutschlands geschrieben wurde, wenn auch mit Texten, die mit Genre-Korsetts wenig zu tun hatten.
Ein Erbe der eben skizzierten stolzen Tradition, die sich auch hier, in »Berlin Noir«, fortschreibt: Weder Döblin noch Benn, Brecht oder Lang beispielsweise haben irgendwelche Formate von Crime Fiction bedient – sie haben nur ihre eigenen literarischen Projekte mit sehr viel noir durchtränkt. Und so steht es auch mit den meisten Texten in unserer Anthologie, sie folgen nicht unbedingt den üblichen Mustern von Crime Fiction, sondern verstehen noir als freestyle, als ein bestimmtes Denken der Großstadt gegenüber, als bestimmte Blicke auf deren Verfasstheit.
Berlin, das notierte schon Franz Hessel, der Flaneur-Bruder im Geiste von Walter Benjamin, ist eine Stadt, die nicht »ist«, eine Stadt, »die immer unterwegs, immer im Begriff ist, anders zu werden«. Stillstand, könnte man sagen, führt zum Tode, wie Robert Rescues Geschichte »Bis irgendwann« zeigt, die nebenbei auch eine schöne Hommage an das Mastul (in der Story die Bar genannt, ein Ort für Veranstaltungen) ist, mitten im Wedding, ein traditionell proletarischer Bezirk, der zunehmend ins Visier der Gentrifizierung gerät, geschrieben in einem Sound, den man als stoischen Wahnsinn beschreiben könnte. Und auch Johannes Groschupfs unsichtbarer Held in »Heinrichplatz Blues« ist plötzlich weg, nachdem er jahrelang zur Freude vieler Frauen durch die Kneipenmeile am Kreuzberger Heinrichplatz gezogen war, die inzwischen ein veritabler Tourist-Spot ist, der von sämtlichen Kreuzberg-Mythen seit den 68er-Zeiten lebt. Nichts bleibt, wie es war – was bleibt, sind ein Rätsel und das sehnsüchtige Echo eines libertären Lebensstils.
Dieser berühmte Lebensstil ist wiederum ein Widerhall der Roaring Twenties, des Zeitalters der ersten sexuellen Emanzipation, die im »Labor der Moderne« gelebt und inzwischen zum verrucht klingenden »Babylon Berlin« verschlagwortet wurde. Sodom und Gomorrha, heute in Ute Cohens giftiger Story »Valverde« zum gelangweilten Spiel der Reichen (und nicht unbedingt Schönen) im schicken und teuren, exklusiven Grunewald verkommen, kein bisschen emanzipatorisch mehr, sondern zwangsläufig gekoppelt mit Gier, Profit und Ausbeutung. Beschreibbar nur noch in einem irrsinnigen Kunstwerk.
Illusionen und Blendwerk auch im hippen In-Viertel Mitte, das zudem immer mehr der artifizielle Ort des Luxus und der Moden wird, zum Ingrimm der alteingesessenen Bevölkerung. Auch wenn die Hipster auf progressiv machen, auf politisch korrekt und ökologisch nachhaltig – kratzt man am Lack, kommen die bekannten kapitalistischen Praktiken zum Vorschein. Die allerdings stinken, wie in Katja Bohnets »Fashion Week«.
Natürlich ist Berlin auch ein Ort, an dem einem, völlig plausibel, die Sicherungen durchbrennen: Was wirklich in dem Kopf von Dora, der – interessanterweise ebenfalls fast unsichtbaren – Hauptfigur von Zoë Becks gleichnamiger Geschichte vorgeht, bleibt unklar. Sicher ist nur, dass es Aspekte von modern times gibt, die Menschen nicht gut aushalten, selbst wenn ihr Background auf den ersten Blick bürgerlich-solide ist. Dora jedenfalls scheint sich lieber der auch sexuellen Gewalt eines Lebens als Obdachlose rund um den Bahnhof Zoo auszusetzen, anstatt sich den Parametern einer »normalen« Existenz zu fügen. Und wenn man dringend »Normalität« herbeizwingen möchte, wird der Ordnungszwang schnell neurotisch bis psychopathisch, wie in Susanne Saygins Geschichte »Die Schönheit des Zymbelkrauts«, in der die in Schöneberg marodierende Killerin dadurch Ordnung schaffen will, dass sie Vertreter der »bürgerlichen« Ordnung beseitigt, weil in ihrem als botanisches Biotop verstandenen Berlin die gesellschaftliche Diversität nur durch finales Jäten zu sichern ist. Welch ein böses Paradox. Den Kampf um das Verständnis, um die Realität hat der frustrierte Journalist in Ulrich Woelks »Ich sehe was, was du nicht siehst« schon längst radikal verloren, er weiß es nur nicht. Die mediale Durchdringung von Realität und Illusion hat den Filmkritiker, der sich an einer human touch-Story im prekären Teil von Moabit versucht, schon von den Grundlagen der eigenen Existenz entfremdet – er lebt nur noch in Filmen, selbst dann, als er … Aber lesen Sie selbst!
Auch mit der viel beschworenen Identität ist es nicht so einfach in dem Labyrinth der Möglichkeiten, die Berlin für jeden, der damit umgehen kann, anbietet. Tagsüber Biedermann, nachts Mörder, um Karl Marx zu paraphrasieren. Vielleicht eine grausame Überlebensstrategie im besonders vom Party-Tourismus tyrannisierten Friedrichshain rund um den Boxhagener Platz. Um das zu verstehen, ist es möglicherweise opportun, aus dem Ausland zu kommen und den fremden Blick auf die Berliner Verhältnisse zu richten, wie das der italienische Ermittler im Fall von Matthias Wittekindts »Der Unsichtbare« riskiert.
Berlin ist eine relativ friedliche Metropole, zumindest im direkten Vergleich mit anderen Großstädten dieser Welt – das liegt auch daran, dass beispielsweise das organisierte Verbrechen, das hier genauso endemisch ist wie anderswo, strikt darauf achtet, möglichst wenig Kollateralschäden unter unbeteiligten Menschen anzurichten. Was nicht heißt, dass Cops & Gangster kein Thema für »Berlin Noir« wären. Kai Hensel nimmt in »Rammelbullen« einen aktuellen Skandal zum Anlass, eine seltsame Art der Rehabilitation eines in die eheliche Kritik geratenen Polizisten aus dem kleinbürgerlichen Altglienicke ironisch umzusetzen. Ganz Deutschland lachte im Sommer 2017 über eine Berliner Polizeieinheit, die während eines Einsatzes in Hamburg wegen öffentlichem Sex und schwerer Trunkenheit in die Hauptstadt zurückgeschickt wurde. Die Konsequenz in unserer Geschichte: tödliche Schubumkehr.
Blutig wird die Angelegenheit auch bei Miron Zownir, wo korrupte Bullen und veritable Gangster aneinandergeraten: »Überstunden«. Dass die Geschichte sich zwischen Kreuzberg und Neukölln hin- und herbewegt, spricht nicht für eine besondere Kriminalitätsrate dieser beiden Bezirke – Berlins fünfzehn Bezirke sind nur politische Einheiten, die sozial relevante Einheit ist der Kiez, und diese Kieze können innerhalb der Bezirke völlig unterschiedliche Lebens- und Verbrechensräume schaffen, untereinander so fern wie der Mond. Deswegen ist das Neukölln, das uns Max Annas vorstellt, eine ganz andere Art von Welt. Und auch seine Figuren, obwohl sicher nicht »Biodeutsche«, gehören zur normalen vielfältigen Bevölkerung einer Metropole. Dem Typen, der in »Local Train« im Sack steckt, gefällt das nicht. Deswegen gehört er auch in den Sack.
Bleibt die Geschichte. Die ist in Berlin auf Schritt und Tritt gegenwärtig, die Stadt ist vollgesogen mit Geschichte voller Blut und Tod und Gewalt. Die Echos der Nazizeit sind in Michael Wuligers »Kaddisch für Lazar« noch deutlich zu spüren, obwohl es eine ganz heutige und ironische Geschichte über das jüdisch-deutsche Verhältnis ist, besonders lebhaft spürbar im »Neuen Westen«, sehr deutlich in Charlottenburg. Rob Alef hingegen beschäftigt sich in »Dog Tag Afternoon« mit den Folgen des Zweiten Weltkriegs, genauer mit der Luftbrücke 1948/1949, die mehr mit der Westbindung Deutschlands zu tun hat als viele andere Aktionen der Westalliierten. Geschichte bricht sich auch hier ihre Bahn aus der eben nicht zu beerdigenden Vergangenheit ins Jetzt, genau in diesem Tempelhof, in dem die amerikanischen und britischen Flugzeuge die sowjetische Blockade durchlöchert hatten.
Berlin, so wollten wir zeigen, ist »Synchronie-City« (Pieke Biermann), eine Stadt der disparatesten und diversesten Gleichzeitigkeiten, fest mit ihrer politischen und literarischen Geschichte verzurrt und nach vorn immer in Bewegung. Noir sowieso, und das konstitutiv. Insofern ist »Berlin Noir« eine Momentaufnahme – und wenn ich das im Januar 2018 schreibe, vertrauen Sie mal lieber nicht darauf, dass alles im Januar 2019 nicht schon wieder ganz anders aussieht.
Thomas Wörtche
Berlin 2018
Teil 1
DoraVon Zoë BeckBahnhof Zoo
Sieh sie dir an.
Auch wenn es schwerfällt. Du willst sie nicht ansehen, weil sie stinkt und vor Dreck strotzt. Du glaubst zu wissen, was du sehen wirst, aber sieh sie dir trotzdem an.
Warte nicht, bis die Frau von der Bahnhofsmission ihr aufhilft, sie stützt, damit sie nicht gleich wieder umfällt, und sie in die geschützten Räume schleppt, wo sie ihr die Kleidung vom Körper schneiden muss, wo sie sie wäscht und ihr etwas Neues zum Anziehen gibt. Es ist natürlich nichts Neues, sondern abgelegtes Zeug von Fremden, aber für sie ist es etwas Neues, sie wird es vielleicht zwei, drei Tage tragen, bis man ihr die Sachen wieder vom Körper schneidet, weil sie nicht mehr in der Lage ist, sich auszuziehen, weil die Sachen von Dreck und Siff und Blut und Sperma und Kotze so starr sind, dass man sie nur noch vom Körper schneiden und wegwerfen kann.
Man kennt sie dort, man weiß, wie es läuft. Man ist froh, wenn sie kommt, manchmal wird sie von jemandem von der Bahnhofsmission gefunden und mitgenommen. Manchmal schreit sie dann und schlägt um sich, stundenlang, und man holt jemanden, der sie einweist, wenigstens für ein paar Tage, bis sie sich selbst entlässt oder einfach verschwindet. Man hofft hier, sie würde länger in der Klinik bleiben, so lange, bis sie ganz gesund ist, falls es so etwas gibt, ganz gesund. Seit einer, der in der Mission arbeitet, sie zufällig sah, nachdem sie ganze fünf Tage am Stück in der Klinik war, und dann allen erzählte, er habe sie erst gar nicht erkannt, weil sie so jung und schön ausgesehen hatte, wünschen sich das alle hier.
Deshalb, sieh sie dir gut an. Irgendwo da, unter dem Dreck und dem Gestank, gibt es sie noch.
Mit Anfang zwanzig hat sie ihre Tabletten genommen. Nicht immer, aber es gab diese stabilen Phasen. Es gab sogar ganze Monate am Stück, in denen nichts mit ihr passierte. Ich weiß noch, dass wir vor anderthalb Jahren wirklich dachten: Jetzt ist alles gut. Jetzt wird unser Leben wieder normal, und ihr Leben auch. Wir dachten: Sie nimmt noch eine Zeit lang die Tabletten, und dann ist das Thema aus der Welt. Diese Sehnsucht nach dem Normalen. Als wäre jemals irgendetwas normal gewesen. Vor anderthalb Jahren, als wir uns in dieser Zuversicht eingerichtet hatten, kam der Anruf von einem ihrer Freunde. Komm sofort her, sagte er, komm einfach sofort her. Dann war das Gespräch beendet. Ich hatte im Hintergrund Stimmen gehört, laut und wirr durcheinander. Campus eben, dachte ich. Cafeteria. Ich war gerade in der Bibliothek, ich hatte es nicht weit und stieg aufs Fahrrad. Als ich fünf Minuten später am Institut für Mathematik der FU in der Arnimallee ankam, spielte sich vor dem Gebäude eines der Horrorszenarien ab, die ich mir auf dem Weg dorthin versucht hatte, aus dem Kopf zu schlagen.
Dora stand auf den Stufen, die zum Eingang hinaufführten. In jeder Hand eine Glasflasche, die sie wie eine Waffe auf ihre Kommilitonen richtete, die sich am Fuß der Treppe versammelt hatten. Dabei rief sie auf Englisch: I’ll kill you! You fuckin’ Nazis! Mir wurde schlecht, nicht weil ich Angst hatte, dass sie ihren Kommilitonen wirklich etwas antun würde, sondern weil ich sah, dass sie sich eingenässt hatte und es selbst nicht zu merken schien. Ich sah, dass ein Typ, der am Rand der kleinen Gruppe stand, Fotos mit seinem Handy machte.
Als großer Bruder hat man Verantwortung und muss Entscheidungen treffen. Meine Entscheidung war: Erst dem Typen das Handy abnehmen, dann meine Schwester einsammeln. Der Typ wollte mir sein Telefon nicht ohne Weiteres überlassen. Es kam zu einer kurzen Rangelei, von der die anderen kaum etwas mitbekamen. Ich steckte das Gerät in die Hosentasche, packte meine Schwester am Arm und zog sie ins Institutsgebäude. Dort nahm ich ihr die Flaschen ab, stellte sie neben der Tür auf den Boden, führte sie zur Toilette und bat sie, sich ein bisschen zu waschen. Wenn man Englisch mit ihr sprach, funktionierte es ganz gut. Einer ihrer Kommilitonen legte seine Hand auf meinen Arm und reichte mir ihren Rucksack. Ich bedankte mich, suchte darin nach ihren Tabletten, fand nur das Rezept, ausgestellt vor einem Monat. Und fand zum Glück ihre Sportkleidung, die ich ihr in die Toilette reichte, sodass sie sich umziehen konnte. Sie schimpfte immer noch auf die Nazis, klang aber etwas ruhiger und wollte wenigstens niemanden mehr töten.
Wir gingen zur nächsten Apotheke in Dahlem Dorf. Wir setzten uns in den Biergarten der Luise, ich gab ihr eine von ihren Tabletten und sagte, sie müsse sie nehmen, um sich gegen die Nazis zu schützen. Wie immer war sie erst misstrauisch, nahm sie aber schließlich doch. Es würde noch ein paar Stunden dauern, bis die Stimmen in ihrem Kopf still waren, und ein paar Tage, bis sie stabil war.
Wenn du sie ansiehst, denk daran, wie jung sie noch ist. Du wirst glauben, sie sei mindestens zwanzig Jahre älter. Das macht der Dreck in ihrem ausgemergelten Gesicht. Ihre hohlen Wangen. Die leeren Augen. Sie isst kaum, dafür trinkt sie, weil sie die Stimmen nicht mehr hören will, und manchmal, wenn sie irgendwie Geld aufgetrieben hat, kauft sie sich Drogen, egal welche. Alles ist ihr recht, solange es stärker ist als die Stimmen.
Dora hörte die Stimmen zum ersten Mal in Südamerika. Jedenfalls glauben wir das. Wir waren nicht dabei, und sie hat uns nie viel darüber erzählt, aber der Freund, mit dem sie in den Semesterferien dorthin gereist war, glaubte es auch. Wir haben es uns so zusammengereimt: Irgendwo hat sie irgendwie die falsche Droge erwischt, sie hatte zu diesem Zeitpunkt so gut wie keine Erfahrung mit Rauschmitteln gemacht, und diese Droge muss in ihrem Gehirn irgendetwas ausgelöst haben. Die Ärzte, mit denen wir gesprochen haben, sagten, dass sie längst in einer Frühphase ihrer Erkrankung gesteckt haben musste und es sowieso dazu gekommen wäre.
Nach ihrer Rückkehr aus Südamerika wirkte sie gehetzt. Sah sich ständig um, sprach leise, weigerte sich zu telefonieren. Sie räumte Radio und Fernseher aus ihrem Zimmer, schloss den Computer und das Handy weg. Verdunkelte das Fenster. Führte Selbstgespräche.
Wir brachten sie zu den besten Ärzten und begleiteten sie zu den renommiertesten Therapeuten. Sie bekam Tabletten, die sie schluckte, bis ihr ein Therapeut sagte, sie müsse sie nicht nehmen, wenn sie sie nicht nehmen wolle. Sie hörte auf, sie zu nehmen, und fing drei Wochen später an, im Hinterhof Nazis zu suchen, die sie abknallen wollte. Wir brachten sie zu einem anderen Therapeuten und verklagten den, der ihr die Tabletten ausgeredet hatte. Es gab schlechte Phasen, aber auch gute. Sie konnte weiterstudieren, und immer seltener hörte sie die Stimmen. Sie benutzte sogar einen Laptop und freundete sich wieder mit dem Internet an.
Früher hatte sie es so sehr geliebt, dieses Internet. Früher, das war vor Südamerika, und die Ärzte fragen immer wieder nach dieser Zeit, nach den ersten Anzeichen. Früher, da gab es nichts, was sie nicht fotografierte und sofort postete. Keinen Schritt machte sie, ohne die Welt darüber zu informieren, wo sie warum war, was sie aß und trank, warum sie lachte und wer mit ihr lachte. Ihr Instagram-Account hatte zu dieser Zeit fast zweitausend Follower. Dora war ein kleiner Star. Früher war sie laut, vorlaut, unser Bruder Bela nannte sie eine Rampensau. Hätte sie, wie er, eine musikalische Ader, sie wäre die geborene Operndiva. Er versteckte sich hinter seinem Kontrabass.
Sie machte die Cafés auf dem Ku’damm unsicher, am liebsten aber war sie in der Lang Bar im Waldorf Astoria. Dort hielt sie Hof für diejenigen unter ihren Bewunderern, die sich diesen Ort leisten konnten. Oder die alles tun würden, um ein Selfie mit ihr posten zu können. Sie scheute sich nicht, die Promis, die dort auftauchten, anzusprechen, um dann ihrerseits Selfies mit ihnen zu machen. Mit der Gedächtniskirche im Hintergrund oder mit dem Zoo Palast. Im Sommer saß sie auf der Dachterrasse und fotografierte sich mit ihrer Gefolgschaft, im Hintergrund die beleuchteten Baustellen rund um den Bahnhof Zoo. Sie liebte es dort.
Deshalb schläft sie häufig hier, unter der Eisenbahnbrücke, neben der Bäckerei. Wenn du dich umsiehst, wirst du hier kaum Frauen sehen. Die Frauen versuchen, nachts von der Straße wegzubleiben. Oder sie schauen nach Ecken, in denen sie nicht so leicht gefunden werden. Die meisten versuchen, irgendwo unterzukommen. Im Frauenhaus, im Obdachlosenheim, in Einrichtungen nur für Frauen. Manche gehen mit einem Mann nach Hause und bleiben bei ihm, solange sie ihn gerade noch ertragen können, sie lassen mit sich machen, was immer er will, damit sie ein Dach über dem Kopf haben. Bei den Frauen ist die Scham oft größer als bei den Männern. Die Scham, aber auch die Angst davor, auf der Straße zu schlafen. Weil sie öfter überfallen werden. Weil sie vergewaltigt werden. Ich habe mich erkundigt.
Dora empfindet keine Scham mehr. Sie hat nichts mehr, was sie schützen oder verstecken will. Manchmal hat sie in solchen Einrichtungen übernachtet, aber wenn wir sie gesucht haben, war sie meistens hier, und wenn uns die Bahnhofsmission ihretwegen kontaktiert hat, wurde uns meistens gesagt, dass man sie direkt um die Ecke gefunden hatte. Man kannte sie, man kannte uns. Einmal war sie mehrere Wochen verschwunden, und niemand hier konnte uns sagen, wo sie war oder wann man sie zuletzt gesehen hatte. Wir fragten in allen Geschäften und Absturzkneipen nach ihr, zeigten sogar Passanten ihr Bild. Wir telefonierten die Krankenhäuser und sämtliche Notunterkünfte ab. Wir fragten bei der Polizei nach. Schließlich standen wir erschöpft vor dem Zoo Palast, und Bela brach in Tränen aus. Ich sah ihm an, dass er glaubte, sie sei tot. Man hätte uns nicht verständigt, sagte er. Man hätte gar nicht gewusst, wer sie ist, vielleicht hatte man sie längst in einem anonymen Armengrab verscharrt. In der Glasscheibe spiegelte sich das hell erleuchtete Waldorf Astoria. Ich ließ Bela stehen und überquerte die Straße, ließ mich von aufgebrachten Autofahrern anhupen, schaffte es unversehrt auf die andere Seite und stürmte in die Lobby des Luxushotels. Ich fragte nach meiner Schwester. Zeigte Fotos. Sah in ratlose Gesichter. Sie ist hier Stammgast gewesen, oben in der Lang Bar, sagte ich. Man hatte sie längst vergessen.
Der Concierge fiel ein, dass hier vor ein paar Wochen eine Obdachlose vertrieben werden musste. Eine junge Frau, sagte sie, aber es war schwer zu erkennen, dass es eine junge Frau war, sie sah im ersten Moment so alt aus. Ich nickte ihr aufmunternd zu, bat sie, mir die ganze Geschichte zu erzählen. Diese Frau, erzählte die Concierge, war erst auf dem Bürgersteig vor dem Hotel auf- und abgegangen, hatte sich dann irgendwann neben dem Haupteingang auf den Boden gekauert. Natürlich wurde sie sofort weggescheucht, aber noch in derselben Nacht hatte ein Kollege sie in der Tiefgarage gefunden, wo sie sich zum Schlafen in einer Ecke niedergelassen hatte.
Niemand wusste, was dann mit ihr passiert war, nicht einmal das genaue Datum ließ sich rekonstruieren. Ich ging zurück zu meinem Bruder, der immer noch vor dem Zoo Palast stand und still weinte. Ich umarmte ihn und weinte ebenfalls. Ich wusste, dass sie niemals mit einem Mann mitgegangen wäre, nur um ein Dach über dem Kopf zu haben. Mir fiel nichts mehr ein, was wir noch tun konnten. Wir glaubten nun beide, dass sie tot war.
Ich war dabei, als sie zum letzten Mal in der Lang Bar Hof hielt. Ich hatte an dem Tag gar nicht vorgehabt auszugehen. Kurz vor meinem Zweiten Staatsexamen hatte ich Besseres zu tun, aber dann lud mich der Anwalt, bei dem ich mein Referendariat absolviert hatte, dorthin ein, und mit Blick auf meine zukünftige Karriere wollte ich nicht absagen. Ich hoffte, meine Schwester nicht anzutreffen, aber natürlich saß sie dort vergnügt inmitten ihrer Bewunderer, vor sich einen alkoholfreien Cocktail – tatsächlich trank sie damals so gut wie keinen Alkohol, weil er ihr nicht schmeckte –, und winkte mir aufgeregt zu. Ich begrüßte sie knapp, verwies auf meinen beruflichen Termin und setzte mich zu dem Anwalt. Eine gute Stunde später wollte sie aufbrechen, aber der Anwalt bat sie zu uns an den Tisch, was mir peinlich war, sich aber nicht abwenden ließ, zumal Dora fröhlich annahm. Wir sprachen über einen Fall, den ich als Referendar bearbeitet hatte, und tranken Tee, eine Leidenschaft des Anwalts. Er bot Dora eine Tasse an, die sie schulterzuckend annahm. Ich weiß noch, wie ich sie damit aufzog, dass sie nie Tee trank, nicht einmal Kaffee, aber dann verstand ich. Sie wollte erwachsener wirken, als sie war, die acht Jahre Altersunterschied zwischen uns irgendwie verringern. So tun, als fände sie es gar nicht spießig, einen Tee zu trinken, und gar nicht eklig, Kaffee zu probieren. Lächelnd warf sie die Haare zurück und beantwortete die Fragen des Anwalts nach ihren Leistungskursen und Prüfungsfächern und was sie später einmal vorhatte.
Ich merkte, wie sie mit einem Mal wortkarger wurde. Sie schien abgelenkt, starrte auf ihren Tee, sah sich nervös um, starrte dann wieder auf die Tasse vor sich. Wäre sie schüchtern, hätte ich mir nichts dabei gedacht, aber dieses Verhalten passte nicht zu meiner Schwester. Ich fragte sie, ob etwas nicht in Ordnung sei, sie murmelte nur, irgendetwas stimme nicht, stand dann auf und verließ grußlos die Bar, vergaß sogar ihre Handtasche.
Die jungen Mädchen in dem Alter, sagte der Anwalt nur und nahm unser Gespräch von davor wieder auf. Als ich nach Hause kam, in die große Wohnung unseres Vaters in der Uhlandstraße, wo ich aus Kostengründen immer noch wohnte, fand ich sie in ihrem Zimmer, wo sie auf dem Bett saß und ins Nichts starrte. Da war was im Tee, sagte sie. Ich fragte nach, und sie meinte, irgendetwas hätte sich auf der Oberfläche gebildet und sei mit dem Dampf aufgestiegen, sie hätte ihn einfach nicht trinken können. Ich wollte wissen, warum sie sich nicht einfach etwas anderes bestellt hatte, und sie sagte: Weil ich wegmusste. Es wollte mich dort nicht haben. Ich glaubte, mich verhört zu haben, bin mir bis heute nicht sicher, ob es wirklich das war, was sie gesagt hatte, oder ob ich es mir rückblickend nur einbilde. Aber nach diesem Tag veränderte sie sich zusehends. Sie wirkte still und nachdenklich, saß manchmal eine Ewigkeit regungslos da und schien zu grübeln, reagierte erst, wenn man sie schüttelte oder sehr laut ansprach. Sie wurde schlechter in der Schule und klagte über Konzentrationsschwierigkeiten und Schlafstörungen. Unser Vater brachte sie zum Arzt, der ihr Beruhigungsmittel aufschrieb und befand, es läge am bevorstehenden Abitur, er habe viele solcher Fälle.
Es gab bessere und schlechtere Tage. Niemand von uns kam auf die Idee, sie könne ernsthaft krank sein. Unser Vater glaubte, sie käme möglicherweise nun doch mehr nach ihm und wandle sich in den eher ernsthaften Typus. So wie du, Adrian, sagte er zu mir. Wie du und dein Bruder eben. Ich denke, er wollte es so sehen, weil sie ihn vorher zu sehr an unsere Mutter erinnert hatte, an unsere Mutter, als diese jung war.
Soweit ich weiß, betrat sie die Lang Bar nie wieder. Ihren Instagram-Bildern entnahm ich, dass sie sich nun öfter im Bikinihaus aufhielt, sie saß offenbar gern vor der großen Glasscheibe, durch die man direkt ins Affengehege sehen konnte. Sie postete seltener Selfies, ich las die Kommentare unter ihren Fotos, in denen sich nicht wenige ihrer Follower besorgt erkundigten, ob alles in Ordnung sei, irgendwas habe sich doch verändert, und was war mit der Lang Bar? In ihren Antworten schrieb sie etwas von Prüfungsstress, und das, ich gebe es zu, beruhigte mich.
Ein paar Wochen später rief mich Bela aus dem Krankenhaus an. Er habe sich das Handgelenk verbrüht, sagte er. Als ich ihn abholte und fragte, wie das passiert sei, sagte er: Dora. Ich habe mir in der Küche einen Tee gemacht, sie kam vorbei, blieb stehen, schaute auf die Tasse und schlug sie mir aus der Hand.
Kannst du spielen?, fragte ich ihn. Oder musst du dich schonen?
Man hatte ihm nahegelegt, ein paar Tage mit dem Kontrabassspielen auszusetzen. Er war nicht schlimm verletzt, und würde er etwas anderes als Musik studieren, wäre er vermutlich gar nicht erst mit dem Taxi zur Notaufnahme gerast. Aber Bela waren seine Finger heilig, und entsprechend schlecht gelaunt rauschte er, wieder zu Hause, an Doras Zimmer vorbei und knallte die Tür zu seinem eigenen Refugium mit Nachdruck zu.
Ich ging zu ihr und wollte wissen, was geschehen war. Sie weinte nicht. Ich wollte ihn nicht verletzen, sagte sie. Aber er durfte den Tee nicht trinken. Sie sah mich an, und ich bemerkte die Angst in ihren Augen. Adrian, was stimmt nicht mit mir?, fragte sie mich. Du bist gestresst, sagte ich. Da macht man komische Sachen.
Ich wusste nicht, dass sie wie in der Lang Bar in dem aufsteigenden Dampf etwas zu sehen geglaubt hatte. Etwas, vor dem sie sich fürchtete, das sie als Bedrohung empfand. Ich wusste es nicht, weil sie es weder mir noch sonst jemanden erzählte. Vielleicht hätte ich dringlicher nachfragen müssen. Vielleicht hatte ich selbst Angst vor dem, was sie mir über sich verraten würde.
Am nächsten Tag entschuldigte sie sich bei Bela. Dann verließ sie das Haus. Sie wollte in den Zoo. Den Tieren zuhören, sagte sie, das beruhigt mich.
Ja, sie schläft auch im Winter hier draußen. Bis man sie einsammelt und ins Warme bringt. Dort will sie aber nicht bleiben. Sie fürchtet sich vor den anderen und davor, dass man ihr etwas Heißes zu trinken gibt. Die meisten Mitarbeiter der Bahnhofsmission wissen darüber Bescheid. Aber die freiwilligen Helfer wechseln häufig. Sie hat schon einige Hände verbrüht. Einer Frau sogar das Gesicht. Die Winter in Berlin sind lang und grau, und sie können sehr kalt werden.
Dora schaffte es, zum Mathematikstudium zugelassen zu werden, und nach dem ersten Semester belohnte unser Vater sie mit einer Reise nach Südamerika. Die Reise, von der sie völlig verändert zurückkam. Sie glaubte, man gebe ihr Befehle, direkt in den Kopf hinein. Die Befehle kamen von amerikanischen Geheimdiensten. In ihrem Kopf war es dann 1945, und sie war eine Soldatin, die die Stadt befreien musste. Wir wissen nicht, wie sie den Rückflug durchgehalten hatte, aber als wir sie am Flughafen abholten, sprang sie gerade einer älteren Frau auf den Rücken und beschimpfte sie wild auf Englisch.
Diesen Vorfall hielten wir noch für die Nachwirkungen eines wilden Drogentrips, weil der Freund, mit dem sie verreist war, so etwas sagte. Ein paar Wochen später erst wussten wir mehr.
Mit den Medikamenten kam die Ruhe. Und für uns die Hoffnung. Es entwickelte sich alles recht gut. Ein paar Aussetzer, immer dann, wenn sie ihre Tabletten nicht genommen hatte – mal absichtlich, mal aus Vergesslichkeit. Wir sammelten sie irgendwo ein, um sie daran zu hindern, imaginierte Nazis zu jagen, und sorgten dafür, dass sie wieder ihre Medikamente bekam. Es lief nicht schlecht. Die Sache am Mathematik-Institut war ein schlimmer Rückfall, aber danach war wieder für einige Wochen Ruhe.
Bis eine Therapeutin versuchte, ihr einzureden, sie fühle sich schuldig am Tod unserer Mutter. Dora kam danach heulend nach Hause und wollte alles ganz genau wissen. Unser Vater hatte immer nur diffus von einem schweren Unfall mit Todesfolge gesprochen, Bela und ich wussten es besser. Nun hielt er es für richtig, ihr die Wahrheit zu sagen, über die er selbst nicht gern sprach. Er erzählte ihr von Mutters Selbstmord kurz nach Doras Geburt. Woher die Therapeutin davon wusste, ob sie überhaupt davon gewusst hatte, war uns nicht klar. Die Therapeutin weigerte sich, mit uns zu reden. Wir sorgten dafür, dass Dora einen anderen Therapieplatz bekam. Die Wahrheit über Mutters Tod beschäftigte sie aber noch lange, natürlich.
Eines Abends klopfte sie an meine Tür, trat ein, setzte sich aufs Sofa und sagte: Adrian, Bela und Dora. Was gibt es da noch, von dem ich nichts weiß? Ich berichtete so sachlich und unaufgeregt wie möglich von unserem Bruder Carl, der nur wenige Tage nach seiner Geburt gestorben war. Er hatte schwerste Missbildungen, unsere Mutter wollte die Schwangerschaft auf keinen Fall abbrechen, und nach seiner Geburt verfiel sie in eine tiefe Depression. Dass sie noch einmal schwanger werden wollte, war allein ihr Wunsch. Warum sie sich dann kurz nach der Geburt eines gesunden Mädchens umgebracht hatte, konnte von uns bis heute niemand verstehen. Sie hatte sich immer ein Mädchen gewünscht, wusste ich von unserem Vater.
Warum heiße ich nicht Carla?, fragte Dora, und ich konnte ihr diese Frage nicht beantworten. Ich war nicht einmal auf die Idee gekommen, sie mir zu stellen. Ich bat sie, mit unserem Vater darüber zu reden.
Sie verschwand noch am selben Tag und kehrte nie mehr in unsere Wohnung zurück.
Oft geht sie nun einfach an uns vorbei, aber manchmal erkennt sie uns. Denk nicht, dass sie uns dann begrüßt oder mit Namen anspricht. Sie registriert uns und reagiert auf unsere Stimmen. Sie lässt sich von uns mitnehmen, wenn wir sie ins Krankenhaus bringen oder versuchen, sie in einer der Unterkünfte abzuliefern, damit sie wenigstens für ein paar Stunden von der Straße ist. Sie lässt sich von uns mitnehmen, wenn wir sie dort abholen. Sie kommt aber niemals mit nach Hause.
Das mit den Stimmen scheint sich in letzter Zeit etwas gelegt zu haben. Dass sie glaubt, eine amerikanische Soldatin zu sein, die Nazis töten soll, kam jedenfalls schon gute zwei Monate nicht mehr vor. Dafür wurde uns erzählt, dass sie oft am Zoologischen Garten entlangläuft. Sie geht die Hardenbergstraße entlang, die Budapester Straße, bleibt stehen, lauscht. Sie hört zu, was die Tiere ihr erzählen, sagte uns eine Frau, die an der Zookasse arbeitet. Manchmal lasse ich sie rein. Das darf ich nicht, aber wenn sie nicht ganz so elend aussieht und einen guten Tag hat, drücke ich beide Augen zu. Sie tut ja keinem was.
Bela gab der Frau hundert Euro und bedankte sich bei ihr.
Einmal brachten wir sie bis vor unsere Haustür. Ab Bahnhof Zoo randalierte sie in Vaters Wagen, weil sie dort aussteigen wollte. Kaum hielten wir in der Uhlandstraße und öffneten ihr die mit Kindersicherung verriegelte Tür, sprang sie aus dem Auto und rannte zum Ku’damm zurück. Wir wussten, wo sie hinwollte, und ließen sie laufen.
Wenn du sie dort siehst, wirst du nicht glauben, dass sich Männer an ihr vergreifen. Du würdest denken, sie ist dreckig und stinkt, wer würde sie wollen? Du hast nicht verstanden, worum es diesen Männern geht. Sie wollen sie bestrafen. Dafür, dass sie ist, was sie ist. Für manche ist sie nur ein Stück Fleisch, das ihnen zufällig vor die Füße fällt. Wahrscheinlich hat sie längst alle Geschlechtskrankheiten, die man sich holen kann. Die Syphilis ist wieder zurück in Europa, habe ich gehört.
Wenn du sie siehst, wirst du nicht glauben, wie oft es passiert. Manchmal wird sie auch einfach nur verprügelt, und wenn ich sie hinterher sehe, wenn sie ihr in der Bahnhofsmission die Sachen vom Körper schneiden, dann frage ich mich, warum sie nicht längst den Lebensmut verloren hat. Ich habe vergessen, wie oft man ihr die Rippen gebrochen hat. Und die Finger. Zweimal das Schienbein, das weiß ich. Einmal hatte sie eine schwere Kopfverletzung. Keine der üblichen Platzwunden, es war schlimmer. Auch das hat sie überstanden. Ihre Nase war schon dreimal gebrochen, und einmal wurde ihr das linke Ohr wieder angenäht. Sie ist kein Einzelfall. Es liegt nicht an ihr. Es würde jeder anderen da draußen genauso gehen, sagen sie bei der Bahnhofsmission. Deshalb versuchen die meisten Frauen, nachts irgendwo unterzukommen. Die meisten, nur Dora nicht.
Als sie vorgestern Bela tötete, war sie am Nachmittag wieder im Zoo gewesen. Seitdem Bela der Frau an der Kasse die hundert Euro gegeben hatte, meldete sich diese jedes Mal, wenn Dora auftauchte. Ich glaubte nicht daran, dass sie es aus Fürsorge tat, aber Bela war immer beruhigt, und ich wusste, dass er Buch über Doras Zoobesuche führte, um der Frau bei nächster Gelegenheit wieder Geld zu geben. Eintrittsgeld, sagte er, zusammengerechnet und aufgerundet. Diese Frau steckt es sich selbst ein, sagte ich. Bela war es egal. Irgendwie beruhigte es sein Gewissen.
Es gab keinen Grund, an diesem Abend nach Dora zu suchen. Ich glaube auch nicht, dass Bela absichtlich an ihr vorbeiging, aber er war nun mal mit Orchesterkollegen unterwegs, man verabschiedete sich am Bahnhof Zoo, wo die meisten in Bahnen und Busse stiegen, um nach Hause zu fahren, und Bela ging zu Fuß. Vorgestern war es nicht ganz so kalt, und Bela machte nach Konzerten gern noch einen kleinen Spaziergang.
Er kam also an Dora vorbei, und vielleicht erkannte sie ihn ausgerechnet an diesem Abend. Es hätte alles gut gehen können, aber Bela trug einen Plastikbecher mit heißem Tee bei sich, er hatte ihn noch im Bahnhof gekauft und offenbar gerade den Deckel entfernt, um davon zu trinken; heißer Dampf stieg vor ihm auf. Wie man es sich erzählt, rannte Dora auf ihn zu und brüllte: Du wirst sterben! Dann schlug sie ihm den Tee aus der Hand, sprang ihn an, er fiel nach hinten, stürzte zu Boden, schlug mit dem Hinterkopf auf die Steinplatten. Dora hockte über ihm und schlug auf ihn ein, Du wirst sterben!, rief sie immer wieder, und so kam es auch. Die Kopfverletzung, die er sich beim Sturz zuzog, wäre nicht unbedingt tödlich gewesen, aber durch Doras Schütteln und Schlagen wurde sie es. Zu spät zog man sie von ihm herunter. Der Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Unsere Schwester war da längst verschwunden.
Wenn du sie also siehst, und ich meine, wenn du sie dir genau ansiehst, dann wirst du wissen, dass sie ihn nicht töten wollte. Sie wollte ihn retten. Ich weiß immer noch nicht, was sie in dem Dampf erkennt, oder ob es etwas ist, was sich auf der Oberfläche der heißen Flüssigkeit spiegelt. Ich glaube auch nicht, dass ich es erfahren muss. Wenn du sie also siehst, bevor die Frau von der Bahnhofsmission sie aufsammelt, hineinbringt, wäscht und anzieht, um dann die Polizei zu rufen, denk daran. Du darfst nicht brutal sein. So viele Männer waren schon brutal zu ihr. Sei sanft, lass es schnell geschehen.
Ich sehe was, was du nicht siehstVon Ulrich WoelkMoabit
Die Dinge, so viel ist sicher, wären anders gekommen, wenn Hauser nicht krank geworden wäre – eine akute Gallenblasengeschichte, wie es hieß. Deswegen fand die morgendliche Redaktionskonferenz ohne ihn statt, eine empfindliche Lücke, wie sich alsbald herausstellen sollte, weil Straftaten keine Rücksicht auf die Gallenprobleme von Journalisten nehmen – sie geschehen trotzdem. Und an jenem Morgen gab es ein Ereignis, über das eine Zeitung wie die unsere – zugegeben, nicht das hochkarätigste Blatt – nun einmal berichten musste.
Ich war während der Konferenz nicht sehr konzentriert, weil ich mich am Abend zuvor wieder einmal mit Irene um das Sorgerecht für Chloe, unsere Tochter, gestritten hatte. Die Angelegenheit war wie immer nervenaufreibend und unschön gewesen, aber ich musste den Tatsachen allmählich ins Auge blicken: Irene, daran konnte es mittlerweile keinen Zweifel mehr geben, wollte mir Chloe wegnehmen. Sie hatte entschieden, zu ihrem neuen Freund nach Frankfurt zu ziehen – mit Chloe selbstverständlich. Und alles, was mir von meiner Tochter danach noch bleiben würde, wären kurze abgezählte Wochenenden und ein paar magere Ferienzeiten.
Wie immer war Irene schließlich hysterisch geworden und hatte mich mit den üblichen Beschimpfungen bedacht, dass ich sowieso nie Zeit für unsere Tochter gehabt hätte und überhaupt unfähig sei, mich in die gedanklichen und emotionalen Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen einzufühlen. Und schließlich verstieg sie sich zu der absurden Behauptung, dass Chloe heilfroh sei, Abstand von mir zu gewinnen, und sich darauf freue, in Frankfurt mit ihr und ihrem neuen Lebensgefährten – einem langweiligen, aber bei den Frankfurter Bankern (oder eher wohl ihren Frauen) offenbar sehr angesagten Homöopathen oder Handaufleger oder Wunderheiler – von vorn anzufangen.
Es kann sein, dass ich deswegen aufhorchte, als Menning bei seiner morgendlichen Analyse der Nachrichtenlage und der Auflistung jener Themen des Tages, die in einer Zeitung wie der unseren nicht fehlen durften, von Janina anfing, einer Schülerin aus Moabit, die seit gestern vermisst wurde. Sie war – so viel war bisher bekannt – gestern mit dem Bus nach Hause gefahren, dort aber nie angekommen. Möglicherweise war sie in der Nähe der Bushaltestelle noch einmal gesehen worden, und vielleicht war sie sogar in einen unbekannten Wagen eingestiegen, referierte Menning, aber offenbar handelte es sich dabei um die üblichen unbestätigten Gerüchte und Mutmaßungen, die es in solchen Fällen ja immer gibt.
Es war jedenfalls klar, dass die Geschichte im Lokalteil oder möglicherweise sogar im Mantelbogen unserer Zeitung erscheinen musste, was es notwendig machte, dass sich jemand darum kümmerte, mit den Angehörigen sprach und sich mit der Pressestelle der Polizei in Verbindung setzte. Und da Hauser, dessen Domäne die Kriminalberichterstattung war, nun also mit Gallenproblemen im Krankenhaus lag, musste sich ein anderer der Sache annehmen, was angesichts der Tatsache, dass wir Journalisten notorisch überlastet und überarbeitet sind, durchaus nicht so leicht zu organisieren war. Doch noch bevor Menning die Geschichte irgendeinem halbwegs passenden Ressort – zum Beispiel »Vermischtes« oder »Aus den Bezirken« – aufs Auge drücken konnte, hob ich die Hand und erklärte, an dem Fall interessiert zu sein.
Menning antwortete nicht gleich. Zugegeben, mein Engagement war ungewöhnlich, da ich üblicherweise für den Kulturteil unserer Zeitung – von einem Feuilleton zu sprechen wäre wohl doch etwas übertrieben – schreibe, und das vornehmlich über Filme und Filmstars. Ich schätze, Menning nahm in diesem Moment an, dass ich mit meiner Meldung spontan die Gelegenheit ergriff, statt über ein fiktives Leinwandverbrechen endlich einmal über eine reale Gräueltat schreiben zu können – und nun ja, warum auch nicht? Vielleicht war da tatsächlich etwas in mir, das sich nach all den Cinemascopeabenteuern und Dolby-Surround-Katastrophen, die ich in den vergangenen zwei Jahrzehnten gesehen und beurteilt hatte, nach dem wirklichen Leben sehnte, den wirklichen Dramen. Menning war als Boulevardzeitungsmacher mit allen Wassern gewaschen, und vielleicht dachte er darüber nach, ob mein journalistischer Quereinsteigerzugang zur Janina-Geschichte dieser vielleicht eine interessante filmische Note hinzufügen konnte, die sie über die üblichen Verschwundene-Teenager-Storys hinausheben würde. Er blickte fragend in die Runde, und niemand widersprach.
Auf dem Weg nach Moabit ging mir mein Streit mit Irene wieder durch den Kopf. Eigentlich war ich dort gewesen – in meiner ehemaligen Wohnung, aus der ich vor einem knappen Jahr ausgezogen bin –, um mit Chloe ins Kino zu gehen wie jeden Dienstag. Aber dann nagelte mich Irene im Wohnungsflur fest, indem sie mir ihre Frankfurt-Umzugspläne verkündete – wobei es ihr unterbewusst (oder auch nicht) vermutlich genau darum ging: Chloes und meinen Kinodienstag zu ruinieren, was ihr auch gelang. Am Ende konnten Chloe und ich nur noch essen gehen, weil alle Filme, die uns interessiert hätten, schon angefangen hatten, aber so schlecht war das gar nicht. Es hat mir immer gefallen, mit Chloe bei einem Italiener oder Griechen zu sitzen und dabei zu erleben, wie sich der Charakter unserer Gespräche über die Jahre allmählich veränderte. Hatten diese sich früher um Chloes kindliche Vorstellungswelten gedreht, wurden sie nun immer häufiger zu ernsthaften Unterhaltungen über dieses und jenes, umso mehr Chloes gedanklicher Horizont über das, was sie unmittelbar betraf, hinauswuchs. Die Vorstellung, sie wäre plötzlich verschwunden und aus meinem Leben gerissen, war der ultimative Albtraum meiner Nächte, und deswegen hatte ich mich wohl für die Janina-Geschichte gemeldet. Es steckte derselbe psychologische Antrieb dahinter, der uns grausame Märchen lesen oder in einen Horrorfilm gehen lässt: der Wunsch, durch das virtuelle Erleben unserer schlimmsten Ängste und Fantasien, diesen irgendwie zu entkommen.
Janina wohnte in einem jener vier- oder fünfstöckigen Berliner Mietshäuser mit schmucklos grauer Fassade, wie man sie in den Fünfzigerjahren gebaut hat, um die vielen Baulücken aus dem Zweiten Weltkrieg zu schließen. Ich schlüpfte hinter einem Werbeausträger ins Haus, der – der übliche Trick – sämtliche Klingelknöpfe gedrückt und abgewartet hatte, bis irgendein Mieter öffnete. Das Treppenhaus war dunkel und erfüllt vom trockenen Geruch des staubigen alten Wandverputzes. Janina lebte im zweiten Stock zusammen mit ihrer Mutter und Großmutter, die in den frühen Neunzigerjahren als deutschstämmige Spätaussiedler aus irgendeiner fernen Provinz Russlands nach Berlin gekommen waren. Die Tür ihrer Wohnung stand offen, vielleicht in der Annahme, ich wäre es gewesen, der geklingelt hatte – wie üblich würde die Redaktion mein Kommen angekündigt haben –, vielleicht aber auch, um zu lüften, denn es roch stark nach irgendeinem gebratenen Frühstück.
Um auf mich aufmerksam zu machen, klopfte ich vorsichtig an den Rahmen der Wohnzimmertür, aber die Großmutter, die auf einem abgewetzten plüschigen Sofa saß und auf den Fernseher starrte, reagierte nicht. Sie war schwerhörig, wie ich später erfuhr, und konnte im Übrigen auch kaum Deutsch. Zudem waren beide, Mutter wie Großmutter, in einem, wie ich schnell feststellte, apathischen, wenn nicht paralysierten Zustand. Die alltäglichen Dinge – die Zubereitung des üppigen Frühstücks, das Öffnen der Tür – verrichteten sie zwar noch, aber mehr wie Automaten und ohne persönliche Anteilnahme oder Lebendigkeit. Die Szenerie war, um dieses etwas aus der Mode gekommene Filmgenre-Wort zu benutzen, das ich mir innerlich bereits für meinen Artikel vormerkte: gruselig.
Ich setzte mich in einen der billigen braunen Sessel und betrachtete die Großmutter, die mit leerem Blick durch mich hindurch auf den Fernseher starrte. Auf dem Bildschirm lief ein Videospiel – »Super Mario«, wie ich nur wusste, weil es in den Neunzigern einen Super-Mario-Film gegeben hatte, dessen Lächerlichkeit auch für einen wohlmeinenden Kritiker wie mich nicht leicht zu ertragen gewesen war –, und davor hockte ein acht- oder neunjähriges Mädchen, das die auf und ab hüpfende Mario-Figur durch eine Welt aus Ruinen und schwankenden Gewächsen steuerte, in der mal blinkende Schatztruhen auftauchten, mal glubschäugige Monster mit kleinen Klauen und großen, spitz bezahnten Mäulern, die sich gefräßig öffneten und schlossen. Eine Weile lang schaffte es das Mädchen, den Monstern geschickt auszuweichen und sich eine Schatztruhe nach der anderen zu sichern, doch dann tauchte hinter einem Farnbusch überraschend ein Monster auf und schnappte zu. Der Bildschirm fror ein, und zu einem simplen Sound-Jingle erschien darauf: »You lose a life. Game over«.
Die Mutter kam mit dem Frühstücksspeck herein, der neben dunklen Brotscheiben ölig auf zwei großen Tellern schwamm. Ich entschuldigte mich für mein Eindringen, die Tür habe offen gestanden, doch da ich die aktuelle Ausgabe unserer Zeitung auf dem Tisch liegen sah, fühlte ich mich einigermaßen willkommen.
»Vielleicht«, sagte ich, »ist Ihre Tochter ja nur bei einer Freundin oder einem Freund. Die meisten Vermisstenfälle klären sich innerhalb von achtundvierzig Stunden als harmlos auf.«
Janinas Mutter wandte sich in irgendeiner Sprache mit großer Lautstärke an die Großmutter – ich nahm an, dass sie meine Bemerkung übersetzte. Die Großmutter nickte stumm, ich hatte allerdings nicht den Eindruck, dass meine Überlegungen eine besonders tröstliche Wirkung auf sie ausübten. Eine Weile lang ließ ich die artifiziellen Geräusche und die simple Dauerschleifenmusik des Videospiels auf mich wirken und sagte nichts mehr. Ich war nicht als Psychologe hier, sondern als Journalist, als Beobachter der Tristesse des Wartens und Bangens. Das Mädchen, das aus der bedrückenden Realität in die Künstlichkeit der Super-Mario-Welt geflohen war, würde ich in meinem Artikel auf jeden Fall erwähnen. Das ist es, was die Leser unserer Zeitung erfahren wollen, die Geschichte der Menschen hinter der Schlagzeile – die Homestory, wie wir als Zeitungsmacher sagen.
»Dürfte ich mir einmal Janinas Zimmer ansehen?«, bat ich, die Mutter übersetzte, und die Großmutter nickte.