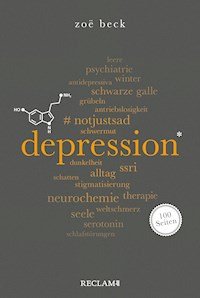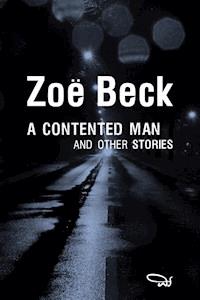10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Schottland-Reihe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Beim Joggen macht Caitlin eine grausige Entdeckung: Ein toter Mann liegt im Gebüsch vor ihr. Und er ist kein Unbekannter. Bei der Leiche handelt es sich um ihren Exmann, den sie gehofft hatte, nie wieder sehen zu müssen. Vor kurzem erst ist sie von London in die schottischen Highlands gezogen, um vor ihm und ihrer Vergangenheit zu fliehen. Doch wer hätte ein Motiv haben können, ihn zu töten – außer Caitlin selbst?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 344
Ähnliche
Titel
Zoë Beck
Der frühe Tod
Thriller
Suhrkamp
Der vorliegende Text ist eine durchgesehene Version des 2011 unter demselben Titel bei Bastei Lübbe, Köln, erschienenen Romans.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2022
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuchs 5197.
Erste Auflage 2022Neuausgabe© Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2022Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Umschlagabbildungen: Dakai Zhang/Getty Images (Edinburgh Clock Tower, Royal Mile); FinePic(c), München (Wolken, Rastertexture)
Umschlaggestaltung: zero-media.net, München
eISBN 978-3-518-76998-0
www.suhrkamp.de
Der frühe Tod
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Hinweise zum eBook
Cover
Titel
Impressum
Fünf Monate zuvor …
MONTAG
1
2
3
4
5
Drei Monate zuvor …
DIENSTAG
6
7
8
9
10
Einen Monat zuvor …
MITTWOCH
11
12
13
14
15
16
17
18
Drei Tage zuvor …
DONNERSTAG
19
20
21
22
Einen Tag zuvor …
23
24
25
26
27
Vergangenen Sonntag …
28
29
Eine Woche später …
Informationen zum Buch
Hinweise zum eBook
Fünf Monate zuvor …
»Einige werden sterben«, sagte sein Vater.
Er sah ihn an. In den letzten zehn Monaten war er schneller gealtert als in den zehn Jahren davor. »Dann sterben sie eben. Sie verpassen nichts mehr in ihrem Leben. Falls das jemand Leben nennen will.«
Sein Vater schüttelte den Kopf und trat ans Fenster. »Wann bist du nur so zynisch geworden?«
»Haben wir eine Wahl?« Er schob die Hände in die Hosentaschen. »Ich besorge sie dir, und dann kannst du weitermachen.«
Sein Vater ließ sich langsam nach vorne fallen, bis seine Stirn die Fensterscheibe berührte.
Der alte Mann wird senil, dachte er. Es wird Zeit, dass wir es hinter uns bringen. Hoffentlich hält er noch durch.
»Ich will damit aufhören«, sagte sein Vater leise. »Das kann so nicht weitergehen.«
»Seit wann hast du Skrupel?«
Der Alte drehte sich mit einem Ruck zu ihm um. »Ich weiß, dass es falsch ist, was ich mache. Ich will nicht …«
Er unterbrach ihn. »Du hast die Grenze schon längst überschritten. Es macht keinen Unterschied mehr, ob es drei oder dreizehn sind.«
»Oder mehr.«
»Oder mehr. Ich besorge dir neue. Überlass alles mir. Ich weiß, wer uns helfen wird. Alles, was wir brauchen, ist Geld.«
»Und Zeit.«
»Haben wir nicht. Wir haben Geld.«
Sein Vater drehte ihm den Rücken zu, ließ sich wieder langsam nach vorne fallen, bis seine Stirn die Glasscheibe berührte. Dann begann er, mit den Fingern sacht gegen das Glas zu trommeln.
»Ich werde sie töten …«
MONTAG
1
Caitlin ahnte die Leiche mehr, als sie zu sehen. Sie war noch am Anfang ihrer morgendlichen Laufrunde – um Punkt sieben Uhr zehn Meilen am Ufer von Loch Katrine entlang –, und sie konnte nicht sagen, was es war, das sie aus dem Takt brachte, sie stolpern und drei Schritte zurückgehen ließ. Ob es nur ein Gefühl war. Ob vielleicht die Luft vom Tod ein paar Grad kühler war. Sie stolperte, hielt inne, ging drei Schritte zurück und sah sich so lange um, bis sie ihn entdeckte. Eine innere Stimme warnte sie. Lauf weg!
Nur eine Hand ragte aus dem Ufergestrüpp hervor, der Ehering funkelte im noch schwachen Licht. Weiterlaufen!, rief ihr die Stimme zu, aber sie bog stattdessen die Zweige auseinander.
Lauf weg!
Sein rechtes Bein zeigte zum Wasser, der handgenähte schwarze Schuh berührte die Wasseroberfläche. Das linke Bein war angewinkelt, dieser Schuh fehlte. Beide Arme waren vom Körper abgespreizt, als hätte er sie hochgerissen. Vorsichtig stieß sie ihn mit der Spitze ihrer Laufschuhe am Rumpf an, um den letzten Zweifel auszuräumen.
Geh, bevor dich jemand sieht!
Sie blieb. Behutsam schob sie das Geäst weiter zur Seite und sah in sein Gesicht. Er lag auf dem Rücken, das Jackett aufgeknöpft, die Dior-Krawatte verrutscht, die Augen geöffnet, den Blick zur Seite gerichtet, weil sein Kopf nach links gedreht war.
Sein Mund stand offen, und Caitlin konnte die Zunge sehen. Ihre Augen wanderten zum Hals und zu den schmalen, dunkel verfärbten Striemen. Sie wollte sich hinabbeugen, schreckte aber zurück, als vor ihr etwas in die Luft stob.
Sie hatte Fliegen aufgescheucht, die ersten Besucher nach dem Tod. Sie hatten sich in seinem Haar versteckt, saßen auf seinem Blut. Caitlin sah sich um. Niemand. Sie sollte einfach weiterlaufen. Jemand anderes würde ihn finden. Es war noch früh, die Morgensonne warf lange Schatten, die Gipfel der Trossachs zeigten sich mit weichen Konturen im pudrigen Licht. Später würden Wanderer vorbeikommen. Sie könnten ihn finden.
Aber dann verwarf sie diesen Gedanken, nahm ihr Handy aus der Innentasche ihrer Trainingsjacke, rief die Polizei und anschließend im Büro an, um zu sagen, dass sie später kommen würde.
Zwanzig Minuten brauchten die Polizisten, und Caitlin nutzte die Zeit, um sich ihre Worte zurechtzulegen.
Als die Polizei eintraf, schenkte man ihr kaum Beachtung. Jemand legte ihr eine Decke um die Schultern und gab ihr süßen Tee, ein anderer notierte sich ihren Namen und ließ sie auf dem Parkplatz stehen, der jetzt zu einer Art Stützpunkt für das Team der Spurensicherer geworden war. Sie öffnete die Tür ihres Wagens und hockte sich auf den Fahrersitz, beobachtete das Treiben und klammerte sich an den Plastikbecher. Ein paar Uniformierte sperrten den Weg ab. Frauen und Männer in weißen Anzügen schleppten große Koffer zum See. Ein Wagen parkte, und ein großer dunkelhaariger Mann mit einer Arzttasche in der Hand stieg aus. Nach einer Weile kam er den Fußweg vom See wieder zurück, um wie sie mit geöffneter Fahrertür in seinem Auto zu warten. Er füllte Formulare aus, manchmal telefonierte er, manchmal warf er ihr einen ausdruckslosen Blick zu. Erst als ein Vauxhall neben ihr parkte und ein Endvierziger in Anzug und Krawatte ausstieg, änderte sich die Atmosphäre: Wichtig, dachte Caitlin. Wenn ich mit jemandem reden muss, dann mit dem. Sie stand auf und ging auf ihn zu, aber er sah an ihr vorbei.
Ein uniformierter Sergeant rief: »Detective Inspector Reese? Ich bin Sergeant Kerr. Wenn Sie mir folgen wollen …«
»Entschuldigung«, versuchte sie, sich bemerkbar zu machen, aber niemand kümmerte sich um sie. Die beiden Männer verließen den Parkplatz und folgten dem Fußweg. Caitlin starrte ihnen nach, als jemand zu ihr sagte: »Kann ich Ihnen helfen?«
Sie drehte sich um und sah dem Arzt auf die Brust. Er musste gute zwei Meter groß sein. Caitlin ging einen Schritt zurück, um ihm ins Gesicht schauen zu können, ohne sich den Hals zu verrenken.
»Ich hätte gern mit jemandem von der Polizei gesprochen«, erklärte sie.
»Hat man sich Ihre Personalien noch nicht notiert?«
»Darum geht es nicht.«
Er schwieg einen Moment, bevor er sagte: »Dr. Iain Balfour, ich bin der Polizeiarzt. Worum geht’s denn?«
Sie hob die Schultern. »Ich dachte, es spricht noch jemand mit mir.«
»Wenn man Ihre Personalien aufgenommen hat, wird man sich mit Ihnen in Verbindung setzen. Sie können jetzt nach Hause. Das wollten Sie doch wissen? Ob Sie fahren können?« Er lächelte aufmunternd. »Das war sicher ein Schock für Sie. Falls Sie sich nicht in der Lage fühlen, Auto zu fahren, frage ich gern nach, ob man Sie nach Hause bringen kann. Oder soll ich Ihre Angehörigen verständigen, damit man Sie abholt?«
Caitlin schüttelte den Kopf. »Ich dachte, es spricht jemand mit mir«, wiederholte sie. »Wegen des Toten. Es weiß doch niemand, wer er ist.«
»Das wird die Polizei schon herausfinden«, sagte Balfour und wollte noch etwas hinzufügen, hielt aber inne, als Caitlin sich von ihm wegdrehte und zurück zu ihrem Auto ging. Sie zögerte, überlegte, ob sie mit ihm reden sollte.
Balfour nahm ihr die Entscheidung ab. »Sie kennen den Mann.« Es war mehr Feststellung als Frage.
Sie nickte, ohne ihn anzusehen. Kämpfte zum ersten Mal mit Tränen. Schwieg.
»Soll ich den Inspector holen?«, fragte Balfour.
Caitlin setzte sich in ihren Wagen. »Sagen Sie ihm, er soll sich bei mir melden. Der Tote ist mein Exmann.« Schnell schlug sie die Autotür zu und startete den Motor. Sie fuhr mit durchdrehenden Reifen an, nur um den Arzt nicht sehen zu lassen, dass ihr Tränen über das Gesicht liefen, würgte den Motor ab, noch bevor sie zwanzig Meter gefahren war, und heulte los.
»Und das konnten Sie uns nicht gleich sagen?« Inspector Reese gab sich keine Mühe, rücksichtsvoll zu sein.
»Ich habe versucht, mit Ihnen zu reden, aber Sie haben mich nicht mal angesehen«, sagte Caitlin. »Und Ihr Sergeant hat mich keinen einzigen Satz zu Ende reden lassen, nachdem er meinen Namen und meine Adresse hatte.«
»Kerr!« Reese brüllte nach dem Sergeant, der sofort in sein Büro gerannt kam und seine Uniform stramm zog. »Ich weiß nicht, wie ihr das hier so handhabt, aber bei uns in Stirling lässt man Zeugen ausreden, egal, was sie vor lauter Wichtigtuerei schwafeln.«
Kerr nickte eifrig zu allem, was der Inspector vom Criminal Investigation Department sagte, und lief dunkelrot an.
»Gut. Der Tote heißt Thomas West. Ist Anderson Ihr Mädchenname?«
»Der meiner Großmutter.«
Er stutzte, entschied sich aber offenbar, seine Verwunderung vorerst zu ignorieren. »Adresse?«
»Gloucester Road in Kew. London.« Sie sah seinen goldenen Ehering.
»Wie lange sind Sie schon geschieden?« Reese wedelte Kerr mit der linken Hand aus dem Raum.
»Ein halbes Jahr.«
»Seit wann sind Sie in Schottland?«
»Einen Monat. Ich arbeite für die We-Help-Stiftung.«
»Der Gutmenschenverein, der sich um Straßenkinder kümmert?«
Caitlin nickte. »Auch um Straßenkinder. Sie sind kein großer Freund der Stiftung?«
Der Inspector zuckte nur mit den Schultern. »Schön, wenn man den Armen und Schwachen helfen will. Es wird nur nichts nützen«, sagte er gelangweilt.
»Wird es nicht? Und warum nicht?«, fragte Caitlin, um eine ruhige Stimme bemüht.
»Es zwingt sie ja keiner, Drogen zu nehmen und sich dumm zu saufen«, erklärte Reese. »Ich kenne die Kids. Das ist meine Kundschaft von morgen. Irgendwann bringen sie jemanden um, weil sie nicht wissen, wie sie sonst an Geld kommen sollen.«
»Wir kümmern uns gezielt um diese Kinder, damit sie eine Chance haben.«
»Super. Meinen Segen haben Sie. Aber seien Sie nicht enttäuscht, wenn Sie merken, dass Ihre Bemühungen umsonst sind. Wenn Sie die Kids nicht gleich nach der Geburt aus ihrem Elend rausholen, haben Sie schon verloren. Die werden wie ihre Eltern. Oder wie ihre Kumpels, die so geworden sind wie ihre Eltern.« Er dachte kurz nach. »Nein, stimmt nicht. Nicht nach der Geburt.«
»Sie geben den Kindern doch noch eine Chance, auch wenn sie schon älter als ein paar Wochen sind?«
»Ich gebe auch Neugeborenen keine Chance. Die kommen als Junkies auf die Welt, weil ihre Mütter während der Schwangerschaft weiter trinken und rauchen und koksen und Tabletten nehmen.«
»Sie sind vermutlich für Geburtenkontrolle bei Sozialhilfeempfängern«, vermutete Caitlin.
»Arbeiten Sie mal zwanzig Jahre mit denen. Wäre interessant, sich dann mit Ihnen zu unterhalten. Wenn Sie so alt sind wie ich. Falls Sie es so lange durchhalten.«
»Ist das unser Thema?«, fragte sie scharf.
Er lächelte gelangweilt. »Was genau machen Sie bei der Stiftung? Sie sehen nicht aus wie eine Sozialarbeiterin.«
»Wie genau sieht eine Sozialarbeiterin aus?«
Reese verdrehte die Augen. »Sie sind keine, okay? Also, was machen Sie da? Ich weiß, dass Sie im Büro sitzen.«
Caitlin hob die Augenbrauen. »Ach, und woher wissen Sie das?«
»Das ist mein Job.« Reese beugte sich vor. »Also?«
»PR«, gab Caitlin zu.
»Sehen Sie«, triumphierte Reese und lehnte sich wieder in seinem Stuhl zurück. »Sie wohnen zur Miete in Callander?«
Sie nickte.
»Wollen Sie umziehen? Näher zum Büro? Die Stiftung ist am Loch Lomond, richtig? Wie lange fahren Sie da jeden Morgen? Eine Stunde?«
»Nicht ganz«, antwortete Caitlin. »Warum fragen Sie das alles?«
Er schüttelte den Kopf. »Sie wohnen hier seit vier Wochen, und dann finden Sie eines Morgens die Leiche Ihres Londoner Exmanns. Da darf ich mir ein Bild von Ihnen machen. Warum war Mr West hier? Geschäftlich?«
Caitlin schüttelte den Kopf. »Er arbeitete für eine Bank in London.« Sie nannte ihm den Namen der Bank. »So etwas wie Geschäftsreisen hat er nie unternommen. Selbst wenn er jetzt eine gemacht hätte, kann ich mir nicht vorstellen, was er am Loch Katrine zu suchen hatte.«
»Vielleicht Sie?«
Auf diese Frage war sie vorbereitet. »Sicher nicht. Thomas wusste nicht, wo ich war, und ich habe dafür gesorgt, dass er keine Möglichkeit hatte, mich ausfindig zu machen. Hätte er mich wider Erwarten doch gefunden, hätte er sich bei mir gemeldet, denken Sie nicht?«
»Hat er?«
»Natürlich nicht«, sagte sie ungeduldig.
Er sah sie mit einem Blick an, als sei er von ihren Lügen angeödet. »Hatte er Freunde oder Bekannte hier in der Nähe?«
»Nein.«
»Hatte er Feinde?«
»Vermutlich. Aber ich könnte Ihnen keine Namen nennen.«
Kerr kam mit einem Stapel ausgedruckter Seiten zurück. Er gab Reese ein Zeichen, dass er ihn unter vier Augen sprechen wollte. Caitlin wartete, um Ruhe bemüht. Kerr hatte mit Sicherheit in London angerufen und sich alles über sie und ihren Exmann schicken lassen. Sie würden Bescheid wissen, und Caitlin war selbst schuld daran, weil sie nicht einfach weitergelaufen war. Weil sie die Polizei gerufen hatte. Sie hatte keine Ahnung, wie sie dem begegnen sollte, was in Gestalt von Reese, der den Papierstapel schwenkte, auf sie zukam.
»Ms Anderson, Caitlin. So wollen Sie seit sechs Monaten genannt werden.«
»So heiße ich seit meiner Scheidung.«
»Ich denke, wir wissen beide, worüber wir als Nächstes reden werden.« Er setzte sich wieder auf seinen Stuhl und legte die Unterlagen vor sich auf den Tisch, ohne den Blick von ihr zu nehmen.
Caitlin beschloss die Flucht nach vorne. »Darüber, dass ich das stärkste Motiv hatte, meinen Exmann umzubringen.«
»Ms Anderson, wo waren Sie gestern zwischen zehn Uhr abends und zwei Uhr morgens?«
»Ich habe kein Alibi, wenn Sie das meinen.«
»Das meinte ich.«
»Gut. Und jetzt? Nehmen Sie mich fest?«
2
Das Fax, das am Sonntag gekommen war, ging Ben im Grunde nichts an. Er war nur zufällig in der Redaktion gewesen, als es kam, weil er den Dienst für einen Kollegen übernommen hatte. Eigentlich war Ben Edwards Gerichtsreporter, aber das sollte sich ändern. Fand er. Deshalb sprang er bei jeder Gelegenheit für Kollegen ein, um zu beweisen, dass er mehr konnte. Und dieses Fax verhieß eine Geschichte, wie sie sein sollte: groß, schmutzig, heikel. Mit dem heiklen Teil allerdings hatte er so seine Probleme.
Ben nahm sein Handy, verließ die Redaktionsräume des Scottish Independent und ging vor die Tür, um in Ruhe zu telefonieren. Er wählte die Durchwahl, die er sich notiert hatte, bekam aber immer nur den Anrufbeantworter dran und versuchte es über die Zentrale. Er hörte dem Besetztzeichen eine Weile zu, ließ dabei den Blick über das gegenüberliegende Gebäude des Scottish Parliament wandern, ohne wirklich aufzunehmen, was er dort sah, bis ihn die quietschenden Reifen eines Taxis in die Realität zurückholten: Fast hätte ein Pulk japanischer Touristen dran glauben müssen. Wieder wählte er, hörte eine Stimme, fragte nach Caitlin Anderson und wurde an den persönlichen Assistenten des Stiftungsleiters verwiesen.
»Termine außer Haus«, seufzte Lenny McGarrigle am anderen Ende, als man Ben schließlich zu ihm durchgestellt hatte. »Kann ich Ihnen helfen?«
Ben präsentierte ihm seine Ausrede, er wolle ein Feature über die Stiftung schreiben, und der persönliche Assistent versprach ihm einen Rückruf von Ms Anderson.
Immer noch keinen Schritt weiter, dachte Ben. Gestern hatte ihn schon die Projektleiterin in Edinburgh, eine Dr. Angela Keane, an die Pressesprecherin verwiesen.
Ben nahm sich das Fax noch einmal vor:
Es wird Sie interessieren, dass das We-Help-Projekt bereits gescheitert ist, bevor es richtig angefangen hat: Drei Kinder sind in Edinburgh gestorben, und dabei wird es nicht bleiben.
Anonym gesendet von einer Nummer in Edinburgh. Die Nummer gehörte zu einem Internetcafé am Grassmarket. Dort rief er als Nächstes an. Die Mitarbeiterin, die zu der Zeit Dienst hatte, als das Fax gesendet wurde, war jetzt wieder im Laden.
»Keine Ahnung, wir hatten eine deutsche Reisegruppe hier … Schüler auf Klassenfahrt. Alle Rechner waren besetzt. Und dann sind auch noch Franz Ferdinand vorbeigekommen.«
Die Band war aus ihrem Tourbus gestiegen, um in einem Hotel in der Victoria Street einzuchecken. Das hatte so ziemlich alle in Aufregung versetzt, wer hätte da noch aufs Faxgerät geachtet. Alle hatten sie an der Fensterscheibe geklebt oder waren rausgerannt, um sich Autogramme geben zu lassen. Ausnahmezustand. Glück für den anonymen Absender. Ben bedankte sich bei dem Mädchen und beendete enttäuscht das Gespräch.
Seit gestern versuchte er, etwas über ungeklärte Todesfälle von Jugendlichen herauszufinden, die in Zusammenhang mit der Stiftung standen, aber auch da hatte er bislang keinen Erfolg gehabt. Was nichts heißen musste. Für solche Fälle waren investigative Journalisten zuständig: Zusammenhänge ans Licht holen, statt nur die Informationen wiederzugeben, die ohnehin für jeden zugänglich waren. Das eine war echter Journalismus. Das andere Berichterstattung. Ben wollte den Schritt zum echten Journalismus schaffen. Ob es bei dieser Sache etwas ans Licht zu holen gab oder diese Dinge besser im Dunkeln blieben, das galt es herauszufinden.
»Du willst mit dem Herausgeber sprechen?« Der Chef vom Dienst glotzte ihn ungläubig an. »Was sind das für Methoden? Du kannst mit mir reden, mit dem Redaktionsleiter, aber warum muss es der Herausgeber sein? Haben wir dich schlecht behandelt? Bist du von der Praktikantin sexuell belästigt worden? Hast du schlecht geschlafen?«
»Mach nicht so ’nen Wind«, murmelte Ben. »Es geht um eine Geschichte.«
»Ja. Klar. Am besten lassen wir ab jetzt auch noch die Partnerschaftsanzeigen von ihm absegnen.«
Okay, es hatte schon bessere Montage gegeben, aber Ben ließ sich nicht abwimmeln. »Die Geschichte betrifft ihn persönlich.«
Der Chef vom Dienst sah ihn mit zusammengekniffenen Augen an. »Wie? Persönlich? Steht er vor Gericht, oder was?«
»Nein, ich meine persönlich persönlich.«
»Persönlich persönlich?«, wiederholte der andere zunehmend gereizter.
»Hey, Mann, ehrlich, ich will keinen Stress machen, ich will nur mit ihm reden. Um ganz sicher zu sein.«
So ging es noch ein paar Minuten hin und her. Der Chef vom Dienst wollte wissen, um was genau es sich handelte, Ben verriet es ihm nicht, dann wurden sie beide laut, und schließlich verließ Ben türenschlagend das Büro, die Privatnummer des Herausgebers auf einem abgerissenen Zettel in der Hosentasche. Wieder ging er zum Telefonieren vor die Tür, und zehn Minuten später saß er im Auto auf dem Weg nach Merchiston, wo Cedric Darney, Herausgeber des Scottish Independent, vor einem Dreivierteljahr eine Villa bezogen hatte. Seinem Vater hatte ein schlossähnliches Anwesen irgendwo in Fife gehört, bis er unter – wie es hieß – mysteriösen Umständen verschwunden war und sein Sohn kommissarisch seinen Platz einnehmen musste. Mysteriöse Umstände wohl kaum, dachte Ben. Bis zum Hals und tiefer hatte Darney senior in Geschäften mit der organisierten Kriminalität gesteckt.
Und Cedric Darney, damals noch Student in St. Andrews, hatte als Allererstes eine Titelstory daraus gemacht.
Man bekam ihn kaum zu Gesicht, er überließ die Geschäfte denen, die – wie man ihn zitierte – mehr davon verstanden als er selbst. Außerdem wurden ihm gewisse Eigenarten nachgesagt, aber die Gerüchte blieben vage. Vielleicht, weil man es nicht genau wusste, vielleicht, weil nichts dran war.
Ben klingelte an der Tür der edwardianischen Villa, und Cedric Darney selbst öffnete ihm. Ben hatte Personal erwartet. Den Herausgeber des Scottish Independent kannte er von Bildern. Auch im echten Leben wirkte er zerbrechlich und angreifbar. Die zehn Jahre, die er jünger war als Ben, waren nicht zu übersehen, und einzig seine aufrechte, fast strenge Haltung verlieh ihm eine natürliche Autorität. Darney war genau die Sorte schwindsüchtiger, dekadenter Aristokratensohn, die man aus viktorianischen Romanen kannte. Wenn man ihn sah, wusste man, warum das blaue Blut regelmäßig eine bürgerliche Frischzellenkur brauchte. Er musste an Dorian Gray denken und konnte sich gut vorstellen, dass Cedric Darney auf dem Speicher ein Bild von sich hatte, das für ihn alterte. Vielleicht, weil er so perfekte Gesichtszüge hatte, als sei er selbst ein Gemälde. Ben konnte aber nicht behaupten, dass der junge Mann ihm unsympathisch war. Im Gegenteil.
Cedric Darney ging durch die Halle voran und öffnete eine der hinteren Türen. Der Raum war im Bauhausstil eingerichtet, und die Möbel standen irritierend geometrisch. Nirgendwo Unordnung, nirgendwo Dreck oder auch nur ein Körnchen Staub. Also doch Personal, dachte Ben zufrieden.
Er wartete, bis Darney ihn bat, sich zu setzen, und hatte den Eindruck, dass der seinen Platz strategisch an ihm ausrichten wollte. Steckte eine bestimmte Psychologie dahinter? Irgendein Trick, den Ben nicht kannte?
»Sie sind auf eine Geschichte gestoßen, die Sie mit mir besprechen wollen«, sagte Cedric Darney ohne Umschweife. »Handelt es sich dabei um meinen Vater?«
»Nein, Mr Darney«, antwortete Ben.
»Cedric.«
Ben bemerkte, dass seine Hände ineinander verflochten waren und er zusammengekauert dasaß. Schnell änderte er seine Sitzposition, um nicht mehr ganz so angestrengt zu wirken. »Es geht um We Help. Das sagt Ihnen sicher etwas?«
Cedric sah ihn abwartend an.
»Ich – oder vielmehr die Redaktion – habe ein anonymes Schreiben erhalten, dass bei der Stiftung nicht alles mit rechten Dingen zugehen würde.«
»Inwiefern?«
»Es habe Todesfälle gegeben. Kinder, die am Programm der Stiftung teilgenommen hatten, seien gestorben. Drei. Ich habe versucht, mehr darüber zu erfahren, bin aber bisher noch nicht sehr weit gekommen.«
»Haben Sie die Polizei verständigt?«
Ben starrte Cedric einige Sekunden an: »Warum hätte ich das tun sollen?«
»Wer außer Ihnen hat dieses Schreiben noch gesehen?«
»Außer mir? Niemand. Ich war gestern in der Redaktion und stand direkt neben dem Faxgerät, als es kam.«
»Kann ich es sehen?«
Ben zog es aus dem Rucksack, den er immer mit sich herumtrug, und hielt es Cedric hin.
»Legen Sie es auf den Tisch«, sagte Cedric, beugte sich vor und las die knappen Zeilen durch, ohne das Papier anzufassen. »Das ist nicht viel«, murmelte er.
»Aber wenn was dran ist …«, begann Ben.
»Wissen wir, ob andere Zeitungen ebenfalls informiert wurden?«, fragte Cedric.
Ben schüttelte den Kopf.
»Ich habe mich umgehört. Es scheint nur bei uns eingegangen zu sein. Wer es abgeschickt hat, konnte ich noch nicht rausfinden.«
»Haben Sie schon mit jemandem von der Stiftung gesprochen?«
»Gestern konnte ich kurz mit der Leiterin des Edinburgh-Projekts reden. Die Pressesprecherin habe ich auf Rückruf. Aber ich dachte, vielleicht ist es besser, erst mit Ihnen zu reden, bevor …« Er ließ den Satz in der Luft hängen und wartete auf Cedrics Antwort. Wartete und dachte: Verdammt, was mach ich hier eigentlich?
Endlich sagte Cedric: »Reden Sie mit den Leuten. Warum auch nicht? Bestimmt ist an dieser Geschichte gar nichts dran, und irgendjemand will sich wichtigmachen.«
»Und wenn doch?«
»Dann wäre es gut, wenn Sie darüber schreiben. Oder dachten Sie, ich hätte etwas dagegen?«, hakte Cedric nach.
Ben entschied sich für die Wahrheit. »Ihnen gehört der Laden.«
Cedric schüttelte den Kopf. »Der Laden, wie Sie es nennen, gehört mir nicht. Streng genommen gehört mir gar nichts, sondern meinem Vater. We Help ist eine Tochtergesellschaft von Duncan Livingston Pharmaceutics, einer Aktiengesellschaft, an der wiederum mein Vater beteiligt ist. Das meinten Sie, nehme ich an?«
Ben nickte. »Wenn die Stiftung Negativschlagzeilen macht, gehen die DLP-Aktien runter. Jeder weiß, wie das zusammenhängt. Man kann ja in keine Apotheke gehen, ohne dass man mit Werbebotschaften von DLP belästigt wird: Für jedes gekaufte Medikament aus dem Hause DLP gehen zwanzig Pence direkt an die Stiftung, und die hilft vor Ort in Schottland.«
»Und Sie dachten: Lieber einen Skandal vertuschen als das Darney-Vermögen gefährden?«
»Ich dachte: Lieber rechtzeitig Bescheid geben, bevor die Aktien fallen.«
Cedric lächelte. »Das ist fast rührend, wäre es nicht auf eine gewisse Art unverschämt. Ich bin mir sehr wohl bewusst, was für einen Ruf mein Vater hat. Aber dieser Ruf hat bisher niemanden daran gehindert, sein Geld zu nehmen. Einzig mit seinem Namen will man sich nicht mehr schmücken. Nein, Ben, wenn an dem Ganzen etwas dran ist, sollten wir es so schnell wie möglich herausfinden.«
Es war nicht die Antwort, mit der Ben gerechnet hatte. Aber hätte er nicht genau damit rechnen müssen bei dem Mann, der die Verbrechen seines eigenen Vaters auf die Titelseite gebracht hatte? Trotzdem regte sich Misstrauen in ihm. Er ließ es sich nicht anmerken.
»Gut.« Ben stand auf. »Ich sehe mir die Sache näher an. Sobald ich mehr weiß … informiere ich Sie?«
»Sehr gern.«
»Und … dann?«
»Dann werden Sie darüber berichten. Das ist doch Ihre Aufgabe, oder nicht?«
»Eigentlich bin ich Gerichtsreporter.«
»Eigentlich.«
»Na ja. Ja.«
»Dann rufe ich Ihren Chef an und sage ihm, er soll Sie bis auf Weiteres freistellen, weil Sie für mich an einer Geschichte arbeiten.« Er lächelte und führte Ben zur Haustür.
Cedric forderte ihn auf, an dem Ast zu sägen, auf dem er saß. Oder saß Ben auf dem Ast und wusste es nur nicht? Er verließ die Villa mit einem Gefühl der Benommenheit, und als er wieder in seinem Auto saß, kam er sich vor, als bewege er sich auf dünnem Eis.
3
Caitlin ließ die Polizisten in ihrem Haus allein. Sie wusste, sie würden nichts finden, solange sie nicht ihren Laptop untersuchten. Sie rechnete damit, dass sie sich lange genug mit der Hausdurchsuchung aufhalten würden, und diese Zeit würde sie nutzen, um die letzten Spuren ihres Exmanns zu verwischen.
Nachdem man ihr Auto untersucht und freigegeben hatte, fuhr sie zur Arbeit. Sie gratulierte sich selbst, dass sie den Laptop übers Wochenende im Büro gelassen und nicht wie sonst mitgenommen hatte.
Es war eine Fahrt von einer Dreiviertelstunde. Sie führte über die schmalen, sich windenden Straßen in südwestlicher Richtung zum Südzipfel des Loch Lomond. Das Gebäude, in dem die Stiftung untergebracht war, lag nicht weit von Balloch Castle entfernt. Es war unscheinbar genug, um das Desinteresse der Touristen zu garantieren. Darin zu arbeiten war deutlich attraktiver: Aus Caitlins Büro sah man über den See. Viele Touristen würden für diese Aussicht bedenkenlos Eintritt zahlen. Caitlin nahm sie heute nicht mal wahr. Sie stürmte zu ihrem Schreibtisch, fuhr den Laptop hoch und trommelte ungeduldig mit den Fingern auf der Tischplatte herum.
»Ich habe allen gesagt, du seist krank«, murrte Lenny, der persönliche Assistent des Stiftungsleiters, ohne von dem Modemagazin aufzusehen, das er durchblätterte. Sie teilten sich das Büro. Caitlin konnte sich nicht erinnern, wann sie sich jemals auf Anhieb so gut mit jemandem verstanden hatte, und sie glaubte zu wissen, dass es Lenny ähnlich ging.
»Spontane Wunderheilung«, gab sie zurück und suchte die Mail, die sie so dringend löschen musste. »Ich hab doch angerufen und gesagt, dass ich später komme.«
»Aber nicht, warum. Und ich weiß, dass ich recht habe, wenn ich sage: Es lag nicht an einem Mann.«
»Falsch. Es lag an einem Mann.« Sie schob die Nachricht in den Papierkorb.
»Unmöglich. Du siehst so ungefickt aus wie eh und je.«
»Sagt der Richtige. Du hattest am Wochenende wohl kein Glück, oder warum weinst du beim Anblick von Unterhosenmodels?« Sie löschte den Inhalt des Papierkorbs. Die Warnung, dass damit alle darin befindlichen Mails unwiderruflich verloren seien, nahm sie dankbar zur Kenntnis.
»Vielleicht, weil ich ihn kenne.« Lenny hielt ihr die Seite hin, die er gerade aufgeschlagen hatte: ein durchtrainiertes Männermodel, noch keine zwanzig, schielte den Betrachter in James-Dean-Manier an.
Caitlin schüttelte den Kopf. »Wo findest du diese Typen? Für mich sehen sie alle gleich aus. Oder ist das derselbe wie letzte Woche?«
»Nein, der ist neu. Der von letzter Woche hat es nicht mal in die Zahnpastawerbung geschafft.« Lenny verdrehte die Augen und schlug die Zeitschrift zu. »Baby, jemand hat sich große Mühe gegeben, nach dir zu suchen.«
Bitte nicht das Pflegeheim, dachte sie. Ihre Mutter war seit Jahren ein Pflegefall, obwohl sie noch keine fünfzig war. Sie lag kaum ansprechbar und fern jeder Realität in einem Londoner Heim. Es gab immer wieder Wochen, in denen es aussah, als ginge es mit ihr zu Ende. Dann erholte sie sich wieder. Caitlin hatte schon längere Zeit keinen Anruf mehr vom Pflegeheim bekommen. Eine Nachricht war überfällig. Dann fiel ihr ein, dass sie bei den Schwestern nur ihre neue Handynummer hinterlassen hatte.
»Wer war’s?«, fragte sie und versuchte, unverkrampft zu klingen.
»Ein Mann. Vielleicht der vom Wochenende?«
Unwillkürlich zuckte sie zusammen und griff nach der Schreibtischkante. »Wer?«
Lenny reichte ihr einen Zettel. »Ben Edwards vom Scottish Independent. Will ein Feature über die Stiftung machen und tat sehr wichtig. Vier Mal hat er angerufen. Und weil mir langweilig war, hab ich für dich nachgesehen: Der Süße ist eigentlich Gerichtsreporter. Will sich wohl mit was Neuem profilieren. Du weißt Bescheid?«
»Danke, ich kenne die Sorte«, log sie und nahm den Zettel mit der Telefonnummer. »Wieso hattest du Langeweile?«
»Der gute Dan hatte den ganzen Tag Meetings, Meetings, Meetings, und jemand musste auf das Telefon aufpassen, ohne zu stören, also durfte ich hier kuschelig im Warmen bleiben. Es ging sowieso nur darum, dass sich die einzelnen Projektleiter kennenlernen.«
Lenny sprach von den Kinderhilfsprojekten der Stiftung, die jetzt anliefen. Begonnen hatten sie in Stirling, dann war ein größeres in Edinburgh hinzugekommen, Aberdeen und Dundee waren in Planung, und ganze drei Projekte standen für Glasgow an. Die Stiftung finanzierte sich teils aus direkten Spenden, teils durch den Pharmakonzern Duncan Livingston Pharmaceutics, kurz DLP
4
»Morgen Abend passt mir sehr gut«, bestätigte Ben. »Ich freu mich auf Sie und Dr. Keane.« Er konnte sich noch kein Bild von Caitlin Anderson machen. Ihre Stimme verriet nicht viel: Engländerin, Mittelschicht, jung, aufgeregt. Im Internet hatte er nichts über sie gefunden, aber über Dr. Keane hatte er Informationen gesammelt, und die offiziellen Daten über das We-Help-Projekt in Edinburgh konnte er auswendig. Zwei Stunden und ein Dutzend Telefonate später hatte er eine Mail mit sämtlichen Edinburgher Todesfällen der vergangenen drei Monate.
Ben sortierte die Namen derer aus, die über achtzehn waren. Dann ging er nach Postleitzahl vor. Das Büro der Stiftung und das dazugehörige Jugendzentrum waren in einem Gebäude in der Niddrie Mains Road untergebracht. Also waren Niddrie, Greendykes und Craigmillar interessant. In den letzten drei Monaten waren dort elf Kinder und Jugendliche gestorben. Ben hatte keine Ahnung, ob das viel oder wenig war. Er tippte auf viel. In mühevoller Kleinarbeit machte er sich daran herauszufinden, welche Todesfälle auch in den Polizeiberichten auftauchten: Ein sechzehnjähriger Junge war das Opfer einer Messerstecherei. Blieben noch zehn. Zwei Mädchen starben bei einem Autounfall auf dem Weg nach Glasgow.
Acht.
Davon waren drei Säuglinge, von denen der jüngste offenbar direkt nach der Geburt, der älteste nach acht Monaten gestorben war. Vielleicht Frühchen. Vielleicht Missbildungen. Vielleicht Infektionen.
Fünf.
Sie waren zwischen acht und fünfzehn, alle männlich: Der Achtjährige hatte sich an Glasscherben geschnitten und war verblutet, bevor ihn jemand fand. Der Neunjährige war aus dem Fenster seines Kinderzimmers im zehnten Stock gefallen. Der Zehnjährige war im Firth of Forth ertrunken. Der Zwölfjährige hatte mit der Waffe seines Vaters herumgespielt und im falschen Moment abgedrückt. Der Fünfzehnjährige war vom Dach des Wauchope House gestürzt – eine Mutprobe. Ben notierte sich jeweils Name, Alter und Todesart. Dann schaltete er den Computer aus.
Beim Rausgehen fiel sein Blick auf die halb geöffnete Tür zum Büro des Personalchefs. Er klopfte an den Türrahmen.
»Ben, wann hab ich dich zuletzt gesehen«, murmelte Gregg ohne Begeisterung. Was nicht an Ben lag. Gregg klang nie begeistert, selbst wenn er sich Mühe gab.
»Kannst du was für mich rausfinden? Ich treffe mich morgen mit der Pressesprecherin von dieser Stiftung, die sich um Schottlands verarmten Nachwuchs kümmert.«
»We Help? Meine Frau kauft jetzt immer die Pillen von DLP. Halsabschneider, wenn du mich fragst. Es kann mir keiner erzählen, dass die wirklich die Kohle an die Stiftung abgeben. Alles Betrug.«
»Möglich. Mich würde interessieren, ob du diese Pressesprecherin kennst? Ihr Name ist Caitlin Anderson. Sie kommt aus London. Du hast bestimmt eine Ahnung, wo man da nachschauen kann?«
Gregg legte die Stirn in Falten. »Anderson, Caitlin … Warte mal …« Er tippte auf seiner Tastatur herum, murmelte etwas vor sich hin und sagte endlich: »Hier ist sie. Hat sich kürzlich bei uns beworben. Ich darf dir das eigentlich gar nicht zeigen.« Gregg drehte den Bildschirm so, dass Ben freien Blick auf die Bewerbung von Caitlin Anderson erhielt. »Nettes Foto«, brummte er. »Deshalb interessierst du dich für sie, was?«
Ben zuckte die Schultern. »Ja, nett«, murmelte er abwesend. Ihn interessierte ihr Lebenslauf. Er versuchte, sich so schnell wie möglich so viele Fakten wie möglich daraus einzuprägen, bevor der launische Gregg den Bildschirm wieder wegdrehen und anfangen würde, etwas von Datenschutz zu faseln.
Gregg gab ihm noch zehn Sekunden, dann klickte er die Datei wieder weg. »Genug für heute, das war schon mehr als ein einfacher Gefallen. Bist mir was schuldig.«
Ben kannte diese Leier. »Du kriegst morgen eine Flasche Wein, ich versprech’s. Und falls ich morgen nicht da bin, übermorgen. Okay?«
»Aber kein billiges Zeug. Was Gutes. Ich will die Verpackung sehen, wo du ihn gekauft hast, und wenn nicht Harvey Nichols Foodmarket draufsteht, kannst du ihn gleich wieder mitnehmen.«
»Du spinnst.«
»Nein, ich will nur, dass du blutest.«
Ben hörte Gregg noch lachen, als er schon fast das Treppenhaus erreicht hatte.
Er fuhr in seine kleine Wohnung in Duddingston, südöstlich des Holyrood Parks. Ben hatte die Zwei-Zimmer-Wohnung bezogen, als er den Job beim Scottish Independent bekommen hatte. Seit drei Jahren wohnte er jetzt in Edinburgh, und er hatte nicht das Gefühl, die Stadt wirklich zu kennen. Sie überraschte ihn immer wieder. Aufgewachsen war er im Nordosten Englands. Das hatte es ihm in Schottland leichter gemacht. Dadurch galt er nicht als Engländer. Er wechselte bei Bedarf in den Akzent der Minenarbeiter des County Durham, was ihm die Sympathien der einfachen Leute sicherte. Die meisten erinnerten sich noch gut an die 80er Jahre, als dort alle ihre Arbeit verloren hatten. So wie Bens Vater und seine beiden Großväter und der älteste seiner drei Brüder. Ben war der Einzige, der das Abitur geschafft hatte. Mit einem Stipendium war er an die Universität in Newcastle gegangen. Und als Einziger hatte er heute Arbeit und eine eigene Wohnung. Für den Preis, dass seine beiden älteren Brüder nichts mehr mit ihm zu tun haben wollten. Verräter, hatten sie ihn genannt, als er zur Uni gegangen war. Hält sich für was Besseres, hatten sie zu Hause im Pub erzählt.
Bin ich ja auch, würde er heute sagen, und er hätte das besser auch damals schon gesagt, als er seinen BA in Geschichte machte. Er hatte Geschichte gewählt, weil das sein Lieblingsfach gewesen war – und weil ihn die Aussicht, studieren zu können, überwältigt hatte. So sehr, dass er gar nicht gewusst hatte, wofür er sich entscheiden sollte, bis ihm seine Lehrer geraten hatten: Nimm das, was dir Spaß macht. Nur dann kannst du gut sein.
Jedes Wochenende war er nach Hause gefahren, es war nicht weit von Newcastle. Mit der Bahn nach Durham und von dort aus weiter mit dem Bus. Nur, um zu beweisen, dass er sich nicht für was Besseres hielt, dass er immer noch einer von ihnen war. Deshalb hatte er nach seinem Abschluss auch nicht weiterstudiert, wie es seine Professoren gewollt hatten. Bekniet hatten sie ihn, seinen Master zu machen, vielleicht sogar den Doktor. Eine akademische Karriere sagten sie ihm voraus. Ben wollte aber nicht, dass sie zu Hause noch schlechter von ihm dachten. Wie dumm man sein kann, dachte er heute, wie unendlich dumm, nur weil man Angst hat, irgendwann nicht mehr dazuzugehören.
Sein erster Job bei einer Zeitung war in Newcastle gewesen. Einer seiner Professoren hatte ihm die Stelle vermittelt. Versteck dich nicht, hatte er ihm gesagt. Wenn du schon nicht an der Uni weitermachst, dann werde Journalist, zeig, was du kannst, verändere die Welt, wenn es sein muss. Aber versteck dich nicht in deinem Dorf.
Diese Sätze hatten ihm Angst gemacht, aber dann hatte er den Job doch angenommen. Seht her, ich arbeite, ich bin kein Student mehr, hatte er zu Hause gesagt, aber seine Brüder hatten die Nase gerümpft und gesagt: Hält sich für was Besseres, der kleine Scheißer.
Und trotzdem hatte er ihnen angeboten, ihnen finanziell unter die Arme zu greifen. Was sie ablehnten, weil sie ihn ablehnten. Dreißig musste er werden, um zu verstehen, dass er einfach nicht dazugehörte. Nie dazugehört hatte. Nie dazugehören würde. Dann zog er nach Edinburgh und fuhr nie wieder nach Hause. Nicht an den Wochenenden, nicht an Weihnachten und schon gar nicht an Geburtstagen. Er schickte nicht mal Päckchen. Beantwortete keine Briefe (Mails schrieben sie nicht, obwohl sie Internet hatten – Mails waren was für Klugscheißer). Ging nicht ans Telefon, wenn er ihre Nummer sah. Stellte sich tot und fühlte sich zum ersten Mal im Leben frei.
Nicht einmal mit seiner damaligen Freundin hatte er richtig Schluss gemacht, aber deshalb hatte Ben kein schlechtes Gewissen. Sie hatte sich sowieso mehr für seinen ältesten Bruder interessiert. Wahrscheinlich vögelte sie längst mit ihm, obwohl er vier Kinder mit einer anderen Frau hatte. Es interessierte ihn nicht. Seine neue Freundin kam aus Edinburgh. Wie er hatte sie studiert. Nina wohnte in einer Eigentumswohnung in Bruntsfield. Sie lebte das Leben, das für ihn nicht in Frage gekommen war: Nina war an der Uni geblieben, um zu promovieren, und hatte jetzt einen Lehrauftrag. Philosophie. Er war stolz darauf, dass eine Frau wie sie sich mit einem Kerl wie ihm abgab.
Trotzdem würde er Nina heute Abend absagen, weil etwas anderes wichtiger war. Er zog sich um: die ältesten Jeans, ausgetretene Turnschuhe, ein Kapuzenshirt, darunter ein Shirt von der Band Maxïmo Park. Er steckte eine Zwanzig-Pfund-Note, ein paar Münzen und seine Schlüssel in die Hosentasche. Kurz überlegte er, das Handy in der Wohnung zu lassen, entschied sich dann aber, es mitzunehmen. Rasch überprüfte er sein Outfit im Spiegel, trank ein halbes Glas Olivenöl, rannte die Treppe runter und weiter zur Bushaltestelle, um nach Craigmillar zu fahren.
Es war nicht weit. Craigmillar grenzte südlich an Duddingston, und doch war es eine Reise in eine andere Welt. Alle Versuche der Stadt, die Wohnsituation zu verbessern, hatten bisher nur wenig gebracht. Aber man gab nicht auf. Mittelklassefamilien sollten angelockt werden, indem man neue Wohnsiedlungen mit Einfamilienhäusern baute und die technische wie auch die soziale Infrastruktur verbesserte. Die Sozialbauten reichten nun nicht mehr bis in den fünfzehnten, sondern nur noch bis in den zweiten Stock hinauf. Hier und da entstanden Grünflächen. Die verkommenen Hochhäuser, die man in den 50ern und 60ern in Craigmillar, Niddrie oder Greendykes errichtet hatte, waren bereits abgerissen worden oder standen leer, um in den nächsten Jahren dem Erdboden gleichgemacht oder komplett saniert zu werden. Edinburgh versuchte (mal wieder), aus den sozialen Brennpunkten etwas Besseres zu machen. Aber der schlechte Ruf blieb an den Stadtteilen kleben, und es würde Generationen dauern, bis er verschwand.
Ben ging ohne Ziel durch die Straßen. In Greendykes blieb er vor den Hochhäusern stehen, die für ihn zum Symbol der Armut geworden waren: Wauchope House und Greendykes House. Beide fünfzehn Stockwerke hoch, jeweils sechsundachtzig Wohnungen. Baujahr 1964. Hatte man damals wirklich geglaubt, den Menschen damit etwas Gutes zu tun? Man verschaffte ihnen Wohnraum, baute in die Höhe, um Platz zu sparen, obwohl es genügend gab. Dachte nicht daran, dass Menschen genauso reagieren würden wie Tiere in zu kleinen Käfigen: aggressiv. Hilflos richteten sie ihre Wut gegen sich selbst und andere. Ging ein Fünfzehnjähriger aufs Dach des Hauses, in dem er lebte, weil er eine Mutprobe bestehen wollte? Warum nicht, es gab in unmittelbarer Nähe so gut wie nichts. Die flacheren Häuser waren fast vollständig verlassen, nur ein oder zwei Parteien wohnten dort noch. Sonst gab es noch karge Felder ohne Herausforderungen für einen Jungen. Keine Geschäfte, keine Pubs, nichts war hier. Greendykes wirkte auf Ben wie das Ende der Stadt. Er war versucht, mit dem Handy ein Foto zu machen. Wer wusste schon, wie lange die Türme noch dort standen. Aber irgendetwas hielt ihn davon ab: Angst? Oder Anstand? Ben ging zurück zur Hauptstraße, weiter nach Niddrie.
Die Männer, die ihm begegneten, ließen ihn in Ruhe. Die jungen Frauen, Mädchen eigentlich, die Kinderwagen vor sich herschoben, musterten ihn hoffnungslos, aber ohne Aggression. Wenn man wusste, wie man sich zu bewegen hatte, hörte diese Gegend auf, gefährlich zu sein. Die Anwohner rochen die Angst der Menschen, die nicht hier lebten. Es war wie mit den Studenten in Durham: Sie bekamen genaue Instruktionen, wo sie hingehen durften und wo nicht. Eine unsichtbare Linie teilte die kleine Stadt: bis hierhin town, dahinter gown. Die Pubs der Anwohner waren tabu – Studenten hatten ihre eigenen Kneipen. Natürlich übertraten immer wieder welche diese Grenze, gingen in die Pubs, in die sie nicht sollten. Beleidigten die Leute durch ihren Privatschulakzent, ihre teure Kleidung, ihre selbstherrliche Art. Kurze Zeit später fand man sich ganz demokratisch im Wartebereich des staatlichen Krankenhauses wieder, wo den Ärzten egal war, ob jemand privat versichert war oder nicht.