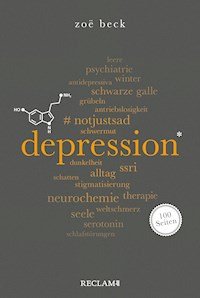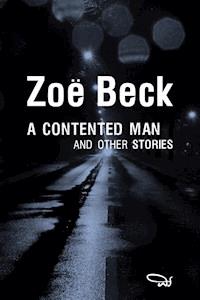9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
London, in einer nicht wirklich fernen Zukunft: Ein Drogenhändler treibt tot in der Themse, ein Schutzgelderpresser verschwindet spurlos. Ellie Johnson weiß, dass auch sie in Gefahr ist – sie leitet das heißeste Start-up Londons und zugleich das illegalste: Über ihre App bestellt man Drogen in höchster Qualität, und sie werden von Drohnen geliefert. Anonym, sicher, perfekt organisiert.
Die Sache hat nur einen Haken – die gesamte Londoner Unterwelt fühlt sich von ihrem Geschäftsmodell bedroht und will die Lieferantin tot sehen. Ein Kopfgeld wird auf sie ausgesetzt. Ellie beschließt zu kämpfen – ihre Gegner sind mächtig, und sie lauern an jeder Straßenecke.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 343
Sammlungen
Ähnliche
Zoë Beck
DIE LIEFERANTIN
Thriller
Herausgegeben vonThomas Wörtche
Suhrkamp
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2017
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage der Ausgabe des suhrkamp taschenbuchs 4775
Originalausgabe
© Suhrkamp Verlag Berlin 2017
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das des öffentlichen Vortrags, der Übersetzung sowie der Übertragung durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.
Umschlagabbildung: Alex Ortega/EyeEm/Getty Images
Umschlaggestaltung: zero-media.net
eISBN 978-3-518-75119-0
www.suhrkamp.de
London, vielleicht bald
1
Rotweißblau waren nicht ihre Farben.
Morayo Humphries war schwarz.
Auf dem Nachhauseweg kam Mo an den Demonstranten vorbei. Sie waren friedlich. Sogar die Sabotage der Baustelle verlief in gewisser Weise friedlich. Die Sachbeschädigungen hatten nachts stattgefunden und beschränkten sich nur noch auf Baumaschinen, seit die Obdachlosen dort eingezogen waren. Die Sitzblockaden arteten nicht in Gewalt aus. Die Demonstranten waren aktiv in den sozialen Medien und dabei effizient, und vor Ort achteten sie darauf, vor allem lästig zu sein. Die Plakate und Spruchbänder mit »Olive Morris ist nicht vergessen!« fehlten nie.
Wer nicht vor Gewalt und Krawall zurückschreckte, waren die Gegendemonstranten, von denen es hieß, sie seien bezahlt. Sie waren laut. Sie suchten Streit, und vielleicht waren sie wirklich bezahlt. Zumindest waren sie organisiert, es gab nämlich feste Wochentage, an denen sie zu festen Uhrzeiten auftauchten. Heute war so ein Tag, und Mo war zur entsprechenden Uhrzeit nach Hause gegangen. Routiniert hatten die Demonstranten Bagger und Kräne besetzt und geduldig ihre Spruchbänder ausgerollt. Die Gegendemonstranten waren im Stechschritt vorbeimarschiert und hatten die üblichen Parolen geplärrt, rotweißblau, und als sie Mo gesehen hatten, waren einige von ihnen ausgeschert und hatten versucht, sie einzukreisen. Einer hatte sie an den Haaren gepackt und gerufen: »Geh nach Hause, du gehörst hier nicht her!«
Er hatte so fest gezogen, dass sie schon glaubte, er würde ihr ein ganzes Büschel mitsamt der Kopfhaut ausreißen.
Mo hatte ihm den Ellenbogen in den Unterleib gerammt und war gerannt. Sie kannte die Gegend und wusste, durch welche Gassen sie verschwinden konnte. Jetzt war sie in ihrer Wohnung und wollte nur noch ihre Ruhe haben.
Sie konnte sie immer noch hören. Leise, aber deutlich, rotweißblau, vielleicht nur in ihrem Kopf. Was egal war. Sie hörte sie nun mal. Die Fenster waren geschlossen, die Tür mehrfach verriegelt, niemand außer ihr war in der Wohnung, und auch sonst war es im Haus ruhig. Alles wäre ganz wunderbar, wenn die Stimmen ihr nicht gefolgt wären, rotweißblau, sie schienen mit ihr durch die Tür gekommen zu sein.
Mo weckte den Computer auf. Er zeigte ihr die Nachrichten. Nun waren auch noch die Bilder in ihrer Wohnung. Die Demonstranten. Die Gegendemonstranten. Eingerahmt von den Werbebannern für das Referendum. Nichts davon wollte sie sehen. Mo schickte ihn wieder schlafen.
Sie stellte Musik über ihr Smartphone an. Mogwai klang aus allen Lautsprechern. Sie legte sich auf das Sofa und schloss die Augen, konzentrierte sich auf die Musik, auf ihre Atmung, wurde aber nicht ruhiger, sondern nervöser. Die Stelle an der Kopfhaut brannte, ihr Herz schlug schnell und holprig. Sie stand auf, ging hin und her, biss sich fest auf die Lippen, biss sich auf die Zunge, verschränkte die Arme und grub die Finger tief in ihre Unterarme. Es half alles nichts. Sie sank auf die Knie, versuchte es mitten im Raum und ohne Matte mit einer Yogastellung, sah ein, dass es Quatsch war, stand auf, ging ins Schlafzimmer und holte sich alles aus dem Versteck im Kleiderschrank: ihr Röhrchen, Alufolie, H, Feuerzeug. Damit ging sie zurück zum Sofa, setzte sich hin, legte die Sachen vor sich auf den Tisch. Rieb die Folie mit dem Ärmel glatt, bog sie, streute das H drauf, erhitzte es. Der Stoff war so rein und gut, dass er sofort schmolz und die ölige Substanz anmutig über die Folie floss.
»Geh nach Hause«, hatte der Typ gesagt, der ihr fast die Haare ausgerissen hätte.
Sie machte sich auf den Weg.
.
Den Drachen jagen.
Die Monster verjagen. Rotweißblau, sie rückten in immer weitere Ferne. Wenige Minuten später hatte Mo den Kopf über die Armlehne gelegt, sah an die Decke, spürte keine Schmerzen, keine Unruhe mehr.
Diese Stille.
Alles überstrahlendes Glück.
Sie schwebte in einer Blase reiner Glückseligkeit. Der rotweißblaue Dreck rutschte daran herunter wie an einer Teflonschicht. Für ein paar Stunden.
Und immer wieder, wann immer sie wollte. Sie allein bestimmte die Dosis.
So wie jetzt.
Jetzt herrschte Stille.
2
Leigh hatte schon fünf Tage lang nichts mehr von dem Mann unter seinem Fußboden gehört. Langsam glaubte er, sich entspannen zu können. Er hatte sich schon sehr lange nicht mehr entspannen können, was an diesem Mann lag. Besonders in den letzten Monaten war sein Leben durch ihn höchst unangenehm gewesen, und nun war Leigh ehrlich gesagt froh, dass sich dieser Zustand offenbar zum Besseren verändern würde. Auch wenn es die erste Zeit, nachdem der Mann unter seinen Fußboden geraten war, nicht danach ausgesehen hatte. Aber seit fünf Tagen war Ruhe. Endlich.
Morgens war Leigh der Erste in seinem Restaurant und nachts der Letzte. Unter seinen Eltern war es ein traditionelles englisches Pub gewesen. Damals war Clapham noch eine Gegend für ärmere Leute gewesen, aber das hatte sich geändert, das Publikum war ein anderes geworden, es hatte mehr Geld und wollte es ausgeben. Das Pub lief schon immer gut, und mit den neuen Anwohnern noch besser, vor allem, wenn Sport übertragen wurde. Als aber das Rauchverbot in Kraft trat und die Gäste nur noch spärlich kamen, gab er (gerade mal den Schulabschluss in der Tasche) seinen Eltern den Rat, es von Grund auf zu renovieren. Einen Monat später eröffneten sie ein Steakhouse. Es lief gut. Und je mehr vegane und vegetarische Restaurants aufmachten, desto mehr Umsatz hatten auch sie. Eine zweite, kleinere Renovierung vor ein paar Jahren machte aus dem Steakhouse ein Feinschmecker-Restaurant mit Schwerpunkt auf Steaks und Burgern, und ja, sie hatten auch vegetarische Burger im Angebot. Der Laden lief bestens. Der gute Ruf sprach sich schnell herum. Dann bekam sein Vater einen Schlaganfall und starb. Bei seiner Mutter wurde kurz darauf Krebs diagnostiziert. Sie würde ihrem Mann zwei Jahre später folgen. Jetzt war Leigh der Chef.
Sein Restaurant fand Erwähnung in Gourmet- und Reisemagazinen. Deshalb hatte Leigh überlegt, einen zweiten Laden zu eröffnen, aber diesen Gedanken hatte er gleich wieder aufgeben müssen, und das hatte mit dem Mann unter dem Fußboden zu tun gehabt.
»Sie haben es aber sehr schön hier«, hatte der Mann gesagt, damals, als sie sich zum ersten Mal begegnet waren. Er trug einen dunklen Anzug, nicht besonders teuer, aber auch kein billiges Ding, dazu eine Aktentasche, unauffälliges Schwarz, ebenfalls nicht besonders teuer, aber auch nicht zu billig. Die Schuhe, das war Leigh sofort aufgefallen, waren allerdings von sehr guter Qualität, und die Armbanduhr hatte er sich ebenfalls etwas kosten lassen. Er trug keine Rolex oder etwas in der Preisklasse, aber das dezente silberne Stück lag schon durchaus im vierstelligen Bereich. Leigh achtete auf solche Details, sein Vater hatte es ihm beigebracht. »An den Schuhen erkennst du, mit wem du es zu tun hast«, hatte er immer gesagt. Und: »Mit der Uhr zeigen sie dir, wie viel sie verdienen. Oder wie viel sie gern verdienen würden.« Leigh hatte von seinem Vater viel über Menschen gelernt, und von seiner Mutter wusste er alles, was es übers Geschäftemachen zu wissen gab.
Beides half ihm an diesem Abend wenig, so kurz vor Schluss, als der Mann sich ihm gegenüber an die Theke setzte und sein Wohlgefallen über die Einrichtung ausdrückte. Leigh bedankte sich höflich und erklärte mit großem Bedauern, die Küche sei für heute geschlossen, ob er ihm etwas zu trinken anbieten könne, ein Glas Wein oder einen Whisky? Der Mann nahm dankend an und bestellte den teuersten Brunello, den Leigh im Angebot hatte, machte es sich auf dem Barhocker bequem und sah interessiert den letzten Gästen dabei zu, wie sie sich deutlich angetrunken zum Aufbruch bereitmachten und George, dem Kellner, ein unmäßiges Trinkgeld hinlegten. Anschließend ließ er sich die Speisekarte geben (»Nur mal schauen!«) und studierte sie so intensiv, als wollte er sie auswendig lernen.
Der Mann saß immer noch auf dem Barhocker, als George aufgeräumt hatte und im Hinterzimmer verschwunden war, um sich umzuziehen. Leigh war nun allein mit seinem seltsamen Gast und fragte, ob er noch ein Glas wünsche oder möglicherweise doch schon die Rechnung, eine Formulierung, die ihn fast schmerzte, weil er noch nie so unhöflich zu einem Gast hatte sein müssen. Aber dieser Mann war irgendwie anders, er blieb am Barhocker kleben wie ein alter Kaugummi und bestellte sich ein weiteres Glas Wein. Erst als sich George und die Jungs aus der Küche verabschiedet hatten, dehnte er mit einem Seufzer den Rücken, lächelte ein wenig müde, nickte Leigh zu und sagte: »Also dann.«
»Die Rechnung?«
»Die Bücher.«
»Ich fürchte, ich verstehe nicht?« Leigh erlaubte sich, eine Spur genervt zu klingen.
»Zeigen Sie mir Ihre Bücher.«
»Bitte?«
»Sie haben mich schon verstanden.«
Einige Sekunden lang dachte Leigh, der Mann sei vom Finanzamt. Eine unangekündigte Buchprüfung. Oder jemand vom Gesundheitsamt, der glaubte, er könne sich hier aufspielen. Er verstand im ersten Moment wirklich nicht, was der Mann wollte. Irritiert sah er ihm dabei zu, wie er den Aktenkoffer auf die Theke legte, ihn öffnete und ein iPad herausholte.
»Kein Problem«, sagte er freundlich. »Wenn Sie mir Ihre Bücher nicht zeigen wollen, machen wir es anders. Wie viel Quadratmeter sind das?« Er drehte den Kopf hin und her, spähte in Richtung Küche, stand aber nicht auf. »Mit allem Drum und Dran zweihundert? Hundertachtzig? Sagen wir hundertachtzig, weil der Wein so gut ist. Miete oder Eigentum?«
Leigh starrte ihn finster an, antwortete nicht, polierte stattdessen Gläser.
»Eigentum, nicht wahr? Ihre Eltern waren schon jahrzehntelang vor Ihnen drin.« Er fing an, auf seinem iPad herumzutippen, murmelte leise irgendwelche Zahlen vor sich hin, zählte zwischendurch die Tische, spitzte immer mal wieder die Lippen, wenn er nachzudenken schien, blätterte einmal sogar in der Speisekarte etwas nach, sagte schließlich: »Was meinen Sie, fangen wir mit zweitausendfünfhundert Pfund im Monat an?« Der Mann zwinkerte ihm freundschaftlich zu.
Leigh polierte immer noch Gläser. »Der Wein geht aufs Haus«, sagte er. »Und jetzt verschwinden Sie. Wir haben geschlossen.«
Der Mann lachte. »Natürlich geht der Wein aufs Haus! Ab sofort geht auch das Essen aufs Haus! Dachten Sie, wir verrechnen das mit den zweifünf?«
»Sie gehen jetzt auf der Stelle!«
»Wenn ich daran denke, wie lange Ihre Familie diesen Laden nun schon hat. Wann sind Ihre Großeltern aus ihrem Kaff in Yorkshire weggegangen und nach London gekommen? Gleich nach dem Krieg, oder? Ihre Mutter ist hier geboren. Sie sind hier geboren. Sie sind hinter dieser Theke groß geworden.«
»Ich kann auch die Polizei rufen.« Leigh griff nach dem Telefon.
Der Mann sprach weiter. »Kennen Sie den Chinesen, Old Town Ecke Grafton Square? Von dem haben Sie bestimmt gehört. Ebenfalls seit Jahrzehnten in Familienbesitz. Dem ist doch tatsächlich die Küche abgebrannt. Fast hätte es noch das Pub nebenan erwischt.« Der Mann schüttelte bedauernd den Kopf. »Die haben auch die Polizei gerufen, aber irgendwie kommt die einfach immer zu spät.« Er zwinkerte ihm zu, machte eine ausladende Geste. »Sagen wir drei?«
Leigh wusste im Grunde, dass er Glück hatte. Er hätte genauso gut schon vor Jahren an der Reihe sein können. Warum dieser Mann erst heute zu ihm kam, blieb ihm ein Rätsel, aber sicher war, dass er seinen Plan von einem zweiten Laden begraben musste. Dieser Mann würde das Geld bekommen, mit dem er den neuen Laden finanziert hätte. Er überlegte kurz, dann stellte er das Glas weg, an dem er bestimmt schon seit fünf Minuten herumpolierte, und sagte: »Dreitausend sind zu viel. Ich zeige Ihnen die Bücher.«
Der Mann legte sein iPad auf die Theke und hob das Weinglas, in dem noch ein letzter Rest Brunello schwappte, um ihm zuzuprosten.
Jahrelang war es gut gegangen. Der Mann, der Gonzo genannt werden wollte, aber definitiv ein Engländer ohne erkennbaren Migrationshintergrund war, richtete sich in seinen Forderungen nach Leighs Büchern. Der Laden sollte weiterlaufen, nicht ausbluten, und Leigh betrachtete diese Abgaben als eine Art steuerlich nicht absetzbare monatliche Versicherungssumme.
Vor einem Jahr hatte sich dann ohne erkennbaren Anlass etwas verändert: Gonzo unterstellte Leigh, ihm gefälschte Bücher vorzulegen, und forderte mehr. Nun hatte Leigh nicht die Möglichkeit zu sagen: »Ich will mit Ihrem Boss sprechen!«, obwohl er das wirklich gern getan hätte. Er wusste, dass Gonzo für Leute arbeitete, die ihr Geld mit Drogen, Waffen und Prostitution verdienten. Das Schutzgeld war nur ein kleiner Teil ihres Einkommens. Er vermutete, dass ein Clan aus Croydon dahintersteckte, den manche liebevoll »die Croydon-Boyce« nannten. Boyce war der Familienname. Aber sicher wusste Leigh es nicht, und er hatte es nie gewagt, Gonzo danach zu fragen.
Er handelte den Mann etwas runter, zahlte aber doch mehr, als ihm guttat, und jeden Monat führten sie aufs Neue die Diskussion darüber, ob Leighs Bücher wirklich stimmten. Irgendwann machte er sogar eine Kopie seiner Steuererklärung, ließ sie amtlich beglaubigen und zeigte sie dem Mann, aber der winkte ab, nannte das Schreiben eine billige Fälschung, die das Papier nicht wert sei, auf dem sie gedruckt war. Schlecht gelaunt ging er mit seinen Forderungen sogar noch ein Stück hinauf.
Leigh ging langsam das Geld aus, und mit dem Geld auch die Geduld. Der Mann mochte denken, dass die Geschäfte großartig liefen, aber Leigh spürte die Folgen des Brexit. Großzügige Touristen vom Kontinent blieben hier im Londoner Süden zunehmend aus, Studierende aus der EU waren selten geworden, Studierende aus Großbritannien dafür geizig, weil Mieten und Studiengebühren gestiegen waren. Viele EU-Bürger hatten das Land verlassen müssen, weil ihre Firmen aus Großbritannien weggegangen waren, und die Einheimischen sparten aus Ungewissheit darüber, wie sich das Pfund entwickeln und ob sie morgen noch ihre Jobs haben würden. Die neuen Besucher Londons kamen aus China und Russland. Sie blieben jeweils gern unter sich. Leighs Laden lief zum ersten Mal, seit ihn seine Großeltern vor siebzig Jahren eröffnet hatten, nur mäßig, und durch die Zahlungen an Gonzo war die Lage brutal. Seine privaten Rücklagen waren aufgebraucht. Als der Gefrierschrank kaputtging und mit ihm nicht nur das teure Rindfleisch und einige Kilo Büffel, sondern auch der Holzboden im Lagerraum, drohten ihm die Kosten über den Kopf zu wachsen. Er hatte bereits einen Kredit aufnehmen müssen, um über den Sommer zu kommen. Er glaubte nicht, dass man ihm so schnell einen zweiten geben würde. Aber Gonzo zuckte nur desinteressiert die Schultern.
»Morgen komme ich wieder. Und dann werden wir uns bestimmt einig«, sagte er, nahm ohne zu fragen zwei teure Flaschen Rotwein aus dem Regal und ging durch den leeren Laden hinaus auf die Straße. Er blieb vor einem der großen Fenster stehen, die Flaschenhälse lugten aus seiner Aktentasche, im Mundwinkel hatte er eine Zigarette. Er grinste und winkte, dann verschwand er endlich in Richtung Clapham Common.
Leigh wusste nach all den Jahren immer noch nichts über diesen Mann, nicht einmal, ob er mit dem E-Shuttle kam oder mit der U-Bahn oder vielleicht sogar zu Fuß. Er hatte keine Ahnung, wie alt Gonzo war, ob er eine Frau hatte (schwul war er sicher nicht), ob er wirklich gern den teuren Rotwein trank oder ob es nur eine Pose war, um ihn zu ärgern.
Leigh fragte sich, ob es nicht doch eine Möglichkeit gab, mit jemandem aus der Boyce-Familie zu sprechen. Es konnte kaum in deren Interesse sein, das Restaurant komplett kaputtzumachen. Sie hatten gut an ihm verdient, weil er gut verdient hatte. Und jetzt wollten sie, dass er pleiteging? Wollten sie die Immobilie? Oder das Restaurant übernehmen?
Er kam hinter der Theke hervor, ging zur Tür und schloss ab. Er hängte das Schild auf, das er vorbereitet hatte, um seine Kundschaft darüber zu informieren, dass eine Woche lang wegen Renovierungsarbeiten geschlossen sein würde. Eine Woche keine Einnahmen, dafür würde er die meisten Gehälter weiterzahlen müssen. Der neue Gefrierschrank war heute geliefert worden, der Boden im Lagerraum musste morgen herausgerissen und komplett neu gemacht werden. Handwerker konnte er sich nicht leisten. Er hatte sich im Baumarkt und in Internetforen darüber informiert, was wie getan werden musste und welche Materialien er brauchte, wie lange es dauern würde und welche Kosten auf ihn zukamen.
Morgen würden ihm George und ein paar Jungs aus der Küche dabei helfen, den alten Holzboden rauszureißen, damit er die Betonschicht gießen konnte, um den Boden auszugleichen, ihn zu dämmen und Fliesen zu legen. Wenn er an das Geld dachte, das ihn das Material gekostet hatte, wurde ihm schon wieder ganz elend.
Leigh löschte die Lichter bis auf eine kleine Lampe hinter der Theke, schenkte sich ein Glas Wein ein (während der Arbeit trank er nie), setzte sich auf einen Barhocker und dachte nach. Gegen Mitternacht war er davon überzeugt, dass er Gonzo umstimmen konnte. Er würde alle Belege mit den Kosten für die Renovierung zusammensuchen, um einen Aufschub bitten und ihm dann – und dieser Plan musste einfach aufgehen, er war nämlich richtig gut – ihm also dann von der Idee mit dem zweiten Laden erzählen. Gonzo würde nur ein klein wenig Geduld haben müssen, danach aber mehr verdienen als zuvor.
Warum er in den letzten Monaten so eine harte Linie fuhr, konnte alle möglichen Gründe haben, aber tief im Innersten würde Gonzo wissen, wie man gute Geschäfte machte. Vielleicht war er sogar zu einer Investition bereit? Für solche Leute war es doch einfacher, in ein gutes Geschäft zu investieren, statt es selbst zu übernehmen. Hatte Gonzo nicht davon gesprochen, dass sie sich bestimmt einig werden würden? Der Mann war nie gewalttätig gewesen, er hatte nie offen gedroht, nicht einmal geflucht. Ein Geschäftsmann eben.
Als Leigh seinen Wein ausgetrunken hatte und die Treppe hinauf in seine Wohnung ging, wusste er, dass am Ende doch alles wieder gut werden würde.
Vierundzwanzig Stunden später hoffte Leigh, dass niemand den Mörtelrührer hörte, während er Kies, Zement und Wasser zusammenschüttete, und er fragte sich, ob er die Pistole zusammen mit dem Mann in den Boden betonieren oder doch besser aufheben sollte. Er entschied sich fürs Einbetonieren. Er hatte nämlich nicht vor, das Ding jemals wieder zu benutzen, und abgesehen davon gehörte es ihm auch gar nicht. Mochte es zusammen mit seinem Besitzer in Frieden in die Betonschicht eingehen.
Achtundvierzig Stunden später glaubte Leigh, Geräusche aus dem Fußboden zu hören. Mal war es ein Kratzen, mal ein Stöhnen oder Seufzen. Er hörte die Geräusche sogar bis in seine Wohnung, die über dem Restaurant lag. Wenn er in den Lagerraum ging, um die Betonschicht zu überprüfen, fürchtete er, dass eine Hand oder ein Bein aus dem Boden ragte, aber alles blieb glatt und unberührt.
Erst als er den Laden wieder öffnete und die Gäste hereinströmten, als hätten sie eine Woche lang gehungert und nur auf ihn gewartet, legte sich Leighs Nervosität, und er hörte nichts mehr von dem Mann unter seinem Fußboden, selbst dann nicht, wenn alle gegangen waren und er ganz allein im Türrahmen zum Lagerraum stand und angestrengt lauschte. Nein, da war nichts, nur vollkommene Stille. Leigh war zufrieden, sogar glücklich. Anderthalb Wochen waren verstrichen, und noch immer kam niemand, um Gonzos Platz einzunehmen.
Der nächste Tag begann neblig, aber am Nachmittag strahlte die Oktobersonne. Gerade war nicht viel los, die Zeit zwischen Mittag- und Abendessen. Er wollte im Internet nach passenden Immobilien für einen zweiten Laden schauen. Nur schauen. Ein wenig träumen. Pläne schmieden. Aber er kam nicht über die Nachrichtenseite hinaus. Dort las er, was in der Nacht zuvor im Hafen von Tilbury geschehen war.
Was er angerichtet hatte.
3
Es gab ein paar Männer, die nicht wussten, was Leigh angerichtet hatte. Sie hatten ihre eigene Theorie darüber, was mit Gonzo geschehen war, und ein Restaurantbesitzer in Clapham spielte dabei keine Rolle.
Einer von ihnen war Declan Boyce, und das, worüber Leigh lesen würde, war noch nicht geschehen. Declan schloss gerade die Augen und wischte sich das Blut ab, das ihm ins Gesicht gespritzt war. Er zog sich dafür den Ärmel seines Pullovers über die Hand und dachte: Ich muss meine Klamotten verbrennen, wenn wir hier fertig sind. Als er die Augen wieder öffnete, sah er in drei ihm zugewandte Gesichter.
»Warum sagst du, ich soll aufhören?« Leos Hand, mit der er zugeschlagen hatte, war noch zur Faust geballt. Blut lief ihm über die Fingerknöchel.
Der Mann, den er geschlagen hatte, winselte, keuchte und spuckte roten Schleim. Declan vermutete, dass ein paar Zähne dabei waren. Hielte Victor ihn nicht fest, läge er schon lange am Boden. Victor hatte ebenfalls ein paar Blutspritzer im Gesicht, das schien ihn aber nicht weiter zu stören.
Leo wiederholte seine Frage, und Declan sagte endlich: »Das bringt nichts.«
»Seh ich anders.« Leo wandte sich dem Mann zu, den Victor auf den Beinen hielt. Einen Moment lang sah es so aus, als wollte er etwas zu ihm sagen. Dann schlug er einfach wieder zu. Diesmal zielte er auf den Solarplexus, und der Mann sackte mit einem dumpfen Seufzer bewusstlos in sich zusammen.
Victor schüttelte ihn leicht.
»Na toll. Ist er tot?«
»Der wird wieder.« Leo ohrfeigte den Mann. »Declan, hol mal Wasser.«
»Wo soll ich denn jetzt Wasser herkriegen?«, fragte Declan und sah sich um, als hoffte er, dass aus der Dunkelheit zwischen den riesigen Containern jeden Moment eine Hafenkneipe aufleuchten würde.
»Ich hab ne Flasche im Auto«, sagte Leo und warf ihm die Schlüssel zu.
»Super.« Insgeheim war Declan Boyce froh, eine Weile von hier wegzukommen. Blut konnte er nicht besonders gut sehen, ihm wurde davon immer ein wenig übel, und außerdem war ihm kalt. Er trabte los, verlief sich zwischen den Containern, die sich nachts noch ähnlicher sahen als tagsüber, fand schließlich den Wagen und die Wasserflasche. Er musste sich keine Gedanken darüber machen, ob ihn jemand sehen würde. Von den Port Constables, die die Nachtschicht schoben, war mindestens einer geschmiert, die Überwachungskameras galten als nutzlos, weil sie nachts nur beschissene Qualität lieferten, und hier vorn an der Themse war alles ruhig. Die Schiffe, deren Ladung gerade gelöscht wurde, lagen im Hafenbecken. Die Hafenarbeiter würden sie nicht bemerken.
Sie hatten den Tipp bekommen, dass der Mann heute Nacht zum Containerhafen von Tilbury kommen würde, und ihr Informant hatte recht gehabt. Nur hatten sie immer noch nicht rausbekommen, mit wem er sich treffen wollte. Oder wie er auf die glorreiche Idee gekommen war, ihnen das Geschäft zu versauen. Oder was ihn geritten hatte, ausgerechnet Gonzo umzubringen.
Gonzo hatte jahrelang für Declans Vater und seinen großen Bruder gearbeitet und mit dafür gesorgt, dass die Geschäfte im Londoner Süden gut liefen. Es war schwer, zuverlässige Leute zu finden, man arbeitete schließlich nicht mit Tarifverträgen und zahlte auch nicht in die Pensionskasse ein. Man musste sich vertrauen, und gleichzeitig durfte man niemandem trauen.
Gonzo hieß eigentlich Gerald Miller, aber er hatte behauptet, alle würden ihn Gonzo nennen, schon seit der Schulzeit, und vielleicht stimmte das sogar. Nachdem er drei oder vier Tage verschwunden war, hatte der alte Boyce seine Söhne losgeschickt, damit sie herausfanden, was los war.
Declan und sein Bruder Mick fanden in Gonzos Wohnung einen Haufen Bargeld, den er in der Matratze versteckt hatte: über hunderttausend Pfund. (Woher zum Teufel …?) Sonst gab es dort nichts, womit sie etwas anfangen konnten. Die Wohnung sah nicht so aus, als ob jemand die Koffer gepackt hätte und verschwunden wäre. Declan entdeckte sogar Gonzos Pass in einer Schublade, in der sich noch alle möglichen anderen Papiere befanden, die sie allerdings auch nicht weiterbrachten. Der Kühlschrank war mäßig gefüllt, die Reste eines Takeaway-Essens warteten darauf, aufgewärmt und verzehrt zu werden, eine angebrochene Weinflasche stand in der Kühlschranktür. Sie nahmen das gefundene Geld mit und erstatteten ihrem Vater Bericht. Sie waren gerade noch rechtzeitig gekommen, bevor der Vermieter merkte, dass mit Mr. Miller etwas nicht stimmte, die Polizei informierte und eine offizielle Vermisstensache daraus wurde.
Der alte Boyce hörte sich an, was seine Jungs zu sagen hatten, dachte kurz nach, dann telefonierte er mit bestimmt fünf verschiedenen Leuten. Schließlich verkündete er, dass sie alle zusammen ins East End fahren würden. Sie trafen sich mit Victor Thrift, der im Osten der Stadt das Sagen hatte, und wenige Stunden später saßen Victor Thrift, der alte Boyce und seine beiden Söhne mit Leo Hunter, Boss von Nordlondon, an einem Tisch. Alle waren sich einig: Gonzo war zu den Neuen übergelaufen. Sie hatten sich jemanden ausgesucht, der nicht direkt in die Drogengeschäfte eingebunden war, um keinen Verdacht zu erregen. Und Gonzo hatte sich fürstlich für seine Spitzelarbeit bezahlen lassen.
Es gab keine andere logische Erklärung.
Dass Gonzo tot sein musste, auch darüber waren sie sich einig. Von der Wohnung, die aussah, als würde er jeden Moment zurückkommen, ließen sie sich nicht täuschen. Hätte er vorgehabt unterzutauchen, hätte er alles genau so inszeniert: Essen im Kühlschrank, Ausweispapiere in der Schublade. Er hätte sich neue Papiere besorgt und nichts aus seinem alten Leben behalten. Aber er hätte nicht einfach hunderttausend Pfund Bargeld zurückgelassen.
Auch hierfür gab es keine andere logische Erklärung.
Declan hakte trotzdem nach. »Warum sollen sie ihn umgebracht haben? Er war auf ihrer Seite, er hat sich bezahlen lassen.«
»Vielleicht haben sie gemerkt, dass er den Deal platzen lässt«, sagte sein Vater. »Vielleicht hat er sich nur zum Schein auf sie eingelassen, um sie für uns auszuspionieren, und nicht umgekehrt, und das haben sie spitzgekriegt.« Er warf einen Blick in die Runde. Victor Thrift und Leo Hunter hatten die Augenbrauen hochgezogen. »Ich weiß, was ihr denkt. Aber ich kenne Gonzo. Er war mein bester Mann.«
Damit war entschieden, dass man sich den Neuen endgültig widmen musste. Sie hatten nach und nach immer mehr vom Drogenmarkt übernommen, und das auf so elegante, unauffällige Art, dass die drei Bosse lange gebraucht hatten, um es überhaupt zu kapieren. Die drei würden sich gegenseitig nie ins Revier pissen. Es gab ungeschriebene Gesetze, und an die hielten sie sich. Wenn sie ihre Reviere erweiterten, dann in Gegenden, die noch frei waren.
Man sprach sich ab.
Man verhandelte von Angesicht zu Angesicht.
Man besiegelte Geschäfte mit einem Handschlag.
Man hielt sich an sein Wort.
Deshalb war klar, dass sie alle zusammenarbeiten würden: Gonzo musste gerächt werden.
Sie schickten ihre Informanten los, setzten Belohnungen aus, halfen gelegentlich dem einen oder anderen Gedächtnis mit der Faust auf die Sprünge, trugen alle Meldungen zusammen, rauften sich die Haare und verstanden schließlich, dass die Neuen ihre Geschäfte dezentral und ausschließlich im Netz abwickelten. Endlich tauchte ein Name auf, und mit dem Namen ein Ort und eine Uhrzeit: Jimmy Macfarlane, Containerhafen von Tilbury, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag um ein Uhr. Sie passten ihn ab, um aus ihm herauszuprügeln, mit wem er zusammenarbeitete und was mit Gonzo geschehen war.
Deshalb waren sie in dieser Nacht dort.
Für den Rückweg brauchte Declan noch länger, weil er diesmal völlig die Orientierung verlor. Er glaubte schon, die anderen seien woanders hingegangen. Er blieb stehen, lauschte, hoffte, etwas zu hören. Schließlich rief er Leo an, von Prepaid-SIM zu Prepaid-SIM.
Leo lotste ihn zu sich. Declan hatte keine Ahnung, wie er das machte. Als er die drei Männer endlich gefunden hatte, lag Macfarlane bewusstlos auf dem Boden, und Victor pinkelte auf ihn drauf.
Declan wusste, dass es besser war, jetzt nichts zu sagen. Er tat es trotzdem. »Du konntest wohl nicht abwarten, bis ich mit dem Wasser komme.«
»Wir dachten schon, du wärst ins Hafenbecken gefallen, Kleiner.« Grinsend verpackte Victor seinen Schwanz und zog den Reißverschluss zu. Dann wischte er sich die Hände an seiner Jacke ab. Er hatte immer noch Blutspritzer im Gesicht.
»Ist er jetzt wach?«, fragte Declan.
Leo stieß mit der Fußspitze gegen den Mann auf dem Boden. »Hey. Hey! Aufwachen, Prinzessin!«
Der Mann stöhnte.
»Seht ihr, der wird wieder.« Leo schien zufrieden.
»Brauchst du das Wasser?«, wollte Declan wissen.
»Der ist gleich wieder frisch und munter«, wehrte Leo ab.
»Ich dachte eigentlich …« Declan verstummte.
»Was? Um ihm die Pisse aus dem Gesicht zu waschen?« Victors Lachen dröhnte durch die schmalen Gassen zwischen den Containern. Declan glaubte, ein paar Möwen schimpfen zu hören.
Leo trat dem Mann in die Rippen. Er krümmte sich vor Schmerz, rollte sich auf die Seite, hustete. Declan stellte die Wasserflasche ab.
»Na also. Guten Morgen. Da sind wir ja wieder«, sagte Leo.
Der Mann antwortete nicht, jedenfalls nicht so, dass man es verstehen konnte.
»Für wen arbeitest du wirklich?«, fragte Leo.
Der Mann versuchte, sich auf alle viere aufzurichten. Er bewegte sich in Zeitlupe, und Declan glaubte, die Schmerzen des Mannes ebenfalls zu spüren. Er fühlte sich miserabel. Als Leo einen Schritt auf das kriechende Elend zuging, schob er sich dazwischen. Er hockte sich neben den Mann, versuchte, den Uringestank zu ignorieren, und sagte ruhig: »Wir wissen, dass Sie dazugehören. Wir wollen nur ein paar Namen von Ihnen hören. Wer ist Ihr Boss, und wer von euch hat Gonzo umgebracht. Sie reden mit uns, und dann können Sie verschwinden. Wenn Sie nicht mit uns reden, wird mein Freund hier Ernst machen. Falls Sie glauben, er hätte schon Ernst gemacht: Das war gerade nur die Aufwärmphase.«
Leo brummte seine Zustimmung.
Der kriechende Mann ließ den Kopf hängen und flüsterte etwas. Declan bat ihn, es zu wiederholen, streckte den Kopf vor und konzentrierte sich.
»Ich kenne keinen Gonzo.« Jedenfalls glaubte Declan, dass er das gesagt hatte.
»Sie kennen keinen Gonzo?«, fragte er zur Sicherheit, und der blutverschmierte Kopf von Jimmy Macfarlane nickte mühsam.
»Oh, ich fürchte, das war keine gute Antwort. Aber Sie haben noch eine Chance. Vielleicht fangen wir lieber mit der leichteren Frage an? Wer ist Ihr Boss?«
Macfarlane schüttelte den Kopf.
»Was soll das heißen? Sie haben keinen Boss?«
»Er ist der Boss!«, sagte Leo. »Na also. Dann hat der Drecksack selbst den Auftrag gegeben, Gonzo aus dem Weg zu räumen.« Leo trat dem Mann, der sich gerade so auf allen vieren hielt, in den Hintern. Er stürzte nach vorn, knallte mit dem Kopf auf den Asphalt, blieb mit ausgebreiteten Armen und von sich gestreckten Beinen liegen. Er wimmerte. Zu mehr schien ihm die Kraft zu fehlen.
»Kein Gonzo«, flüsterte er. »Kein Boss.« Dann hustete er und spuckte wieder etwas Schleim aus.
Declan erhob sich und winkte Leo Hunter und Victor Thrift zu sich. »Kann es sein, dass wir den Falschen haben und der Typ wirklich keine Ahnung hat?« Als er Leos Blick sah, fügte er schnell hinzu: »Ich will nur ganz sichergehen.«
Victor antwortete: »Der Informant ist zuverlässig und hat mehrere Quellen gecheckt. Unsere kleine Prinzessin hier«, er deutete mit dem Daumen auf Macfarlane, »arbeitet nämlich auch einem von unseren Lieferanten zu. Der weiß, wann und wo welche Lieferungen kommen, und zwar, weil er sie selbst bestellt.«
»Er arbeitet für dich?«
»Indirekt.«
»Jetzt red doch keine Scheiße. Du kennst ihn?«
»Indirekt«, wiederholte Victor stur.
»Kennst du ihn auch?«, fragte er Leo.
Der hob abwehrend die Hände. »Das sind Lieferketten. Das ist kompliziert.«
Declan sah die beiden älteren Männer an, dachte kurz nach, fragte dann: »Er beliefert auch uns?«
Leo und Victor nickten, ohne ihn anzusehen.
»Scheiße.«
Sie nickten wieder.
»Vielleicht hatte Gonzo von ihm das ganze Geld? Beliefert er auch die Neuen?«
»Kleiner, was denkst du eigentlich, warum wir so nett zu ihm sind? Natürlich beliefert er die Neuen! Mindestens!« Er drehte sich zu Macfarlane, der regungslos am Boden lag, und trat ihm auf die rechte Hand. Der Mann stieß einen langen, bebenden Laut aus, der gleichzeitig hohl und schwach klang. Declan konnte hören, wie die Fingerknochen brachen. Ihm wurde wieder etwas flau im Magen.
»Du steckst selbst hinter der ganzen Scheiße, ja? Du bist der Neue! Du zweigst dir selbst was ab und bringst es unter die Leute. Das ist unser Revier, Prinzessin. Das war eine Scheißidee von dir. Und dann auch noch Gonzo mit reinzuziehen.« Leo sah kurz Declan an, dann glitt sein Blick zu Victor. »Wen hast du noch angeworben?«
Victor ging um den Mann herum und ließ den schweren Stiefel über dessen linker Hand schweben. »Ich will Namen hören. Na los.« Er wartete einen Moment, und als Macfarlane nichts sagte, oder nichts, was irgendjemand verstehen konnte, zählte er selbst einige Namen auf. Der Mann, der am Boden lag, reagierte auf keinen. Leo mischte sich ein, betete ebenfalls die Namen derer herunter, denen er zutraute, ihn zu hintergehen. Declan war sich mittlerweile gar nicht mehr so sicher, ob es noch darum ging, herauszubekommen, was mit Gonzo geschehen war. Deshalb hatten es die beiden zur Chefsache gemacht: Wenn schon jemand den alten Boyce hinterging, lag es nahe, dass auch sie hintergangen wurden. Und sie trauten nun mal nur sich selbst. So gesehen war es fast schon eine Auszeichnung, dass sein Vater ihn geschickt hatte. Wobei Declan dieser Entscheidung nicht zu viel Gewicht beimessen wollte: Sein Vater war mit siebzig schon zu alt, um sich selbst zu prügeln, und sein großer Bruder Mick musste sich um seine kranken Zwillinge kümmern.
Victor hatte den Mann vom Boden hochgerissen und auf die Füße gestellt. Er hielt ihn wieder fest, damit er aufrecht stehen blieb. Der Mann ließ Kopf, Schultern und Arme hängen, das blonde Haar klebte an der Stirn, seine Kleidung war voller Blut und feucht von Victors Urin. Leo verpasste ihm ein paar Tritte und sang dabei ein paar Namen. Declan leuchtete vollkommen ein, dass man ihn heimlich Leo the Loony nannte, Leo, den Irren. Der Mann hing schlaff in Victors Griff und rührte sich nicht.
»Lebt der überhaupt noch?« Declan schob Leo beiseite und streckte vorsichtig die Hand aus. Er hatte wieder den Ärmel über die Finger gezogen, um keinen direkten Kontakt zu bekommen. »Hallo? Sind Sie noch da?«
Er glaubte, so was wie einen Seufzer zu hören.
Victor sagte: »Aus dem kriegen wir wohl echt nichts mehr raus. Was machen wir?«
Declan wusste es nicht.
»Ab ins Hafenbecken«, sagte Leo.
»Was? Aber er hat uns nichts gesagt!«
»Eben wolltest du noch, dass ich aufhöre«, beschwerte sich Leo.
»Aber doch nicht, um ihn … Wollen wir nicht noch einen Moment warten, bis er sich erholt hat, und dann redet er vielleicht? Ich meine, jetzt ist er so fertig, da kann er einfach nicht mehr. Oder so.«
Leo tätschelte ihm mit einem Lächeln die Schulter. »Ach Kleiner. Du bist süß. Du musst noch viel lernen.« Jetzt legte er den Arm um Declans Schultern und schob ihn ein Stück von dem Mann weg, aus dessen Mund gerade wieder blutiger Schleim tropfte. »Die Erfahrung zeigt, dass solche Typen entweder relativ zeitig oder gar nicht reden. Okay? Der da sagt nichts. Wir haben alles versucht, was üblicherweise Ergebnisse bringt. Also müssen wir ihn loswerden. Damit er nicht doch noch was sagt, und zwar im falschen Moment zu den falschen Leuten.« Jetzt grinste er, machte einen Schritt von Declan weg und breitete die Arme aus. »Und weißt du was? Wir lassen dir den Vortritt, den Verräter zu entsorgen. Dein Dad wird stolz auf dich sein, und du lernst was.«
Declan sagte nichts. Sein Blick wanderte zu den Containern, die sich gegen den mondhellen Himmel abhoben. Er dachte daran, wie schön er sie als Kind gefunden hatte, wenn er an der Küste gestanden und durchs Fernglas den Schiffen hinterhergesehen hatte, auf denen sich die bunten Container stapelten. Sie reisten um die ganze Welt. Sie waren wochenlang auf hoher See. Sie hatten etwas Geheimnisvolles. Von außen war es nicht möglich zu sagen, was in ihnen war. Damals hätte er stundenlang am Hafen stehen und zusehen können, wie Schiffsladungen gelöscht oder geladen wurden. Ab jetzt würde er mit den bunten Containern etwas anderes verbinden.
»Kleiner?« Leos Stimme holte ihn wieder zurück. »Na komm. Es ist nicht schwer. Du schubst ihn nur ins Wasser. Der Rest erledigt sich von selbst. Schwimmen kann er nicht mehr in seinem Zustand. Er säuft dann einfach ab. Glaub mir, wenn du’s einmal hinter dir hast, wird’s leichter.«
Victor rief: »Habt ihr’s jetzt mal? Mir wird der Penner hier langsam zu schwer. Soll ich ihn wieder ablegen?«
»Bring ihn an die Kaimauer.«
Declan schloss die Augen. Deshalb hatte man ihn also geschickt. Nicht weil sein Vater zu alt und sein Bruder zu beschäftigt war. Sondern weil er seine Lektion lernen sollte. Sein Bruder hatte es schon vor ein paar Jahren hinter sich gebracht. Von seinem Vater erzählte man sich voller Bewunderung, er hätte bereits mit sechzehn jemanden zu Brei geschlagen, endgültig. Jetzt war er an der Reihe. Was für eine Auszeichnung.
»Wie alt bist du eigentlich?«, fragte Leo, vielleicht hatte er seine Gedanken erraten.
»Einunddreißig.«
»Dann wird’s aber Zeit.« Leo lachte, wuschelte ihm durchs Haar, schob ihn zur Kaimauer, wo Macfarlane bereits lag, die Beine über dem Mauerrand, und Victor über ihn wachte.
»Wir sollten es wirklich noch mal versuchen, bevor wir …« Er brach den Satz ab. Ihm fiel die Flasche Wasser wieder ein. Er lief zurück zu den Containern, vor denen der Mann zusammengeschlagen worden war. Er nahm die Flasche, trabte zur Kaimauer, kniete sich neben den Mann.
»Samariterallüren oder was?« Victor klang amüsiert.
Declan schraubte die Flasche auf und goss dem Mann etwas Wasser auf die Lippen. Der Mund öffnete sich ein wenig, dann hustete der Mann, als würde er gleich ersticken.
»Hilf ihm, sich aufzusetzen«, sagte Declan zu Victor.
Der rührte sich nicht.
»Verdammt, jetzt mach schon!«
Victor kniete sich unwillig hinter den Mann und riss seinen Oberkörper hoch. Es sah aus, als würde er eine lebensgroße Stoffpuppe herumwuchten, weil der Mann gar keinen Widerstand mehr leisten konnte, gar keine Körperspannung mehr hatte. Er saß nun direkt auf der Kaimauer und lehnte schlaff an Victor.
Declan gab ihm wieder einen Schluck Wasser. Jetzt trank der Mann und hustete nicht mehr ganz so grässlich. Declan bemerkte wieder den Uringestank, der ihm stärker erschien als zuvor. Vielleicht hatte der Mann sich in die Hosen gemacht. Er wünschte, der Wind käme aus einer anderen Richtung.
»Jimmy«, sagte Declan leise. »Reden Sie mit mir. Was ist mit Gonzo passiert? Hat er für Sie gearbeitet?«
Der Mann schüttelte schwer atmend den Kopf. »Ehrlich«, flüsterte er.
»Aber Sie arbeiten auch für die Neuen, richtig? Wer ist der Boss? Sind Sie der Boss?« Declans Stimme klang ganz ruhig und verständnisvoll. Das war seine Stärke: mit Menschen zu reden. Ungefähr das genaue Gegenteil von dem, was in seiner Branche gefragt war. Jedenfalls gaben ihm ständig alle das Gefühl, dass es so war.
»Kenne Gonzo nicht«, stieß der Mann hervor.
Declan gab ihm Wasser. »Aber Sie kennen die Neuen.«
Der Mann prustete, spuckte das Wasser aus, schüttelte den Kopf. Declan glaubte ihm, dass er nichts über Gonzo wusste, aber mit den Neuen kannte er sich definitiv aus. »Also?«
»Ich kann nicht.«
»Okay, das war’s«, sagte Leo. »Komm, Kleiner. Walte deines Amtes. Tu’s für Gonzo.«
»Er hat mit Gonzo nichts zu tun.«
»Tu’s für deinen Dad!«
Declan seufzte. Er kam aus dieser Nummer nicht mehr raus. Man hatte ihm diesen Mann ausgesucht, präsentierte ihm sozusagen sein erstes Opfer auf dem Silbertablett. Wehrlos, halb bewusstlos, und nur einen Fußtritt vom sicheren Tod in der Themse entfernt. Aber er brachte es nicht über sich.
»Jimmy. Sie müssen mir irgendwas geben«, raunte er dem Mann zu. »Kommen Sie schon. Glauben Sie etwa, ich hätte Lust auf dieses Theater hier?«
Macfarlane atmete schwer, drehte mühsam den Kopf, um Declan anzusehen. Declan beugte sich zu ihm vor.
»Ich weiß nichts über Gonzo«, keuchte er.
»Ja, so weit waren wir schon, und ich glaube Ihnen. Aber …«
»Mein Boss«, sagte der Mann ganz leise, und jetzt schien er wieder etwas Körperspannung zu haben, er kippte den Oberkörper leicht nach vorn. Victor, der immer noch hinter ihm kniete, ließ ihn gewähren und zündete sich eine Zigarette an. »Mein Boss.«
»Ja?«, drängte Declan. »Wie heißt er?«
Der Mann versuchte, sich mit den Händen abzustützen. Er stöhnte auf vor Schmerz. Die gebrochenen Finger. Aber er schaffte es, sich aus eigener Kraft aufrecht hinzusetzen, während seine Beine über dem schwarzen Wasser der Themse schwebten. »Polizei«, sagte er so laut und klar, wie er konnte. Dann ließ er sich nach vorn in den Fluss fallen.
»Scheiße!«, brüllte Leo. Er kniete sich an die Kaimauer, sah nach rechts und links. »Gibt’s hier irgendwo ne Scheißleiter oder Treppen oder so was?« Er schien für einen Moment sogar den Werftkran in Betracht zu ziehen, jedenfalls sprang er auf und rannte in diese Richtung.
»Victor, warum hast du ihn nicht festgehalten?« Declan sprang auf und schlug nach Victor. Er traf den fast zwei Meter großen Mann nur leicht an der Schulter. Es war das erste Mal, dass er jemanden schlug. Es war wohl auch das erste Mal seit langer Zeit, dass sich jemand traute, Victor zu schlagen. Er ließ seine Kippe fallen und starrte Declan an.
»Kleiner! Wenn ich dir eine reinhaue, fliegst du hinter dem Dreckskerl her!« Victor schüttelte fassungslos den Kopf und rieb sich die Stelle, an der Declan ihn erwischt hatte, aber es sah eher so aus, als wollte er einen Fleck abreiben. »Mach das nie wieder! Außerdem, wir wollten ihn doch sowieso loswerden. Wo ist das Problem?«
Declan sah über die Kaimauer auf das Wasser. Macfarlane war untergegangen, von ihm war nichts mehr zu sehen. Er trieb vermutlich längst Richtung Nordsee. »Scheiße. Er ist weg.«
»Natürlich ist er weg!« Victor grunzte.