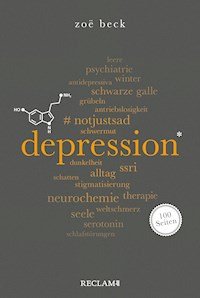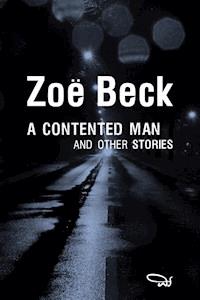13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Der Tod von Margaret Thatcher, die Occupy-Bewegung und Anonymous halten London in Atem
Emma Vine hat alles erreicht, was man als Eventmanagerin in London erreichen kann: Sie organisiert die schillerndsten Partys, vertritt die größten Stars und hat die wichtigsten Kunden im Portfolio. Doch als ihre Firma in Canary Wharf einer Cyberattacke zum Opfer fällt, erkennt Emma, dass jemand hinter ihr her ist – im Netz und in der Realität …
Als in ihrer Firma plötzlich die Klimaanlage und der Strom ausfallen und dann sämtliche Ausgänge verriegelt werden und Rauch aus den Belüftungsschächten strömt, muss Emma hilflos zusehen, wie ihre Freundin panisch aus dem 15. Stock des Luxushochhauses springt. Kurz darauf wird Emma verhaftet. Sie soll sich in die Gebäudetechnik gehackt und die Katastrophe ausgelöst haben. Emma sieht sich einer Intrige ausgesetzt. Als dann ein weiteres Attentat verübt wird, bei dem sie selbst das Ziel war, beschließt Emma zurückzuschlagen. Eine erste Spur führt nach Brixton Hill, zu Allen, der sie schon seit Wochen stalkt. Doch sehr schnell kommt Emma einem Verbrechen auf die Spur, bei dem es um sehr viel Geld geht und bei dem ihre eigene Familie eine ganz eigene Rolle spielen könnte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 380
Ähnliche
Cover
Titel
Zoë Beck
Brixton Hill
Thriller
Suhrkamp
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
Der vorliegende Text ist eine Neuauflage des 2014 unter demselben Titel beim Wilhelm Heyne Verlag, München, erschienenen Romans.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2024
Der vorliegende Text folgt der 1. Auflage des suhrkamp taschenbuchs 5425.
Neuausgabe© Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2024
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung: zero-media.net, München
Umschlagfoto: FinePic®, München
eISBN 978-3-518-77888-3
www.suhrkamp.de
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Cover
Titel
Impressum
29. März 2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
30. März 2013
10
11
8. April 2013
12
13
14
15
16
17
18
9. April 2013
19
10. April 2013
20
21
11. April 2013
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
12. April 2013
33
34
35
36
37
38
16. April 2013
39
40
17. April 2013
41
42
43
44
45
1. Mai 2013
46
Informationen zum Buch
Brixton Hill
29. März 2013
1
Es ist nicht der Aufprall, an den man sich später erinnert. Was man immer wieder vor sich sehen wird, ist der Moment des freien Falls.
Und man wird die Stille dieses Moments hören. Denn die Welt hört auf, sich zu drehen. Alles ist ruhig.
Nur der Körper fällt, schwebend, lautlos.
2
Dabei war Kimmy Rasmussen überhaupt nicht lebensmüde. Warum auch. Kimmy stand mindestens fünfmal am Tag zufrieden, wenn nicht sogar glücklich am Fenster ihres neuen Büros im fünfzehnten Stock des Limeharbour Tower und schaute hinaus. Vor ihr, oder eigentlich unter ihr, die Großbaustelle für den nächsten Tower, dahinter die vergleichsweise niedrigen alten Wohnblocks und Reihenhäuser, wie man sie in ein paar Jahren hier nicht mehr finden würde. Auch nicht die Menschen, die darin lebten.
Die strenge, klare Architektur der Wolkenkratzer von Canary Wharf hatte Kimmy von Anfang an geliebt. Und auch wenn sie erst einmal mit einem Randplatz vorliebnehmen musste, auch wenn der Ausblick in die falsche Richtung ging – zur Baustelle statt zum One Canada Square –, war Kimmy Rasmussen weit davon entfernt, sich schlecht zu fühlen oder gar ihr Leben beenden zu wollen.
Sie wartete auf Emma Vine, der allein sie es zu verdanken hatte, dass sie den neuesten Auftrag für ihre Agentur an Land ziehen konnte. Vor einem halben Jahr etwa hatten sie sich auf einer Veranstaltung kennengelernt und auf Anhieb gut verstanden. Em war die Frau in der Entertainmentbranche, wenn es darum ging, Liveshows zu inszenieren. Rockstars, Fashion Events, Filmpremieren – Em hatte alle großen Namen in ihrem Portfolio. Kimmy war weniger künstlerisch kreativ, hatte dafür aber ein Händchen für Finanzen und einen Instinkt für gute Geschäfte. Die perfekte Ergänzung.
Das war die berufliche Seite. An Kimmys Privatleben gab es, zumindest seit einigen Monaten, ebenfalls nichts auszusetzen. Nach einer Reihe unbedeutender Liebhaber war sie nun auf einen getroffen, der möglicherweise der vielzitierte Richtige war. Wie sie war er gebürtiger Kanadier, und wie sie liebte er London, gutes Essen und harten Sex.
Außerdem verstand sie sich gut mit ihren Eltern und ihren beiden Brüdern, erfreute sich bester Gesundheit und bewohnte mit zwei netten Spanierinnen ein hübsches Apartment in Bermondsey. Und wie schon erwähnt, würde sie gleich Emma Vine in ihrem Büro empfangen, um auf den gewonnenen Pitch anzustoßen und die Einzelheiten der Projektumsetzung zu besprechen: die Verleihung der British Academy Film Awards. So etwas wie die Oscarverleihung, nur eben in England. Kimmy hatte keine Angst vor dieser Aufgabe, von der manche denken mochten, sie sei zu groß für ihre vergleichsweise kleine Agentur. Sie freute sich darauf. Sie war stolz. Sie hatte Pläne. Sie hoffte darauf, Em für eine dauerhafte Zusammenarbeit gewinnen zu können.
Es gab also wirklich keinen Grund für Kimmy Rasmussen, unglücklich zu sein. Trotzdem würde sie in weniger als einer Stunde aus dem Fenster des fünfzehnten Stocks springen.
Vermutlich fing alles an, als das Internet streikte. Vielleicht war es aber auch zuerst die Klimaanlage, die ausgefallen war. Irgendwann bemerkte Kimmy, dass sich die Temperatur im Raum verändert hatte. Sie hielt schon den Telefonhörer in der Hand und wollte die Nummer des Portiers wählen, als Em hereinkam und sagte:
»Leg wieder auf. Ich weiß, ich bin spät.«
»Ich wollte gar nicht dich anrufen«, sagte Kimmy und legte auf.
»Ich bin mit dem Fahrstuhl stecken geblieben.« Em zog den schwarzen Ledermantel nicht aus. »Kalt habt ihr’s hier drin.« Sie ließ sich auf den Besucherstuhl vor Kimmys Schreibtisch fallen und schlug die langen Beine übereinander.
»Was?!«
»Nicht so kalt wie draußen, aber …«
»Nein, ich meine den Aufzug.«
Em verdrehte die Augen und winkte ab. »Das hat keine halbe Minute gedauert.«
Kimmy schüttelte den Kopf. »So etwas darf nicht passieren. Und dann?«
»Dann ging’s weiter. Einfach so.«
»Hast du den Alarm …«
»Nein. Ich dachte, ich warte erst mal ab.«
So war Em: überlegt, kühl. Kimmy fragte sich, was passieren musste, um sie aus der Reserve zu locken. Und wie es wohl in ihr aussah.
»Ich hätte nach einer Viertelsekunde den Alarmknopf gedrückt.«
Em grinste und lehnte sich zurück. Kimmy nahm wieder den Telefonhörer auf, doch der Portier wusste auch nur zu berichten, dass es kleinere Störungen im ganzen Tower gab, um die man sich unverzüglich kümmern würde.
Als Kimmy wenige Minuten später die Eventkalkulation auf dem Server ihres Rechners aufrufen wollte, reagierte dieser immer noch nicht. Dann wurde der Bildschirm schwarz. Sie konnte auch nicht mehr telefonieren. Kimmy wollte etwas zu Em sagen, doch laute Rufe vom Flur schnitten ihr das Wort ab. Em sprang auf und lief aus dem Büro. Kimmy brauchte einen Moment. Etwas hielt sie fest, eine alte Angst, die sich regte. Sie musste sie abschütteln, um Em zu folgen.
»Jemand steckt im Aufzug fest«, sagte Jono, einer ihrer Praktikanten, als sie zu ihnen kam. Ihr Buchhalter hämmerte sinnlos gegen die geschlossenen Aufzugstüren. Dahinter hörte man eine Frau aufgeregt rufen.
»Bestimmt geht es gleich weiter«, sagte Em. »Vorhin ist er auch schon mal kurz stecken geblieben.«
Die Frau aus dem Off rief weiter um Hilfe.
»Im ganzen Gebäude ist der Strom ausgefallen«, sagte Jono. »Das Internet streikt auch.«
»Wozu hat man Smartphones?«, sagte jemand im Hintergrund.
Kimmy sah, wie Em die Schultern hochzog. »Wir können nur hoffen, dass sich schnell jemand darum kümmert.« Sie schob den Mann, der weiter gegen die Aufzugstür schlug, beiseite und sagte zu der eingeschlossenen Frau, Hilfe sei unterwegs, sie solle sich möglichst ruhig verhalten. Es half nichts, die Frau schrie weiter.
»Panikattacke«, sagte Em, und Kimmy musste denken, dass Em bestimmt noch nie in ihrem Leben eine Panikattacke gehabt hatte. Nicht Em.
Für Kimmy war Angst eine Zeit lang ihr ständiger Begleiter gewesen. Der Grund dafür lag allerdings schon viele Jahre zurück. Damals hatte sie noch in Toronto gelebt. Mit ihrem Freund war sie abends im Bovine Sex Club verabredet gewesen, einem angesagten Indie-Club, der zwischen Chinatown und dem Fashion District lag. Es sollte eine junge kanadische Band namens Metric auftreten, und was Kimmy vorab von der Band gehört hatte, gefiel ihr. Sie freute sich auf den Abend.
Das Konzert fand nicht statt, denn irgendjemand versprühte Reizgas. Massenpanik brach aus. Kimmy stürzte zu Boden, und die Leute trampelten über sie hinweg. Sie spürte, wie ihre Rippen brachen, und das Atmen fiel ihr schwer, nicht nur wegen der Schmerzen, sondern auch, weil das Gas in Nase und Hals brannte. Es dauerte eine gefühlte Ewigkeit, bis jemand sie hochriss und hinaustrug, doch bis dahin hatte sie schon so schlimme Quetschungen und Prellungen besonders im Bereich der Wirbelsäule erlitten, dass sie drei Monate lang im Krankenhaus liegen musste.
Während der ersten Wochen war sie überzeugt gewesen, nie wieder laufen zu können. Sie hatte kein Gefühl in den Beinen. Sie versuchte, sich ein Leben im Rollstuhl vorzustellen. Man gab ihr Antidepressiva und Beruhigungsmittel, damit sie diese Gedanken ertrug. Ihr Freund erwies sich wieder einmal als Feigling – nicht er hatte sie aus dem Club gerettet, wie sie nun wusste, sondern ein Fremder – und verließ sie. Kimmy hielt ihn nicht auf. Tag für Tag lag sie da, starrte an die Decke, weinte, haderte, hasste.
Aber es kam alles in Ordnung. Die Schwellungen gingen zurück, sie spürte ihre Beine wieder, nichts war dauerhaft geschädigt. Nur die Angst hatte sich festgesetzt. Man attestierte ihr eine posttraumatische Belastungsstörung und schickte sie zur Therapie. Sie brauchte lange, bis sie sich wieder in Menschenmengen traute. Bis sie nicht mehr in jedem Gebäude als Erstes überprüfte, wo die Notausgänge waren. Keine Heulkrämpfe mehr bekam, wenn im Fernsehen Bilder von Tränengaseinsätzen gegen Demonstranten zu sehen waren. Heute, gute zehn Jahre später, waren diese Ängste nur noch ein Schatten, jedenfalls bis zu dem Zeitpunkt, als der Feueralarm im Limeharbour Tower losging.
Rauch quoll in den Flur.
Kimmy hörte nicht, was Em zu ihr sagte. Sie starrte auf den sich ausbreitenden weißen Nebel und versuchte zu verstehen, was gerade geschah. Wo sie war. Für einen Augenblick sah sie nämlich die leere Bühne vor sich, die bunten Scheinwerfer, wie vor zehn Jahren im Bovine.
Um Kimmy herum aufgeregtes Schreien, atemloses Husten. Sie spürte, wie sich ihre Kehle verengte. Sie wollte nicht atmen müssen, gleichzeitig forderte ihr Körper, dass sie es tat, und kaum dass sie Luft geholt hatte, brannten ihre Schleimhäute, als hätte man sie verätzt.
Tränengas. Oder Schlimmeres. Gift. Dieser Rauch war vergiftet. Die Bühne blitzte wieder auf, und Kimmy hörte das anschwellende Gemurmel Hunderter Menschen. Jemand schrie: »Raus hier, sofort!«, und Kimmy sah sich nach der Stimme um. Vier oder fünf ihrer Kollegen, sonst war dort niemand. Sie konnte nicht ausmachen, wer gerufen hatte. In ihren Ohren rauschten unzählige Stimmen durcheinander, alle in Angst, alle in Not.
Sie drückte sich gegen die Wand. Wusste, dass sie sterben würde. Wenn sie hier noch weiter dieses Gift einatmete, würde sie sterben. Sie spürte, wie es in ihren Körper kroch. Es zerstörte sie von innen, lähmte die Muskeln. Ließ sie Dinge sehen und hören, die nicht sein konnten.
Jemand rief: »Die Notausgänge sind blockiert.« Diesmal konnte sie die Stimme zuordnen. Es war der Buchhalter.
Kimmy sah sich weiter um, den Körper fest gegen die Wand gepresst. Sie sah Em, die sich um Jono kümmerte, der nun mit geschlossenen Augen auf dem Boden lag.
Auf dem Boden.
Wieso lag er auf dem Boden?
Immer mehr Menschen drängten aus ihren Büros auf den Flur. Sie schlugen gegen die verriegelten Türen zum Treppenhaus, gegen die Aufzugtüren, gegen die Fenster. Manche telefonierten nervös. Manche schrien herum. Kimmy kannte sie alle. Und doch konnte sie die Gesichter nicht auseinanderhalten. Sie versanken in einer konturlosen Menschenmenge, ein Bild, das sich wie ein Schleier über ihren Blick legte und die Perspektiven verrückte. Wieder hörte sie jemanden rufen. »Raus hier, sofort!« Sie schloss die Augen, weil sie niemanden mehr sehen wollte, und versuchte, nicht zu atmen.
Die Bühne.
Noch leer, aber die Scheinwerfer waren bereits eingeschaltet.
Lichtprobe, sagte ihr Freund. Ein Roadie erschien, und die Menge wollte schon klatschen, doch der Junge winkte ab. Dann rief jemand: »Raus hier! Sofort!« Kimmy sah sich um. Von der rechten Bühnenseite aus drang feiner weißer Nebel in den Club. Der Roadie fiel auf die Knie und hielt sich schreiend die Hände vors Gesicht. Der Nebel kam nun aus zwei oder drei anderen Richtungen.
Mehr Schreie, mehr Rufe. Die Menge bewegte sich aufeinander zu. Kimmy war für einen Moment eingekesselt, dann stieß jemand sie zu Boden.
Sie lag auf dem Boden.
Füße traten auf sie ein.
Sie würde sterben.
Kimmy spürte das Gas in ihren Lungen. Wie es sich immer tiefer in Nase und Rachen hineinbrannte. Ihr wurde schwindelig, sie fühlte sich, als würde sie gleich umkippen. Kimmy riss die Augen auf. Blinzelte. Sie sah ihre Umgebung nur noch verschwommen, wenn überhaupt. Der Feueralarm konnte die Stimmen der Menge nicht betäuben. Wenn sie erst einmal auf dem Boden lag, würde es zu spät sein. Diesmal würde sie es nicht überleben. Diesmal würden sie ihr das Rückgrat brechen, wenn sie nicht schon vorher erstickte.
Atmen konnte sie kaum noch.
Kimmy Rasmussen war davon überzeugt, in diesem Moment die einzig richtige Entscheidung zu treffen. Gerade bekam sie eine zweite Chance, das war offensichtlich. Sie hielt sich ihr Halstuch vor Mund und Nase und lief durch den Nebel in Richtung ihres Büros. Jemand versuchte, sie festzuhalten, aber sie machte sich los und rannte weiter. Es war laut, alle schrien durcheinander, Hunderte Stimmen, Hunderte Menschen, die alle zum Konzert gekommen waren. Heute würde sie sich nicht aufhalten, nicht zu Boden reißen lassen. Kimmy hatte aus ihren Fehlern gelernt. Es gab nur einen Weg: raus.
Denn sie hatte sich längst in ihrem Kopf verlaufen, war nicht mehr im Limeharbour Tower auf der Isle of Dogs, sondern im Bovine in Toronto. Ein Zustand, der sich in zehn Minuten vermutlich wieder gelegt hätte.
Niemand hielt sie mehr auf, als sie ihr Büro betrat, einen Feuerlöscher nahm und ihn mit aller Kraft so lange gegen die Fensterscheibe schlug, bis das Sicherheitsglas zerbrach. Kimmy warf einen letzten Blick zurück. Sie sah nur dichten Rauch, roch das tödliche Gas, wusste, dass es keinen anderen Weg der Rettung gab, glaubte, dass vor ihr auf gleicher Ebene die Straße lag.
Als Em mit ein paar anderen durch diesen Nebel trat, war Kimmy schon gesprungen.
3
Vor zwanzig Jahren war es noch schwer vorstellbar gewesen, in den heruntergekommenen Docklands zu wohnen, wenn man dort nicht aufgewachsen war. Vor zehn Jahren hatte man sich an den Gedanken gewöhnt.
Die Verbesserung der Infrastruktur wurde durch einen führerlosen Zug erzielt. Die Hochhäuser bekamen eigene Fitnessräume und einen Einkaufsservice.
Unter dem höchsten Hochhaus, dem One Canada Square, entstand eine Shoppingmall der oberen Preisklasse.
In der U-Bahn-Station liefen Kurzfilme.
Canary Wharf war zum zweiten Finanzzentrum der britischen Hauptstadt geworden. Wer heute hier seine Büroräume eröffnete, dachte in Millionen und Milliarden. Wer hier wohnte, dachte in 80-Stunden-Wochen.
Emma Vine wohnte dort seit einem Jahr. Der krude Charme der Isle of Dogs. Die Romantik des Verfalls einerseits, das Versprechen der glänzenden Wolkenkratzerfassaden von Canary Wharf andererseits. Es gefiel ihr. Sie mochte Gegensätze. Veränderung.
Wenn sie aus dem Fenster ihrer Wohnung schaute, dann sah sie Wasser und Hochhausfassaden und die O2-Arena auf der anderen Seite der Themse.
Canary Wharf war der Mittelpunkt der Isle of Dogs. Der neue Londoner Osten. Das Herzstück der Docklands: Es wuchs immer weiter, es würde noch zwanzig Jahre lang eine Großbaustelle sein.
Man hatte nur vergessen, tatsächlich ein neues Herz einzupflanzen. Wenn man ganz genau hinsah, war Canary Wharf tot.
4
Der Limeharbour Tower war nicht weit von Ems Wohnung entfernt, aber sie durfte nicht nach Hause.
»Zu gefährlich«, hieß es.
»Personalien müssen aufgenommen werden.«
»Es ist zu Ihrer eigenen Sicherheit.«
Jeder hatte eine Antwort, die keine war.
Em wurde eine Decke über die Schultern gelegt. Sie wollte keine.
»Es ist besser für Sie«, sagte der Polizist und lächelte sie an.
Em gab die Decke wortlos zurück. Sie war mit den anderen, die sich im Limeharbour Tower aufgehalten hatten, in einen Büroblock in der Nähe gebracht worden und half nun mit, dem marmornen Foyer den Charme eines Flüchtlingslagers zu verleihen. Überall Decken und Plastikbecher mit süßem Tee: Es musste eine Katastrophenschutzeinheit geben, die nur zum Teekochen abgestellt war. Polizisten und Sanitäter bewegten sich durch Hunderte von Menschen. Jemand sagte, in den oberen Etagen seien noch mehr untergebracht. Über allem lag ein Raunen, das tiefer klang als sonst bei Menschenmengen üblich. Keiner sprach wirklich laut. Einzelne Schluchzer, mal aus der Nähe, mal weiter entfernt, brachen gelegentlich das dumpfe Surren auf. Em registrierte die unruhigen Blicke der bleichen Gesichter. Nicht zu wissen, was geschehen war, bedeutete für alle die größere Katastrophe. Em fragte sich, wer von Kimmys Tod wirklich betroffen war.
Jono kam auf sie zu und lächelte unsicher. Seine Augen waren rot. Vom Weinen, das wusste sie. Er weinte wirklich wegen Kimmy.
»Ich komm mir so blöd vor«, sagte er. »Da werd ich einfach ohnmächtig, und weil alle um mich rumstehen, merkt keiner, dass Kimmy …« Er hatte wieder Tränen in den Augen. »Sorry«, murmelte er und wischte sich übers Gesicht. »Du bist so … ruhig. Hattest du keine Angst?«
»Doch. Aber nicht davor, zu sterben.«
Jono kaute auf seiner Unterlippe herum. »Ich weiß echt nicht, was da mit mir los war.«
»Panik.«
»Aber Kimmy …«
»Ich weiß es nicht«, sagte Em. »Auch Panik. Nur schlimmer.« Eine Weile betrachtete sie wieder die Menschen, die um sie herum waren. Frauen, die sich hilflos gaben. Männer, die galant wirken wollten. Wie Extremsituationen die Gesellschaft doch um mindestens hundert Jahre zurückwarfen. Bei aller Sympathie und Begeisterung für die Wissenschaft wollte Em nicht glauben, dass Männer die geborenen Versorger waren. Auch wenn alles gerade danach aussah.
Jono schien ihre Gedanken zu lesen.
»Ich bin echt ein Mädchen, was?« Es sollte wohl wie ein Scherz klingen.
»Nicht lustig«, sagte Em.
»Sorry.« Er lehnte sich an eine der Marmorsäulen und glitt daran herunter. »Ich hab noch nie gesehen, wie jemand …«
»Du hast es nicht gesehen«, unterbrach sie ihn.
»Aber …«
»Ich hab sie fallen gesehen, okay? Du hast überhaupt nichts gesehen.«
Er schwieg eine Weile. Dann sagte er, mehr zu sich: »Doch nicht so cool.«
»Nein. Nicht wirklich.«
»Aber du wirkst immer so.«
»Jahrelange Übung.«
Er nickte gedankenverloren, als wüsste er genau, was sie meinte. Em hockte sich neben ihn, betrachtete ihn von der Seite. Vorhin, als er ihr ohnmächtig vor die Füße gefallen war, hatte sie sich darauf konzentriert, ihn in eine stabile Position zu bringen, sich darum gekümmert, dass er wieder zu sich kam. Sie hatte jemandem zugerufen, er solle Wasser aus dem Wasserspender neben dem Aufzug holen. Von einem anderen forderte sie das Jackett, um es Jono unter den Kopf zu legen. Die beiden Männer waren froh gewesen, Anweisungen zu bekommen, und hatten diese dankbar, fast schon glücklich ausgeführt. Sie halfen, weil es ihnen selbst half, vor der eigenen Angst zu fliehen.
Jono war ein hübscher Junge, Anfang zwanzig, sehr schlank, mit der Figur eines Balletttänzers. Dunkle Locken, dunkle Augen, helle Haut. Südafrikaner mit portugiesischen und englischen Wurzeln. Seit einem Monat machte er ein Praktikum in der Buchhaltung der Agentur, hatte er erzählt, und er hatte schnell gemerkt, dass es nicht das Richtige für ihn war. Trotzdem hatte er das Praktikum durchziehen wollen. Wem er damit etwas beweisen wollte, wusste Em nicht, und sie hatte ihn auch nicht danach gefragt. Vielleicht sollte sie es jetzt tun, um ihn abzulenken. Und sich selbst ebenfalls.
»Was hast du eigentlich vor?«
Jono sah sie fragend an.
»Ich meine, das Praktikum wirst du wohl abbrechen.«
»Du fragst mich jetzt, was ich vorhabe?«
Sie antwortete nicht und wandte den Blick von ihm ab. Das mit dem Ablenken hatte schon mal nicht funktioniert. Am liebsten würde sie gehen. Gleichzeitig wollte sie nicht allein sein. Aber eben auch nicht unter Menschen. Nicht so jedenfalls.
»Wollen Sie einen Tee?«
Sie sah auf, ein Sanitäter stand vor ihnen. Er fragte schon zum vierten Mal, er konnte sich die vielen Gesichter nicht merken. Diesmal nahm sie ihm den Plastikbecher ab, dankbar, dass er ihre Gedanken unterbrochen hatte, und reichte ihn weiter an Jono. Sie lehnte sich mit der Wange gegen die kühle Marmorsäule und überlegte, ob sie jemanden anrufen sollte. Ihren Bruder. Oder einen Freund. Um mit jemand anderem als Jono zu reden, weil der Junge es am Ende noch schaffen konnte, sie ebenfalls zum Weinen zu bringen. Sie entschied sich dagegen, nahm trotzdem ihr Telefon aus der Manteltasche und ging online, um zu sehen, ob sie in den Nachrichten was über Kimmy brachten. Em hatte vor fünf Minuten schon nachgesehen. Und vor zehn Minuten. Ständig, eigentlich. Offiziell gab es nichts Neues. Sie wechselte zu Twitter, gab probehalber ein paar Suchbegriffe ein und las sich durch, was die anderen, die irgendwo hier mit ihr in diesem Marmorfoyer mit einer Decke über den Schultern dasaßen, getwittert hatten. Von »Giftgas« hatte jemand geschrieben. »Terroranschlag«, behauptete ein anderer. Em wusste es besser. Weil die meisten Meldungen unter dem Suchbegriff #canarywharf erschienen, benutzte sie ihn ebenfalls und schrieb:
kein giftgas, nur rauchpatronen #canarywharf
Sie brachte es nicht über sich, etwas über Kimmy zu schreiben, und sie ärgerte sich darüber, dass Dutzende in einer Art Pseudo-Massentrauer Dinge wie
RIP kimberly rasmussen #canarywharf
mit einem Link auf Kimmys Agentur in die digitale Welt hinauswarfen. Ohne sie überhaupt gekannt zu haben. Wer sie wirklich kannte, würde so etwas nicht machen. Aber jemand hatte gleich nach dem Sprung ihren Namen veröffentlicht. Lange bevor die Rettungskräfte eingetroffen waren, war ein Tweet abgesetzt worden.
Agenturchefin Kimberly Rasmussen: tödlicher Sprung aus 15. Stock
Die Presse hatte den Namen sofort aufgenommen und alles über Kimmy ausgegraben, was sich auftreiben ließ.
Es gab keine Geheimnisse mehr im 21. Jahrhundert. Jedenfalls nicht, wenn Menschen mit internetfähigen Geräten in der Nähe waren.
Als Em von ihrem Display aufsah, stand eine uniformierte Polizistin vor ihr. Sie hielt einen Block in der Hand, lächelte nicht und sagte: »In welchem Stockwerk waren Sie?«
»Im fünfzehnten.«
»Sehen Sie sich in der Lage, ein paar Fragen zu beantworten?« Dies nicht fürsorglich, eher rhetorisch.
Em nickte und stand vom Boden auf.
»Ihre Personalien haben wir schon aufgenommen?«
Sie nickte wieder und steckte das Telefon weg. Jono erhob sich unsicher. Seine Beine knickten ein. Sie hielt ihm die Hand hin und half ihm auf.
»Wenn Sie sie mir noch einmal geben könnten, damit ich Ihre vorläufige Aussage aufnehmen kann.«
Em nannte ihren Namen, die Adresse, das Geburtsdatum. Sie erklärte ihren Beruf, warum sie mit Kimmy verabredet gewesen war und dass sie sich um den ohnmächtigen Praktikanten gekümmert hatte, als Kimmy das Fenster eingeschlagen hatte. Dann war Jono an der Reihe, der sich sichtlich unwohl fühlte, der ohnmächtige Praktikant zu sein.
»Was können Sie zum Hergang der … Situation sagen?«
»Sie war allein in ihrem Büro, soweit ich das in dem dichten Rauch erkennen konnte«, antwortete Em. »Ich hab nur schemenhaft gesehen, wie sie auf die Fensterbank geklettert ist. Niemand hat ihr dabei … geholfen.«
»Haben Sie versucht, sie davon abzuhalten?«, fragte die Polizistin. Sie hatte die langen braunen Haare zu einem Zopf geflochten, und ihr Gesicht hätte hübsch sein können, wären ihre Augen nicht so ausdruckslos gewesen.
Em unterdrückte den Impuls, ihr Jonos Tee über den Notizblock zu kippen. »Wir waren zu sehr damit beschäftigt, Wetten abzuschließen, ob sie wirklich springt.«
Jono unterdrückte einen Laut. Die Polizistin hob den Blick, und Em sah, dass Sarkasmus bei dieser Frau elend verhungerte. »Natürlich habe ich es versucht. Oder wir. Wir haben gerufen, sie soll da wieder runterkommen.«
»Hat sie noch etwas gesagt?«
»Sie meinen, ob sie eine Abschiedsrede gehalten hat?«
»Ms Vine, ich weiß, die emotionale Anspannung ist sehr groß, aber könnten Sie sachlich bleiben?« Die Polizistin klang nicht mal gereizt, nur müde.
Em entschuldigte sich bei ihr.
»Ich hatte den Eindruck, dass sie uns gar nicht bemerkt. Sie hat sich nicht nach uns umgedreht und auch nicht gezögert. Sie ist einfach gesprungen. Wir waren zu spät.«
Die Polizistin sah sie nicht an, sie machte sich nur Notizen. Beim Schreiben bewegte sie die Lippen, wie um sich die Wörter vorzusagen. Den Stift umklammerte sie wie einen Meißel. Die Buchstaben, die sie in ihren Block gravierte, waren groß und rund. Ihre Fingernägel waren sehr kurz und wirkten abgekaut.
»Warum müssen wir hierbleiben?«, fragte Jono.
»Weil wir die Möglichkeit eines Terroranschlags nicht ausschließen können«, sagte die Polizistin.
»Und wir sind hier, weil wir geschützt werden sollen, oder weil man uns verdächtigt?«
Jetzt sah die Polizistin von ihrem Block auf, Jono direkt in die Augen, und sie schien sich zu fragen, warum jemand, der vorhin noch so schwach und verletzlich gewirkt hatte, mit einem Mal so nerven konnte. »Sie sind zu Ihrer eigenen Sicherheit hier und weil wir ausschließen wollen, dass Sie etwas mit dem Anschlag zu tun haben«, antwortete sie. Ausweichend.
»Aber es waren doch nur Rauchpatronen«, sagte Em. »Ein Terroranschlag mit Rauchpatronen, glauben Sie das wirklich?«
Die Polizistin straffte die Schultern und stellte sich etwas breitbeiniger hin.
Unbewusste Vorgänge. Wie viel sie über uns verraten, dachte Em.
»Woher wissen Sie das?«
»Das konnte man riechen. Und sehen. Ich arbeite dauernd mit dem Zeug. Nebelmaschinen. Pyrotechnik.«
»Trotzdem war es ein Anschlag. Können Sie bestätigen, dass vor dem Unfall der Strom …«
»Vor dem was?«, unterbrach Em.
»Vor dem Vorfall«, verbesserte sich die Polizistin. »Dass vorher schon ungewöhnliche Dinge passiert sind?«
Jono sagte: »Klar, der Strom war ausgefallen, und eine Frau steckte im Fahrstuhl fest. Und das Internet, also der Server war nicht erreichbar. Und, na ja, die Klimaanlage, und hat nicht jemand erzählt, dass auf dem Klo sogar das Wasser abgestellt war?«
»Das Wasser war abgestellt?«, fragte Em.
»Ich weiß nicht. Vielleicht auch nicht.« Jono klang unsicher.
»Wann fing das alles an?«, fragte die Polizistin.
Er überlegte. »Eine Viertelstunde, zwanzig Minuten vorher?«
»Die Notausgänge waren blockiert«, sagte Em.
»Wie kann so was überhaupt passieren?« Jono machte eine ausladende Geste. Der Tee schwappte aus seinem Becher. Ein paar Spritzer landeten auf dem Notizblock der Polizistin. Sie sah Jono nicht an, als sie mit dem Ärmel ihrer Uniform die Flüssigkeit abtupfte. »Ich meine, die Aufzüge, okay, die brauchen Strom, aber die Türen?«
»Das Gebäude hat offenbar einen Schließmechanismus, der die feuerfesten Türen zum Treppenhaus hin zentral verriegelt.«
»Damit man, wenn es brennt, nicht abhauen kann?«, fragte Jono, und diesmal schwappte der Rest des Tees auf die Schuhe der Frau.
»Damit das Feuer auf der Etage eingedämmt und der Fluchtweg über die Treppe nicht abgeschnitten wird«, sagte die Polizistin und sah dabei auf ihre nassen Schuhspitzen. »Es gibt ja noch die Nottreppe.«
»Zu der die Tür aber auch verschlossen war«, sagte Em. »War das auf allen Etagen so? Und der Rauch, war der auch überall?«
Die Polizistin nickte. »Überall dasselbe. Das mit den Notausgängen muss noch untersucht werden.«
»Überall? Wie viele Rauchpatronen waren das denn? Ich meine …«
»Ich glaube, das war jetzt erst mal alles«, schnitt ihr die Polizistin das Wort ab. Sie nickte den beiden knapp zu und ging weiter.
»Wie will sie hier den Überblick behalten?«, fragte Jono.
»Oder die anderen?« Em deutete auf die Uniformierten, die sich nach und nach mit ihren Notizblöcken durch die Menge frästen. Vor dem Gebäude langweilte sich schon seit Stunden die Presse, und Em fragte sich, was wohl gerade in dem geräumten Bürotower geschah. Sehr weiträumig war nicht abgesperrt worden, eine Bombe befürchtete man also nicht.
Mitten in London, und keiner hatte Angst vor einer Bombe. Es gab immer wieder etwas, das einen staunen ließ.
Wieder zog sie ihr Telefon hervor, wieder sah sie nach, was es Neues gab. Ein paar Leute verhöhnten sie auf Twitter, weil sie etwas von Rauchpatronen geschrieben hatte. Ob sie noch an Märchen glaube. Ob sie überhaupt dabei gewesen sei. Jemand schrieb:
@em_vine geht es dir gut? bist du verletzt? brauchst du hilfe? #canarywharf
Der Absender: eine wirre Zahlen- und Buchstabenkombination, das Twitterprofil offensichtlich neu angelegt. Kein Profilfoto, keine Follower, und nur eine Person, der er folgte: natürlich ihr.
Sie wusste, wer es war. Er hatte jeden Tag einen anderen Twitteraccount, eine andere Mailadresse.
Jono stieß ihr mit dem Ellenbogen in die Seite. »Da will jemand was von uns.«
Sie sah vom Display auf. Der Junge zeigte auf den Eingang des Foyers, wo sich die Uniformierten um einen Mann im Anzug scharten. Es hätte nach einer Einsatzbesprechung aussehen können, wären nicht alle Blicke der Polizisten auf Em und den Praktikanten gerichtet. Der Mann im Anzug löste sich von der Gruppe und kam auf sie zu, die uniformierte Polizistin von eben im Schlepptau.
»Emma Vine?«
Em nickte und schluckte das ungute Gefühl hinunter.
»Detective Constable Cox, Scotland Yard. Wenn Sie mich bitte begleiten würden.«
Sie sah ihn fest an. »Wohin?«
»Es gibt hier einen Raum, in dem wir uns ungestört unterhalten können.«
Em wusste längst, dass etwas schieflief, aber Jono begriff es erst in diesem Moment. »Hä? Was soll das jetzt?«, fragte er, seine Stimme klang schrill.
»Also, gehen wir?« Cox wies mit der rechten Hand die Richtung.
Sie rührte sich nicht. »Was ist los?«, fragte sie, und auch ihre Stimme kam ihr etwas zu schrill vor.
»Wir haben nur ein paar Fragen an Sie. Detective Chief Inspector Palmer wird auch gleich da sein.«
»Ein DCI? Brauche ich einen Anwalt?«
Cox zögerte. Aus der Nähe sah man seinem Anzug an, dass er oft getragen und viel strapaziert war. Er konnte nicht sehr viel gekostet haben. Cox selbst war jünger als Em – Ende zwanzig. Er war so groß wie sie, aber sehr viel breiter gebaut, dabei nicht unsportlich. Mittelblondes kurzes Haar, sorgfältig gestylt, und stechende grüne Augen. Schließlich sagte er zu der uniformierten Polizistin: »Durchsuchen.«
Em trat instinktiv einen Schritt zurück und hob abwehrend die Hände. Die Polizistin blieb auf Abstand. Vermutlich nur, weil hinter Ems Rücken längst zwei weitere Polizisten standen, was ihr ein Blick über die Schulter verriet.
»Was soll das?«, rief Em.
Cox schien selbst ganz überrascht von dem, was er gerade gesagt hatte. Er schnaufte und bedeutete der Polizistin mit einer knappen Handbewegung, sich nun doch endlich Em zu widmen. Diesmal zögerte die Polizistin nicht, und Em stand Sekunden später mit dem Gesicht gegen die Marmorsäule gepresst. Die Polizistin ertastete Ems Telefon und steckte es ein, zusammen mit ihrem Schlüsselbund.
»Was soll das?«, wiederholte sie und versuchte, den Kopf so zu drehen, dass sie Cox sehen konnte.
»Sauber«, sagte die Polizistin.
»Festnehmen«, sagte Cox.
»Sind Sie verrückt?« Em schrie jetzt. Ihr Blick fiel auf Jono, der mit offenem Mund danebenstand.
Die Polizistin riss sie an der Schulter herum, und einer ihrer Kollegen legte Em Handschellen an.
»Warum? Warum werde ich verhaftet?«
»Wo soll ich da anfangen«, sagte Cox, als hätte er absolut keine Ahnung. Dann schien er sich eines Besseren zu besinnen. »Erst einmal wegen versuchter Körperverletzung in mindestens fünfhundert Fällen und fahrlässiger Tötung. Vielleicht wird noch Mord daraus. Nehmt sie mit.«
»Sie sind doch wahnsinnig!«, rief Em. »Jono! Ruf meinen Bruder an.«
»Deinen Bruder?«
»Eric.« Sie nannte ihm den Namen seiner Kanzlei. »Lass dich nicht abwimmeln.« Erics Mitarbeiter würde es höchst effizient versuchen. »Hörst du? Erzähl alles, was passiert ist. Jono? Hast du verstanden?«
Jono nickte und wurde ganz grün im Gesicht.
Die Polizisten führten sie nicht durchs Foyer zum Hauptportal, sondern zu einem Hinterausgang, der in einen Innenhof mündete, wo einige Polizeiwagen geparkt waren. »Wegen der Presse«, sagte Cox, und Em musste lachen, wenn auch bitter. Jeder im Foyer, der ein Smartphone besaß, hatte sie längst fotografiert und ihr Foto getweetet, versehen mit dem Hashtag #canarywharf. Etwas anderes anzunehmen, wäre irgendwas zwischen naiv und dumm. In zwei Minuten würden die Journalisten den passenden Namen zu ihrem Gesicht haben, und die Schlagzeile könnte lauten: »Emma Vine – inszenierte die Queen der Megashows das Attentat von Canary Wharf?«
Ihr wurde übel.
Als sie auf den Rücksitz des Streifenwagens kletterte, klingelte Ems Telefon aus der Uniform der Polizistin heraus. Es würde nicht mehr aufhören zu klingeln, bis man ihr erlaubte, es abzustellen.
5
Einen Anwalt in der Familie zu haben, war ein unbestreitbarer Vorteil. Umso besser, wenn es der eigene Zwillingsbruder war. Eric Vine war kein Strafverteidiger, sondern kümmerte sich unter anderem um die Geschäfte der in Familienbesitz befindlichen Privatbank. Aber er war für sie da. Dankbar ließ sich Em von ihm umarmen und drückte ihn ein paar Sekunden länger an sich, als zur Begrüßung nötig war. Er hatte einen Kollegen vom Fach mit zu Scotland Yard gebracht. Em betrachtete den adretten jungen Mann mit leichtem Misstrauen und machte dabei wahrscheinlich ein ganz ähnliches Gesicht wie DC Cox, auch wenn die Gründe für ihre Skepsis anders gelagert waren. Während Cox berufsbedingt kein gutes Verhältnis zu Strafverteidigern haben mochte, dachte Em darüber nach, ob Erics Kollege wirklich so gut war, wie es sein teurer Anzug vermitteln wollte. Von Eric wusste sie, dass er seine Arbeit gut machte, aber sie kannte auch seine Schwächen, beruflich wie privat, und mehr als einmal hatte er ihr gestanden, wie er erst in letzter Sekunde eigene schwerwiegende Fehler entdeckt und gerade noch so korrigiert hatte. Mit Anwälten war es wie mit Ärzten: Kaum kannte man einen von ihnen privat, schon schwand der Glaube an den gesamten Berufsstand.
Aber immerhin waren die beiden Anwälte jetzt da und machten Wind.
Mit Cox sprachen sie nur das Nötigste. Sie hörten sich an, was Em zu sagen hatte, verlangten dann, einen Vorgesetzten von Cox zu sprechen, wenn möglich gleich den Commissioner. Man kannte sich schließlich aus irgendeinem Gentlemen’s Club persönlich.
Es war nicht der Commissioner, der eine halbe Stunde später auftauchte, dafür DCI Palmer vom Special Branch, eine hervorragend frisierte und perfekt geschminkte Endvierzigerin mit dezenten Absätzen, die sich mit den beiden Anwälten in ihr Büro zurückzog, während Em weiter im Vernehmungsraum mit einem missmutigen Cox und zwei Polizistinnen warten musste.
»Es spricht alles gegen Sie«, murmelte Cox, nicht zum ersten Mal. Er hatte spätestens seit Palmers Anweisung, er solle sich nicht von der Stelle rühren, unterirdische Laune. Von seiner Überzeugung, eine gefährliche Terroristin quasi noch mit der Bombe in der Hand erwischt zu haben, war schätzungsweise noch so viel übrig wie von einer flügellahmen Taube in einem Hinterhof voller Katzen. Weshalb er sein »Es spricht alles gegen Sie« auch wie ein Mantra wiederholte. Cox versuchte, das Gesicht zu wahren.
Wenn Em alles richtig verstanden hatte, dann war es offenbar jemandem gelungen, Telefonleitungen und Stromversorgung im gesamten Gebäude lahmzulegen, Rauch über die Klimaanlagen auf alle Etagen zu blasen und die Sicherheitstechnik ad absurdum zu führen. Tags zuvor waren zwei Mitarbeiter der Firma, die sich um die Klimatechnik des Bürotowers kümmerte, wegen Reparaturen im Haus gewesen. Ein Mann und eine Frau, deren Beschreibung angeblich auf Em passte. Auf sie und Millionen andere. Groß, schlank, dunkelhaarig, Anfang dreißig. Die Firma hatte nicht bestätigen können, jemanden geschickt zu haben. Die vermeintlichen Techniker hatten die Klimaanlagen manipuliert und das gesamte Equipment zurückgelassen, nur leider keine Spuren. Jedenfalls hatte man bis jetzt noch keine gefunden, die sich verwerten ließen. Ob und wie sie sich Zugang zu den Computersystemen der Haustechnik verschafft hatten, war noch unklar. Fest stand nur, dass sich jemand von außen eingehackt und alle Systeme für eine Weile lahmgelegt hatte.
»Von außen?«, hatte Em gefragt. »Ich war im Gebäude.«
»Außerhalb des Systems«, erklärte Cox. Allerdings war sie sich sicher, dass er selber nicht hundertprozentig verstand, wie alles abgelaufen war.
»Und Sie kommen auf mich, weil ich ›stadtbekannte Hackerin‹ im Ausweis stehen habe? Ich kann einen Computer bedienen, aber ich habe keine Ahnung, warum er funktioniert oder wie er funktioniert.«
Die Leidenschaft, mit der Cox daraufhin nickte, bestätigte ihren Verdacht, dass sich auch seine Affinität zu digitaler Technik eher auf ihren Gebrauch beschränkte. »Unsere Experten haben da etwas zu Ihrem Rechner zurückverfolgt.«
»Zu meinem Rechner? Okay, ich weiß nicht, auf welchem Spezialgebiet Ihre Experten Experten sind, aber das kann nicht sein. Ich hab meinen Rechner tagelang nicht benutzt. Ich war unterwegs, da benutze ich nur mein Smartphone.«
Cox sah in die Unterlagen, die man ihm reingereicht hatte. »Äh, zu Ihrem Smartphone. Genau.«
»Zu meinem Smartphone? Und was soll ich damit gemacht haben?«
»Zum selben Zeitpunkt, als die Störungen im Limeharbour Tower losgingen, wählte sich Ihr Telefon in das WLAN-Netz des Gebäudes ein.«
»Was?«
»Die, ähm, Techniker untersuchen jetzt, ob es der Auslöser war für … also, so etwas wie der Zünder.« Cox hatte Schweiß auf der Stirn stehen und fuhr mit dem Zeigefinger die Zeilen im Bericht entlang.
»Das ist so schwachsinnig. Wie hätte ich das denn machen sollen? Ich habe überhaupt keine Ahnung von solchen Sachen.«
»Dafür haben wir ja unsere Experten«, sagte er, sah sie an und legte die Papiere zur Seite. »Ihr Telefon wird gründlich untersucht.«
»Von mir aus. Wann bekomme ich es wieder?«
»Wenn unsere Experten damit fertig sind.«
»Ihre Experten. Sie sagten es schon. Wollen wir noch ein bisschen weiter über Ihre Experten reden?«
»Außerdem«, wechselte er das Thema, »wussten Sie das mit den Rauchpatronen vor allen anderen«, sagte Cox. »Sie haben es getwittert.«
Natürlich hatte sie es gewusst. Sie arbeitete oft genug mit Rauchpatronen. Em machte sich nicht die Mühe zu antworten.
Dass sie nicht die Frau gewesen sein konnte, die sich als Klimatechnikerin Zutritt zu den Technikräumen verschafft hatte, könnte sie schnell belegen, wenn auch widerwillig.
»Muss das wirklich sein?«, fragte sie wenig später Eric, und am Gesicht seines Kollegen konnte sie ablesen, dass dieser sofort begriffen hatte, was Ems Problem war.
»Es muss«, sagte Eric schulterzuckend.
»Dann brauch ich mein Telefon zurück.«
Nach einigem Hin und Her hatte Em zwar nicht ihr Telefon, aber doch die Nummer, die sie benötigte. Sie tippte sie in Erics Telefon ein, und nach viermaligem Klingeln meldete sich eine männliche Stimme.
»Hi. Hier ist Em. Emma.« Pause. Stille. »Emma Vine.«
»Ja, schon klar …«, sagte der Mann. »Es ist nur gerade …«
»Ich weiß. Hör einfach nur zu.« Sie sah, wie Eric und sein Kollege gleichzeitig warnend die Zeigefinger hoben. Nicht beeinflussen. Nicht mal die Spur eines Verdachts der Beeinflussung aufkommen lassen. Sie hatten es ihr mehrfach gesagt. »Es gibt hier ein Missverständnis mit der Polizei. Sie wollen dich etwas fragen, und ich möchte dich bitten, dass du ihnen ehrlich antwortest. Es ist sehr wichtig. Danke.«
»Aber …«
»Sorry.«
»Wie, bitte schön, soll ich das …«
»Danke. Bis dann.« Sie beendete das Gespräch und gab Eric das Telefon zurück. »Die Nummer hast du jetzt. Gib sie Cox oder wem auch immer. Der Typ heißt Steve Banks.«
Erics Kollege konnte ein Schmunzeln nur schwer unterdrücken.
»Und der arme Mr Banks hofft jetzt, dass die Polizei nicht bei seiner Frau anruft?«, fragte Eric angespannt.
Em hatte gestern so etwas wie ihren freien Tag gehabt und diesen in einem Hotel in Brighton verbracht. Steve und sie hatten seit zwei Monaten ein Verhältnis, das an die einzige Bedingung gekoppelt war, dass sie zu nichts verpflichtet waren. Nun würde er sich mit Sicherheit nicht mehr bei ihr melden.
Sie würde es überleben.
Cox hatte letztlich nichts mehr, woran er sich klammern konnte, und wiederholte nur schwach seine Rechtfertigungen, als DCI Palmer hereinkam und Cox zu verstehen gab, dass sie ihn nun nicht mehr bräuchte.
Sie gingen in Palmers Büro. Erics Kollege wischte noch im Gehen auf seinem iPad herum. Em erkannte die Oberfläche von Twitter.
»Wir könnten eine Menge Verleumdungsklagen gewinnen«, sagte er zu Em, während sie sich setzten. »Jemand schreibt sogar, Sie gehörten al-Qaida an.«
»Zu viel der Ehre«, sagte Em.
»Die PLO hätte ich noch im Angebot.«
»Ich denk drüber nach.«
»Über die PLO oder die Verleumdungsklagen?«
Eric mischte sich ein. »Em, ein paar Fragen noch, dann können wir gehen. Ist das okay?«
»Wo ist mein Telefon?«, fragte sie.
»Morgen, denke ich«, sagte Palmer. »Wir müssen das noch alles prüfen.«
»Das kann doch nicht so lange dauern. Das haben Sie doch schnell ausgelesen, oder was machen Sie damit?«
»Ich kann Ihnen nur sagen, was die Technik sagt. Die haben ihre eigenen Abläufe im Labor.«
»Und was wollen Sie jetzt noch wissen? Ich dachte, wir sind uns einig, dass ich nicht diejenige war, die Rauchpatronen gezündet und ein ganzes Gebäude lahmgelegt hat?«
»Sie meinen ins Chaos gestürzt hat. Mit Verletzten und einer Toten«, sagte Palmer.
Em schwieg und sah zu ihrem Bruder, der leicht den Kopf schüttelte. Sie wusste, was er dachte: einfach den Mund halten.
»DCI Palmer würde gerne wissen, ob du dir vorstellen kannst, dass jemand absichtlich den Verdacht auf dich lenkt«, sagte Eric.
Sie schüttelte den Kopf.
»Jemand, der es vielleicht direkt auf Ms Rasmussen abgesehen hat? Viele Menschen wussten wohl von ihren Ängsten.« Palmer sah von Em zu Eric und von Eric zu seinem Kollegen, der, ohne aufzublicken, die Schultern zuckte.
»Sie hat jedem, mit dem sie häufiger zu tun hatte, irgendwann erzählt, dass sie Angst vor Feuer hat, weil sie einmal in einem brennenden Club eingesperrt war und dabei sehr schwer verletzt wurde«, sagte Em.
»Und Sie haben nicht daran gedacht, als sich überall Rauch ausbreitete? Dass Sie sich besonders um Ms Rasmussen kümmern müssten?«
»Es hat doch gar nicht gebrannt!«
»Ms Rasmussen hatte keine Angst vor Feuer, sondern vor genau dieser Situation: starke Rauchentwicklung und keine Fluchtmöglichkeit. Damals in dem Club handelte es sich um Reizgas. Sie stürzte, einige trampelten über sie hinweg und verletzten sie schwer.«
Em sah Palmer lange an. »Das wusste ich nicht. Ich dachte, es sei ein Feuer gewesen. Sie hat es mir vor Wochen einmal abends im Pub erzählt.«
»So etwas merkt man sich doch.«
»Meine Güte, dann hab ich das mit dem Feuer wohl dazugedichtet. Ich weiß nur, sie sagte was von einer Massenpanik in einem Club und dass überall Rauch war. Da kann man schon mal an Feuer denken.« Em verschränkte die Arme vor der Brust.
Palmer verzog den Mund ganz leicht nach unten. »Der Tod von Kimmy Rasmussen scheint Sie nicht sehr zu berühren.«
»Mehr, als Sie denken. Oder darf ich erst gehen, wenn ich geheult habe?«
»Em«, sagte Eric leise.
»Oh, lassen Sie Ihre Schwester ruhig. Ich finde das sehr interessant«, sagte Palmer spitz.
»Wie schön«, sagte Em.
»Emma hat Probleme damit, ihre Gef…«
»Eric!« Sie schlug mit der flachen Hand nach seinem Arm.
»Ich denke, in gewissen Situationen wäre es hilfreich, um nicht zu sagen relevant, wenn du darüber …«
»Nein«, sagte sie entschieden. Ihr Bruder wusste, wie es ihr gerade wirklich ging. Dass Palmer es auch wissen sollte, sah sie gar nicht ein.
Schweigen in der Runde, bis Palmer sagte: »Jonathan Baker, einer von Rasmussens Praktikanten, erzählte uns auch von den Ängsten seiner Chefin. Er macht sich große Vorwürfe, dass er ihr nicht geholfen hat.«
Em musste sich räuspern. Ihre Stimme war belegt. »Jono war ohnmächtig, und ich habe ihm geholfen.«
»Sie können sich also auch nicht vorstellen, dass der Anschlag direkt Ms Rasmussen galt?«
»So viel Aufwand, um einen Menschen zu töten?«, fragte Em.
»In den Selbstmord zu treiben.«
»So viel Aufwand?«, wiederholte Em.
Palmer nickte, sah wieder von einem zum anderen, dann erhob sie sich. »Wir haben noch sehr viel Arbeit. Ms Vine, halten Sie sich bitte zu unserer Verfügung. Ich habe Ihren Anwälten gesagt, wo Sie sich melden können, um Ihre Sachen wiederzubekommen. Im Moment gibt es keinen Grund mehr für uns, Sie hierzubehalten. Danke für Ihre Mitarbeit.« Sie öffnete die Bürotür und gab den beiden Anwälten zum Abschied die Hand. Als Em an ihr vorbeikam, sah Palmer auf ihre Armbanduhr und wandte sich ihrem Schreibtisch zu. Em ließ ihre ausgestreckte Hand sinken und hob die Schultern.
Sie hatte sich schon in der Pubertät daran gewöhnt, keine Beliebtheitswettbewerbe zu gewinnen. Jedenfalls nicht bei einer bestimmten Sorte Frauen.
»Ist Jono noch hier?«, fragte Em ihren Bruder.
»Er wartet unten auf uns. Er hat mir gleich gesagt, dass er nicht ohne uns weggeht. Ohne dich, eigentlich.«
»Gut.« Em wandte sich an Erics Kollegen. »Wie heißen Sie noch mal?«
Er lächelte. »Du erkennst mich nicht mehr?«
»Muss lange her sein, sonst könnte ich mich erinnern.«
»Sehr lange. Fünfzehn Jahre? Ich bin Alex.«
»Alex Hanford? Ist nicht wahr! Jetzt muss ich wohl so was sagen wie: Mein Gott, bist du aber groß geworden!«
Alex nickte und breitete lächelnd die Arme aus. Eric schob seinen Kollegen zur Seite, bevor Em ihn umarmen konnte. »Tut mir das nicht an. Denkt nicht mal dran.«
Alex und Em verzogen beleidigt die Gesichter.
6
Als Em daran dachte, was ihr Bruder schon alles mit ihr hatte erleben müssen, meldete sich ihr schlechtes Gewissen. Sie war streng genommen die Ältere und hatte sogar einen Tag vor ihm Geburtstag, weil sie vor Mitternacht geboren war, und Eric erst eine gute halbe Stunde danach. Natürlich hatte das überhaupt nichts zu sagen. Eric hatte stets auf sie aufpassen müssen. Die Rolle des Vernünftigen, des Besonnenen passte zu ihm: Er hatte sie ermahnt, wenn sie zu hoch auf einen Baum geklettert war. Er hatte sie gerettet, wenn sie sich mit den älteren Nachbarjungs angelegt hatte. Er hatte sie zum Arzt begleitet, wenn sie sich mal wieder verletzt hatte. Auch wenn sie überzeugt war, schon seit langer Zeit sehr gut auf sich allein aufpassen zu können, war sie froh, dass er heute bei Scotland Yard erschienen war. Dass er gnädigerweise die Wohnung mit ihr teilte, rechnete sie ihm ebenfalls hoch an. Welcher Bruder ließ mit dreiunddreißig noch seine Schwester bei sich wohnen, nur weil diese keine Lust hatte, sich etwas Eigenes zu suchen? Sich nicht festlegen wollte? Aber Eric hatte gerade keine Beziehung, und die einzige Bedingung, die er ihr gemacht hatte, war: Bring keine Männer mit. Ihre Weigerung, sich auch in Beziehungsdingen nicht festlegen zu wollen, ging ihm nicht nur auf die Nerven, sondern erschütterte fast schon sein Weltbild. Er glaubte an die große Liebe, an Ehe, an Familie, und das, obwohl er keinen Grund dazu haben konnte. Ihre Mutter hatte die Familie verlassen, als sie vier Jahre alt gewesen waren. Sie hatte nie wieder Kontakt zu ihren Kindern gesucht, und die beiden wussten nicht einmal, wo sie lebte. Oder ob überhaupt.