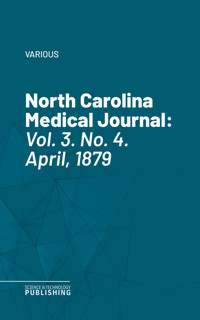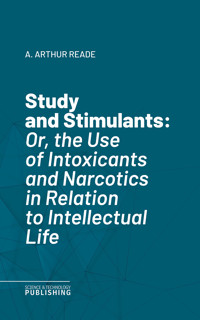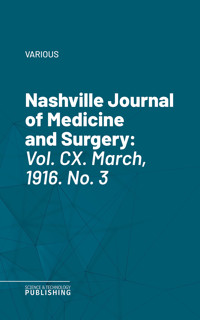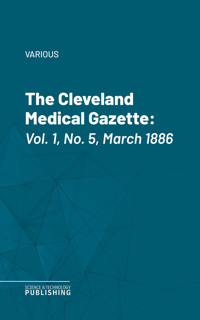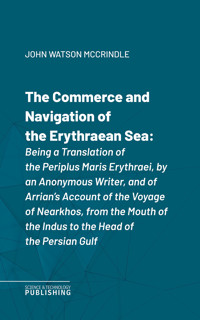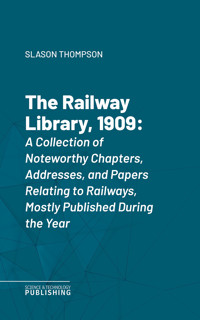Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bild und Heimat
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Berühmte Märchen aus aller Welt
- Sprache: Deutsch
Mit vielen prachtvollen Illustrationen Die Märchen von Hans Christian Andersen, Charles Dickens, den Brüdern Grimm, Wilhelm Hauff, Alexander Puschkin … Mit den Erzählungen aus Tausendundeiner Nacht, chinesischen Volksmärchen, "Die Schöne und das Biest" aus Frankreich, "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" aus Tschechien, Märchen aus Amerika, Afrika, Indien …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 322
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Berühmte Märchen aus aller Welt
Vom Löweneckerchen bis Rumpelstilzchen
Ausgesucht von Dennis Grabowsky
Bild und Heimat
Von Dennis Grabowsky liegen bei Bild und Heimat
außerdem vor:
Die schönsten Tierfabeln (2016)
Die schönsten tschechischen und slowakischen Märchen (2016)
Illustrationen
Iwan Bilibin: S. 26, S. 32, S. 36, S. 44, S. 55; Bertall: S. 73, S. 76, S. 82; Peter Carl Geissler: S. 100, S. 109, S. 127, S. 132, S. 167; Arthur Rackham: S. 198; Artuš Scheiner: S. 214, S. 223, S. 227; Otto Speckter (The Library of Congress): S. 231, S. 233, S. 235; E. Ille (Münchener Bilderbogen): S. 246–252
Es war leider nicht in allen Fällen möglich, die Rechteinhaber zu ermitteln. Berechtigte Ansprüche bleiben gewahrt.
eISBN 978-3-95958-757-0
1. Auflage
© 2017 by BEBUG mbH / Bild und Heimat, Berlin
Umschlaggestaltung: fuxbux, Berlin
Umschlagabbildung: Farbdruck von Willy Planck © akg-images
In Kooperation mit der SUPERillu
www.superillu-shop.de
Laotse
Aus China
Übertragen von Richard Wilhelm
Laotse ist eigentlich älter als Himmel und Erde. Er ist der gelbe Alte, der mit den anderen vieren die Welt geschaffen. Zu verschiedenen Zeiten aber hat er sich auf der Erde unter verschiedenen Namen gezeigt. Seine berühmteste Menschwerdung jedoch ist die als »altes Kind« (Laotse) mit dem Namen Pflaume (Li). Das ging aber so zu: Seine Mutter empfing ihn auf übernatürliche Weise und trug ihn zweiundsiebzig Jahre lang. Als er geboren wurde, kam er aus der linken Achselhöhle seiner Mutter hervor. Er hatte gleich von Anfang an weiße Haare, darum nannte man ihn altes Kind. Auch konnte er schon sprechen. Da er keinen menschlichen Vater hatte, deutete er auf den Pflaumenbaum, unter dem er zur Welt gekommen war, und sprach: »Dies soll mein Name sein!«
Er erlangte große Zauberkünste, durch die er sein Leben verlängerte. Einst nahm er einen Knecht zu seinem Dienst. Mit dem wurde er einig, dass er ihm täglich hundert Kupferstücke geben wollte, doch bezahlte er ihn nicht aus und war ihm schließlich sieben Millionen zweihunderttausend Kupferstücke schuldig. Da bestieg er einen schwarzen Stier und ritt nach Westen. Er wollte seinen Knecht mitnehmen. Als sie aber an den Han-Gu-Pass kamen, da weigerte sich der Knecht und verlangte seine Bezahlung. Doch Laotse gab ihm nichts.
Als sie sich dem Haus des Passwächters nahten, da zeigten sich am Himmel rote Wolken. Der Passwächter verstand das Zeichen und wusste, dass ein Heiliger nahe. So ging er ihm entgegen und nahm ihn in seinem Haus auf. Er fragte ihn nach geheimer Weisheit. Laotse aber streckte die Zunge weit heraus und sagte nichts. Dennoch beherbergte ihn der Passwächter aufs ehrerbietigste in seiner Wohnung. Laotses Knecht erzählte dem Diener des Passwächters, dass sein Herr ihm noch viel Geld schuldig sei, und bat, ein gutes Wort für ihn einzulegen. Als der Diener von der großen Summe hörte, da lockte es ihn, so einen reichen Mann zum Schwiegersohn zu haben, und er gab ihm seine Tochter zur Frau.
Schließlich hörte der Passwächter von der Sache und trat mit dem Knecht zusammen vor Laotse. Da sprach Laotse zu seinem Knecht: »Du Schalksknecht! Du wärest eigentlich schon lange tot. Ich habe dich angestellt, und da ich arm war und dir kein Geld geben konnte, habe ich dir einen Zauber des Lebens zu essen gegeben. Darum bist du noch heute am Leben. Ich sagte dir: Wenn du mir nachfolgst nach Westen ins Reich der seligen Ruhe, dann will ich dir deinen Lohn in gelbem Gold zahlen. Du aber hast nicht gewollt.«
Damit klopfte er dem Knecht auf den Nacken. Da öffnete der den Mund und spie den Zauber des Lebens auf die Erde. Noch sah man darauf die Zeichen mit Zinnober geschrieben, wohlerhalten, wie neu. Der Knecht aber brach plötzlich zusammen und verwandelte sich in einen Haufen trockenen Gebeins. Der Passwächter warf sich zur Erde und legte Fürbitte für ihn ein. Er versprach, für Laotse den Knecht zu bezahlen, und bat, er solle ihn wieder lebendig machen. Da tat Laotse den Zauber unter die Knochen, und augenblicklich war der Knecht zum Leben erweckt. Der Passwächter entlohnte den Knecht und ließ ihn gehen. Dann verehrte er den Laotse als seinen Meister, und Laotse teilte ihm die Kunst des ewigen Lebens mit und hinterließ ihm seine Lehre in fünftausend Worten, die der Passwächter niederschrieb. Das Buch, das so entstand, ist das Buch Vom Sinn und Leben. Laotse verschwand darauf den Blicken der Menschen. Der Passwächter aber hat seine Lehre befolgt und wurde unter die Unsterblichen versetzt.
Das singende springende Löweneckerchen
Aus Deutschland
Von den Brüdern Grimm
Es war einmal ein Mann, der hatte eine große Reise vor, und beim Abschied fragte er seine drei Töchter, was er ihnen mitbringen sollte. Da wollte die Älteste Perlen, die Zweite wollte Diamanten, die Dritte aber war ganz vernarrt in die lustigen Vögel am Himmel. Besonders hatte es ihr das Löweneckerchen angetan, das man auch Lerche nennt. Also sprach sie: »Lieber Vater, ich wünsche mir ein singendes, springendes Löweneckerchen.« Der Vater sagte: »Ja, wenn ich es kriegen kann, sollst du es haben«, küsste alle drei und zog fort. Als nun die Zeit kam, dass er wieder auf dem Heimweg war, so hatte er Perlen und Diamanten für die Ältesten gekauft, aber das singende, springende Löweneckerchen für die Jüngste hatte er umsonst gesucht, und das tat ihm leid, denn sie war sein liebstes Kind.
Da führte ihn der Weg durch einen Wald, und mitten darin war ein prächtiges Schloss, und nah am Schloss stand ein Baum, ganz oben auf der Spitze des Baums aber sah er ein Löweneckerchen singen und springen. »Ei, du kommst mir gerade recht« sagte er ganz vergnügt und rief seinem Diener, er sollte hinaufsteigen und das Tierchen fangen. Wie er aber zum Baum trat, sprang ein Löwe darunter auf, schüttelte sich und brüllte, dass das Laub an den Bäumen zitterte. »Wer mir mein singendes, springendes Löweneckerchen stehlen will«, rief er, »den fresse ich auf!« Da sagte der Mann: »Ich habe nicht gewusst, dass der Vogel dir gehört, ich will mein Unrecht wieder gutmachen und mich mit Geld loskaufen, lass mir nur das Leben!«
Der Löwe sprach: »Dich kann nichts retten, außer wenn du mir versprichst zu geben, was dir daheim zuerst begegnet. Willst du das tun, so schenke ich dir das Leben und den Vogel für deine Tochter obendrein.« Der Mann aber weigerte sich und sprach: »Das könnte meine jüngste Tochter sein, die hat mich am liebsten und läuft mir immer entgegen, wenn ich nach Haus komme.« Dem Diener aber war angst, und er sagte: »Muss Euch denn gerade Eure Tochter begegnen, es könnte ja auch eine Katze oder ein Hund sein.« Da ließ sich der Mann überreden, nahm das singende, springende Löweneckerchen und versprach dem Löwen zu geben, was ihm daheim zuerst begegnen würde.
Als er daheim anlangte und in sein Haus eintrat, war das Erste, was ihm begegnete, niemand anders als seine jüngste, liebste Tochter: Die kam gelaufen, küsste und herzte ihn, und als sie sah, dass er ein singendes, springendes Löweneckerchen mitgebracht hatte, war sie außer sich vor Freude. Der Vater aber konnte sich nicht freuen, sondern fing an zu weinen und sagte: »Mein liebstes Kind, den kleinen Vogel habe ich teuer gekauft, ich habe dich dafür einem wilden Löwen versprechen müssen, und wenn er dich hat, wird er dich zerreißen und fressen.« Er erzählte ihr alles, wie es zugegangen war, und bat sie, nicht hinzugehen, es möchte auch kommen, was da wolle. Sie tröstete ihn aber und sprach: »Liebster Vater, was Ihr versprochen habt, muss auch gehalten werden: Ich will hingehen und will den Löwen schon besänftigen, dass ich wieder gesund zu Euch komme.«
Am anderen Morgen ließ sie sich den Weg zeigen, nahm Abschied und ging getrost in den Wald hinein. Der Löwe aber war ein verzauberter Königssohn und war bei Tag ein Löwe, und mit ihm wurden alle seine Leute Löwen. In der Nacht aber hatten sie ihre natürliche menschliche Gestalt. Bei ihrer Ankunft wurde sie freundlich empfangen und in das Schloss geführt. Als die Nacht kam, war er ein schöner Mann, und die Hochzeit wurde mit Pracht gefeiert. Sie lebten vergnügt miteinander, wachten in der Nacht und schliefen am Tag.
Zu einer Zeit kam er und sagte: »Morgen ist ein Fest in deines Vaters Haus, weil deine älteste Schwester sich verheiratet, und wenn du Lust hast hinzugehen, so sollen dich meine Löwen hinführen.« Da sagte sie, ja, sie möchte gern ihren Vater wiedersehen, fuhr hin und wurde von den Löwen begleitet. Da war große Freude, als sie ankam, denn sie hatten alle geglaubt, sie wäre von dem Löwen zerrissen worden und schon lange nicht mehr am Leben. Sie erzählte aber, was sie für einen schönen Mann hätte und wie gut es ihr ginge, und blieb bei ihnen, so lang die Hochzeit dauerte, dann fuhr sie wieder zurück in den Wald.
Als die zweite Tochter heiratete und sie wieder zur Hochzeit eingeladen war, sprach sie zum Löwen: »Diesmal will ich nicht allein sein, du musst mitgehen!« Der Löwe aber sagte, das wäre zu gefährlich für ihn, denn wenn dort der Strahl eines brennenden Lichts ihn berührte, so würde er in eine Taube verwandelt und müsste sieben Jahre lang mit den Tauben fliegen. »Ach«, sagte sie, »geh nur mit mir! Ich will dich schon hüten und vor allem Licht bewahren.« Also zogen sie zusammen und nahmen auch ihr kleines Kind mit. Sie ließ dort einen Saal mauern, so stark und dick, dass kein Strahl durchdringen konnte, darin sollte er sitzen, wann die Hochzeitslichter angesteckt würden. Die Tür aber war von frischem Holz gemacht, das sprang und bekam einen kleinen Ritz, den kein Mensch bemerkte.
Nun wurde die Hochzeit mit Pracht gefeiert, als aber der Zug aus der Kirche zurückkam mit den vielen Fackeln und Lichtern an dem Saal vorbei, da fiel ein haarbreiter Strahl auf den Königssohn, und so dieser Strahl ihn berührt hatte, in dem Augenblick war er auch verwandelt, und als sie hineinkam und ihn suchte, sah sie ihn nicht, aber es saß da eine weiße Taube. Die Taube sprach zu ihr: »Sieben Jahr muss ich in die Welt fortfliegen. Alle sieben Schritte aber will ich einen roten Blutstropfen und eine weiße Feder fallen lassen, die sollen dir den Weg zeigen, und wenn du der Spur folgst, kannst du mich erlösen.« Da flog die Taube zur Tür hinaus, und sie folgte ihr nach, und alle sieben Schritte fielen ein rotes Bluttröpfchen und ein weißes Federchen herab und zeigten ihr den Weg. So ging sie immerzu in die weite Welt hinein und schaute nicht um sich und ruhte nicht. Schon waren fast die sieben Jahre herum: Da freute sie sich und meinte, sie wären bald erlöst, und war noch so weit davon.
Einmal, als sie so fortging, fiel kein Federchen mehr und auch kein rotes Bluttröpfchen, und als sie die Augen aufschlug, so war die Taube verschwunden. Und weil sie dachte: Menschen können dir da nicht helfen, so stieg sie zur Sonne hinauf und sagte zu ihr: »Du scheinst in alle Ritzen und über alle Spitzen, hast du keine weiße Taube fliegen sehen?« – »Nein«, sagte die Sonne, »ich habe keine gesehen, aber da schenk ich dir ein Kästchen, das mach auf, wenn du in großer Not bist.« Da dankte sie der Sonne und ging weiter, bis es Abend war und der Mond schien, da fragte sie ihn: »Du scheinst ja die ganze Nacht und durch alle Felder und Wälder, hast du keine weiße Taube fliegen sehen?« – »Nein«, sagte der Mond, »ich habe keine gesehen, aber da schenk ich dir ein Ei, das zerbrich, wenn du in großer Not bist.« Da dankte sie dem Mond und ging weiter, bis der Nachtwind herankam und sie anblies. Da sprach sie zu ihm: »Du wehst ja über alle Bäume und unter allen Blättern weg, hast du keine weiße Taube fliegen sehen?« – »Nein«, sagte der Nachtwind, »ich habe keine gesehen, aber ich will die drei andern Winde fragen, die haben sie vielleicht gesehen.«
Der Ostwind und der Westwind kamen und hatten nichts gesehen, der Südwind aber sprach: »Die weiße Taube habe ich gesehen, sie ist zum Roten Meer geflogen, da ist sie wieder ein Löwe geworden, denn die sieben Jahre sind herum, und der Löwe steht dort im Kampf mit einem Lindwurm, der Lindwurm ist aber eine verzauberte Königstochter.« Da sagte der Nachtwind zu ihr: »Ich will dir Rat geben: Geh zum Roten Meer, am rechten Ufer da stehen große Ruten, die zähle, und die elfte schneide ab und schlage den Lindwurm damit, dann kann ihn der Löwe bezwingen, und beide bekommen auch ihren menschlichen Leib wieder. Hernach schau dich um, und du wirst den Vogel Greif sehen, der am Roten Meer sitzt, schwinge dich mit deinem Liebsten auf seinen Rücken. Der Vogel wird euch übers Meer nach Haus tragen. Da hast du auch eine Nuss, wenn du mitten über dem Meer bist, lass sie herabfallen, alsbald wird sie aufgehen, und ein großer Nussbaum wird aus dem Wasser hervorwachsen, auf dem sich der Greif ausruht. Und könnte er nicht ruhen, so wäre er nicht stark genug, euch hinüberzutragen. Und wenn du vergisst, die Nuss herabzuwerfen, so lässt er euch ins Meer fallen.«
Da ging sie hin und fand alles, wie der Nachtwind gesagt hatte. Sie zählte die Ruten am Meer und schnitt die elfte ab, damit schlug sie den Lindwurm, und der Löwe bezwang ihn. Alsbald hatten beide ihren menschlichen Leib wieder. Aber als die Königstochter, die vorher ein Lindwurm gewesen war, vom Zauber frei war, nahm sie den Jüngling in den Arm, setzte sich auf den Vogel Greif und führte ihn mit sich fort. Da stand die arme Weitgewanderte und war wieder verlassen und setzte sich nieder und weinte. Endlich aber ermutigte sie sich und sprach: »Ich will noch so weit gehen, wie der Wind weht, und so lange der Hahn kräht, bis ich ihn finde.« Und ging fort lange, lange Wege, bis sie endlich zum Schloss kam, wo beide zusammen lebten. Da hörte sie, dass bald ein Fest wäre, wo sie Hochzeit miteinander machen wollten.
Sie sprach aber: »Gott hilft mir noch«, und öffnete das Kästchen, das ihr die Sonne gegeben hatte, da lag ein Kleid darin, so glänzend wie die Sonne. Da nahm sie es heraus und zog es an und ging hinauf in das Schloss, und alle Leute und die Braut sahen sie mit Verwunderung an. Und das Kleid gefiel der Braut so gut, dass sie dachte, es könnte ihr Hochzeitskleid abgeben, und fragte, ob es nicht zu verkaufen wäre. »Nicht für Geld und Gut«, antwortete sie, »aber für Fleisch und Blut.« Die Braut fragte, was sie damit meinte. Da sagte sie: »Lasst mich eine Nacht in der Kammer schlafen, wo der Bräutigam schläft.« Die Braut wollte nicht und wollte doch gern das Kleid haben, endlich willigte sie ein, aber der Kammerdiener musste dem Königssohn einen Schlaftrunk geben.
Als es nun Nacht war und der Jüngling schon schlief, wurde sie in die Kammer geführt. Da setzte sie sich ans Bett und sagte: »Ich bin dir nachgefolgt sieben Jahre, bin bei Sonne und Mond und bei den vier Winden gewesen und habe nach dir gefragt und habe dir geholfen gegen den Lindwurm; willst du mich denn ganz vergessen?« Der Königssohn aber schlief so tief, dass es ihm nur vorkam, als rauschte der Wind draußen in den Tannenbäumen. Wie nun der Morgen anbrach, da wurde sie wieder hinausgeführt und musste das goldene Kleid hingeben. Und als auch das nichts geholfen hatte, wurde sie traurig, ging hinaus auf eine Wiese, setzte sich da hin und weinte.
Und wie sie so saß, da fiel ihr das Ei noch ein, das ihr der Mond gegeben hatte. Sie schlug es auf, da kam eine Glucke heraus mit zwölf Küken ganz aus Gold, die liefen herum und piepten und krochen der Alten wieder unter die Flügel, so dass nicht Schöneres auf der Welt zu sehen war. Da stand sie auf, trieb sie auf der Wiese vor sich her, so lange, bis die Braut aus dem Fenster sah, und da gefielen ihr die kleinen Küken so gut, dass sie gleich herabkam und fragte, ob sie nicht zu verkaufen wären. »Nicht für Geld und Gut, aber für Fleisch und Blut. Lasst mich noch eine Nacht in der Kammer schlafen, wo der Bräutigam schläft!« Die Braut sagte ja und wollte sie betrügen wie am vorigen Abend. Als aber der Königssohn zu Bett ging, fragte er seinen Kammerdiener, was das Murmeln und Rauschen in der Nacht gewesen sei. Da erzählte der Kammerdiener alles, dass er ihm einen Schlaftrunk hätte geben müssen, weil ein armes Mädchen heimlich in der Kammer geschlafen hätte, und heute Nacht sollte er ihm wieder einen geben! Da sagte der Königssohn: »Gieß den Trank neben das Bett!«
Zur Nacht wurde sie wieder hereingeführt. Und als sie anfing zu erzählen, wie es ihr traurig ergangen wäre, da erkannte er gleich an der Stimme seine liebe Gemahlin, sprang auf und rief: »Jetzt bin ich erst recht erlöst, mir ist gewesen wie in einem Traum, denn die fremde Königstochter hatte mich bezaubert, dass ich dich vergessen musste, aber Gott hat noch zu rechter Stunde die Betörung von mir genommen.« Da gingen sie beide in der Nacht heimlich aus dem Schloss, denn sie fürchteten sich vor dem Vater der Königstochter, der ein Zauberer war, und setzten sich auf den Vogel Greif. Der trug sie über das Rote Meer, und als sie in der Mitte waren, ließ sie die Nuss fallen. Alsbald wuchs ein großer Nussbaum, darauf ruhte der Vogel. Und dann führte er sie nach Haus, wo sie ihr Kind fanden, das war groß und schön geworden, und sie lebten von nun an vergnügt bis an ihr Ende.
Das Mädchen im Mond
Aus Mikronesien
Übertragen von Paul Hambruch
Es war einmal ein Mädchen, dessen Mutter hieß Egigu, und der Vater hieß Gadia. Es hatte noch zwei Schwestern, die wurden wie sie nach der Mutter Egigu genannt. Eines Tages spielten alle drei um einen großen hohen Baum, als der Ältesten zum ersten Mal unwohl wurde. Sie stieg auf den Baum hinauf und sang:
»Egigu! Egigu, oho!
O nein, ich bin unwohl!
Geht zum Vater Gadia,
Schmuck soll er euch geben oho!
Und Muschelketten und den Gürtel oho!«
Als der Vater das erfuhr, ließ er ihr sagen, sie solle in ihr neues Haus gehen, er wolle ihr dann schönes Essen und herrlichen Zierrat senden. Und die Älteste tat, was der Vater befohlen hatte. Am anderen Tag geschah dasselbe mit der zweiten Tochter. Auch sie stieg auf den Baum und sang das gleiche Lied, das die ältere Schwester gesungen hatte. Sie erhielt ebenfalls ein schönes Haus und viele Geschenke. Am dritten Tag wurde der Jüngsten unwohl. Sie stieg auf den Baum und sang das gleiche Lied. Doch da antwortete die Mutter: »Dir wird der Vater kein Haus schenken, wir mögen dich nicht leiden. Geh nur, wohin du willst, in den Busch oder an die See.«
Das Mädchen ging traurig fort. Es ging an den Strand und fand dort eine keimende Nuss. Sie pflanzte den Keimling tiefer in den Boden ein, begoss ihn und sprach: »Wachse, Bäumlein, wachse! Du sollst nicht im Sonnenbrand oder im Sturmwind vergehen. Wachse, wachse ein wenig!« Da wuchs der Keimling rasch zum Baum heran, und der Baum wuchs höher und höher, bis er schließlich an den Himmel stieß.
Als das Mädchen dies sah, kletterte es in den Baum hinein und stieg höher und immer höher, bis es endlich in den Himmel kam. Dort schlenderte es umher und gelangte zu einer alten Frau, welche Enibarara hieß. Die Alte war blind. Sie war gerade damit beschäftigt, im Kochhaus Palmwein zu Sirup einzukochen. Egigu war sehr durstig. Sie nahm eine Schale Palmwein fort, trank sie aus und setzte sie wieder an den Platz zurück. Dreißig Schalen waren es. Zunächst merkte die alte Frau nicht, dass die Schalen fortgenommen wurden, als aber das Mädchen die letzte Schale austrinken wollte und schon zugriff, da wurde es von der Alten ertappt. Sie fasste es bei der Hand und hielt es fest.
»Oh«, rief Egigu, »lass mich in Frieden; ich will brav sein, will dir helfen und dir dienen.« Doch die Alte antwortete: »O nein, ich lasse dich nicht gehen, du hast mir meinen Wein ausgetrunken, und dafür musst du jetzt sterben.« »Ach nein, lass mich los, ich will dir auch deine Augen wieder gesund machen!« – »Nun, wenn du das kannst, und tust, will ich zufrieden sein und dich freigeben.« Da sprach Egigu: »Puh, puh! Deine Augen, Enibarara! Puh, puh!« Und allerlei flog aus den Augen der Alten heraus: Ameisen, Fliegen, Würmer, alles mögliche Getier. Die Augen wurden klar, und die alte Frau konnte wieder sehen. Sie freute sich und wartete nun auf die Rückkehr ihrer drei Söhne. Und weil sie fürchtete, dass sie dem Mädchen ein Leid antun würden, denn sie waren Menschenfresser, versteckte sie Egigu unter einer großen Muschelschale.
Bald danach kamen die Söhne nach Haus. Zuerst erschien Ekuan, die Sonne. Er schnupperte umher und sagte: »Mutter, es riecht so, als ob hier noch jemand ist.« Die Alte antwortete nicht. Sie öffnete auch nicht die Augen, denn ihr Sohn sollte nicht merken, dass sie wieder sehen konnte. Ekuan ging fort, und es erschien der zweite Sohn, Tebau, der Donner. Er schnupperte wie sein Bruder umher und sagte: »Mutter, es riecht hier nach Menschen.« Enibarara antwortete wieder nicht. Sie öffnete auch die Augen nicht. Tebau ging weiter, und nun kam der dritte Sohn, der milde, freundliche Maramen, der Mond. »Oh, Mutter«, rief er, »es riecht so, als ob hier noch jemand ist.« Da öffnete die Alte die Augen und sagte: »Komm, schau her, sieh mir in die Augen.« Maramen ging zur Mutter, blickte ihr in die Augen, wunderte sich und sprach: »Oh, wer hat das gemacht? Seit wann kannst du wieder sehen?«
Da erzählte Enibarara ihrem Sohn die Geschichte. Maramen freute sich sehr und fragte, wo das Mädchen sei. Die Alte antwortete: »Dort unter der Tridacna-Schale sitzt das Mädchen Egigu; die tat es, und nun sollst du sie zur Frau haben!« Jetzt war Maramens Freude noch größer. Er machte Egigu zu seiner Frau. Und heute noch kann jeder das Mädchen im Mond sehen.
Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern
Aus Dänemark
Von Hans Christian Andersen
Es war entsetzlich kalt. Es schneite, und der Abend dunkelte bereits. Es war der letzte Abend im Jahr, Silvesterabend. In dieser Kälte und in dieser Finsternis ging auf der Straße ein kleines armes Mädchen mit bloßen Kopf und nackten Füßen. Es hatte wohl Pantoffeln angehabt, als es von zu Hause fortging, aber was konnte das helfen! Es waren sehr große Pantoffeln, sie waren früher von seiner Mutter gebraucht worden, so groß waren sie, und diese hatte die Kleine verloren, als sie über die Straße eilte, während zwei Wagen in rasender Eile vorüberjagten. Der eine Pantoffel war nicht wieder aufzufinden, und mit dem anderen machte sich ein Knabe aus dem Staub, welcher versprach, ihn als Wiege zu benutzen, wenn er einmal Kinder bekäme.
Da ging nun das kleine Mädchen auf den nackten zierlichen Füßchen, die vor Kälte ganz rot und blau waren. In ihrer alten Schürze trug sie eine Menge Schwefelhölzer, und ein Bund hielt sie in der Hand. Während des ganzen Tages hatte ihr niemand etwas abgekauft, niemand ein Almosen gereicht. Hungrig und frostig schleppte sich die arme Kleine weiter und sah schon ganz verzagt und eingeschüchtert aus. Die Schneeflocken fielen auf ihr langes blondes Haar, das schön gelockt über ihren Nacken hinabfloss, aber bei diesem Schmuck weilten ihre Gedanken wahrlich nicht. Aus allen Fenstern strahlte heller Lichterglanz, und über alle Straßen verbreitete sich der Geruch von köstlichem Gänsebraten. Es war ja Silvesterabend, und dieser Gedanke erfüllte alle Sinne des kleinen Mädchens.
In einem Winkel zwischen zwei Häusern, von denen das eine etwas weiter in die Straße vorsprang als das andere, kauerte es sich nieder. Seine kleinen Beinchen hatte es unter sich gezogen, aber es fror nur noch mehr und wagte es trotzdem nicht, nach Hause zu gehen, da es noch kein Schächtelchen mit Streichhölzern verkauft, noch keinen Heller erhalten hatte. Es hätte gewiss vom Vater Schläge bekommen, und kalt war es zu Hause ja auch. Sie hatten das bloße Dach gerade über sich, und der Wind pfiff schneidend hinein, obgleich Stroh und Lumpen in die größten Ritzen gestopft waren. Ach, wie gut musste ein Schwefelhölzchen tun! Wenn es nur wagen dürfte, eins aus dem Schächtelchen herauszunehmen, es gegen die Wand zu streichen und die Finger daran zu wärmen! Endlich zog das Kind eins heraus. Ritsch! Wie sprühte es, wie brannte es. Das Schwefelholz strahlte eine warme helle Flamme aus, wie ein kleines Licht, als es das Händchen um dasselbe hielt. Es war ein merkwürdiges Licht. Es kam dem kleinen Mädchen vor, als säße es vor einem großen eisernen Ofen mit Messingbeschlägen und Messingverzierungen. Das Feuer brannte so schön und wärmte so wohltuend! Die Kleine streckte schon die Füße aus, um auch diese zu wärmen – da erlosch die Flamme. Der Ofen verschwand – sie saß mit einem Stümpchen des ausgebrannten Schwefelholzes in der Hand da.
Ein neues wurde angestrichen, es brannte, es leuchtete, und an der Stelle der Mauer, auf welche der Schein fiel, wurde sie durchsichtig wie ein Flor. Die Kleine sah gerade in die Stube hinein, wo der Tisch mit einem blendend weißen Tischtuch und feinem Porzellan gedeckt stand, und köstlich dampfte die mit Pflaumen und Äpfeln gefüllte, gebratene Gans darauf. Und was noch herrlicher war, die Gans sprang aus der Schüssel und watschelte mit Gabel und Messer im Rücken über den Fußboden hin, gerade die Richtung auf das arme Mädchen schlug sie ein. Da erlosch das Schwefelholz, und nur die dicke kalte Mauer war zu sehen.
Sie zündete ein neues an. Da saß die Kleine unter dem herrlichsten Weihnachtsbaum. Er war noch größer und weit reicher ausgeputzt als der, den sie am Heiligabend bei dem reichen Kaufmann durch die Glastür gesehen hatte. Tausende von Lichtern brannten auf den grünen Zweigen, und bunte Bilder, wie die, welche in den Ladenfenstern ausgestellt werden, schauten auf sie hernieder, die Kleine streckte beide Hände nach ihnen in die Höhe – da erlosch das Schwefelholz. Die vielen Weihnachtslichter stiegen höher und höher, und sie sah jetzt erst, dass es die hellen Sterne waren. Einer von ihnen fiel herab und zog einen langen Feuerstreifen über den Himmel.
»Jetzt stirbt jemand!«, sagte die Kleine, denn die alte Großmutter, die sie allein freundlich behandelt hatte, jetzt aber längst tot war, hatte gesagt: »Wenn ein Stern fällt, steigt eine Seele zu Gott empor!«
Sie strich wieder ein Schwefelholz gegen die Mauer. Es warf einen weiten Lichtschein ringsumher, und im Glanze desselben stand die alte Großmutter hell beleuchtet mild und freundlich da.
»Großmutter!«, rief die Kleine, »oh, nimm mich mit dir! Ich weiß, dass du verschwindest, sobald das Schwefelholz ausgeht, verschwindest, wie der warme Kachelofen, der köstliche Gänsebraten und der große flimmernde Weihnachtsbaum!« Schnell strich sie den ganzen Rest der Schwefelhölzer an, die sich noch im Schächtelchen befanden, sie wollte die Großmutter festhalten. Und die Schwefelhölzer verbreiteten einen solchen Glanz, dass es heller war als am lichten Tag. So schön, so groß war die Großmutter nie gewesen. Sie nahm das kleine Mädchen auf ihren Arm, und hoch schwebten sie empor in Glanz und Freude. Kälte, Hunger und Angst wichen von ihm – sie war bei Gott.
Aber im Winkel am Haus saß in der kalten Morgenstunde das kleine Mädchen mit roten Wangen, mit Lächeln um den Mund – tot, erfroren am letzten Tag des alten Jahres. Der Morgen des neuen Jahres ging über der Kleinen auf, die mit den Schwefelhölzern, wovon fast ein Schächtelchen verbrannt war, da saß. »Sie hat sich wärmen wollen«, sagte man. Niemand wusste, was sie Schönes gesehen hatte, in welchem Glanze sie mit der alten Großmutter zur Neujahrsfreude eingegangen war.
Die kleine Meerjungfrau
Aus Dänemark
Von Hans Christian Andersen
Weit draußen im Meer ist das Wasser so blau wie die Blütenblätter der schönsten Kornblume, und so klar wie das reinste Glas, aber es ist dort sehr tief, tiefer als irgendein Ankertau reicht, viele Kirchtürme müssten aufeinandergestellt werden, um vom Grund bis über das Wasser zu reichen. Dort unten wohnt das Meervolk.
Nun muss man nicht etwa glauben, dass dort nur der nackte, weiße Sandboden sei! Nein, da wachsen die wundersamsten Bäume und Pflanzen, deren Stiele und Blätter so geschmeidig sind, dass sie sich bei der geringsten Bewegung des Wassers rühren, als ob sie lebendig wären. Alle Fische, klein und groß, schlüpfen zwischen den Zweigen hindurch, gerade wie hier oben die Vögel in der Luft. An der allertiefsten Stelle liegt des Meerkönigs Schloss. Die Mauern sind aus Korallen und die langen spitzen Fenster von allerklarstem Bernstein. Das Dach aber besteht aus Muschelschalen, die sich öffnen und schließen, je nachdem wie das Wasser strömt. Das sieht prächtig aus, denn in jeder liegen strahlende Perlen, eine Einzige davon würde der Stolz einer Königskrone sein.
Der Meerkönig dort unten war seit vielen Jahren Witwer, aber seine alte Mutter besorgte sein Haus. Sie war eine kluge Frau, doch recht stolz auf ihren Adel, deshalb trug sie zwölf Austern auf dem Schwanz, während die anderen Vornehmen nur sechs tragen durften. Sonst verdiente sie großes Lob, besonders weil sie die kleinen Meerprinzessinnen, ihre Enkelinnen, so liebte. Das waren sechs prächtige Kinder, aber die Jüngste war die Schönste von allen. Ihre Haut war so klar und zart wie ein Rosenblatt, ihre Augen so blau wie die tiefste See, aber ebenso wie alle die anderen hatte sie keine Füße. Ihr Körper endete in einem Fischschwanz.
Den lieben langen Tag durften sie unten im Schloss, wo lebendige Blumen aus den Wänden wuchsen, spielen. Die großen Bernsteinfenster wurden aufgemacht, und dann schwammen die Fische zu ihnen herein, gerade wie bei uns die Schwalben hereinfliegen, wenn wir die Fenster aufmachen. Aber die Fische schwammen geradeswegs auf die kleinen Prinzessinnen zu, fraßen aus ihren Händen und ließen sich streicheln.
Draußen vor dem Schloss war ein großer Garten mit feuerroten und dunkelblauen Bäumen, die Früchte strahlten wie Gold und die Blumen wie brennendes Feuer, indem sie fortwährend Stängel und Blätter bewegten. Der Boden selbst war der feinste Sand, aber blau wie Schwefelflamme. Über dem Ganzen dort unten lag ein seltsamer blauer Schein, man hätte eher glauben mögen, dass man hoch oben in der Luft stände und nur Himmel über und unter sich sähe, als dass man auf dem Meeresgrund sei. Bei Windstille konnte man die Sonne sehen, sie erschien wie eine Purpurblume aus deren Kelche alles Licht strömte.
Jede der kleinen Prinzessinnen hatte ihren kleinen Fleck im Garten, wo sie graben und pflanzen konnte, ganz wie sie wollte. Eine gab ihrem Blumenbeet die Gestalt eines Walfisches, einer anderen erschien es hübscher, dass das ihre einem Meerweiblein glich, aber die Jüngste machte ihr Beet ganz rund wie die Sonne und hatte nur Blumen darauf, die so rot wie diese leuchteten. Sie war ein seltsames Kind, still und nachdenklich, und während die anderen Schwestern sich mit den merkwürdigsten Sachen, die aus gestrandeten Schiffen genommen waren, schmückten, wollte sie nur, außer ihren rosenroten Blumen, die der Sonne dort oben glichen, ein schönes Marmorbild haben. Es war ein herrlicher Knabe, aus weißem, klarem Stein gehauen, der beim Stranden auf den Meeresboden gesunken war. Sie pflanzte neben dem Bild eine rosenrote Trauerweide, die prächtig wuchs, und mit ihren frischen Zweigen darüber hing sie bis auf den blauen Sandboden hinab, wo der Schatten sich violett färbte und gleich den Zweigen in sanfter Bewegung war. Es sah aus, als ob die Spitze und die Wurzeln miteinander spielten, als ob sie sich küssen wollten.
Sie kannte keine größere Freude, als von der Menschenwelt über ihr zu hören, die alte Großmutter musste ihr alles erzählen, was sie wusste von den Schiffen und Städten, Menschen und Tieren. Ganz besonders wunderbar und herrlich erschien es ihr, dass oben auf der Erde die Blumen dufteten, denn das taten sie auf dem Meeresboden nicht, und dass die Wälder grün waren und die Fische, die man dort auf den Zweigen sieht, so laut und lieblich singen konnten, dass es eine Lust war. Es waren die kleinen Vögel, die die Großmutter Fische nannte, denn sonst hätten es die Kinder nicht verstehen können, da sie nie einen Vogel gesehen hatten.
»Wenn ihr euer fünfzehntes Jahr erreicht habt«, sagte die Großmutter, »so werdet ihr Erlaubnis bekommen, aus dem Meer emporzutauchen, im Mondschein auf den Klippen zu sitzen und die großen Schiffe vorbeisegeln zu sehen, auch die Wälder und Städte sollt ihr dann sehen!« Im nächsten Jahr wurde die eine von den Schwestern fünfzehn Jahre, die eine war immer ein Jahr jünger als die andere, die Jüngste musste also noch fünf lange Jahre warten, bevor sie vom Meeresgrund aufsteigen und sehen konnte, wie es bei uns aussieht. Aber die eine versprach der anderen zu erzählen, was sie gesehen und am ersten Tag am schönsten gefunden hätte, denn ihre Großmutter erzählte ihnen nicht genug, da war noch so vieles, worüber sie Bescheid wissen mussten.
Keine war so sehnsuchtsvoll, wie die Jüngste, gerade sie, die am längsten zu warten hatte und die so still und gedankenvoll war. Manche Nacht stand sie am offenen Fenster und sah hinauf durch das dunkelblaue Wasser, wo die Fische mit ihren Flossen und Schwänzen einherruderten. Mond und Sterne konnte sie sehen. Zwar leuchteten sie nur ganz bleich, aber durch das Wasser sahen sie viel größer aus, als für unsere Augen. Glitt es dann gleich einer schwarzen Wolke unter ihnen dahin, so wusste sie, dass es entweder ein Walfisch war, der über ihr schwamm, oder auch ein Schiff mit vielen Menschen. Die dachten gewiss nicht daran, dass eine liebliche kleine Meerjungfrau unten stand und ihre weißen Hände gegen den Kiel emporstreckte.
Nun war die älteste Prinzessin fünfzehn Jahre alt und durfte zur Meeresoberfläche aufsteigen. Als sie zurückkam, wusste sie hundert Dinge zu erzählen, das Herrlichste jedoch, sagte sie, wäre, im Mondschein auf einer Sandbank in der ruhigen See zu liegen und zu der großen Stadt dicht bei der Küste hinüberzuschauen, wo die Lichter blinkten wie hundert Sterne, die Musik und den Lärm und die Geräusche der Wagen und Menschen zu hören, die vielen Kirchtürme und Giebel zu sehen und zu hören, wie die Glocken läuten. Und die Jüngste sehnte sich immer mehr nach diesem allen, gerade weil sie noch nicht hinauf durfte. Oh, wie horchte sie auf, und wenn sie dann abends am offenen Fenster stand und durch das dunkelblaue Wasser hinaufsah, dachte sie an die große Stadt mit all ihrem Lärm und Geräusch, und dann vermeinte sie, die Kirchenglocken bis zu sich herunter läuten zu hören.
Ein Jahr danach bekam die zweite Schwester Erlaubnis, durch das Wasser aufzusteigen und zu schwimmen, wohin sie wollte. Sie tauchte auf, gerade als die Sonne unterging, und dieser Anblick erschien ihr das Schönste. Der ganze Himmel habe wie Gold ausgesehen, sagte sie, und die Wolken – ja, deren Herrlichkeit konnte sie nicht genug beschreiben! Rot und violett waren sie über ihr dahingesegelt, aber weit hurtiger als sie flog, wie ein langer weißer Schleier, ein Schwarm wilder Schwäne über das Wasser hin, wo die Sonne stand. Sie schwamm ihr entgegen, aber sie sank, und der Rosenschimmer erlosch auf der Meeresfläche und den Wolken.
Im Jahre darauf kam die dritte Schwester hinauf. Sie war die dreisteste von allen. Darum schwamm sie einen breiten Fluss hinauf, der in das Meer mündete. Herrliche grüne Hügel mit Weinreben sah sie, und Schlösser und Bauernhöfe schauten zwischen den prächtigen Wäldern hervor, sie hörte, wie alle Vögel sangen, und die Sonne schien so warm, dass sie untertauchen musste, um im Wasser ihr brennendes Antlitz zu kühlen. In einer kleinen Bucht traf sie eine Schar kleiner Menschenkinder, ganz nackend liefen sie im Wasser umher und plätscherten, sie wollte mit ihnen spielen, aber sie waren erschreckt davongelaufen, und ein kleines schwarzes Tier war gekommen – das war ein Hund, aber sie hatte nie zuvor einen Hund gesehen –, der bellte sie so schrecklich an, dass sie es mit der Angst bekam und schnell in die offene See zu kommen suchte. Aber niemals konnte sie die prächtigen Wälder vergessen, und die grünen Hügel und die niedlichen Kinder, die im Wasser schwimmen konnten, obwohl sie keinen Fischschwanz hatten.
Die vierte Schwester war nicht so dreist, sie blieb draußen mitten im wilden Meer und erzählte, dass gerade das das Herrlichste gewesen wäre: Man sehe viele Meilen weit umher, und der Himmel stände über einem wie eine große Glasglocke. Schiffe hätte sie gesehen, aber weit in der Ferne, sie sähen aus wie Strandmöwen. Die lustigen Delfine hätten Purzelbäume geschlagen, und die großen Walfische hätten aus ihren Nasenlöchern Wasser hoch in die Luft gespritzt, so dass es wie hundert Springbrunnen ringsumher ausgesehen habe.
Nun kam die Reihe an die fünfte Schwester. Ihr Geburtstag fiel gerade in den Winter, und darum sah sie, was die anderen das erste Mal nicht gesehen hatten. Das Meer nahm sich ganz grün aus, und ringsum schwammen große Eisberge. Jeder sähe aus, wie eine Perle, sagte sie, und doch sei er größer als die Kirchtürme, die die Menschen bauten. In den seltsamsten Gestalten zeigten sie sich und funkelten wie Diamanten. Sie hatte sich auf einen der größten gesetzt, und alle Segler kreuzten erschrocken in großem Bogen dort vorbei, wo sie saß und ihre Haare im Wind fliegen ließ. Aber gegen Abend überzog sich der Himmel mit schwarzen Wolken, es blitzte und donnerte, während die schwarze See die großen Eisblöcke hoch emporhob und sie in rotem Licht erglänzen ließ. Auf allen Schiffen nahm man die Segel herein, und überall herrschte Angst und Grauen, sie aber saß ruhig auf ihrem schwimmenden Eisberg und sah die blauen Blitze im Zickzack in die schimmernde See herniederschlagen.
Das erste Mal, wenn eine der Schwestern über das Wasser emporkam, war jede entzückt über all das Neue und Schöne, was sie sah, aber da sie nun als erwachsene Mädchen emporsteigen durften, wann sie wollten, wurde es ihnen gleichgültig, sie sehnten sich wieder nach Hause zurück, und nach eines Monats Verlauf sagten sie, dass es doch unten bei ihnen am allerschönsten sei, man sei da so hübsch zu Hause.
In mancher Abendstunde fassten sich die fünf Schwestern an den Händen und stiegen in einer Reihe über das Wasser hinauf. Herrliche Stimmen hatten sie, schöner als irgendein Mensch, und wenn dann ein Sturm heraufzog, so dass sie annehmen konnten, dass Schiffe untergehen würden, so schwammen sie vor den Schiffen her und sangen so wundersam, wie schön es auf dem Meeresgrund sei, und sie baten die Schiffer, sich nicht zu fürchten vor dem Untergehen, aber diese konnten die Worte nicht verstehen und glaubten, es wäre der Sturm. Und sie bekamen die Herrlichkeiten da unten auch nicht zu sehen, denn wenn das Schiff sank, ertranken die Menschen und kamen nur als Tote zu des Meerkönigs Schloss.