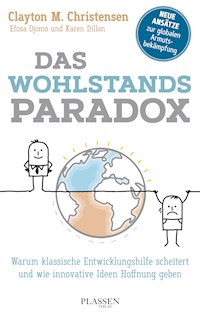Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Plassen Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Produkte werden technisch immer ausgefeilter, es gibt Dutzende verschiedene Versionen, aus denen der Kunde wählen kann. Trotzdem liegen sie wie Blei in den Regalen. Warum? Hersteller beachten nicht, welchen "Job" ein Produkt oder auch eine Dienstleistung für den Kunden erfüllen soll. Clayton M. Christensen liefert mit dem "Jobs to Be Done"-Ansatz eine umfassende Theorie, wie man die Wünsche der Kunden erkennt und in den eigenen Produkten oder Dienstleistungen umsetzt. Er zeigt die praktische Anwendung und welche Auswirkungen die Methode auf Organisationsstrukturen und Führungsentscheidungen hat. So wird Innovation von der reinen Glückssache zu einem planbaren Prozess, der Unternehmen den entscheidenden Marktvorteil bringt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 396
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
„Jobs to Be Done“ –die Strategie fürerfolgreiche Innovation
Besser alsder Zufall
DER „ERFINDER“ DER DISRUPTION
CLAYTON M.CHRISTENSEN
Taddy Hall, Karen Dillon und David S. Duncan
Die Originalausgabe erschien unter dem TitelCompeting Against Luck: The Story of Innovation and Customer Choice
ISBN 978-0-06-256523-5
© Copyright der Originalausgabe 2016:
Copyright © 2016 Clayton M. Christensen, Ridgway Harken Hall, Karen Dillon, and David S. Duncan.
All rights reserved.
Published by arrangement with HarperBusiness, an imprint of HarperCollins Publishers, LLC.
© Copyright der deutschen Ausgabe 2017:
Börsenmedien AG, Kulmbach
Übersetzung: Egbert Neumüller, Eckhart Böhme
Gestaltung Cover: Johanna Wack
Gestaltung und Satz: denksportler Grafikmanufaktur
Herstellung: Martina Köhler
Lektorat: Claus Rosenkranz
Druck: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-86470-501-4eISBN 978-3-86470-502-1
Alle Rechte der Verbreitung, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe und der Verwertung durch Datenbanken oder ähnliche Einrichtungen vorbehalten.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
Postfach 1449 • 95305 Kulmbach
Tel: 0 92 21-90 51-0 • Fax: 0 92 21-90 51-44 44
E-Mail: [email protected]
www.plassen.de
www.facebook.com/plassenverlag
Inhalt
Einführung: Weshalb Sie dieses Buch „beauftragen“ sollten
Spielen Sie bei Innovationen nicht mehr auf Risiko. Überlassen Sie das Glück Ihren Konkurrenten – und lassen Sie sie weit hinter sich.
Teil I: Einführung in die Jobs-Theorie
Kapitel 1: Das Milchshake-Dilemma
Warum ist es so schwer, Innovationen vorherzusagen – und sie dauerhaft hervorzubringen? Weil wir bisher nicht die richtigen Fragen gestellt haben.
Kapitel 2: Fortschritte statt Produkte
Eine Erklärung der Theory of Jobs to Be Done: Um die Innovationstätigkeit vom Schuss ins Blaue auf die Ebene der Vorhersehbarkeit zu heben, müssen Sie den dahinterstehenden Kausalmechanismus verstehen – die Fortschritte, die ein Verbraucher unter bestimmten Umständen machen möchte.
Kapitel 3: Jobs in freier Wildbahn
Die Jobs Theory verwandelt die Art, wie man die Branche definiert, in der man tätig ist, die Größe und Art des Marktes, in dem man konkurriert, und die Frage, wer die Mitbewerber sind. Die Southern New Hampshire University, FranklinCovey, Intuit und eine ganze Reihe alltäglicher Produkte zeigen, wie leistungsfähig Innovationen mithilfe der Jobs-Theorie sein können.
Teil II: Die harte Arbeit – und der Lohn – für die Anwendung der Jobs Theory
Kapitel 4: Jobs aufstöbern
Wo aber sind nun alle diese Jobs, die auf ihre Entdeckung warten – und wie findet man sie? Die Lösung liegt nicht in den Werkzeugen, die man dafür verwendet, sondern darin, wonach man sucht und was man aus seinen Beobachtungen macht.
Kapitel 5: Wie man hört, was die Kunden nicht sagen
Die Kunden können nur selten ihre Ansprüche genau oder vollständig formulieren – ihre Motivationen sind komplexer und ihre Wege zum Kauf aufwendiger, als sie es beschreiben können. Man kann der Sache aber auf den Grund gehen. Was sie beauftragen und – genauso wichtig – was sie „feuern“, erzählt eine bedeutsame Geschichte.
Kapitel 6: Eine Bewerbung erstellen
Wie können Sie sicherstellen, dass Ihre Lösung mit dem Job „beauftragt“ wird? Dazu gehört mehr, als nur ein Produkt mit den richtigen Merkmalen und Funktionen zu schaffen. Um wirklich auf eine zu erledigende Aufgabe zu reagieren, muss man den Kunden die richtigen Erfahrungen ermöglichen. Und dafür bezahlen die Kunden gern einen Aufpreis.
Teil III: Das Jobs to Be Done-Unternehmen
Kapitel 7: Die Integration um eine Aufgabe
Normalerweise strukturieren sich Unternehmen anhand von Funktionen, von Geschäftszweigen oder geografisch – doch einen echten Wettbewerbsvorteil erzielen Unternehmen, wenn sie sich für die Aufgabe optimieren. Die Integration interner Kompetenzen und Prozesse, die eine Aufgabe bewältigen, ist der Mechanismus, der ein Produkt oder eine Dienstleistung deutlich von der Konkurrenz abhebt.
Kapitel 8: Die Aufgabe im Blick behalten
Sogar großartige Unternehmen können bei der Erledigung der Aufgabe für ihre Kunden vom rechten Weg abkommen – und sich darauf konzentrieren, eine eigene Aufgabe zu erledigen. Das liegt daran, dass Unternehmen auf Fehlschlüsse bezüglich der Daten hereinfallen, die sie bezüglich ihrer Produkte gewinnen: den Fehlschluss der aktiven beziehungsweise passiven Daten, den Fehlschluss des oberflächlichen Wachstums und den Fehlschluss der passenden Daten.
Kapitel 9: Das auf Jobs fokussierte Unternehmen
Ein klar formulierter Job ermöglicht eine Art „Führung mit Auftrag“ und macht Mikromanagement überflüssig, weil die Mitarbeiter auf allen Ebenen den Durchblick haben und dadurch motiviert sind, dass sich die Arbeit, die sie leisten, in einen umfassenden Prozess einfügt, der den Kunden helfen soll, ihre Aufgaben zu bewältigen. Wir beschreiben hier, wie dies bei Organisationen wie der Mayo Clinic, beim Consumer Financial Protection Bureau (CFPB), bei OnStar und bei Deseret News – um nur einige zu nennen – funktioniert.
Kapitel 10: Schlussbemerkungen zur Theory of Jobs
Wir leisten es uns schon viel zu lange, zu glauben, erfolgreiche Innovation resultiere aus Glück. Es ist an der Zeit, dieses Paradigma zu kippen. Wir sammeln seit 20 Jahre Belege dafür, dass man seine Zeit, seine Energie und seine Ressourcen in die Schaffung von Wettbewerbsvorteilen durch Produkte und Dienstleistungen investieren kann, von denen man vorhersagen kann, dass die Kunden sie gerne beauftragen werden. Überlassen Sie Glücksfälle den anderen.
Danksagungen
Einführung
Weshalb Sie dieses Buch „beauftragen“ sollten
In diesem Buch geht es um Fortschritte.
Ja, dieses Buch handelt von Innovationen – und davon, wie man bei ihrer Verwirklichung besser wird. Doch im Kern handelt es sich um das Ringen um Fortschritte in unserem Leben.
Wenn Sie so sind wie viele Unternehmer und Manager, fällt Ihnen bei dem Versuch, Innovationen hervorzubringen, wohl nicht unbedingt als Erstes das Wort „Fortschritt“ ein. Dann sind Sie vielmehr davon besessen, das perfekte Produkt zu erschaffen mit genau der richtigen Kombination aus Funktionen und Vorteilen, die bei den Kunden gut ankommt. Oder sie versuchen, Ihre bereits bestehenden Produkte stetig weiter zu verbessern, sodass sie mehr Gewinn bringen oder sich von denen Ihrer Mitbewerber abheben. Sie glauben genau zu wissen, was Ihren Kunden gefallen würde, aber in Wirklichkeit kann sich das wie ein Glückstreffer anfühlen. Wenn man genug Versuchsballons steigen lässt, fliegt – mit ein bisschen Glück – einer weit davon.
Das muss aber nicht so sein, jedenfalls nicht, wenn Sie wirklich verstehen, was Verbraucher dazu veranlasst, die Entscheidungen zu treffen, die sie treffen. Innovationen könnten viel vorhersehbarer und viel profitabler sein – aber nur dann, wenn Sie darüber anders nachdenken. Es geht nämlich nicht um Produkte, sondern um Fortschritte. Wenn Sie also keine Lust mehr haben, sich und Ihr Unternehmen in gut gemeinte Innovationsanstrengungen zu stürzen, die regelmäßig enttäuschen; wenn Sie Produkte und Dienstleistungen schaffen wollen, von denen Sie im Voraus wissen, dass die Kunden sie nicht nur gerne kaufen, sondern dass sie auch bereit sind, dafür einen Aufpreis zu bezahlen; wenn Sie mit Unternehmen konkurrieren – und dabei gewinnen – wollen, die sich bezüglich des Erfolgs ihrer Innovationen auf ihr Glück verlassen, dann lesen Sie weiter. Dieses Buch soll dazu beitragen, dass auch Sie Fortschritte machen.
Die falschen Dinge immer besser machen
Seit ich denken kann, haben Innovationen für Unternehmen auf der ganzen Welt oberste Priorität – und sind gleichzeitig ihre größten Enttäuschungen. Bei einer neueren Umfrage von McKinsey sagten 84 Prozent der befragten Führungskräfte aus aller Welt, Innovationen seien ein äußerst wichtiger Bestandteil ihrer Wachstumsstrategien, jedoch waren unglaubliche 94 Prozent mit ihrer eigenen Innovationsleistung nicht zufrieden. Die meisten räumten ein, dass die überwältigende Mehrzahl der Innovationen hinter den Ambitionen zurückbleibt, und an dieser Tatsache hat sich seit Jahrzehnten nichts geändert.
Auf dem Papier leuchtet das nicht ein. Noch nie standen den Unternehmen so viele ausgeklügelte Instrumente und Methoden zur Verfügung wie heute – und es werden mehr Ressourcen denn je dafür eingesetzt, Innovationsziele zu erreichen. Laut einem Artikel in strategy+business1 gaben 1.000 Aktiengesellschaften im Jahr 2015 mehr als 680 Milliarden Dollar für Forschung und Entwicklung aus, eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 5,1 Prozent.
Und noch nie wussten die Unternehmen mehr über ihre Kunden als heute. Durch die Big-Data-Revolution sind die Vielfalt, der Umfang und die Geschwindigkeit der Datensammlung erheblich gestiegen und in gleichem Maße wurden die Analysewerkzeuge, die darauf angewendet werden, immer ausgefeilter. Die Hoffnungen, die in diese Datenfundgrube gesetzt werden, sind größer denn je. Chris Anderson, der damalige Chefredakteur von Wired, tat 2008 den berühmten Ausspruch: „Korrelation genügt.“ 2 Damit wollte er andeuten, wir könnten Innovationsprobleme mithilfe der schieren rohen Kraft der Daten-Sintflut lösen. Seit Michael Lewis in dem Buch „Moneyball“ eine Chronik des unerwarteten Erfolgs der Oakland A’s geliefert hat (die wussten nämlich, dass die Häufigkeit, wie oft ein Schlagmann ein Base erreicht und zum Läufer wird, ein besserer Indikator für den offensiven Erfolg ist als der Schlagdurchschnitt), versuchen Unternehmen, das „Moneyball“-Pendant im Bereich der Kundendaten zu finden, das zu erfolgreichen Innovationen führt. Doch gefunden haben es nur wenige.
In vielen Unternehmen sind die Innovationsprozesse durchstrukturiert, sie erfolgen diszipliniert und die Menschen, die sie umsetzen, sind hochqualifiziert. Die Innovationsprozesse der meisten Unternehmen beinhalten zur Absicherung Meilensteine, die Prüfung in schnellen Iterationen und diverse Gegenkontrollen. Die Risiken werden sorgfältig berechnet und entschärft. Prinzipien wie Six Sigma haben sich in der Gestaltung von Innovationsprozessen allgemein durchgesetzt, sodass wir heutzutage präzise Kennzahlen haben und neue Produkte in allen Phasen ihrer Entwicklung strengen Anforderungen genügen müssen. Von außen betrachtet sieht es so aus, als hätten die Unternehmen einen außerordentlich präzisen wissenschaftlichen Prozess voll im Griff.
Trotzdem fischen die meisten bei Innovationen nach wie vor schmerzlich im Trüben. Und das Schlimmste daran ist, dass all diese Aktivitäten die Illusion von Fortschritt vermitteln, ohne wirklich Fortschritte zu bewirken. Die Unternehmen steigern ihren Aufwand exponentiell, erzielen aber lediglich bescheidene Innovationsschritte und liegen bei bahnbrechenden Innovationen, die für langfristiges, nachhaltiges Wachstum von entscheidender Bedeutung sind, völlig daneben. Dazu passt der berühmte Ausspruch von Yogi Berra: „Wir haben uns verlaufen, aber wir kommen gut voran.“
Was läuft da so sehr schief?
Das grundlegende Problem ist Folgendes: Die Massen und Abermassen an Daten, die die Unternehmen sammeln, werden nicht so organisiert, dass sie zuverlässig vorhersagen können, welche Produkte erfolgreich sein werden. Vielmehr werden die Daten nach Kriterien wie diesen ausgewertet: „Dieser Kunde sieht aus wie jener“, „Dieses Produkt hat ähnliche Leistungsmerkmale wie jenes“, „Diese Menschen haben sich in der Vergangenheit genauso verhalten“ oder „68 Prozent der Kunden bevorzugen nach eigener Aussage Version A gegenüber Version B.“ Aber nichts davon sagt einem wirklich, warum die Kunden sich für bestimmte Produkte entscheiden.
Ich möchte Ihnen das anhand eines Beispiels erklären. Ich heiße Clayton Christensen und bin 64 Jahre alt. Ich bin 2,03 Meter groß und habe Schuhgröße 51. Meine Frau und ich haben alle unsere Kinder aufs College geschickt. Ich wohne in einem Vorort von Boston und fahre mit einem Honda-Minivan zur Arbeit. Ich habe noch viele andere Eigenschaften und Merkmale, aber diese haben mich nicht dazu veranlasst, heute das Haus zu verlassen und die New York Times zu kaufen. Es mag wohl eine Korrelation zwischen einigen dieser Eigenschaften und der Neigung von Kunden geben, die Times zu kaufen. Aber diese Merkmale veranlassen mich nicht, diese Zeitung – oder irgendein anderes Produkt – zu kaufen.
Wenn ein Unternehmen nicht weiß, weshalb ich mich dazu entscheide, unter gewissen Umständen sein Produkt „zu beauftragen“ – und weshalb ich mich unter anderen Umständen vielleicht für ein anderes entscheide –, dann verhelfen ihm seine Daten 3 über mich oder über Menschen wie mich 4 wahrscheinlich nicht dazu, irgendwelche Innovationen für mich zu entwickeln. Es ist zwar verlockend zu glauben, wir könnten in unseren Datensätzen bedeutsame Muster und Querbezüge erkennen, aber das heißt ja noch nicht, dass das eine wirklich das andere verursacht hätte. Wie Nate Silver, der Autor von „Die Berechnung der Zukunft: Warum die meisten Prognosen falsch sind und manche trotzdem zutreffen“, erläutert: „Eiscreme-Verkäufe und Waldbrände sind miteinander korreliert, weil beide in der sommerlichen Hitze häufiger auftreten. Es besteht jedoch keine Ursächlichkeit, denn wenn man sich 500 Gramm Häagen-Dazs kauft, zündet man dadurch kein Waldstück in Montana an.“
Es ist natürlich nicht überraschend, dass Korrelation und Kausalität nicht das Gleiche sind. Doch obwohl die meisten Organisationen das wissen, handeln sie meines Erachtens nicht so, als gäbe es einen Unterschied. Für sie ist die Korrelation bequem. Sie lässt die Manager nachts ruhig schlafen.
Jedoch sagt eine Korrelation überhaupt nichts über das aus, was bei Innovationen am meisten zählt: über die Kausalität, also warum ich womöglich eine ganz bestimmte Lösung kaufe. Und doch sehen die wenigsten Innovatoren ihre hauptsächliche Herausforderung darin, eine Ursache zu finden. Stattdessen konzentrieren sie sich darauf, wie sie ihre Produkte besser, profitabler oder anders als die der Konkurrenz machen können.
William Edwards Deming, der Vater des Qualitätsmanagements, das den verarbeitenden Sektor verwandelte, hat einmal gesagt: „Wenn man nicht weiß, wie man die richtigen Fragen stellen soll, findet man nichts heraus.“ Nachdem ich jahrzehntelang zugesehen habe, wie großartige Unternehmen immer wieder scheitern, bin ich zu dem Schluss gelangt, dass man tatsächlich eine bessere Frage stellen kann: Mit welcher Aufgabe haben Sie dieses Produkt beauftragt?
Für mich ist das eine klare Vorstellung. Wenn man ein Produkt kauft, „beauftragt“ man es im Grunde mit der Erledigung einer Aufgabe. Wenn es diese Aufgabe gut erledigt hat, beauftragen wir das gleiche Produkt wieder, wenn wir mit der gleichen Aufgabe konfrontiert sind. Wenn das Produkt hingegen Pfusch abliefert, „kündigen“ wir ihm und schauen uns nach etwas Anderem um, das wir mit der Lösung des Problems beauftragen könnten.
Uns passiert jeden Tag etwas. Es tauchen Aufgaben auf, die wir bewältigen müssen. Manche sind klein („mir beim Schlange-Stehen die Zeit vertreiben“), andere groß („mich vor einem Auswärts-Geschäftstermin umziehen, nachdem die Fluggesellschaft meinen Koffer verbummelt hat“) und manche treten regelmäßig auf („meiner Tochter etwas Gesundes und Leckeres als Pausenbrot für die Schule einpacken“). In anderen Fällen wissen wir, dass sie auf uns zukommen. Wenn wir merken, dass wir eine Aufgabe erledigen müssen, machen wir uns auf und „holen“ etwas in unser Leben, das sie erledigt. Es könnte zum Beispiel sein, dass ich mir die New York Times deshalb kaufe, weil ich mir die Wartezeit vor einem Arzttermin vertreiben muss und nicht die langweiligen Zeitschriften im Wartezimmer lesen will. Oder vielleicht, weil ich Basketballfan bin und gerade die March Madness läuft. Nur wenn in meinem Leben eine Aufgabe auftaucht, die die Times für mich lösen kann, entscheide ich mich dafür, diese Zeitung damit zu beauftragen. Vielleicht lasse ich sie mir auch an die Haustür liefern, damit meine Nachbarn mich für gut informiert halten – und auch darüber sagt der Times die Postleitzahl oder das mediane Haushaltseinkommen überhaupt nichts.
Diese zentrale Erkenntnis kam während eines Kurses auf, den ich an der Harvard Business School halte, aber danach wurde sie im Laufe von 20 Jahren durch zahlreiche Gespräche mit meinen Koautoren, mit geschätzten Kollegen, Mitarbeitern und Vordenkern verfeinert und ausgestaltet. Sie wurde durch die Arbeit einiger der angesehensten Unternehmenslenker und Innovatoren der Welt – zum Beispiel Jeff Bezos von Amazon und Scott Cook von Intuit – sowie durch die Gründung höchst erfolgreicher Unternehmensprojekte in den letzten Jahren bestätigt und bewiesen. Wer hätte gedacht, dass einer Dienstleistung, bei der Reisende dafür bezahlen, dass sie in einem freien Zimmer eines fremden Menschen übernachten, ein größerer Wert beigelegt würde als Marriott, Starwood oder Wyndham Worldwide? Airbnb schon. Die Videos, die Sal Khan aufnahm, um seinem jüngeren Cousin Mathematik beizubringen, waren nach seiner eigenen Beschreibung „billiger und mieser“ als viele Lehrvideos, die bereits online verfügbar waren, aber heute ermöglichen sie es Millionen von Schülern auf der ganzen Welt, in ihrem eigenen Tempo zu lernen.
Diese Innovationen waren nicht dafür ausgelegt, auf den neuesten Trend aufzuspringen oder eine neue Geschmacksrichtung einzuführen, um den Umsatz zu steigern. Sie wurden nicht geschaffen, um ein bestehendes Produkt mit zusätzlichem Schnickschnack zu versehen, damit das Unternehmen von den Kunden einen höheren Preis verlangen konnte. Sie wurden in dem klaren Wissen konzipiert, entwickelt und auf den Markt gebracht, dass sie den Verbrauchern dabei helfen würden, jene Fortschritte zu machen, mit denen sie bisher rangen. Wenn man eine Aufgabe zu erledigen hat und es gibt dafür keine gute Lösung, dann ist „billiger und mieser“ besser als nichts. Man stelle sich das Potenzial von etwas wirklich Großartigem vor.
Allerdings geht es in diesem Buch nicht vorrangig darum, frühere erfolgreiche Innovationen zu feiern. Es geht vielmehr um etwas, das für Sie viel wichtiger ist: um die Schaffung und das Vorhersagen von neuen.
Die Grundlage unserer Denkweise ist die Jobs to Be Done-Theorie. Sie ist darauf gerichtet, das Bemühen um Fortschritte Ihrer Kunden gründlich zu verstehen, um dann die richtige Lösung und dazugehörige Erlebnisse zu schaffen, die gewährleisten, dass Sie die Aufgaben Ihrer Kunden jedes Mal gut erledigen. Der Begriff „Theorie“ beschwört vielleicht Bilder von Grübeleien im Elfenbeinturm herauf, doch ich versichere Ihnen, dass dies das praktischste und nützlichste unternehmerische Instrument ist, das wir Ihnen anbieten können. Dank einer guten Theorie verstehen wir das „Wie“ und das „Warum“. Sie hilft uns zu verstehen, wie die Welt funktioniert, und die Folgen unserer Entscheidungen sowie unseres Handels vorherzusagen. Wir sind überzeugt, dass die „Jobs-Theorie“ 5 Unternehmen über die Hoffnung, Korrelation reiche aus, hinaus und hin zu dem Ursachenmechanismus erfolgreicher Innovationen bringen kann.
Innovation wird wohl nie eine perfekte Wissenschaft sein, aber darum geht es ja auch gar nicht. Wir sind in der Lage, die Innovation zu einem zuverlässigen Wachstumsmotor zu machen, der auf dem klaren Verständnis der Kausalität basiert – anstatt einfach Samen auszustreuen und zu hoffen, eines Tages könnten wir wenigstens ein paar Früchte ernten.
Die Jobs to Be Done Theory – die Theorie der zu erledigenden Aufgaben – ging aus stark wirklichkeitsbezogenen Erkenntnissen und Erfahrungen hervor. Ich habe meine Koautoren unter anderem deshalb gebeten, mit mir dieses Buch zu schreiben, weil sie die Jobs-Theorie seit Jahren bei ihrer täglichen Arbeit einsetzen und viel Erfahrung damit haben, sie in das praxisorientierte Reich der Innovation zu überführen. Gemeinsam haben wir die Theorie gestaltet, verfeinert und geschliffen – auch mithilfe der Gedanken und Beiträge vieler geschätzter Kollegen und Firmenchefs, deren Arbeiten und Erkenntnisse wir im gesamten Buch darstellen werden.
Mein Koautor Taddy Hall saß in dem ersten Kurs, den ich an der Harvard Business School hielt, und im Laufe der Jahre haben wir bei mehreren Projekten zusammengearbeitet. Gemeinsam mit Scott Cook, dem Gründer von Intuit, haben wir für die Harvard Business Review (HBR) den Artikel „Marketing Malpractice“ geschrieben, der die Jobs to Be Done Theory erstmals auf den Seiten der HBR vorstellte. Derzeit ist Taddy Hall in leitender Funktion bei der Cambridge Group (gehört zur Nielsen Company) tätig und leitet das Nielsen Breakthrough Innovation Project. Dabei arbeitet er eng mit weltweit führenden Unternehmen zusammen, auch mit vielen, die in diesem Buch immer wieder erwähnt werden. Noch wichtiger ist jedoch, dass er die Jobs Theory seit Jahren bei seiner Arbeit als Innovationsberater verwendet.
Karen Dillon war Herausgeberin der Harvard Business Review und meine Koautorin bei „Wege statt Irrwege“. Im vorliegenden Buch schlägt sich ihre Perspektive als langjährige leitende Managerin in Medienunternehmen nieder, die sich bemühen, Innovationen richtig hinzubekommen. Im Rahmen unserer Zusammenarbeit versucht sie stets, sich in die Lage des Lesers – in Ihre Lage – zu versetzen. Außerdem ist sie eine meiner zuverlässigsten Verbündeten bei dem Versuch, zwischen den Welten der Gelehrten und der Praktiker eine Brücke zu schlagen.
David S. Duncan ist Seniorpartner der Beratungsfirma Innosight, die ich im Jahr 2000 gegründet habe. Er ist ein führender Denker und berät Spitzen-Führungskräfte hinsichtlich Innovationsstrategien und Wachstum, wobei er ihnen hilft, sich in disruptiven Veränderungen zurechtzufinden, nachhaltiges Wachstum zu schaffen und ihre Unternehmen so zu wandeln, dass sie langfristig florieren. Die Klienten, mit denen er zusammengearbeitet hat, erzählen mir, sie hätten ihre unternehmerische Denkweise vollständig geändert und ihre Unternehmenskultur dahingehend verwandelt, dass sie konkret auf die Aufgaben ausgerichtet ist, die die Kunden erledigt haben wollen. (Ein Kunde hat sogar ein Konferenzzimmer nach ihm benannt.) In den letzten zehn Jahren hat ihn seine Arbeit zur Entwicklung und Umsetzung der Jobs-Theorie zu einem der sachkundigsten und innovativsten Praktiker gemacht.
Wir haben uns zwar dafür entschieden, in diesem Buch überwiegend in der ersten Person zu sprechen – „ich“ –, um es für den Leser leichter lesbar zu machen, aber wir haben es als echte Partner geschrieben. Es ist in hohem Maße das Produkt eines gemeinschaftlichen „Wir“ und unserer vereinten Kompetenzen.
Zum Schluss ein knapper Überblick über den Aufbau des Buches: Teil 1 bietet eine Einführung in die Jobs-Theorie als kausaler Mechanismus, der erfolgreiche Innovationen speist. Teil 2 geht von der Theorie zur Praxis über und beschreibt die anstrengende Arbeit, die Jobs-Theorie auf den chaotischen Tumult der wirklichen Welt anzuwenden. Teil 3 skizziert die Konsequenzen für die Unternehmensund Führungsorganisation sowie die Herausforderungen und Vorteile, die sich ergeben, wenn man sich auf die zu erledigenden Aufgaben – Jobs to Be Done – konzentriert. Damit Ihnen die Reise durch dieses Buch leichter fällt und damit es Ihnen möglichst viel Nutzen bringt, finden Sie am Anfang jedes Kapitels den Grundgedanken und am Ende ein Fazit in Stichpunkten. Am Ende der Kapitel 2 und 9 bringen wir zudem eine Liste von Fragen, die Führungskräfte an ihre Unternehmen richten können und die es ihnen erleichtern, die Ideen in die Praxis umzusetzen.
Wir ziehen es vor, etwas anhand von Beispielen zu zeigen anstatt es in Form von Behauptungen oder Meinungen zu äußern. Wie wir selbst schon bei der Entdeckung von Jobs to Be Done festgestellt haben, sind Geschichten ein effektiveres Mittel, jemandem eine Denkweise beizubringen, als ihm einfach zu sagen, wie er denken soll – darum haben wir in das gesamte Buch Geschichten eingeflochten. Wir hoffen, dass Sie aus der Lektüre dieses Buches ein neues Verständnis davon mitnehmen, wie Sie Ihren Innovationserfolg steigern können.
Mit welcher Aufgabe haben Sie dieses Buch beauftragt?
Organisationen in aller Welt wenden zahllose Ressourcen – unter anderem Zeit, Energie und das Heranziehen von Spitzen-Führungskräften – für die Herausforderung der Schaffung von Innovation auf. Und natürlich optimieren sie ihr Vorgehen auf Effizienz. Wenn jedoch all diese Anstrengungen auf die Beantwortung der falschen Fragen gerichtet sind, dann ruhen sie auf einem äußerst wackligen Fundament.
Ebenfalls William Edward Deming wird die Bemerkung zugeschrieben, dass jeder Prozess perfekt auf die Ergebnisse zugeschnitten sei, die er liefert. Wenn wir der Meinung sind, Innovation sei chaotisch, unvollkommen und nicht durchschaubar, dann kreieren wir Prozesse, die nach dem Prinzip dieser Überzeugungen funktionieren. Und genau das haben viele Unternehmen getan: Sie haben unwissentlich Innovationsprozesse eingerichtet, die Mittelmaß in Perfektion ausspucken. Sie bringen Zeit und Geld für die Erstellung datenlastiger Modelle auf, mit denen sie zwar die Beschreibung in den Griff bekommen, aber mit ihren Vorhersagen scheitern.
Damit brauchen wir uns nicht zufriedenzugeben. Man kann eine bessere Frage stellen – eine Frage, mit deren Hilfe wir die Ursache-Wirkungs-Beziehung verstehen können, die hinter der Entscheidung eines Kunden steckt, ein neues Produkt in sein Leben einzubeziehen. Mit welcher Aufgabe haben Sie dieses Produkt beauftragt? Die gute Nachricht: Wenn Sie den Versuch, die Aufgaben Ihrer Kunden zu verstehen, zu Ihrer Handlungsgrundlage machen, ist Ihre Strategie nicht mehr auf Glück angewiesen. Eigentlich konkurrieren Sie dann mit dem Glück, auf das sich die anderen immer noch verlassen. Sie sehen die Welt mit anderen Augen. Andere Mitbewerber, andere Prioritäten und vor allen Dingen andere Ergebnisse. Dann können Sie Innovationen, die Zufallstreffer sind, hinter sich lassen.
Anmerkungen
1Jaruzelski, Barry, Kevin Schwartz und Volker Staack: „Innovation’s New World Order“, in: strategy+business, Oktober 2015.
2Anderson, Chris: „The End of Theory: The Data Deluge Makes the Scientific Method Obsolete“, in: Wired, 23. Juni 2008.
3Mein Sohn Spencer war in der Little League unserer Stadt ein wirklich guter Werfer. Ich sehe ihn immer noch vor mir, wie er seine großen Hände fest um den Ball schließt, seine Haltung, wenn ein guter Schlagmann auf der Home Plate stand, die Art, wie er sich nach jedem Wurf mit neuer Konzentration innerlich sortierte. In so manchem großen Augenblick ließ er sich nicht aus der Fassung bringen. Irgendwo gibt es Zahlen, aus denen hervorgeht, wie viele Spiele er gewonnen und verloren hat, wie viele Balls und Strikes er geworfen hat und so weiter. Aber nichts davon verrät einem, warum. Die Daten sind nicht das Phänomen. Sie geben das Phänomen zwar wieder, aber nicht sehr gut.
4In den 1950er-Jahren fiel der US Air Force auf, dass Piloten Schwierigkeiten hatten, ihre Flugzeuge zu kontrollieren. Wie Todd Rose, Leiter des Programms „Mind, Brain, and Education“ an der Harvard Graduate School of Education, in „The End of Average“ berichtet, ging die Air Force zunächst davon aus, es liege an schlechter Ausbildung oder an Pilotenfehlern. Es stellte sich jedoch heraus, dass dies keineswegs das Problem war. Die Cockpits wiesen einen Konstruktionsfehler auf: Sie waren für den „durchschnittlichen“ Piloten der 1920er-Jahre gestaltet worden. Da es auf der Hand lag, dass die Amerikaner seither größer geworden waren, beschloss die Air Force, die Körpergröße des „Durchschnittspiloten“ auf den neuesten Stand zu bringen. Dafür wurden bei über 4.000 Piloten fast ein Dutzend verschiedene Maße genommen, die sich darauf bezogen, wie gut sie in das Cockpit passten. Die Air Force dachte sich, wenn sie die Cockpits so umgestalten könnte, dass sie für den Durchschnittspiloten der 1950er-Jahre passten, dann müsste das Problem gelöst sein. Und wie viele Piloten entsprachen nach diesem gigantischen Unterfangen tatsächlich der Definition von „durchschnittlich“? Laut Rose keiner. Jeder einzelne Pilot hatte, wie Rose sich ausdrückte, „Ecken und Kanten“. Manche hatten lange Beine, andere hatten lange Arme. Die Körpergröße korrespondierte nie mit dem gleichen Brust- oder Kopfumfang und so weiter. Die für alle gedachten umgestalteten Cockpits passten eigentlich zu niemandem. Schließlich wischte die Air Force dann ihre Grundannahmen beiseite und der verstellbare Sitz wurde geboren. Im richtigen Leben gibt es nichts „Durchschnittliches“. Und auf den Durchschnitt ausgerichtete Innovationen sind zum Scheitern verurteilt.
Rose, Todd: The End of Average: How We Succeed in a World That Values Sameness, New York, HarperCollins 2015.
5Wir verwenden in diesem Buch die Begriffe „Theory of Jobs to Be Done“, „Jobs Theory“, Jobs-Theorie und Abwandlungen davon, die aber alle das Gleiche bedeuten.
TEIL 1
EINFÜHRUNG IN DIE JOBS-THEORIE
Wir haben uns verlaufen, kommen aber gut voran!
– Yogi Berra
Kapitel 1
Das Milchshake-Dilemma
Der grundgedanke
Warum ist es so schwer, Innovationen vorherzusagen – und sie dauerhaft hervorzubringen? Weil wir bisher nicht die richtigen Fragen gestellt haben. Auch wenn die Disruption als Modell für wettbewerbsfähiges Reagieren erfolgreich ist und sich als dauerhaft nützlich erweist, so sagt sie einem doch nicht, wo man nach neuen Chancen suchen soll. Sie liefert keine Anleitung dafür, wo oder wie ein Unternehmen Innovationen schaffen sollte, um etablierte Marktführer zu schwächen oder neue Absatzmärkte zu schaffen. Die Jobs to Be Done-Theorie hingegen schon.
Warum lässt sich Erfolg so schwer konservieren?
Diese Frage nagte jahrelang an mir. In den ersten Jahren meiner Karriere hatte ich die Gelegenheit, mit vielen in Schwierigkeiten geratenen Unternehmen eng zusammenzuarbeiten, zuerst als Berater bei der Boston Consulting Group und dann als Vorstandsvorsitzender meines eigenen Unternehmens CPS Technologies, das ich zusammen mit mehreren Professoren vom MIT gegründet hatte, um Produkte aus den modernen Werkstoffen herzustellen, die sie entwickelt hatten. Dabei erlebte ich aus erster Hand, dass viele kluge Menschen nicht in der Lage sind, die Probleme von einstmals großartigen Unternehmen zu lösen. Zur gleichen Zeit beobachtete ich den Aufstieg des in Boston heimischen Unternehmens Digital Equipment Company (DEC) zu einem der meistbewunderten Unternehmen der Welt. Wenn man damals las, weshalb es so erfolgreich war, wurde der Erfolg immer der Brillanz der Führungsmannschaft zugeschrieben. Doch dann, etwa um das Jahr 1988, stürzte Digital Equipment in den Abgrund und fiel auseinander. Wenn man damals las, weshalb es so schwer gestrauchelt war, wurde das immer der Inkompetenz der Führungsmannschaft zugeschrieben, also denselben Unternehmenslenkern, die so lange Zeit ungeteiltes Lob geerntet hatten.
Eine Weile erklärte ich mir dies mit der Frage: „Wie konnten kluge Leute bloß so schnell so dumm werden?“ Und so fassten auch die meisten anderen Leute den Untergang von DEC auf. Irgendwie konnte dasselbe Führungsteam, das zu einem Zeitpunkt den Dreh raus hatte, zu einem anderen Zeitpunkt nicht mehr mithalten. Doch die Hypothese vom „dummen Manager“ hielt nicht stand, wenn man berücksichtigte, dass so gut wie alle Minicomputer-Unternehmen der Welt im Gleichschritt kollabierten.
Als ich an die Harvard Business School (HBS) zurückkehrte, um zu promovieren, brachte ich also einige Rätsel mit, die ich wissenschaftlich lösen wollte. Gab es neben schlechtem Management noch etwas anderes, das beim Untergang dieser großartigen Unternehmen eine entscheidende Rolle gespielt hatte? Waren sie anfangs nur deshalb so erfolgreich, weil sie irgendwie Glück gehabt hatten? Waren diese etablierten Unternehmen ins Hintertreffen geraten, verließen sie sich auf veraltete Produkte und gerieten schlicht aus dem Tritt, als einfallsreichere Konkurrenten auf den Plan traten? Waren die Schaffung neuer erfolgreicher Produkte und die Gründung neuer erfolgreicher Unternehmen im Grunde ein Würfelspiel?
Doch nachdem ich mich in meine Forschungen vertieft hatte, wurde mir klar, dass meine Annahmen falsch waren. Ich erkannte, dass selbst die besten und professionellsten Manager – die alles richtig machten und die besten Ratschläge befolgten – ihre Unternehmen den ganzen Weg bis hinauf an die Spitze ihres jeweiligen Marktes führen und dann in den Abgrund stürzen konnten. Fast alle etablierten Unternehmen der Branche, die ich untersuchte – Laufwerkshersteller –, wurden irgendwann von Neulingen mit billigeren und zunächst weit unterlegenen Angeboten geschlagen, die ich als „disruptive Innovationen“ bezeichnete.
Durch diese Arbeit gelangte ich zu der Theorie der disruptiven Innovation 1, die das Phänomen erklärt, dass eine Innovation einen bestehenden Markt oder Sektor transformiert, indem sie Einfachheit, Bequemlichkeit, Zugänglichkeit und Erschwinglichkeit hineinbringt, nachdem Kompliziertheit und hohe Kosten zum Status quo geworden sind – und so die Branche letztlich vollständig neu definiert.
Im Kern ist das eine Theorie der wettbewerbsgetriebenen Reaktion auf eine Innovation. Sie erklärt und sagt das Verhalten von Unternehmen vorher, die Gefahr laufen, einer Disruption zum Opfer zu fallen, und liefert Erkenntnisse über die Fehler, die führende Unternehmen machen, wenn sie auf Bedrohungen reagieren, die anfangs winzig klein erscheinen. Außerdem bietet sie etablierten Unternehmen eine Möglichkeit, vorherzusagen, welche Innovationen, die sich am Horizont abzeichnen, wahrscheinlich die größten disruptiven Bedrohungen darstellen. Jedoch wurde die Theorie der Disruption in den letzten 20 Jahren auf derart breiter Front falsch interpretiert und angewendet, dass sie sich heute auf alles bezieht, was schlau, neu und ambitioniert ist.
Aber die Theorie der disruptiven Innovation sagt einem nicht, wo man nach neuen Chancen suchen soll. Sie sagt nicht voraus und erklärt nicht konkret, auf welche Art ein Unternehmen Innovationen hervorbringen sollte, um die etablierten führenden Unternehmen zu schwächen, oder wo es neue Märkte schaffen sollte. Sie sagt einem nicht, wie man um die Enttäuschung innovativer Versuchsballons herumkommt – sodass man sein Schicksal immer noch dem Glück überlässt. Sie sagt einem nicht, wie man Produkte und Dienstleistungen kreieren soll, für die die Kunden gerne bezahlen – und sie sagt nicht voraus, welche Produkte Erfolg haben werden.
Die Jobs to Be Done-Theorie hingegen tut das.
Milchshakes am Morgen
Mitte der 1990er-Jahre fragten mich zwei Berater aus Detroit, ob sie mich einmal in meinem Büro an der Harvard Business School besuchen könnten, um mehr über meine soeben veröffentlichte Theorie der disruptiven Innovation zu erfahren. Bob Moesta und sein damaliger Partner Rick Pedi bauten damals ein Nischenunternehmen auf, das Bäckerei- und Imbissunternehmen bei der Entwicklung neuer, marktgerechter Produkte beriet.
Als wir über die Theorie der Disruption sprachen, merkte ich, dass sie ganz klar vorhersagte, was die am Markt etablierten Unternehmen tun würden, wenn sie mit einer bevorstehenden Disruption durch kleine Bäckerei- und Imbissunternehmen konfrontiert wären. In dieser Hinsicht lieferte sie eine klare Aussage über Ursache und Wirkung. Doch im Laufe des Gesprächs wurde deutlich, dass die Theorie der Disruption keine Anleitung für die Kunden lieferte. Sie bietet keine klare und vollständige kausale Erklärung, was ein Unternehmen offensiv unternehmen sollte, um erfolgreich zu werden: Wenn Sie dies tun und nicht jenes, dann werden Sie gewinnen. Mir wurde klar, dass selbst dann, wenn ein Unternehmen die Disruption eines angreifbaren etablierten Unternehmens beabsichtigt, die Chancen, dass es exakt das richtige Produkt oder die richtige Dienstleistung kreiert, um dies zu erreichen, wahrscheinlich bei weniger als 25 Prozent stehen.
Seit Jahren hatte ich mich darauf konzentriert zu verstehen, weshalb großartige Unternehmen scheitern, doch nun wurde mir klar, dass ich nie wirklich über das umgekehrte Problem nachgedacht hatte. Woher wissen erfolgreiche Unternehmen, wie sie wachsen können?
Erst nach Monaten hatte ich eine Antwort gefunden. Moesta erzählte mir von einem Projekt für eine Fast-Food-Kette. Es ging darum, wie sie mehr Milchshakes verkaufen könnte. Die Kette hatte Monate damit verbracht, das Problem unglaublich detailliert zu untersuchen. Sie hatte Kunden eingeladen, die dem Profil des typischen Milchshake-Käufers entsprachen, und sie mit Fragen bombardiert: „Können Sie uns sagen, wie wir unsere Milchshakes so verbessern könnten, dass Sie mehr davon kaufen? Sollen sie billiger sein? Stückiger? Dickflüssiger sein? Schokoladiger?“ Selbst wenn die Kunden erklärten, was sie ihrer Meinung nach mögen würden, war es schwer, daraus abzuleiten, was zu tun war. Die Kette probierte vieles aus, um auf das Kundenfeedback zu reagieren, und brachte Innovationen heraus, die dafür gedacht waren, die größtmögliche Anzahl von potenziellen Milchshake-Käufern zufriedenzustellen. Innerhalb von Monaten passierte etwas Bemerkenswertes: gar nichts. Nach all den Bemühungen der Marketingfachleute änderte sich am Umsatz der Kette in der Kategorie Milchshakes nichts.
Deshalb dachten wir uns, wir gehen an die Frage völlig anders heran: Ich frage mich, welche Aufgabe im Leben der Menschen auftaucht, die sie veranlasst, in dieses Restaurant zu kommen, um einen Milchshake zu „beauftragen“.
Ich hielt das für eine interessante Art, über das Problem nachzudenken. Dass die Kunden nicht einfach ein Produkt kauften, sondern den Milchshake damit beauftragten, in ihrem Leben eine bestimmte Aufgabe zu erledigen – einen Job zu erledigen. Das, was uns veranlasst, Produkte und Dienstleistungen zu kaufen, sind Dinge, die uns allen den ganzen Tag lang und tagtäglich passieren. Bei uns allen treten im Alltagsleben Aufgaben auf, die wir erledigen müssen, und um dies zu tun, beauftragen wir Produkte oder Dienstleistungen.
Mit dieser Perspektive bewaffnet, stellte sich das Team eines Tages 18 Stunden lang in ein Restaurant und beobachtete die Menschen. Zu welchen Zeiten kauften die Menschen Milchshakes? Wie waren sie gekleidet? Waren sie allein? Kauften sie daneben noch etwas anderes zu essen? Tranken sie die Milchshakes im Restaurant oder fuhren sie damit weg?
Es stellte sich heraus, dass eine überraschende Zahl von Milchshakes vor 9:00 Uhr an Menschen verkauft wurde, die allein ins Fast-Food-Restaurant kamen. Und fast immer kauften sie nichts anderes. Sie blieben nicht da, um den Shake vor Ort zu trinken, sondern stiegen in ihre Autos und fuhren damit weg. Daher fragten wir sie: „Entschuldigung, ich habe da eine Frage. Welche Aufgabe wollten Sie erledigen, die Sie veranlasst hat, hierher zu kommen und diesen Milchshake zu beauftragen?“
Zunächst fiel es den Kunden schwer, diese Frage zu beantworten, und wir fragten nach, was sie manchmal anstelle eines Milchshakes beauftragten. Dabei wurde bald klar, dass die morgendlichen Kunden alle die gleiche Aufgabe zu erledigen hatten: Sie hatten eine lange, langweilige Fahrt zur Arbeit vor sich. Sie brauchten etwas, um die Fahrt interessant zu gestalten. Eigentlich hatten sie noch keinen Hunger, aber sie wussten, dass ihnen in ein paar Stunden, wie vormittags üblich, der Magen knurren würde. Es stellte sich heraus, dass es viele Mitbewerber um diese Aufgabe gab, aber keiner die Aufgabe perfekt erfüllte. „Ich beauftrage manchmal Bananen. Aber glauben Sie mir: Nehmen Sie keine Bananen. Die sind gleich weg – und am Vormittag ist man wieder hungrig“, sagte uns ein Kunde. Doughnuts krümeln zu sehr und machen die Finger klebrig, sodass sie die Kleidung und das Lenkrad verschmutzen, wenn man versucht, gleichzeitig zu essen und zu fahren. Bagels sind oft trocken und fade – sodass die Leute mit den Knien lenken müssen, während sie Frischkäse und Marmelade auf die Bagels streichen. Ein anderer Pendler bekannte: „Einmal habe ich einen Snickers-Schokoriegel beauftragt. Aber ich hatte so große Schuldgefühle, weil ich zum Frühstück eine Süßigkeit gegessen hatte, dass ich das nie wieder tat.“ Aber ein Milchshake? Der ist für alle das Beste. Es dauert lange, bis man den dickflüssigen Milchshake mit dem dünnen Strohhalm ausgetrunken hat. Und er ist gehaltvoll genug, um die lauernde Hungerattacke am Vormittag abzuwenden. Ein Pendler schwärmte: „Dieser Milchshake! Er ist so dick! Ich brauche locker 20 Minuten, um ihn mit diesem dünnen Strohhalm auszutrinken. Wen kümmert es, was drin ist – mich jedenfalls nicht. Ich weiß nur, dass ich morgens satt bin. Und er passt genau in meinen Becherhalter“, dabei hielt er seine freie Hand hoch. Da zeigte sich, dass Milchshakes die Aufgabe besser erledigen als alle Konkurrenten – was in den Augen der Kunden nicht nur Milchshakes von anderen Ketten sind, sondern auch Bananen, Bagels, Doughnuts, Frühstücksriegel, Smoothies, Kaffee und so weiter.
Als das Team alle Antworten zusammenführte und sich die unterschiedlichen Profile der Menschen ansah, wurde noch etwas klar: Das, was diese Milchshake-Käufer gemeinsam hatten, hatte nichts mit ihren individuellen demografischen Merkmalen zu tun. Vielmehr hatten sie am Morgen die gleiche Aufgabe zu erledigen.
„Mir bei der morgendlichen Fahrt zur Arbeit helfen, wach und beschäftigt zu bleiben, und gleichzeitig die Fahrt unterhaltsamer machen.“ Da hatten wir die Antwort!
Doch ganz so einfach war es leider nicht.
Sehr viele Milchshakes werden nämlich auch am Nachmittag und am Abend gekauft, was nichts mit der Fahrt zur Arbeit oder zurück zu tun hat. In diesen Fällen beauftragen dieselben Kunden einen Milchshake möglicherweise mit einer völlig anderen Aufgabe. Eltern müssen ihren Kindern die ganze Woche lang bei unzähligen Dingen Nein sagen: Nein, kein neues Spielzeug. Nein, du kannst nicht länger aufbleiben. Nein, du bekommst keinen Hund. Ich merkte, dass ich einer von diesen Vätern war, die nach einem Zeitpunkt suchen, um einen Draht zu ihren Kindern zu finden. Ich hatte nach etwas Harmlosem gesucht, zu dem ich Ja sagen konnte – damit ich mir wie ein netter, liebevoller Papa vorkomme. Also stehe ich am späten Nachmittag mit meinem Sohn in der Schlange und bestelle mein Essen. Dann hält mein Sohn kurz inne, schaut zu mir auf, wie es nur ein Sohn kann, und fragt mich: „Papa, kriege ich auch einen Milchshake?“ Das ist der richtige Moment. Wir sind nicht zu Hause, wo ich meiner Frau verspreche, zur Mittagszeit nicht zu viele ungesunde Naschereien zu erlauben. Wir sind an einem Punkt, an dem ich zu meinem Sohn endlich Ja sagen kann, weil dies ein besonderer Anlass ist. Ich lege Spence die Hand auf die Schulter und sage: „Aber natürlich bekommst du einen Milchshake.“ In diesem Moment konkurriert der Milchshake nicht wie der morgendliche Milchshake gegen eine Banane oder ein Snickers oder einen Doughnut. Er tritt dagegen an, dass wir beim Spielzeugladen halten oder dass ich mir später Zeit nehme, mit meinem Sohn Fangen zu spielen.
Bedenken Sie, wie sehr sich diese Aufgabe von der Aufgabe des Pendlers unterscheidet – und wie anders die Mitbewerber für die Erledigung dieser Aufgabe sind. Stellen Sie sich vor, die oben erwähnte Fast-Food-Kette würde einem Vater wie mir bei einer Kundenbefragung die oben erwähnte Frage stellen. „Wie können wir diesen Milchshake so verbessern, dass Sie mehr davon kaufen würden?“ Welche Antwort wird ihr dieser Vater geben? Die gleiche wie der morgendliche Pendler?
Die morgendliche Aufgabe verlangt einen dickflüssigeren Milchshake, bei dem es lange dauert, bis er während der langen, langweiligen Fahrt ausgetrunken ist. Man könnte Fruchtstücke hineingeben, allerdings nicht, um ihn gesünder zu machen. Mit dieser Aufgabe wird er ja gar nicht beauftragt. Vielmehr würden Obststücke oder gar Schokoladenstücke bei jedem Zug aus dem Strohhalm eine kleine „Überraschung“ bieten und dazu beitragen, dass die Fahrt auf die Arbeit interessant bleibt. Man könnte sich auch vorstellen, dass der Dispenser vorne an der Theke statt dahinter steht und dass die morgendlichen Pendler eine Magnetkarte durchziehen können – sie würden hereinkommen, schnell einen Becher mit Milchshake füllen und schon wären sie wieder weg.
Am Nachmittag bin ich zwar derselbe Mensch, aber unter ganz anderen Umständen. Die Aufgabe des Vaters, der am Nachmittag seine Kinder versöhnlich stimmen und sich wie ein guter Vater fühlen will, sieht ganz anders aus. Vielleicht sollte es den Nachmittags-Milchshake auch in der halben Menge geben, damit er schneller ausgetrunken ist und bei Papa weniger Schuldgefühle weckt. Hätte sich das Fast-Food-Unternehmen nur auf die Frage konzentriert, wie es sein Produkt im allgemeinen Sinne „besser“ machen könnte – dicker, süßer, größer –, hätte es sich auf das falsche Untersuchungsobjekt konzentriert. Man muss die Aufgabe verstehen, die ein Kunde unter bestimmten Umständen erledigen will. Würde das Unternehmen einfach versuchen, einen Durchschnitt aus den Antworten der Väter und der Pendler zu bilden, ergäbe sich ein zu niemandem passendes Einheitsprodukt, das keine der Aufgaben gut erledigt.
Und darin liegt der Aha-Effekt.
Die Menschen beauftragen Milchshakes im Laufe des Tages entsprechend den ganz unterschiedlichen Umständen mit zwei ganz unterschiedlichen Aufgaben. Zu jeder Aufgabe gibt es eine völlig andere Gruppe von Konkurrenten – am Morgen beispielsweise Bagels, Energieriegel und Fruchtsaft in Flaschen, am Nachmittag hingegen konkurriert der Milchshake mit einem Zwischenstopp beim Spielzeugladen oder einer eiligen Heimfahrt, um noch ein paar Körbe werfen zu können – und deshalb muss er an ganz unterschiedlichen Kriterien für die beste Lösung gemessen werden. Daraus folgt, dass es für die Fast-Food-Kette, die mehr Milchshakes verkaufen will, wahrscheinlich keine einzelne Lösung gibt, sondern zwei. Eine Einheitslösung würde keine der beiden Aufgaben lösen.
Ein Bewerbungsschreiben für Margarine
Für mich war es ein aufregender Durchbruch, Innovationsaufgaben durch die Brille von Aufgaben zu betrachten, die Kunden erledigt haben wollen. Dadurch gewann ich etwas, das mir die Theorie der Disruption nicht liefern konnte: die Erkenntnis, was Kunden veranlasst, Produkte oder Dienstleistungen in ihr Leben einzubeziehen.
Die Betrachtung aus der Perspektive von Aufgaben leuchtete mir derart unmittelbar ein, dass ich sie unbedingt bei anderen Unternehmen ausprobieren wollte, die Schwierigkeiten mit Innovationen hatten. Das ergab sich schon bald in unerwarteter Form. Die Gelegenheit ergab sich durch Margarine. Kurz nachdem wir das Milchshake-Dilemma abgearbeitet hatten, bereitete ich mich auf einen Besuch von Unilever-Managern in meinem Unterrichtsraum an der Harvard Business School vor. Zu den Wochenzielen gehörte es, über Innovationen in der Kategorie Margarine zu sprechen – damals ein Milliardengeschäft. Unilever beherrschte circa 70 Prozent des US-amerikanischen Margarinemarkts. Wenn man einen derart großen Marktanteil hat und bereits eine große Vielfalt von Margarineprodukten anbietet, ist schwer zu erkennen, woher weiteres Wachstum kommen soll. Ich war zuversichtlich, dass die Jobs Theory Unilever eine Chance bieten würde, sein Wachstumspotenzial zu überdenken, aber dazu kam es nicht. Doch dafür half mir das Dilemma von Unilever zu verstehen, weshalb einer der wichtigsten Grundsätze der Innovation – das, was die Kunden zu den Entscheidungen veranlasst, die sie treffen – bei den meisten Unternehmen offenbar nicht verfängt.
Und das kam so: Von unseren Milchshake-Erkenntnissen angeregt, saßen meine Tochter Ann und ich in der Küche und überlegten uns, mit welcher Aufgabe wir Margarine betrauen könnten. In unserem Fall wurde sie oft damit beauftragt, das Popcorn gerade ausreichend zu befeuchten, damit das Salz daran haftet. Das machte sie aber nicht annähernd so gut wie die wohlschmeckendere Butter. Also machten wir uns zur Feldforschung im örtlichen Star Market auf, um zu schauen, ob wir dort mehr darüber erfahren würden, warum Menschen diesen Butterersatz kaufen. Sofort überraschte uns die überwältigende Produktvielfalt. So um die 21 verschiedene Margarinesorten lagen direkt neben ihrer Nemesis, der Butter. Wir dachten, wir hätten den Hauptvorteil der Margarine erkannt: Da sie weniger Fett enthält, galt sie damals vielleicht als gesünder. 2 Und sie war billiger als Butter. Die 21 Möglichkeiten unterschieden sich zwar leicht voneinander, aber die Unterschiede konzentrierten sich offenbar auf die Verbesserung einer bestimmten Eigenschaft – des Fettanteils –, die bei allen Aufgaben, für die wir Margarine engagiert hätten, irrelevant war. Als wir da standen und zuschauten, wofür sich die Menschen entschieden, konnten wir uns nicht zusammenreimen, weshalb sie sich für das eine statt des anderen Produkts entschieden. Ebenso wie bei den Milchshakes bestand keine offenkundige Korrelation zwischen der Demografie der Käufer und ihren Entscheidungen.
Wir sahen zu, wie die Menschen ihre Auswahl trafen, und fragten uns: „Welche Aufgabe sehen wir hier?“ Je länger wir da standen, desto klarer wurde uns, dass die Entscheidung nicht einfach zwischen Margarine und Butter stattfand. Uns wurde klar, dass wir im Gang mit den Kühlregalen gar nicht alle denkbaren Konkurrenten der Margarine sahen. Margarine konnte mit der Aufgabe beauftragt werden: „Ich brauche etwas, das die Brotkruste aufweicht, damit sie leichter zu kauen ist.“ Die meisten Margarine- und Buttersorten sind allerdings so hart, dass sie das Brot zerreißen – dann hat man einen großen Brocken Fett in der Mitte des Brotes, das ohnehin leicht zu kauen ist, aber sie lassen sich nur schwer zum Rand hin verstreichen, wo sie am meisten gebraucht werden. Mitbewerber für diese Aufgabe können zum Beispiel Butter, Frischkäse, Olivenöl, Mayonnaise und so weiter sein, die aber meiner Meinung nach alle nach nichts schmecken. 3 Oder die Margarine wurde mit einer ganz anderen Aufgabe beauftragt – damit beim Kochen das Essen nicht anbrennt. Zu den Mitbewerbern für diese Aufgabe zählen unter anderem Teflon und Antihaft-Spray. Beide Produkte befanden sich in ganz anderen Gängen und keinen davon konnten wir von der Kühlabteilung aus sehen.
Wenn man den Markt für Margarine aus der Perspektive der Dinge betrachtet, mit denen sie in den Köpfen der Verbraucher wirklich konkurriert, eröffnen sich neue Wachstumsmöglichkeiten. Wenn eine Kundin sich entscheidet, ein bestimmtes Produkt statt eines anderen zu kaufen, dann hat sie eine Art Bewerbungsschreiben der Konkurrenzprodukte im Kopf, aus denen hervorgeht, welches ihre Aufgabe am besten erfüllt. Stellen Sie sich vor, Sie würden für alle konkurrierenden Produkte Bewerbungen schreiben. Butter – das Produkt, das wir anfangs für den Hauptkonkurrenten von Margarine gehalten hatten – könnte beauftragt werden, Lebensmitteln Geschmack zu verleihen. Sie ist aber nicht immer die Konkurrentin von Margarine. Man könnte auch eine Bewerbung für Teflon schreiben, eine für Olivenöl und eine für Mayonnaise. Womöglich beauftragen die Menschen das gleiche Produkt zu verschiedenen Zeiten mit verschiedenen Aufgaben – ähnlich wie beim Milchshake. Unilever mag einen großen Anteil an dem gehabt haben, was die Marketingfachleute als Streichfettgeschäft definiert hatten, aber es geht ja kein Kunde in den Laden und sagt: „Ich brauche etwas aus der Kategorie Streichfette.“ Die Kunden gehen mit einer bestimmten Aufgabe, die sie erledigt haben wollen, in den Laden.
Wir haben an jenem Tag im Lebensmittelmarkt wohl nicht alle anderen Produkte korrekt identifiziert, gegen die Margarine konkurriert, aber eines wurde uns klar: Aus Sicht der Jobs to Be Done Theory war der Markt für Margarine womöglich größer als gemäß den Kalkulationen von Unilever.
Ich war mir der Macht dieser Erkenntnis so sicher, dass wir diese Denkweise den Unilever-Managern vorlegten, die zu dem Manager-Schulungsprogramm der HBS kamen. Ich erklärte ihnen, wenn sie alle Aufgaben ermitteln könnten, mit denen Kunden Margarine beauftragen, könnten sie vielleicht darauf kommen, wie sie ihren Umsatz auf andere Weise steigern konnten.
Leider verlief das Gespräch nicht so gut. Vielleicht fehlten uns damals die richtigen Worte, um unser Denken zu erklären, jedenfalls waren die anwesenden Unilever-Manager von dem, was wir zu sagen versuchten, kein bisschen beeindruckt. Ich zog sogar die Pause vor und regte an, danach mit einem anderen Thema weiterzumachen. Auf das Thema Jobs to Be Done kamen wir nicht mehr zurück.
Ich zweifle nicht daran, dass die anwesenden Unilever-Manager erfahrene, qualifizierte Führungskräfte waren. Doch ihre laue Reaktion warf bei mir die Frage auf, wie viele Unternehmen wohl innerhalb derart festgefahrener Annahmen in Bezug auf Innovationen operieren, dass es ihnen schwerfällt, einen Schritt zurückzutreten und zu beurteilen, ob sie überhaupt die richtigen Fragen stellen. Führungskräfte werden mit Daten über ihre Produkte überschwemmt. Sie kennen ihre Marktanteile bis zur x-ten Stelle nach dem Komma, sie wissen, wie sich ihre Produkte auf verschiedenen Märkten verkaufen, sie kennen die Gewinnspannen Hunderter verschiedener Artikel und so weiter. Doch all diese Zahlen drehen sich um die Kunden und um das Produkt an sich – und nicht darum, wie gut das Produkt die Aufgaben der Kunden löst. Nicht einmal Kennzahlen zur Kundenzufriedenheit, die offenbaren, ob ein Kunde mit einem Produkt glücklich ist oder nicht, geben irgendwelche Hinweise darauf, wie es seine Aufgabe besser erfüllen könnte. Trotzdem verfolgen und messen die meisten Unternehmen ihren Erfolg auf diese Art.