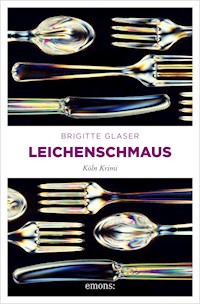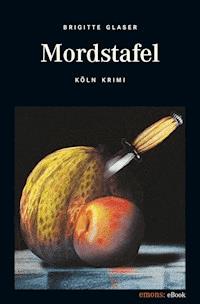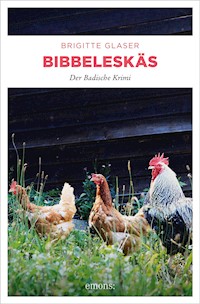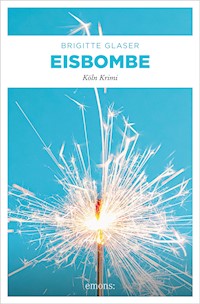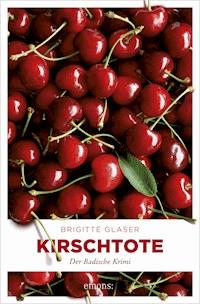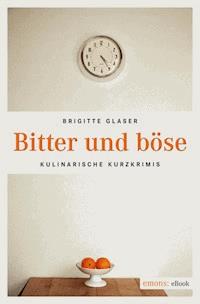Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Der Badische Krimi
- Sprache: Deutsch
Nach dem plötzlichen Tod ihrer Patentante Rosa erbt Katharina deren Haus und Hof. Bald mehren sich ihre Zweifel an dem angeblich natürlichen Tod der alten Frau. Wer ist in ihr Haus eingebrochen? Warum hat Rosa sich geweigert, ihre Felder als Bauland zu verkaufen? Wohin sind ihre Bienenstämme verschwunden? Oder hat Rosas Tod etwas mit ihrer Rolle in der Mais-Guerilla zu tun, die gegen den Einsatz von tödlichen Insektiziden kämpft? Um die Rätsel zu lösen, muss Katharina tief in Rosas Geschichte eintauchen und damit auch in ihre eigene Vergangenheit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 477
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Brigitte Glaser, Jahrgang 1955, stammt wie ihre Heldin aus dem Badischen und lebt und arbeitet seit fast dreißig Jahren in Köln. Bei Emons erschienen ihre Katharina-Schweitzer-Romane »Leichenschmaus«, »Kirschtote«, »Mordstafel« und »Eisbombe«. Sie ist außerdem die Autorin der Stadtteilkrimis »Tatort Veedel« im Kölner Stadt-Anzeiger. Die bisherigen 33Kurzkrimis erschienen im Emons Verlag in einem Sammelband.
Näheres über die Autorin:
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig.
Im Anhang finden sich Rezepte für Bienenstich und andere Honigspezialitäten.
© 2014 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagzeichnung: Heribert Stragholz eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-86358-653-9 Der Badische Krimi Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de
Für Bernd, Beate und Martina
EINS
Neun kopflose Hühner torkeln wild durcheinander und spritzen mit ihrem Blut zackige Muster auf den grauen Kachelboden. Mit dem Beil in der Hand jage ich das zehnte Huhn durch die blutverschmierte Küche. Coq au vin steht auf dem Speiseplan, im Restaurant poltern die hungrigen Gäste. Das zehnte Huhn gackert nervös und entwischt mir mit wildem Flügelschlagen jedes Mal, wenn ich es am Hals packen will. Aber ich kann erst anfangen zu kochen, wenn ich auch das letzte Huhn geköpft und dann alle gerupft und ausgenommen habe.
Das Telefon riss mich aus diesem Hühnerblutbad. Ein jobbedingter Alptraum. Köche träumen gern so einen Scheiß.
»Ja?«, raunzte ich in den Hörer.
»Kannst wenigstens Guten Morgen sagen!«
Auch heute noch, fünfundzwanzig Jahre nachdem ich ausgezogen war, konnte es Martha nicht lassen, mich im Kasernenton in aller Herrgottsfrühe aus dem Bett zu klingeln. Meist nutzte meine Mutter meinen schlaftrunkenen Zustand, um mir Vorwürfe zu machen. Nie würde ich mich melden, die eigenen Eltern wären mir egal, immer vergäße ich Familienfeste.
»Mama«, stöhnte ich und versuchte die kopflosen Hühner zu verscheuchen. »Was willst du diesmal?«
»Tante Rosa ist tot.«
Die Hühner verschwanden sofort, stattdessen klumpte sich mein Magen zu einem harten, schmerzenden Etwas zusammen.
»Die Beerdigung ist am Freitag«, hörte ich Martha sagen, »’s wär besser, du kommst heut schon. Auch wegen dem Testament.«
Der Klumpen in meinem Magen zog sich fester zusammen. Ich ließ mich an der Wand auf dem Fußboden nieder, zog die Knie eng an den Körper, in der Hoffnung, dass es dann nicht so weh tat.
»Katharina? Du kommst doch?«
»Ja«, murmelte ich und legte auf.
Eine frühe Bahn rumpelte über den Gotenring, der Dackel aus der Wohnung über uns kläffte, auf der Kasemattenstraße startete ein Auto. Die Stadt erwachte. Ohne mich. Ich war nicht da.
Von dem geträumten Hühnergemetzel wanderten meine Gedanken zu Rosas Schlachtfesten. Anfang der siebziger Jahre schlachtete kaum ein Bauer mehr zu Hause, alle brachten ihre Schweine oder Kälber direkt zum Metzger, holten sich dort die fertige Wurst und das portionierte Fleisch für die Gefriertruhe ab. Nicht so Rosa. Ein kriegsversehrter, einbeiniger Fleischer aus dem Hanauerland tötete und zerlegte das Schwein für sie. Ich muss acht oder neun Jahre alt gewesen sein, als ich zum ersten Mal dabei war. Sie zwang mich zuzusehen, wie der Einbeinige das Schwein erschoss. »Es hat Angst vor dem Tod, wie jede Kreatur«, sagte sie, als der Fleischer der quietschenden Sau den Bolzen an die Stirn drückte. »Schau ihr in die Augen«, befahl sie. »Sie stirbt, damit wir in den nächsten Monaten gut zu essen haben. – Fressen und gefressen werden, so geht es zu auf unserer Welt!« Geschockt nahm ich die plötzliche Stille im Hof wahr, nachdem der Schlachter die Sau von ihrer Angst erlöst hatte. Ich wartete nicht, bis er das tote Tier mit heißem Wasser überbrühte und ihm mit Ketten die Borsten abrieb. Ich stolperte zu meinem Fahrrad, schwang mich auf den Sattel und raste am Bach entlang die Talstraße hinunter, immer schneller und schneller, bis mir der Wind um die Ohren pfiff. Ich wollte Rosa nie wieder besuchen. Ich hasste sie, weil sie so brutal, direkt und ohne viel Federlesen war.
Immer noch zusammengekrümmt wie ein Embryo schreckte ich auf, als mich jemand an der Schulter berührte.
»Kathi!«, murmelte Ecki. »Hast schlecht geträumt?«
»Rosa ist tot«, sagte ich.
»Rosa?«, fragte Ecki.
Nicht mal Ecki hatte ich von Rosa erzählt! Wie hatte ich Rosa nur für so lange Zeit vergessen können?
»Sie war meine Patentante.«
»Vielleicht erbst was!«, rief er, während er im Bad nach Papiertaschentüchern für mich suchte. »Ein bissl Extrageld könnt dich und die Weiße Lilie über das nächste halbe Jahr retten. – Hat’s überhaupt was zum Vererben?«
»Ich hab mich bestimmt zehn Jahre nicht bei ihr gemeldet«, schniefte ich.
Ecki rupfte ein Taschentuch aus der Plastikpackung und drückte es mir in die Hand. »Vor zehn Jahren haben wir zwei uns kennengelernt«, sagte er.
Und sofort fiel mir ein, wann ich Rosa zum letzten Mal gesehen hatte. Die Silberhochzeit meiner Eltern, großes Familienfest, ich, frisch verliebt, zum ersten Mal mit Ecki in Fautenbach. Während er reihenweise meine Tanten und Kusinen mit seinem Wiener Charme einwickelte, nahm Rosa mich zur Seite und sagte: »Der ist ein Hallodri! Lass die Finger davon, bevor’s richtig wehtut.« Ich stellte ihr Ecki an dem Abend nicht vor und erzählte Ecki nicht, was sie über ihn gesagt hatte, erzählte ihm eigentlich überhaupt nichts über sie. Den Satz mit dem Hallodri hatte ich ihr übel genommen, wie so vieles. Dabei hatte sie recht gehabt, wie bei so vielem.
Ein paar Stunden später fegte ich über die Frankfurter Autobahn in Richtung Süden. Während hinter dem Siebengebirge die Sonne unterging, sang Billie Holiday »Travelin’ Light«, eines von Rosas Lieblingsstücken. Das Stück hatte sie, genau wie die Musik von Glenn Miller, aus Amerika mitgebracht, als sie Ende der vierziger Jahre mit Karl nach Fautenbach kam. Die zwei hatten sich in New York kennengelernt, Rosa hatte dort als Köchin, Karl als »Tschoffr«, wie Rosa es in ihrem harten, alemannisch gefärbten Englisch ausdrückte, gearbeitet. Es brauchte zwei Jahre Englischunterricht, bis ich kapierte, dass »Tschoffr« nichts anderes als Chauffeur bedeutete.
Musikhören mit Rosa war den kalten Winternachmittagen vorbehalten, wenn es auf dem Feld und im Garten nichts zu tun gab und ich sie mit Fragen zu ihrem Leben in New York löchern durfte. Nie hat sie mir alle beantwortet. Von Rosas Ami-Musik mochte ich als Kind schnelle, fröhliche Stücke wie »Chattanooga Choo Choo« oder »Pennsylvania 6-5000« gern, besonders wenn Rosa mit mir dazu Boogie tanzte. Den traurigen Blues von Billie Holiday verstand ich erst, als mir zum ersten Mal das Herz gebrochen wurde.
Es war nach Mitternacht, als ich in Achern von der Autobahn abfuhr. Am Ortseingang von Fautenbach erinnerte mich die riesige Holzzwiebel sofort wieder an Rosa. Im ewigen Wettstreit mit Traudl um die größte Zwiebel hatte sie beim jährlichen »Ziwwlfescht« öfter als ihre Nachbarin den ersten Platz ergattert. Dabei war Traudl die Frau mit dem grünen Daumen und nicht Rosa. Die Zwiebelfelder, die früher die Scherwiller Straße säumten, hatten einem Neubaugebiet weichen müssen. Jahrelang war hier nicht gebaut worden, aber auf einmal säumten frisch gestrichene Einfamilienhäuschen die Straße. Selbst in so einem kleinen Kaff wie meinem Heimatdorf blieb nichts, wie es war.
Als ich im Hof der Linde parkte, lag die Gaststube bereits im Dunkeln. Auch im Schlafzimmer meiner Eltern brannte kein Licht mehr. Ich hatte Martha überhaupt nicht Bescheid gegeben, dass ich tatsächlich heute schon kommen würde. Wenn ich meine Mutter jetzt wach klingelte, würde sie, aus dem Schlaf gerissen und schlecht gelaunt, sofort eine geballte Ladung Vorwürfe über mir ausschütten. Nichts, was ich jetzt gebrauchen konnte.
Kurz entschlossen stieg ich wieder ins Auto. »Fautenbach ist ein Straßendorf«, hatte uns Fräulein Giersig in Heimatkunde beigebracht, »es wurde nur rechts und links entlang des Baches gebaut. Deshalb ist es fast vier Kilometer lang, aber nicht mal einen halben Kilometer breit.« Und diese vier Kilometer fuhr ich durch die stille Talstraße bis hinauf zum Weber-Hof und zur Ölmühle. Dahinter lag Rosas Haus. Es war das letzte im Dorf, ein altes Fachwerkhaus mit einer separaten Tabakscheune. Rosas Garten zog sich bis zu den Kirschbaumhügeln hin, hinter den Bohnenstangen stapelten sich ihre bunten Bienenstöcke. Der Hühnerhof lag in Richtung Bach, ein Maisfeld verdeckte dessen Lauf. Aber natürlich wusste ich, wie er sich von der Schwend aus in vielen Serpentinen den Schwarzwald hinunterschlängelte, bis er im Unterdorf in die Acher floss.
Ich parkte unter der alten Kastanie und stieg aus. Der Kies knirschte unter meinen Füßen, der Bach murmelte leise, ein leichter Sommerwind ließ die Maisblätter hinter dem Hühnerhof rascheln und wehte den Duft reifer Zwetschgen vom Garten zu mir herüber. Alles unglaublich vertraut. Viele Jahre lang war mir dieser Ort Heimat gewesen, weit mehr als mein Zuhause in der Linde.
Ihr Ersatzschlüssel lag immer noch unter Schnurresten in einem alten Bastkörbchen auf der Fensterbank. Rosa hatte das Versteck nicht geändert, aber der Schlüssel war ein anderer. Sie hatte das Schloss austauschen lassen. Auf den ersten Blick war dies die einzige Neuerung in Rosas Haushalt. Im schmalen Flur, von dem aus eine steile Treppe zu den Schlafzimmern führte, hingen noch die Bilder aus gepressten Blumen, das graue Wandtelefon und das Poster mit den New Yorker Bauarbeitern beim Frühstück in luftiger Höhe, das ich ihr zum siebzigsten Geburtstag geschenkt hatte. Wie immer führte mein erster Weg in die Küche. Beim Lichtanmachen stolperte ich über eine Wurstmaschine und sah sofort, dass hier alles zum Schlachten bereitstand: die ausgespülten Konservendosen auf dem Tisch, die großen Töpfe auf dem Herd und eben diese Wurstmaschine, die genauso aussah wie die, die der einbeinige Schlachter immer im Gepäck gehabt hatte. Hielt sich Rosa tatsächlich noch eine Sau?
Ich öffnete die Tür zum Garten, in deren Rahmen sich ein altmodischer brauner Fliegenfänger, schwarz gepunktet von Fliegenleichen, kringelte, und ging nach draußen. Ich roch die Sau, bevor ich sie sah. Sie stand in einer Box von Rosas altem Schweinestall, schaute mich mit ihren kleinen, wässrigen Augen neugierig an und grunzte gierig. Ich schüttete ihr aus einem Eimer ein paar gekochte Kartoffeln in den Futtertrog, mischte Wasser darunter und beobachtete, wie sie sich schlabbernd darüber hermachte. Sie war fett und schwer, reif für den Schlachter.
Zurück in der Küche trieb mich mein leerer Magen in die Speisekammer. Diese roch wie früher nach Geräuchertem. Ich entdeckte zwei schwarz glänzende Speckseiten und je eine Kette schrumpeliger Leberwürstchen und Landjägerle. In den Regalen thronten in großen Gläsern und irdenen Töpfen Rosas Spezialitäten: süßsauer eingelegte Sauerkirschen, Zimtzwetschgen, Dillgurken und natürlich gläserweise Honig. Blüten-, Raps-, Löwenzahn-, Kastanienhonig, Rosas ganzer Stolz. Von allen Arbeiten auf dem Hof hatte ihr die Imkerei am meisten Freude gemacht. Ich riss eines der Leberwürstchen ab, fand im Kühlschrank Senf und ein Ulmer Bier, schob auf dem Küchentisch ein paar Konservendosen, alte Zeitungen und anderen Papierkram beiseite und setzte mich. Die Küche roch nach Rosa. Unvorstellbar, dass sie nie mehr zur Tür hereinkommen sollte.
Irgendwann schlenderte ich hinüber in die gute Stube, wo immer noch das Schränkchen mit den alten Ami-Schallplatten stand, neben dem inzwischen ein neuer Computer seinen Platz gefunden hatte, auch ein Internetmodem entdeckte ich. Irgendwie passte es zu ihr, dass sie sich auf ihre alten Tage noch auf das World Wide Web eingelassen hatte. Den abgewetzten rot-gelben Perserteppich sprenkelten kleine weiße Papierschnipsel, wie sie bei feinen Ausschneidearbeiten entstanden, regelrecht groß und grobschlächtig wirkte dazwischen der abgerissene Knopf einer Drillichjacke. Den hob ich auf, legte ihn in das Nähkästchen in der Kommode, fand darin die alten Goldknöpfe, meinen Schatz aus Kinderzeiten. Zwischen dem Gold kringelte sich ein bunt geflochtenes Freundschaftsbändchen neueren Datums. Ich ließ die weichen Baumwollfäden durch die Finger gleiten und besah mir das Foto, das schon seit Ewigkeiten über der Kommode an der Wand hing: Rosa und Karl beim Entenfüttern im Central Park, ein freudig in die Kamera blickendes junges Paar. Ein Bild, aufgenommen kurz bevor sie erfuhren, dass sie nach Deutschland zurückmussten. Wie wäre Rosas Leben verlaufen, wenn sie in Amerika geblieben wäre? Wäre sie glücklicher, zufriedener, erfolgreicher gewesen? Hingen Glück und Zufriedenheit von dem Ort ab, an dem man lebte? Hätte ich sie dann jemals kennengelernt? – Ich holte Billie Holiday aus dem Plattenschrank, legte »Travelin’ Light« auf, trank das kalte Bier, atmete Rosas Luft und merkte, dass ich zu müde zum Weinen war.
Die schmalen Holzstufen knarrten auf dem Weg nach oben. Die Kammer, in der ich früher öfter geschlafen hatte, fand ich unverändert. Allerdings war das Bett bezogen und benutzt, Rosa musste also in den letzten Tagen Übernachtungsbesuch gehabt haben. Ich kramte einen Satz frischer Wäsche aus der Kommode, bezog Kissen und Plumeau neu, legte mich ins Bett und schlief sofort ein.
Es dauerte nicht lange, bis Rosa in mein Zimmer trat. »Lässt du dich auch mal wieder blicken«, begrüßte sie mich. »Das ist recht, ich werd ja nicht jünger. Komm«, befahl sie und schlug die Bettdecke zur Seite, »ich muss dir was zeigen!« Ich folgte ihr die schmale Stiege hinunter, bemerkte, dass ihr Hals noch faltiger, die grauen, kurz geschnittenen Haare noch dünner geworden waren seit meinem letzten Besuch. Aber ihr Gang war aufrecht und kraftvoll wie immer. Sie öffnete die Küchentür, die, bevor ich folgen konnte, von einem heftigen Windstoß zugeknallt wurde und sich nicht mehr öffnen ließ. Der Wind pfiff um die Ecken, brachte die Kaffeetassen zum Klirren, wirbelte das Stroh vor dem Schweinestall auf. Ich drückte mich gegen die Küchentür und stolperte, als der Wind plötzlich nachließ, in den Raum. Wie ein Tornado war er hier durchgefegt, zerbrochene Fensterscheiben, umgekippte Stühle, Geschirrscherben. Die Tür zum Garten klapperte leise, und in dem Türrahmen, dort, wo vorher noch der Fliegenfänger gebaumelt hatte, hing Rosa. Die Beine gespreizt, den Kopf nach unten, so wie damals die Sau des einbeinigen Metzgers. Unter ihrem Kopf hatte sich eine Blutlache gebildet. Die Arme schaukelten unmittelbar über dem Boden, und der Schlüssel, den Rosa in der rechten Hand hielt, kratzte unverständliche Zeichen in das Blut auf dem alten Steinboden.
»Nein«, schrie ich, »nicht Rosa!«
Ich saß aufrecht im Bett. Hinter dem schmalen Fenster beleuchtete ein halbvoller Mond die dunklen Bergkämme des Schwarzwaldes. Unten schlug eine Tür auf und zu. War ich wach oder träumte ich? Dann ein weiteres Geräusch, Schritte im Kies. Ich sprang aus dem Bett, hastete nach unten. Der Sommerwind spielte mit der Küchentür, in der wieder der Fliegenfänger schaukelte, aber mir ging das grauenvolle Traumbild nicht aus dem Kopf. Ich schloss schnell die Tür. Gerade als ich mich fragte, ob ich sie, bevor ich nach oben in die Kammer gegangen war, offen gelassen hatte, hörte ich, wie etwas weiter weg ein Auto gestartet wurde. Ich rannte zum Vordereingang, riss die Tür auf, sah zwei Scheinwerfer, die sich in Richtung Dorf bewegten, konnte unter der Straßenlaterne an der Ölmühle die Umrisse eines roten Autos erkennen, bevor es die Dunkelheit dahinter wieder verschluckte.
Ich lief zurück ins Haus, und plötzlich fiel mir ein, dass ich Martha überhaupt nicht gefragt hatte, woran Rosa gestorben war.
ZWEI
»Sie ist von der Leiter g’falle!«
Traudl hatte mein Auto im Hof bemerkt, sich gewundert, was ich schon so früh bei Rosa suchte, sich noch mehr gewundert, als sie hörte, dass ich in ihrem Haus geschlafen hatte. Mit ihrer schrundigen Hand auf meinem Arm und den kleinen Stechaugen hinter der dicken Brille sah sie mich lange an.
»Isch sie dir begegnet?«, fragte sie dann, und als ich die Stirn runzelte und schwieg, meinte sie: »’s heißt doch, dass die Toten noch so lange in ihren Häusern rumoren, bis sie unter der Erde sind.«
Ich sprach nicht über meinen Traum, wollte stattdessen wissen, wie Rosa gestorben war. Als Traudl es mir erzählte, schüttelte ich ungläubig den Kopf. Seit dem Unfall mied Rosa Leitern wie der Teufel das Weihwasser. Mit sechzig war sie beim Kirschenpflücken von einer besonders hohen gefallen, hatte mit einem komplizierten Beckenbruch vier Wochen im Krankenhaus gelegen und sich geschworen, nie mehr auf eine Leiter zu steigen. Seit dieser Zeit musste die Verwandtschaft antanzen, um ihre Kirschen, Zwetschgen und Mirabellen zu ernten. Das wusste Traudl so gut wie ich.
»Wieso ist sie wieder auf eine Leiter gestiegen?«
»Des wisse nur die Rosa und der Herrgott. Vielleicht hat sie auf ihre alte Tag noch der Hafer g’stoche. Nimm doch nur mal die Sau! Sie hat doch schlachte wolle an dem Tag.«
Traudl sah mich an, als ob ich ihr Rosas Verhalten erklären könnte. Wir standen unter dem Zwetschgenbaum, genau an der Stelle, an der Traudl Rosa vor zwei Tagen gefunden hatte.
»Mittags, so gegen einse. Der Schlag hat sie troffe, hab ich gedacht, weil des hat sie sich doch immer g’wünscht: g’sund sterben. Ein Herzschlag, und aus. Ein schönerer Tod kann’s doch nicht geben mit dreiundachtzig.«
»Aber es war kein Herzschlag?«
»Genickbruch, hat der Dr.Buchenberger g’sagt. – Den hab ich sofort ang’rufe.«
Ich nickte, trat an die Leiter, blickte nach oben in die Krone des Baumes, ins eng verzweigte Geäst, an dem die reifen Zwetschgen hingen. Ich prüfte den Stand der Leiter, sie war fest und gut in den Boden gerammt.
»Und die Leiter?«, fragte ich.
»Die isch auf ihre draufg’lege. Ich hab sie wieder an den Baum g’stellt, nachdem sie die Rosa …« Schnell wischte sie mit einem großen Taschentuch die Augen hinter den Brillengläsern.
Ich kletterte hinauf, keine Sprosse erwies sich als morsch oder wackelig. Der Blick von hier oben war weit und nach allen Richtungen offen. Man sah die Dorfstraße, die sich am Bach entlangschlängelte, die Kirschbaumhügel, die sich in Richtung Mösbach erstreckten, und natürlich den Schwarzwald, mächtig und schön, ein Bild wie für eine Werbepostkarte gemacht. Aber wegen dieses Blicks wäre Rosa niemals hier hochgestiegen. Wieder schob sich das blutige Traumbild von der aufgehängten Rosa in meinen Kopf. Ich versuchte mich an die Zeichen, die ihr toter Arm mit dem Schlüssel in das Blut gemalt hatte, zu erinnern. Es waren keine Buchstaben gewesen, eher Striche, Kreise, Balken, wie sie in asiatischen oder arabischen Schriftbildern vorkamen. Fremd, unerklärlich, verworren. Und was sollte der Schlüssel, den sie so fest umklammert hielt?
Autogeräusche durchbrachen meine Gedanken, und ich sah eine Kolonne von drei weißen Kastenwagen mit roter Aufschrift an der Ölmühle vorbei dorfauswärts fahren. Ich konnte ihnen folgen, bis sie hinter dem Maisfeld verschwanden und danach nicht mehr zum Vorschein kamen.
»Sind das die Vermesser?«, rief Traudl zu mir hinauf.
»Weiße Autos, rote Aufschrift«, erklärte ich und kletterte wieder nach unten. »Sie haben hinter dem Maisfeld gestoppt.«
Traudl nickte. »Jetzt geht’s los.«
»Was?«, fragte ich.
»Soll doch alles Bauland werden, vom Mais bis nauf zum Rückstaubecken. Die nächste zwei Jahr wird hier mehr los sein als auf dem Bühler Zwetschgenfest. – ›Bauland in absolut ruhiger Lage mit freiem Blick auf den Schwarzwald‹. Hast du die großen Schilder am Dorfeingang nicht g’sehe?«
Ich schüttelte den Kopf. »Mir ist nur die Holzzwiebel aufgefallen. Die hat mich an euren Wettstreit erinnert.«
Traudls Augen blitzten. »Diesmal hätt ich g’wonne. Geh in mein Garten und guck! Hab eine Zwiebel, die ist größer als alles, was wir bisher g’züchtet haben.« Und dann leiser, leicht weinend: »Aber was nützt mir das, wo die Rosa tot ist?« Die verhornte Hand kramte in der Kittelschürze wieder nach dem Taschentuch, und Traudl schnäuzte sich. »Was willsch übrigens mit der Sau mache?«, fragte sie, als sie sich wieder gefasst hatte.
»Seit wann schlachtet Rosa im August? Sonst hat sie das immer im Winter gemacht.«
»Ach je. Was isch schon noch wie früher? Der Metzger isch alt, hat’s an der Leber, das gesunde Bein tut ihm weh, der Stumpf auch, und die Rosa macht z’ viel. Seit Aschermittwoch schiebet sie die Sau vor sich her. Mal hat er nicht könne, mal sie. Aber jetzt wird’s höchste Eisenbahn.«
»Die Wurstmaschine von dem Einbeinigen steht in der Küche.«
»Dann isch er schon da g’wese? Ein paarmal hab ich ihr g’sagt: Was willsch du noch mit einer Sau, Rosa? Und wenn, musst du wirklich noch selber schlachten? Bring sie dem Jörger-Metzger, der erledigt das für dich. Aber vernünftiger isch sie nicht g’worde mit dem Alter, wirklich nicht.«
Wieder kramte sie nach dem Taschentuch, schnäuzte sich und sah mich an, als wüsste ich, warum Rosa im Alter nicht vernünftig geworden war.
»Wo ist Rosa jetzt?«, fragte ich stattdessen.
»Dort, wo alle erst hinkommen. In der Leichenhalle.«
»Hast du noch den Schlüssel?«
Traudl nickte. O-beinig watschelte sie zurück zu ihrem Haus. Ich folgte ihr in die niedrige dunkle Küche, in der immer noch der süßlich-modrige Geruch von Krankheit hing, wie damals, als sie ihre kranke Schwester gepflegt hatte. Solange ich denken kann, hat Traudl die Kirche, das Pfarrheim und die Leichenhalle geputzt.
»Sie liegt in der zweiten Kühlkammer«, erklärte sie, als sie mir den Schlüssel in die Hand drückte.
Ich wählte den Weg über die Felder. Ein sanfter Wind strich durch die Blätter der abgeernteten Kirschbäume und sorgte dafür, dass dieser Augustmorgen sommerlich warm, aber nicht zu heiß war. Hinter der alten Kirche nahm ich den steilen Weg, der hoch zum Friedhof führte. Auf dem höchsten Hügel liegend, umgeben von einem Meer von Kirschbäumen, mit einem weiten Blick hinunter in die Rheinebene und hinauf zum Schwarzwald, hatte man den Toten den schönsten Ort des Dorfes gegeben. Nirgendwo waren sie dem Himmel näher als hier.
Vor mir lag der flache Bau der Leichenhalle, aber zuerst stapfte ich durch den tiefen Kies bis zum Grab meiner Großeltern und erinnerte mich daran, wie Rosa mir zum ersten Mal den Tod gezeigt hatte. Ich war sechs, hatte gerade das Pfeiffersche Drüsenfieber hinter mir, als meine Großmutter starb. Rosa hatte sie in der Kammer, in der ich die Nacht zuvor geschlafen hatte, aufgebahrt. Ich sah den Sarg, der auf zwei Stühlen neben dem Bett aufgebockt war. Die Großmutter lag in einem weißen Totenhemd auf dem Rücken, um ihren Kopf einen Kranz blutroter Nelken, die Hände um einen Rosenkranz gefaltet. »Du kannst ruhig zu ihr gehen«, sagte Rosa, als ich vom Flur aus einen Blick in das Zimmer wagte, »sie tut dir nichts.« Ich aber stellte mir vor, dass der Tod überall in dieser Kammer war, ansteckend wie das Pfeiffersche Drüsenfieber, und mich, falls ich näher trat, genauso packte, wie er die Großmutter mit sich genommen hatte. Ich sträubte mich, auch nur einen Fuß in die Kammer zu setzen. Aber Rosas Hand auf meiner Schulter schob mich kraftvoll und unerbittlich vorwärts in den Totenraum, und als ich, starr vor Angst, fest davon überzeugt, gleich sterben zu müssen, vor dem Sarg stehen blieb, trat sie an mir vorbei, strich behutsam über das Gesicht der Toten, arrangierte die roten Nelken neu und sagte: »So enden wir alle. Auch du, obwohl du noch nicht mal erwachsen bist.«
Dafür hatte ich sie gehasst und dafür, dass ich jahrelang nicht auf dem Rücken oder in dieser Kammer schlafen konnte. Und gleichzeitig bewunderte ich sie, weil sie weiterlebte, obwohl sie ja nicht nur im Totenzimmer gestanden, sondern die Tote sogar berührt hatte! Irgendwie begriff ich, dass der Tod nicht wie das Pfeiffersche Drüsenfieber war, es nicht jeden in seiner Umgebung erwischte, er lange Ruhe geben konnte, bis er, wie jetzt bei Rosa, wieder unerwartet zuschlug.
Ich griff nach dem Schlüssel in meiner Hosentasche, ging zurück zur Leichenhalle, schloss die Seitentür auf, trat hinein in den kühlen, dunklen Flur und öffnete die Tür, auf die eine große Zwei gemalt war. Kein weißes Totenhemd, kein Rosenkranz, keine roten Nelken. Dafür stach ein anderes Rot sofort ins Auge. Nur notdürftig von den spärlich grauen Haaren bedeckt zog sich eine tiefe, blutige Kerbe vom Ohr bis zur Stirn. Vielleicht durch die Wunde, vielleicht durch den Tod wirkte ihr Gesicht viel kleiner, als ich es in Erinnerung hatte, und ohne die lebendigen braunen Augen uralt. Vorsichtig strich ich über die kalte, wächserne Haut.
»Rosa«, flüsterte ich, »jetzt habe ich dir nicht mehr sagen können, wie wichtig du für mich warst.« Ich spürte die Tränen, die Kühle des Raumes und den Verlust. Zehn Jahre hatte ich kaum an sie gedacht, und jetzt, wo sie tot war, schmerzten die ewig verschobenen Besuche, die nicht geführten Gespräche, der blöde Streit. Nicht mal zu ihrem Achtzigsten war ich gekommen, hatte nur einen Fleurop-Strauß und eine Karte geschickt und am Telefon meinen Glückwunsch aufgesagt. Wir zwei hätten uns wieder vertragen, ganz bestimmt, so wie wir uns immer wieder vertragen hatten, wenn der scheiß Tod uns keinen Strich durch die Rechnung gemacht hätte. Ich strich über die alten, knochigen Hände und küsste die kalte Stirn. »He said goodbye and took my heart away«, sang ich leise ihr altes Lieblingslied, »so since that day, I’m travelling light.«
Zwanzig Minuten später klopfte ich bei Traudl, um ihr den Schlüssel zurückzugeben.
»Sie sieht friedlich aus, oder?«
»Hast du die Leichenwäsche gemacht?«
Sie nickte.
»Ja«, bestätigte ich, »sie sieht friedlich aus, trotz der Wunde am Kopf.«
»Ich hab überlegt, ob ich ihr ein Kopftuch aufziehe«, sagte Traudl, »aber das hätt sie bestimmt nicht wolle.«
»Ist das beim Sturz passiert?«
»Des isch von der Leiter, die auf sie draufg’falle isch. ‘s hat noch viel schlimmer ausg’sehe, bevor ich sie herg’richtet hab«, erklärte sie mir, griff wieder zum Taschentuch, tupfte die feuchten Augen und schnäuzte sich.
»Die Traudl könnt sich vor dem Haus einen kleinen Salzsee anlegen«, hörte ich Rosa spotten. »Ich kenn keinen, der so nah am Wasser gebaut ist. So viel, wie die plärrt!« Rosa mal wieder! Dabei wussten alle im Dorf, wie jähzornig Traudls alter Vater sein konnte und dass sie die jüngere Schwester, mit Multipler Sklerose ans Bett gefesselt, pflegen musste. »Sie isch ä armer Siech«, hieß es überall, »het ä schwärs Päckl zum Trage.«
Ich war fünfzehn und mit Rosa im Garten, als ich die Peitsche knallen hörte, mit der der alte Morgenthaler nach Traudl schlug, und ihr verzweifeltes Schluchzen zu uns herüberdrang. »Du musst was machen«, hatte ich Rosa angefleht, die so tat, als merke sie nichts, »geh rüber und stell ihn zur Rede.« – »Sie muss erst wollen, dass es aufhört«, erwiderte sie hart. Ich warf ihr vor, dass sie selbstgerecht und feige sei, klemmte mich auf mein Fahrrad und raste davon, schämte mich, weil ich nicht selbst rübergegangen war. Irgendwann später, ich weiß nicht mehr, wann, hat sie mir erzählt, dass sie Traudls Vater mit einer Anzeige gedroht hat, aber Traudl sie angefleht habe, nicht zur Polizei zu gehen. Sie könne sich doch nicht gegen den eigenen Vater stellen, außerdem, so oft schlage er sie nicht, und dann müsse sie doch auch an das Gerede im Dorf denken, an die Blicke der Leute beim Einkaufen, beim Kirchgang. »So jemandem kannst du nicht helfen. Der Mensch muss wollen, dass sich was ändert, sonst passiert nichts. Merk dir das!« – Rosa-Lehren. Alte Geschichten, Traudls Vater war längst tot, genau wie die kranke Schwester, Traudl aber hatte auch danach nicht aufrecht gehen gelernt, sie ging weiter gebückt, behielt die leidende Miene, blieb nah am Wasser gebaut.
»Gute Arbeit«, kam ich auf Rosa zurück, »auch dass du ihr das taubenblaue Wollkleid angezogen hast. Das hat sie besonders gern gehabt.«
Traudl nickte.
Stumm hingen wir eine Zeit lang, jede für sich, Rosa-Erinnerungen nach. Traudl wieder mit Tränen und Schnupftuch. Fast fünfzig Jahre waren die beiden Frauen Nachbarinnen gewesen. Ein großer Verlust auch für sie.
»Morgen kommt sie unter die Erde.« Wieder wischte Traudl die feuchten Augen. »D’ Elsbeth kommt auch.«
»Wie geht’s der Elsbeth?«, fragte ich aus Höflichkeit, denn Traudls Tochter hat mich nie interessiert. Ein paar Jahre älter als ich, hatte ich als Kind wenig mit ihr gespielt und kaum Erinnerungen an sie.
»Sie isch die Leiterin von einem Altenheim in Villingen«, erklärte mir Traudl stolz, »Heilig-Geist, da, wo auch die Ottilie, d’ Schweschter von der Rosa, isch. D’ Rosa hat doch, als die Ottilie immer wirrer g’worden isch, mit der Elsbeth g’redet wegen einem Platz. Und dann isch ein Zimmer frei g’worden, und die Ottilie hat einziehen können. Sie muss viel schaffe, die Elsbeth, und viel Verantwortung trage. Das drückt ihr schwer aufs Gemüt. Aber sie kommt trotzdem morgen zur Beerdigung.«
»’s wird langsam Zeit für die Linde«, wechselte ich das Thema.
»Kommsch noch mal vorbei?«, fragte Traudl.
»Bestimmt.«
»Du weisch ja, wo der Schlüssel liegt.«
Ich nickte und ging durch Traudls Garten zurück zu Rosas Grundstück. Hinter den Bohnenstangen leuchteten ihre Bienenkästen in kräftigen Rot- und Gelbtönen. »Schau!«, hörte ich sie sagen. »Siehst du die, die den Schwänzletanz machen? Damit erklären sie den anderen, wo’s das beste Futter gibt!« Heute sah ich sie nicht. Weder die, die mit dem Schwänzle tanzten, noch die anderen. Überhaupt keine Bienen schwirrten in Rosas Garten umher.
Hatte Rosa ihre Bienenzucht drangegeben? Ich konnte es mir nicht vorstellen, eher hätte sie die Sau abgeschafft. Aber ich hatte sie zehn Jahre nicht gesehen, wer weiß, wie sie sich verändert hatte? Als ich auf dem Weg zum Haus an dem Zwetschgenbaum vorbeikam, suchte ich an der Leiter nach Blutspuren, die die hässliche Wunde an Rosas Kopf hinterlassen haben musste, fand aber nichts dergleichen. Im Haus sperrte ich sorgfältig alle Fenster und Türen zu und legte den Schlüssel zurück in das Bastkörbchen. Dann klingelte mein Handy.
»Bist du noch in Köln?«, fragte Martha. »Wann kommst du?«
»Ich bin in fünf Minuten da.«
Innereien setzt kaum ein Koch mehr auf die Speisekarte, aber meine Mutter. »Heute saure Nierle« stand auf der Schiefertafel, die an der dicken Linde lehnte, der der Gasthof meiner Eltern seinen Namen verdankte. Saure Nierle waren eine Spezialität der Linde, eines der wenigen Gerichte, die Martha wirklich gut kochen konnte. Es war Mittagszeit, und eine Mischung aus Touristen, Durchreisenden und Stammgästen saß an den sonnenbeschirmten Außentischen und verspeiste Marthas Spezialität oder wartete darauf. An dem kleinen Tisch links neben dem Eingang tunkte ein älterer Herr im hellen Anzug mit einem Stück Brot den letzten Soßenrest von seinem Teller. Er hob sein Gesicht, als ich auf der Höhe seines Tisches war.
»Saure Nierle waren schon vor zwanzig Jahren Ihre Leibspeise«, sagte ich. »Guten Tag, Dr.Buchenberger.«
»Wenn das nicht die kleine Katharina ist«, antwortete er und schüttelte mir die Hand, »die kleine Katharina, die …«
»… so groß geworden ist«, beendeten wir den Satz unisono.
Seit meinem vierzehnten Lebensjahr sagte er dies jedes Mal, wenn er mich sah. Denn spätestens ab dieser Zeit hatten Marthas Gene mit voller Wucht zugeschlagen und das zarte, untergewichtige Kleinkind, das er mal behandelt hatte, in einen großen, schweren Teenager verwandelt, der der Walkürengestalt der Mutter in nichts nachstand. Ihr wunderschönes pechschwarzes Haar und den bronzefarbenen Teint hatte sie mir nicht vererbt, da hatte sich die väterliche Seite mit roten Locken, heller Haut und unzähligen Sommersprossen durchgesetzt.
»Trauriger Anlass, dein Besuch.« Der alte Arzt seufzte.
»Schwer zu glauben, dass sie wieder auf eine Leiter gestiegen ist.«
»Kann mich noch gut an den Beckenbruch erinnern. Teuflische Sache, hat ihr lang Malaisen bereitet«, meinte er, »aber du glaubst gar nicht, was alte Leute so alles tun, was sie nicht tun sollten oder sich selbst verboten haben. Manchmal sind sie so unvernünftig wie kleine Kinder!«
»Hat sie Alzheimer bekommen?«
»Nein, nein, ihre kleinen grauen Zellen funktionierten brillant«, versicherte er. »Ihr Verstand war immer noch messerscharf und ihre Schlagfertigkeit unerreicht.«
»Wieso ist sie dann auf diese Leiter gestiegen?«
»Himmel sapperlot, da ist sie ja!«, donnerte hinter mir die vertraute Stimme meines Vaters. »Komm rein, d’ Martha ist schon ganz ungeduldig.«
»Ich mache nächsten Monat ein paar Tage Urlaub in Köln«, sagte Dr.Buchenberger beim Abschied, »will mir das neue Richter-Fenster im Dom anschauen.«
»Dann kommen Sie doch mal bei mir zum Essen vorbei«, schlug ich vor. »Die Weiße Lilie liegt in Köln-Mülheim. Ich würde mich freuen.«
»Kommst du jetzt?«, drängelte mein Vater.
Ich folgte ihm in die Gaststube, die nach dem hellen Augustlicht auf der Terrasse wie eine dunkle Höhle wirkte. Auf der Bank vor dem großen grünen Kachelofen lagen die hiesigen Tageszeitungen und auf den Tischen immer noch diese hässlichen beigefarbenen Kunststoffdecken mit den roten Bordüren. Mein Vater deutete mit dem Kopf in Richtung Küche und machte sich dann hinter dem Tresen zu schaffen, wo er ein Bier zapfte und zwei Gläser mit Weißweinschorle füllte.
Ich atmete tief durch, bevor ich die Tür zur Küche aufstieß. Dann kriegte ich den Mund vor Staunen nicht mehr zu. Frisch gekachelt mit einem großen neuen Gasherd, zwei neuen Kühlschränken, einem Dampfgarer, großzügigen Waschbecken und einer durchgängigen Edelstahlarbeitsfläche war die alte Küche meiner Mutter nicht wiederzuerkennen. Erst vor ein paar Jahren hatte ich meine Küche in der Weißen Lilie finanzieren müssen, und der Kredit dafür war noch lange nicht abbezahlt. Ich hatte also eine ziemlich genaue Vorstellung davon, was meine Eltern hier investiert hatten.
In drei verschiedenen Pfannen schwenkte Martha die dünn geschnittenen, mit Zwiebeln und Weißwein gewürzten Nierle. Trotz des feinen Dufts, den die Nierchen durchs Braten und Würzen erhielten, roch ich noch den penetranten Gestank von Pisse, der immer da ist, wenn man die rohen Innereien wässert und säubert.
»Hallo, Mama.«
»Kommst natürlich im günstigsten Augenblick.« Sie sah nur kurz auf. »Ich muss noch acht Portionen machen.«
Ich fragte nicht, ob ich ihr helfen sollte. Nach all den Jahren wussten wir beide, dass wir nicht gemeinsam in einer Küche arbeiten konnten.
»Guck mal, was auf dem Regal hinter dem Radio liegt«, befahl sie mir und löschte eine weitere Portion Nierle mit Weißwein ab.
Ich tat wie geheißen, zog einen Umschlag hervor, auf dem in Rosas energischer Schrift »Mein Testament« stand.
Traudl habe angerufen, erzählte Martha weiter Pfannen schwenkend, nachdem sie die tote Rosa gefunden hatte. Mein Vater Edgar, als einziger Bruder von Karl, war ihr nächster Verwandter im Dorf. Nachdem der Leichenwagen Rosa abgeholt hatte, war Traudl mit Edgar und Dr.Buchenberger in Rosas gute Stube gegangen. Traudl wusste, wo Rosa ihr Testament aufbewahrte, und hatte es Edgar mitgegeben.
Ich hielt den Umschlag in der Hand, traute mich nicht, ihn zu öffnen.
»Guck’s dir an«, sagte Martha. »In einer Stund bin ich hier fertig.«
Ich stellte mich ans geöffnete Küchenfenster und legte den Umschlag auf die Fensterbank. Von der Schule drang der Lärm johlender Kinder zu mir herüber, und ich sah, wie sich die Grundschüler laufend, schubsend, redend oder lachend auf den Weg nach Hause machten. Nach zehn Minuten war der Spuk vorbei, und nur noch eine getigerte Katze räkelte sich auf einem sonnigen Fleck des Schulhofes. Mit einem energischen Griff zog ich das Blatt Papier aus dem Umschlag. Es standen nur zwei Sätze darauf. »Alles, was ich besitze, vermache ich meiner Nichte Katharina Schweitzer.« Und ein Stück weiter unten: »Ich versichere, dass ich im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte bin.« Unterschrift, Ort und Datum. Sie hatte das Testament vor zwei Jahren gemacht, also lange nach unserem letzten Streit.
Ich merkte nicht, wie Martha neben mich trat, mir ein Taschentuch zusteckte, das Blatt aus den Händen nahm und wieder in den Umschlag steckte.
»Du bist immer ihr besonderer Liebling gewesen, hast ja als Kind mehr Zeit bei ihr als bei uns verbracht. Gedankt hast du’s ihr im Alter nicht. Hast sie noch weniger besucht als uns.«
Noch keine Stunde zu Hause, und Martha fuhr schon die erste Breitseite gegen mich. Leider hatte ich im Gegensatz zu meinem Bruder nie gelernt, die Ohren auf Durchzug zu stellen. Aber diesmal würde ich ihr nicht auf den Leim gehen.
»Muss noch was für die Beerdigung organisiert werden?«, fragte ich.
»Das macht ja heut alles das Beerdigungsinstitut. Morgen, zehn Uhr dreißig, ist angesetzt. Der Pfarrer ist auch bestellt. Zum Mittagessen sind wir wieder hier.«
»Kommt jemand aus dem Oberland?« Rosa war auf der Baar, in Aasen, einem kleinen Dorf in der Nähe von Bad Dürrheim, aufgewachsen.
»Von ihren Geschwistern lebt ja nur noch Ottilie. Die ist doch verwirrt und schon seit Jahren im Heim. Michaela hat noch nicht gewusst, ob sie sie mitbringt.«
Rosa hatte weder ihre Schwester noch deren Tochter besonders gut leiden können.
»Michaela ist in den letzten Jahren immer mal wieder da gewesen. Neben dem Papa ist sie ja die Einzige gewesen, die sich um die alte Frau gekümmert hat.«
Die zweite Breitseite. Ich war selbst gespannt, wie lange ich durchhielt. In Gedanken ging ich Rosas Freundinnen durch. »Was ist mit Antoinette?«
»Die kann nimmer Auto fahren, auf keinen Fall mehr durch Straßburg.«
Schade. Rosas elsässische Freundin hatte ich immer gemocht. »Hast du was für den Leichenschmaus überlegt?«, fragte ich dann.
»Ist alles da. Nudelsuppe, Sauerbraten. In der Gefriertruhe gibt’s Eis.«
Klar. Nur keine Umstände. Schon gar nicht für Rosa. Dabei hatte sie sich bei mir mal einen ganz besonderen Leichenschmaus gewünscht. »Ich würde gern kochen. – Wenn du mich in deine neue Küche lässt.«
»Damit hast du nicht gerechnet, oder? Dass ich mir mal so eine neue Küche gönne.« Ein leichtes Lächeln zeigte ihren Besitzerstolz. »Der Herd war kaputt, und ich werd nicht jünger. Mit dir ist ja nicht zu rechnen, und dein Bruder kann auch nicht. Da haben wir halt in Sachen investiert, die mir die Arbeit leichter machen.«
»Schon gut, Mama. Also?«
Sie zögerte, schüttelte den Kopf. »Da vererbt dir die Rosa alles, und du willst nicht mal auf ihre Beerdigung.«
Natürlich, die Beerdigung! Wie in jedem Dorf gab’s auch hier ein paar Klageweiber, die sich für jede Leiche auf den Friedhof schleppten, um hinterher herumtratschen zu können, wer den Toten die letzte Ehre erwiesen hatte, ob’s eine große oder kleine Beerdigung gewesen war. Und Martha mit ihren starren Vorstellungen von Dingen, die man tut oder nicht tut, mit ihren im Klatsch- und-Tratsch-Hören erprobten Wirtinnen-Ohren wusste schon genau, was dann über mich erzählt werden würde: »Zehn Jahre hat sie sich nicht bei ihr gemeldet, und nicht mal zur Beerdigung kommt sie. Aber das Geld steckt sie ein, dafür ist sie sich nicht zu schade. Die Großstadt hat sie hochnäsig gemacht, sie weiß nicht mehr, was sich gehört.«
»Ich bin in der Leichenhalle gewesen und hab mich von ihr verabschiedet, Mama. – Ich frag mich, wieso sie wieder auf eine Leiter gestiegen ist.«
Martha schnaubte ärgerlich: »Lass die Toten in Ruhe, Katharina! Wenn du anfängst, herumzustochern, wird sie auch nicht mehr lebendig. Die Rosa war dreiundachtzig, ein gesegnetes Alter. Ich wär dankbar, ich könnt so sterben wie sie.«
Ich zuckte mit den Schultern. Was anderes hatte ich von meiner Mutter nicht erwartet. »Was ist jetzt mit der Küche?«
»Von mir aus. Einer muss sich ja ums Essen kümmern«, knurrte sie.
Keine weitere Breitseite mehr? Jetzt überraschte sie mich.
»Du musst das nach Achern zum Grundbuchamt bringen, auch wegen dem Bauland«, befahl Martha und gab mir das Testament zurück.
»Was für Bauland?«
»Du weißt doch, wie stur die Rosa hat sein können. Von wegen im Alter wird man weise, also …«
»Martha!«
Mein Vater schnitt ihr mit strengem Ton das Wort ab. Er stand in der Küchentür. Seit meinem letzten Besuch waren seine Haare noch weißer geworden. Nur noch die Sommersprossen erinnerten daran, dass sie mal im gleichen satten Rot wie meine geleuchtet hatten. Ohne ein weiteres Wort stapfte Martha zum Herd, packte Töpfe und Pfannen zusammen, schleppte sie zur Spüle, pausierte dabei gelegentlich, strich sich über die Hüfte, die sie seit dem Beinbruch vor ein paar Jahren schmerzte.
Es stach scharf ins Herz, zu sehen, wie die eigenen Eltern alt wurden.
»Die Zwetschgen im Grasgarten müssen runter«, wandte sich Edgar an mich, »wenn du mir hilfst, sind wir in einer Stunde fertig mit dem Baum.«
Kein Wort mehr zu dem Bauland von keinem der beiden. Ich folgte meinem Vater nach draußen, griff im Schuppen nach zwei Körben, während Edgar die Leiter schulterte und in den Garten schleppte.
»Und?«, schnaufte er, als er sie sicher an den Baum gelehnt und in die Erde gestampft hatte. »Was macht die Weiße Lilie? Hast du wegen Rosas Beerdigung zumachen müssen?«
»Zum Glück nicht. Ecki vertritt mich.«
»So, so.«
»In drei Wochen fängt er einen neuen Posten in Singapur an. So lang ist er in Köln.«
»Dann passt’s ja.« Ohne ein weiteres Wort nahm Edgar sich einen Korb und stieg auf die Leiter.
Das schätze ich an meinem Vater. Er bohrt nicht in meinem Liebesleben herum. Dass ich mit einem Mann zusammen bin, der überall in der Welt, aber nicht an meiner Seite kocht und nur gelegentlich bei mir hereinschneit, kann ich manchmal selbst nicht kapieren, und mein Vater kapiert es überhaupt nicht. Dennoch mischt er sich nicht ein.
»Aber laufen tut das Geschäft?«
»Reich werd ich damit nicht. Am Ende vom Monat bin ich immer froh, wenn ich meine Leute bezahlen kann.«
Er nickte wieder, fragte auch hier nicht näher nach. Blau schimmerten die berühmtesten Früchte der Gegend zwischen den Blättern, und die faulen unter dem Baum zeigten an, dass es höchste Eisenbahn war, sie zu ernten. Mit geübtem Griff packte Edgar nach den Ästen, knipste die Früchte ab. Ich widmete mich den tief hängenden Ästen, die ich ohne Leiter abernten konnte. Schnell waren die reifsten gepflückt, und ich dachte an Zwetschgenkuchen mit Kartoffelsuppe, ein Gericht, das Rosa immer aus den ersten reifen Zwetschgen zubereitet hatte. Auch wenn man die ungewöhnliche Kombination nur im Badischen kennt, es gibt nichts Leckereres: eine sämige, milde, nur leicht mit Knoblauch gewürzte Kartoffelsuppe und dazu ein einfacher, mit Zimt und Zucker bestreuter Zwetschgenhefekuchen. Dann dachte ich wieder an das Testament und den scharfen Ton, mit dem Edgar Martha vorhin in der Küche das Wort abgeschnitten hatte.
»Was ist mit dem Bauland, Papa?«
»Das Bauland, ja, das Bauland. Hast du doch bestimmt gesehen, als du von der Autobahn gekommen bist, oder?« Er dehnte die Worte in die Länge, sagte dann eine ganze Weile nichts, bevor er sich doch zum Weiterreden entschloss: »Jahrelang ist hier gar nicht gebaut worden, aber letztes Jahr hat die Gemeinde nicht nur die Felder an der Scherwiller Straße, sondern auch das Gebiet hinter Rosas Haus bis hoch zum Rückstaubecken des Bachs als Bauland ausgewiesen. Weißt ja, dass wir da ein Feld haben, und die Rosa hat auch eins. Das kannst du jetzt verkaufen, dann hast du für ein paar Monate keine Sorgen mit deiner Weißen Lilie. Die Unterlagen liegen in Rosas guter Stube. Schau sie dir an, ich finde, dass der Retsch gut zahlt.« Er reichte mir einen vollen Korb nach unten, stieg langsam von der Leiter.
»Habt ihr schon verkauft?«, wollte ich wissen.
»Noch nicht, aber jetzt dann schon«, nuschelte er ungenau und suchte sich einen neuen Ort zum Aufstellen. Während er nach einem sicheren Stand suchte, hielt ich die Leiter fest.
»Wieso ist Rosa noch mal auf eine Leiter gestiegen? Kannst du dir das erklären?«
»Weißt du, darüber mach ich mir gar keine Gedanken«, seufzte er und hakte seinen Korb in einen Ast fest. »Die Rosa hat ihr Leben gelebt bis zuletzt, ohne dass ihr einer dreinreden konnt. Ich bin froh, dass sie so hat sterben können. Du weißt doch selber, wie viele dann noch ins Altenheim müssen oder den Verstand verlieren …«
»Trotzdem.«
Mein Vater zuckte mit den Schultern und hielt den Mund. Vielleicht hatte er recht, und auch ich sollte froh sein, dass Rosa so ein schneller Tod vergönnt gewesen war. Schweigsam pflückten wir weiter Zwetschgen, schleppten eine halbe Stunde später die vollen Körbe in die Küche der Linde.
»Sie wird nicht wieder lebendig, wenn du herausfindest, warum sie auf die Leiter gestiegen ist«, griff mein Vater das Thema noch mal auf, bevor ich mich auf den Weg zu Rosas Haus machte. »Grad für dich ist es schwer, dass sie nicht mehr unter uns ist. Aber sie ist tot, Katharina, damit müssen wir alle leben.«
Wie lebt man mit dem Tod?, fragte ich mich, als ich Rosas Schlüssel aus dem Bastkörbchen kramte. Ich hatte es bis heute nicht herausgefunden. Als Kind hatte ich mir den Tod als übergroßen Sensenmann vorgestellt, der alle Menschen in unserem Dorf umbrachte. Aber man konnte mit ihm verhandeln, ihn freundlich bitten, dass dabei ein paar überleben durften: die Eltern, der Bruder und Rosa. Klar weiß ich heute, dass der Tod weder Rücksicht auf die Wünsche einer Acht- noch einer Dreiundvierzigjährigen nimmt. Er lässt nicht mit sich handeln, holt sich, wen er will, und schert sich nicht um die Lücken, die er bei denen reißt, die zurückbleiben.
In der guten Stube lagen ein paar an Rosa adressierte, teils ungeöffnete Umschläge der Firma »Retsch & Co«, aber ich hatte nicht die geringste Lust, mich jetzt mit dem Bauland zu beschäftigen. Stattdessen registrierte ich, dass Rosa sich noch ein neues tragbares Telefon mit einem Anrufbeantworter gekauft hatte. Ich drückte auf Abhören und lauschte der Stimme einer fremden Frau. »Hallo, Frau Schweitzer, ich bin’s. Wegen dem Clothianidin … Am besten schicke ich Ihnen die Namen. Rufen Sie mich an, meine Nummer haben Sie ja.«
Eine junge Stimme, ein Kaiserstühler Dialekt, und was zum Teufel war Clothianidin? Ich wiederholte die Nachricht, stellte fest, dass sie schon eine Woche vor Rosas Tod eingegangen war und die Anruferin eine unterdrückte Nummer benutzt hatte. Keine Möglichkeit, zurückzurufen, außerdem schien Rosa den Anrufbeantworter nicht regelmäßig abgehört zu haben.
Nichts in diesem Zimmer half mir, etwas über die Anruferin oder dieses Clothianidin herauszufinden, zudem roch es im Haus so intensiv nach Rosa, dass es mich raus in den Garten trieb, in eine pralle hochsommerliche Üppigkeit. Gemüse in Hülle und Fülle, der Duft von Rosmarin und reifen Tomaten, rot, gelb, rosa blühende Dahlien, prächtige Gladiolen, zarte pastellfarbene Astern, ein Festmahl für Bienen, die hier genauso fehlten wie Rosa.
»Sie können Hunderte von Düften unterscheiden«, hörte ich Rosa flüstern, die auf der alten Bank unter dem Holunderbusch zum Bienenbeobachten neben der kleinen Katharina saß, »und sie sind die exaktesten Baumeister der Welt.« Ich weiß nicht mehr, wie oft ich mit Lineal und kariertem Papier versucht habe, gleichgroße Waben zu zeichnen, wie viele Blätter zusammengeknüllt im Papierkorb gelandet sind, wie wütend ich als Kind war, weil mir die Waben nicht gleichmäßig gerieten. Und Rosa dann: »Du kannst es bis an dein Lebensende probieren, nie kommst du an die Bienen ran.«
Ihr Wissen über Bienen war immens, ganz strenge Lehrmeisterin fragte sie mich regelmäßig ab: »Was sind die sechs Berufe der Bienen, Katharina? Welche Aufgabe müssen die Drohnen erfüllen? Wofür brauchen die Bienen das Gelée royale? Was passiert beim Hochzeitsflug?« Mit acht Jahren hatte ich ihr noch gern darauf geantwortet, aber je älter ich wurde, desto nerviger fand ich die Fragerei. Als Erwachsene hatte ich die Bienen vergessen, aber jetzt, in diesem Garten, in dem ich sie so oft mit Rosa beobachtet hatte, vermisste ich sie. Selbst wenn Rosa ihre Bienenstöcke aufgegeben hatte, wo waren die Bienen von anderen Imkern? Wieso gab es in diesem Blütenmeer keine Bienen mehr?
Ich schlenderte zum Zwetschgenbaum hinüber. Die Unglücksleiter lehnte unschuldig am Baum, verriet nicht, warum Rosa heruntergefallen war. Ich pflückte ein paar frische Zwetschgen, spuckte die Kerne in den Garten, zermanschte mit meinen Schuhen ein paar vom Baum gefallene schon gärende Früchte und machte eine andere Entdeckung: Auch die Wespen waren weg. Dabei gab es im Spätsommer keinen einzigen Zwetschgenbaum, unter dem sie nicht in Massen herumsurrten, damit beschäftigt, die aufgeplatzten Früchte zu fressen. Hier war keine einzige.
DREI
Ochsengroße Killerbienen pflügten durch meine Träume, hinterließen auf ihrem Weg allerorts verwüstete Bienenstöcke, verbrannte Erde, blattlose Bäume, verdorrte Blumen. Meine Tante Rosa in Gestalt einer Zeichentrickbiene und mit einem Kassettenrekorder zwischen den Beinchen führte eine bunt gemischte Tierschar in den Kampf gegen die Killerbienen. Diese nahmen sofort Reißaus, wenn das Rosa-Bienchen auf den Playknopf drückte und wie durch tausend Lautsprecher verstärkt die Stimme von Karel Gott ertönte, der sang: »Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maja. Schlaue, freche, süße Biene Maja …«
Lieber Killerbienen im Traum als wieder das schreckliche Bild von der aufgehängten Rosa, dachte ich am nächsten Morgen, als mir das Lied immer noch im Kopf herumspukte. Ich pflanzte mich mit einem Kaffee auf Rosas Gartenbank und überlegte, wie der Text weiterging: »Maja kommt aus dieser Welt«? »Maja zeigt dir ihre Welt«? Ich kam nicht drauf, war zu lange her. Drüben sah ich Traudl schon in ihrem Garten werkeln, die, kaum dass sie mich erspäht hatte, zu mir herüberwatschelte und eine kohlkopfgroße Zwiebel neben mir auf die Bank legte.
»Alle Achtung!«
»Und das ist nicht die größte«, behauptete sie. »Komm gucken, wenn du mir nicht glaubst.«
Ich glaubte ihr, und Traudl wirkte enttäuscht. Aber ich wollte mich nicht in ihren Garten schleppen lassen, denn Traudl würde mir nicht nur die Riesenzwiebeln zeigen, sondern auch den Mangold, den Blumenkohl, die gelben Rübchen, die Zucchini und was sie dieses Jahr sonst noch gepflanzt hatte. Ganz zu schweigen von der Litanei über erprobte Bodenbehandlung, die sie herunterrasseln würde: Bearbeitung der Oberkrume, Lockerung der Unterkrume, Hornmist, Hornkiesel, Leguminosen. Für ihre Gartenarbeit fand Traudl Worte ohne Ende. Stundenlang hatte sie uns früher in ihrem Garten festgehalten. Ich erinnerte mich an lange Abhandlungen über Mineraldünger und daran, wie sie Rosa von der wunderbaren Wirkung der Kalkdüngung bei Vollmond überzeugen wollte. Nur um diesen ewigen Gartenführungen und Fachabhandlungen zu entgehen, war Rosa damals in diesen Zwiebelwettstreit eingestiegen. »Jetzt, wo wir Konkurrenten sind«, hatte sie Traudl erklärt, »ist es besser, keine betritt den Garten von der anderen. Besser keine redet über Saatgut, Setzplatz, Düngung. Das verzerrt sonst den Wettbewerb, verstehst du?« Eine der wenigen Male, wo Rosa auf List und nicht auf Konfrontation gesetzt hatte. Es hatte funktioniert.
Traudl tupfte sich wieder die Stechäuglein mit einem Taschentuch.
»Ein anderes Mal«, tröstete ich sie und hörte, wie in meinem Kopf Karel Gott wieder von der Biene Maja sang. »Was hat Rosa eigentlich mit ihren Bienen gemacht?«
»Ja, weisch das nicht?« Sie schüttelte den Kopf, konnte nicht glauben, dass ich davon noch nichts gehört hatte. »Morgalomania«, murmelte sie dann düster, »2012 ist nicht mehr weit.«
Ich verstand gar nichts, und Traudls Erzählungen über die Maya-Indianer, die an einen Neuanfang der Welt im Jahre 2012 glaubten, für den alles Bestehende zerstört werden musste, damit das Zeitalter »Morgalomania« anbrechen konnte, verwirrten mich eher, als dass sie mich aufklärten.
»Die ganzen Naturkatastrophen, das sind alles untrügliche Zeichen, Katharina«, prophezeite sie.
Nostradamus, Flares, Sonnenstürme, Meteoriteneinschläge und die Umkehrung der magnetischen Pole, von denen Traudl dann sprach, verwirrten mich noch mehr, für sie aber schien das eine schlüssige Welt, von der aus sie mühelos zu Matthäus 24, Verse 35–36, wandern konnte, der das, was sie gerade gesagt hatte, ad absurdum führte: »Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Von jenem Tag und jener Stunde hat niemand Kenntnis, weder die Engel noch der Himmel noch der Sohn, sondern nur der Vater.«
»Aber«, gelang es mir irgendwann, sie zu unterbrechen, »was hat das alles mit Rosas Bienen zu tun?«
»Sie sind tot, alle verreckt. Bienen, Wespen, Hummeln, Hornissen und Schmetterlinge. Genau wie es in der Prophezeiung steht: Erst sterben die Bienen, dann der Mensch. Und dann geht die Welt unter. Der Zorn des Herrn.«
»Und seit wann?«
»Angefangen hat’s in den milden Apriltagen. Jeden Morgen hat die Rosa schaufelweise tote Bienen vor dem Stock gefunden. – Alle sind verreckt, alle. Kannst du alles nachlesen. Ich hab die Bücher daheim, ich kann dir die Stellen zeigen!«
Auf keinen Fall, dachte ich und griff dankbar nach meinem klingelnden Handy. Martha, die wissen wollte, wann ich endlich käme. Der Leichenschmaus.
»Teufelszeug«, schimpfte Traudl und deutete auf mein Handy. »Am Anfang hat die Rosa gedacht, die Dinger sind schuld am Tod von den Bienen. Hast du eine Ahnung, wie viele unsichtbare Strahlen deswegen durch die Luft schwirren? Hast du eine Ahnung, was das –«
»Traudl«, unterbrach ich sie, »ich muss in die Linde zum Kochen. Wir sehen uns nach der Beerdigung.«
Während ich Kürbis klein schnitt und den Truthahn füllte, dachte ich darüber nach, dass es jenseits von Traudls apokalyptischen Visionen rationale Erklärungen für das Bienensterben geben musste. Aber als ich den Honig über die Quitten träufelte, kam es mir doch unheimlich vor, dass es keine Bienen mehr geben sollte. Bilder aus alten Science-Fiction-Filmen in Schwarz-Weiß tauchten vor mir auf, in denen durch eine kleine Verschiebung in der Natur – verwachsene Vögel oder vermehrtes Auftauchen von Schlangen – eine komplett bedrohliche Stimmung erzeugt und auf den Zuschauer übertragen wurde. Martha holte mich aus dieser düsteren Stimmung, indem sie mir ihren neuen Herd und den Dampfgarer erklärte.
»Gib Gas, in anderthalb Stunden sind wir wieder da«, befahl sie, als sie die Goldknöpfe ihrer schwarzen Chanel-Jacke schloss und den dazu passenden Rock zurechtzupfte. Dann brüllte sie die Treppe hinauf: »Edgar! Wir müssen los.«
Wie würdest du am liebsten sterben? Es muss nach dem Tod der Großmutter gewesen sein, als ich Rosa das gefragt habe. »Keiner kann sich aussuchen, wie er stirbt, außer er legt selbst Hand an sich«, lautete Rosas Antwort. Ja schon, machte die kleine Katharina weiter, aber wünschen darf man sich doch erst mal alles. Zum Beispiel, ob man lieber im Bett sterben will oder beim Essen, im Winter oder im Sommer. »Im Sommer«, antwortete Rosa schnell, »draußen auf dem Feld. Und mein Leichenschmaus soll auch draußen sein, an einem großen Tisch mit einer weißen Tischdecke, auf die während des Essens eine Taube scheißt.« Und was soll’s zum Essen geben? Eine untypische Frage für eine Sechsjährige, aber schon die kleine Katharina hatte sich fürs Essen interessiert. »Well«, kicherte Rosa, »schocken wir die Badener mit einem real american meal: Kürbissuppe, Bagels mit Pastrami, turkey mit Süßkartoffeln und ein Quitten-Pie zum Nachtisch.«
Den Kürbis hatte ich aus Rosas Garten, die Quitten aus ihrer Vorratskammer mitgebracht, Truthahn, Süßkartoffeln, Bagels, selbst Pastrami-Schinken fand ich im Scheck-in, dem bestsortierten Supermarkt der Gegend. Den großen Tisch und die weiße Tischdecke hatte Edgar schon vor der Beerdigung in den Grasgarten schleppen müssen.
Es war ein Tag, wie Rosa ihn sich gewünscht hätte. Angenehme fünfundzwanzig Grad, ein leichter Sommerwind, der nach späten Zwetschgen und frühen Äpfeln roch. Mein kleiner Neffe Daniel, o-beinig und noch mit Windeln gepolstert, umrundete den Tisch im Grasgarten immer wieder, konnte unter den Gästen kein anderes Kind ausmachen, nur ernst dreinblickende Erwachsene: die Mutter-Tochter-Paare Michaela und Ottilie auf der einen und Traudl und Elsbeth auf der anderen Seite, an den Kopfenden Martha und Edgar, dazwischen mein Bruder Bernhard, seine Frau Sonja und ich. Der kleine Daniel stolperte mit den kurzen Beinchen über eine Graskrumme und hielt sich schnell an dem nackten, von Krampfadern durchzogenen Bein von Michaela fest. Seine Augen rutschten über einen gedeckten grauen Baumwollrock und ein schwarzes T-Shirt nach oben zu einem Gesicht, dessen fast waagrechter Mund sich ein gezwungenes Lächeln abrang. Die Störung passte der Kusine aus dem Oberland gar nicht, die gerade angesetzt hatte, nach dem Testament der Tante zu fragen. Ob es überhaupt eines gebe, wollte sie wissen, wenn nicht, seien schließlich Ottilie und sie als einzige noch lebende Blutsverwandte die Erben.
Martha lockte den kleinen Kerl zu sich, drückte ihn stolz an ihre Großmutterbrust, nicht ohne mir dabei einen Blick zu schicken, den ich nur zu gut kannte: Da siehst du’s. Der Bernhard hat mir einen Enkel geschenkt, aber du hast es nicht mal geschafft zu heiraten. Einer ihrer Vorwürfe, den sie mir direkt oder indirekt ich weiß nicht wie oft gemacht hatte. Ich war froh, dass in der Zwischenzeit meine biologische Uhr nicht mehr tickte. Edgar holte derweil das Testament und legte es vor Michaela auf den Tisch. Die Enden des waagrechten Mundes bogen sich nach unten. So eine Flappe hatte sie schon als Kind gezogen, wenn es mir gelungen war, das letzte Stück Linzer Torte von Rosas Kaffeetafel vor ihr zu ergattern.
Also das wundere sie wirklich, meinte sie ganz bekümmert, mehrfach habe Rosa ihr zugesagt, dass sie sie in ihrem Testament berücksichtigen würde, sie wolle jetzt wirklich nicht falsch verstanden werden, aber ob man wirklich sicher sein könne, dass dies das letzte Testament sei?
»Ebbes anderes hätt die Rosa mir g’sagt«, beeilte sich Traudl zu antworten. Sie habe doch gewusst, wo Rosa ihr Testament aufbewahrte. Selbst wenn sie es geändert hätte, hätte sie es wieder in das Regal neben dem Plattenschrank gelegt. Eine Vereinbarung auf Gegenseitigkeit sei das gewesen, auch Rosa habe gewusst, wo sie, Traudl, ihr Testament aufhob. »Und der letzte Wille von einer Toten …«
»… den muss man erfüllen«, vervollständigte Michaela den Satz. Das sei doch selbstverständlich, über so etwas brauche man hier am Tisch gar nicht zu reden. Aber sie könne sich immer noch nicht vorstellen, dass Rosa nur Katharina – »nichts gegen dich persönlich, ganz bestimmt nicht« – und niemanden aus ihrer Blutsverwandtschaft testamentarisch berücksichtigt habe.
Den kleinen Daniel hatte es nicht lange auf Marthas Schoß gehalten, er saß jetzt unter dem Tisch, zwirbelte die losen Socken von Tante Ottilie nach unten und kitzelte dabei ihre Waden, was ihr sichtlich Vergnügen bereitete. Die alte Frau gluckste wie ein junges Mädchen.
»Der Klapperstorch, der Klapperstorch«, kicherte sie. »Die Rosa hat mich doch deswegen ang’rufe!«
Es war das erste Mal, dass Ottilie etwas sagte. Bisher hatte sie versucht, mit zittriger Hand den Suppenlöffel zu füllen, es damit aber nie bis zum Mund geschafft, stattdessen die Suppe auf den Tisch geschlabbert und wirre Blicke in die Runde geschickt. Behutsam hatte Michaela ihr den Löffel abgenommen, sie wie ein kleines Kind gefüttert und dabei erzählt, dass Ottilie auch Messer und Gabel verwechsele, nicht mal mehr ein Butterbrot allein essen könne. Ich dachte an Edgars Sätze über ein würdiges Alter und war jetzt froh, dass Rosa einen schnellen Tod unter dem Zwetschgenbaum gefunden hatte.
»Der Klapperstorch bringt die Kinder, Mutti, deswegen hat dich die Rosa bestimmt nicht angerufen«, korrigierte Michaela sie und wischte ihr mit einer feinen Bewegung den Mund sauber. Schnell kam sie danach wieder auf das Testament zurück. Sie würde gern selbst noch einmal in Rosas Haus nachsehen.
»Tu, was du nicht lassen kannst«, meinte Martha. »Oder, Katharina?«
Sie wolle ja überhaupt nicht hetzen, es sei doch so schön, wie wir alle hier zusammensitzen, aber: »Geht es vielleicht gleich?«
Da war er wieder, dieser gierige Blick wie damals bei der Linzer Torte, der im Widerspruch zu dieser Ich-bin-so-fromm-dass-ich-in-den-Himmel-komm-Haltung stand. Gern hatte Michaela mich danach gepfetzt oder getreten oder mir in den Kakao gespuckt. Dabei war’s doch ein Spiel, verdammt. Sie war einfach nicht so flink wie ich. Und manche können nicht verlieren – weder als Kinder noch als Erwachsene.