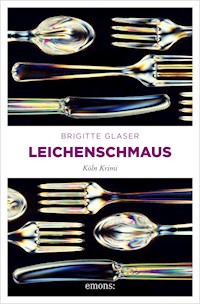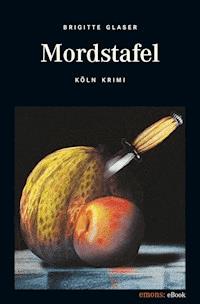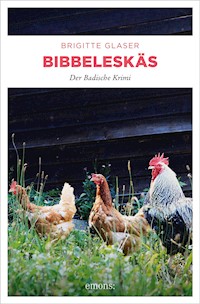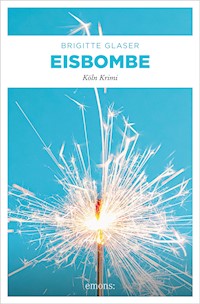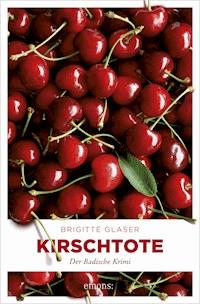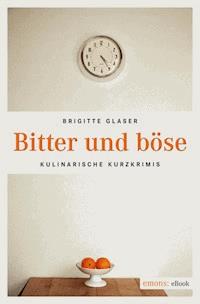14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Von der Autorin des Spiegel-Bestsellererfolgs Bühlerhöhe Deutschland, im November 1972: Niemand kennt das Bonner Polittheater besser als Hilde Kessel, legendäre Wirtin des Rheinblicks. Bei ihr treffen sich Hinterbänkler und Minister, Sekretärinnen und Taxifahrer. Als der Koalitionspoker nach der Bundestagswahl härter wird, wird Hilde in das politische Ränkespiel verwickelt. Verrat ist die gültige Währung. Gleichzeitig kämpft in der Abgeschiedenheit einer Klinik auf dem Venusberg die junge Logopädin Sonja Engel mit Willy Brandt um seine Stimme, die ihm noch in der Wahlnacht versagte. Doch auch sie gerät unter Druck. Beide Frauen sind erpressbar. Für Hilde steht ihre Existenz auf dem Spiel, Sonja will ihre kleine Schwester beschützen. Wie werden sie sich entscheiden? Die Presse zu Bühlerhöhe: »Das Buch lässt Raum zum Denken. Es ist eine Symbiose aus vielen Genres: Heimat- und Kriminalroman, Geschichtsbuch, aber auch die Darstellung von menschlichen Beziehungen, Sehnsüchten und Ängsten.« Brigitte WIR, Hannah Krekeler "Selten wurde so spannend und sprachlich präzise über die Gründungszeit der Bundesrepublik geschrieben." Verena Hagedorn, Barbara
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Rheinblick
Die Autorin
Brigitte Glaser lebt seit über 30 Jahren in Köln. Bevor sie zum Schreiben kam, hat die studierte Sozialpädagogin in der Jugendarbeit und im Medienbereich gearbeitet. Heute schreibt sie Bücher für Jugendliche und Krimis für Erwachsene, u. a. ihre erfolgreiche Krimiserie um die Köchin KatharinaSchweitzer. Mit Bühlerhöhe gelang ihr der Durchbruch.
Das Buch
Bonn ist in den Tagen nach der Wahl ein brodelndes Durcheinander, es geht um Positionen und Posten, um Versprochenes und Verrat. Hilde Kessel hat wieder einmal den Wahlausgang richtig vorhergesagt. Kein Wunder, sie sitzt an der Quelle. Ihr Lokal Rheinblick liegt genau gegenüber vom Bundestag. Alle kommen zu ihr, alle reden mit ihr und schätzen ihre Verschwiegenheit. Nur einmal hat sie diese verletzt, und der Erfolg Willy Brandts fördert diese alte Geschichte wieder zutage. Sonja Engel dagegen hat wenig Erfahrung mit Politik, doch plötzlich soll sie den Kanzler behandeln – und niemandem davon erzählen. Auch sie gerät unter Druck. Beide Frauen sind erpressbar. Für Hilde steht ihre Existenz auf dem Spiel, und Sonja will ihre kleine Schwester beschützen. Wie werden sie sich entscheiden?
Brigitte Glaser
Rheinblick
Roman
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
List ist ein Verlagder Ullstein Buchverlage GmbH
ISBN 978-3-8437-2079-3
© 2019 by Ullstein Buchverlage GmbH, BerlinUmschlaggestaltung: BÜRO JORGE SCHMIDT, MünchenUmschlagabbildung: © ullstein bild (Montage aus zwei Bildern von ALINARI ARCHIVES und UNKEL)Autorenfoto: © Werner MeyerE-Book Konvertierung powered by pepyrus.comAlle Rechte vorbehalten
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Die Autorin / Das Buch
Titelseite
Impressum
… da pfeift der Wind so kalt
The Times They Are a-Changin’
… turn my nightmares into dreams
Sail on silver girl
Fly Me to the Moon
Break on Through to the Other Side
Help Me Make it Through the Night
I’m Ready For You
Lazy Sunday
Wilde Gesellen
Wheel turnin’ round and round
Let me spend one night in your soul kitchen
Close to You
We can work it out
Fire
… love you when we’re apart
… da pfeift der Wind so kalt.
Zum Schluss
Mein Dank gilt
Soundtrack
Literaturliste
Glossar
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
… da pfeift der Wind so kalt
Für Irene
»Ich musste noch lernen, dass es auch in den eigenen Reihen Leute gibt, die länger andauernden sowie durchschlagenden Erfolg übelnehmen und kaum verzeihen. Oder sollte ich sagen: Gerade in den eigenen Reihen?«
Willy Brandt, Erinnerungen
… da pfeift der Wind so kalt
Bonn, Samstag, 18. 11. 1972
Auf Bonn fiel leichter Nieselregen. Zu schwach, um den Schirm aufzuspannen, doch stark genug, um einem unter die Haut zu kriechen. Auf feuchten Plakaten und in schwarzen Lettern versprach die CDU, den Fortschritt auf Stabilität zu bauen. Barzel lächelte siegessicher, der spärliche Haarkranz glänzte regennass.
Ihr Weg führte Hilde Kessel auf den Münsterplatz und zweimal an »Willy Brandt muss Kanzler bleiben« vorbei. Auch sie würde am Sonntag wählen. Aber im Gegensatz zu all denen, die in den letzten Wochen ihre politische Überzeugung herausposaunt hatten, hielt sie ihre geheim. Alles andere wäre auch beruflicher Selbstmord. Sie war Wirtin, und zu ihr kamen alle: die Schwarzen, die Roten, die Gelben, die Presseleute, die Chauffeure, die Sekretärinnen, die Taxifahrer. Ihr Rheinblick war die Bonner Schweiz oder das schweizerische Bonn. Hausmannskost und internationale Küche, Rheinwein und Kölsch, Ort geselliger Heiterkeit und deftigen Skats, vor allem aber: neutrales Gelände.
Das Angelusläuten der Münsterglocken riss sie aus ihren Gedanken. Wochentags ging sie nie zur Kirche, doch jeden Sonntag besuchte sie das Hochamt. Sehen und gesehen werden war wichtig in ihrem Geschäft. Das ließ sie sich nicht nehmen, auch wenn sie nicht zur Hautevolee der Stadt gehörte. Das Geläut der Glocken füllte die Luft, dröhnte selbst dem alten, überlebensgroß über dem Platz thronenden Beethoven in den tauben Ohren, übertönte das Gekreisch der Rheinmöwen und das Klacken ihrer Stiefel. Die glitschigen Pflastersteine und die neuen Stiefel luden zu einer hinterhältigen Rutschpartie ein. Hilde zog den Mantel enger um sich zusammen und überquerte den Martinsplatz in Richtung Schloss.
Als Wirtin des Rheinblicks war es bereits ihre fünfte Bundestagswahl: 1957 mit Adenauer als Bundeskanzler, 1961 erneut Adenauer, ab 1963 dann Erhard. 1965 wieder Erhard, schon 1966 von seiner CDU geschasst und nach der Bildung einer großen Koalition mit der SPD durch Kiesinger ersetzt. 1969 die CDU wie immer stärkste Partei, alles sah noch einmal nach Kiesinger und großer Koalition aus, aber dann Brandts auch für manche Genossen überraschender Coup mit der die Seiten wechselnden FDP. Knapp, sehr knapp reichte es zum Regieren. Nicht nur die CDU hatte deswegen vor Wut geschäumt.
Das Geläut verstummte, als sie den Fußgängerweg durch den Schlosshof nahm und dahinter den Hofgarten betrat. Die Bäume waren schon kahl, die Grasflächen braun und an schattigen Stellen mit Schneeresten bedeckt. Erstaunlich früh war in diesem Jahr der erste Schnee gefallen, hatte die Stadt in das übliche Verkehrschaos gestürzt und war dann wieder weggetaut. An diesem trüben Mittag begegneten ihr keine Studenten, die den Park bei schönem Wetter bevölkerten. Manchmal in solchen Massen, dass die Hörsäle leer sein mussten. Hilde fragte sich, was die überhaupt noch lernten bei den vielen Sit-ins, Teach-ins und weiß der Teufel was noch für -ins. Vielleicht brüteten sie wenigstens bei diesem Wetter über ihren Büchern.
Ein Inder kam ihr entgegen und verlieh dem Park mit seinem orangefarbenen Turban und dem weinroten Kaftan etwas Farbe. Auch MdB Alois Brunner, der von Montag bis Freitag im Rheinblick zu Mittag aß, vertrat sich im Hofgarten die Beine. Die Hände in den Hosentaschen pfiff er Oh du schöner Westerwald. Warum war der nicht in seinen Wahlkreis gereist? War seine Aussicht auf Wiederwahl so schlecht, dass er erst im allerletzten Moment dort auftauchen wollte? Sie hätte nichts dagegen, wenn er sein Mandat verlöre und Bonn verlassen müsste. Ein schmieriger Typ, der den Serviermädchen gern in den Hintern kniff. Da, Brunner war verabredet, ein anderer Mann ging auf ihn zu. Den o-beinigen, drahtigen Kerl erkannte sie auch von hinten. Erwin Tibulski. Was wollte denn Genosse Tibulski von CSU-Mann Brunner oder Brunner von Tibulski? Er drehte ihr weiter den Rücken zu, hatte sie also noch nicht bemerkt. Das sollte auch so bleiben. Tibulski weckte in ihr keine guten Erinnerungen. Sie schlug den Kragen ihres Wollmantels hoch und beschleunigte ihre Schritte.
Sie war froh, dass sie am Morgen Stiefel angezogen hatte. Schwarzer Knautschlack, Modell Amazone, der letzte Schrei, hatte Schuhhändler Schmitz beim Kauf behauptet. Na ja, zumindest wasserdicht und warm waren sie. Der Kies knirschte unter dem Knautschlack, am Wegrand hoben kahle Platanen dürre Äste in den grauen Himmel. Ein Schwarm Krähen ließ sich schimpfend auf die Blutbuchen dahinter fallen; welke Blätter segelten zu Boden und gesellten sich zu unzähligen anderen ins nasse Laub. Es war nicht mehr weit bis zum Fluss.
Auch wenn dieser trübe Novembertag nach Vergänglichkeit roch, in der Politik standen die Zeichen auf Aufbruch. Für so was hatte Hilde ein Gespür, das hatte sie schon 1969 nicht getrogen. Diesmal würden die Roten gewinnen. Am Rhein riss für einen Augenblick der Himmel auf, als teilte der Wettergott ihre Einschätzung. Der Drachenfels auf der anderen Seite des Flusses zeigte sich. Dort hatte Siegfried den Drachen getötet und in seinem Zauberblut gebadet, das ihn bis auf die kleine Stelle am Rücken, auf die beim Baden ein Lindenblatt fiel, unverwundbar machte. Jeder hatte so eine Lindenblattstelle, wusste Hilde, und hier in Bonn galt es, diese noch besser zu verbergen als anderswo.
Als sie aufblickte, schoben sich schon wieder dunkle Wolken vor die Sonne, und vom Fluss her stieg Nebel auf. Doch kein eindeutiges Zeichen der Götter, dachte sie. Aber auf himmlische Hilfe hatte ein Mann wie Willy Brandt noch nie gesetzt.
The Times They Are a-Changin’
Bonn, Sonntag, 19. 11. 1972
Dass er sich endlich die Haare schneiden lassen solle, pflaumte Kohlmeier Max Dorando immer an, wenn er seinen Dienst antrat. Bei Max ging der Satz zu einem Ohr hinein und zum anderen hinaus, während er erst die Mütze, die der Chef ihm zuwarf, und dann die Autoschlüssel auffing. Wie in einem oft geprobten Theaterstück wusste er genau, dass Kohlmeier, während er sich die Haare unter die Mütze schob, »dass mir keine Klagen kommen« sagen würde, und natürlich tat er es. Anstatt zu antworten, griff Max nach Portemonnaie und Quittungsblock und fragte, ob er einen Vorschuss in bar bekommen könne. Mit Missbilligung auf der Stirn nestelte Kohlmeier ein Schlüsselchen aus der Westentasche, sperrte damit die Geldschublade auf, zählte Max fünf Zwanzigmarkscheine auf den Tisch und ließ sich den Betrag quittieren. Im Gegenzug förderte Max aus den Hosentaschen die Überbleibsel zutage, die Kunden in seiner letzten Schicht im Taxi vergessen hatten. Diesmal war nichts dabei gewesen, was eine Unterschlagung lohnte. Er legte einen schweren Füllfederhalter, einen roten Baumwollschal und ein Taschentuch mit dem Monogramm MC auf den Tisch. Kohlmeier kramte alles zusammen und verstaute es im Fach unter der Geldschublade. Manches wurde tatsächlich abgeholt, anderes staubte so lange vor sich hin, bis es im Kohlmeier’schen Sinn reif zum Wegwerfen war.
Heute hatte es der Chef gut mit ihm gemeint und ihm den Audi 100, die neueste Anschaffung im Fuhrpark, zugeteilt. Eine Spießerkarre zwar, aber mit ordentlich PS unterm Hintern. Max schaltete den Sprechfunk ein, drückte die mitgebrachte Kassette – Led Zeppelin – in den Schlitz und drehte auf volle Lautstärke. Dann ließ er den Motor aufheulen, schoss mit quietschenden Reifen vom Parkplatz und drosselte das Tempo erst kurz vor dem Bahnhof, wo er den Audi auf den leeren Taxistand rollen ließ.
Während er auf den ersten Fahrgast wartete, trommelte er im Rhythmus der Musik aufs Lenkrad, schrie, wie Robert Plant schrie, und überlegte, wann und wo er Witiko Bonak endlich das Geld geben würde. Auf keinen Fall in seiner Werkstatt, da lungerte seit Neuestem einer herum, der wie Bud Spencer aussah und bestimmt kräftig zuschlagen konnte. Der Kerl stammte nicht aus der Venusberg-Siedlung, die alten Kumpels von Witiko kannte Max. Morgen zur Mittagszeit an der Uni-Mensa? Da herrschte ordentlich Betrieb, da würde Witiko keinen Aufstand machen, wenn er anstelle der dreihundertfünfzig erst mal nur hundert Mark kriegen würde. Überhaupt sollte der schön stille sein. Loswerden hatte er die Boxen wollen, keinen Tag länger hatten sie in der Werkstatt rumstehen sollen, er, Max, hatte ihm, so gesehen, einen Gefallen getan – aber mal ehrlich: Wer hätte zu zwei Spendor-BC1-Boxen Nein sagen können? Ein Wahnsinnssound, das Beste, was es zurzeit auf dem Markt gab. Deshalb hatte er auch nicht nachgefragt, wo Witiko die Boxen so billig bekommen hatte, die bei Elektro-Klüwer für tausendzweihundert Mark angeboten wurden.
Ein ungeduldiges Klopfen an der Fahrertür riss ihn aus seinen Gedanken. Ein langbeiniger Ami mit Cowboyhut wollte zur amerikanischen Botschaft gebracht werden. Max stellte das Radio aus und fuhr den Cowboy nach Godesberg, wo er ihn mit all seinen Koffern in der Deichmanns Aue unten am Rhein absetzte. Die Zentrale gönnte ihm keine Pause, er wurde sofort weiter zur britischen Botschaft geschickt. Dort ließ man ihn warten, und er betrachtete die Wahlplakate an der B 9. Stimmt! Wählen musste er auch noch. Willy, wen sonst? Da konnten die Kommunisten in der Schumann-Klause noch so sehr das Hohelied der DKP singen, er würde Willy wählen und seine Kreuzchen machen, sowie ihn eine Fuhre in die Nähe seines Wahllokals brachte. Der Engländer, der nun endlich auftauchte, wollte allerdings nicht zurück in die Stadt, sondern zum Flughafen. Auch recht, Max nutzte die Autobahn, um die PS-Stärke des Audi zu testen. Am liebsten hätte er bei dem Tempo When the Levee Breaks voll aufgedreht, aber der Engländer – grauer Anzug, schwarze Melone – sah nicht so aus, als würde er gern Led Zeppelin hören.
Auf dem Rückweg kutschierte er ein Ehepaar nach Endenich und dachte wieder an Witiko. Der konnte auch noch zwei, drei Wochen warten, bis Max die ganze Summe beisammenhatte. Danach fuhr er nacheinander fünf alte Schachteln zu ihren Wahllokalen und konnte sich nicht verkneifen, ihnen »Willy wählen« hinterherzurufen. Doch sie würden ihre Kreuzchen brav bei der CDU machen, Bonn war ein konservatives Pflaster. Es traf sich gut, dass eines der Wahllokale auch seines war, so konnte wenigstens er endlich Willy wählen.
Um kurz vor 18 Uhr stellte er das Radio ein und suchte einen Sender. Als ein paar Minuten später die ersten Hochrechnungen einen klaren Sieg der SPD ankündigten, nahm Max die Mütze ab und schüttelte seine Locken aus. Das ist doch mal was, dachte er. Trotz all der Weltuntergangsstimmung, die sie im Wahlkampf verbreitet hatten, war es den Schwarzen nicht gelungen, den Aufbruch zu stoppen, der überall zu spüren war. Er warf die Mütze nach hinten und zog sie auch nicht wieder auf, als er den nächsten Fahrgast aufnahm. Ein reaktionärer Spießer, klobig wie ein alter Bunker, mit einer fetten Zigarre im Mundwinkel. Er wollte in die Reutersiedlung und wetterte über ewige Studenten, langhaarige Gammler und das Wahlergebnis. Der Kerl gab keinen Pfennig Trinkgeld, dafür waren die drei Genossen, die Max danach von der Luisenstraße zur Baracke kutschierte, umso spendabler. Das beste Wahlergebnis seit Bestehen der Partei, die Herren waren in Feierlaune. Eine Weile kurvte Max danach fahrgastlos die B 9 rauf und runter, grüßte vor dem Rheinblick mit einem kräftigen Hupen Hilde, die gerade von ihrem Spaziergang zurückkehrte, hörte im Radio Wehner und Genscher über das Wahlergebnis palavern und dachte wieder an Witiko. Vielleicht sollte er ihn doch morgen anrufen und ihm sagen, dass er schon einen Hunderter für die Boxen blechen konnte. Die letzte Fuhre brachte ihn hoch auf den Venusberg. Kurz überlegte er, im Waldauweg vorbeizufahren und seinen alten Herrn herauszuklingeln, um sich an dessen schlechter Laune zu weiden. Für den strammen CDU-Mann kam das Ergebnis dem Untergang des Abendlandes gleich. Aber als Max feststellte, dass seine Schicht in zehn Minuten zu Ende war, brachte er stattdessen den Audi in den Fuhrpark zurück.
Er beschloss, den Abend mit ein paar Kölsch in der Schumann-Klause zu beschließen. Heute bediente Conny, vielleicht konnte er sie überreden, nach der Sperrstunde mit ihm in die Kiste zu steigen. Der Tag musste schließlich mit allem Drum und Dran gefeiert werden. Wie immer parkte er seinen alten 2CV in der Weberstraße, und schon von dort konnte er die Musik aus der Kneipe hören. Irgendeiner, wahrscheinlich Heiner, hatte auf seiner Gitarre Dylan angestimmt, und der ganze Laden grölte The Times They Are a-Changin’. Max schaffte es nicht durch die Tür, denn just in diesem Moment drängten alle nach draußen. Die Jusos, schnappte Max auf, machten einen Fackelzug zum Kanzleramt. Conny hakte sich bei ihm unter, lotste ihn zu seinem Wagen, im Schlepptau noch ein paar andere, die Max vom Sehen kannte. Die Ente kurz darauf voller als eine italienische Familienkutsche auf dem Weg über die Alpen, nach ein paar Startschwierigkeiten – der olle Vergaser – hing die Karre bedrohlich tief auf der Straße, aber es war nicht weit bis ins Regierungsviertel. Ein paar Minuten später parkte Max den Wagen auf Höhe des Museums König, das kurze Stück zum Palais Schaumburg gingen sie zu Fuß. Nachdem sie die Straße überquert hatten, hörten sie »Willy-Willy«-Rufe, und bald sahen sie auch die Fackeln. Ein wogendes Freudenfeuer bis zum Kanzleramt, das ebenfalls hell erleuchtet war. Unter den Fackelträgern entdeckte Max seinen Kommilitonen Konrad, mit dem er neulich erst Vier Fäuste für ein Halleluja gesehen hatte. Mit Konrad kämpfte er sich noch ein Stück weiter vor, und plötzlich konnte er Willy Brandt, der auf die Freitreppe des Palais Schaumburg getreten war, gut sehen. Der alte und neue Kanzler hob die Hände und bat um Ruhe. Leise und krächzend begann er zu sprechen. Treulosigkeit und Hass hätten sie gemeinsam besiegt, sagte er, und Max spürte Gänsehaut auf seinen Armen. Als wieder »Willy-Willy«-Rufe losbrandeten, ihm die Fackeln freudig entgegengereckt wurden, lächelte Brandt. Dann senkte er sanft den Kopf, drehte sich um und ging zurück ins Kanzleramt. Ein Sieger der leisen Art.
Die Fackeln brannten schnell nieder, die Leute zerstreuten sich. Max fand Conny nicht mehr und hätte jetzt sehr gerne zumindest ein Bier getrunken, aber die Sperrstunde galt selbst für die Schumann-Klause. Konrad schlug vor, noch bei der FDP vorbeizugehen, er kenne eine Jungdemokratin, die Wahlkampf für Liselotte Funcke gemacht hatte. Gesagt, getan, keine zehn Minuten später erwies sich am Bonner Talweg der Name des Mädchens – Edeltraud – als Sesam-öffne-dich. Die Sause hier war mehr oder weniger durch. Sir Walter lächelte nur noch von Plakaten auf seine Getreuen, auch kein anderer Spitzenpolitiker war zu sehen. Nur ein paar namenlose Unentwegte debattierten weiter in einer Ecke, und um einen sehr großen Tisch saß jede Menge jungdemokratisches Volk. Die hatten die halb vollen Sekt- und Schnapsflaschen eingesammelt, waren bester Stimmung und teilten die Vorräte großzügig mit den Ankommenden. Max trank Sekt anstelle von Bier, und es fiel ihm leicht, eine schwäbelnde Schwarzhaarige namens Gaby für sich zu begeistern. Gegen zwei Uhr morgens eskortierte er sie zu seinem 2CV und chauffierte sie zu sich nach Hause. Er ließ sie vor der Haustür aussteigen und fuhr in den Hinterhof, um den Wagen abzustellen. Er achtete nicht auf die Gestalt am Hoftor, zu groß seine Vorfreude auf das, was gleich kommen würde, ein schneller Ritt ins Paradies, in Gedanken sah er diese Gaby sich schon nackt auf seinem Bett rekeln. Deshalb überraschte ihn der erste Schlag in den Magen völlig. Als er sich stöhnend aufrichtete, erkannte er Witikos Bud Spencer. Der holte nun erneut aus, ließ seine Rechte auf sein Auge knallen, und während Max im Fallen bereits Sternchen sah, dachte er noch, dass es nicht vier Fäuste für ein Halleluja brauchte. Eine reichte vollkommen.
… turn my nightmares into dreams
Bonn, Montag, 20. 11. 1972, 5 Uhr 30
Sonja Engel blies Trübsal. Mit einer Hand in der Halteschlaufe stand sie im Frühzug von Köln nach Bonn. Sie hatte ein beschissenes Wochenende hinter sich. Nicht mal der Wahlsieg Brandts konnte sie aufmuntern, und es irritierte sie, als eine ältere, ihr unbekannte Frau sie über die Schulter eines Mannes hinweg anlächelte. Sie wich dem Blick aus und wandte sich dem Fenster zu, in dem sich ihr müdes Gesicht spiegelte.
Am Samstag hatte Reni sie angerufen. Wegen der Mutter, mal wieder. Also hatte Sonja ihre Sachen gepackt und war nach Köln gefahren. Reni öffnete ihr die Tür des winzigen Reihenhauses. Siebzehn war die Schwester jetzt und fast so groß wie sie. »Ist er da?«, fragte sie und war erleichtert, als Reni den Kopf schüttelte. »Ist zum Rhein runter angeln«, erklärte sie. »Wird nicht vor der Sportschau zurück sein.« Schnell trat Sonja in den dunklen Flur. Ohne den Mantel abzulegen, lief sie die Stufen zur ersten Etage hinauf und holte tief Luft, bevor sie die Tür des Elternschlafzimmers öffnete. Ein Lichtstrahl fiel auf das kitschige Bild zweier Engel über dem Bett. Langsam trat sie näher. Wie eine Ertrinkende griff die Mutter nach ihren Händen. Sonja mied ihren Blick. »Welche Seite?«, fragte sie und öffnete die mitgebrachte Medikamententasche. Diesmal war es die linke. Hämatome vom Brustkorb bis zum Oberschenkel, schwere Hautabschürfungen auf der Pobacke. Das Gesicht wie immer ohne Verletzungen. Sonja säuberte und verband die offene Wunde, rieb behutsam ein kühlendes Gel auf die Schwellungen. »Er hat sich wegen Reni furchtbar aufgeregt«, wisperte die Mutter. »Sie ist so aufmüpfig in letzter Zeit. Einfach aus dem Haus gerannt ist sie. Dann ist ihm bei mir die Hand ausgerutscht. Er meint es nicht so.« Dass sie seine Schläge verteidigte, war das Schlimmste.
Sonja löste die Hand von der Halteschlaufe und schüttelte die Bilder aus dem elterlichen Schlafzimmer ab. Als sie sich zurückdrehte, blickte sie erneut ins Gesicht der unbekannten Frau. Die lächelte immer noch – oder schon wieder – und deutete mit den Augen auf ihr Revers. Nun verstand Sonja. Der orangefarbene Willy-wählen-Button, auch die Frau hatte für die SPD gestimmt. Hätte sie nicht schon vor zwei Wochen per Brief gewählt, Sonja hätte es vergessen. Die gestrige Wahl war komplett an ihr vorbeigelaufen. Sie hatte den Tag gebraucht, um die Mutter wieder halbwegs herzustellen. Der Erzeuger war ihnen, wie immer nach einem solchen »Vorfall«, aus dem Weg gegangen.
Wieder kehrte ihr Blick zu der fremden Frau im Zug zurück, die nun ihrerseits aus dem Fenster sah. Sie trug ein beigefarbenes Kostüm mit passendem Mantel, dezentes Make-up in Pastelltönen und eine toupierte Haarspray-Frisur. Chefsekretärin und CDU, hätte Sonja bei diesem Aussehen getippt. Aber irgendwoher mussten die vielen Stimmen für Willy Brandt ja gekommen sein. Das Ergebnis war fantastisch, wusste sie von den Schlagzeilen der Zeitungen im Kölner Hauptbahnhof. Fast sechsundvierzig Prozent für die SPD, acht und ein paar Zerquetschte für die FDP, mit so einem klaren Sieg hatte keiner gerechnet. Zumindest das war gut an diesem trüben Montagmorgen.
Den Button trug sie seit vier Wochen. Sie hatte ihn angesteckt, nachdem sie den Kanzler bei einer Wahlveranstaltung in der Mülheimer Stadthalle in Köln erlebt hatte. Ihr gefiel Brandts leise und eindringliche Art zu sprechen. Seine Stimme – und von Stimmen verstand Sonja was – war gleichzeitig krächzend und kräftig, zart und brüchig, melodisch und weich. Obwohl ein paar Jahre älter als der Erzeuger wirkte er so viel jünger, so viel freundlicher, so viel moderner als er. Willy Brandt drohte nicht, er schikanierte nicht, er schrie nicht, er verurteilte nicht. Er war einer, der zuhörte, einer, der argumentierte, einer, der Konflikte mittels Vernunft löste.
Vielleicht gelang es ihm wirklich, das Land in ein friedliebendes, menschenfreundliches zu verwandeln. Dass seine Politik auch ihren Erzeuger zu einem friedliebenden, Frau und Kinder achtenden Menschen machen konnte, glaubte sie allerdings nicht.
Der Zug fuhr in den Bonner Hauptbahnhof ein. Sonja quoll mit der Menge auf den Bahnsteig, wurde zur Treppe hinunter- und wieder hinaufgeschoben und vor dem Bahnhofsgebäude ausgespuckt. Der Bus zum Venusberg war noch nicht eingetroffen, sie musste nicht hetzen, und so überflog sie, während sie am Bahnhofskiosk vorbei zur Bushaltestelle schlenderte, wie schon in Köln die Titelseiten der Zeitungen. Ein lächelnder Willy Brandt zwischen Walter Scheel und Günter Grass blickte ihr von einer der Zeitungen entgegen. »Überraschend deutlicher Wahlerfolg für die sozialliberale Koalition.«
Wenn sie nur auch mal Erfolg hätte! Wenn es endlich mit ihrer Stelle als Logopädin klappen würde! Dann käme sie weg von Stationsschwester Herta und den ekligen Bettpfannen, dann könnte sie die Arbeit tun, die ihr wirklich Freude bereitete. Bei jedem neuen Patienten gab sich der Professor zuversichtlich, aber danach landete sie doch wieder auf der HNO-Station und unter der Fuchtel der Heiligen Inquisition.
Als der Bus kam, setzte ein leichter Nieselregen ein. Ein dunkles Grau hielt den frühen Tag gefangen, aus den beschlagenen Scheiben des Busses drang milchiges Licht. Vor Sonja stürmten zwei Kolleginnen aus der Chirurgie in den Bus, sie quetschten sich nach hinten durch und winkten ihr. Aber Sonja war nicht nach Tratsch über die Klinik und nach Klatsch übers Wochenende schon gar nicht, sie blieb vorne stehen und hielt sich wieder an einer Halteschlaufe fest. Die Luft roch nach feuchter Wolle, Müdigkeit und Haarspray. Der Mann neben ihr auf dem Sitzplatz las den Express. »Brandt bleibt Kanzler.« »Heilsarmeemädchen tot auf dem Alten Friedhof gefunden.«
Sonja fiel sofort die Kleine ein, die vor ein paar Monaten bei ihnen auf Station gelegen hatte. Hochfiebrig war sie von einem Notarztwagen gebracht worden, die Mandeln entzündet, eine Operation allerhöchste Eisenbahn. Sonja hatte dem Mädchen beim Ablegen der viel zu großen Heilsarmeeuniform geholfen und erschrak ob des dürren Kindes, das darunter zum Vorschein kam. Kaum handgroße Brüste, Bauch und Oberschenkel voll blauer Flecke, zerkratzte Knöchel an Händen und Füßen. Das Mädchen wollte ihre Hilfe nicht. Trotz des Fiebers schlug sie mehrfach Sonjas Hände weg und fauchte wie eine räudige Straßenkatze. Sie erkundigte sich nach ihrem Namen, aber die Kleine antwortete nicht, und in ihren Kleidern fanden sich keinerlei Papiere. Als sie nach der OP immer noch nicht sprach, hielt Sonja ihr Papier und Bleistift hin, und darauf schrieb sie mit krakeliger Kinderschrift: Sally Bowles. »Bist du Engländerin? Gehörst du zum diplomatischen Corps in Bad Godesberg? Vor wem bist du davongelaufen?« Was immer Sonja fragte, Sally antwortete nicht.
Mit fünfzehn war Sonja auch mal davongelaufen. Zumindest für ein paar Stunden. Nach Mitternacht hatte sie sich mit gepackter Tasche aus dem Haus geschlichen, aber schon an der Bahnhaltestelle verließ sie der Mut, und sie trollte sich unbemerkt zurück. Ein Angsthase war sie. Ein Feigling.
Als sich der Bus zum Venusberg hinaufquälte, drängte sich der röhrende Motor in ihre Gedanken, Sonjas Hand in der Halteschlaufe musste fester zupacken. Sie versuchte ihrem Gesicht einen munteren Ausdruck zu verleihen, denn gleich an der Bodelschwingh-Straße stieg Luzie zu. Die Kollegin winkte schon von der Tür aus, schlängelte sich geschickt an zwei Männern in grauen Mänteln vorbei und quetschte sich dann neben sie.
»Glaubst du, es ist unsere Sally?«, fragte sie als Erstes und deutete auf den Express-Leser. »Bei Heilsarmee …«
»Ich habe auch sofort an sie denken müssen«, stimmte Sonja ihr zu. »Andererseits, Sally ist das einzige Heilsarmeemädchen, das wir kennen.«
»Wenn sie es ist, werden wir es bald erfahren.« Luzie löste den handgestrickten Schal, den sie um den Hals geschlungen hatte. »Dann kommt die Polente bestimmt in die Klinik und befragt uns.«
»Hoffen wir, dass sie es nicht ist.« Sonja sah auf die kahlen Bäume des Venusbergs, die von den Scheinwerfern des Busses gestreift wurden.
»Bestimmt ist sie es nicht«, unterstützte Luzie sie. »Sally ist ein Stehaufmännchen. Die lässt sich nicht unterkriegen, die wurstelt sich durch. Und jetzt erzähl mal! Wie war dein Wochenende?«
»Bloß nicht. Familie!« Sonja verdrehte die Augen. Luzie nickte. Es war eine ihrer besten Eigenschaften, dass sie genau wusste, wann sie nicht nachhaken durfte.
»Wie läuft es eigentlich in der WG?«
»Kurt hat Freitagabend so eine bescheuerte Diskussion über den Prager Frühling vom Zaun gebrochen. Ich sage dir, der ist schlimmer als unsere Heilige Inquisition.«
»Kann gar nicht sein«, widersprach Luzie. »Schlimmer als unsere Heilige Inquisition geht gar nicht. Apropos, hat sie eigentlich heute Dienst?«
»Glaub nicht. Weißt du, an wen mich Kurt erinnert? An den irren Strelnikow aus Doktor Schiwago. Ja, genau, der immer mit dem Zug durch die Gegend fährt und Leute terrorisiert. Diesmal wollte Kurt von mir wissen, ob ich in der Niederschlagung des Prager Frühlings eher eine Chance oder eine Gefahr für den Sozialismus sehe. Ich meine, das ist vier Jahre her, das war ’68. Will der mein Geschichtswissen, meine politische Gesinnung oder beides testen? Und dann, was für eine bescheuerte Frage! Wenn Panzer rollen, wenn Leute zusammengeschossen werden, ist das niemals eine Chance für irgendwas. Meine Antwort hat ihm überhaupt nicht gepasst, und er wollte mich mit dieser dialektischen Argumentationskette durcheinanderbringen, aber da ist Max dazwischengegangen …«
»Der charmante Max ergreift also Partei für dich.«
»Klar und mit eindeutiger Absicht. Make love not war ist sein Lebensmotto. Aber er interessiert mich nicht. Ich werde sicher keins von seinen Betthäschen.«
»Und wie nimmt er es auf?«
»Sportlich. Er versucht es halt immer mal wieder.« Mit einem Ruck drehte sie sich zu der Kollegin um. »Bestimmt führt er eine Strichliste, mit wie vielen Frauen er schon im Bett war.«
»Wer zweimal mit der gleichen pennt und so weiter.« Luzie verdrehte die Augen. »Manchmal denk ich, die Männer profitieren mehr von der Pille als wir.«
Fünf Minuten später tauschten die zwei Jeans, Bluse und Pullunder gegen Häubchen und Schwesterntracht und meldeten sich dann bei der Stationsschwester zum Dienst. Schwester Herta, die Heilige Inquisition, stand vor ihnen. Sonja hatte sich geirrt.
»Sie sind fünf Minuten zu spät«, pflaumte Schwester Herta die beiden an.
»Wir können dem Busfahrer schlecht befehlen, dass er den Venusberg schneller hochfährt«, wagte Luzie zu widersprechen.
Schwester Herta schnaubte kurz. Sie sah aus wie Nadeschda Tschischowa, die russische Olympiasiegerin im Kugelstoßen: muskelbepackt, mürrisch, furchterregend, der Schrecken der Patienten. Bei ihr kuschte selbst der nörgeligste Herr der Schöpfung.
»In Zimmer 413 ist heute Nacht ein Krebspatient gestorben. Sie fahren die Leiche in die Pathologie«, befahl sie Luzie und ließ damit das Fallbeil auf sie niedersausen. Nichts fürchtete Luzie so sehr wie die Nähe eines Toten. »Und Sie, Schwester Sonja, kommen mit. Wir haben einen Termin bei Professor Becker.«
Was für einen Termin? Wieso mit der Heiligen Inquisition? Wenn der Professor sie brauchte, hatte er doch bisher immer direkt nach ihr geschickt. Wieso hatte er auch Schwester Herta bestellt? Sollte etwa ihre Stelle als Logopädin genehmigt sein?
Bonn, Montag, 20. 11. 1972, 8 Uhr
Der Montagmorgen verströmte Katzenjammer, Katerstimmung, Katzengrau. Unberührt davon eilten wie jeden Werktag Sekretärinnen und Angestellte in Richtung Regierungsviertel, auf dem Weg zu den Büros der Abgeordneten und Ministerien. Den grauen Mäusen war es egal, wer die Wahl gewonnen oder verloren hatte. Sie dienten denen, die sie bezahlten. Onkel Jupp hatte Hilde immer gedrängt, sich eine Stelle in der Stadtverwaltung oder beim Amt zu suchen, um gut versorgt zu sein. Doch bei so einer Arbeit wäre sie eingegangen wie eine Primel. Sie brauchte Menschen um sich herum, keine Akten. Sie wollte ihr eigener Herr sein, nicht vor einem Amtsleiter buckeln. Hätte sie auf ihren Onkel gehört, wäre auch sie in so einer Bürostube gelandet.
Hatte sie aber nicht, deshalb trug sie bunt und nicht grau. Ein Kleid wie ein psychedelisches Farbenspiel mit labyrinthischen Kreisen und sich drehenden Kegeln. Orange, lila, gelb und grün lugten bei jedem Schritt aus ihrem Mantel hervor.
Sie brauchte Frisches. Wirsing und Möhren, Zwiebeln, Lauch, Kartoffeln, Petersilie, alles, was der Markt für einen Pichelsteiner Eintopf hergab. Pichelsteiner, die Lieblingsspeise von Ex-Kanzler Erhard. Aber, mal unter uns: Gab es irgendwas, was der nicht gerne aß? Sein »Wohlstand für alle« lebte er doch zentnerschwer vor. Doch nicht seinetwegen hatte sie das Gericht heute auf die Speisekarte des Rheinblicks gesetzt. Nein, Pichelsteiner war eine kulinarische Allzweckwaffe. Es besänftigte die Gewinner und tröstete die Verlierer.
Wie es sich für eine gute Bonner Geschäftsfrau gehörte, verteilte sie ihre Einkäufe gerecht auf die Marktstände, feilschte um den Preis und bat darum, ihr die Ware spätestens bis 10 Uhr in den Rheinblick zu schicken. Dann setzte sie ihren Weg fort.
Vor dem Schreibwarengeschäft neben dem Rathaus baute Canasius die Zeitungsständer auf und fächelte die Tagespresse in die dafür bestimmten Halterungen. Hilde nickte ihm zu und überflog die Titelseiten. Auf einem Blatt blickte ihr ein schwer enttäuschter Rainer Barzel, auf einem anderen eine mit Mildred Scheel um die Wette strahlende Rut Brandt entgegen. Sie las: »Brandt fährt sensationellen Sieg für die SPD ein.« »Starb das Heilsarmeemädchen wirklich auf dem Alten Friedhof?« »Wahlbeteiligung 91 %.«
»Schrecklich«, seufzte Canasius und ließ offen, ob er das Wahlergebnis oder den Tod des Mädchens meinte.
Hilde betrübte der graue Morgen nicht. Das Wahlergebnis freute sie, weil sie mal wieder den richtigen Riecher gehabt hatte. Der Bundeskanzler für die nächsten vier Jahre hieß Willy Brandt. Vergessen waren das Misstrauensvotum, die Gerüchte um gekaufte Stimmen. Die SPD hatte deutlich zugelegt. Mal sehen, was sie daraus machten. Die alten Hasen des politischen Geschäftes, die im Rheinblick verkehrten, behaupteten gerne, dass einer Regierung eine satte Mehrheit gefährlicher werden könnte als eine hauchdünne. Zu viel Übermut der Minister, zu viele Begehrlichkeiten in der Partei und so weiter.
»Wat jitt et hück ze esse, Hilde?«, schallte es über den Marktplatz. Unverkennbar kölsche Tön, zudem eine altvertraute Stimme, die sie schon lange nicht mehr Mundart hatte sprechen hören. Als sie sich umdrehte, stapfte Erwin Tibulski auf den Zeitungsständer zu. Sein Schnäuzer vibrierte vor guter Laune, als er mit den Händen nach ein paar Zeitungen griff und mit einem Zehnmarkschein bezahlte. Er hatte in seinem Wahlbezirk sicher noch zugelegt. Aber dass er schon wieder ihren Weg kreuzte verhieß nichts Gutes.
Kurz wehte ihr die Erinnerung ein Bild des jungen Tibulski herbei, der 1965 zum ersten Mal den Rheinblick stürmte. Der verwegene Humor in seinen Augen und seine unbändige Lebensfreude hatten ihr sofort gefallen. Dass er mit seinen sechsundzwanzig Jahren der jüngste Abgeordnete des Bundestages sei, hatte er jedem stolz erzählt. Inzwischen gab es Jüngere als ihn, inzwischen wusste er, wie in Bonn der Hase lief. Als Experte für berufliche Bildung hatte er es längst in den Ausschuss für Bildung und Wissenschaft geschafft. Politik war für ihn ein Geschäft, ein Beruf geworden. Seine kölsche Mundart hatte er – genau wie sie selbst – gegen Hochdeutsch eingetauscht beziehungsweise gegen das, was der Rheinländer als Hochdeutsch empfand. Gelegentlich spielte er noch im Rheinblick Skat, doch er kam nicht mehr wie früher spätabends auf ein Bier vorbei. Hilde wusste nicht, wo er dieser Tage verkehrte. Vielleicht in feineren Häusern. Bei Caminetto, im Bristol oder im Königshof, wo Separees zum Intrigieren einluden, wo man Gäste nach Rang und Namen beurteilte, wo man um sie herumscharwenzelte und Bücklinge machte, ihnen aber hinterrücks in die Suppe spuckte.
Sie machte sich auf den Heimweg. Tibulski sollte ihr nicht die Laune verderben.
»Hilde! Auf ein Wort«, rief er ihr nach, eilte herbei und passte seinen Schritt ihrer Gangart an.
»Ich habe keine Zeit«, knurrte sie, aber Tibulski ließ sich nicht abwimmeln.
»Dann komm ich direkt zur Sache: Jetzt, wo die Schwarzen so hoch verloren haben, werden sie Druck wegen der angeblich gekauften Stimmen beim Misstrauensvotum machen. Sie werden so schnell wie möglich einen Untersuchungsausschuss beantragen.«
»Einen Untersuchungsausschuss?« Sie rang nach Luft, als hätte er einen Eimer Eiswasser über ihr ausgeschüttet.
»Meine Rolle in der Angelegenheit war diskret, es muss mit dem Teufel zugehen, wenn ich in die Schusslinie gerate«, machte er schnell weiter. »Falls doch, sollst du wissen, dass meine Lippen versiegelt sind. Wir drei vom Rheinblick, auf immer und ewig, weißt du noch? Niemals würde ich eine alte Freundin verraten. Du brauchst dir also keine Sorgen zu machen.«
Angst und Ärger stiegen in ihr auf, rangelten miteinander, und Hilde war froh, dass erst mal der Ärger siegte. »Wieso erzählst du es mir überhaupt, wenn ich mir keine Sorgen machen muss?«, raunzte sie ihn an.
»Damit du Bescheid weißt. Das Thema wird im Rheinblick bald die Runde machen. Spätestens wenn der Wahlkampfrummel sich gelegt hat.«
Bonn, Montag, 20. 11. 1972, 10 Uhr
Max trieb in einem dreckigen, trägen Fluss, die Arme um ein Stück Treibholz geschlungen, als Kurt ihn weckte. Max konnte nur ein Auge öffnen. Auf das andere drückte das Lid mit dem Gewicht einer Grabplatte, und darunter puckerte und brannte es.
»Da ist Astrid für dich am Telefon.« Kurt rüffelte die Nase. »Lüfte mal«, empfahl er angewidert. »Bei dir stinkt es schlimmer als in einer Rekrutenstube.«
Astrid! Die schärfste Braut in seinem Geschichtsseminar, schön wie Uschi Obermeier und verdammt schlau. Nur ihretwegen hatte er das Seminar über das Elisabethanische Zeitalter belegt, sogar Interesse an ihrer Arbeitsgruppe geheuchelt, in der über die Gefahren der Ehe am Beispiel von Maria Stuart diskutiert wurde. Landen hatte er bisher trotzdem noch nicht bei ihr können, und ausgerechnet jetzt rief sie ihn an.
Als er aus dem Bett sprang, bremste ihn ein scharfer Schmerz im Bauchbereich aus. Stöhnend humpelte er in den Flur, wo der graue Hörer, den Kurt neben den Telefonapparat gelegt hatte, auf ihn wartete. Bevor er danach griff, atmete er einmal tief durch. »Hallo, Astrid.« Seine Stimme tönte, wie er sich fühlte: verkatert und zerschlagen.
»Hör mal, wo bleibst du?«
Wenn Frauen in etwas einsame Spitze waren, dann in der Kunst des Vorwurfs. Die beherrschten sie aus dem Effeff, die reicherten sie immer wieder mit frischen Nuancen und Finessen an. Dagegen kam man als Mann nur an, wenn man gut in Form war, und das war er an diesem Morgen wahrlich nicht.
»Wir wollen hier über Mary, Queen of Scots von Antonia Fraser diskutieren«, machte Astrid weiter, ohne eine Antwort abzuwarten. »Ja, genau, das Buch, das die sogenannten Kassettenbriefe neu bewertet. Du hast doch letztes Mal so groß getönt, wie sehr dich der Brief als Mittel der politischen Intrige interessiert, und wolltest bei Stefan Zweig die Kapitel über die Kassettenbriefe nachlesen. Hast du oder hast du nicht?«
»Sorry, Astrid, aber mir ist etwas dazwischen …« Er hasste sich für diese erbärmliche Antwort. Warum fiel ihm keine bessere Ausrede ein?
»Viel Lärm um nichts. Mal wieder typisch Mann.« Astrid blies weiter ins Vorwurfshorn. »Ich will jetzt der basisdemokratischen Entscheidung unserer Arbeitsgruppe nicht vorgreifen, aber Männer wie du bringen uns nicht voran.« Bevor er zu einer Antwort ansetzen konnte, legte sie einfach auf.
Mit dem Tut-Tut-Tut im Ohr klebte Max noch eine Weile im Flur fest, bevor er den Hörer auflegte und sich zurück in sein Zimmer schleppte. Sister Morphine kam ihm in den Sinn, mit fahrigen Fingern schob er Exile on Mainstreet, das neueste Album der Stones, zur Seite und suchte nach Sticky Fingers. – Ja, er besaß tatsächlich eine Erstausgabe mit diesem Wahnsinnsplattencover von Andy Warhol, das mit dem echten Reißverschluss, und nein, er stand nicht auf Pillen und Spritzen, nein, er hatte gestern nichts eingeworfen. Oder etwa doch? Hatten ihm die feierwütigen Jungdemokraten oder diese schwäbelnde Gaby etwas in den Sekt geträufelt? Sein Schädel fühlte sich so an, und seine Hände zitterten wie auf Entzug, als er die Platte aus der Hülle nahm. Er schaffte es nicht, die Nadel des Plattenspielers ohne Kratzen auf die richtige Stelle zu legen, dann endlich tönte Jaggers Flehen durch den Raum: »Please, Sister Morphine, turn my nightmares into dreams.«
»Leiser«, brüllte Kurt und hämmerte mit den Fäusten gegen die Wand. »Nicht jeder in dieser WG steht auf die Stones, und mit deinen Spendor-Boxen gehst du mir tierisch auf den Zeiger.«
Die Spendor-Boxen. Aus seinen vernebelten Hirnwindungen stiegen Erinnerungsfetzen auf: die Rückfahrt von der Party, seine Hand zwischen Gabys Schenkeln, das Hoftor, seine Erregung, und Bud Spencer. Witikos Schläger und nicht einem gepanschten Getränk verdankte er seinen erbärmlichen Zustand. Wo war eigentlich Gaby abgeblieben? Hatte sie sich dünne gemacht, weil er nicht zurückkehrte? Oder die Flucht ergriffen, als er auf allen vieren angekrochen kam? Eine heiße Wut auf Witiko stieg in ihm auf und sorgte für einen Moment der Klarheit. Witiko hatte ihm nicht nur die Nacht mit der Schwäbin vermasselt, der war auch schuld, dass seine Chancen bei Astrid nun gegen null tendierten. Und das alles nur, weil sich sein alter Kumpel plötzlich als Kleinstadtmafioso aufspielte. Witiko wusste doch ganz genau, dass er die dreihundertfünfzig Mocken nicht von heute auf morgen auftreiben konnte, aber irgendwann bezahlen würde. Himmel, sie kannten sich seit ewigen Zeiten. Gestern Nacht hätte ein freundlicher Satz von Bud Spencer genügt, und er hätte ihm den ersten Hunderter in die Hand gedrückt. Stattdessen hatte der direkt die Fäuste sprechen lassen.
Die Wut trieb ihn zurück in den Flur, Witikos Nummer kannte Max auswendig. Der meldete sich nach dreimaligem Klingeln. »Den ersten Hunderter kannst du dir von der Backe putzen«, geiferte Max in den Hörer. »Der ist Schmerzensgeld. Hast du sie noch alle? Mir einen Schläger auf den Hals zu hetzen? Was ist das überhaupt für einer?«
»Du meinst wohl, ich warte bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag auf dein Geld? Wie lange renne ich dir deswegen schon hinterher? Drei Monate? Vier Monate? Wie oft habe ich dich im Guten daran erinnert? Aber du glaubst immer noch, nur weil wir im Sandkasten zusammen gespielt haben, kannst du mir auf der Nase herumtanzen.« Seine Stimme klang viel zu klar für Max’ malträtierten Kopf. »Ich habe es dir tausendmal gesagt. Die erste Rate am Sonntag, sonst passiert was.«
»Jetzt mach hier mal nicht auf Gangsterboss. Ich hatte das Geld in der Tasche, gestern verdient. Ich hätte es heute vorbeigebracht, aber das kannst du jetzt knicken.«
»Soso. Jetzt bin ich also schuld, dass du deine Schulden nicht bezahlst.«
Max hörte ein Rascheln und Schieben und dann ein metallisches Kratzen. Er war oft genug in Witikos kleinem Büro hinter der Werkstatt gewesen, er wusste, wie es klang, wenn Witiko Platz auf seinem Schreibtisch schaffte, um seine Cowboystiefel darauf zu platzieren.
»Ich kann die Rechnung auch an deinen alten Herrn weiterreichen. Der Herr Ministerialrat wird sich bestimmt freuen, seinem Sohn aus der Patsche zu helfen.«
Max’ Wut zerplatzte wie ein zu kräftig aufgeblasener Luftballon. Der Schmerz kehrte in den Bauch zurück, und im Kopf machte sich deprimierende Nüchternheit breit. Wie konnte ihm Witiko nur mit seinem Alten drohen? Stundenlang hatten sie mit fünfzehn oben am Venusberg hinter der Sakristei von Heilig Geist gehockt, schachtelweise Zigaretten gequalmt und sich über ihre Alten ausgekotzt. Vertrauen gegen Vertrauen, versiegelte Lippen, großes Indianerehrenwort hatten sie sich damals geschworen. Das brach Witiko nun eiskalt, um ihn wegen ein paar läppischer Kröten unter Druck zu setzen. Sie waren schon lange keine Freunde mehr, aber doch so was wie alte Kumpel. Max hielt Witiko für ein schlichtes Gemüt, bauernschlau, ja, auf seinen Vorteil bedacht, ja, aber alles in überschaubarem Rahmen. Er unterschätzte ihn, stellte er fest. So verletzt und lädiert, wie er augenblicklich war, blieb ihm nichts anderes übrig, als die Waffen zu strecken.
»Ich komm später bei dir vorbei«, maulte er. »Aber halt deinen Schläger von mir fern.«
»Ich wusste doch, dass du vernünftig bist.«
Noch einmal hörte Max das metallische Kratzen, und vor seinem geistigen Auge sah er, wie Witiko seine Cowboystiefel übereinanderschlug, sich weit zurücklehnte, die langen Haare nach hinten strich und den Mund zu diesem feinen, scheinbar gütigen Grinsen verzog, das er sich von Marlon Brandos Vito Corleone im Paten abgeguckt hatte. Filme! Sie konnten so einen verdammt schlechten Einfluss auf Menschen haben. Darüber konnte Max sich aufregen, aber wenn er ehrlich war, irritierte ihn viel mehr, dass er nicht mehr wusste, ob Witiko den Gangster nur spielte oder tatsächlich einer geworden war.
Bonn, Montag, 20. 11. 1972, 11 Uhr 30
Energisch wienerte Hilde das blanke Buchenholz, aus dem der Tresen des Rheinblicks gezimmert war. Der Rheinblick war ihr Reich, hier galten ihre Regeln. Daran würde auch Tibulski nichts ändern. Sie bürstete die Angst weg, die auf dem Rückweg vom Markt den Ärger verdrängt hatte, und vergaß die grauenvollen Was-wäre-wenn-Szenarien, die ihr durch den Kopf geschossen waren. Tibulski konnte sie mal, von ihm würde sie sich nicht bang machen lassen. Wieder tunkte sie die Bürste ins Scheuerpulver und schrubbte, was das Zeug hielt.
Als der Tresen zu ihrer Zufriedenheit blitzte, machte Hilde die Runde durchs Lokal. Sie fuhr mit dem Staubwedel über die Kupferlampen, zupfte welke Blätter aus den Blumenkästen, ärgerte sich über die Kippen, die sie aus der Blumenerde pulte. Als ob nicht genug Aschenbecher herumstanden. Eine Illustrierte war hinter die Bank vor einem der Blumenkästen gerutscht, einer der Gäste musste sie liegen gelassen haben. Hilde hob sie auf, blätterte sie durch, es war eine aktuelle, setzte sich, ließ sich nur zu gerne ein paar Minuten ablenken. Sie blieb an einer Doppelseite hängen. »Die zwei mächtigsten Minister der neuen Regierung?« Gemeint waren Horst Ehmke und Helmut Schmidt, die ihr von scharfen Schwarz-Weiß-Fotos entgegenblickten. Horst Ehmke mit seinen buschigen pechschwarzen Augenbrauen und dem grau melierten Bürstenschnitt, Helmut Schmidt mit dem akkurat gescheitelten dunklen Haar und dem schmalen Mund, in dem ausnahmsweise weder eine Pfeife noch eine Zigarette steckte.
»Schmidt Schnauze wird er landauf, landab genannt«, las Hilde. »Der Hanseat ist nicht nur berühmt für seine präzisen Analysen, sondern ebenso berüchtigt für seine scharfen Reden und meist treffsicheren Repliken. 1966 wird er in der Großen Koalition Fraktionsvorsitzender der SPD und damit einer der mächtigsten Männer seiner Partei.«
Schmidt, überlegte Hilde, war als junger Abgeordneter Anfang der 1960er oft in den Rheinblick gekommen und danach nur noch selten. Ehrgeiz stand ihm damals schon ins Gesicht geschrieben.
»Es ist ein offenes Geheimnis, dass Schmidt nach der Wahl 1969 die Große Koalition gerne fortgesetzt hätte und von Brandts Vorstoß, mit der FDP zu regieren, überrascht wurde«, setzte sie ihre Lektüre fort. »In der sozialliberalen Koalition war Schmidt erst Verteidigungsminister und übernahm nach dem Rücktritt von Karl Schiller im Juli 1972 dessen Superministerium aus Wirtschaft und Finanzen. Aus gut unterrichteten Kreisen ist zu hören, dass Schmidt dieses Superministerium behalten und zu einer Art Schatzkanzleramt nach englischem Vorbild ausbauen will. Mit diesem Doppelministerium wäre er nach dem Kanzler der mächtigste Mann der Regierung.«
Ja, dachte Hilde, das passte zu ihm. Sie war sicher, dass er nicht nur der mächtigste Mann neben dem Kanzler sein, sondern selbst Kanzler werden wollte. Bestens in der Partei vernetzt, scharte er gewichtige Parteifreunde um sich, immer bereit, falls Brandt straucheln sollte. Davon war Brandt im Moment allerdings weit entfernt. Der sensationelle Sieg der SPD war im Wesentlichen sein Verdienst.
»Tag, Hilde«, unterbrach Karlchen, der zur Arbeit kam, ihre Gedanken.
Sie sah kurz auf und nickte ihrem Oberkellner zu. »Kannste im Keller noch eine Kiste Roten von der Ahr und ein paar Flaschen Weißen aus dem Rheingau holen?«, bat sie ihn und wechselte zur anderen Zeitungsseite, die ebenfalls einem Mann mit großem Ehrgeiz gewidmet war:
»Er sieht aus wie ein Mittelgewichtler, der sich erfolgreich in die Getränkebranche zurückgezogen hat; aber er ist ein Professor. Horst Ehmke, der Chef des Kanzleramtes. Die altmodische Bundeskanzlei am Rhein baute er mit einem gewaltigen Aufwand Schritt für Schritt zu einer der größten Regierungszentralen der westlichen Welt aus. Immer noch modernisiert und reformiert er, überschreitet fröhlich Kompetenzen und bringt damit mehr als einen Minister zur Weißglut.«
Ehmke war ein Charmeur, wusste Hilde. Wenn er gelegentlich im Rheinblick vorbeikam, begrüßte er sie stets als schönste Wirtin Bonns. Gern war er mit großer Entourage unterwegs, in einer fröhlichen Runde lief er zur Bestform auf. Er kam aus dem Osten, wusste sie, aber seinem Temperament nach hätte er Rheinländer sein können. Sie beugte sich wieder über die Zeitung:
»Sein ›Spezialist für alles‹, so nennt ihn der Kanzler, der in dem kein Kampfgetümmel scheuenden, sich in jeden Schlagabtausch werfenden, vor fröhlicher Unverfrorenheit strahlenden Ehmke einen kongenialen Gegenpart zu seinem nachdenklichen, oft zweifelnden Wesen sieht. Ein Mann, der im Gegensatz zu seinen bisherigen Vorgängern im Kanzleramt weder zurückhaltend noch geräuschlos noch öffentlichkeitsscheu ist.«
Hilde musste an den Witz denken, der über Ehmke im Umlauf war: »Sein Fahrer fragt: Wohin, Herr Minister? Ehmke antwortet: Egal, ich werde überall gebraucht.«
»Zwei vor Selbstbewusstsein strotzende Männer«, las sie weiter, »die nicht gegensätzlicher sein könnten: Schmidt eher dem rechten Flügel seiner Partei zuzurechnen, Ehmke der linken Mitte, Schmidt der scharfzüngige Analytiker, Ehmke der Hans Dampf in allen Gassen, Schmidt der strenge, norddeutsche Protestant, Ehmke der hedonistische Lebemann. Beide mit großen Plänen: Schmidt will ein Finanz- und Wirtschaftsministerium nach englischem Vorbild, Ehmke ein Kanzleramt mit präsidialem Zuschnitt. Nicht nur deshalb sind sich Schmidt und Ehmke nicht grün, ihre Rivalität ist in Bonn allgemein bekannt.«
Für Hilde war auch das nichts Neues. SPD-Löffler, einer ihrer Stammgäste, war ein großer Ehmke-Freund, der gern gegen Schmidt wetterte. Ein Blick auf die Uhr, ein paar Minuten blieben ihr noch, sie konnte den Artikel zu Ende lesen.
»Das Wahlvolk hat Willy Brandt am Sonntag einen glorreichen Sieg beschert. Nun bringen sich seine Gefolgsleute in Stellung. Man darf gespannt sein, wie der Kanzler mit ihren Forderungen umgeht, nach welchen Kriterien er sein neues Kabinett zusammenstellt, wer auf der Gewinner- und wer auf der Verliererseite stehen wird.«
Niemals mischte sich Hilde im Rheinblick in Debatten ein. Ihren Gästen gegenüber stellte sie sich dumm und behauptete, dass Politik sie nicht interessierte, aber das entsprach nicht ganz der Wahrheit. Brandt regierte noch keine vier Jahre. Seit den ersten drei Wahlperioden der jungen Bundesrepublik, in denen der Gewinner immer Adenauer hieß, war keinem Kanzler mehr als eine Amtszeit vergönnt gewesen. Sieg und Niederlage rückten in Bonn enger zusammen. Würde Brandt so schnell weg vom Fenster sein wie Erhard und Kiesinger? Oder würde er ein zweiter Adenauer? Sie überlegte hin und her, wagte aber keine Prognose. »Et kütt, wie et kütt«, zitierte sie eine kölsche Lebensweisheit der Großmutter. Dann schlug sie die Illustrierte zu.
Karlchen war inzwischen mit dem Wein zurückgekehrt und schob die Weißweinflaschen unter dem Tresen in die Kühlung. Hilde stand auf und öffnete zwei Fenster, um einmal Durchzug zu machen. Aus der Ferne hörte sie das Angelusläuten der Münsterglocken. Sie schloss die Fenster und öffnete die Tür. Es war so weit. Zeit für die Mittagsschicht, sie wappnete sich für den Ansturm. Es würde wie immer brechend voll werden.
Bonn, Montag, 20. 11. 1972, 12 Uhr
Ungeduldig mit dem linken Fuß wippend, stand Sonja im Flur und blickte aus dem großen Fenster hinaus auf den Kottenforst, der sich hinter der Uniklinik erstreckte. Die Tristesse des frühen Morgens war wie weggepustet, sie konnte nicht still stehen bei all den Ideen, die durch ihren Kopf flipperten, und der freudigen Aufregung, die ihr den Mund ausdörrte. Am liebsten hätte sie Luzie, auf die sie hier wartete, alles brühwarm erzählt, aber Professor Becker hatte sie zu striktem Stillschweigen verdonnert.
Als sie vor ein paar Stunden im Schlepptau von Schwester Herta die weiten Flure der Klinik durcheilt hatte, war sie mit einmal überzeugt, ja hundert Prozent sicher gewesen, dass es bei Professor Becker nicht um die Logopädie-Stelle ging. Die Stelle war nichts weiter als laue Luft und schöne Worte, nichts als eine hohle Versprechung. Der Professor wäre nicht der Erste, der sie enttäuschte. Versprochen hatte ihr der Vater damals etwas, und sie hatte ihm wirklich geglaubt. Als Klassenbeste wäre sie so gerne aufs Gymnasium gegangen. Ihre Lehrerin, Fräulein Giersig, wollte deshalb sogar bei ihnen vorbeikommen und mit dem Erzeuger reden, aber die Mutter wehrte ab. Niemals würde sich ihr Mann von einer Frau, und sei sie noch so studiert, sagen lassen, was das Beste für seine Tochter war. Da hatte sie, Sonja, selbst allen Mut zusammengenommen und ihn gebeten, aufs Gymnasium zu dürfen. »Das ist nichts für dich und damit basta«, hatte er entschieden, aber sie blieb hartnäckig. Wochenlang stellte sie ihm abends die Pantoffeln hin, holte ihm Bier aus dem Kühlschrank, rückte ihm den Sessel vor dem Fernseher zurecht. Sie machte sich so sehr lieb Kind, dass ihr die Brüder schon den Vogel zeigten. Aber irgendwann erwischte sie bei ihm einen schwachen Moment, und er sagte Ja. Doch sein Wort war nichts wert, als er beim Schulwechsel ihre Anmeldung bestätigen sollte, verweigerte er die Unterschrift. Dabei hatte sie ihm dieses eine Mal wirklich geglaubt.
Sonja seufzte. Bestimmt war sie schlicht wegen eines Fehlers zum Rapport bestellt. Sie rief sich alle Fehler der letzten Zeit ins Gedächtnis, bereit, der doppelten Inquisition – der Heiligen und der von Professor Becker – selbst den Diebstahl der einen Klopapierrolle zu gestehen, die sie mitgenommen hatte, als Max die beim WG-Einkauf vergessen hatte. Ihre Kindheit hatte sie gelehrt, immer mit dem Schlimmsten zu rechnen. Aber es kam alles ganz anders, und sie musste gar nichts gestehen, und dann wurde auch noch die Heilige Inquisition vom Professor in ihre Schranken verwiesen. Während er Sonja durch das schmale Vorzimmer der Sekretärin in sein Büro führte, sah sie aus dem Augenwinkel, dass Schwester Herta wie vom Donner gerührt im Türrahmen stand. Der Professor hatte sie überhaupt nicht zu Wort kommen lassen. Sowie sie sich von ihrem Schock erholt hatte, würde sie mit Schaum vor dem Mund zurück auf die Station stürmen und mit ihrem Zorn auf die selbstherrlichen Götter in Weiß keinen verschonen. Am allerwenigsten Sonja, wenn sie auf die Station zurückkehrte.
Bonn, Montag, 20. 11. 1972, 12 Uhr
Die Sieger trudelten heute zuerst ein. Zehn Genossen, Hessen und Ruhrpott gemischt, zwei neue Gesichter. Kölsch und Schnaps für alle, Koslowski aus Bochum bezahlte.
»Prost, Hilde!« Koslowski hob das Glas. »Ham wir uns doch verdient. Hier unsere Neuen, damit du se unter deine Fittiche nehmen kannst: Genosse Wolfgang Keller aus Dortmund.« Er deutete auf einen großen schweren Mann, der Hilde eine Pranke entgegenstreckte, die nach harter Arbeit aussah. »Und dat is dat Hilde, die Chefin vom Ganzen. Sie macht ’nen astreinen Panhas.« Koslowski drehte sich nun zu einem jungen schwarzlockigen, mageren Kerlchen in Lederjacke und legte ihm den Arm um die Schultern. »Und dat dünne Hemdken is der Genosse Richard Weber aus Rüsselsheim. Unser Jüngster! Ein wildes Bürschken.«
Hilde musterte ihn, und Erwin Tibulski drängte sich wieder in ihre Gedanken. Es war nicht gut, wenn sie so jung nach Bonn kamen. Ein bisschen Lebenserfahrung, ein bisschen Gegenwind, die eine oder andere Niederlage, all das sollten sie gesammelt haben, bevor sie in der großen Politik mitspielen durften.
»Richy, wenn de mal Heimweh hast, dann kocht dir dat Hilde bestimmt eine Frankfurter Soße«, machte Koslowski weiter. »Na denn, Prost, Genossen. Auf den Sieg.«
Die zweite und dritte Runde gingen auf die beiden Neuen. Inzwischen hatte das Finanzministerium, Abteilung Zoll und Verbrauchsteuern, an Tisch 3 zum Essen Platz genommen. Erstaunt stellte Hilde fest, dass sich heute sogar die Ministerialräte Dorando und Emmersberg die Ehre gaben. Die zwei tauchten sonst nie gemeinsam auf. Hilde hatte munkeln hören, dass sie sich nicht ausstehen konnten. Fast zeitgleich trafen die Sekretärinnen des Kanzleramts ein, die Hilde mit dem Kopf zum letzten Tisch links neben der Theke dirigierte, den sie immer für die Damen frei hielt. Ihnen folgten die Chauffeure des Auswärtigen Amtes sowie die Herren aus den Abteilungen Waldwirtschaft und Nutztierhaltung des Landwirtschaftsministeriums. Mit dem nächsten Schwall kühler Herbstluft drängte eine Referentengruppe aus dem Langen Eugen nach drinnen. Hilde vertraute Karlchen den Zapfhahn an und wechselte vom Tresen in den Gastraum. Sie verteilte Sitzplätze, drückte Hände, nahm Bestellungen auf, grüßte, winkte, nickte und machte dem Serviermädchen Platz, das mit Tellern voll mit Pichelsteiner Eintopf durch die Gänge eilte. Dorando und Emmersberg orderten Fisch, sicher dem Wahlergebnis geschuldet. Katzenjammer wie am Aschermittwoch. Die Niederlage mussten die beiden strammen Konservativen erst mal wegstecken.
Als fast alle schon gegessen und bezahlt hatten und die meisten bereits gegangen waren, zeigten sich die Verlierer. Die Schwarzen rückten im Tross an. Fünfzehn zählte Hilde auf die Schnelle und sah sich im Raum um. Wenn sie sich setzen wollten, musste man Tisch 3 und 4 zusammenschieben, aber Tisch 3 war noch nicht frei. An der linken Seite des Tresens hielten die Genossen die Stellung, daneben kippte die Abteilung Nutztierhaltung eine Runde Klaren, bevor es zurück in die Büros ging.
»Wenn ihr noch was essen wollt, müsst ihr kurz warten«, begrüßte Hilde die Herren. »Stellt euch doch so lang neben die Nutztierhaltung. Ich bin direkt bei euch.« In Windeseile tauschte sie mit Karlchen den Platz und flüsterte ihm beim fliegenden Wechsel zu, wer noch bezahlen musste. »Wat darf ich euch bringen, Liebeleins?«, fragte sie. »Eine Runde Kölsch?«
Als der Kranz mit den Kölschgläsern rundging, besah sich Hilde die bedröppelten Gesichter. Ach herrje! Es war schwer für die Schwarzen. Drei Jahre lang fühlten sie sich zu Unrecht auf die Oppositionsstühle verbannt, weil Brandt die Ehe mit der FDP einer weiteren großen Koalition vorzog, schließlich waren sie bei der Wahl 1969 die stärkste Partei gewesen. Das Fiasko mit dem Misstrauensvotum hatte sie noch mehr durcheinandergebracht, und jetzt waren sie nicht mal mehr stärkste Partei. Hilde schielte zu den Siegern hinüber. Die Genossen bewiesen Anstand. Kein hämisches Grinsen, kein gemeines Auftrumpfen, stattdessen ein höfliches Nicken, dann vertieften sie sich wieder in ihre Debatte über das Mitbestimmungsgesetz, das, so der kleine Weber, die Regierung in dieser Legislaturperiode unbedingt durch den Bundestag peitschen musste. »Paritätisch. Auf was anderes dürfen wir uns nicht einlassen.«
»Was ist mit dem Friedel Holthusen?«, erkundigte sich Hilde, nachdem sie bemerkt hatte, wer bei den Schwarzen fehlte.
»Hat’s nimmer g’schafft«, brummte der Franke Oberfellner. »Genau wie der Brunner.«
Um Holthusen – Großbauer aus dem Alten Land, ein feiner, stiller Mensch – tat es ihr leid, um Brunner nicht. Der hielt sich für den Jäger aus Kurpfalz und behandelte Frauen wie Freiwild. Gut, dass er die Bonner Wildbahn verlassen musste. Für immer, hoffte Hilde, was wahrscheinlich nur ein frommer Wunsch war. Es gab Politiker, die klebten auch ohne Mandat an Bonn fest, die sicherten sich über die Partei ab oder erschlichen sich eine Stelle in einem Ministerium. Brunner zählte zu dieser Sorte. Der hatte Tibulski am Tag vor der Wahl bestimmt nicht getroffen, um übers Wetter zu reden. Plötzlich beunruhigte sie die Frage, wo Tibulski inzwischen überall mitmischte.
»So isset in Bonn«, antwortete sie Oberfellner. »Ein Kommen und Gehen.«
Bonn, Montag, 20. 11. 1972, 12 Uhr 30
Wie befürchtet, verdonnerte die Heilige Inquisition sie zum Leeren der Bettpfannen. Für Sonja gab es keine widerlichere, ekligere, üblere Arbeit auf der Station, als die Ausscheidungen der Kranken zu entsorgen. Sie erledigte das in rasender Geschwindigkeit, danach hatte sie endlich Zeit für ihre Patienten: Sie tröstete die alte Frau Bär, deren Sohn am Sonntag wieder nicht zu Besuch gekommen war. Sie legte Adalbert Anstetten, dessen frisch operiertes linkes Ohr gewaltig schmerzte, das sehnsüchtig erwartete neue Kicker-Heft auf den Nachtisch, das sie ihm im Kiosk im Foyer besorgt hatte. Sie erfand für die kleine Elsie Raubach, der man die Polypen im Rachenbereich entfernt hatte, eine fesselnde Feengeschichte, damit sie trotz Halsschmerzen immer wieder ein Schlückchen Kamillentee trank. Kurzum, es war so viel zu tun, dass sich keine Gelegenheit für einen Plausch im Schwesternzimmer bot, wo Luzie sie hätte nach dem Gespräch bei Professor Becker ausfragen können. Wo blieb sie eigentlich? Wenn sie nicht bald auftauchte, verpassten sie den Bus.
Es leuchtete ihr ein, dass sie Luzie nichts erzählen durfte, aber sie musste mit jemandem darüber sprechen, sonst platzte die Neuigkeit an falscher Stelle heraus. Es gab nur eine, bei der das Geheimnis gut aufgehoben war, Sybille. Ihre Cousine, die vor ein paar Jahren nach Berlin gezogen war, konnte schweigen wie ein Grab. Sie musste Sybille schreiben, ein Telefon gab es in der Kreuzberger WG noch nicht.
Überhaupt Sybille. Ohne sie hätte sie diesen Auftrag nie bekommen. Kurz blitzte in Sonjas Kopf ein Bild des Innenhofs der Weißen Stadt auf, wo die Tibulskis wohnten. Sie, die Engels, lebten linksrheinisch in einem Haus der Longericher Katholikentagssiedlung, deren Baubeginn mit dem 77. Katholikentag 1956 zusammenfiel. Eine Anlage bescheidener Einfamilienhäuser mit Nutzgärten, für die kinderreiche katholische Familien mit geringem Einkommen von der Kirche einen günstigen Baukredit erhielten. Im Familienalbum fanden sich etliche Zeitungsausschnitte über den Bau der Siedlung, die Berühmtheit erlangte, weil sie einige Jahre als die kinderreichste Siedlung der Bundesrepublik galt. Die Tibulskis dagegen wohnten zur Miete in einem Genossenschaftshaus. Rechtsrheinisch, genau gesagt, in der Weißen Stadt in Buchforst, einer fünfstöckigen, im Karree gebauten Arbeitersiedlung, wo man das Weiß, dem die Siedlung ihren Namen verdankte, noch erahnen konnte. Im großen, hellen Innenhof der Anlage war neben den obligatorischen Teppichstangen, Wäscheleinen, Gemüseparzellen und Hasenställen viel mehr Platz zum Spielen als in den winzigen Gärten in Longerich, und den nutzten die Engel- und Tibulski-Kinder weidlich. Bis auf Erwin, der da bereits um die Erwachsenen herumschlich. »Eins, zwei, drei, vier Eckstein, alles muss versteckt sein.« Was war es für ein Vergnügen, unentdeckt zwischen Hasenställen oder hinter Holundersträuchern zu kauern und vorzustürmen, wenn der Platz zum Anschlagen frei war! Doch mit Sybille als Fänger wurde das Spiel zur Tortur. »Ei-ei-eins, zwa a zwa a …« Puterrot vor Anstrengung kam sie nie über das »Zwa a« hinaus. Sie quälte sich mit den Buchstaben, die ihr nicht gehorchten, mit Worten, die ihr Mund nicht ausspucken wollte. Alle Kinder lachten sie aus, bis Sonja die Grausamkeit nicht mehr länger aushielt, Sybille beiseitenahm und damit das Spiel beendete. Während die Buben danach als Cowboy und Indianer durch den Hinterhof stoben, malte Sonja mit einem Kreidestück ein Hüpfkreuz auf den Beton unter den Teppichstangen, warf Sybille ein Steinchen zu und bedeutete ihr mit dem Kopf anzufangen. So hüpften sie eine Weile, Sybille zunächst stumm und verbissen, Sonja ebenso stumm, aber neugierig beobachtend, wie sich die Anstrengung aus Sybilles Gesicht verzog und sie wenig später fast stotterfrei fragte: »Sollen wir jetzt Gummitwist spielen?«
Später, als Sybille sich in Berlin in der Lehranstalt von Professor Gutzmann zur Logopädin ausbilden ließ, erinnerte sie Sonja an dieses Erlebnis und versuchte sie ebenfalls für den Beruf zu begeistern. »Schon als Zehnjährige hast du gewusst, wie du mit einem Stotterer umgehen musst. Wenn einer eine Begabung für diese Arbeit hat, dann du.« Sonja interessierte Sybilles Ausbildung brennend, so gerne würde sie noch einmal etwas Neues lernen, so gerne mal richtig weit weg von zu Hause sein, dennoch wehrte sie ab. Sie musste Geld verdienen, sich um Reni und die Mutter kümmern, zudem, wie sollte sie eine weitere Ausbildung finanzieren? Aber als Sybille ihr vor drei Jahren erzählte, dass sie auch berufsbegleitende Kurse in Stimmheilkunde belegen könnte, die Gutzmann an seinem Institut anbot, stimmte sie zu. Schwester Herta hielt nicht viel von diesem neumodischen Zeugs, aber Professor Becker genehmigte die Fortbildung. Von Gutzmann erfuhr Sonja später, dass die beiden regelmäßig korrespondierten.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: