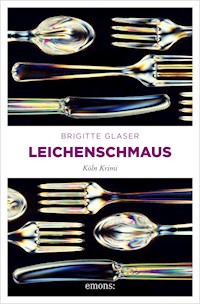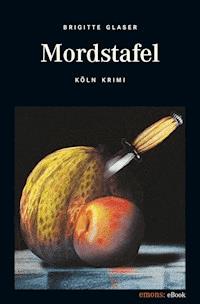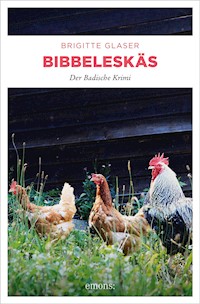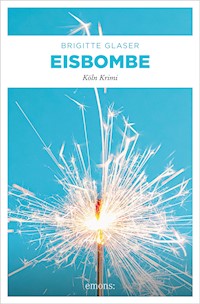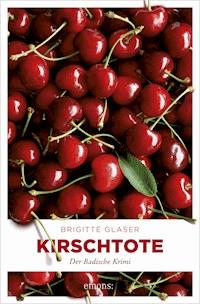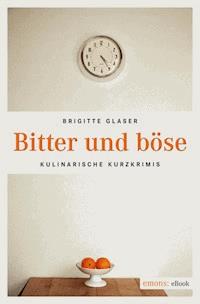10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Stadt an der Grenze, zwei Menschen getrennt durch die Zeit des Krieges und die zarten Anfänge des europäischen Traums Am Kaiserstuhl kreuzen sich kurz nach Kriegsende die Wege von Henny Köpfer und Paul Duringer. Die Tochter eines Weinhändlers und der elsässische Soldat leben auf dem Hof der alten Bäuerin Kätter. Mit ihr und dem kleinen Kaspar wachsen sie zu einer Familie zusammen. Doch es sind keine einfachen Zeiten. So leicht die Liebe entsteht, zerbricht sie auch wieder. Erst 1962 stehen sich Henny und Paul wieder gegenüber: Henny ist im Besitz einer alten Champagnerflasche, die Paul im Auftrag des französischen Sicherheitsdienstes sucht. An Symbolkraft kaum zu überbieten, steht sie für die Plünderungen der Deutschen in Frankreich und soll Adenauer von de Gaulle bei einem Festakt überreicht werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Kaiserstuhl
Die Autorin
Brigitte Glaser lebt seit über 30 Jahren in Köln. Bevor sie zum Schreiben kam, hat die studierte Sozialpädagogin in der Jugendarbeit und im Medienbereich gearbeitet. Heute schreibt sie Bücher für Jugendliche und Krimis für Erwachsene, u. a. ihre erfolgreiche Krimiserie um die Köchin Katharina Schweitzer. Mit Bühlerhöhe gelang ihr der Durchbruch.
Das Buch
Henny Köpfer ist Weinhändlerin mit Leib und Seele. In den Fünfzigerjahren hat sie das berühmte Geschäft ihres Vaters wieder aufgebaut. Und schon als Kind ist sie mit ihm durch die Weinregionen Deutschlands und Frankreichs gereist. 1962 schließlich beschert ihr das Wirtschaftswunder gute Geschäfte, der Verkauf von französischem Wein läuft hervorragend, und Henny weitet ihr Sortiment aus. Nur ein Champagner-Haus meidet sie: das Haus Vossinger in Épernay. Mitten im Krieg war sie das letzte Mal dort gewesen. Ein Besuch mit desaströsen Folgen.Kaiserstuhl erzählt von der heilenden Erfahrung, sich der Vergangenheit zu stellen und zu vergeben – und von den Anfängen des europäischen Traums.
Brigitte Glaser
Kaiserstuhl
Roman
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
List ist ein Verlagder Ullstein Buchverlage GmbH© 2022 by Ullstein Buchverlage GmbH, BerlinAlle Rechte vorbehaltenUmschlaggestaltung: BÜRO JORGE SCHMIDT, MünchenUmschlagabbildungen: Montage aus drei Bildern vonakg-images / Bernhard Wübbel (Frau mit Auto);picture alliance / blickwinkel / A. Laule (Landschaft)und ullstein bild / Müller-Stauffenberg (Himmel)Autorenfoto: © MEYER ORIGINALSE-Book-Konvertierung powered by PepyrusAlle Rechte vorbehalten.ISBN 978-3-8437-2741-9
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Titelei
Die Autorin / Das Buch
Titelseite
Impressum
Teil 1
Schlossberg
Als das Wünschen noch geholfen hat …
My Funny Valentine
Der Général
Teil 2
Am langen Arm verhungern
Noch wackelig auf den Beinen
Schäferstündchen
Stinkende Hoffart
Männer in Hut und Trenchcoat
Nouvelle Vague
Butter bei die Fische
Waterloo
Teil 3
Raunächte
Spuren im Schnee
Gut gemeinte Ratschläge
Persilschein
Kapriolen
Baeckeoffe
Hunde, die bellen …
À nos morts – Unseren Toten
Windschatten
Balkanesischer Feuertopf
Vielleicht sind das die neuen Zeiten
Canal Saint-Martin
Zum Schluss
Anhang
Danke …
Bücher, die ich zur Recherche und Inspiration gelesen habe:
Stammbaum
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Teil 1
Widmung
Für Lynn und Nora
Motto
»Wahr ist, was uns verbindet.«
Carl JaspersTeil 1
BonnSeptember 1962
Schlossberg
Freiburg
Ihr Vater erzählte gern, dass sie beim Knall eines Champagnerkorkens das Licht der Welt erblickte, was ihm als Weinhändler ein gutes Omen schien, obwohl er doch vor lauter Aufregung den Korken viel zu früh köpfte. Als ihm die Hebamme beim ersten Schluck Dom Pérignon den kleinen Schreihals präsentierte, schwante ihm allerdings, dass er für diesen Winzling den falschen Namen ausgesucht hatte. Denn kaum auf Erden gab die Kleine durch die Art, wie sie mit den Ärmchen ruderte, an der Flasche nuckelte oder ihren Protest in die Welt hinausposaunte, zu verstehen, dass in ihr mehr als ein Leben steckte. Und für so eine passte der Name Henriette nicht. Zu steif, und mit drei Silben viel zu lang. So eine brauchte einen kurzen, energischen Vornamen. Henriette Köpfer stand in ihrem Ausweis, aber schon immer wurde sie Henny gerufen.
Bereits am Morgen hatte Henny wie so oft an den Vater denken müssen und nach langer Zeit wieder einmal an ihre erste gemeinsame Reise in die Champagne. Wenn sie sich umblickte, wusste sie, warum. Das warme goldene Spätsommerlicht erinnerte an die riesigen Weizenfelder, die sie auf der Fahrt nach Reims passiert hatten. Im Sommer 1938 war das, kurz nach ihrem siebzehnten Geburtstag. Es gab ein Foto von ihr vor dem prächtigen Brunnen der Fontaine Subé. Die Haare frisch gekürzt, ein Bein in der Luft, ein Glas Champagner in der Hand. Sie trug das hellblaue Sommerkleid mit den weißen Punkten und strahlte in die Kamera.
Sie wischte die Erinnerungen fort und ging weiter. Ein leichter Wind strich durch die Bäume des Schlossbergs und trug ihr von irgendwoher den Duft später Rosen zu. Mit aufgestützten Armen beugte sie sich über ein Mäuerchen am Wegrand und schaute auf die Stadt hinunter. Überhaupt schaute sie gern auf alles hinunter. Was man auf ihre Größe, sie maß gut einen Meter achtzig, schieben konnte, was aber eher an ihrer Einstellung lag. Alles im Blick behalten konnte man nun mal schlecht von unten. Manche hielten sie deshalb für hoffärtig, aber das juckte sie nicht. Sie steckte gern in ihrer Haut. Immer ein frischer Wind um die Nase, immer frei von der Leber weg, immer mit voller Kraft voraus. Buckeln war ihr ein Graus. Ihr Vater hatte sie deswegen selten gerügt, nur gelegentlich zur Vorsicht gemahnt.
Sie setzte sich auf eine Bank und dachte wieder an die Champagne. Damals war sie glücklich und noch gertenschlank gewesen. Inzwischen hatte sich das Glück verflüchtigt, und sie hatte etwas zugelegt. Für eine Geschäftsfrau nicht das Schlechteste, das verschaffte ihr im wahrsten Sinn des Wortes Gewicht.
Natürlich war es damals bei diesem Besuch auch ums Geschäft gegangen. Um einzukaufen, klapperte der Vater mit ihr die großen Champagnerhäuser ab: Pommery, Taittinger, Ruinart, Bollinger, Deutz, Veuve Clicquot und noch viele weitere, ihre Erinnerungen daran mehr als vage. Woran sie sich allerdings sehr genau erinnerte, war ihr erster Besuch im kleinen Champagnerhaus Vossinger in Épernay.
Schluss jetzt, befahl sie sich, als sie merkte, dass sich ihr Pulsschlag beschleunigte, und griff nach ihrer Handtasche. Sie zog den Rock glatt, wischte ein paar Fussel von ihrer Kostümjacke, scheuchte im Aufstehen drei Tauben auf. Die flogen in Richtung Münsterturm davon, sie eilte ins Geschäft zurück. 1955 hatte sie endlich das nötige Geld gehabt, um es an alter Stelle neu aufzubauen. Das Grundstück in der Schusterstraße gehörte ihr ja. Ein Schaufenster bis zum Boden, ein großer lichter Einkaufsraum mit modernen String-Regalen, zudem schmale Stühle und ein heller Tisch aus Birkenholz. Keine schwerfällige Gemütlichkeit, sondern frische Leichtigkeit. Das alles hatte einen ordentlichen Batzen Geld gekostet, sie konnte sich das leisten.
Es ging ihr gut, sehr gut. Eigenes Haus, eigenes Geschäft, eigenes Geld, sogar einen eigenen Wagen, den sie selbst chauffierte. Wirtschaftswunder, Fleiß, Biss und Geschick, ja sicher, aber nicht nur. Bei ihr hockte keiner daheim, der nachts im Schlaf schreiend wieder an der Front lag, und erst recht keiner, der ihr vorschreiben konnte, was sie zu tun oder zu lassen hatte. Bei ihr hockte überhaupt keiner zu Hause, und das war gut so. Nur manchmal fehlte ihr das. Die Sache, die man Liebe nennt, hatte sie in ihrem Leben nämlich gründlich vermasselt. »Lass die Finger davon«, befahl sie sich wie immer, wenn sie sich nach einem Quäntchen Glück oder einem Rendezvous sehnte. Sie war einfach nicht für die Liebe geschaffen.
Ein Blick auf die Uhr. Oh, sie sollte sich beeilen. Für 14 Uhr hatte sich Monsieur Debray, der Vertreter dreier großer Champagnerhäuser angekündigt, mit dem sie seit letztem Jahr Geschäfte machte. Das würde sie auch weiterhin tun, allerdings nur, wenn er den Dobler, der vor zwei Monaten eine neue Weinhandlung eröffnet hatte, nicht belieferte. Am Rathausplatz, beste Lage. Es wurmte Henny, dass der Dreckskerl schon wieder Oberwasser hatte!
Als das Wünschen noch geholfen hat …
Freiburg
Charles Debray hatte am Vortag abgesagt und kam nun zu spät, deutsche Pünktlichkeit lag den Franzosen halt nicht. Hennys vorwurfsvollen Blick auf die Uhr machte er mit Charme wett: Oh, là, là, Handkuss und Komplimente, Madame hier und Madame da, alles leicht und luftig. Trotz ihrer einundvierzig Jahre kicherte sie wie ein Backfisch. Der alte Zängerle, den sie vor zwei Jahren als Verkäufer angestellt hatte, staunte Bauklötze. »Ja, Herr Zängerle, was den Umgang mit Frauen angeht, können sich die deutschen Männer bei den Franzosen eine Scheibe abschneiden«, lachte sie, beendete dann aber schnell die Honneurs, um zum Geschäft zu kommen.
Debray radebrechte deutsch, Henny ölte ihr Schulfranzösisch, irgendwie verstand man sich. Henny, die guten Verkaufszahlen des letzten Jahres im Kopf, orderte großzügig Champagner nach. Das Wirtschaftswunder sorgte für immensen Aufschwung: Otto Normalverbraucher konnte sich ein Eigenheim, einen Fernseher und ein Auto leisten, in besseren Kreisen gehörte Champagner wieder zum guten Ton.
»Der Professor Künzle hat neulich nach einem Bollinger gefragt«, warf Zängerle ein. »Und die Frau Drescher will unbedingt einen Taittinger-Champagner.«
Auch Bollinger und Taittinger könne er besorgen, bot Debray an. »Bien sûr.«
Henny erkundigte sich nach der kleinsten Menge und dem Preis und orderte auch Taittinger und Bollinger. »Wer weiß! Vielleicht kommen wir in den nächsten Jahren auf die fünfzehn Champagnersorten, die mein Vater in den Zwischenkriegsjahren im Sortiment hatte«, prophezeite sie übermütig.
»Fünfzehn verschiedene?«, echote Debray höflich.
Henny nickte. »Ich kann sie Ihnen heute noch aufzählen!«
»Mais non!«, widersprach er.
»Mais oui«, hielt sie dagegen und legte los.
»Vossinger? Ihr Vater hatte Vossinger im Sortiment?« Debray war nun regelrecht elektrisiert.
Henny ohrfeigte sich innerlich, weil sie sich von einem kindlichen Stolz hatte hinreißen lassen, alle Champagner-Häuser aufzuzählen. Wieso hatte sie Vossinger nicht weggelassen?
»Vossinger stellt nur eine kleine Menge hervorragenden Champagners her und vertreibt diesen über wenige, exquisite Adressen. Pardon, Madame, es wundert mich, dass Vossinger in den Zwischenkriegsjahren an einen kleinen deutschen Weinhändler geliefert hat«, erklärte Debray. »Oder etwa während des Krieges? Das wäre etwas anderes.«
»Mein Vater und Georges Vossinger kannten sich«, erwiderte Henny schnell. »Vor dem Ersten Weltkrieg hat mein Vater ein Jahr bei Vossinger gearbeitet. Georges und er haben sich angefreundet.«
»Ah oui. Dann wissen Sie sicherlich, wie schwer gerade das Haus Vossinger im Zweiten Krieg von der deutschen Besatzung betroffen war?«
Henny machte eine undeutliche Kopfbewegung. Bloß nicht darüber reden müssen. Bloß nicht.
»Euer Reichsmarschall Göring war ein gefräßiges Ungeheuer. Ein gefräßiges Ungeheuer mit einem exquisiten Geschmack.«
Bildete sie es sich nur ein, oder klang Debrays Stimme plötzlich eisiger? Musterte er sie nicht kühler, ja regelrecht feindselig? Mit einem Schlag kamen ihr Debrays Honneurs von vorhin nur wie ein dünner Firnis aus Höflichkeit vor.
»Alle Nazis waren gierig, aber keiner war so gierig wie Göring. Kannten Sie seinen Statthalter in der Champagne? Den Weinhändler Friedrich Rohl?«
Die Ladenklingel ersparte ihr die Antwort: »Das ist bestimmt Elfie, die ihren Schlüssel vergessen hat«, sagte sie, als Zängerle aufstehen wollte. »Ich geh schnell.«
Natürlich war es nicht Elfie. Die war im Theater und präparierte die Requisiten für die Abendvorstellungen. Der unbekannte Kunde wollte zwei Flaschen Merdinger Bühl. Henny ließ sich Zeit, um den Wein in Seidenpapier einzuwickeln, sie musste sich sammeln.
Es erleichterte sie bei ihrer Rückkehr, dass Debray bereits in Hut und Mantel dastand. Zängerle reichte ihr die Bestellliste zum Unterzeichnen. Debray gab ihr einen Kugelschreiber.
»Dann kennen Sie bestimmt auch Yves, den Sohn von Georges Vossinger«, knüpfte er an ihr Gespräch an. »Vor einigen Jahren hat er den Betrieb seines Vaters übernommen. Er macht einen genauso guten Champagner wie der Alte.«
Henny war, als hätte er ihr einen Schlag in die Kniekehlen verpasst. Sie musste sich am Tisch festhalten, um nicht umzuknicken.
»Alles in Ordnung?«, fragte Zängerle besorgt, Debrays Gesicht konnte sie nicht lesen.
»Der Kreislauf.« Ihr gelang ein Lächeln. »Manchmal spielt er mir einen Streich.«
Irgendwo
»Wer bist du, Fremder?«, fragte die Frau, die neben Paul Duringer auf der Bettkante saß und mit ihrem Finger ein Fragezeichen auf seinen nackten Rücken zeichnete.
»Das willst du gar nicht wissen«, antwortete er, drehte sich um und setzte sich auf. Er hasste Fragen am Morgen danach. Während er ihr kurz übers Haar strich, fiel ihm ihr Name nicht mehr ein. Marie? Maria? Marie-Luise?
»Wo bist du zu Hause?«
Er lächelte schief und suchte neben dem Bett nach seinen Anziehsachen.
»Hältst nicht viel von Bindung, was?« Sie reichte ihm einen Socken.
»Eine große Illusion! Jeder ist allein, jeder bleibt allein, jeder stirbt allein.«
»Oh, da muss einer aber mal schwer enttäuscht worden sein.« Sie erhob sich und schlüpfte in einen Morgenmantel, der mit großen, fleischigen Blüten bedruckt war.
Das ging die Frau nichts an. »Ich muss weiter«, sagte er und stopfte das Hemd in die Hose. »Ich bin heute mit einem alten Kameraden verabredet.«
»Alte Kameraden reden immer vom Krieg. Immer noch geht es um den Krieg. Ich hasse den Krieg.«
»Ja«, bestätigte Paul. »Er verfolgt uns, wir werden ihn nicht los, obwohl er schon fast zwanzig Jahre vorbei ist. Er hat uns verdorben. Auch wenn man es äußerlich nicht bei allen sieht: Viele von uns haben etwas abgekriegt, wie die Opfer einer Explosion.« Er schlüpfte in seine Jacke, sie brachte ihn zur Tür.
Er küsste sie zum Abschied. »Danke«, sagte er.
»Lang wirst du dieses Leben nicht mehr führen können, Fremder.« Sie strich ihm mit den Fingern durch die grauen Haare. »Du wirst alt, und mit alten Männern geht keine mehr umsonst ins Bett.«
Er griff nach dem Hut an der Garderobe neben der Tür.
»Kein Mensch glaubt, dass er alt wird. Er weiß es, aber er glaubt es nicht.«
»So ist es wohl.« Er setzte den Hut auf, wünschte ihr alles Gute und eilte dann die Treppe hinunter. Erst als die Haustür hinter ihm zuschlug, atmete er auf.
In der Kneipe, in der er gestern Abend gestrandet war, hörte er Freddy »Fährt ein weißes Schiff nach Hongkong …« singen, das Lieblingslied von Marie-Luise. Ja, sie hieß Marie-Luise, sie bediente dort. Er war der letzte Gast gewesen, sie hatte ihn mitgenommen. So einfach ging das. Er war gut darin, den Frauen ein bisschen Nähe zu geben. Ein bisschen, mehr nicht. Nur den kleinen Finger, niemals die ganze Hand.
Es war nicht weit bis zum Bahnhof. Paul kaufte sich eine Fahrkarte nach Bonn. Der nächste Zug fuhr in zwanzig Minuten.
Bonn
Zeit, das wusste Paul, war keine gleichbleibende Maßeinheit. Es gab Jahre, die mit ihrem Gewicht andere auf ein Nebengleis schoben; Jahre, die bis ins Detail grell erleuchtet blieben, während andere im Nebel des täglichen Einerleis versanken. Die Jahre, die sich ihm eingebrannt hatten, waren die zwischen 1940 und 1948, und fast fünf davon hatte er mit Colonel Bruno Fels verbracht.
Sie waren in Bonn verabredet, der Colonel hatte den Königshof als Treffpunkt vorgeschlagen. Ihre letzte Begegnung lag bereits ein paar Monate zurück. Sie bewegten sich schon lange in verschiedenen Welten, führten sehr unterschiedliche Leben, zudem trennten sie achtzehn Jahre Altersunterschied. Ihrer tiefen Verbundenheit tat dies keinen Abbruch. Der Krieg hatte sie, zwei Elsässer in der Panzerdivision von Général Leclerc, zusammengeschweißt. Sie waren sich nah wie Brüder. Wenn der eine rief, kam der andere. Das war einfach so. Und diesmal hatte der Colonel ihn gerufen.
Bruno Fels wartete auf der Terrasse des Hotels. Er saß in der Sonne und blickte auf den Rhein. Faucon, Habicht hatten sie ihn wegen seiner Hakennase genannt. Sie bestimmte immer noch sein Gesicht, war aber nun von vielen Falten umgeben. Er war ein 1900er, zweiundsechzig Lenze zählte er inzwischen. Er trug Zivil, konnte aber den Militär nicht verbergen. Seine hagere Gestalt steckte in einem leichten Sommeranzug, doch sein Körper strahlte immer noch die Wachsamkeit eines Kämpfers aus. Dass die linke Hand und der Unterarm nicht echt waren, merkte man erst, wenn man ihm gegenüberstand.
»Mon Colonel.« Er deutete einen militärischen Gruß an.
»Mais non«, winkte der Habicht ab und erhob sich zur Begrüßung. Sie reichten sich die Hand, und der Colonel wies ihm den Stuhl gegenüber zu. »Sieht anders aus als bei uns in Strasbourg.« Er deutete mit dem steifen, künstlichen Arm auf den Fluss. »Richtig romantisch mit all den Hügeln und Burgen dahinter.«
»Hübsch und bescheiden«, stimmte Paul ihm zu. »Wer hätte gedacht, dass das kleine Bonn Berlin als Hauptstadt ablöst?« Er setzte sich.
Der Colonel orderte Cognac für sie beide. »Bon, vieles wurde für unmöglich gehalten. Wer hätte gedacht, dass die Nazis Frankreich besetzen und Europa dem Erdboden gleichmachen? Niemand außer dem Général. Doch mit seinem Weitblick war er damals ein einsamer Rufer in der Wüste gewesen.«
Der Général, der Général, der Général! Wegen de Gaulle war der Colonel nach Kriegsende in der Armee geblieben, und seit der Général wieder französischer Präsident war, arbeitete er in seinem Sicherheitsstab. Sie trafen sich in Bonn, weil de Gaulle seit dem 4. September zu Besuch in der Bundesrepublik weilte. Es gehörte zu den Aufgaben des Habichts, de Gaulle wieder heil zurück nach Paris zu bringen. Diesmal auch mittels verschärfter Sicherheitsmaßnahmen, denn seit dem Algerien-Referendum im Juli herrschte Aufruhr in Frankreich, und der Terror der OAS beschränkte sich möglichweise nicht aufs eigene Land.
»Schwieriger Besuch, n’est-ce pas?«
»Wenn es nur Bonn wäre, aber er muss ja herumreisen. In Köln, Düsseldorf und Duisburg hat er schon auf einem Bad in der Menge bestanden«, knurrte der Colonel. »Der Général ist stur wie eh und je. Seit dem letzten Attentat hält er sich für unverwundbar und setzt sich über jede Sicherheitsmaßnahme hinweg.«
Paul nickte. Hundertfünfzig Schüsse waren am 22. August in Paris auf den Citroën des Präsidenten abgefeuert worden. Nur der Chuzpe seines Chauffeurs war es zu verdanken, dass de Gaulle und seine Frau den Anschlag überlebt hatten.
»Stellen Sie sich vor, es passiert hier etwas«, ereiferte sich der Colonel weiter. »Ausgerechnet jetzt müssen die Idioten der OAS ihren Terror nach Europa bringen. Ein Attentat in Deutschland würde den eben begonnenen Friedensprozess um Jahre zurückwerfen. Das zarte Pflänzchen der deutsch-französischen Freundschaft wäre zertreten, bevor es Wurzeln schlagen kann. Das würde ich mir nie verzeihen. Niemals!«
Trotz der Vertrautheit siezten sie sich, wie das unter französischen Offizieren üblich war.
»Mon Colonel, mein letzter militärischer Einsatz liegt siebzehn Jahre zurück«, warf Paul ein, der plötzlich den Eindruck hatte, Bruno Fels wolle ihn für seine Sicherheitsgruppe rekrutieren.
»Mais non, deshalb habe ich Sie nicht hergebeten, mon camerade.« Der Habicht schickte ein kurzes, rollendes Bauchlachen ins Feld und griff nach dem Cognacglas, das der Kellner auf den Tisch gestellt hatte. »Es geht um den 1937er Vossinger-Champagner aus dem Bunker in Berchtesgaden. Sie haben die Flasche doch noch?«
Der Champagner! Dunkel erinnerte Paul sich, wie er die Flasche 1945 in Eichingen in der hintersten Ecke von Kätters Weinkeller versteckt hatte. Der kleine Kaspar, sein Ziehsohn, hatte ihm das Versteck gezeigt.
»Santé, cher ami!« Der Colonel hob das Glas.
»Santé!«, murmelte Paul und griff nach seinem Glas. »Verzeihen Sie mein Erstaunen, mon Colonel, aber seit 1945 haben wir nie mehr über den Champagner gesprochen. Gibt es nach all den Jahren neue Erkenntnisse?«
Der Champagner stammte aus einer Kriegsbeute der Nazis, die ihre Einheit bei der Befreiung Berchtesgadens gefunden hatte. Paul erinnerte sich noch genau, dass diese Flasche in dem riesigen Weinlager allein in einem Wandfries gelagert war, sehr versteckt. Es war Zufall, dass er sie entdeckt hatte. Damals bat ihn der Colonel, die Flasche in Sicherheit zu bringen. All die Jahre, und sie hatten sich regelmäßig getroffen, all die Jahre hatte der Colonel den Champagner nie mehr erwähnt, und er, Paul, hatte ihn fast vergessen.
»Meines Wissens nicht«, antwortete der Colonel. »Aber endlich sind Deutschland und Frankreich bereit, ihre Erbfeindschaft zu beenden.«
»Der Champagner als Versöhnungstrunk?« Paul runzelte verwirrt die Stirn. Deswegen bestellte der Colonel ihn extra nach Bonn? Wurde der Habicht auf seine alten Tage wunderlich? Färbte es ab, dass er seine Zeit in der Umgebung eines eigensinnigen Generals verbrachte, der davon besessen war, die grandeur Frankreichs wiederherzustellen?
»Alles, was zu einem friedlichen Europa beiträgt, ist Champagner wert«, verkündete der Colonel.
»Natürlich«, pflichtete Paul ihm bei. Er hoffte, dass die Flasche noch da war, wo er sie gebunkert hatte. »Aber ich bezweifle, dass ein 1937er Champagner heute noch trinkbar ist. Den hätten wir 1945 saufen sollen. Der Grund, weshalb wir die Flasche damals sichergestellt haben, war doch ein anderer. Wir haben uns gefragt, warum diese eine Flasche versteckt war, und das frage ich mich bis heute. Warum?«
»Damals haben wir hinter allem eine Nazisauerei gesehen, Sie noch mehr als ich«, wischte der Colonel den Einwand weg. »Aber rückblickend sollten wir auch die simple Möglichkeit in Betracht ziehen, dass der 37er Vossinger nur versteckt war, weil der Führer ihn für ganz bestimmte Gäste vorgesehen hatte.«
»Nun ja, aber ist er heute noch genießbar?«
»Bei der Verkostung alter Champagner erlebt man immer wieder wahre Wunder. 1959 hat man beim Muscheltauchen vor Cape Cod eine Flasche Charles Heidsieck Extra Dry von 1920 gefunden, das ging damals durch die Presse. Erinnern Sie sich nicht? Die Flasche war nach all den Jahren noch genießbar.«
»Schon möglich«, stimmte Paul zu. »Ausnahmen gibt es immer wieder.« Ganz zufrieden war er mit der Antwort allerdings nicht.
»Sie haben die Flasche doch kühl gelagert?«
»Ja, sicher.«
»Alors … Zudem gibt es kein Getränk, das besser zu diesem Anlass passt«, fuhr der Colonel fort. »Der Champagner bringt aufs Schönste die besonderen Fähigkeiten der Deutschen und Franzosen zusammen. Bien évidemment, wir Franzosen haben den Champagner erfunden, aber ohne die sprachbegabten deutschen Händler hätte er im 19. Jahrhundert niemals seinen Siegeszug durch die Welt antreten können. Und 1937 war ein ganz großartiges Jahr, ein Jahr voller Hoffnungen.«
Die Erinnerung zauberte eine jugendliche Frische auf das Gesicht des Colonels. 1937, die Weltausstellung in Paris, sein Wiedersehen mit der Kölner Sozialistin Alice. Oh ja, der alte Freund hatte oft darüber gesprochen. Für den Habicht war 1937 ein Jahr mit Gewicht, ein Jahr, dessen Glanz manch dunkle Stunden erhellte. Doch bei Paul blieben leise Zweifel, ob die Erinnerungen an Alice und das Ende der deutsch-französischen Feindschaft die einzigen Gründe waren, warum er den Champagner aus seinem Versteck holen sollte.
»Ist Ihnen in Ihrer Position niemals etwas über die Flasche zu Ohren gekommen?«, hakte er nach. »Damals haben wir doch vermutet, dass sie vielleicht einen Hinweis auf weiteres Naziraubgut enthält. Sie wissen, wie viel davon bis heute verschollen ist.«
»Ich hatte die Flasche komplett vergessen«, beteuerte der Colonel. »Sie ist mir erst bei der Planung der Deutschlandreise des Général wieder in den Sinn gekommen. Endlich ein würdiger Anlass, sie zu köpfen. Ludwigsburg ist übrigens die letzte Station von de Gaulles Reise. Können Sie es möglich machen, dass wir uns am 9. September dort zur Übergabe der Flasche treffen?«
Paul zögerte.
»Ich gebe zu, es ist ein bisschen kurzfristig, aber Sie wissen, wie eingespannt ich bei diesem Besuch bin, ich hatte vorher einfach keine Zeit, mich mit Ihnen …«
»Nein, nein«, unterbrach ihn Paul. »Das ist nicht das Problem.«
»Wo haben Sie die Flasche denn gelagert?«, wollte der Colonel wissen.
»In Kätters Weinkeller in Eichingen.«
»Oh!« Der Colonel lehnte sich überrascht zurück und legte die künstliche Hand auf den Tisch. »Sind Sie noch einmal dort gewesen, seit …«
»Selten«, unterbrach ihn Paul, starrte auf die künstliche Hand und suchte nach einer Möglichkeit, den Wunsch des Colonels zu erfüllen. Er konnte Kaspar fragen, ob er ihm die Flasche nach Ludwigsburg bringen würde. Kaspar hatte vermutlich nichts gegen einen kleinen Ausflug. »Das lässt sich einrichten«, sagte er.
»Très bien! Und jetzt zu Ihnen, cher ami«, wechselte der Colonel das Thema. »Was machen die Geschäfte? Irgendetwas, wobei ich mit meinen Beziehungen behilflich sein kann?«
Bonn
Bahnhöfe, französische, deutsche, belgische, holländische, italienische, kannte Paul en masse. Er hätte Tage gebraucht, um all die aufzuzählen, an denen er ein-, aus- oder umgestiegen war. Manche Bahnhöfe waren ihm vertraut, an andere erinnerte er sich nicht mehr. Bonn gehörte zur ersten Kategorie, deshalb wusste er, wo am Hauptbahnhof die Telefonzellen zu finden waren. Er wartete, bis eine frei wurde, dann legte er eine Handvoll Münzen auf die Ablage über dem Hörer, warf eine Mark in den Münzschlitz und wählte die Nummer in Eichingen.
Kaspar meldete sich. Sehr gut. Bei Kätter würde das Gespräch viel länger dauern.
»Salut, mon grand«, begrüßte er ihn.
»Paul?«, fragte Kaspar vorsichtig.
»Klar, wer sonst?« Paul konnte nicht heraushören, ob in Kaspars Stimme Freude oder Misstrauen mitschwang. Wahrscheinlich beides, er hatte den Jungen oft genug enttäuscht. Jungen? Ach was, ein junger Mann war er nun, im Mai einundzwanzig geworden. Den Geburtstag hatte er vergessen, wie so oft. »Wie geht’s, wie steht’s?«
»Stell dir vor, die Badische Bauernzeitung hat in ihrer letzten Nummer drei Fotos von mir gedruckt. Die von den Mädchen aus dem Brettenbachtal, die im letzten Jahr bei der Lese geholfen haben«, berichtete er als Erstes. »Sogar ein kleines Honorar haben sie bezahlt.«
»Großartig! Ich habe schon immer gewusst, dass du ein gutes Auge hast!«
»Warum rufst du an?«
Kaspar war auf der Hut, das spürte Paul. »Bist du schon mal in Ludwigsburg gewesen?«
»Nein …«, sagte Kaspar vorsichtig. »Das ist in der Nähe von Stuttgart, oder?«
»Genau! Du weißt, dass der Général auf Deutschlandreise ist?«
»Ich bin kein kleines Kind mehr, schon vergessen? Ich lese jeden Morgen die Zeitung, schon wegen des Kinoprogramms. Auf den Titelseiten seit Tagen immer nur de Gaulle. Erster Besuch eines französischen Staatsoberhaupts nach dem Krieg und so weiter.«
»Der Général hält am 9. September in Ludwigsburg eine Rede an die deutsche Jugend.«
»Davon habe ich gelesen«, brummte Kaspar.
»Obwohl ich im Gegensatz zu dir weder jung noch ein Deutscher bin, dürfen wir zwei bei dieser Rede nicht fehlen, n’est-ce pas? Es geht um Europa, l’Europe, tu comprends?«
»Europa«, echote Kaspar.
»Um Kleineuropa, Kerneuropa«, präzisierte Paul. »Um das Europa der Vaterländer, wie de Gaulle es nennt. Deutschland und Frankreich, das Ende der Erbfeindschaft. Das Treffen riecht nach einem historischen Ereignis. Davon kannst du später deinen Enkeln berichten.«
Schweigen am anderen Ende der Leitung. Paul sah Kaspar im Flur stehen und auf den Raiffeisen-Kalender hinter dem Telefonapparat starren, auf dem Kätter wahrscheinlich wie früher den voraussichtlichen Beginn der Weinlese markiert hatte.
»Das würde ich gern, aber die Weinlese steht vor der Tür. Du weißt, wie viel man fürs Herbsten vorbereiten muss. Ich muss die Tragebütten verschwellen, die Rebscheren kontrollieren und …«
»Ach, komm schon, Kaspar! Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. So wie es aussieht, dauert es noch, bis ihr mit dem Herbsten anfangt. Mit der Kätter rede ich, wenn dir das Sorgen bereitet.« Paul ließ nicht locker.
»Mit der Kätter kann ich selbst reden.«
»So sag schon Ja! Es geht ja nur um einen Tag, abends bist du wieder zurück.«
»Also gut«, stimmte Kaspar zu.
Erleichtert registrierte Paul, dass das Misstrauen aus Kaspars Stimme verschwunden war. »Du musst noch was mitbringen«, fuhr er fort. »Erinnerst du dich an die Flasche, die ich im Gepäck hatte, als ich nach dem Krieg zu euch gekommen bin? Die wir zwei ganz hinten in eurem Weinkeller versteckt haben?«
»Die einem Kameraden von dir gehört?«
»Genau! Die brauche ich jetzt. Umwickle sie erst mit Stroh, dann mit Zeitungspapier und pack sie so in den Rucksack. Sei vorsichtig, spiel nicht den Hans-guck-in-die-Luft! Sie darf dir nicht kaputtgehen. Sie ist ein Unikat.«
»Ich pass schon auf. Immer noch denkst du, ich wär ein kleines Kind.«
Ungeschicklichkeit verlor sich in der Regel auch bei Erwachsenen nicht, dachte Paul, behielt die Meinung aber für sich.
»Ich müsst halt morgen Abend schon nach Freiburg fahren und dort übernachten, wenn ich den frühen Zug nach Stuttgart kriegen will«, überlegte Kaspar laut.
»Henny hat doch ein Bett für dich, oder? Alors, dann bis übermorgen in Ludwigsburg am Bahnhof.«
Paul legte den Hörer auf und steckte die restlichen Münzen in die Hosentasche. Er dachte an seine Zeit in Eichingen und spürte, wie eine leichte Traurigkeit von ihm Besitz ergriff. Um sie abzustreifen, eilte er in die Bahnhofsbuchhandlung und kaufte die aktuellen Cahiers du Cinéma.
Wenig später saß er im Zug nach Hamburg, vertiefte sich in die Filmzeitschrift und vergaß seine Traurigkeit.
Freiburg
Henny starrte aus dem Fenster ihres Wohnzimmers auf die enge Schusterstraße, durch die zwei alte Zecher torkelten, und zündete sich eine neue Zigarette an. Der Aschenbecher auf der Fensterbank quoll schon über vor Kippen. Konnte sie Debray glauben? Lebte Yves wirklich? Oder war es wie im Mai 1948 in Baden-Baden, als sie mit Paul in den Fluren der französischen Militärregierung auf eine Bescheinigung wartete, Yves plötzlich durch den Flur eilen sah und ihren Augen nicht traute? Ein Wunder, ein von den Toten Auferstandener, hatte ihr doch Rohl bei seinem Besuch 1944 mitgeteilt, dass Yves tot sei. Aber der große Schlaks mit den zurückgekämmten schwarzen Locken, er war es, ganz bestimmt war er es. Es gab nur wenige Franzosen, die so groß waren wie Yves. Wo immer er hinkam, fiel er auf wie ein bunter Hund. Und sie, sie zögerte, Paul neben ihr verstand gar nichts, sie zögerte, rief nicht nach Yves, sprang nicht sofort auf, um ihm zu folgen, und als sie es endlich tat, war er verschwunden. So ein großer Mann einfach verschwunden, das konnte nicht sein. Sie klopfte an Türen, fragte nach Yves Vossinger, erntete verständnislose Blicke oder ein resigniertes Schulterzucken, wurde nach seinem Dienstgrad gefragt oder ein Büro weitergeschickt. »Un grand homme avec des boucles noires«, so beschrieb sie ihn immer wieder, aber niemand wollte einen großen Mann mit schwarzen Locken gesehen haben. Verstört kehrte sie zu Paul ins Wartezimmer zurück, glaubte nun selbst an eine Fata Morgana, an einen Streich des Unterbewussten. Als Paul sie fragte, was los sei, murmelte sie etwas von einem Bekannten, den sie glaubte, erkannt zu haben. Paul schaute sie fragend an, sagte aber nichts weiter. Sie schämte sich in Grund und Boden. Yves war alles andere als ein Bekannter gewesen.
Im Sommer 1938 hatte alles so märchenhaft begonnen. Damals, als das Wünschen noch geholfen hatte. Zum ersten Mal sah sie Yves von der Terrasse des Weingutes aus. Georges Vossinger hatte den Vater und sie auf einen Aperitif eingeladen. Yves stand am Fenster, die Abendsonne zeichnete seine große, schlanke Figur als Schattenriss, sodass er etwas Unwirkliches, Traumhaftes ausstrahlte. Als er wenig später auf sie zutrat und ihr die Hand reichte, lächelte er. Sofort wünschte sie, Yves würde mit ihr spazieren gehen, und am nächsten Tag ging er mit ihr spazieren. Beim Spazierengehen wünschte sie, er möge wie zufällig ihre Hand nehmen, und er tat es. Dann wünschte sie, er möge ihr nachjagen, sie fangen, sie umarmen, sie endlich küssen, und all das geschah. Beim Abschied glaubte sie tausend Tode zu sterben, aber da sie leben wollte, wünschte sie, er möge ihr bis zu ihrem Wiedersehen unendlich viele Liebesbriefe schreiben, und das tat er.
Nach einem viel zu kurzen Treffen in Paris im Herbst 1938 rückte im August 1939 ein erneutes Wiedersehen endlich in greifbare Nähe. Yves und Georges Vossinger reisten wie ihr Vater zum Internationalen Weinkongress nach Bad Kreuznach. Danach wollten die Vossingers mit ihm nach Freiburg kommen und ein paar Tage bleiben. In seinem letzten Brief hatte Yves angedeutet, er würde ihr einen Antrag machen. Natürlich würde sie annehmen! Während sie die Betten für die Gäste bezog und überlegte, welches Kleid sie an diesem großen Tag tragen würde, gaukelte Reichsbauernführer Walther Darré den Kongressteilnehmern vor, sich für die Verständigung friedliebender Völker einzusetzen, derweil Hitler mit seinen Generälen bereits den Überfall auf Polen plante. Als die deutschen Truppen am 1. September in Polen einmarschierten, wurden alle französischen Teilnehmer der Winzertagung sofort nach Hause gerufen. Ihr Vater kehrte tief besorgt über die politische Entwicklung und ohne Yves nach Freiburg zurück. Zwei Tage später erklärte Frankreich, zusammen mit Großbritannien, Deutschland den Krieg.
Es blieb Henny nichts anderes übrig, als wieder zu schreiben. Doch es wurden keine Briefe mehr nach Frankreich verschickt. Korrespondenz mit dem Feind war verboten. Wie betäubt lief sie durch Freiburgs Straßen und wartete in den Tagen nach dem Kongress vergeblich auf Nachrichten aus Épernay. Auch Briefe aus Frankreich kamen nicht mehr an. Davor hatten sie sich wöchentlich geschrieben. Immer donnerstags kam ein Brief von Yves – wehe, er kam erst samstags! –, und sie schickte ihre Briefe immer dienstags ab. Und nun, von einem Tag auf den anderen, nichts mehr, nicht das kleinste Lebenszeichen! Wochenlang irrlichterte an Donnerstagen die Hoffnung auf, dass doch Post von Yves käme, und verwandelte sich dann in tiefe Traurigkeit. Ein paar Wochen später erkundigte sie sich vorsichtig bei Doktor Kühnle, einem vertrauenswürdigen Kunden aus dem Universitätsbereich, der wie viele Professoren und Doktoren mit ausländischen Kollegen korrespondierte, nach Möglichkeiten der Kontaktaufnahme. Er riet ihr, es über das Reisebüro Thomas Cook zu versuchen. Also schickte sie einen Brief über Thomas Cook, doch der blieb unbeantwortet. Dann noch einen und noch einen.
Es dauerte, bis sie verstand, dass der Krieg sie jeder Form des Kontakts zu Yves beraubte, dass die erhoffte Verlobung nicht stattfinden würde, bestenfalls auf unbestimmte Zeit verschoben war. Ihr Leben, so wie sie es sich erträumt hatte, löste sich in Luft auf. Sie, die tatkräftige, fröhliche, immer vorwärtsstürmende Henny war plötzlich bleibeschwert. Sie schleppte sich durch die Tage, weinte nachts die Kissen nass und wünschte nichts sehnlicher, als dass der Krieg bald zu Ende ginge.
Aber das Wünschen half nichts mehr, und die bittere Erkenntnis, dass die Zeiten, in denen das Wünschen noch geholfen hatte, im Leben knapp bemessen waren, traf sie wie ein Schlag in den Magen.
Eichingen, Kaiserstuhl
In ihrem Weinberg auf der Steinhalde probierte Kätter Köpfer ein paar Trauben und wusste schnell, dass es noch ein paar Tage dauern würde, bis sie mit der Lese beginnen konnten. Ein paar mehr Grad Öchsle täten dem Wein schon gut. Als die Kirchturmuhr sechsmal schlug, machte sie sich auf den langen, beschwerlichen Heimweg. Sie hätte nichts dagegen, wenn es mit der Flurbereinigung am Kaiserstuhl endlich losging. Da ein Äckerle, dort ein Äckerle und dazwischen noch ein halbes Ar Feld. Immer musste man von einem zum anderen rennen, und in ihrem Alter waren die Füße nicht mehr so schnell. Aber natürlich wusste sie, dass das nur ein frommer Wunsch war. An nichts hing der Bauer so sehr wie an seinem Land. Wenn also Land getauscht, zusammengelegt oder wie geplant terrassiert werden sollte, würde das ein großes Palaver und ein noch größeres Geschacher geben, und es würde dauern.
Bald tauchte ihr Heimatdorf auf. Eichingen lag in einer Senke mitten in den Weinbergen. Die Häuser gluckten eng beieinander, die roten Dächer schimmerten kupfern im Abendlicht. Von der mächtigen Eiche auf dem Dorfplatz stob ein Schwärm Krähen auf, der Hahn auf dem Kirchturm drehte sich. Aus der Ferne könnte man meinen, Eichingen wär der schönste Platz auf Gottes weiter Erde, aber wie überall auf der Welt gab es auch hier Freud und Leid und Händel und Zank sowieso.
Jesses, jetzt aber, dachte Kätter, als die Uhr halb sieben schlug. Ihr Tagewerk war noch nicht geschafft, sie beschleunigte ihre Schritte. Es ging ja zum Glück bergab. Zu Hause angekommen, sperrte sie die Hühner in den Stall, fütterte die Sauen und stellte den Katzen ein Schälchen Milch hin. Dann holte sie einen Krug Wein und eine Speckseite aus dem Keller und ging ins Haus.
In der Küche hing der Duft früher Herbstäpfel, ein Korb davon stand auf der Bank. Schon seit Tagen wollte sie Apfelmus einkochen, hatte es aber noch nicht geschafft. Sie schaffte einfach nicht mehr so viel wie früher. Mit Bedacht schnitt sie eine Scheibe Speck ab und teilte diese in winzige Streifen, von denen sie jeweils einen auf den Messerrücken schob und dann in den Mund steckte. Draußen fegte ein heftiger Windstoß durch den Nussbaum und ließ die ersten Walnüsse zu Boden prasseln. Kätter schloss die Augen, und für einen Moment saßen alle wieder am Küchentisch: Paul, Henny und der kleine Kaspar. Sie hatte das Knirschen der Schalen im Ohr, wenn Paul mit einer Hand zwei Nüsse zerdrückte, das helle Kinderlachen von Kaspar und Hennys Kommandostimme, mit der sie verkündete, was getan werden musste. Damals war noch Leben im Haus! Nun war nur noch Kaspar auf dem Hof, und sie hockte oft allein am Tisch.
Sie schob Brot und Speck zur Seite und zog den Stapel alter Zeitungen zu sich heran. Draußen im Abort fehlte Papier, und sie begann, die Seiten in handgroße Stücke zu reißen. Ihre Augen blieben an einem Witz hängen. »Frage: Warum hat sich Kanzler Adenauer eine junge Schildkröte gekauft? Antwort: Er will prüfen, ob sie wirklich zweihundert Jahre alt werden kann.« Sakramoscht! Aus dem Hemd springen könnte sie! Kätter schüttelte erbost den Kopf: Keinen Respekt hatten die Leute! Wer hatte sie nach dem Krieg aus dem Jammertal gezogen? Wer hatte für das Wirtschaftswunder gesorgt? Wer regierte das Land seit Jahren mit ruhiger Hand? Wer schützte sie vor dem Iwan? Dankbar sollten die Leute sein, dass der Adenauer mit seinen siebenundachtzig weiterregieren wollte, aber nein! Selbst in der eigenen Partei warfen sie ihm sein Alter vor. Die Herren konnten es nicht erwarten, dass er von selber abtrat! Von ihr aus könnte der Adenauer ewig regieren. Es gab keinen besseren.
In der Zeitung hatte sie gelesen, dass der Kanzler sich Sorgen um sein Erbe machte. Ein guter Nachfolger war nicht in Sicht. So einer würde auch schwer zu finden sein. Sie legte den Zettel ganz obenauf. Mit dem Witz würde sie sich das Füdli abwischen. Nur dafür war er gut.
Als sie vom Abort zurückkehrte, tauchte die Dämmerung die Küche in ein fahles Licht. Entre chien et loup, zwischen Hund und Wolf, so nennen die Franzmänner das Zwielicht, hatte der Karl ihr einmal erzählt, der ja lang drüben im Elsass gelebt hatte. Eine gute Beschreibung für die Zeit der trüben Gedanken. Wie oft in den letzten Monaten sorgte sich Kätter um Hof und Weinberg, und in ihrem Kummer fühlte sie sich dem Kanzler verbunden. Gut, bei ihrem Erbe ging es nicht ums ganze Land, aber schwer wogen die Sorgen trotzdem. Was sollte werden, wenn sie nicht mehr konnte oder nicht mehr war?
Ihre zwei Männer hatte sie früh zu Grabe getragen. Der Heiner, ihr einziges Kind, war im Krieg geblieben, im Balkan-Feldzug 1941 in der Nähe von Skopje gefallen, grad mal dreiundzwanzig Jahre alt, und der Karl, ihr Mann, im Stall von einem Balken erschlagen im Winter 1943. Und Kaspar war halt kein Bauer und kein Winzer. Als Henny das Kind nach der Bombardierung 1944 mitbrachte, da hatte Kätter gedacht, dass sie dem Enkel schon alles beibringen würde, was es brauchte, um den Hof zu bewirtschaften. Aber drei Jahre Stadt konnte sie ihm genauso wenig austreiben wie die linken Hände und Füße. Sie wunderte sich schon, dass das Buebl, das von Generationen von Winzern, väterlicher- und mütterlicherseits, abstammte, in der Erbmasse so gar nichts davon mitgekriegt hatte. Aber Ausreißer gab es in jeder Familie. Erst 1947 war Henny damit herausgerückt, dass Kaspar weder ihr Sohn noch Kätters Enkelkind war. Nachdem der Schock verdaut war, entschied Kätter, dass das Buebl zur Familie gehörte. Blut war nicht das einzige Band, das zählte. Wer sollte ihr Erbe antreten, wenn nicht Kaspar? Es gab niemanden außer ihm.
Eine rechte Frau an seiner Seite könnte es schon richten, davon war die Kätter überzeugt. Aber Kaspar machte keine Anstalten, sich eine zu suchen, da konnte sie noch so mit Engelszungen auf ihn einreden. Einundzwanzig war er, in dem Alter hatten die meisten im Dorf die Brautschau bereits erledigt. Der Wagner Schorsch, ein Schulkamerad von Kaspar, hatte sogar schon einen Stammhalter gezeugt.
Es wird sich schon eine finden für Kaspar, redete Kätter sich ein. Vielleicht eine von den Herbstermädchen, die immer aus dem Brettenbachtal zur Weinlese nach Eichingen kamen. Fürs Erste hoffte sie, dass Paul ihm in Ludwigsburg keinen neuen Floh ins Ohr setzte. Der hatte ihm doch den Fotoapparat geschenkt und war auch schuld, dass der Kaspar so verrückt nach dem Kintopp war! Der Bueb hockte sich am freien Sonntag lieber mit seinem Freund Bertold in die Vorführkabine der Kurbel und glotzte Filme, anstatt mit einem Mädchen zu poussieren.
My Funny Valentine
Freiburg
Nach der schlaflosen Nacht plagten Henny Kopfschmerzen. Sie goss sich eine zweite Tasse Kaffee ein und massierte sich immer wieder die Stirn, was nichts half.
»Albträume gehabt?«, fragte Elfie, die den Kopf durch die Küchentür steckte. »Du bist ja die halbe Nacht durch die Wohnung gegeistert. Kopfschmerzen? Soll ich dir aus dem Bad eine Spalt-Tablette mitbringen?«
»Kann nichts schaden. Danke, Elfchen.«
Wenig später lag die Tablette neben ihrer Kaffeetasse, und Elfie saß ihr gegenüber. Wie üblich mit zerzaustem Haar und in Pyjama und Pantoffeln. Sie arbeitete im Theater, kam selten vor Mitternacht nach Hause, und die Morgenstund’ hatte bei ihr kein Gold im Mund.
Elfie Schäfer war Kriegerwitwe wie Henny und ihre Untermieterin. Sie waren beide gleich alt, kannten sich aus Schwarzmarktzeiten und hatten sich danach nie aus den Augen verloren. Als der Freundin vor drei Jahren die Wohnung gekündigt wurde und sie, die stets chronisch knapp bei Kasse war, nirgends eine günstige Bleibe fand, hatte Henny ihr übergangsweise ein Zimmer ihrer Wohnung zur Untermiete angeboten. Aus der Notlösung war ein prächtiger Dauerzustand geworden. Sie verstanden sich gut, und sehr zu Hennys Erleichterung mochte Elfie alle Hausarbeiten, die ihr selbst ein Graus waren. Allerdings war Elfie einem Abenteuer nie abgeneigt, sie nahm gerne mal einen Mann mit nach Hause, der sich dann morgens aus der Wohnung schlich. Darüber stritten sie gelegentlich. Im Eifer des Gefechts kehrte Henny manchmal die seriöse Geschäftsfrau heraus, die keinesfalls Ärger wegen des Kuppeleiparagrafen kriegen wollte, Elfie warf ihr im Gegenzug Kleingeisterei und, wenn es ganz übel lief, Neid vor und hatte wahrscheinlich mit beidem recht. Dabei war es doch gerade das Bohemienhafte, das Abenteuerlustige an Elfie, das Henny an der Freundin mochte.
»Gibt’s einen Grund, weshalb du heute Nacht nicht schlafen konntest? Oder kommst du schon in die Wechseljahre?«
»Ich mache mir Sorgen ums Geschäft«, murmelte Henny, die sich noch nicht in der Lage fühlte, über Yves und alles, was ihr in der Nacht durch den Kopf gegangen war, zu reden.
»Der Laden läuft doch gut.«
»Hör dir das an!« Sie deutete auf eine Anzeige in der Zeitung, die sie in Rage brachte. »Zusammen mit dem Reisebüro Schneider bietet die Weinhandlung Dobler eine Fahrt durch die Weindörfer der Pfalz an. Höhepunkt ist ein Mittagessen im Dürkheimer Fass. Zurück in Freiburg folgt eine Probe Pfälzer Weine in der neuen Weinhandlung am Rathausplatz. Alle vorgestellten Weine können an diesem Abend zu Sonderpreisen käuflich erworben werden.«
»Was regst du dich auf? Du bist doch letztes Jahr auch mit Kunden ins Burgund gefahren.«
»Pfälzer Wein? Da sind doch Pfuscher am Werk! Erinnere dich an den Skandal an Neujahr. Mehr als hunderttausend Liter sichergestellt, chemisch behandelt von einem Labor in Bad Dürkheim. Aber das passt zum Dobler. Pfusch zu Pfusch.«
»Henny! Die Leute haben das Recht, schlechten Wein bei schlechten Menschen zu kaufen.«
»Ich möchte zu gerne wissen, wie der Dobler an den Laden am Rathausplatz gekommen ist. Dem Dobler war schon immer jedes Mittel recht. SA-Oberscharführer, von Anfang an in der Partei, zu allen Schandtaten bereit, stets auf seinen Vorteil bedacht. Hab ich dir mal erzählt, was der mit dem Weinhändler Blumfeld gemacht hat? Und unsere Weinhandlung hätte er sich beinahe auch noch unter den Nagel gerissen. Kurz vor dem großen Bombenangriff war das. Die englischen Bomben haben das verhindert. Einen Trümmerberg wollte er nicht.«
Henny schlug die Zeitung zu. Immerhin hatte sie gestern, trotz der aufwühlenden Neuigkeiten, nicht vergessen, Debray zu stecken, wie eng Dobler und Friedrich Rohl in der Champagne »zusammengearbeitet« hatten. Das sollte Debray davon abhalten, Geschäfte mit Dobler zu machen.
»Mangelnde Anpassungsfähigkeit kann man den alten Nazis nicht vorwerfen«, stellte Elfie fest.
Henny knurrte zustimmend und stand auf. »Ich muss runter in den Laden.«
»Bei uns in der Requisite gibt es heute Abend eine kleine Feier. So gegen 23 Uhr geht es los. Komm vorbei, wenn es dir nicht zu spät ist«, rief Elfie ihr nach.
Hamburg
In der Bahnhofsgaststätte in Hamburg roch es nach gebratenem Fisch. Paul hängte seinen Hut an die Garderobe. Der Mann, mit dem er verabredet war, nickte ihm von einem der Tische zu, die im hinteren Teil der Kneipe im Halbdunkel lagen.
»Mon oncle.« Paul schüttelte ihm herzlich die Hand.
Frédéric Meunier war ein Tausendsassa im Filmgeschäft, sie kannten sich, seit Paul ein kleiner Junge war. Schon damals hieß er in der Familie Duringer oncle, obwohl sie nicht miteinander verwandt waren, und das war so geblieben. Meunier hatte bei Realfilm zu tun gehabt, deshalb trafen sie sich in Hamburg.
»Wie läuft die Synchronisation des Melville-Films?«, erkundigte sich Paul.
»Le Doulos soll auf Deutsch Der Teufel mit der weißen Weste heißen.«
»Nicht schlecht. Klingt poetischer als Polizeispitzel.« Paul bestellte ein Bier beim Kellner.
»Das nehme ich mal als Lob. Wo du sonst immer an der deutschen Synchronisation französischer Filme herummeckerst.«
»Zu Recht, so furchtbar, wie viele Übersetzungen sind. Walter Benjamin sagt, Übersetzung heißt, die eigene Sprache erweitern. Davon merkt man bei den meisten Filmübersetzungen nichts, die sind einfallslos, ohne ein Gespür für Feinheiten. Dabei kommt es gerade auf die kleinen Frechheiten an, den richtigen Ton für alltäglichen Kleinkram und so weiter«, erklärte Paul. »Klar macht das mehr Arbeit, aber …«
»Alter Idealist«, neckte ihn Meunier. »Ich habe übrigens deinen Artikel über Helmut Käutner und Wolfgang Staudte in den Cahiers du Cinéma gelesen, sehr interessant.«
Das Lob freute ihn. Meunier war nicht irgendwer, und Meunier nahm nie ein Blatt vor den Mund, der sagte so etwas nicht aus Gefälligkeit. »Käutner und Staudte sind die einzigen Nachkriegsregisseure in Westdeutschland, die etwas zu sagen haben. Alle anderen machen nur seichte Unterhaltung.«
»Auch die Unterhaltung braucht es, damit der Rubel rollt. Ohne Kommerz keine Kunst, du kennst doch das Geschäft.«
»Ich habe nichts gegen gute Unterhaltung.«
Meunier grinste. »Aber sie muss dann schon das Niveau eines Charlie Chaplin, Ernst Lubitsch oder Billy Wilder haben, n’est-ce pas?«
Paul grinste zurück. Über das Thema hatten sie beide schon endlose Debatten geführt. »Aber ich denke, das ist nicht der Grund unseres Treffens, oder?«
»Sehr richtig. Ich habe einen Auftrag für dich, der ganz nach deinem Geschmack ist.«
Paul wartete neugierig, während Meunier ein Schreiben aus seiner Aktentasche zog, das er vor sich auf den Tisch legte. »Angesichts des Tauwetters diesseits und jenseits des Rhein«, begann er, »ist von politischer Seite ein intensiverer Kulturaustausch gewünscht.«
Für einen Moment ruhte Pauls Blick auf den gewaltigen Pranken, mit denen Meunier das Papier glatt strich. Man konnte sich den schweren, großen Mann eher auf einem Fischkutter oder in einem Stahlwerk als im Filmgeschäft vorstellen. Aber darin war le géant normand, der normannische Riese, wie er in der Branche genannt wurde, seit vierzig Jahren unterwegs.
»Das Institut français plant eine Präsentationstour mit drei Truffaut-Filmen, um den Deutschen mittels der Nouvelle Vague französische Film- und Alltagskultur der Gegenwart nahezubringen«, fuhr Meunier fort. »Ich habe dich empfohlen, weil du der geeignete Mann für die Tour bist: Du kennst das Filmgeschäft aus dem Effeff, bist perfekt zweisprachig, gerne unterwegs, mit der deutschen Kultur so vertraut wie mit der französischen. Also: Was hältst du davon?«
»Warum drei Truffaut-Filme?«, fragte er. »Warum nicht auch Chabrols Das Auge des Bösen? Chabrol hat in München gedreht, der Film spielt in Süddeutschland. Ein psychologischer Thriller, in dem Chabrol deutsche Wesenszüge herausarbeitet. Der Film schreit förmlich danach, bei einem deutsch-französischen Kulturaustausch dabei zu sein.«
Meunier winkte ab. »Du kennst doch die Liebe der bourgeois cultivés zur Vertiefung. Das Werk eines einzelnen Künstlers in all seinen Facetten und so weiter. Und du musst zugeben: Der junge Truffaut hat mit Sie küssten und sie schlugen ihn, Schießen Sie auf den Pianisten und Jules und Jim innerhalb kürzester Zeit drei sehr verschiedene und allesamt herausragende Filme gedreht.«
»Natürlich, keine Frage. Gibt es bereits einen Tourenplan?«
»Gibt es.« Meunier deutete auf die zweite Seite des Papiers. »Die Tour startet Anfang Oktober in Freiburg und endet Mitte November in Hamburg. Im Augenblick gibt es zehn Stationen, es können aber noch einige hinzukommen. Bezahlung klärst du mit dem Institut français in Freiburg, das die Federführung des Projekts innehat. Adresse und Telefonnummer stehen auf dem Tourenplan.«
»Gut, mach ich.«
»Sehr schön, dann ist das geklärt.« Meunier schob ihm das Schreiben über den Tisch. »Und, mein Junge? Immer noch keine Absichten, sesshaft zu werden? Immer noch keine Herzdame gefunden?«
»Herzdamen können sich als gezinkte Karten erweisen. Und sesshaft werden, wozu? Ist doch ein spannendes Leben. Es gibt immer was zu tun, auch dank Ihnen, mon oncle.«
Meunier winkte ab.
»Wenn Sie mich empfehlen«, wechselte Paul das Thema, »erzählen Sie dann immer noch, dass ich in einem Kino geboren wurde?«
»Mais oui, ist doch eine tolle Geschichte! Zwischen Reihe acht und zehn, wie ich von deiner Mutter weiß«, erklärte er. »Eine Sturzgeburt, sie kehrte gerade die Zigarettenstummel unter den Sitzen zusammen und hat es nicht mehr bis hoch in eure Wohnung geschafft.«
»Zigarettenstummel? Davon hat maman mir nie erzählt. Nur dass ich so ungeduldig war und nicht warten konnte, bis sie in der Klinik war.«
»Was passt besser zu einer Kinodynastie, als dass die dritte Generation direkt im Kino das Licht der Welt erblickt? Dein Großvater war sehr stolz und sehr gerührt. Er hat das Union als kleines Kino gegründet, zu Anfang war’s nicht mehr als ein derber Vaudeville-Stall. Als du geboren wurdest aber bereits ein Palast, das schönste Kino in Strasbourg.«
»Maman führt es bis heute, nehme ich an?«
Meunier nickte. »Das Union ist immer noch eines der besten Kinos in Strasbourg, und die Witwe Duringer hat einen Namen in der französischen Kinowelt. Aber Ottilie ist nicht mehr die Jüngste, du solltest also überlegen, ob …«
»Nein«, unterbrach ihn Paul schnell und sprach das Nein mit solcher Bestimmtheit aus, dass Meunier nicht nachhakte. Schnell kam er auf seine Kindheit zurück. »Im Kino geboren, im Kino großgeworden, alle stellen sich das großartig vor, weil man unentwegt Filme sehen kann. Aber von wegen! Es hat ewig gedauert, bis ich in unserem Kino einen Film von Anfang bis Ende sehen konnte. Mit sieben war ich Kinoportier mit Uniform und allem Pipapo. Bei Wind und Wetter draußen vor dem Kino stehen, vornehmen Damen die Automobiltür öffnen, Kriegsversehrten über die Stufen helfen, mal schnell ein Hemd aus der Reinigung holen, ein Vergnügen war’s nicht. Was habe ich meinen großen Bruder Jean-Pierre beneidet, weil der schon drinnen Karten abreißen durfte! Mit zehn durfte ich das dann endlich auch, da musste der kleine Auguste den Portierdienst übernehmen. Aber auch drinnen war meist viel zu tun. Jede Hand wurde gebraucht, anders ging es nicht.«
»Natürlich, eure Mutter hat euch früh hart rangenommen«, bestätigte Meunier. »Aber sie hatte keine Wahl, nachdem erst euer Großvater gestorben war und dann euer Vater. Er ist so früh von euch gegangen.«
»Mit dreizehn habe ich meinen Filmvorführschein gemacht, ab da konnte ich zumindest durch das kleine Fenster der Vorführkabine Filme in voller Länge sehen. Aber ein kleiner Kasten ist nicht Kino!«
»Wohl wahr! Das Kino braucht die große Leinwand!« Meunier warf einen Blick auf die Uhr und erschrak. »Mon Dieu, ich muss los. Immer vergesse ich die Zeit, wenn ich mit dir zusammensitze. Ich habe noch eine Verabredung mit einem deutschen Produzenten, der frisch im Geschäft ist.« Er erhob sich; Paul, der ebenfalls aufstand, reichte ihm grade mal bis zur Brust. »Mach’s gut, mein Kleiner. Wir sehen uns bald. Bonne chance für die Truffaut-Reihe.«
»Wird schon schiefgehen. Merci.« Paul setzte sich wieder, seine Erinnerungen hielten ihn noch fest. Weil er Vernays Der Graf von Monte Christo einmal auf der großen Leinwand sehen wollte, verließ er die Vorführkabine und stellte sich ganz hinten auf den Balkon der ersten Etage. Seine Mutter bemerkte ihn trotzdem. Beide Hände in die Hüften gestemmt, stand sie plötzlich da und versetzte ihm mitten im Theatersaal zwei schallende Ohrfeigen. »Ein Vorführer hat in der Kabine zu bleiben! Was, wenn der Film reißt oder das Zelluloid Feuer fängt?«, zischte sie. Auch Jean-Pierre verließ manchmal die Vorführkabine. Aber den Bruder erwischte die Mutter nie, ihm ließ sie das durchgehen, Prügel bezog nur er.
Freiburg
Es gibt Dinge, die durch Nachdenken nicht besser werden. Grübeln machte Henny nervös, und in diesem Zustand konnte sie sich selbst nicht leiden. Singen und ein Glas Champagner, entschied sie, nichts vertrieb die Tristesse besser. Sie würde ausgehen, ihren Jazzkeller besuchen, die Feier in der Requisite begann viel zu spät für sie. Wie blöd, dass Elfie schon im Theater war! Nun musste sie allein entscheiden, was sie anziehen sollte. Das Blumenkleid mit dem Petticoat drunter oder das schlichte Schwarze? Sie entschied sich für das cremefarbene Kleid mit Golddruck und der großen Schleife am Rücken. Mit den passenden, ellbogenlangen Handschuhen sehr elegant! Die dunklen Haare zu einem modischen Knoten am Hinterkopf geschlungen, ein bisschen Lippenstift, ein paar Tropfen Odeur d’Orient, schon war sie ausgehfertig. Sie ging zu Fuß, es war nicht weit.
Der junge Hasenkamp machte am Eingang die Honneurs. Er studierte Medizin, interessierte sich aber nur für Jazz, was seinen Vater, dessen Praxis er übernehmen sollte, in den Wahnsinn trieb. Er begrüßte Henny mit einem angedeuteten Diener, nahm ihr den Mantel ab und führte sie zu ihrem Platz. Als er ihr den Stuhl zurechtrückte, beobachtete sie amüsiert, wie die Aufregung ein leichtes Rot auf sein glattes, unverbrauchtes Gesicht wischte.
»Heute platzen wir aus allen Nähten«, verkündete er stolz. »Das Trio ist sensationell. International besetzt: Ein Londoner am Schlagzeug, ein Münchner am Bass, ein New Yorker an der Trompete. Sie spielen New Jazz. Die drei sind schon in Paris gefeiert worden.«
Paris, natürlich Paris. Für die jungen Jazzfreunde war Paris der Nabel der Welt. In Lepold Scherers altem Weinkeller spielten sie Rive Gauche: Zogen die Stirn kraus vor Melancholie, trugen Schwarz wie Juliette Gréco, begeisterten sich für Miles Davis oder John Coltrane, klemmten sich zerlesene Traktate existenzialistischer Philosophen unter den Arm. Henny beobachtete das alles mit großem Amüsement. Im Gegensatz zu ihr war kaum einer der Grünschnäbel jemals in Paris gewesen, und im Gegensatz zu ihr wusste keiner, dass sich Sartres Das Sein und das Nichts nach seinem Erscheinen 1943 vor allem bei Pariser Hausfrauen wie geschnitten Brot verkaufte. Das Buch wog exakt ein Kilo, und nachdem die Nazis alle Eisengewichte der Waagen zur Waffenproduktion requiriert und eingeschmolzen hatten, erwies sich die Sartre’sche Philosophie als nützlich, um beim Kartoffelkauf nicht betrogen zu werden. Not machte erfinderisch; der Krieg trieb manchmal seltsame Blüten. Aber vom Krieg hatten die Herren Studenten keine Ahnung. Im Krieg waren sie noch kleine Kinder gewesen. Wie ihr Kaspar durften sie in Friedenszeiten aufwachsen.
»Singen Sie? Darf ich den Musikern Bescheid geben?«, fragte der junge Hasenkamp.
Henny nickte. »Noch ein Glas Champagner, dann komme ich in die Garderobe.«
Schon eilte der Kellner mit der Flasche herbei, ließ den Korken knallen und füllte ihr ein Glas. Seit sie mal erwähnt hatte, dass sie Champagner liebte, wartete bei ihren Besuchen immer eine Flasche auf sie. Sie genoss es, hier von jungen Männern umschwirrt und wie eine Königin hofiert zu werden. Dabei wäre Dank gar nicht nötig. Sie hatte keine andere Verwendung für den Keller, der schon mal bessere Tage gesehen hatte, sie überließ ihn den jungen Leuten gerne für ihren Jazzschuppen. Gegen einen kleinen Obolus versteht sich. Und für das Privileg, gelegentlich hier singen zu dürfen. Ja, nicht nur Elfie, auch sie hatte eine künstlerische Ader.
Vor dem Krieg hatte ihr Vater selig diesen Keller, übrigens nur ein paar Häuser vom Weinladen in der Schusterstraße entfernt, in einem deutlich besseren Zustand als Lagerraum für die einfachen Weine genutzt. Lepold Scherer war damals der beste Weinhändler der Stadt gewesen. Im Keller direkt unter der Weinhandlung hatte er legendäre Weine gehortet: Bordeaux aus den 1910er-Jahren, Burgunder aus dem letzten Jahrhundert, Champagner aus dem Krönungsjahr von Wilhelm II., Loire-Weine aus der Zeit vor der Reblaus. Die feinen Flaschen zersplitterten allesamt in einer einzigen Nacht, und die edlen Tropfen versickerten im Lehmboden des Kellers, als im November 1944 die Royal Air Force Freiburg bombardierte. Die Operation Tigerfish legte die Altstadt in Schutt und Asche, zerstörte Hennys Elternhaus und kostete ihren Vater das Leben: Weinhändler Scherer ging mit seinen Schätzen unter. Obwohl sein Tod sie zur Vollwaise machte, ihre Mutter war kurz nach ihrer Geburt an Kindbettfieber gestorben, empfand Henny ihn für Lepold Scherer als gnädig, denn niemals hätte der Vater den Verlust seines Lebenswerkes verkraftet.
»Die Herren erwarten Sie«, verkündete Hasenkamp ein paar Minuten später.
Henny trank ihr Glas aus und folgte ihm.
Als sie mit Hasenkamp und seinen Freunden über die Vermietung des Kellers verhandelt hatte, der im Gegensatz zum Keller unter der Weinhandlung nur geplündert worden war, bestand sie darauf, gelegentlich selbst aufzutreten. Ihre Bedingung wurde mit herunterfallenden Kinnladen quittiert, Henny konnte nicht übersehen, wie bitter die Pille war, die sie den Studenten zu schlucken gab. Was sie denn gedenke darzubieten, hatte sich der Blondschopf Kellermann vorsichtig erkundigt, ein ausgezeichneter Pianist übrigens, schließlich wollten sie in dem Keller Jazz und nur Jazz spielen. »Glaubt ihr etwa, ich will euch Operettenarien vorträllern?«, neckte sie die jungen Männer. »Ich dachte an My Funny Valentine.« »Ah, wie alle Frauen lieben Sie Frank Sinatra«, warf der korpulente Frischmüller ein. »Tsstssstsss, Frankie-Boy singt das viel zu gefällig, ich denke eher an eine Interpretation à la Chet Baker«, erwiderte sie und genoss es, in überraschte Gesichter zu schauen. »Nicht einfach zu singen«, gab Hasenkamp zu bedenken, und Henny nickte. Seit sie Chet Baker damit gehört hatte, war sie von dem Stück hingerissen, summte es, wo sie ging und stand, probte es in der Badewanne. Die dritte Zeile, Herrgott, die war verdammt schwer!
Bei der Eröffnung des Jazzkellers gab sie das Stück zum ersten Mal öffentlich zum Besten. Etwas holprig, das merkte sie selbst, aber nicht blamabel, auch dank Kellermanns Klavierbegleitung. Seither sang sie es gelegentlich. Jazzmusiker waren Meister der Improvisation, keiner, der sie nicht begleiten konnte. Es sprach sich in der Jazzszene herum, dass es in Freiburg diese verrückte My Funny Valentine-Vermieteringab. Henny sang immer nur dieses Stück, nie ein anderes. Jedes Mal trotzte sie ihm neue Nuancen ab.
»This is our Mrs Funny Valentine«, stellte Hasenkamp sie den Musikern des Abends vor.
Henny schüttelte Hände und besprach, unterstützt durch Hasenkamps Englischkenntnisse, wie sie das Stück begleitet haben wollte. »Slow and smooth«, übersetzte er.
Damit die Musiker ihr Programm wie geplant spielen konnten, trat sie immer als Erstes auf. Sie genoss den Beifall, als sie mit den Musikern die Bühne betrat. Der Raum war richtig voll, kein Platz mehr frei, vom Eingang her drängelten weitere Leute herein, hinten an der Wand quetschten sie sich dicht an dicht. Hauptsächlich junges Volk, aber der eine oder andere ihres Alters fand sich ebenfalls darunter.
»My funny valentine, Sweet comic valentine, You make me smile with my heart …« Sowie sie zu singen begann, vergaß sie alles um sich herum. Mal schwang Sehnsucht, mal Zuversicht, mal Übermut mit, diesmal war es Traurigkeit. Sie dachte an Yves, der ihr 1938 eine Schallplatte mit Gypsy Swing von Stéphane Grappelli und Django Reinhardt vorgespielt hatte. Die Musik war ihr sofort in die Beine gegangen, dieses Leichte, Verrückte, Übermütige unterlegt mit einer Spur von Traurigkeit. Gypsy Swing war so anders als die Marschlieder, die sie im Bund Deutscher Mädel rauf und runter singen mussten, oder die Operettenträllerei in den Ufa-Filmen. Doch Jazz galt als entartete Musik, die war in Deutschland verboten. Als sie nach dem Krieg zum ersten Mal Glenn Miller im Radio hörte, tanzte sie mit ausgebreiteten Armen durchs Wohnzimmer, klatschte wie wild und sang lauthals Chattanooga Choo Choo.
Hamburg
Im Hauptbahnhof stand der Nachtzug nach München bereit. Paul lief am Bahnsteig entlang, stieg in den Waggon mit der Nummer 3 und fand sein Coupé. Am Fenster saß ein älteres Paar, auf der Ablage türmten sich sechs Koffer, die Betten waren noch nicht vorbereitet. Es störte Paul nicht, wenn fünf weitere Bettgefährten neben, über oder unter ihm schnarchten, nirgendwo schlief er so gut wie im Zug. Auch im Auto fielen ihm die Augen zu oder im Schiff, Hauptsache ein Gefährt, das fuhr. Musste er in einem Hotelbett schlafen, so imaginierte er ein Karussell und drehte es so lange, bis ihm die Augen zufielen. Selbst im Einschlafen hasste er Stillstand.
Er nickte dem Paar zu, verstaute seinen Koffer und suchte den Speisewagen auf. Nur wenige Tische waren besetzt, er wählte einen am Fenster. Am Nachbartisch saß eine Frau mit einem kessen Bubikopf und las in einem Taschenbuch. Es muss nicht immer Kaviar sein.