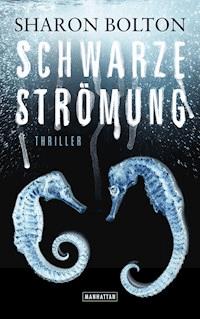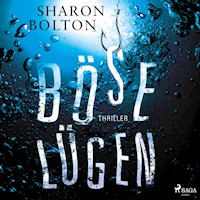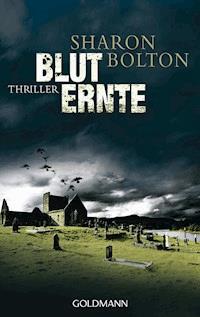
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Manhattan
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Es gibt eine Zeit zu leben. Eine zu sterben. Und eine zu töten.
Die Familie Fletcher ist erst vor kurzem aufs Land gezogen. Doch die vermeintliche englische Dorfidylle entpuppt sich bald als Alptraum. Die beiden Söhne der Fletchers hören auf dem Friedhof nahe des Hauses rätselhafte Stimmen und sehen immer wieder die seltsame Gestalt eines Kindes. Als eine Friedhofsmauer einstürzt und ein Grab mit den Überresten dreier Mädchen freigelegt wird, ist klar, dass der Ort ein tödliches Geheimnis birgt. Auch der neue Vikar, Harry Laycock, und die Psychotherapeutin Evi Oliver werden in die rätselhaften Vorgänge um verschwundene Mädchen und ein unfassbares Verbrechen hineingezogen. Und die kleine Tochter der Fletchers könnte das nächste Opfer eines rätselhaften Killers sein ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 707
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
SHARON BOLTON
Bluternte
Thriller
Aus dem Englischenvon Marie-Luise Bezzenberger
GOLDMANN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Die Originalausgabe erschien 2010 unter dem Titel »Blood Harvest« bei Bantam Press, an imprint of Transworld Publishers, London
Copyright © der Originalausgabe 2010 by S. J. Bolton
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2011 by Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Die Nutzung des Labels Manhattan erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Hans-im-Glück-Verlags, München
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur GmbH Umschlagmotive: © Corbis / Radius Images
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-05346-8V003
www.goldmann-verlag.de
Für die Coopers, die ihr großes, brandneues Haus ganz oben im Hochmoor gebaut haben …
»Wer mit Ungeheuern kämpft, mag zusehen, dass er nicht dabei zum Ungeheuer wird. Und wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein.«Friedrich Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse
»Sie beobachtet uns jetzt schon seit einer ganzen Weile.«
»Erzähl weiter, Tom.«
»Manchmal ist es, als wäre sie immer da, hinter einem Steinhaufen, im Schatten unten am Turm, unter einem von den alten Gräbern. Sie ist gut im Verstecken.«
»Bestimmt.«
»Manchmal kommt sie einem ganz nahe, bevor man irgendetwas ahnt. Man denkt an etwas ganz anderes, und plötzlich springt dich eine von ihren Stimmen an, und ganz kurz erwischt sie dich. Du glaubst wirklich, es wäre dein Bruder oder deine Mum, die sich hinter der nächsten Ecke versteckt haben.«
»Und dann merkt man, dass das gar nicht stimmt?«
»Genau, es stimmt nicht. Das ist nämlich sie. Das Mädchen mit den Stimmen. Doch sobald man sich umdreht, ist sie weg. Wenn man richtig schnell ist, bekommt man sie vielleicht ganz kurz zu sehen. Aber normalerweise ist da nichts, alles ist genau wie vorher, nur …«
»Nur was?«
»Nur dass es jetzt ist, als ob die Welt ein Geheimnis hätte. Und man hat so ein Gefühl ganz tief im Bauch, das einem sagt, sie ist wieder da. Sie beobachtet einen.«
Prolog
3. November
Es war also tatsächlich geschehen. Das, wovon er nur im Nachhinein hätte sagen können, dass er es befürchtet hatte. In gewisser Weise war es fast eine Erleichterung zu wissen, dass das Schlimmste vorbei war. Dass er nicht mehr zu heucheln brauchte. Jetzt musste er vielleicht nicht mehr so tun, als sei dies eine ganz gewöhnliche Kleinstadt, als seien dies ganz normale Leute. Harry atmete tief durch und stellte fest, dass der Tod nach Abflussrohren roch, nach feuchter Erde und Plastikplanen.
Der Schädel, keine zwei Meter entfernt, sah winzig aus. Als könnten ihn seine Finger fast völlig umschließen, wenn er ihn in der Hand hielte. Fast noch schlimmer als der Schädel war die Hand. Sie lag halb verborgen im Schlamm, die Knochen von der Haut kaum noch zusammengehalten, als versuchten sie, aus der Erde hervorzukriechen. Das grelle Kunstlicht flackerte wie ein Stroboskop, und einen Augenblick lang schien die Hand sich zu regen.
Auf der Plastikplane über Harrys Kopf hörte sich der Regen an wie Gewehrfeuer. So hoch oben auf dem Moor blies der Wind beinahe mit Sturmstärke, und die behelfsmäßigen Wände des Polizeizeltes konnten ihn nicht völlig abhalten. Als Harry seinen Wagen geparkt hatte, vor noch nicht einmal drei Minuten, war es 3.17 Uhr gewesen. Es war die dunkelste Stunde der Nacht. Harry wurde klar, dass er die Augen geschlossen hatte.
Detective Chief Superintendent Rushtons Hand lag noch immer auf seinem Arm, obgleich die beiden Männer den Rand der inneren Absperrung erreicht hatten. Näher würde man sie nicht heranlassen. Außer ihnen waren noch sechs weitere Personen in dem Zelt; alle trugen die gleichen weißen Overalls mit Kapuze und die gleichen Gummistiefel wie die, die Harry und Rushton gerade angezogen hatten.
Harry spürte, wie er zitterte. Mit geschlossenen Augen lauschte er dem beharrlichen, stetigen Trommeln des Regens auf dem Zeltdach. Er konnte noch immer diese Hand sehen. Als er merkte, dass er schwankte, schlug er die Augen auf und verlor beinahe das Gleichgewicht.
»Ein Stückchen zurück, Harry«, wies Rushton ihn an. »Bitte bleiben Sie auf der Matte.« Harry tat wie geheißen. Sein Körper schien mit einem Mal viel zu groß geworden zu sein, die geborgten Stiefel waren unerträglich eng, seine Kleider klebten an ihm, die Knochen seines Schädels fühlten sich zu dünn an. Das Geräusch von Wind und Regen ging weiter, wie der Soundtrack eines billigen Films. Zu viel Licht, zu viel Krach für mitten in der Nacht.
Der Schädel war von dem dazugehörigen Torso fortgerollt. Harry konnte einen Brustkorb sehen, so klein, noch immer bekleidet; winzige Knöpfe schimmerten unter den Lampen. »Wo sind die anderen?«, fragte er.
DCS Rushton neigte den Kopf und führte ihn dann über die Riffelblech-Platten, die wie Trittsteine über den Matsch gelegt worden waren. Sie folgten dem Verlauf der Kirchenmauer. »Passen Sie auf, wo Sie hintreten, mein Junge«, sagte Rushton. »Das ganze Gelände ist eine einzige Schlammsuhle. Da, sehen Sie?«
Sie waren am anderen Ende der Absperrung stehen geblieben. Der zweite Leichnam war noch intakt, sah jedoch nicht größer aus als der erste. Ein winziger Gummistiefel steckte auf seinem linken Fuß.
»Das Dritte liegt an der Mauer«, erläuterte Rushton. »Ist von hier aus schwer zu sehen. Es wird von den Steinen verdeckt.«
»Auch ein Kind?«, wollte Harry wissen. Unbefestigte PVC-Planen des Zeltes schlugen im Wind, und er musste fast schreien, um sich verständlich zu machen.
»Sieht so aus.« Rushtons Brille war von Regentropfen gesprenkelt. Er hatte sie nicht abgewischt, seit sie das Zelt betreten hatten. Vielleicht war er dankbar dafür, nicht deutlich sehen zu können. »Sehen Sie, wo die Mauer eingestürzt ist?«, fragte er.
Harry nickte. Ein ungefähr drei Meter langes Stück der Steinmauer, die die Grenze zwischen dem Grundstück der Fletchers und dem Kirchhof bildete, war eingestürzt, und das Erdreich, das sie zurückgehalten hatte, war wie ein kleiner Erdrutsch in den Garten gerollt. Eine alte Eibe war zusammen mit der Mauer umgestürzt. Im harten künstlichen Licht erinnerte der Baum ihn an das lange Haar einer Frau.
»Als die Mauer umgekippt ist, sind die Gräber am Friedhofsrand beschädigt worden«, sagte Rushton gerade. »Ganz besonders eines, das Grab eines Kindes. Ein kleines Mädchen namens Lucy Pickup. Das Problem ist, laut unseren Plänen lag das Kind allein in dem Grab. Es wurde vor zehn Jahren extra für sie angelegt.«
»Das weiß ich«, erwiderte Harry. »Aber dann …« Er wandte sich wieder der Szene vor ihm zu.
»Na ja, jetzt verstehen Sie bestimmt unser Problem«, meinte Rushton. »Wenn die kleine Lucy hier allein bestattet wurde, wer sind dann die beiden anderen?«
»Kann ich einen Moment mit ihnen allein sein?«, fragte Harry.
Rushtons Augen wurden schmal. Sein Blick wanderte von den kleinen Gestalten zu Harry und wieder zurück.
»Das hier ist heiliger Boden«, sagte Harry fast zu sich selbst.
Rushton trat von ihm weg. »Ladys und Gentlemen«, rief er. »Bitte eine Minute Ruhe für den Vikar.« Die über das Areal verteilten Beamten blickten auf. Einer öffnete den Mund, um zu widersprechen, hielt jedoch inne, als er Brian Rushtons Gesichtsausdruck sah. Mit einem gemurmelten Dank trat Harry näher an die Absperrung heran, bis eine Hand auf seinem Arm ihm bedeutete, dass er stehen bleiben musste. Der Schädel des Leichnams, der ihm am nächsten war, war zertrümmert. Fast ein Drittel schien zu fehlen. Er erinnerte sich, gehört zu haben, wie Lucy Pickup ums Leben gekommen war. Er holte tief Luft und registrierte, dass alle um ihn herum reglos verharrten. Einige beobachteten ihn, andere hatten die Köpfe gesenkt. Harry hob die rechte Hand und schickte sich an, das Kreuz zu schlagen. Auf, ab, nach links. Er hielt inne. Näher am Fundort, direkt unter den Lampen, konnte er den dritten Leichnam besser sehen. Die winzige Gestalt war mit etwas bekleidet, das um den Hals herum mit einem Muster bestickt war: ein kleiner Igel, ein Kaninchen, eine Ente mit einer Haube. Figuren aus den Geschichten von Beatrix Potter.
Er begann zu sprechen und wusste doch kaum, was er sagte. Ein kurzes Gebet für die Seelen der Toten; es hätte alles Mögliche sein können. Offenbar hatte er es beendet, die Leute von der Spurensicherung machten sich wieder an die Arbeit. Rushton klopfte ihm auf den Arm und führte ihn aus dem Zelt. Harry folgte widerspruchslos; ihm war klar, dass er unter Schock stand.
Drei kleine Leichname, die aus einem Grab gepurzelt waren, das nur einen hätte bergen sollen. Zwei unbekannte Kinder hatten Lucy Pickups letzte Ruhestätte mit ihr geteilt. Nur war eins davon nicht unbekannt, jedenfalls nicht ihm. Die Kleine in dem Beatrix-Potter-Pyjama. Er wusste, wer sie war.
Teil I –Abnehmender Mond
1
4. September (neun Wochen vorher)
Die Fletchers hatten ihr großes, brandneues Haus ganz oben auf dem Moor gebaut, in einem kleinen Ort, den die Zeit anscheinend sich selbst überlassen hatte, damit er sich um seine eigenen Angelegenheiten kümmern konnte. Es stand auf einem Grundstück von eher bescheidener Größe, das die Diözese hatte abstoßen müssen, weil sie dringend Geld brauchte. Die Fletchers bauten so nahe bei den beiden Kirchen – die eine alt, die andere sehr alt –, dass sie sich aus dem Schlafzimmerfenster beugen und fast das leere Gehäuse des uralten Turmes berühren konnten. Und auf drei Seiten ihres Gartens hatten sie die ruhigsten Nachbarn, die sie sich nur wünschen konnten. Denn die Fletchers hatten ihr neues Haus mitten auf einem Friedhof gebaut. Sie hätten es eigentlich besser wissen müssen.
Doch Tom und sein kleiner Bruder Joe waren anfangs ganz aus dem Häuschen vor Freude. In ihrem neuen Zuhause hatten sie riesige Zimmer, die noch nach frischer Farbe rochen. Draußen hatten sie den von Brombeerranken überwucherten Kirchhof mit den zerbröckelnden Steinen, wo Abenteuer wie aus dem Märchenbuch nur auf sie zu warten schienen. Drinnen hatten sie ein Wohnzimmer, das je nach Sonnenstand in endlosen Gelbschattierungen leuchtete. Draußen hatten sie uralte Bogengänge, die zum Himmel emporragten, Tierbaue mit Efeu, der so alt und starr war, dass er ganz allein stehen konnte, und Gras, das so lang war, dass der sechsjährige Joe darin zu ertrinken schien. Drinnen nahm das Haus allmählich das Wesen ihrer Eltern an, je mehr frische Farben, Wandgemälde und geschnitzte Tiere in den Zimmern Einzug hielten. Draußen nahmen Tom und Joe den Kirchhof in Besitz.
Am letzten Tag der Sommerferien lag Tom auf dem Grab von Jackson Reynolds (1875–1945) und sog die Wärme des alten Steines in sich auf. Der Himmel hatte denselben kornblumenblauen Farbton wie die Lieblingsmalfarbe seiner Mutter, und die Sonne schien bereits seit dem frühen Morgen. Es war ein Leuchtetag, wie Joe gern sagte.
Tom hätte nicht zu sagen vermocht, was auf einmal anders war. Wie es kam, dass er sich eben noch absolut prima fühlte, warm und glücklich, und darüber nachdachte, wie alt man wohl sein musste, um bei den Blackburn Rovers vorzuspielen – und plötzlich … na ja … fühlte er sich nicht mehr prima. Aber alles war in Ordnung, außer dass ihn etwas drängte, sich aufzusetzen. Zu schauen, was in der Nähe los war. Ob da jemand …
Bescheuert. Aber er richtete sich trotzdem auf, blickte sich um und fragte sich, wie Joe es geschafft hatte, schon wieder zu verschwinden. Weiter unten am Hügel erstreckte sich der Friedhof über die Länge eines Fußballfelds und fiel immer steiler ab. Dann kamen ein paar Straßen mit Reihenhäusern und dahinter wieder Wiesen. Hinter diesen Wiesen, am Grund des Tals, lag der Nachbarort Goodshaw Bridge, wo für ihn und Joe am Montagmorgen die Schule wieder anfangen würde. Jenseits des Tales erstreckten sich auf allen Seiten die Hochmoore. Jede Menge Hochmoore.
Toms Dad sagte gern, wie toll er die Moore fand, die Wildheit, die Erhabenheit und die absolute Unberechenbarkeit der Natur hier oben im Norden von England. Tom war natürlich derselben Meinung wie sein Dad, er war ja auch erst zehn. Insgeheim jedoch überlegte er manchmal, ob eine Landschaft, die berechenbar war – er hatte das Wort nachgeschlagen, er wusste, was es bedeutete –, vielleicht gar nicht so schlecht wäre. Manchmal kam es Tom so vor, als wären die Moore um sein neues Zuhause herum ein kleines bisschen zu unberechenbar. Obwohl er das niemals laut sagte.
Natürlich war er ein Idiot, das verstand sich von selbst.
Aber irgendwie schien Tom ständig ein neuer Felsbrocken aufzufallen, ein winziges Tal, das vorher nicht da gewesen war, ein Heidekrautflecken oder eine Baumgruppe, die über Nacht aufgetaucht war. Manchmal, wenn die Wolken rasch am Himmel dahinzogen und ihre Schatten über den Boden jagten, kam es Tom so vor, als bildeten sich Wellen auf dem Moor, wie bei Wasser, wenn sich etwas unter der Oberfläche bewegte. Oder es regte sich wie ein schlafendes Ungeheuer, das aus dem Schlaf gerissen wird. Und hin und wieder, wenn die Sonne auf der anderen Seite des Tals unterging und es dunkel wurde, konnte Tom sich des Gedankens nicht erwehren, dass die Moore ringsum näher herangekrochen waren.
»Tom!«, schrie Joe von der anderen Seite des Friedhofs her, und zur Abwechslung bedauerte Tom es einmal nicht, seinen kleinen Bruder zu hören. Der Stein unter ihm war kalt geworden, und über ihm waren Wolken aufgezogen.
»Tom!«, rief Joe abermals. Er schrie ihm diesmal fast ins Ohr. Mann, Joe, das ging aber schnell! Tom sprang auf und drehte sich um. Joe war nicht da.
Rund um den Kirchhof begannen die Bäume zu rauschen. Der Wind nahm wieder zu, und wenn der Wind auf dem Hochmoor es wirklich ernst meinte, kam er überall hin, selbst an geschützte Stellen. In den Büschen, die Tom am nächsten waren, bewegte sich etwas.
»Joe«, sagte er leiser, als er eigentlich wollte. Denn der Gedanke, dass sich irgendjemand, und sei es Joe, in diesen Büschen versteckte und ihn beobachtete, gefiel ihm überhaupt nicht. Er starrte die großen, glänzenden grünen Blätter an und wartete darauf, dass sie sich noch einmal rührten. Es waren Lorbeerbüsche, hoch, alt und dicht. Der Wind nahm definitiv an Stärke zu; jetzt konnte er ihn in den Baumwipfeln hören. Die Lorbeerbüsche vor ihm bewegten sich nicht.
Wahrscheinlich war es nur ein komisches Echo gewesen, das ihm vorgegaukelt hatte, Joe sei ganz in der Nähe. Doch Tom hatte wieder dieses Gefühl, jenes Kitzelgefühl, das er immer dann bekam, wenn ihm jemand bei etwas Verbotenem zusah. Und außerdem, hatte er nicht eben Joes Atem im Nacken gespürt?
»Joe?«, versuchte er es abermals.
»Joe?«, kam seine eigene Stimme zurück. Tom machte zwei Schritte rückwärts und prallte gegen den Grabstein. Dann schaute er sich gründlich um, ob auch wirklich niemand in der Nähe war, und kauerte sich hin.
In dieser Höhe waren die Lorbeerbüsche nicht so dicht belaubt. Zwischen Brennnesseln konnte Tom mehrere kahle Zweige des Gesträuchs erkennen. Und er sah noch etwas anderes, einen vagen Umriss, von dem er nur sagen konnte, dass es keine Pflanze war. Es sah ein bisschen so aus wie … wenn es sich bewegte, würde er es vielleicht besser erkennen können … ein großer und sehr schmutziger menschlicher Fuß.
»Tom, Tom, komm her und schau dir das an!«, rief sein Bruder und klang diesmal, als sei er kilometerweit weg. Tom ließ sich nicht zweimal bitten. Er sprang auf und rannte in die Richtung, aus der die Stimme kam.
Joe kauerte am Fuß der Mauer, die den Kirchhof vom Garten der Familie trennte. Er betrachtete ein Grab, das neuer zu sein schien als jene, die es umgaben. Am Fußende, dem Grabstein zugewandt, stand eine Statue.
»Schau mal, Tom«, verkündete Joe, noch ehe sein großer Bruder zum Stehen gekommen war. »Das ist ein kleines Mädchen. Mit einer Puppe.«
Tom bückte sich. Die Statue war ungefähr dreißig Zentimeter hoch und stellte ein winziges, rundliches Mädchen mit Locken dar, das ein Partykleidchen trug. Behutsam streckte Tom die Hand aus und kratzte ein wenig von dem Moos ab, das sie überwucherte. Der Bildhauer hatte sie mit vollendet herausgearbeiteten Schuhen ausgestattet, und in den Armen hielt sie eine kleine Puppe.
»Kleine Mädchen«, meinte Joe. »Das ist ein Grab für kleine Mädchen.«
Tom schaute auf und stellte fest, dass Joe recht hatte – beinahe. Nur ein einziges Wort war in den Grabstein eingemeißelt. Lucy. Vielleicht stand da noch mehr, doch alles, was sich möglicherweise darunter befinden mochte, war von Efeu bedeckt. »Nur für ein kleines Mädchen«, erwiderte er. »Lucy.«
Tom zerrte den Efeu weg, der über den Grabstein wucherte, bis er die Daten erkennen konnte. Lucy war vor zehn Jahren gestorben. Sie war erst zwei Jahre alt gewesen. Geliebtes Kind von Jennifer und Michael Pickup lautete die Inschrift. Mehr stand dort nicht.
»Nur für Lucy«, wiederholte er. »Komm, wir gehen.«
Tom machte sich auf den Weg, wand sich vorsichtig durch das hohe Gras, wich Brennnesseln aus, schob Brombeerranken zur Seite. Hinter sich hörte er das Gras rascheln und wusste, dass Joe ihm folgte. Als er den Hügel hinaufstieg, kamen die Mauern der Abteiruine in Sicht.
»Tom«, sagte Joe mit einer Stimme, die sich einfach nicht richtig anhörte.
Tom blieb stehen. Er konnte hören, wie sich direkt hinter ihm das Gras bewegte, doch er drehte sich nicht um. Er blieb einfach, wo er war, und starrte den verfallenen Kirchturm an, ohne ihn zu sehen. Stattdessen fragte er sich, warum er sich plötzlich so davor fürchtete, sich nach seinem Bruder umzudrehen.
Er tat es trotzdem. Da waren nur die hohen Grabsteine. Sonst nichts. Tom merkte, dass seine Hände zu Fäusten geballt waren. Das war wirklich nicht witzig. Dann bewegten sich die Büsche ein paar Meter weiter erneut, und dort war Joe. Er rannte durchs Gras, keuchte und war ganz rot im Gesicht, als hätte er sich mächtig angestrengt, um Schritt zu halten. Er kam näher, erreichte seinen Bruder und blieb stehen.
»Was ist?«, fragte Joe.
»Ich glaube, irgendjemand folgt uns«, flüsterte Tom.
Joe fragte nicht, wer oder wo, oder woher Tom das wusste, er starrte ihn bloß an. Tom streckte die Hand aus und fasste seinen Bruder am Arm. Sie würden nach Hause gehen, und zwar jetzt gleich.
Allerdings, nein, vielleicht doch nicht. Auf der Mauer, die den älteren Teil des Kirchengeländes von dem Friedhof trennte, welcher sich den Hügel hinunterzog, standen sechs Jungen aufgereiht wie Kegel und beobachteten sie. Tom konnte fühlen, wie sein Herz schneller zu schlagen begann. Sechs Jungen und möglicherweise noch einer ganz in der Nähe.
Der größte der Jungen hielt einen dicken, gegabelten Zweig in der Hand. Tom sah das Geschoss nicht, das auf sie zugeflogen kam, doch er fühlte den Luftzug, der an seinem Gesicht vorbeipfiff. Ein anderer Junge in einem auffälligen Fußballtrikot in Weinrot und Blau zielte gerade auf sie. Mit schnelleren Reflexen ausgestattet als sein Bruder, warf Joe sich hinter einen großen Grabstein. Tom folgte ihm genau in dem Moment, als der Schuss weit danebenging.
»Wer sind denn die?«, flüsterte Joe, als ein weiterer Stein über sie hinwegflog.
»Jungs aus der Schule«, antwortete Tom. »Zwei von denen sind in meiner Klasse.«
»Und was wollen die?« Joes blasses Gesicht war noch weißer geworden als sonst.
»Ich weiß nicht«, sagte Tom, obwohl er es sehr wohl wusste. Einer von denen wollte ihm etwas heimzahlen. Die anderen halfen ihm nur dabei. Ein Stein traf den Rand des Grabsteins, und Tom sah Staub auffliegen. »Der mit dem Burnley-Trikot heißt Jake Knowles«, gestand er.
»Der, mit dem du dich geprügelt hast?«, fragte Joe. »Als du zum Direktor geschickt worden bist? Dessen Dad wollte, dass du von der Schule fliegst?«
Tom duckte sich und beugte sich vor. Er hoffte, dass das lange Gras seinen Kopf verbergen würde, als er aus der Deckung hervorspähte. Ein weiterer Junge aus Toms Klasse, Billy Aspin, zeigte auf ein Brombeergebüsch dicht bei dem Grab des kleinen Mädchens, das Joe gerade gefunden hatte. Tom wandte sich wieder an Joe: »Sie schauen nicht her«, sagte er. »Wir müssen ganz schnell sein. Komm mit.«
Joe war unmittelbar hinter ihm, als Tom vorwärtsschoss, auf ein mächtiges, aufrecht stehendes Grabmal zu, eines der größten auf dem Hügel. Sie schafften es. Steine kamen durch die Luft gesurrt, doch Tom und Joe waren hinter der riesigen Steingruft, die ringsherum eiserne Geländer hatte, in Sicherheit. Außerdem besaß sie ein Eisentor und dahinter eine hölzerne Tür, die ins Innere führte. Ein Familienmausoleum, hatte ihr Vater gesagt, innen wahrscheinlich ziemlich groß. In den Hügel gegraben, mit jeder Menge Simse, um Generationen von Särgen daraufzustellen.
»Die haben sich getrennt!«, war ein Ruf von der Mauer her zu vernehmen. »Ihr beide, kommt mit!«
Tom und Joe sahen einander an. Sie hatten sich doch gar nicht getrennt.
»Das sind echt Volltrottel«, stellte Joe fest.
Tom beugte sich hinter der Gruft hervor. Drei der Jungen gingen entlang der Mauer auf Lucy Pickups Grab zu. Die anderen starrten immer noch in ihre Richtung.
»Was ist denn das für ein Geräusch?«, wollte Joe wissen.
»Der Wind?«, meinte Tom, ohne wirklich hinzuhören. Meistens war es der Wind.
»Das ist nicht der Wind. Das ist Musik.«
Joe hatte recht. Definitiv Musik, leise, mit einem stetigen Rhythmus; eine tiefe Männerstimme sang. Die Volltrottel hatten es auch gehört. Einer von ihnen sprang von der Mauer und rannte auf die Straße zu. Dann schlossen sich ihm die übrigen an. Die Musik wurde lauter, und Tom konnte den Motor eines Autos hören.
Das war John Lee Hooker. Ihr Dad hatte ein paar Hooker-CDs und spielte sie – sehr laut –, wenn ihre Mutter nicht zu Hause war. Irgendjemand kam den Hügel heraufgefahren und hörte im Auto John Lee Hooker. Das war genau der richtige Zeitpunkt, um abzuhauen. Tom trat aus dem Schutz des Mausoleums heraus.
Nur Jake Knowles war noch in Sicht. Er schaute sich um und erblickte Tom. Beide Jungen wussten, dass das Spiel aus war. Es sei denn …
»Der hat ja deinen Baseballschläger«, stieß Joe hervor, der Tom aus der Deckung gefolgt war. »Was macht er denn da?«
Jake hatte Toms Baseballschläger und auch seinen Ball, einen sehr großen, sehr schweren roten Ball. Toms Mum hatte ihm verboten, damit irgendwo in der Nähe eines Gebäudes zu spielen. Schon gar nicht in der Nähe von Gebäuden mit Fenstern, wollte er nicht eines langen, schmerzhaften Todes sterben – so redete sie, wenn es ihr ernst war. Und ob sie sich auch klar und verständlich ausgedrückt habe?
Tom und Joe hatten vorhin neben der Kirche Fangen geübt. Sie hatten sowohl den Schläger als auch den Ball bei der Mauer liegen lassen, und jetzt hatte Knowles beides.
»Der klaut deine Sachen«, meinte Joe. »Wir können die Polizei rufen.«
»Glaube ich nicht«, erwiderte Tom, als Jake sich zur Kirche umdrehte. Tom sah zu, wie Jake den Ball behutsam hochwarf. Dann schlug er hart mit dem Schläger zu. Der Ball segelte durch die Luft und dann durch das riesige Buntglasfenster an der Seite des Kirchenschiffs. Eine blaue Scheibe ging zu Bruch, während der Automotor erstarb, die Musik verstummte und Jake Knowles seinen Freunden folgte und das Weite suchte.
»Warum hat er denn das gemacht?«, fragte Joe. »Er hat ein Fenster eingeschmissen. Die bringen ihn um.«
»Nein«, entgegnete Tom. »Die bringen uns um.«
Joe starrte seinen Bruder einen Augenblick an, dann begriff er. Er mochte ja erst sechs und ungeheuer lästig sein, ein Volltrottel jedoch war er nicht.
»Das ist nicht fair!« Joes kleines Gesicht war vor Empörung verzerrt. »Das sagen wir.«
»Die glauben uns ja doch nicht«, antwortete Tom. Sechs Wochen in seiner neuen Schule: dreimal Nachsitzen, zweimal zum Direktor geschickt, jede Menge ernste Strafpredigten von seinem Klassenlehrer, und nie glaubte ihm jemand. Warum sollten sie auch, wenn Jake Knowles die halbe Klasse auf seiner Seite hatte und die anderen vor Eifer, ihm den Rücken zu stärken, praktisch auf ihren Stühlen herumhopsten? Sogar die, die nicht mit Jake befreundet zu sein schienen, hatten zu viel Angst vor ihm und seiner Gang, um irgendetwas zu sagen. Sechs Wochen, in denen man Tom für alles die Schuld gab, was Jake Knowles angezettelt hatte. Vielleicht war er ja selbst der Volltrottel.
Er nahm Joes Hand, und die beiden Jungen rannten durch das hohe Gras, so schnell sie konnten. Tom kletterte auf die Mauer, schaute sich auf dem Kirchhof um und beugte sich dann hinab, um Joe hochzuziehen. Jake und die anderen Jungen waren nirgends zu sehen, doch in der Umgebung der alten Kirchenruine gab es Hunderte von Verstecken.
Ein alter Sportwagen parkte gleich neben dem Kirchentor, blassblau mit jeder Menge Silberverzierungen. Das Verdeck war zurückgeklappt und über dem Kofferraum zusammengefaltet worden. Ein Mann beugte sich über den Beifahrersitz und fuhrwerkte im Handschuhfach herum. Dann fand er, was er suchte, und richtete sich auf. Er war ungefähr so alt wie Toms Dad, vierunddreißig oder fünfunddreißig. Größer als Toms Dad, aber dünner.
Tom bedeutete Joe, ihm zu folgen. Dann hob er den Baseballschläger auf – es brachte schließlich nichts, Beweise offen herumliegen zu lassen – und rannte los, bis sie hastig in ihr Lieblingsversteck krabbeln konnten: ein von vier Steinsäulen getragenes, rechteckiges Grabmal, das aussah wie ein steinerner Tisch. Das Gras darum herum war hoch, und wenn die Jungen erst einmal unter die Deckplatte gekrochen waren, waren sie allen Blicken entzogen.
Der Fahrer des Sportwagens öffnete die Autotür und stieg aus. Als er sich der Kirche zuwandte, konnten die Jungen sehen, dass sein Haar dieselbe Farbe hatte wie das ihrer Mutter – rotblond, nicht rot – und dass es auch lockig war wie das ihrer Mum, nur war seines kurz geschnitten. Er trug knielange Shorts, ein weißes T-Shirt und rote Crocs. Jetzt ging er über die Straße und betrat den Kirchhof. Dort blieb er auf dem Pfad stehen und schaute hinter sich, dann drehte er sich langsam auf der Stelle und betrachtete die kopfsteingepflasterten Straßen, die Reihenhäuser, die beiden Kirchen und das Moor dahinter.
»Der war noch nie hier«, flüsterte Joe.
Tom nickte. Der Fremde ging an den Jungen vorbei und erreichte den Haupteingang der Kirche. Er zog einen Schlüssel aus der Tasche. Einen Augenblick später schwang die Tür auf, und der Mann ging hinein. Gerade, als Jake Knowles am Eingang des Kirchhofs erschien. Tom stand auf und sah sich um. Billy Aspin war hinter ihnen. Dann tauchten auch die anderen hinter Grabsteinen auf oder kamen über die Mauer geklettert. Die Brüder waren umzingelt.
2
»Es hat drei Stunden gebrannt, bevor sie’s löschen konnten. Und sie haben gesagt, die Temperatur da drin, direkt am … Ich weiß nicht mehr, was sie gesagt haben …«
»Am Brandherd?«, schlug Evi vor.
Die junge Frau, die ihr gegenübersaß, nickte. »Ja, genau«, bestätigte sie. »Am Brandherd. Sie haben gesagt, da wäre es gewesen wie in einem Hochofen. Und ihr Zimmer war genau darüber. Sie konnten nicht ans Haus rankommen, schon gar nicht ins Obergeschoss, und dann ist die Decke eingebrochen. Als sie’s schließlich geschafft haben, das Ganze genug abzukühlen, konnten sie sie nicht finden.«
»Keine Spur von ihr?«
Gillian schüttelte den Kopf. »Nein, gar nichts«, antwortete sie. »Sie war doch so klein, verstehen Sie. So winzige, weiche Knochen.«
Gillians Atmen ging wieder schneller. »Irgendwo habe ich gelesen, es wäre ungewöhnlich, dass Menschen … völlig verschwinden, aber es ist schon vorgekommen«, fuhr sie fort. »Das Feuer verbrennt sie ganz einfach.« Die junge Frau begann krampfhaft nach Luft zu schnappen.
Evi stemmte sich in ihrem Sessel hoch, und sofort meldeten sich die Schmerzen in ihrem linken Bein. »Gillian, es ist okay«, beschwichtigte sie. »Kommen Sie erst mal wieder zu Atem. Ganz ruhig.«
Gillian legte die Hände auf die Knie und ließ den Kopf sinken, während Evi sich ihrerseits darauf konzentrierte, ihre eigene Atmung unter Kontrolle zu bringen, sich auf etwas anderes zu konzentrieren als auf die Schmerzen in ihrem Bein. Die Uhr an der Wand verriet ihr, dass 15 Minuten der Sitzung vergangen waren.
Ihre neue Patientin Gillian Royle war arbeitslos, geschieden und Alkoholikerin. Sie war sechsundzwanzig. In dem Überweisungsschreiben des Hausarztes hatte etwas von »übermäßig langer und abnormaler Trauer« nach dem Tod ihrer siebenundzwanzig Monate alten Tochter bei einem Hausbrand vor drei Jahren gestanden. Laut ihrem Hausarzt litt Gillian unter schweren Depressionen, hegte Selbstmordgedanken und hatte sich schon öfter selbst Verletzungen zugefügt. Er hätte sie schon früher überwiesen, hatte er erklärt, doch der Fall sei ihm gerade erst von einer Sozialarbeiterin zur Kenntnis gebracht worden. Dies war ihr erster Termin bei Evi.
Gillians Haar hing fast bis zum Boden. Früher hatte sie blonde Strähnchen gehabt, jetzt waren die Haare von einem ungewaschenen Mausbraun. Allmählich verlangsamte sich das Heben und Senken ihrer Schultern. Einen Moment später hob sie die Hand, um ihr Haar zurückzustreichen. Ihr Gesicht kam wieder zum Vorschein. »Entschuldigung«, stammelte sie, wie ein Kind, das man dabei ertappt hatte, wie es sich schlecht benahm.
Evi schüttelte den Kopf. »Nicht doch«, wehrte sie ab. »Was Sie empfinden, ist ganz normal. Haben Sie oft Probleme mit dem Atmen?«
Gillian nickte.
»Das ist völlig normal«, wiederholte Evi. »Menschen, die sehr große Trauer empfinden, leiden oft unter Atemnot. Sie bekommen ganz plötzlich Beklemmungen oder sogar Angstzustände, und dann haben sie Mühe, Luft zu holen. Kommt Ihnen das bekannt vor?«
Wieder nickte Gillian. Sie keuchte noch immer, als hätte sie gerade ein Wettrennen knapp verloren.
»Haben Sie irgendwelche Andenken an Ihre Tochter?«, erkundigte sich Evi.
Gillian streckte die Hand nach dem kleinen Tischchen neben sich aus und zog ein weiteres Papiertaschentuch aus der Schachtel. Noch hatte sie nicht geweint, sich jedoch unaufhörlich die Tücher ans Gesicht gedrückt und sie in den knochigen Fingern zerknüllt. Winzige zusammengedrehte Papierfetzen waren auf dem Teppich verstreut.
»Die Feuerwehrleute haben eins von ihren Spielsachen gefunden«, sagte sie. »Ein rosa Kaninchen. Eigentlich hätte es in ihrem Bettchen sein sollen, aber es war hinters Sofa gefallen. Ich sollte wohl froh sein, dass es so war, aber ich muss immer daran denken, dass sie das alles durchmachen musste und nicht mal ihr rosa Kaninchen bei sich hatte –« Gillians Kopf kippte nach vorn, und ihr Körper begann zu beben. Beide Hände, die noch immer dünnes, pfirsichfarbenes Papier umklammerten, waren fest gegen ihren Mund gedrückt.
»Hat es das für Sie schwerer gemacht?«, fragte Evi. »Dass sie Hayleys Leichnam nicht gefunden haben?«
Gillian hob den Kopf, und Evi konnte ein dunkleres Leuchten in ihren Augen sehen, härtere Kanten um die Linien ihres Gesichts. Dort drin war auch eine Menge Zorn, der mit der Trauer um die Vorherrschaft rang. »Pete hat gesagt, es wäre gut«, erwiderte sie. »Dass sie sie nicht finden konnten.«
»Und was denken Sie?«, wollte Evi wissen.
»Ich glaube, es wäre besser gewesen, wenn sie sie gefunden hätten«, schoss Gillian zurück. »Weil, dann hätte ich es ganz sicher gewusst. Ich hätte es akzeptieren müssen.«
»Akzeptieren, dass sie tot ist?«, fragte Evi.
»Ja«, bestätigte Gillian. »Weil, das konnte ich nicht. Ich konnte es nicht fassen, konnte nicht glauben, dass sie wirklich tot war. Wissen Sie, was ich gemacht habe?«
Evi gestattete sich ein sanftes Kopfschütteln. »Nein«, antwortete sie. »Erzählen Sie mir, was Sie gemacht haben.«
»Ich bin sie suchen gegangen, draußen auf dem Moor«, sagte Gillian. »Wie sie sie nicht gefunden haben, da habe ich gedacht, dass das bestimmt irgendwie ein Irrtum ist. Dass sie irgendwie rausgekommen ist. Ich dachte, vielleicht hat Barry, der Babysitter, sie irgendwie rausholen und in den Garten schaffen können, bevor der Rauch zu viel für ihn geworden ist, und sie ist einfach weggelaufen und hat sich verirrt.«
Gillians Augen bettelten Evi an, flehten sie an, zuzustimmen, zu sagen, ja, das sei durchaus wahrscheinlich, vielleicht sei sie immer noch dort draußen, irrte umher und lebte von Beeren, Gillian müsse nur weitersuchen.
»Sie hätte doch solche Angst vor dem Feuer gehabt«, sagte Gillian gerade, »also hätte sie versucht wegzulaufen. Sie hätte irgendwie aus dem Tor rauskommen und die Gasse hinaufrennen können. Also sind wir sie suchen gegangen, Pete und ich und noch ein paar andere. Wir sind die ganze Nacht auf dem Moor rumgelaufen und haben nach ihr gerufen. Verstehen Sie, ich war so sicher, dass sie nicht wirklich tot sein konnte.«
»Das ist auch vollkommen normal«, meinte Evi. »Das nennt man Verdrängen. Wenn Menschen einen großen Verlust erleiden, dann können sie das oft zuerst nicht ertragen. Manche Ärzte glauben, dass uns der Körper auf diese Weise vor zu viel Schmerz schützt. Auch wenn die Menschen im Kopf wissen, dass jemand, den sie lieben, tot ist, sagt ihr Herz ihnen etwas anderes. Es ist auch nicht ungewöhnlich, dass man den Menschen sogar sieht, den man verloren hat, dass man seine Stimme hört.«
Sie hielt einen Augenblick inne. Gillian hatte sich auf ihrem Sessel aufgerichtet. »Wirklich?«, fragte sie und beugte sich zu Evi vor. »Die Leute sehen und hören Tote?«
»Ja«, bekräftigte Evi. »Das kommt durchaus vor. Ist Ihnen das auch passiert? Haben Sie … sehen Sie Hayley?«
Langsam schüttelte Gillian den Kopf. »Ich sehe sie nie«, sagte sie. Einen Moment lang erwiderte sie Evis Blick. Und dann erschlaffte ihr Gesicht, sank in sich zusammen, als entweiche die Luft langsam aus einem Ballon. »Ich sehe sie nie«, wiederholte sie und griff abermals nach den Papiertaschentüchern. Die Schachtel fiel zu Boden, doch es gelang ihr, eine Handvoll Tücher festzuhalten. Sie presste sie gegen ihr Gesicht. Immer noch keine Tränen. Vielleicht waren sie alle aufgebraucht.
»Lassen Sie sich Zeit«, meinte Evi. »Sie müssen weinen. Lassen Sie sich so viel Zeit, wie Sie brauchen.«
Gillian weinte nicht, nicht wirklich, aber sie hielt sich die Papiertücher vors Gesicht und gestattete ihrem ausgetrockneten Körper zu schluchzen. Evi sah zu, wie der große Zeiger dreimal das Zifferblatt umrundete.
»Gillian«, sagte sie, als sie fand, dass sie der jungen Frau genug Zeit gegeben hatte. »Dr. Warrington hat mir erzählt, dass Sie immer noch jeden Tag mehrere Stunden auf dem Moor herumlaufen. Suchen Sie immer noch nach Hayley?«
Ohne aufzublicken, schüttelte Gillian den Kopf. »Ich weiß nicht, warum ich das mache«, murmelte sie in die Papiertücher hinein. »Ich krieg’ einfach so ein Gefühl im Kopf, und dann halte ich’s drinnen nicht mehr aus. Ich muss raus. Ich muss suchen.« Gillian hob den Kopf, und ihre blassgrauen Augen starrten Evi an. »Können Sie mir helfen?«, fragte sie und sah plötzlich viel jünger aus als ihre sechsundzwanzig Jahre.
»Ja, natürlich«, antwortete Evi rasch. »Ich verschreibe Ihnen ein paar Medikamente. Antidepressiva, damit Sie sich besser fühlen, und dann noch etwas, damit Sie nachts besser schlafen können. Das ist eine vorübergehende Maßnahme, um Ihnen zu helfen, diesen Kreislauf des Krankseins zu durchbrechen, verstehen Sie?«
Gillian starrte sie an wie ein Kind, das erleichtert ist, dass endlich ein Erwachsener die Dinge in die Hand genommen hat.
»Sehen Sie, der Schmerz, den Sie empfinden, hat Ihren Körper krank gemacht«, fuhr Evi fort. »Seit drei Jahren schlafen oder essen Sie jetzt nicht mehr richtig. Sie trinken zu viel, und Sie überanstrengen sich bei diesen langen Märschen auf dem Moor.«
Gillian blinzelte zweimal. Ihre Augen sahen rot und wund aus.
»Wenn Sie sich tagsüber ein bisschen besser fühlen und nachts richtig schlafen, dann können Sie auch etwas gegen das Trinken unternehmen«, erklärte Evi weiter. »Ich kann Sie an eine Therapiegruppe überweisen. Die helfen Ihnen, die ersten Wochen zu überstehen. Wäre das eine Idee?«
Gillian nickte.
»Wir werden uns jede Woche hier sehen, so lange, wie es nötig ist«, sagte Evi. »Wenn Sie allmählich besser mit sich klarkommen, wenn Sie das Gefühl haben, Sie haben den Schmerz im Griff, dann müssen wir daran arbeiten, Ihnen zu helfen, sich an Ihr Leben zu gewöhnen, so wie es jetzt ist.«
Gillians Augen waren trübe geworden. Sie zog die Brauen hoch.
»Bevor das alles passiert ist«, erklärte Evi, »waren Sie Ehefrau und Mutter. Jetzt ist Ihre Situation vollkommen anders. Ich weiß, das klingt krass, aber es ist eine Realität, der wir uns zusammen stellen müssen. Hayley wird immer ein Teil Ihres Lebens sein. Aber im Augenblick ist sie – ihr Verlust – Ihr ganzes Leben. Sie müssen dieses Leben neu aufbauen und gleichzeitig einen Platz für Ihre Tochter finden.«
Schweigen. Die Papiertücher waren zu Boden gefallen, und Gillian hatte die Arme fest vor dem Körper verschränkt. Das war nicht die Reaktion, auf die Evi gehofft hatte.
»Gillian?«
»Sie finden mich bestimmt total ätzend, weil ich das sage.« Gillian fing an, den Kopf zu schütteln. »Aber manchmal wünsche ich mir …«
»Was wünschen Sie sich?«, fragte Evi, und ihr wurde klar, dass sie zum ersten Mal, seit sie Gillian begegnet war, wirklich nicht wusste, was die junge Frau antworten würde.
»Dass sie mich einfach in Frieden lassen würde.«
3
Das schlafende Kind hatte weiches helles Haar von einer Farbe wie Zuckerwatte. Die Kleine lag in ihrem Wagen und schlief tief und fest im Sonnenschein. Ein feinmaschiges Netz war von oben bis unten über den Wagen gespannt, um sie vor Insekten zu schützen und vor allem anderen, was sonst noch im Garten umherhuschen mochte. Eine feuchte Locke klebte an ihrer runden Wange. Die Faust hatte sie gegen den Mund gedrückt, der Daumen ragte im rechten Winkel daraus hervor. Als hätte sie beim Einschlafen am Daumen gelutscht und irgendein Gedanke im Schlaf habe sie dazu veranlasst, ihn auszuspucken. Ihr Bäuchlein hob und senkte sich, hob und senkte sich.
Ungefähr zwei Jahre alt. Die Beinchen noch pummelig genug, um unsicher dahinzustapfen, die Lippen begannen gerade, Worte zu formen. In ihren Augen würde, wenn sie offen waren, die vertrauensselige Unschuld einer frisch geschaffenen Person liegen. Sie hatte noch nicht gelernt, dass Menschen einem wehtun konnten.
Eine Speichelblase hatte sich zwischen ihren winzigen rosigen Lippen gebildet. Sie verschwand und bildete sich dann erneut. Das Kind seufzte, und die Blase platzte. Und das Geräusch schien durch den stillen Septembervormittag zu treiben.
»Ah, da da da«, murmelte das kleine Mädchen im Schlaf.
Sie war einfach wunderschön. Genau wie die anderen.
4
Joe sprang auf und rannte los. Ohne nachzudenken folgte Tom ihm, und die beiden Jungen sausten die Stufen hinauf und durch die offene Kirchentür. Tom erhaschte einen flüchtigen Blick auf den hellhaarigen Mann vor ihnen, der auf den Altar zuging, und dann hechtete Joe hinter die hinterste Kirchenbank. Tom tat es ihm nach.
Die Steinplatten, die den Boden bedeckten, waren staubig. Unter den Kirchenbänken konnte Tom Spinnennetze sehen, manche unversehrt und vollkommen, andere zerrissen und mit den Leichen längst toter Fliegen verziert. Die mit Teppichstoff bezogenen Betkissen hingen ordentlich an Haken.
»Er betet«, flüsterte Joe, der über die Lehne der Bank spähte. Tom stemmte sich hoch. Der Mann mit den Shorts kniete vor den Altarstufen; seine Ellenbogen ruhten auf dem Geländer, und er schaute zu dem großen Buntglasfenster an der Vorderseite der Kirche empor. Es sah wirklich aus, als würde er beten.
Ein plötzliches Geräusch draußen ließ Tom herumfahren. Die Kirchentür war offen, und er sah ganz kurz eine Gestalt daran vorbeirennen. Jake und seine Gang waren immer noch da und warteten. Ein jähes Zerren zog ihn hinter die Banklehne hinab.
»Er hat was gehört«, hauchte Joe.
Tom glaubte zwar nicht, dass sie ein Geräusch gemacht hatten, doch er erschrak trotzdem. Wenn der Mann sie fand, würde er sie vielleicht hinausschicken, und dort lauerten Jake und die anderen. Joe hatte es riskiert, abermals den Kopf zu heben. Tom tat es ihm nach. Der Mann mit den Shorts hatte sich nicht von der Stelle gerührt, doch er betete nicht mehr, so viel war klar. Sein Kopf war aufgerichtet, und sein Körper hatte sich versteift. Er lauschte. Dann stand er auf und drehte sich um. Joe und Tom duckten sich so schnell, dass sie mit den Köpfen zusammenstießen. Jetzt waren sie geliefert. Sie waren ohne Erlaubnis in der Kirche, und wenn man so wollte, hatten sie ein Fenster kaputt gemacht.
»Ist da wer?«, rief der Mann. Er klang verwundert, aber nicht verärgert. »Hallo«, rief er. Seine Stimme trug mit Leichtigkeit bis in den hinteren Teil der Kirche.
Tom versuchte aufzustehen. »Nein!«, zischte sein Bruder und klammerte sich an ihn. »Er meint doch gar nicht uns!«
»Natürlich meint er uns«, zischte Tom zurück. »Sonst ist doch niemand hier.«
Joe antwortete nicht, sondern hob nur ganz vorsichtig den Kopf, wie ein Soldat, der über eine Brustwehr späht. Dann schaute er nach unten und bedeutete Tom mit einem Nicken, es ihm gleichzutun. Der Mann mit den Shorts ging langsam auf eine Tür rechts vom Altar zu. Er griff nach der Klinke und zog sie auf. Dann blieb er im Türrahmen stehen und schaute in den Raum dahinter.
»Ich weiß, dass jemand da drin ist«, rief er, wie ein Vater beim Versteckspielen. Er stammte aus dem Norden, aber nicht aus Lancashire oder aus Yorkshire gleich jenseits der Grenze. Noch weiter nördlich, tippte Tom. Vielleicht aus Newcastle.
Tom hob die Hände und machte sein Was ist denn jetzt los?-Gesicht. Es waren drei Personen in der Kirche, und sie beide waren zwei davon.
»Willst du nicht rauskommen und Guten Tag sagen?« Es sollte so klingen, als wäre dem Mann das Ganze völlig egal, das wusste Tom. Doch es klappte nicht ganz. Der Mann war nervös. »Ich muss gleich abschließen«, fuhr er fort, »und das geht wirklich nicht, wenn sich einer hier versteckt.« Dann fuhr er auf dem Absatz herum. »So langsam ist das kein Witz mehr«, knurrte er, als er rasch auf die andere Seite der Kirche hinüberging und hinter der Orgel verschwand. Das war die Chance für die Jungen. Tom zerrte an Joes Arm, und sie traten genau in dem Moment in den Mittelgang hinaus, als Billy Aspin in der Eingangstür erschien und sie angrinste. Tom schnappte sich Joe und zerrte ihn abermals hinter die Kirchenbank.
»Hallo«, sagte eine Stimme über ihren Köpfen. Der Mann mit den Shorts stand in der Kirchenbank vor der ihren und schaute auf sie herab.
»Hi«, antwortete Joe, »haben Sie sie gefunden?«
Der Mann runzelte die Stirn. »Wie seid ihr beide aus der Sakristei erst hinter die Orgel und dann wieder hier nach hinten gekommen, ohne dass ich euch gesehen habe?«, fragte er.
»Wir waren die ganze Zeit hier«, sagte Tom.
»Wir haben gesehen, wie Sie gebetet haben«, fügte Joe mit einer Stimme hinzu, die er vielleicht benutzt hätte, wenn er gesehen hätte, wie jemand hinter den Altar pinkelte.
»Ach ja?«, fragte der Mann mit den Shorts. »Wo wohnt ihr zwei denn?«
Tom überlegte einen Augenblick, ob sie wohl damit durchkommen könnten, ihm das nicht zu sagen. Der Mann stand zwischen den Jungen und der Tür, aber wenn Tom schnell um ihn herumflitzte –
»Gleich nebenan«, verkündete Joe. »In dem neuen Haus«, setzte er hinzu, als hätte er das noch nicht klar zum Ausdruck gebracht.
Der Mann nickte. »Ich muss abschließen«, sagte er und trat auf den Mittelgang hinaus. »Kommt.«
»Wie kommt’s denn, dass Sie einen Schlüssel haben?«, wollte Joe wissen, der sich zu weit von Tom entfernt hatte, als dass der ihn hätte anstupsen können. »Nur der Vikar darf einen Schlüssel haben. Hat er ihn Ihnen gegeben?«
»Der Erzdiakon hat ihn mir gegeben. Okay, bevor ich abschließe, sind noch mehr von euch da drin?«
»Da können gar nicht noch mehr drin sein«, versicherte Tom. »Wir sind gleich hinter Ihnen reingekommen. Wir haben, äh, mit ein paar Jungs draußen Verstecken gespielt. Niemand ist uns nachgekommen.«
Der Mann mit den Shorts nickte. »Okay«, meinte er. »Dann mal raus hier.«
Er winkte in Richtung Tür, was bedeutete, dass Tom und Joe vorgehen sollten. Tom setzte sich in Bewegung. So weit, so gut. Jake und die anderen würden sie in Ruhe lassen, wenn er und Joe mit einem Erwachsenen auftauchten. Und der Mann hatte gar nicht bemerkt, dass das Fenster –
»Tom, dein Ball!«, rief Joe, während er nach einer Seite davonschoss. Tom schloss die Augen und führte seinerseits ein Privatgespräch mit Gott, darüber, ob kleine Brüder denn wirklich unbedingt notwendig seien.
Als er die Augen wieder aufmachte, hatte Joe den Ball zwischen den Scherben aufgelesen, und die Augenbrauen des Mannes mit den Shorts waren in seinem Haar verschwunden. Er streckte die Hand nach dem Ball aus. Tom öffnete den Mund und machte ihn dann wieder zu. Es hatte ja doch keinen Sinn.
»Wer ist der Junge mit dem rasierten Schädel?«, erkundigte sich der Mann. »Der, der auf der Mauer gestanden hat, als ich angekommen bin?«
»Jake Knowles«, sagte Joe. »Er ist in Toms Klasse. Der macht ständig Ärger. Die haben mit Zwillen Steine auf uns geschossen, und dann hat er Toms Schläger geklaut.«
»Tatsächlich?«
»Die warten draußen auf uns.«
»Ach ja?«
»Die wollen uns verdreschen, wenn wir rauskommen. Das sind Volltrottel.«
»Wie heißt du?«, wollte der Mann mit den Shorts wissen, und Tom versuchte gar nicht erst, Joe mit einem Zeichen zu verstehen zu geben, dass es wirklich keine gute Idee –
»Joe Fletcher«, antwortete Joe. »Und er heißt Tom. Ich bin sechs, und er ist zehn, und Millie ist zwei, und mein Dad ist sechsunddreißig, und Mum –«
»Lass gut sein, Kumpel.« Der Mann mit den Shorts sah aus, als fände er Joe ungemein amüsant. Der sollte mal versuchen, mit ihm zusammenzuwohnen. »Kommt, lasst uns den Laden hier dichtmachen.«
5
Evi stand am Fenster, atmete tief durch und wartete darauf, dass die Kombination aus Paracetamol und Ibuprofen zu wirken begann. Ihr Praxisraum befand sich im dritten Stock, und vom Fenster aus konnte man die Notaufnahme des Krankenhauses sehen. Ein Krankenwagen fuhr vor, und ein Rettungshelfer sprang heraus, gefolgt von dem Fahrer. Sie öffneten die Türen und machten sich daran, den Rollstuhllift in Position zu bringen.
Einatmen, ausatmen. Die Medikamente würden wirken, sie wirkten immer. An manchen Tagen schien es nur ein wenig länger zu dauern. Auf der anderen Seite der Straße war ein Einkaufszentrum. Auf dem Parkplatz des Supermarktes war bereits eine Menge los. Freitagvormittag. Die Leute deckten sich fürs Wochenende ein. Evi schloss einen Moment die Augen, dann hob sie den Kopf, schaute über Dächer und Büroblocks hinweg in die Ferne. Die Großstadt, in der sie an den meisten Tagen arbeitete, war entlang eines breiten Tals erbaut worden. Moorlandschaft erstreckte sich zu beiden Seiten hangaufwärts. Ein Vogel, der von ihrem Fenstersims aufflog, könnte geradewegs zur nächsten Hügelkuppe fliegen, ungefähr sieben oder acht Kilometer entfernt. Von dort aus könnte er auf das Moor hinabblicken, wo Gillian Royle noch immer den größten Teil ihrer Tage verbrachte. Evi wandte sich wieder ihrem Schreibtisch zu. Vor ihrem nächsten Patienten hatte sie noch eine Viertelstunde Zeit.
Das Behandlungsprotokoll ihrer Sitzung mit Gillian hatte sie bereits geschrieben, bevor sie die Schmerzmittel genommen hatte. Sie versuchte, den Abstand dazwischen jeden Tag um fünf Minuten zu vergrößern. Wieder an ihrem Schreibtisch, googelte sie die Website des Lancashire Telegraph. Es dauerte nicht lange, den Artikel zu finden, den sie suchte.
Der Ort Heptonclough steht nach dem Brand eines Cottage in der Wite Lane vor drei Tagen noch immer unter Schock. Stanley Hargreaves, ein Anwohner, sagte, er habe noch nie ein Feuer derart wüten sehen. »Keiner von uns ist da rangekommen«, erklärte er dem Reporter des Telegraph. »Wir hätten die Kleine gerettet, wenn wir gekonnt hätten.«
In dem Artikel hieß es, dass die Feuerwehr noch immer Beweise sichte, jedoch der Ansicht sei, dass eine versehentlich angelassene Flamme am Gasherd den Brand verursacht haben könnte. Neben dem Herd stehende Ölflaschen hätten wie Brandbeschleuniger gewirkt. Das steinerne Cottage, eines der älteren Gebäude von Heptonclough, lag etwas abseits, und als das Feuer bemerkt wurde, war es viel zu spät, um der Flammen Herr zu werden. Der Telegraph-Artikel schloss mit den Sätzen:
Barry Robinson, 14, der als Babysitter für die Familie tätig war, liegt gegenwärtig im Burnley General Hospital, nachdem er von Einsatzkräften der Feuerwehr bewusstlos im Garten aufgefunden worden war. Die Ärzte gehen davon aus, dass er sich vollständig von seiner Rauchvergiftung erholen wird. Laut seinen Eltern kann er sich nicht erinnern, das Feuer entdeckt oder das Haus verlassen zu haben.
Evis Telefon klingelte. Ihr nächster Patient war da.
6
»Wo wart ihr zwei denn? Millie und ich brüllen schon seit zehn Minuten nach euch.«
Die Frau auf der Türschwelle war nicht viel größer als ihr Ältester und sah selbst in einem weiten Hemd und Jeans aus, als würde sie auch nicht viel mehr wiegen. Sie hatte rotblondes Haar, das sich bis auf die Schultern lockte, und große, türkisgrüne Augen. Als ihr Blick von ihren Söhnen zu Harry hinaufwanderte, öffneten sie sich vor Überraschung ein wenig weiter.
»Hallo«, sagte sie.
»’lo«, sagte das pummelige kleine Mädchen, das auf der Hüfte ihrer Mutter saß und sich die Augen rieb, als sei sie gerade erst aufgewacht. Ihr Haar hatte genau denselben warmen rötlichen Blondton wie das ihrer Mutter. Tom, der ältere Junge, hatte dagegen sehr helles Haar, und das seines Bruders war von einem glänzenden, dunklen Rot. Allerdings hatten alle vier die gleichen blassen, sommersprossigen Gesichter.
»Hi«, sagte Harry und zwinkerte dem kleinen Mädchen zu, ehe er sich wieder der Mutter zuwandte. »Guten Tag«, fuhr er fort. »Entschuldigen Sie die Störung, aber ich habe die beiden hier in der Kirche gefunden; sie hatten sich da versteckt. Anscheinend hatten sie Ärger mit ein paar älteren Jungen, und ich dachte, ich bringe sie lieber sicher nach Hause.«
Jetzt furchte die Frau die Stirn und schaute von einem Jungen zum anderen. »Alles okay?«, wollte sie wissen.
»Die haben Steine auf uns geschossen, mit Zwillen, und dann sind sie weggerannt, als sie Harry gehört haben. Das ist Harry«, erklärte Joe. »Er hat in der Kirche gebetet. Wir haben ihn gesehen.«
»Na ja, dafür ist die Kirche ja wohl da«, meinte die Frau. »Nett, Sie kennenzulernen, Harry, und vielen Dank. Mein Name ist übrigens Alice Fletcher. Möchten Sie vielleicht … eine Tasse Kaffee? Ich gehe doch davon aus, dass Sie kein Psychopath sind? Weil, wenn doch, dann sollte ich Sie den Kaffee wohl lieber hier vor der Tür trinken lassen.«
»Ich bin Vikar«, erwiderte Harry, der fühlte, wie sein Gesicht glühte, wie meistens, wenn er sich einer hübschen Frau gegenübersah. »Wir sind normalerweise keine Psychopathen«, setzte er hinzu. »Der Erzbischof hält nicht viel von so was.«
»Vikar?«, fragte Alice. »Sie meinen, unser Vikar? Der neue?«
»So ist es.«
»Sie können gar kein Vikar sein«, wandte Joe ein.
»Warum denn nicht?«
»Vikare haben keine Shorts an«, ließ Joe ihn wissen. »Und die sind auch echt alt. Wie Opas.«
Harry grinste. »Na ja, an der Sache mit den Shorts kann ich wahrscheinlich was drehen. Den Rest muss ich wohl dem Lauf der Zeit überlassen. Müssen Vikare ihren Kaffee draußen vor der Tür trinken?«
Auch Alice hatte Harry angestarrt, als könne sie es nicht recht glauben, doch sie war ein bisschen höflicher als ihr jüngster Sohn. Rasch machte sie einen Schritt zurück, so dass Harry und die Jungen eintreten konnten. Sie schloss die Tür hinter ihnen, während Joe und Tom den Flur entlang vorausgingen und dabei ihre Turnschuhe von sich kickten.
»Was ist ein Psychopath?«, hörte Harry Joe flüstern, als die Jungen die Tür am Ende des Flurs aufstießen.
»Jake Knowles, wenn er mal erwachsen ist«, antwortete Tom und hob seinen Bruder hoch.
Alice und Harry folgten den beiden in die Küche, und Millie fing an zu zappeln und wollte abgesetzt werden. Sobald sie auf eigenen Beinen stand, tappte sie zu den Jungen hinüber. Joe, von Toms Armen umschlungen, hatte die Hände fest um eine große Keksdose gelegt.
»Kek, Kek«, sagte Millie und sah für so einen kleinen Floh erstaunlich listig aus.
Alice bedeutete Harry mit einer Geste, am Tisch Platz zu nehmen, ehe sie zum Wasserkessel hinüberging und ihn kurz prüfend schüttelte, ob Wasser darin war. Dann schaltete sie ihn ein. Auf dem Tisch standen noch die Überreste des Frühstücks; Teller und Besteck waren neben dem Spülbecken aufgestapelt.
»Sie sind nicht von hier«, stellte Alice fest, während sie Kaffee in einen Filter löffelte.
»Das müssen Sie gerade sagen«, gab Harry zurück. Bei ihrem Akzent musste er an Mint Juleps und duftgeschwängerte Luft denken, an so intensive Hitze, dass die Luft stofflich zu sein schien. »Lassen Sie mich raten. Texas?«
Bewegung hinter ihnen veranlasste ihn, sich nach den Kindern umzudrehen. Millie kaute an einem Ingwerplätzchen und beäugte interessiert einen Schokoladenkeks in Joes Hand.
»Knapp daneben. Ich bin aus Tennessee, aus Memphis«, sagte Alice und deutete auf die Zuckerschale. Harry schüttelte den Kopf. Zu seiner Rechten klemmte sich Joe ein Ende des Schokokekses zwischen die Lippen, ehe er sich bückte und Millie den Rest anbot. Sie schlug die Zähne hinein und begann zu mümmeln, gerade als Joe dasselbe tat. Am Ende küssten sie sich und brachen in wildes Gekicher aus.
»Das reicht jetzt, ihr drei. Bald gibt’s Mittagessen«, verkündete Alice, ohne sich umzudrehen. Harry sah, wie die beiden Jungen einen raschen Blick wechselten, ehe Joe sich drei Schokokekse und ein Ingwerplätzchen in die Tasche stopfte und hastig den Rückzug aus der Küche antrat. Millie, der ein Keks mit Vanillefüllung anvertraut worden war, stopfte diesen in den Ausschnitt ihres Kleides und tappte hinaus, während ihr ältester Bruder mit stolzem Lächeln zusah. Tom steckte sich gerade eine Handvoll Kekse in die eigenen Taschen, als er merkte, dass Harry ihn beobachtet hatte. Sein Gesicht wurde um eine Schattierung rosiger, während sein Blick zwischen dem Besuch und seiner Mutter hin und her zuckte.
»Wir gehen nur ins Wohnzimmer«, verkündete er.
»Okay, aber zuerst her mit den Keksen.« Alice streckte die Hand aus. Tom warf einen letzten Blick zu Harry hinüber – der zuckte mitfühlend die Schultern –, ehe er seine Beute herausrückte und hinausschlich.
Einen Augenblick war alles still. Ohne die Kinder wirkte der Raum zu leer. Alice stellte Becher, die Zuckerschale und eine Milchflasche auf den Tisch und legte Löffel zurecht.
»Wohnen Sie schon lange hier?«, erkundigte sich Harry. Er wusste, dass das nicht sein konnte. Das Haus war unverkennbar neu.
»Seit drei Monaten«, sagte Alice. Sie wandte sich ab und fing an, schmutzige Teller und Schalen in die Spülmaschine zu stellen.
»Schon gut eingelebt?«, erkundigte sich Harry.
Nachdem die Spülmaschine eingeräumt war, bückte Alice sich zu einem Schrank unter dem Spülbecken und holte einen Lappen und Desinfektionsspray hervor. Sie spülte den Lappen unter dem Hahn aus und machte sich dann daran, die Arbeitsplatte abzuwischen. Harry fragte sich, ob seine Anwesenheit wohl unerwünscht war, trotz des angebotenen Kaffees.
»So etwas dauert wohl eine Weile«, antwortete Alice nach einem Augenblick. Sie brachte den Kaffee zum Tisch und setzte sich. »Werden Sie hier im Ort wohnen?«
Harry schüttelte den Kopf. »Nein, das Pfarrhaus liegt ein Stück den Hügel runter. In Goodshaw Bridge. Ich bin für drei Gemeinden zuständig; dies hier ist die kleinste. Und wahrscheinlich die größte Herausforderung, wenn man bedenkt, dass hier seit mehreren Jahren keine Gottesdienste mehr stattgefunden haben. Was meinen Sie, werden die Eingeborenen sich als friedlich erweisen?«
Wieder eine Pause. Diesmal definitiv unbehaglich. Alice schenkte Kaffee ein und schob Harry die Milch hin.
»Dann wird die Kirche also wieder aufgemacht«, meinte sie, nachdem er sich bedient hatte. »Das ist wohl gut für den Ort. Wir gehen eigentlich nicht oft in die Kirche, aber wir sollten uns wohl die Mühe machen, wo wir doch so dicht dran wohnen. Wann machen Sie denn auf?«
»Erst in ein paar Wochen«, erwiderte Harry. »Nächsten Donnerstag werde ich offiziell in das Benefizium eingesetzt, in der St. Mary’s Church in Goodshaw Bridge. Es wäre toll, wenn Sie und Ihre Familie zu dem Gottesdienst kämen.«
Alice nickte vage und verstummte abermals. Allmählich fühlte Harry sich entschieden unwohl. Dann gab Alice sich anscheinend einen Ruck. »Es hat hier im Ort ziemlichen Widerstand dagegen gegeben, dass wir herziehen«, sagte sie und lehnte sich vom Tisch weg. »Dieses Haus war seit zwanzig Jahren der erste Neubau im Ort. Der größte Teil des Grund und Bodens und viele von den Häusern im Dorf gehören der Familie Renshaw, und die scheint wohl darüber bestimmen zu können, wer in Heptonclough wohnen darf und wer nicht.«
Von irgendwoher im Haus waren laute Stimmen zu vernehmen und dann ein hohes Aufquietschen von Millie.
»Mein Kirchenvorsteher hier ist ein Mann namens Renshaw«, meinte Harry. »Er war in der Kommission, vor der ich mich beworben habe.«
Alice nickte. »Das war Sinclair«, sagte sie. »Er wohnt mit seiner ältesten Tochter und seinem Vater in dem großen Haus auf der anderen Seite des Kirchengeländes. Der alte Mr. Tobias ist neulich vorbeigekommen und zum Kaffee geblieben. War anscheinend ganz hin und weg von den Kindern. Jenny, die jüngere Tochter, hat sich mir vor ein paar Wochen im Postamt vorgestellt und gesagt, sie würde mal vorbeischauen. Wie gesagt, so etwas braucht Zeit.«
Noch mehr Gekicher aus dem Nebenzimmer.
»Ist das Ihr Mann?«, erkundigte sich Harry und zeigte auf ein Foto auf dem Fensterbrett hinter ihr. Darauf war ein gutaussehender Mann zu sehen, Mitte dreißig, den Cowboyhut auf dem dunklen Haar nach hinten geschoben. Er trug ein blaues Polohemd von derselben Farbe wie seine Augen.
Alice nickte. »Das hier war jahrelang sein Traum«, meinte sie. »Ein eigenes Haus zu bauen, in einer Gegend wie dieser. Hühner zu halten, einen Gemüsegarten zu haben. Natürlich ist er die meiste Zeit nicht –«
Sie wurde von einem lauten Klopfen an der Haustür unterbrochen. Mit einer gemurmelten Entschuldigung verließ sie die Küche. Harry schaute auf die Uhr. Er hörte das leise Tap, Tap, Tap winziger Füße, und gleich darauf erschien Millie wieder in der Küche und zog eine leuchtend rote Ente an einem Stock hinter sich her. Sie begann den Tisch zu umkreisen, als er hörte, wie Alice die Tür öffnete. Entschlossen trank er einen letzten großen Schluck Kaffee und stand auf. Er musste wirklich los.
»Alice, hi. Ich wollte schon seit einer Ewigkeit mal vorbeischauen. Störe ich?« Die Stimme der Frau war hell und klar, ohne den leisesten Akzent. Noch ehe er die Küchentür erreicht hatte und den Flur hinunterschauen konnte, wusste er, dass sie jung sein musste und eine Privatschule besucht hatte. Und wahrscheinlich recht schön war, vielleicht mit der Andeutung eines Pferdegesichts. Sie stand direkt in der Haustür. Alles richtig getippt.
»Haben Sie und Gareth nächsten Freitag zufällig Zeit?«, fragte sie Alice gerade. »Wir haben ein paar Leute zum Abendessen eingeladen.«
Ihr blondes Haar wies zu viele Schattierungen und helle Strähnen auf, um irgendetwas anderes als natürlichen Ursprungs zu sein. Es fiel ihr bis auf die Schultern und wurde von einer teuren Sonnenbrille zurückgehalten. Sie hatte das Gesicht einer Alabasterstatue. Neben ihr sah die kleine, hübsche Alice aus wie eine Puppe.
»Es wäre toll, wenn Sie auch kommen könnten«, beteuerte sie und setzte eine flehende Miene auf, doch es war offenkundig, dass sie nicht mit einer Ablehnung rechnete.
Als Harry den Flur hinunterging, bereit, sich zu entschuldigen und zu gehen, tauchten die Jungen aus einem der Zimmer auf.
Der Neuankömmling trug Jeans und eine cremeweiße Leinenbluse. Es gelang ihr, gleichzeitig leger und teuer auszusehen. Ehe Alice antworten konnte, erblickte sie Harry, und ihr Mund verzog sich belustigt. »Hi«, sagte sie, und Harry fühlte, wie sein Gesicht rot anlief.
»Jenny, das ist Harry. Unser neuer Vikar«, erklärte Alice. »Joe hat ihn bereits über die Bekleidungsvorschriften für Geistliche in dieser Gegend aufgeklärt. Harry, das ist Jenny Pickup. Sie und ihr Mann haben etwas außerhalb eine Farm.«
»Reverend Laycock?« Jenny streckte die Hand aus. »Wie wunderbar. Wir hatten Sie schon aufgegeben. Dad wartet schon seit mindestens einer Stunde auf Sie.«
Harry ergriff ihre Hand. »Dad?«
»Sinclair Renshaw«, antwortete sie, ließ seine Hand los und schob die ihren in die Hosentaschen. »Ihr Kirchenvorsteher. Wir wussten, dass Sie heute Vormittag hier ankommen. Wir dachten, Sie würden bei uns vorbeischauen.«
Wieder sah Harry auf die Uhr. Hatte er eine feste Absprache mit seinem Kirchenvorsteher gehabt? Seiner Meinung nach nicht. Er hatte lediglich eine Nachricht hinterlassen, dass er am frühen Vormittag eintreffen und sich die Kirche anschauen würde.
»Also, wenn man vom Teufel spricht«, fuhr Jenny fort und schaute durch die offene Haustür hinaus. »Hier ist er, Dad. Ich habe ihn gefunden.«
Harry, selbst über eins dreiundachtzig groß, musste hochschauen, um dem anderen Mann in die Augen zu sehen, als dieser über die Schwelle trat. Sinclair Renshaw war Ende sechzig. Sein dichtes weißes Haar fiel ihm in die Stirn und ließ von den dunklen Augenbrauen fast nichts mehr erkennen. Er hatte braune Augen, trug eine elegante Brille und war gekleidet wie ein englischer Gentleman aus einem Lifestyle-Magazin, in verschiedenen Grün-, Braun- und Beigetönen. Er nickte kurz Harry zu und wandte sich dann an Alice, die neben dem hochgewachsenen Duo aus Vater und Tochter winzig wirkte.
»Ich fürchte, es hat einen ernsten Fall von Vandalismus an der Kirche gegeben«, sagte er. Seine Worte waren an Alice gerichtet, doch er warf Harry einen raschen Blick zu. »Eins von den älteren Fenstern ist zerbrochen. Ich habe gehört, dass Ihre Söhne heute Morgen dort gesehen worden sind, Mrs. Fletcher. Dass sie mit einem Cricketschläger und einem Ball gespielt haben.«
»Baseball«, warf Joe hilfreich ein.
Alices Gesicht wurde starr, als sie sich umdrehte und Tom ansah. »Was ist passiert?«