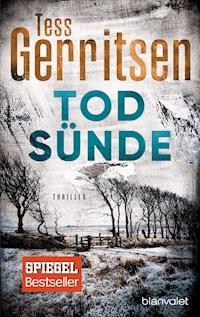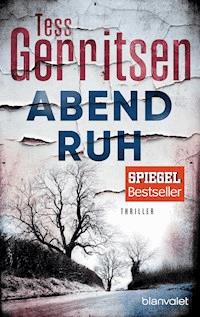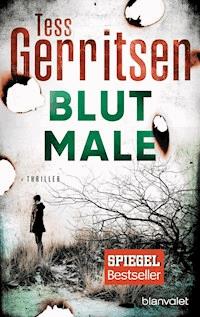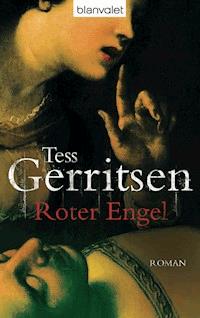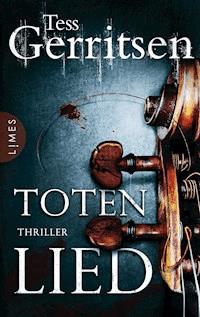9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Limes Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Rizzoli-&-Isles-Serie
- Sprache: Deutsch
Sie haben das Böse gesehen, und er lässt sie mit ihrem Blut zahlen.
In Boston wird die Leiche einer jungen Frau gefunden – in der offenen Handfläche liegen ihre Augäpfel. Die Verstümmelung geschah post mortem, die genaue Todesursache bleibt unklar. Kurze Zeit später taucht die Leiche eines Mannes auf – Pfeile ragen aus seinem Brustkorb, die ebenfalls erst nach seinem Tod dort platziert wurden. Beide wurden Opfer desselben Täters, ansonsten scheint es keine Verbindung zwischen ihnen zu geben. Jane Rizzoli steht vor einem Rätsel, bis eine Spur sie zu einem Jahrzehnte zurückliegenden Fall von Misshandlungen in einem katholischen Kinderhort führt ...
Verpassen Sie auch nicht »Spy Coast – Die Spionin« und »Die Sommergäste«, Tess Gerritsens brillante neue Thrillerreihe über eine Gruppe aus ehemaligen Spionen, die noch lange nicht zum alten Eisen gehören!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 514
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Buch
In Boston wird die Leiche einer jungen Frau gefunden – in der offenen Handfläche liegen ihre Augäpfel. Die Verstümmelung geschah post mortem, wie bei der Obduktion eindeutig festgestellt wird. Doch die genaue Todesursache bleibt unklar. Kurze Zeit später taucht die Leiche eines Mannes auf – Pfeile ragen aus seinem Brustkorb, die ebenfalls erst nach seinem Tod dort platziert wurden. Beide wurden Opfer desselben Täters, ansonsten scheint es keine Verbindung zwischen ihnen zu geben. Detective Jane Rizzoli von der Bostoner Polizei steht vor einem Rätsel, bis eine Spur sie zu einem Jahrzehnte zurückliegenden Fall von Misshandlungen in einem katholischen Kinderhort führt …
Autorin
So gekonnt wie Tess Gerritsen vereint niemand erzählerische Raffinesse mit medizinischer Detailgenauigkeit und psychologischer Glaubwürdigkeit der Figuren. Bevor sie mit dem Schreiben begann, war die Autorin selbst erfolgreiche Ärztin. Der internationale Durchbruch gelang ihr mit dem Thriller Die Chirurgin, und seither sind ihre Romane von den internationalen Bestsellerlisten nicht mehr wegzudenken. Tess Gerritsen lebt mit ihrer Familie in Maine.
Weitere Informationen unter: www.tess-gerritsen.de
Von Tess Gerritsen bereits erschienen Gute Nacht, Peggy Sue · Kalte Herzen · Roter Engel · Trügerische Ruhe · In der Schwebe · Leichenraub · Totenlied
Die Rizzoli-&-Isles-ThrillerDie Chirurgin · Der Meister · Todsünde · Schwesternmord · Scheintot · Blutmale · Grabkammer · Totengrund · Grabesstille · Abendruh · Der Schneeleopard · BlutzeugeBesuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvaletund www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Tess Gerritsen
Blutzeuge
Thriller
Deutsch von Andreas Jäger
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel »I Know a Secret« bei Ballantine Books, an imprint of Random House, a division of Penguin Random House LLC., New York. Copyright der Originalausgabe © 2017 by Tess Gerritsen Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2017 by Limes in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkterstr. 28, 81673 München Published by Arrangement with Tess Gerritsen Inc. Dieses Werk wurde im Auftrag der Jane Rotrosen Agency LLC vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen. Redaktion: Gerhard Seidl Umschlaggestaltung: © www.buerosued.deUmschlagmotiv: © Francesca Perticarini/Arcangel Images; plainpicture/Demurez Cover Arts/Gary Waters WR · Herstellung: sto Satz: Uhl + Massopust, Aalen ISBN 978-3-641-21157-8 V007 www.limes-verlag.de
Der göttlichen Ms. Margaret Ruley
1
Als ich sieben Jahre alt war, lernte ich, wie wichtig es ist, bei Beerdigungen zu weinen. Der Mann, der an jenem Sommertag im Sarg lag, war mein Großonkel Orson, der sich vor allem durch seine stinkigen Zigarren, seinen üblen Mundgeruch und sein ungeniertes Furzen unvergesslich gemacht hatte. Zu Lebzeiten hatte er mich mehr oder weniger ignoriert, so wie ich ihn, weshalb ich auch über seinen Tod keineswegs untröstlich war. Ich sah nicht ein, warum ich zu seiner Beerdigung gehen sollte, aber das gehört nun einmal nicht zu den Dingen, die eine Siebenjährige selbst entscheiden darf. Und so rutschte ich an jenem Tag unruhig auf meinem Platz in der Kirchenbank herum, schwitzte in meinem schwarzen Kleid und langweilte mich fürchterlich. Warum hatte ich nicht zu Hause bei Daddy bleiben können? Der hatte sich schließlich kategorisch geweigert mitzukommen. Daddy sagte, er wäre ein Heuchler, wenn er so täte, als ob er um einen Mann trauerte, den er in Wirklichkeit verachtet hatte. Ich wusste nicht, was das Wort Heuchler bedeutete, aber ich ahnte, dass auch ich keiner sein wollte. Trotzdem saß ich nun da, eingeklemmt zwischen meiner Mutter und Tante Sylvia, und musste die schier endlose Reihe von stumpfsinnigen Lobreden auf den so ganz und gar nicht bemerkenswerten Onkel Orson über mich ergehen lassen. Er war stolz auf seine Unabhängigkeit! Wie leidenschaftlich er sich seinen Hobbys gewidmet hat! Ein passionierter Briefmarkensammler!
Seinen Mundgeruch erwähnte niemand.
Während des nicht enden wollenden Trauergottesdienstes vertrieb ich mir die Zeit damit, die Köpfe der Leute in der Reihe vor uns zu studieren. Mir fiel auf, dass Tante Donnas Hut mit Schuppen übersät war, dass Onkel Charlie eingenickt und sein Toupet verrutscht war. Es sah aus, als ob eine braune Ratte von seinem Kopf herunterzukrabbeln versuchte. Da tat ich, was jedes normale siebenjährige Mädchen getan hätte.
Ich prustete los.
Sofort drehten sich alle Leute zu mir um und musterten mich streng. Meine Mutter wäre vor Scham am liebsten im Boden versunken. Sie bohrte mir fünf spitze Fingernägel in den Arm und zischte: »Sei still!«
»Aber seine Haare sind runtergerutscht! Die sehen aus wie eine Ratte!«
Ihre Nägel bohrten sich mir tiefer ins Fleisch. »Darüber reden wir später noch, Holly.«
Aber zu Hause wurde nicht darüber geredet. Stattdessen gab es eine Schimpftirade und eine Ohrfeige, und so lernte ich, wie man sich bei einer Beerdigung angemessen benimmt. Ich lernte, dass man ernst und still sein muss und dass manchmal Tränen erwartet werden.
Vier Jahre später, bei der Beerdigung meiner Mutter, achtete ich darauf, besonders laut zu schluchzen und reichlich Tränen zu vergießen, weil alle das von mir erwarteten.
Aber heute, bei der Beerdigung von Sarah Basterash, bin ich mir nicht sicher, ob irgendjemand von mir erwartet, dass ich weine. Es ist über zehn Jahre her, dass ich sie zuletzt gesehen habe – das Mädchen, das ich in der Schule als Sarah Byrne kannte. Wir standen uns nie sehr nahe, deshalb kann ich eigentlich nicht behaupten, dass ich um sie trauere. Tatsächlich bin ich nur aus Neugierde zu ihrer Beerdigung in Newport gekommen. Ich wollte wissen, wie sie gestorben ist. Ich muss wissen, wie sie gestorben ist.
So eine furchtbare Tragödie, höre ich die Leute in der Kirche murmeln. Ihr Mann war verreist, Sarah hatte etwas getrunken und war mit einer brennenden Kerze auf dem Nachttisch eingeschlafen. Das Feuer, das sie getötet hat, war ein tragischer Unfall. Zumindest behaupten das alle.
Ich will es gerne glauben.
Die kleine Kirche in Newport ist bis auf den letzten Platz gefüllt mit all den Freunden und Bekannten, die Sarah in ihrem kurzen Leben begleitet haben. Die meisten habe ich nie kennengelernt. Auch Kevin, ihren Mann, sehe ich heute zum ersten Mal. Unter glücklicheren Umständen wäre er ein ziemlich attraktiver Mann, ein Typ, der durchaus in mein Beuteschema fällt, aber heute wirkt er völlig aufgelöst. Ist es das, was Trauer mit einem macht?
Ich sehe mich in der Kirche um und erblicke in der Reihe hinter mir Kathy, eine alte Klassenkameradin aus der Highschool. Ihre Augen sind verquollen, die Wimperntusche vom Weinen verschmiert. Fast alle Frauen und viele der Männer weinen, weil jetzt eine Sopranistin das alte Quäkerlied »Simple Gifts« singt, das anscheinend eine unfehlbare Wirkung auf die Tränendrüsen hat. Dann treffen sich unsere Blicke – der ihre tränenverschleiert, der meine kühl und ungerührt. Seit der Highschool habe ich mich sehr verändert, und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie mich erkennt. Trotzdem starrt sie mich mit großen Augen an, als ob sie einem Geist begegnet wäre.
Ich drehe mich wieder nach vorn.
Als dann die letzten Töne von »Simple Gifts« verklingen, gelingt es sogar mir, ein paar Tränen zu vergießen.
Ich reihe mich in die lange Schlange von Trauergästen ein, die der Verstorbenen die letzte Ehre erweisen, und als ich an dem geschlossenen Sarg vorbeikomme, betrachte ich das Foto von Sarah auf der Staffelei. Sie war erst sechsundzwanzig, vier Jahre jünger als ich, und auf dem Foto sieht sie taufrisch aus, lächelnd und mit rosigen Wangen, genau die hübsche Blondine, die ich aus unserer Schulzeit in Erinnerung habe, als ich das Mädchen war, das von allen übersehen wurde, das Phantom, das immer ein wenig abseits stand. Und jetzt stehe ich hier, meine Haut immer noch warm und von Leben durchpulst, während Sarah, die hübsche kleine Sarah, nur noch ein Haufen verkohlte Knochen in einer Holzkiste ist. Ich bin mir sicher, dass alle hier das Gleiche denken, wenn sie das Bild der lebendigen Sarah betrachten – sie sehen das lächelnde Gesicht auf dem Foto und stellen sich dabei das verbrannte Fleisch vor, den schwarz verkohlten Schädel.
Die Schlange rückt vor, und ich spreche Kevin mein Beileid aus.
Er murmelt: »Danke, dass Sie gekommen sind.« Er hat keine Ahnung, wer ich bin oder woher ich Sarah kenne, aber er sieht meine tränenfeuchten Wangen und dankt mir mit einem Händedruck. Ich habe um seine tote Frau geweint, und das reicht, um diese Prüfung zu bestehen.
Ich trete aus der Kirche in den kalten Novemberwind und schreite zügig aus, denn ich möchte nicht, dass mir Kathy oder andere Bekannte aus meiner Kinderzeit auflauern. In alle den Jahren ist es mir stets gelungen, ihnen aus dem Weg zu gehen.
Oder vielleicht gehen sie mir aus dem Weg.
Es ist erst 14 Uhr, und obwohl mein Chef bei Booksmart Media mir den ganzen Tag freigegeben hat, überlege ich, ob ich nicht ins Büro zurückgehen und noch ein paar E-Mails und Telefonate erledigen soll. Ich arbeite als Agentin für ein Dutzend Autorinnen und Autoren, und ich habe Publicity-Auftritte zu organisieren, Druckfahnen zu verschicken und Werbetexte zu schreiben. Aber bevor ich mich auf den Weg zurück nach Boston mache, muss ich noch einen Zwischenstopp einlegen.
Ich fahre zu Sarahs Haus – oder vielmehr zu dem, was von dem Haus übrig ist. Jetzt sind da nur noch verbrannte Trümmerteile, verkohlte Balken und rußgeschwärzte Steine zu sehen. Der weiße Lattenzaun, der den Vorgarten umschloss, liegt zersplittert am Boden, plattgemacht von den Feuerwehrleuten, als sie ihre Schläuche und Leitern von der Straße herbeischleppten. Als die Löschfahrzeuge eintrafen, muss das Haus schon ein flammendes Inferno gewesen sein.
Ich steige aus und gehe auf die Ruine zu. Die Luft ist immer noch vom stechenden Rauchgeruch geschwängert. Als ich dort auf dem Gehweg stehe, kann ich den schwachen Schimmer eines Edelstahlkühlschranks ausmachen, der unter dem schwarzen Trümmerhaufen vergraben ist. Ich muss mich nur einmal in dieser edlen Wohngegend von Newport umsehen, um zu wissen, dass dies eine Luxusbleibe gewesen sein muss, und ich frage mich, in welcher Branche Sarahs Mann wohl arbeitet, oder ob seine Familie begütert ist. Ein Vorteil, den ich bestimmt nie hatte.
Ein Windstoß wirbelt welkes Laub um meine Füße, und das trockene Rascheln weckt Erinnerungen an einen anderen Herbsttag vor zwanzig Jahren, als ich zehn Jahre alt war und durch das dürre Laub in einem Wald stapfte. Dieser Tag wirft immer noch seinen Schatten über mein Leben, und er ist der Grund, weshalb ich heute hier stehe.
Ich blicke auf die improvisierte Gedenkstätte für Sarah, die hier entstanden ist. Die Menschen haben Blumen niedergelegt, und ich betrachte den Berg von verwelkten Rosen, Lilien und Nelken, dargebracht als letzten Gruß für eine Frau, die offensichtlich von vielen geliebt wurde. Plötzlich fällt mein Blick auf etwas Grünes, das nicht zu einem der Sträuße und Gestecke gehört, sondern über die anderen Blumen drapiert wurde wie ein nachträglicher Einfall.
Ein Palmzweig. Das Symbol der Märtyrer.
Es läuft mir eiskalt über den Rücken, und ich weiche zurück. Das Hämmern meines Herzens wird vom Motorgeräusch eines Autos übertönt. Ich drehe mich um und erblicke einen Streifenwagen der Polizei von Newport, der auf Schritttempo abbremst. Die Fenster sind geschlossen, und ich kann das Gesicht des Beamten nicht erkennen, doch ich weiß, dass er mich im Vorbeifahren lange und gründlich mustert. Ich wende mich ab und steige wieder in meinen Wagen.
Dort sitze ich eine Weile und warte, bis mein Herzschlag sich beruhigt hat und meine Hände nicht mehr zittern. Wieder fällt mein Blick auf die Ruine des Hauses, und wieder sehe ich die sechsjährige Sarah vor mir. Die hübsche kleine Sarah Byrne, wie sie im Schulbus auf dem Sitz vor mir herumhüpft. Damals waren wir zu fünft im Bus.
Jetzt sind nur noch vier von uns übrig.
»Mach’s gut, Sarah«, murmele ich. Dann starte ich den Wagen und fahre zurück nach Boston.
2
Auch Monster sind sterblich.
Die Frau, die auf der anderen Seite der Scheibe im Bett lag, mochte genauso menschlich aussehen wie all die anderen Patienten auf dieser Intensivstation, aber Dr. Maura Isles wusste nur zu gut, dass Amalthea Lank in der Tat ein Monster war. Dort, nur durch eine Glasscheibe von ihr getrennt, war die Kreatur, die Maura in ihren Albträumen verfolgte, die einen Schatten über Mauras Vergangenheit warf und deren Gesicht Mauras Zukunft vorhersagte.
Da liegt meine Mutter.
»Wir hatten gehört, dass Mrs. Lank eine Tochter hat, aber uns war nicht bewusst, dass Sie hier in Boston ganz in der Nähe wohnen«, sagte Dr. Wang.
Hörte sie da einen Anflug von Kritik in seiner Stimme? Warf er ihr etwa vor, dass sie ihre Tochterpflichten vernachlässigt und es versäumt hatte, ihre im Sterben liegende Mutter zu besuchen?
»Sie ist meine biologische Mutter«, sagte Maura, »aber ich war noch ein Säugling, als sie mich zur Adoption freigab. Ich habe erst vor ein paar Jahren von ihrer Existenz erfahren.«
»Aber Sie sind ihr schon einmal begegnet?«
»Ja, aber ich habe nicht mehr mit ihr gesprochen, seit …« Maura hielt inne. Seit ich mir geschworen habe, dass ich nichts mehr mit ihr zu tun haben will. »Ich wusste nicht, dass sie auf der Intensivstation liegt, bis die Schwester mich heute Nachmittag anrief.«
»Sie wurde vor zwei Tagen hier eingeliefert, nachdem sie Fieber bekommen hatte und ihre Leukozyten in den Keller gingen.«
»Wie niedrig sind sie?«
»Ihre Neutrophilen – das ist ein spezieller Typ von weißen Blutkörperchen – liegen gerade mal bei fünfhundert. Es sollten drei Mal so viele sein.«
»Ich nehme an, Sie haben eine empirische Antibiotikatherapie eingeleitet?« Sie sah das verblüffte Blinzeln ihres Gegenübers und fügte hinzu: »Entschuldigen Sie, Dr. Wang. Ich hätte Ihnen sagen sollen, dass ich Ärztin bin. Ich arbeite am rechtsmedizinischen Institut.«
»Oh, das wusste ich nicht.« Er räusperte sich und wechselte sofort zu dem technischen Jargon, der ihnen beiden als Mediziner vertraut war. »Ja, wir haben mit den Antibiotika begonnen, gleich nachdem wir Blutkulturen angelegt hatten. Ungefähr fünf Prozent der Patienten mit ihrem Chemotherapieschema entwickeln eine fiebrige Neutropenie.«
»Welche Chemo bekommt sie?«
»Folfirinox. Das ist eine Kombination von vier Medikamenten, darunter Fluoruracil und Leukovorin. Laut einer französischen Studie verlängert Folfirinox eindeutig die Lebenserwartung bei Patienten mit metastasierendem Pankreaskarzinom, aber wegen des Risikos von Fieberschüben müssen sie engmaschig überwacht werden. Zum Glück hatte die Gefängniskrankenschwester alles im Griff.« Er hielt inne und schien zu überlegen, wie er die heikle Frage formulieren sollte. »Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen, wenn ich Sie das frage …«
»Ja?«
Er wandte den Blick ab, offenbar war es ihm unangenehm, dieses Thema anzuschneiden. Es war viel einfacher, über Blutwerte, Antibiotikatherapien und wissenschaftliche Daten zu sprechen, denn Fakten waren weder gut noch böse; da gab es nichts zu bewerten oder zu verurteilen. »In Mrs. Lanks Krankenakte aus Framingham steht nicht, weshalb sie inhaftiert ist. Man hat uns lediglich darüber informiert, dass sie eine lebenslange Haftstrafe ohne Aussicht auf vorzeitige Entlassung verbüßt. Der Aufseher, der mit ihrer Bewachung betraut war, hat darauf bestanden, dass seine Gefangene stets mit Handschellen ans Bettgestell gefesselt sein muss, was mir ziemlich barbarisch erscheint.«
»Das ist nun mal Vorschrift, wenn Gefangene ins Krankenhaus eingeliefert werden.«
»Sie hat Bauchspeicheldrüsenkrebs im Endstadium, und jeder kann sehen, wie gebrechlich sie ist. Sie wird ganz bestimmt nicht aufspringen und davonlaufen. Aber der Aufseher sagte uns, sie sei wesentlich gefährlicher, als sie aussieht.«
»Das ist sie«, bestätigte Maura.
»Weswegen wurde sie verurteilt?«
»Mord. In mehreren Fällen.«
Er starrte Amalthea durch das Sichtfenster an. »Diese Dame?«
»Jetzt wissen Sie, wozu die Handschellen nötig sind. Und warum vor ihrem Zimmer eine Wache postiert ist.« Mauras Blick ging zu dem uniformierten Beamten, der neben der Tür saß und ihr Gespräch aufmerksam verfolgte.
»Es tut mir leid«, sagte Dr. Wang. »Es muss sehr schwierig für Sie sein zu wissen, dass Ihre Mutter …«
»Eine Mörderin ist? Oh ja.« Und Sie wissen noch nicht einmal das Schlimmste. Sie kennen den Rest meiner Familie nicht.
Durch die Scheibe beobachtete Maura, wie Amalthea langsam die Augen aufschlug. Ein knochiger Finger, dürr wie eine Teufelsklaue, winkte sie herbei, eine Geste, bei der es Maura eiskalt überlief. Ich sollte mich umdrehen und gehen, dachte sie. Amalthea hatte weder Mitleid noch Zuwendung verdient. Aber Maura konnte nicht leugnen, dass es eine Verbindung zwischen ihr und dieser Frau gab, eine Verbindung, die bis in ihre Moleküle hineinreichte. Amalthea Lank war ihre Mutter, wenn auch nur in genetischer Hinsicht.
Der Wachmann behielt Maura genau im Auge, als sie Schutzkittel und Maske anlegte. Dies würde kein privater Besuch werden – der Aufseher würde jeden Blick registrieren, den sie tauschten, jede Geste; und die unvermeidlichen Gerüchte würden mit Sicherheit im Krankenhaus die Runde machen. Dr. Maura Isles, die Rechtsmedizinerin aus Boston, deren Skalpell zahllose Leichen aufgeschnitten hatte und die regelmäßig dort auftauchte, wo der Sensenmann Ernte gehalten hatte – diese Dr. Isles war die Tochter einer Serienmörderin. Der Tod war ihr Familiengeschäft.
Mit Augen so schwarz wie Obsidian blickte Amalthea zu Maura auf. Ein leises Zischen kam von ihrer Sauerstoffnasenbrille, und der Monitor über dem Bett zeichnete piepsend ihren Herzrhythmus auf. Der Beweis, dass selbst eine eiskalte Killerin wie Amalthea ein Herz hatte.
»Du kommst mich doch noch besuchen«, flüsterte Amalthea. »Nachdem du geschworen hast, dass du das niemals tun würdest.«
»Man hat mir gesagt, du seist schwer krank. Es ist vielleicht unsere letzte Gelegenheit für eine Aussprache, und ich wollte dich sehen, solange es noch möglich ist.«
»Weil du etwas von mir brauchst?«
Maura schüttelte ungläubig den Kopf. »Was sollte ich von dir brauchen?«
»Das ist nun einmal der Lauf der Welt. Jedes vernünftige Wesen sucht seinen Vorteil. Alles, was wir tun, tun wir aus Eigennutz.«
»Das gilt vielleicht für dich. Aber nicht für mich.«
»Warum bist du dann gekommen?«
»Weil du im Sterben liegst. Weil du mir immer wieder geschrieben und mich gebeten hast, dich zu besuchen. Weil ich mir einbilde, dass ich nicht ganz ohne Mitgefühl bin.«
»Im Gegensatz zu mir.«
»Was glaubst du, warum du mit Handschellen an dieses Bett gefesselt bist?«
Amalthea verzog das Gesicht, schloss die Augen und presste die Lippen zusammen, als ein jäher Schmerz sie durchzuckte. »Ich nehme an, dass ich das verdient habe«, murmelte sie. Schweiß glänzte auf ihrer Oberlippe, und einen Moment lang lag sie vollkommen reglos da, als ob jede Bewegung, jeder Atemzug eine unerträgliche Qual bedeutete. Als Maura sie das letzte Mal gesehen hatte, war Amaltheas schwarzes Haar dicht und von zahlreichen silbergrauen Strähnen durchsetzt gewesen. Jetzt verloren sich nur noch einige wenige Büschel auf ihrem Schädel, die letzten Überlebenden eines brutalen Chemotherapiezyklus. Das Fleisch an ihren Schläfen hatte sich zurückgebildet, und die Haut hing wie ein zusammengefallenes Zelt über den spitzen Knochen ihres Gesichts.
»Du siehst aus, als ob du Schmerzen hättest. Brauchst du Morphium?«, fragte Maura. »Ich rufe die Schwester.«
»Nein.« Amalthea ließ langsam die angehaltene Luft entweichen. »Noch nicht. Ich muss wach sein. Ich muss mit dir reden.«
»Worüber?«
»Über dich, Maura. Darüber, wer du bist.«
»Ich weiß, wer ich bin.«
»Weißt du das wirklich?« Amaltheas Augen waren dunkel und unergründlich. »Du bist meine Tochter. Das kannst du nicht leugnen.«
»Aber ich bin völlig anders als du.«
»Weil du von dem netten und anständigen Ehepaar Isles in San Francisco aufgezogen wurdest? Weil du auf die besten Schulen und Universitäten gegangen bist? Weil du im Namen von Wahrheit und Gerechtigkeit arbeitest?«
»Weil ich nicht zwei Dutzend Frauen abgeschlachtet habe. Oder waren es mehr? Gab es noch weitere Opfer, die auf der Liste deiner Verbrechen nicht vermerkt waren?«
»Das ist alles in der Vergangenheit passiert. Ich will über die Zukunft reden.«
»Wozu soll das gut sein? Du wirst nicht mehr da sein.« Es war eine herzlose Bemerkung, aber Maura war nun einmal nicht in gnädiger Stimmung. Plötzlich kam sie sich manipuliert vor, hergelockt von einer Frau, die genau wusste, welche Knöpfe sie drücken musste. Über Monate hinweg hatte Amalthea ihr Briefe geschickt. Ich habe Krebs im Endstadium. Ich bin Deine einzige Blutsverwandte. Das wird Deine letzte Gelegenheit sein, Abschied zu nehmen. Nur wenige Worte waren wirkungsvoller als diese: die letzte Gelegenheit. Wenn sie diese Chance verstreichen ließe, würde sie es vielleicht bis an ihr Lebensende bedauern.
»Ja, ich werde tot sein«, sagte Amalthea nüchtern. »Und du wirst dich weiter fragen müssen, wer deine Leute sind.«
»Meine Leute?« Maura lachte. »Das klingt ja, als ob wir irgendein Stamm wären.«
»Das sind wir. Wir gehören zu einem Stamm, der von den Toten profitiert. Dein Vater und ich haben es getan. Dein Bruder hat es getan. Und ist es nicht ironisch, dass du es auch tust? Frag dich doch einmal, Maura, warum du diesen Beruf gewählt hast. Eine so sonderbare Art, sein Geld zu verdienen. Warum bist du nicht Lehrerin oder Bankerin geworden? Was treibt dich dazu, Leichen aufzuschneiden?«
»Es geht mir um die Wissenschaft. Ich will verstehen, warum sie gestorben sind.«
»Natürlich. Die intellektuelle Antwort.«
»Gibt es eine bessere?«
»Es ist die Dunkelheit. Das ist es, was wir beide gemeinsam haben. Der Unterschied ist, dass ich keine Angst davor habe, im Gegensatz zu dir. Du gehst mit deiner Angst um, indem du sie mit Skalpellen aufschneidest in der Hoffnung, ihre Geheimnisse zu enthüllen. Aber das funktioniert nicht, oder? Es löst nicht dein grundsätzliches Problem.«
»Welches wäre?«
»Dass sie in dir ist. Die Dunkelheit ist ein Teil von dir.«
Maura sah ihrer Mutter in die Augen, und was sie dort sah, ließ ihre Kehle schlagartig austrocknen. Du lieber Gott, ich sehe mich selbst. Sie wich zurück. »Ich bin hier fertig. Du hast mich gebeten zu kommen, und ich bin gekommen. Schreib mir keine Briefe mehr, denn ich werde sie nicht beantworten.« Sie wandte sich ab. »Leb wohl, Amalthea.«
»Du bist nicht die Einzige, der ich schreibe.«
Maura hielt inne, die Hand schon an der Türklinke.
»Mir kommt so manches zu Ohren. Dinge, die du vielleicht wissen möchtest.« Sie schloss die Augen und seufzte. »Es scheint dich nicht zu interessieren, aber das wird es schon noch. Denn ihr werdet bald wieder eine finden.«
Eine was?
Maura war schon im Begriff hinauszugehen, doch etwas hielt sie noch zurück, und sie musste dagegen ankämpfen, sich wieder in das Gespräch hineinziehen zu lassen. Nicht antworten, dachte sie. Lass dich nicht von ihr in die Falle locken.
Es war ihr Handy, das sie rettete, als es sich mit seinem tiefen Brummen in ihrer Tasche meldete. Ohne sich noch einmal umzudrehen, ging sie aus dem Zimmer, riss sich die Gesichtsmaske herunter und tastete unter dem Schutzkittel nach dem Telefon. »Dr. Isles«, meldete sie sich.
»Ich hab ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk für dich«, sagte Detective Jane Rizzoli in einem forsch-fröhlichen Ton, der so gar nicht zu der Nachricht passte, die sie loswerden wollte. »Weiblich, weiß, sechsundzwanzig Jahre. Liegt tot im Bett, vollständig bekleidet.«
»Wo?«
»Wir sind im Leather District. Es ist ein Loft in der Utica Street. Ich bin ja so gespannt, was du dazu sagen wirst.«
»Du sagst, sie liegt im Bett? In ihrem eigenen?«
»Genau. Ihr Vater hat sie gefunden.«
»Und es handelt sich eindeutig um ein Tötungsdelikt?«
»Kein Zweifel. Aber es ist das, was danach mit ihr passiert ist, was unseren guten Frost hier total fertigmacht.« Jane hielt inne und fügte leise hinzu: »Wenigstens hoffe ich, dass sie tot war, als es passierte.«
Durch das Sichtfenster konnte Maura sehen, dass Amalthea das Gespräch verfolgte, ihre Augen hellwach und interessiert. Kein Wunder – der Tod war schließlich ihr Familiengeschäft.
»Wie schnell kannst du hier sein?«, fragte Jane.
»Ich bin gerade in Framingham. Es könnte eine Weile dauern – kommt auf den Verkehr an.«
»Framingham? Was tust du denn da?«
Es war ein Thema, über das Maura lieber nicht sprechen wollte, ganz bestimmt nicht mit Jane. »Ich fahre jetzt los«, sagte sie nur und legte auf. Ihr Blick fiel auf ihre todkranke Mutter. Ich bin hier fertig, dachte sie. Jetzt muss ich dich nie wiedersehen.
Amaltheas Lippen verzogen sich zu einem Lächeln.
3
Es war schon dunkel, als Maura in Boston ankam. Ein schneidender Wind hatte die meisten Fußgänger in den Häusern Zuflucht nehmen lassen. Die schmale Utica Street war bereits mit Einsatzfahrzeugen zugestellt, also parkte sie um die Ecke und blieb noch eine Weile sitzen, um den Blick über die menschenleere Straße schweifen zu lassen. Die letzten Tage hatten zuerst Schnee gebracht, dann Tauwetter und schließlich diese bittere Kälte. Der Gehweg war mit einer tückisch glänzenden Eisschicht überzogen. Zeit, an die Arbeit zu gehen und Amalthea hinter mir zu lassen, dachte sie. Genau diesen Rat hatte Jane ihr schon vor Monaten gegeben: Besuch Amalthea nicht; denk nicht mal an sie. Soll sie doch im Gefängnis verrotten.
Jetzt ist es aus und überstanden, dachte Maura. Ich habe mich verabschiedet, und jetzt kann sie mir endlich nicht mehr in mein Leben hineinpfuschen.
Sie stieg aus ihrem Lexus. Sogleich erfasste der Wind den Saum ihres langen schwarzen Mantels, und die Kälte drang glatt durch den Stoff ihrer Wollhose. Sie ging so schnell, wie sie es auf dem vereisten Gehweg eben wagte, vorbei an einem Café und einem Reisebüro mit heruntergelassenen Rollläden, und bog um die Ecke in die Utica Street, die sich wie eine enge Schlucht zwischen den Lagerhäusern aus rotem Backstein hindurchzog. Früher war dies ein Viertel mit Gerbereien, Lederfabriken und Großhändlern gewesen, doch viele der Gebäude aus dem neunzehnten Jahrhundert waren in Loftwohnungen umgewandelt worden, und das einstige Industriegebiet war heute ein angesagtes Künstlerviertel.
Maura umkurvte einen Haufen Bauschutt, der die halbe Straße versperrte, und erblickte das flackernde Blaulicht eines Streifenwagens, wie ein unheilvolles Leuchtfeuer, das ihr den Weg wies. Durch die Windschutzscheibe konnte sie die Silhouetten der beiden Streifenbeamten sehen. Sie hatten den Motor laufen lassen, um den Wagen heizen zu können. Als Maura näher kam, wurde ein Fenster heruntergelassen.
»Hallo, Doc!« Der Polizist grinste sie an. »Sie haben die ganze Aufregung verpasst. Der Krankenwagen ist gerade weg.« Der Mann kam ihr bekannt vor, und er hatte sie offensichtlich erkannt, aber sie hatte keine Ahnung, wie er hieß – etwas, was nur allzu oft vorkam.
»Welche Aufregung?«, fragte sie.
»Rizzoli hat da drin mit einem Typen geredet, und da fasst er sich plötzlich an die Brust und kippt um. Vermutlich Herzinfarkt.«
»Lebt er noch?«
»Er hat noch gelebt, als sie ihn abtransportiert haben. Sie hätten hier sein sollen. Die hätten eine Ärztin gebrauchen können.«
»Falsches Fachgebiet.« Sie sah sich zum Gebäude um. »Ist Rizzoli noch drin?«
»Ja. Gehen Sie einfach die Treppe rauf. Ist wirklich ’ne hübsche Wohnung da oben. Da kann man sich schon wohlfühlen – das heißt, wenn man nicht tot ist.« Während die Scheibe hochfuhr, konnte sie die Polizisten über ihren eigenen Witz lachen hören. Ha-ha. Tatorthumor – stets beliebt, niemals witzig.
Sie blieb noch einen Moment im bitterkalten Wind stehen, um Schuhüberzieher und Handschuhe anzulegen, dann betrat sie das Gebäude. Als die Haustür hinter ihr ins Schloss fiel, blieb sie erschrocken stehen, konfrontiert mit dem Bild eines blutbespritzten Mädchens. An der Wand im Eingangsbereich hing wie ein makabres Willkommensschild das Plakat des Horrorfilms Carrie, eine Technicolor-Blutorgie, so platziert, dass man sie beim Eintreten unmöglich übersehen konnte. Eine ganze Galerie weiterer Filmplakate schmückte die Backsteinwand im Treppenhaus. Als Maura die Stufen erklomm, kam sie an Die Triffids – Pflanzen des Schreckens, Das Pendel des Todes, Die Vögel und Nacht der lebenden Toten vorbei.
»Da bist du ja endlich«, rief Jane vom oberen Treppenabsatz herunter. Sie wies auf Die Nacht der lebenden Toten. »Stell dir vor, du wirst jeden Abend beim Heimkommen von so einem fröhlichen Motiv begrüßt.«
»Diese Plakate sehen alle wie Originale aus. Mein Geschmack ist das nicht, aber sie sind vermutlich ziemlich wertvoll.«
»Komm rein, dann zeig ich dir noch etwas, was nicht nach deinem Geschmack ist. Also, nach meinem ganz bestimmt nicht.«
Maura folgte Jane in die Wohnung und blieb kurz stehen, um die wuchtigen freiliegenden Deckenbalken zu bewundern. Der Boden war noch mit den breiten Originaldielen aus Eiche ausgelegt, nunmehr auf Hochglanz poliert. Das ehemalige Lagerhaus war durch geschmackvolle Renovierung in ein atemberaubendes Loft mit Backsteinwänden umgewandelt worden – mit Sicherheit unerschwinglich für darbende Künstler.
»Viel schicker als meine Wohnung«, meinte Jane. »Ich würde sofort hier einziehen, aber dann würde ich als Erstes das grässliche Ding da von der Wand nehmen.« Sie deutete auf das riesenhafte rote Auge, das sie von einem weiteren Horrorfilm-Plakat anstarrte. »Hast du gesehen, wie der Film heißt?«
»I See You?«, fragte Maura.
»Merk dir den Titel. Er könnte noch wichtig sein«, sagte Jane mit ominösem Unterton. Sie führte Maura durch eine offene Küche, vorbei an einer Vase voller frischer Rosen und Lilien, ein frühlingshafter Akzent an diesem kalten Dezemberabend. Auf der Arbeitsplatte aus schwarzem Granit lag eine Karte von einem Blumengeschäft, beschriftet mit lila Tinte: Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Alles Liebe, Dad.
»Du sagtest, ihr Vater hat sie gefunden?«, fragte Maura.
»Genau. Ihm gehört das Gebäude. Er lässt sie mietfrei hier wohnen. Sie wollte sich heute mit ihrem Vater im Four Seasons zum Lunch treffen, um ihren Geburtstag zu feiern. Als sie nicht auftauchte und auch nicht ans Handy ging, ist er hierher gefahren, um nach ihr zu sehen. Er sagt, er habe die Haustür unverschlossen vorgefunden, aber ansonsten nichts Verdächtiges bemerkt. Bis er dann ins Schlafzimmer kam.« Jane hielt inne. »An dieser Stelle in seinem Bericht wurde er plötzlich kreidebleich und fasste sich ans Herz, und wir mussten den Krankenwagen rufen.«
»Der Streifenpolizist unten vor dem Eingang sagte, der Mann habe noch gelebt, als die Sanitäter ihn abtransportierten.«
»Aber er sah nicht gut aus. Nach dem, was wir im Schlafzimmer gefunden haben, hatte ich Angst, dass Frost vielleicht auch einen Krankenwagen brauchen würde.«
Detective Barry Frost stand in der hinteren Ecke des Schlafzimmers und schrieb mit verbissener Konzentration etwas in sein Notizbuch. Seine winterliche Blässe war noch ausgeprägter als gewöhnlich, und als Maura eintrat, brachte er nur ein mattes Nicken zustande. Doch auch sie beachtete Frost kaum, ihre ganze Aufmerksamkeit war auf das Bett mit dem Opfer gerichtet. Die junge Frau lag in einer seltsam entspannten Haltung da, die Arme am Körper angelegt, als ob sie sich nur mal eben mit den Kleidern auf die Bettdecke gelegt hätte, um ein Nickerchen zu halten. Sie war ganz in Schwarz gekleidet, mit Leggings und einem Rollkragenpulli, der ihre gespenstisch weiße Gesichtsfarbe betonte. Auch ihr Haar war schwarz, doch die blonden Wurzeln verrieten, dass es gefärbt war. In den Ohren trug sie mehrere goldene Stecker, und an ihrer rechten Augenbraue funkelte ein goldener Ring. Aber es war das, was unter den Brauen klaffte, was Mauras geschockten Blick auf sich zog.
Beide Augenhöhlen waren leer. Der Inhalt war herausgeschält worden, sodass nur die blutigen Höhlen zurückblieben.
Fassungslos starrte Maura auf die linke Hand der Frau. Auf das, was da wie zwei grausige Murmeln auf ihrer offenen Handfläche lag.
»Und das ist es, was diesen Abend so speziell macht, Jungs und Mädels«, sagte Jane.
»Bilaterale Enukleation der Bulbi«, murmelte Maura.
»Ist das etwa abgehobener Medizinerjargon für jemand hat ihr die Augen rausgeschnitten?«
»Ja.«
»Ich mag es, wie du alles immer in so ein nüchternes, klinisches Licht rücken kannst. Das macht die Tatsache, dass sie ihre eigenen Augäpfel in der Hand hält, irgendwie weniger – wie soll ich sagen – total krank und abgefahren.«
»Was weiß man über das Opfer?«, wandte sich Maura an Frost.
Widerstrebend sah er von seinem Notizbuch auf. »Cassandra Coyle, sechsundzwanzig. Lebt – lebte – allein hier, derzeit nicht liiert. Sie war freischaffende Filmemacherin, hatte ihre eigene Produktionsfirma namens Crazy Ruby Films. Gedreht wurde in einem kleinen Studio in der South Street.«
»Auch ein Gebäude, das ihrem Dad gehört«, fügte Jane hinzu. »Die Familie hat offensichtlich Geld.«
Frost fuhr fort. »Ihr Vater sagt, er habe zuletzt gestern Nachmittag mit ihr gesprochen, so zwischen siebzehn und achtzehn Uhr, als sie gerade ihr Filmstudio verließ. Wir fahren nachher gleich hin, um ihre Mitarbeiter zu vernehmen und festzustellen, wann genau sie das Opfer zum letzten Mal gesehen haben.«
»Welche Art von Filmen macht dieses Studio?«, fragte Maura, obwohl die Antwort angesichts der Plakate an den Wänden eigentlich auf der Hand lag.
»Horrorstreifen«, antwortete Frost. »Ihr Vater sagt, sie hätten gerade den zweiten abgedreht.«
»Und das passt auch zu ihrem Modegeschmack«, meinte Jane mit Blick auf die Piercings und das rabenschwarze Haar der Toten. »Ich dachte eigentlich, Goth sei out, aber dieses Mädel hat den Look voll drauf.«
Maura zwang sich, den Blick wieder auf die Hand des Opfers zu richten, auf das, was darin lag. Durch den Kontakt mit der Luft waren die Hornhäute eingetrocknet, und die einst glänzenden blauen Augen waren jetzt matt und getrübt. Obwohl das abgetrennte Gewebe geschrumpft war, konnte sie die geraden und schrägen Muskeln identifizieren, die alle Bewegungen des menschlichen Auges so präzise steuern. Ohne das komplexe Zusammenspiel dieser sechs Muskeln könnte kein Jäger den Flug einer Ente am Himmel verfolgen, keine Studentin den Inhalt ihres Lehrbuchs erfassen.
»Bitte sag uns, dass sie schon tot war, als er … das gemacht hat«, sagte Jane.
»Offenbar sind diese Enukleationen postmortal erfolgt, nach dem Zustand der Palpebrae zu urteilen.«
»Der was?«
»Der Augenlider. Kannst du erkennen, dass das Gewebe fast keine äußeren Verletzungen aufweist? Wer immer die Augäpfel entfernt hat, hat sich dabei Zeit gelassen, und das wäre schwierig gewesen, wenn das Opfer bei Bewusstsein gewesen wäre und sich gewehrt hätte. Auch ist der Blutverlust nur minimal, was darauf hindeutet, dass sie keinen Puls hatte. Ihr Blutkreislauf war bereits zum Erliegen gekommen, als der erste Schnitt gemacht wurde.« Maura hielt inne und studierte die leeren Augenhöhlen. »Die Symbolik ist faszinierend.«
Jane wandte sich Frost zu. »Hab ich dir nicht gesagt, dass sie das sagen würde?«
»Die Augen gelten als die Fenster zur Seele. Vielleicht hat es dem Mörder nicht gefallen, was er in ihren gesehen hat. Oder ihm gefiel die Art nicht, wie sie ihn ansah. Vielleicht fühlte er sich von ihrem Blick bedroht und reagierte, indem er ihr die Augen herausschnitt.«
»Oder vielleicht hatte ihr letzter Film etwas damit zu tun«, bemerkte Frost. »I See You.«
Maura wandte sich zu ihm um. »Dieses Plakat war für ihren Film?«
»Sie hat ihn geschrieben und produziert. Laut ihrem Vater war es ihr erster abendfüllender Film. Man kann nie wissen, wer den alles gesehen hat. Vielleicht irgendein kranker Spinner.«
»Der sich möglicherweise davon inspirieren ließ«, meinte Maura nachdenklich, den Blick auf die zwei Augen in der Hand des Opfers gerichtet.
»Haben Sie so etwas schon einmal gesehen, Doc?«, fragte Frost. »Ein Opfer mit herausgeschnittenen Augen?«
»In Dallas«, sagte Maura. »Es war nicht mein Fall, aber ein Kollege hat mir davon erzählt. Drei Frauen wurden erschossen, anschließend wurden ihnen die Augen entfernt. Beim ersten Opfer arbeitete der Mörder mit präzisen chirurgischen Schnitten, wie in diesem Fall. Aber als er zum dritten Opfer kam, hatte seine Sorgfalt schon nachgelassen. Und dadurch konnte er schließlich auch gefasst werden.«
»Also … ein Serienmörder.«
»Der zufällig auch ein geschickter Präparator war. Nach seiner Festnahme fand die Polizei Dutzende Fotos von Frauen in seiner Wohnung, und bei allen waren die Augen herausgeschnitten. Er hasste Frauen, und es erregte ihn sexuell, wenn er sie verletzte.« Sie sah Frost an. »Aber das ist der einzige Fall, von dem ich gehört habe. Diese Art von Verstümmelung ist sehr ungewöhnlich.«
»Für uns ist es eine Premiere«, stellte Jane fest.
»Wollen wir hoffen, dass es das erste und letzte Mal ist.« Maura fasste den rechten Arm der Toten und versuchte, den Ellbogen zu beugen. Doch das Gelenk ließ sich nicht bewegen. »Die Haut ist kalt, und die Leichenstarre ist voll ausgeprägt. Durch das Telefonat mit ihrem Vater wissen wir, dass sie gegen fünf Uhr gestern Nachmittag noch am Leben war. Daraus können wir schließen, dass seit ihrem Tod zwischen zwölf und vierundzwanzig Stunden vergangen sind.« Sie blickte auf. »Irgendwelche Zeugen, die uns helfen könnten, den Todeszeitpunkt genauer einzugrenzen? Gibt es Überwachungskameras in der Gegend?«
»Nicht an diesem Block«, antwortete Frost. »Aber an dem Gebäude um die Ecke habe ich eine Kamera entdeckt, und wie es aussieht, ist sie genau auf die Einmündung der Utica Street gerichtet. Vielleicht hat sie die Frau auf dem Nachhauseweg erfasst. Und wenn wir Glück haben, ist noch jemand anderes auf der Aufnahme zu sehen.«
Maura krempelte den Rollkragen der Toten herunter, um den Hals nach Würgemalen oder Strangmarken abzusuchen, fand aber nichts dergleichen. Als Nächstes zog sie den schwarzen Pullover hoch, um den Rumpf freizulegen, und rollte die Leiche mit Janes Hilfe auf die Seite. Der Rücken war von dem Blut, das sich nach dem Tod dort gesammelt hatte, dunkelviolett angelaufen. Maura presste einen behandschuhten Finger auf eine Stelle am Rücken. Die Verfärbung ließ sich nicht wegdrücken, was ihr verriet, dass das Opfer seit mindestens zwölf Stunden tot war.
Aber was hatte ihren Tod verursacht? Bis auf die verstümmelten Augen konnte Maura keine Anzeichen für irgendwelche Traumata erkennen. »Keine Schusswunden, kein Blut, kein Hinweis auf Strangulation«, sagte sie. »Ich sehe keine anderen Verletzungen.«
»Er schneidet die Augäpfel heraus, aber er nimmt sie nicht mit«, sagte Jane und runzelte die Stirn. »Stattdessen lässt er sie in ihrer Hand liegen, wie eine Art perverses Abschiedsgeschenk. Was zum Teufel soll das bedeuten?«
»Das ist eine Frage für die Psychologen.« Maura richtete sich auf. »Ich kann die Todesursache hier nicht feststellen. Warten wir ab, was die Obduktion ergibt.«
»Vielleicht war es eine Überdosis«, mutmaßte Frost.
»Das steht auf jeden Fall hoch oben auf der Liste. Die Antwort wird uns das Drogenscreening liefern.« Maura streifte sich die Handschuhe ab. »Ich werde sie mir morgen früh gleich als Erstes vornehmen.«
Jane folgte Maura aus dem Schlafzimmer. »Gibt es irgendwas, worüber du reden möchtest, Maura?«
»Ich kann dir nicht mehr sagen, solange die Obduktion nicht abgeschlossen ist.«
»Ich rede nicht von diesem Fall.«
»Ich weiß nicht genau, was du meinst.«
»Vorhin am Telefon hast du gesagt, du seist in Framingham. Bitte sag mir, dass du nicht hingefahren bist, um diese Frau zu besuchen.«
Maura knöpfte ruhig ihren Mantel zu. »Du tust ja fast so, als hätte ich ein Verbrechen begangen.«
»Dann warst du also dort. Ich dachte, wir wären uns einig, dass du dich von ihr fernhalten solltest.«
»Amalthea wurde auf die Intensivstation gebracht, Jane. Es gab Komplikationen bei ihrer Chemotherapie, und ich weiß nicht, wie lange sie noch zu leben hat.«
»Sie benutzt dich, sie spielt mit deinem Mitgefühl. Mensch, Maura, du wirst wieder nur verletzt werden.«
»Weißt du, ich habe eigentlich keine Lust, darüber zu reden.« Ohne sich noch einmal umzudrehen, ging Maura die Treppe hinunter und verließ das Gebäude. Draußen wehte ein eisiger Wind durch die Häuserschlucht, blies ihr ins Gesicht und zerzauste ihr die Haare. Als sie zu ihrem Wagen ging, hörte sie die Haustür abermals ins Schloss fallen. Sie blickte sich um und sah, dass Jane ihr nach draußen gefolgt war.
»Was will sie von dir?«, fragte Jane.
»Sie hat Krebs im Endstadium. Was glaubst du, was sie will? Vielleicht ein bisschen Mitgefühl?«
»Sie spielt mit dir. Sie weiß, wie sie dich packen kann. Schau dir doch nur an, wie sie ihren Sohn manipuliert hat.«
»Du denkst doch nicht, ich könnte jemals so werden wie er?«
»Natürlich nicht! Aber du hast es selbst einmal gesagt. Du hast gesagt, du hast die dunkle Ader der Lanks geerbt. Irgendwie wird sie einen Weg finden, das zu ihrem Vorteil zu nutzen.«
Maura schloss ihren Lexus auf. »Ich habe genug Probleme am Hals, da muss ich mir nicht auch noch deine Vorhaltungen anhören.«
»Okay, okay.« Jane hob beide Hände, eine Geste der Kapitulation. »Ich versuche doch nur, auf dich achtzugeben. Du bist doch sonst so klug. Bitte mach keine Dummheiten.«
Maura sah Jane hinterher, als sie zum Tatort zurückging. Zurück in das Schlafzimmer, in dem eine tote Frau lag, ihre Glieder steif von der Totenstarre. Eine Frau ohne Augen.
Plötzlich kamen ihr Amaltheas Worte wieder in den Sinn: Ihr werdet bald wieder eine finden.
Sie drehte sich um und ließ den Blick rasch über die Straße schweifen, fasste jede Tür ins Auge, jedes Fenster. War da ein Gesicht hinter der Scheibe im ersten Stock, das sie beobachtete? Hatte sich dort in dem Durchgang etwas bewegt? Wohin sie auch schaute, überall glaubte sie, ominöse Schatten zu sehen. Das war es, wovor Jane sie gewarnt hatte. Darin lag Amaltheas Macht: Sie hatte den Vorhang vor einer albtraumhaften Landschaft zurückgezogen, in der alles in düsteren Farben gemalt war.
Schaudernd stieg Maura in ihren Wagen und ließ den Motor an. Eisige Luft strömte aus dem Gebläse. Es war Zeit, nach Hause zu fahren.
Zeit, der Dunkelheit zu entfliehen.
4
Von meinem Platz im Café aus beobachte ich die zwei Frauen, die direkt vor dem Fenster miteinander reden. Ich erkenne sie beide wieder, denn ich habe im Fernsehen Interviews mit ihnen gesehen und in der Zeitung über sie gelesen, und meistens ging es dabei um Mord. Die mit den widerspenstigen dunklen Haaren ist Detective beim Morddezernat, und die große Frau in dem langen, eleganten Mantel ist Rechtsmedizinerin. Ich kann nicht hören, was sie sagen, aber ich kann ihre Körpersprache lesen. Die Polizistin gestikuliert aggressiv, die Ärztin versucht, ihr auszuweichen.
Abrupt macht die Kriminalpolizistin kehrt und stürmt davon. Die Ärztin verharrt einen Moment lang reglos, als ob sie überlegt, der anderen hinterherzugehen. Dann schüttelt sie resigniert den Kopf, steigt in einen schnittigen schwarzen Lexus und fährt davon.
Worüber die beiden wohl gestritten haben?
Ich weiß schon, was sie an diesem bitterkalten Abend hierher geführt hat. Vor einer Stunde habe ich es in den Nachrichten gehört: In der Utica Street ist eine junge Frau ermordet worden. In derselben Straße, in der Cassandra Coyle wohnt.
Ich spähe hinüber zur Einmündung der Utica, doch außer dem Blaulicht der Streifenwagen ist da nichts zu erkennen. Ist es Cassandras Leiche, die jetzt dort liegt, oder die einer anderen Unglücklichen? Ich habe Cassie seit der Middleschool nicht mehr gesehen, und ich frage mich, ob ich sie überhaupt wiedererkennen würde. Ganz bestimmt würde sie mich nicht wiedererkennen, die neue Holly, die jetzt aufrecht dasteht und ihrem Gegenüber in die Augen blickt, die sich nicht mehr im Hintergrund herumdrückt und ihre glücklicheren Geschlechtsgenossinnen beneidet. Die Jahre haben mein Selbstbewusstsein gestärkt und mein Modebewusstsein verfeinert. Mein schwarzes Haar ist jetzt zu einem eleganten Bob geschnitten, ich habe gelernt, in High Heels zu gehen, und ich trage eine Zweihundert-Dollar-Bluse, die ich geschickterweise um fünfundsiebzig Prozent heruntergesetzt ergattert habe. Wenn man als PR-Agentin sein Geld verdient, lernt man schnell, dass es auf Äußerlichkeiten ankommt, und so habe ich mich angepasst.
»Was ist da draußen los? Wissen Sie etwas?«, fragt eine Stimme.
Der Mann ist so urplötzlich an meiner Seite aufgetaucht, dass ich überrascht zusammenzucke. Normalerweise bekomme ich immer mit, was in meiner Nähe vor sich geht, aber ich war so auf den Polizeieinsatz draußen vor dem Café konzentriert, dass ich nicht gemerkt habe, wie er an mich herantrat. Ein scharfer Typ, ist mein erster Gedanke, als ich ihn anschaue. Er ist ein paar Jahre älter als ich, Mitte dreißig, schlank und sportlich gebaut, blaue Augen, weizenblondes Haar. Ich ziehe ein paar Punkte ab, weil er einen Latte in der Hand hat, wo doch echte Männer um diese späte Stunde nur Espresso trinken. Aber wegen seiner umwerfenden blauen Augen bin ich bereit, diesen Schönheitsfehler zu übersehen. Sie sind im Moment nicht auf mich gerichtet, sondern auf das Geschehen vor dem Fenster. Auf all die Einsatzfahrzeuge, die sich in der Straße versammelt haben, in der Cassandra Coyle wohnt.
Oder wohnte.
»Die ganzen Polizeiautos da draußen«, sagt er. »Ich frag mich, was da passiert ist.«
»Etwas Schlimmes.«
Er zeigt auf einen Übertragungswagen. »Sehen Sie mal, Channel Six ist auch schon da.«
Eine Weile sitzen wir nur da, nippen an unseren Drinks und verfolgen die Ereignisse draußen auf der Straße. Jetzt trifft ein weiterer Übertragungswagen ein, und mehrere andere Cafégäste streben zum Fenster hin. Ich spüre, wie sie sich von allen Seiten nähern und sich vordrängeln, um besser sehen zu können. Der bloße Anblick eines Polizeiautos kann uns abgestumpfte Bostoner normalerweise nicht aus der Ruhe bringen, aber wenn die Fernsehkameras anrollen, stellen wir unsere Antennen auf Empfang, weil wir wissen, dass es um mehr geht als um einen Blechschaden oder ein Parkvergehen. Dann ist wirklich etwas Berichtenswertes passiert.
Wie um unsere Ahnungen zu bestätigen, rollt jetzt der weiße Lieferwagen der Rechtsmedizin in unser Blickfeld. Ist er gekommen, um Cassandra oder ein anderes unglückliches Opfer abzuholen? Beim Anblick des Wagens schießt mein Puls plötzlich in die Höhe. Lass es nicht sie sein, denke ich. Lass es eine andere Frau sein, eine, die ich nicht kenne.
»Oh-oh, die Rechtsmedizin«, sagte Mr. Blue Eyes zu mir. »Das lässt nichts Gutes ahnen.«
»Hat irgendjemand gesehen, was passiert ist?«, fragt eine Frau.
»Nur, dass ein Haufen Polizei angerückt ist.«
»Hat jemand Schüsse oder so was gehört?«
»Sie waren zuerst hier«, sagt Mr. Blue Eyes zu mir. »Was haben Sie gesehen?«
Alles schaut in meine Richtung. »Die Polizeiautos waren schon hier, als ich kam. Es muss schon vor einer Weile passiert sein.«
Die anderen stehen da und gaffen, hypnotisiert vom flackernden Blaulicht. Mr. Blue Eyes nimmt auf dem Hocker direkt neben mir Platz und schüttet Zucker in seinen unpassenden Abendkaffee. Ich frage mich, ob er diesen Platz gewählt hat, weil er das Geschehen draußen aus der ersten Reihe verfolgen will oder weil er einfach nur nett sein will. Gegen Letzteres hätte ich nichts einzuwenden. Im Gegenteil, ich spüre schon ein elektrisierendes Kribbeln im Oberschenkel, die automatische Reaktion meines Körpers auf seinen. Ich bin nicht hergekommen, weil ich Anschluss suche, aber es ist schon eine Weile her, dass ich die intime Zuwendung eines Mannes genossen habe. Über einen Monat, wenn man den Handjob zwischen Tür und Angel mit dem Hoteldiener vom Colonnade letzte Woche nicht mitrechnet.
»Und? Wohnen Sie hier in der Nähe?«, fragt er. Eine vielversprechende Eröffnung, wenngleich nicht allzu originell.
»Nein. Und Sie?«
»Ich wohne in der Back Bay. Ich wollte mich mit ein paar Freunden bei dem Italiener hier in der Straße treffen, aber ich bin viel zu früh dran. Da dachte ich mir, ich gönne mir hier noch rasch einen Kaffee.«
»Ich wohne im North End. Ich wollte mich auch mit Freunden hier treffen, aber sie haben in letzter Minute abgesagt.« Wie leicht mir die Lüge über die Lippen geht. Und er hat keinen Grund, an meinen Worten zu zweifeln. Die meisten Menschen gehen automatisch davon aus, dass man die Wahrheit sagt, was das Leben für Leute wie mich so viel einfacher macht. Ich schüttle ihm die Hand, eine Geste, die Männer bei Frauen eher irritiert, aber ich will möglichst früh klare Verhältnisse schaffen. Er soll wissen, dass dies eine Begegnung auf Augenhöhe ist.
Eine Weile sitzen wir in einträchtigem Schweigen da, trinken unseren Kaffee und beobachten die Aktivitäten draußen auf der Straße. Polizeiliche Ermittlungen sind in der Regel für den Außenstehenden nicht sonderlich spannend. Man sieht nur Fahrzeuge kommen und wegfahren und uniformierte Menschen in Häuser gehen und wieder herauskommen. Was drinnen vor sich geht, bekommt man nicht mit. Man kann nur mutmaßen, um welche Art von Situation es sich handeln könnte, je nachdem welches Personal zum Einsatz anrückt. Die Mienen der Polizisten, die ich hier sehe, sind gelassen, ja geradezu gelangweilt. Was immer in der Utica Street passiert ist, es ist schon einige Stunden her, und die Ermittler sind nur noch damit beschäftigt, die Puzzleteile zusammenzusetzen.
Da es nichts Interessantes zu sehen gibt, verstreuen sich die anderen Cafégäste nach und nach wieder, und ich bleibe allein mit Mr. Blue Eyes an der Fenstertheke zurück.
»Dann werden wir wohl erst aus den Nachrichten erfahren, was passiert ist«, sagt er.
»Es ist ein Mord.«
»Woher wissen Sie das?«
»Ich habe vor ein paar Minuten da draußen jemanden vom Morddezernat gesehen.«
»Ist er reingekommen und hat sich vorgestellt?«
»Es ist eine Sie. An ihren Namen kann ich mich nicht erinnern, aber ich habe sie im Fernsehen gesehen. Die Tatsache, dass sie eine Frau ist, finde ich interessant. Ich frage mich, warum sie sich für diesen Beruf entschieden hat.«
Er betrachtet mich eingehender. »Verfolgen Sie etwa die Nachrichten über solche Dinge? Über Morde?«
»Nein, ich habe nur ein gutes Gedächtnis für Gesichter. Aber bei Namen bin ich furchtbar.«
»Wo wir gerade beim Thema Namen sind – meiner ist Everett.« Er lächelt, und um seine Augen bilden sich reizende Lachfältchen. »Jetzt dürfen Sie ihn gleich wieder vergessen.«
»Und wenn ich ihn gar nicht vergessen will?«
»Dann darf ich das hoffentlich als Kompliment auffassen.«
Ich überlege, was zwischen uns passieren könnte. Als ich ihm in die Augen schaue, weiß ich plötzlich ganz genau, was ich will: Ich will, dass wir in seine Wohnung in der Back Bay fahren. Anstatt Kaffee genehmigen wir uns ein paar Gläser Wein. Und dann fallen wir übereinander her und treiben es die ganze Nacht wie die Karnickel. Zu schade, dass er mit seinen Freunden hier in der Nähe zum Essen verabredet ist. Ich bin absolut nicht daran interessiert, seine Freunde kennenzulernen, und ich werde keine Zeit damit verschwenden, neben dem Telefon zu hocken und auf seinen Anruf zu warten, also nehme ich mal an, dass es bei diesem netten Plausch bleiben wird. Manchmal soll es einfach nicht sein, auch wenn man es gerne hätte.
Ich leere meine Kaffeetasse und rutsche vom Hocker. »War nett, Sie kennenzulernen, Everett.«
»Ah. Sie haben sich meinen Namen gemerkt.«
»Ich hoffe, Sie haben einen schönen Abend mit Ihren Freunden.«
»Und wenn ich keine Lust habe, mit meinen Freunden essen zu gehen?«
»Sind Sie nicht deswegen hier in der Gegend?«
»Pläne können sich ändern. Ich kann meine Freunde anrufen und ihnen sagen, dass ich kurzfristig woanders sein muss.«
»Und wo könnte das sein?«
Er erhebt sich auch, und jetzt stehen wir uns Auge in Auge gegenüber. Das Prickeln in meinem Bein breitet sich in warmen, köstlichen Wellen in mein Becken aus, und schlagartig verschwende ich keinen Gedanken mehr an Cassandra und die Frage, was ihr Tod bedeuten könnte. Meine ganze Aufmerksamkeit ist auf diesen Mann fixiert und auf das, was zwischen uns passieren könnte.
»Zu mir oder zu dir?«, fragt er.
5
Amber Voorhees hatte blondes Haar mit violetten Strähnchen und glänzend schwarz lackierte Fingernägel, aber es war das Nasenpiercing, das Jane am meisten irritierte. Während Amber schluchzte, hingen Rotzfäden an dem goldenen Ring, und sie tupfte immer wieder vorsichtig mit einem Papiertaschentuch daran herum, um die Tropfen aufzufangen. Ihre Kollegen Travis Chang und Ben Farney weinten nicht, wirkten aber nicht minder geschockt und am Boden zerstört angesichts der Nachricht von Cassandra Coyles Tod. Die drei Filmemacher trugen alle T-Shirts, Kapuzenpullis und zerrissene Jeans, die Uniform der jungen Hipster, und sie sahen alle aus, als hätten sie sich seit Tagen nicht mehr gekämmt. Und nach dem muffigen Umkleideraumgeruch im Studio zu urteilen hatten sie auch seit Tagen nicht mehr geduscht. Jede horizontale Fläche im Raum war mit Pizzakartons, leeren Energydrinkdosen und verstreuten Drehbuchseiten bedeckt. Auf dem Videomonitor lief eine Szene aus ihrem aktuellen Projekt: Ein blonder Teenager strauchelte schluchzend durch einen finsteren Wald, auf der Flucht vor der schattenhaften Gestalt eines gnadenlosen Killers.
Travis drehte sich abrupt zum Computer um und hielt das Video an. Das Bild des Mörders erstarrte auf dem Monitor, eine ominöse Silhouette, eingerahmt von Baumstämmen. »Scheiße«, stöhnte Travis. »Ich kann’s nicht glauben. Ich kann’s verdammt noch mal nicht glauben.«
Amber schlang die Arme um Travis, worauf der junge Mann aufschluchzte. Jetzt trat auch noch Ben dazu, und so hielten die drei Filmemacher sich eine Weile schweigend im Arm, während im Hintergrund der Computerbildschirm leuchtete.
Janes Blick ging zu Frost, und sie sah eine Träne in seinem Auge schimmern, die er rasch wegblinzelte. Kummer war ansteckend, und auch Frost war dagegen nicht immun, obwohl er im Lauf der Jahre schon so viele schlechte Nachrichten überbracht hatte und Zeuge geworden war, wie die Betroffenen zusammenbrachen. Polizisten waren da wie Terroristen – sie warfen verheerende Bomben in das Leben der Freunde und Angehörigen der Opfer, und dann standen sie da und betrachteten den Schaden, den sie angerichtet hatten.
Travis war der Erste, der sich aus der Umarmung löste. Er ging zu einem durchgesessenen Sofa, ließ sich auf die Polster sinken und verbarg den Kopf in den Händen. »Mein Gott, gestern war sie noch hier. Sie hat genau hier gesessen.«
»Ich wusste, dass es einen Grund gab, warum sie meine SMS nicht mehr beantwortet hat«, sagte Amber und schniefte in ihr Taschentuch. »Als von ihr nichts mehr kam, dachte ich mir, es wäre, weil sie wegen ihrem Dad so gestresst war.«
»Wann hat sie aufgehört, SMS zu schicken?«, fragte Jane. »Können Sie in Ihrem Handy nachsehen?«
Amber stöberte unter den verstreuten Drehbuchseiten herum und fand schließlich ihr Smartphone. Sie scrollte sich rückwärts durch ihre Nachrichten. »Ich habe ihr gestern Nacht gegen zwei Uhr geschrieben, und darauf hat sie nicht mehr geantwortet.«
»Hätten Sie denn eine Antwort von ihr erwartet, um diese Zeit?«
»Doch. In diesem Stadium des Projekts schon.«
»Wir haben Nachtschichten eingelegt«, warf Ben ein. Er ließ sich ebenfalls auf das Sofa plumpsen und rieb sich das Gesicht. »Wir waren bis drei Uhr auf und haben den Film geschnitten. Am Ende waren wir alle zu fertig, um noch nach Hause zu gehen, und da haben wir einfach hier gepennt.« Er deutete mit einem Nicken auf die zusammengerollten Schlafsäcke in der Ecke.
»Sie haben alle drei die Nacht hier verbracht?«
Ben nickte wieder. »Wir stehen schwer unter Termindruck. Cassie hätte normalerweise auch mit angepackt, aber sie musste sich erst sortieren für das Treffen mit ihrem Dad. Davor hatte sie nämlich einen ziemlichen Bammel.«
»Um wie viel Uhr ist sie gestern von hier weggegangen?«, fragte Jane.
»Vielleicht so gegen sechs?«, fragte Ben seine Kollegen, die beide nickten.
»Die Pizzas waren gerade geliefert worden«, sagte Amber. »Cassie ist nicht zum Essen geblieben. Sie sagte, sie würde sich selbst was zu essen holen, also haben wir zu dritt hier weitergearbeitet.« Sie wischte sich mit einer Hand über die Augen, und ein breiter Streifen Wimperntusche blieb auf ihrer Wange zurück. »Ich kann nicht glauben, dass wir sie da zum allerletzten Mal gesehen haben. Als sie zur Tür rausging, hat sie noch von der Party geredet, mit der wir den Picture Lock feiern wollten.«
»Picture Lock?«
»Das heißt, dass der Schnitt im Kasten ist«, erklärte Ben. »Dann ist der Film im Grunde fertig, es fehlen nur noch die Soundeffekte und die Musik. Wir sind fast so weit – vielleicht noch ein bis zwei Wochen.«
»Und noch mal zwanzig Riesen«, murmelte Travis. Er hob den Kopf, und seine schwarzen Haare standen in fettigen Büscheln ab. »Mist. Ich habe keine Ahnung, wie wir ohne Cassie so eine Summe aufbringen sollen.«
Jane sah ihn fragend an. »Hätte Cassandra das Geld beschaffen sollen?«
Die drei jungen Filmemacher wechselten Blicke, als ob sie sich nicht sicher wären, wer die Frage beantworten sollte.
»Sie wollte heute beim Lunch ihren Vater fragen«, ergriff Amber das Wort. »Deswegen war sie so gestresst. Sie hasste es, ihn um Geld angehen zu müssen. Zumal beim Lunch im Four Seasons.«
Jane sah sich im Zimmer um, sie registrierte den fleckigen Teppich, das verschlissene Sofa, die zusammengerollten Schlafsäcke. Diese Filmemacher waren alle weit über zwanzig, aber sie wirkten viel jünger – drei filmverrückte junge Leute, die immer noch wie im Studentenwohnheim hausten.
»Können Sie drei eigentlich vom Filmemachen leben?«, fragte sie.
»Davon leben?« Travis zuckte mit den Achseln, als ob die Frage keine Bedeutung hätte. »Wir machen eben Filme, darum geht es. Wir leben den Traum.«
»Und das Geld kommt von Cassandras Vater.«
»Es ist kein Geschenk. Er investiert in die Karriere seiner Tochter. Mit diesem Streifen könnte sie sich als Filmemacherin einen Namen machen, und die Story hat ihr persönlich viel bedeutet.«
Janes Blick fiel auf das Drehbuch, das auf dem Schreibtisch lag. »Mr. Simian?«
»Lassen Sie sich nicht von dem Titel täuschen, oder von der Tatsache, dass es ein Horrorfilm ist. Es ist ein ernsthaftes Projekt über ein Mädchen, das verschwindet. Der Film basiert auf einem wahren Ereignis aus ihrer Kindheit, und er wird ein viel größeres Publikum finden als unser erster.«
»Und dieser erste Film war I See You?«, fragte Frost.
Travis warf ihm einen verblüfften Blick zu. »Sie haben ihn gesehen?«
»Wir haben das Plakat gesehen. Es hängt in Cassandras Wohnung an der Wand.«
»Haben Sie …« Amber schluckte. »Haben Sie sie dort gefunden?«
»Ihr Vater hat sie dort gefunden.«
Amber schauderte und schlang die Arme um sich, als ob ihr kalt wäre. »Wie ist es passiert?«, fragte sie. »Ist jemand bei ihr eingebrochen?«
Jane beantwortete die Frage nicht, stattdessen stellte sie die nächste: »Wo waren Sie alle in den letzten vierundzwanzig Stunden?«
Die drei Filmemacher wechselten Blicke, unsicher, wer als Erstes sprechen sollte.
Travis antwortete schließlich. »Wir waren alle hier in diesem Gebäude«, sagte er langsam und betont. »Alle drei. Die ganze Nacht und den ganzen Tag.«
Die anderen zwei nickten zustimmend.
»Hören Sie, ich weiß, warum Sie uns diese Fragen stellen, Detective«, fuhr Travis fort. »Es ist Ihr Job, sie zu stellen. Aber wir kennen Cassie, seit wir alle Studenten an der NYU waren. Wenn man zusammen einen Film macht, dann schweißt einen das dermaßen zusammen, das ist … mit nichts zu vergleichen. Wir essen, schlafen und arbeiten zusammen. Okay, wir streiten uns auch mal, aber dann versöhnen wir uns wieder, weil wir eine Familie sind.« Er wies auf den Computerbildschirm, wo immer noch das Standbild des Killers zu sehen war. »Mit diesem Film werden wir den Durchbruch schaffen. Wir werden der Welt beweisen, dass man nicht irgendwelchen Studiobossen in den Arsch kriechen muss, um einen großen Film zu machen.«
»Können Sie uns sagen, was Ihre jeweiligen Aufgaben bei der Produktion von Mr. Simian waren?«, fragte Frost, der alles gewissenhaft in seinem zerfledderten Notizbuch festhielt.
»Ich bin der Regisseur«, sagte Travis.
»Und ich der Director of Photography«, sagte Ben. »Mit anderen Worten, der Kameramann.«
»Produzentin«, sagte Amber. »Ich stelle ein und entlasse, mache die Gehaltsabrechnung und sorge dafür, dass alles reibungslos abläuft.« Sie hielt inne und fügte mit einem Seufzer hinzu: »Eigentlich mache ich so ziemlich alles.«
»Und was war Cassandras Rolle?«
»Sie hat das Drehbuch geschrieben. Und sie ist die Produktionsleiterin – der wichtigste Job von allen, könnte man wohl sagen«, erklärte Travis. »Sie hat die Produktion finanziert.«
»Mit dem Geld ihres Vaters.«
»Ja, aber wir brauchen noch ein kleines bisschen mehr. Noch ein Scheck, das ist alles, worum sie ihn bitten wollte.«
Ein Scheck, den sie wahrscheinlich nie zu sehen bekämen.
Amber ließ sich neben Ben auf das Sofa sinken, und die drei saßen eine Weile schweigend da. Der ganze Raum schien nach abgestandenem Essen und geplatzten Träumen zu riechen.
Jane blickte zu dem Plakat auf, das hinter dem Sofa an der Wand hing. Es war das gleiche, das sie in Cassandras Wohnung gesehen hatte – I See You. »Dieser Film«, sagte sie und deutete auf das Bild eines riesenhaften roten Auges, das aus der Schwärze hervorstarrte. »Erzählen Sie mir davon.«
»Es war unser erster abendfüllender Film«, sagte Travis. »Und hoffentlich nicht unser letzter«, fügte er finster hinzu.
»Haben Sie alle vier daran mitgearbeitet?«
»Ja. Es fing an als Seminarprojekt an der Filmhochschule in New York. Wir haben eine Menge gelernt bei der Arbeit an diesem Film.« Er schüttelte den Kopf und lächelte ein wenig schief. »Wir haben auch eine Menge Fehler gemacht.«
»Wie ist er in den Kinos angekommen?«, fragte Frost.
Das Schweigen war qualvoll. Und vielsagend.
»Wir haben nie einen Verleihvertrag bekommen«, gab Travis zu.
»Dann hat ihn also niemand gesehen?«
»Oh, er wurde schon bei einigen Horrorfilm-Festivals gezeigt. Wie zum Beispiel bei diesem.« Travis zog seinen Kapuzenpulli hoch, um das T-Shirt mit dem Aufdruck SCREAMFESTFILMFESTIVAL zu zeigen, das er darunter trug. »Er ist auch als DVD und Video-on-Demand erhältlich. Wir haben sogar gehört, dass er sich zu einer Art Kultklassiker entwickelt hat, was so ziemlich das Beste ist, was einem Horrorstreifen passieren kann.«
»Und haben Sie damit Geld verdient?«, fragte Jane.
»Darum geht es doch gar nicht.«
»Und worum geht es dann?«
»Wir haben jetzt Fans.Leute, die unsere Arbeit kennen! Im Indie-Filmgeschäft reicht oft allein die Mundpropaganda, um ein Publikum für das nächste Projekt aufzubauen.«
»Sie haben also kein Geld damit verdient.«
Travis seufzte und senkte die Augen auf den schmutzigen Teppich. »Nein«, gestand er.
Janes Blick ging wieder zu dem monströsen Auge auf dem Kinoplakat. »Was passiert in diesem Film? Worum geht es?«