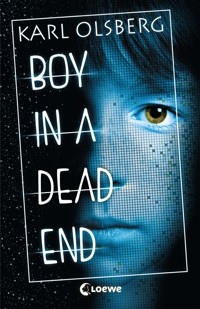
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Loewe Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
In "Team Defense" ist Manuel unschlagbar. Doch was seine Mitspieler nicht wissen: Beinahe Manuels gesamter Körper ist gelähmt. Er steuert seinen Avatar nur mithilfe eines intelligenten Rollstuhls. Denn Manuel leidet an einer unheilbaren Nervenkrankheit und ihm bleiben nur noch wenige Monate zu leben. Als er von einem umstrittenen Experiment erfährt, schöpft er neue Hoffnung: Dabei kann eine Computersimulation seines Gehirns entwickelt werden. So soll sein Bewusstsein in einem Computer weiterleben. Allerdings wird bei dem Scan das Gehirn vollständig zerstört.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 362
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Für Konstantin
Wie schlimm auch das Leben erscheinen mag,es gibt immer etwas, das man noch tunund bei dem man erfolgreich sein kann.Solange es Leben gibt, gibt es Hoffnung.
Stephen Hawking
TEIL 1
HOFFNUNG
1. KAPITEL
Manuel
Vorsichtig spähe ich um die Ecke des verfallenen Bürohauses in die Sackgasse. Sie endet nach ein paar Dutzend Metern an einer provisorischen Mauer, die mit Stacheldraht und wahrscheinlich noch einigen unangenehmen Überraschungen gegen Überklettern gesichert ist. Keine Spur von dem Typ, der John erschossen hat.
Wie kann das sein? Ich habe doch gesehen, wie er gerade eben hier hineingelaufen ist. Hat er ein Stealth Pack eingesetzt, um sich unsichtbar zu machen? Unwahrscheinlich, die sind viel zu selten und wertvoll, um sie in so einer Situation zu verschwenden. Er muss sich in der Ecke hinter dem Autowrack verkrochen haben und wartet vermutlich nur darauf, dass ich dumm genug bin, mich aus der Deckung zu wagen.
Ich schätze die Entfernung ab. Zu weit für eine Handgranate. Vielleicht, wenn ich bis zu dem Müllcontainer da vorne sprinte und sie von dort werfe …
»Sniper!«, tönt eine Warnung aus meinem Headset.
Ich werfe mich zu Boden. Im selben Moment schlägt eine Kugel in die Mauer über mir ein. Eine Falle! Hätte ich mir denken können.
Der Sniper muss in dem Haus auf der anderen Straßenseite hocken, gegenüber der Einmündung der Sackgasse. Er hat ein Präzisionsgewehr benutzt, das nur eine geringe Schussrate pro Minute hat, sonst wäre ich schon tot. Aber dem nächsten Schuss werde ich nicht ausweichen können.
Ich springe auf, sprinte im Zickzack los und hechte hinter den Müllcontainer, während mich eine zweite Kugel knapp verfehlt. Zwar bringt mich das aus der Schusslinie des Snipers, doch dem anderen Schützen bin ich nun ausgeliefert, wenn er sich wirklich dort in der Ecke versteckt hat. Rasch entsichere ich eine Granate und werfe sie hinter das verrostete Wrack des SUVs, dessen blaue Seitentür bereits mehrere Einschusslöcher aufweist. Kurz darauf erschüttert die Explosion die Straße. Metallteile fliegen wie Wurfmesser durch die Luft. Eines zischt dicht an meinem linken Bein vorbei.
Ich zähle bis drei, dann renne ich los. Der Sniper verfehlt mich erneut um Haaresbreite, bevor ich das brennende Wrack erreiche. Keine Spur des Feindes, aber dafür entdecke ich einen Abflussschacht. Bingo!
»Hey, Mike, ich glaube, ich habe den Eingang zu deren Homebase gefunden!«, rufe ich triumphierend.
»Echt jetzt?«
»Ja. Ein Abflussschacht, hier am Ende dieser Sackgasse.«
»Okay, ich komme. Gib mir Feuerschutz!«
Ich wechsele die Waffe und nehme durch das Zielfernrohr meines Scharfschützengewehrs das Haus ins Visier, in dem sich der feindliche Sniper verkrochen haben muss. Als ich hinter einer zersprungenen Scheibe im zweiten Stock eine Bewegung wahrnehme, drücke ich ohne zu zögern ab. Natürlich schieße ich daneben, aber ich zwinge ihn in Deckung, während Mike in Schlangenlinien auf mich zuhastet. Sicherheitshalber gebe ich noch einen zweiten Schuss ab, dann ist mein Teamkollege bei mir.
Wir betrachten den Gullydeckel. Auf den ersten Blick sind keine Sprengsätze erkennbar, aber das muss nichts heißen. Besser, wir gehen auf Nummer sicher. Ich lege eine Mine auf den Deckel, stelle den Timer auf zehn Sekunden und aktiviere sie.
»Los!«, rufe ich und gebe einen weiteren Schuss auf das Fenster ab, hinter dem ich den Sniper gesehen habe.
Mike sprintet auf die andere Straßenseite in die Deckung des Müllcontainers und nimmt von dort den Sniper unter Beschuss, während ich ihm folge. Kurz darauf zerreißt eine weitere, noch stärkere Explosion die angespannte Stille.
Wir kehren zu dem Wrack des SUVs zurück, das durch die Explosion der Mine auf die Seite geworfen wurde, doch der Gullydeckel ist unversehrt. Er muss aus Nanokomposit bestehen. Mit Granaten kriegen wir den nicht auf.
»Mist!«, schimpft Mike. »Dafür brauchen wir einen Hochleistungslaser.«
»Stimmt«, erwidere ich. »Aber immerhin wissen wir jetzt, wo der Eingang zum Versteck dieser Typen ist. Wenn wir wieder in der Homebase sind …«
Ein schweres, stampfendes Geräusch unterbricht mich. Im nächsten Moment kommt ein stählerner Koloss um die Ecke. Eine eckige Kanzel, die wie ein Flugzeugcockpit aussieht, steht auf zwei, fast drei Meter hohen Beinen. Links und rechts sind Schnellfeuerkanonen angebracht, die stark genug sind, um den Müllcontainer, das Autowrack und uns in Sägemehl zu verwandeln. Die Kanonen fangen an zu rotieren. Sie benötigen etwa zwei Sekunden, bis sie feuerbereit sind.
»Oh verdammt!«, ruft Mike aus. »Die haben einen Mech! Eine Rakete, schnell!«
Hastig wechsele ich die Waffe und nehme den Mech ins Visier. Die Panzerung der Kanzel ist selbst für meinen tragbaren Raketenwerfer zu stark, doch wenn ich eines der Beine treffe, fällt der Koloss zu Boden und ist kampfunfähig. Dafür habe ich nur einen Schuss frei, aber auf die Entfernung ist das kein Problem.
Gerade als ich abdrücken will, durchzuckt ein heftiger Schmerz meine linke Seite. Ich verreiße den Raketenwerfer. Das Geschoss zischt an dem Mech vorbei und explodiert an der Hauswand hinter ihm.
Im nächsten Moment bricht die Hölle los.
»Sorry, Leute«, sage ich, als das Totenkopfsymbol in meinem Display erscheint. »Hab’s vermasselt.« Meine Stimme zittert leicht vor Schmerzen. Die Krämpfe werden in letzter Zeit häufiger trotz der Medikamente.
»Schon gut«, meint Mike. »Wir können ja nicht jedes Mal gewinnen.«
»Aber dieses Mal wäre schon schön gewesen«, mischt sich John ein. »Ausgerechnet gegen die Evil Vegetables zu verlieren, kostet uns mindestens vier Plätze im Ranking.«
»Was war denn los?«, fragt Elli. »Du hattest bisher die beste Abschussquote im Team. Und ausgerechnet bei einem Mech, der so groß ist wie ein Scheunentor, schießt du daneben?«
Dass ihre Stimme eher mitleidig als sauer klingt, erschreckt mich. Ahnt sie etwa, dass mit mir etwas nicht stimmt?
»Ich … ich war abgelenkt«, lüge ich. »Meine Mutter kam rein und wollte was von mir. Tut mir echt leid.«
»Okay, verstehe«, meint John. »Sag ihr beim nächsten Mal, dass sie dich mitten im Turnier nicht stören soll.«
»Wenn ich ihr das sage, kommt sie erst recht rein.«
»Ja, das kenne ich. Na, sei’s drum. Wir holen das schon wieder auf«, erwidert John, doch ich höre seiner Stimme an, dass er nicht so recht daran glaubt.
Zwar ist meine Trefferquote immer noch besser als der Durchschnitt in unserem Team, aber sie hat in letzter Zeit immer mehr nachgelassen. Es wird nicht mehr lange dauern und sie werden mich aus dem Team werfen. Dann habe ich nicht einmal mehr das.
Ich verabschiede mich knapp und beende das Spiel.
»Marvin, Display hochklappen.«
Der gebogene Bildschirm, der mir gerade noch die verfallene, düstere Spielwelt von Team Defense vorgegaukelt hat, fährt nach oben und ich habe wieder ungehinderten Blick auf mein Zimmer: schräge, hellblau gestrichene Wände, Poster von Mangahelden, die ich früher mal toll fand, ein Regal voller Bücher, die ich nicht einmal mehr selbst öffnen, geschweige denn darin blättern könnte, zwei Sessel, die ich nicht mehr benutze, und ein ebenso überflüssiger Schreibtisch. Nur das monströse Bett, das den Raum beherrscht, ist hier wirklich erforderlich. Es ist eine Spezialkonstruktion der Firma Carebotics aus Berlin, genauso wie mein Stuhl.
»Marvin, lege mich ins Bett.«
Ich kann noch sprechen, auch wenn es sich manchmal anfühlt, als hätte jemand eine Socke in meinen Mund gestopft. Mit den Bewegungen klappt es nicht mehr so gut. Meine Beine sind vollständig gelähmt, die Arme zucken unkontrolliert herum, wenn ich versuche, nach etwas zu greifen, deshalb lasse ich es meistens.
Zum Glück habe ich Marvin. Er hat Räder, mechanische Beine, mit denen er Treppen steigen kann, einen Greifarm, den ich durch ein visuelles Interface steuere, und kann natürlich sprechen. Für einen Rollstuhl ist er ein bisschen besserwisserisch und ungefähr so einfühlsam wie ein Stück Brot. Trotzdem fühlt es sich an, als wäre er mein einziger Freund.
Er rollt neben das Bett, hebt die Sitzfläche und die Beinauflage an und senkt die Rückenlehne ab, sodass ich flach liege. Dann neigt er die Auflagefläche zur Seite wie die Kipplade eines Baufahrzeugs, woraufhin ich ins Bett rutsche. Das ist etwas entwürdigend, aber weniger unangenehm, als wenn mich Ralph, der Pfleger, der täglich vorbeikommt, jeden Abend ins Bett legen müsste wie ein Baby.
Im Bett sind natürlich jede Menge Sensoren angebracht, die meinen Schlaf überwachen. Sollten mein zerfallendes Nervensystem endgültig den Geist aufgeben und meine Lungen kollabieren, wird es Alarm schlagen. Marvin ist in der Lage, einen Sauerstoffschlauch in meinen Hals einzuführen und mich zu stabilisieren, bis der Notarzt eintrifft. Zum Glück hat er das noch nie machen müssen, aber irgendwann wird es passieren. Vielleicht erst in ein paar Monaten, vielleicht schon heute Nacht. Sie werden mich dann in der Intensivstation noch eine Weile am Leben halten können, doch trotz aller modernen Technik ist das nur ein Hinauszögern des Unvermeidlichen um höchstens wenige Wochen.
Das Leben ist nun mal eine Sackgasse, für jeden von uns. Der Unterschied ist bloß, dass ich das Ende der Straße bereits sehen kann.
Zu wissen, dass man nicht mehr lange lebt, erspart einem manches. Man muss zum Beispiel nicht darüber nachdenken, welchen Beruf man später mal ergreifen will, ob diese blöde Akne irgendwann verschwindet oder ob man jemals eine Freundin findet. Viele Probleme, die andere Jungen in meinem Alter belasten, habe ich nicht. Aber natürlich ist es trotzdem alles andere als toll.
Die Wahrscheinlichkeit, an amyotropher Lateralsklerose, kurz ALS, zu erkranken, ist sehr gering, vor allem, wenn man jung ist. Dass sie, so wie bei mir, bereits im Alter von 13 Jahren ausbricht, ist ungefähr so wahrscheinlich wie ein Lotto-Jackpot. Der Physiker Stephen Hawking war 21, als die Krankheit bei ihm diagnostiziert wurde. Die Ärzte gaben ihm nur noch wenige Jahre, doch er wurde 76. Trotz seiner Krankheit hat er unser Bild des Universums revolutioniert. Das hat Dr. Klein zu mir gesagt, als er mir die schlechte Nachricht überbrachte. Es gebe immer eine Chance, hat er behauptet.
Aber ich bin nicht Stephen Hawking. Die Krankheit verläuft bei mir sehr viel schneller und aggressiver als bei ihm. Mir bleibt nicht mehr viel Zeit und es wird keinen Unterschied machen, ob ich gelebt habe, jedenfalls für die meisten Menschen. Meine Eltern und meine Schwester Julia werden natürlich traurig sein. Doch wenn ich tot bin, müssen sie wenigstens nicht mehr mit ansehen, wie ich immer schwächer werde. Ich sehe jeden Tag in ihren Augen, wie mein Anblick Löcher in ihre Seelen frisst.
Wer weiß, vielleicht habe ich ja Glück und wache morgen einfach nicht mehr auf.
»Guten Morgen, Manuel. Wie geht es dir heute?«
»Halt die Klappe, Marvin.«
Ich lebe also noch. Wirre Träume verziehen sich aus meinem Kopf wie Nebel in der Morgensonne. Irgendwas mit einem schwarzen Loch, das plötzlich in meinem Zimmer war, mich aber nicht einfach aufgesogen, sondern im Kreis herumgewirbelt hat. Immer schneller, bis mir schlecht wurde wie damals in der Wilden Maus auf dem Dom, kurz bevor ich meine ersten Krampfanfälle hatte.
Durch das Fenster sehe ich blauen Himmel und höre Vögel freudig zwitschern, als ob es etwas zu feiern gäbe.
»Marvin, aufstehen.«
Das ist natürlich nicht wörtlich gemeint. Der Prozess, mit dem mich mein Stuhl gestern ins Bett gekippt hat, vollzieht sich nun umgekehrt. Diesmal ist es meine Matratze, die sich schräg stellt und mich auf Marvins flexible Sitzfläche befördert.
»Marvin, duschen.«
Er rollt mit mir ins Bad, benutzt seinen Greifarm, um mir das Nachthemd auszuziehen (inzwischen klappt das ganz gut, er verhakt sich nur noch selten im Stoff), und aktiviert die Waschautomatik. Sie funktioniert ähnlich wie eine Autowaschanlage, mit Wasserdüsen, die an beweglichen Armen befestigt sind, rotierenden Schwämmen und einem Riesenföhn, der mich abtrocknet. Marvin ist natürlich wasserfest, trotzdem habe ich das Gefühl, dass er die Prozedur nicht besonders mag und jedes Mal froh ist, wenn er mit mir wieder aus dem Bad rollen kann. Er zieht mich an und fährt mich in die Küche.
»Guten Morgen, Schatz!«, ruft Mama eine Spur zu fröhlich, während sie mir den Haferbrei auf den Tisch stellt. An ihren roten Augen sehe ich, dass sie wieder kaum geschlafen hat.
»Guten Morgen«, erwidere ich und versuche ebenfalls, vergnügt zu klingen.
Marvin löffelt mir den Brei in den Mund. Mein Schicksal ist ihm schnurzegal und dafür liebe ich ihn. Für einen Stuhl ist er ganz schön schlau und man kann erstaunlich gute Gespräche mit ihm führen, auch wenn ich weiß, dass er nicht wirklich versteht, worüber er redet. Seine Intelligenz basiert auf einem System namens METIS, das von Google zusammen mit irgendeiner Universität entwickelt wurde. Wofür das eine Abkürzung ist, weiß ich nicht, aber sie haben es so hingedreht, dass die Anfangsbuchstaben den Namen der griechischen Göttin der Weisheit bilden. Das System soll in der Lage sein, jede beliebige, von Menschen beantwortbare Frage zu verstehen und korrekt zu beantworten, und was mich betrifft, ist Marvin schon ziemlich gut darin. Nur, warum ausgerechnet ich an diesen digitalen Stuhl gefesselt bin, warum diese beschissene Krankheit unser Leben ruiniert und wir nicht einfach eine ganz normale Familie sein können, kann er mir nicht sagen.
Meine Schwester Julia kommt in die Küche. Sie ist drei Jahre älter als ich und macht dieses Jahr Abitur. Ihre langen schwarzen Haare wirken etwas unordentlich. Sie runzelt die Stirn, als sie mich ansieht.
»Du sabberst schon wieder«, stellt sie fest, schiebt Marvins Arm beiseite und wischt mir das Kinn ab.
»Und du siehst aus, als hättest du dir die Haare mit der Klobürste gekämmt«, gebe ich zurück.
»Wenigstens kann ich sie mir selbst kämmen«, erwidert sie schnippisch.
Aus dem Augenwinkel bemerke ich, wie Mama zusammenzuckt. Sie erträgt es kaum, wenn sich Julia über meinen Zustand lustig macht. Dabei ist das für mich viel weniger schmerzhaft als Mitleid. Ich weiß, dass Julia genauso leidet wie meine Eltern, doch im Unterschied zu ihnen hat sie meine Krankheit akzeptiert. Sie nimmt keine falsche Rücksicht, sagt immer, was sie denkt. Sie nimmt mich ernst.
Marvin ist vielleicht mein bester Freund, aber Julia ist viel, viel mehr als das.
»Ich muss los.« Sie gibt mir einen Kuss auf die Wange.
»Hab ich da jetzt etwa einen Lippenstiftabdruck?«, frage ich.
»Ja, aber keine Sorge, Marvin wird schon nicht eifersüchtig sein und bei deinen ganzen Pickeln fällt das kaum auf.«
»Viel Spaß in der Schule. Und grüß mir deinen minderbemittelten Freund.«
Ein Anflug von echtem Ärger spiegelt sich in ihrem Gesicht und für einen Moment bereue ich meine Worte. David ist wirklich keine große Leuchte.
»Mach ich. Und du grüß mir … Ach, entschuldige, du hast ja niemanden außer Marvin, den du grüßen kannst.« Sie grinst.
Autsch.
»Marvin, bewirf Julia mit Haferbrei!«
»Ich habe die Anweisung nicht verstanden«, behauptet mein Stuhl. Ich habe schon länger den Verdacht, dass er das immer dann sagt, wenn er zu etwas keine Lust hat.
Nachdem Julia gegangen ist, kehrt wieder Stille ein. Mama lächelt mich gezwungen an, doch sie bringt es nicht über sich, etwas zu sagen. Sie tut mir mindestens ebenso sehr leid wie ich ihr.
Nach dem Frühstück putzt mir Marvin die Zähne. Dann nimmt mich mein Krankenpfleger Ralph in die Mangel. Er massiert meine Muskeln, dehnt und streckt sie, zerrt mit seinen kräftigen Armen an mir, als wäre ich eine gefühllose Gummipuppe. Dabei habe ich sehr wohl Empfindungen in meinen Gliedmaßen, auch wenn ich sie nicht bewegen kann. Er nennt das Physiotherapie, ich nenne es Folter. Doch ich behalte dabei einen ebenso stoischen und desinteressierten Gesichtsausdruck wie er.
Als ich endlich wieder auf meinem Stuhl sitze, fragt mich Marvin: »Möchtest du etwas spielen? Oder vielleicht einen Holofilm ansehen?«
Ich zögere einen Moment. Die Versuchung ist groß, wieder in die virtuelle Realität von Team Defense abzutauchen. Dort bin ich kein sterbender Krüppel. Keiner meiner Teamkollegen weiß, wie es um mich steht und dass ich meinen Avatar nicht mit einem Controller oder mit Gesten, sondern mit den Augen und meiner Wangenmuskulatur steuere. Niemand bemitleidet einen in Team Defense.
Doch irgendwie kommt es mir immer so vor, als verpasste ich etwas, während ich spiele, als vergeudete ich die letzten, kostbaren Tropfen Leben, die mir noch geblieben sind. Dabei gibt es in meiner Wirklichkeit eigentlich nicht viel zu verpassen. Seit ich nicht mehr in die Schule gehe, habe ich kaum noch Kontakt zu anderen. Jedenfalls nicht in der Realität.
»Nein, danke. Marvin, wie alt werde ich?«
»Du bist 15 Jahre, drei Monate und elf Tage alt.«
»Ich will nicht wissen, wie alt ich bin. Ich will wissen, wie alt ich werde.«
»Morgen wirst du fünfzehn Jahre, drei Monate und zwölf Tage alt sein.«
Nicht schlecht – er hat wieder dazugelernt.
»Wie alt bin ich, wenn ich sterbe?«
»Niemand weiß, wann er stirbt.«
»Stimmt nicht.«
»Stimmt doch.«
»Was ist mit einem zum Tode Verurteilten auf dem elektrischen Stuhl?«
»Ein zum Tode Verurteilter könnte kurz vor der Hinrichtung einen Schlaganfall erleiden und sterben. Oder er könnte begnadigt werden. Oder der Strom fällt aus.«
Wow. Er hat die ganze Zeit den Kontext gehalten und sogar die Assoziation hinbekommen, dass ein elektrischer Stuhl Strom braucht, um zu funktionieren. Na, mit strombetriebenen Stühlen kennt er sich wohl aus.
Es macht mir Spaß, Marvins künstliche Intelligenz zu testen, obwohl ich mir manchmal nicht sicher bin, ob nicht eher ich das Testobjekt bin. Auf jeden Fall lernt er ständig dazu, und jedes Mal, wenn ich eine Lücke in seiner Fähigkeit, meine Fragen zu interpretieren, aufdecke, findet er eine neue Antwort.
Die erste Maschine bestand den Turing-Test, bei dem selbst ein KI-Experte eine Maschine im Chat nicht mehr von einer menschlichen Testperson unterscheiden kann, vor ungefähr zehn Jahren. Trotzdem heißt es, dass Computer noch nicht »richtig« denken können. Aber was genau das eigentlich bedeuten soll, was »Denken« überhaupt ist, darüber sind sich die Experten höchst uneinig.
»Was ist Zeit, Marvin?«
»›Zeit ist die Methode der Natur zu verhindern, dass alles auf einmal passiert.‹ Das hat der Physiker John Wheeler gesagt. Er hat den Spruch angeblich als Graffito an der Wand einer Herrentoilette entdeckt und fand ihn treffend.«
Das ist typisch für ihn: Er beantwortet Wissensfragen mit witzigen Sprüchen, die er irgendwo in den gewaltigen Datengebirgen des Netzes findet. Offenbar hat er festgestellt, dass ich darauf positiver reagiere, als wenn er mir die Wikipedia-Definition vorliest.
»Was ist Zeit?«, wiederhole ich meine Frage.
»Albert Einstein definierte es so: ›Zeit ist, was die Uhr anzeigt.‹«
Er versucht, sich nicht zu wiederholen. Darin ist er besser als die meisten Menschen.
»Ist die Zeit eine Illusion?«, fordere ich ihn erneut heraus.
»Nach der Vorstellung eines Blockuniversums, die sich aus Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie ergibt, vergeht die Zeit nicht. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind gleich wirklich.«
»Das bedeutet, ich lebe ewig?«
»Das bedeutet, wenn du tot bist, existierst du nicht mehr in der Gegenwart, sondern nur noch in der Vergangenheit.«
Ich bin nicht sicher, ob mich das jetzt beruhigen soll. Wenn Marvin und Einstein recht haben, hieße das, dass mein Leben, so begrenzt es auch sein mag, trotzdem in gewisser Hinsicht ewig ist. Alle, die vor mir gestorben sind, meine Großmutter Klara zum Beispiel, würden immer noch leben, wenn auch in einer Zeitblase, die für mich – jedenfalls für diesen Teil von mir, der heute über das alles nachdenkt – unerreichbar bleibt.
Es würde auch bedeuten, dass wir alle bereits tot sind.
Jedes Mal, wenn ich über solche Dinge grübele, bekomme ich irgendwann einen Knoten im Kopf. Aber gleichzeitig hat es etwas Befreiendes. Manchmal tagträume ich, dass ich in den paar Monaten, die mir noch bleiben, irgendeine bedeutende Entdeckung mache. So wie es Stephen Hawking gelungen ist – zum Beispiel, das Geheimnis der Zeit zu ergründen. Ein Teil von mir weigert sich, die Realität zu akzeptieren, so wie die unbeugsamen Bewohner des kleinen gallischen Dorfes in den alten Comics das Römische Reich einfach ignorieren. Dieser Teil von mir wehrt sich verbissen gegen die Einsicht, dass mein Leben sinnlos und vergeblich ist. Doch ich habe Hawkings Eine kurze Geschichte der Zeit dreimal gelesen und auch beim dritten Mal nicht alles verstanden. Ich bin leider kein Genie wie er.
»Ich muss mal«, sage ich.
Was nun passiert, ist bei Weitem nicht so unangenehm, wie wenn mir Ralph den Po abwischen müsste. Da sage noch einer: Früher war alles besser.
2. KAPITEL
Julia
»Meinst du, dein bescheuerter Stuhl kriegt es hin, ein Eis in dein großes Maul zu befördern?«, frage ich und zeige Manuel den Becher, den ich ihm auf dem Rückweg von der Schule gekauft habe. Pistazie, Schokolade und Stracciatella – die Kombination, die er sich immer geholt hat, als er noch selbst zur Eisdiele laufen konnte.
»Wenn nicht, schmiert er es eben in deine Haare.«
Mein Bruder grinst mich schief an. Liegt es daran, dass seine Gesichtsmuskeln weiter degeneriert sind, oder ist es Ausdruck seiner Freude und gespielten Gehässigkeit? Die Frage drängt sich ungebeten in meine Gedanken und trübt ganz schnell die Befriedigung darüber, dass ich ihn überhaupt zum Lächeln gebracht habe.
Ich halte den Becher vor ihn, während Marvins Arm den kleinen Plastiklöffel präzise, aber auch sehr langsam in die Eiskugeln taucht und winzige Mengen davon in Manuels Mund befördert. Es wäre viel schneller und einfacher, wenn ich ihn füttern würde, aber ich weiß, dass er das nicht mag. So nehmen wir beide in Kauf, dass das Eis geschmolzen ist, bevor er es aufessen kann, und klebrige Rinnsale an seinem Kinn herablaufen.
»Danke«, sagt er und seine Augen glänzen. »Das war lieb von dir. Ich glaube, ich hatte kein Eis mehr, seit …« Er beendet den Satz nicht.
Ich muss schlucken und kämpfe mit den Tränen. Einen Moment lang schweigen wir beide.
»Wärst du so nett, mir den Sabber abzuwischen, oder willst du warten, bis sich die Fliegen auf mich stürzen?«, fragt er.
»Da habe ich keine Angst«, erwidere ich. »Dein Geruch schreckt selbst die hartgesottensten Insekten ab.«
Mit einem Feuchttuch aus seinem Hightech-Bad wische ich ihn sauber.
»Hast du den Bekloppten heute gar nicht mitgebracht?«, fragt er.
Ich zucke zusammen. Sofort verschwindet der spöttische Ausdruck aus seinem Gesicht, als er erkennt, dass er mir unabsichtlich wehgetan hat.
»Ist was nicht in Ordnung?«, fragt er.
»Schon gut. Das mit David war ohnehin nicht für die Ewigkeit.«
»Oh. Es … es tut mir leid … Du weißt, ich habe mich oft über ihn lustig gemacht, aber …«
»David ist ein Arschloch.«
»Willst du darüber reden?«
»Nein.«
Wahrscheinlich habe ich David nie wirklich geliebt und er mich auch nicht, wie man an dem Schulterzucken ablesen konnte, mit dem er sich umdrehte, nachdem ich ihn in die Wüste geschickt hatte. Es war süß, wie er sich anfangs um mich bemüht hat, und ich fühlte mich geschmeichelt von dem Neid und der Eifersucht der anderen Mädchen in unserer Klasse. Immerhin sieht er verdammt gut aus. Er war manchmal ein echter Gentleman, doch ich konnte nie über wichtige Dinge mit ihm reden und habe ihn, wie sich heute Morgen herausstellte, wohl gar nicht wirklich gekannt. Es war höchste Zeit, Schluss zu machen. Trotzdem tut es weh.
Gestern Abend noch waren wir zusammen auf der Geburtstagsparty von Davids bestem Freund Erik – real, nicht in einer Sim. Wir waren beide gut drauf, auch ohne die Pillen, die einer von Eriks weniger vertrauenswürdigen Freunden uns verkaufen wollte, und hatten eine Menge Spaß. Ich habe mich darauf gefreut, ihn heute Morgen wiederzusehen.
Als ich zur Schule kam, stand er gemeinsam mit ein paar Typen, die ich nur flüchtig kenne, vor dem Eingang zum Hauptgebäude. Auch einige Mädchen waren dabei, unter anderem Ricarda aus meiner Parallelklasse, die früher mal mit David zusammen war. Sie lachten alle über etwas und ich ging zu ihnen, weil ich wissen wollte, was so lustig war. Zur Begrüßung gab ich ihm einen Kuss, ohne zu ahnen, dass es der letzte sein würde.
»Guck mal, das hier!«, sagte er und hielt mir einen Zettel vors Gesicht.
Darauf waren einfach gezeichnete Gesichter in verschiedenen Stimmungen zu sehen. Daneben standen Erklärungen der Gesichtsausdrücke: fröhlich, freundlich, neutral, ernst, verwirrt, wütend.
»Das ist meins!«, sagte eines der Mädchen. »Gib es mir zurück!«
Ich hatte sie ein paarmal gesehen, aber noch nie mit ihr gesprochen. Erst jetzt fiel mir auf, dass sie die Einzige in der Gruppe war, die sich nicht zu amüsieren schien.
»Erst musst du mir noch ein paar Fragen beantworten«, rief David. »Was bedeutet das hier?«
Er streckte die Zunge heraus und verdrehte die Augen. Die anderen lachten.
»Gib mir meinen Zettel zurück!«, antwortete das Mädchen. »Er gehört mir. Du musst ihn mir zurückgeben!«
»Falsche Antwort«, erwiderte David, was noch mehr Gelächter zur Folge hatte.
»Sag mal, was soll das?«, mischte ich mich ein. »Spinnst du jetzt, oder was? Gib ihr den Zettel zurück!«
»Jetzt sei doch nicht so eine Spaßbremse! Sie kriegt ihn ja gleich. Aber erst muss sie noch ein paar Fragen beantworten, okay? Kara kann keine Gesichtsausdrücke deuten und hat keinen Sinn für Humor, also merkt sie auch gar nicht, dass wir sie verarschen.«
»Das merke ich sehr wohl«, erwiderte das Mädchen ernst. »Gib mir meinen Zettel zurück! Ich muss ihn haben. Ich komme zu spät zum Unterricht. Ich darf nicht zu spät zum Unterricht kommen!«
Kein Zweifel, diese Kara war ein bisschen seltsam drauf. Aber ebenso offensichtlich war es, dass sie sich sehr unwohl fühlte und sich David und die anderen auf ihre Kosten amüsierten. Und das machte mich verdammt wütend.
»Gib ihr jetzt den Zettel, du Idiot!«, zischte ich.
Er grinste mich an und hielt das Blatt außer Reichweite. »Hol ihn dir doch!«
»Ich muss zum Unterricht!«, rief Kara und es klang, als wäre sie kurz davor, in Tränen auszubrechen. »Ich darf nicht zu spät zum Unterricht kommen!«
Mit einem Satz griff ich nach dem Zettel und erwischte ihn, doch David ließ nicht los, sodass das Papier zerriss.
»Oops!« David lachte und ließ seine Hälfte los.
»Du Blödmann!«, schnauzte ich ihn an, während ich Kara den zerrissenen Zettel gab.
»Er ist kaputt!«, stellte sie fest. »Du hast ihn kaputt gemacht!«
»Tut mir leid«, sagte ich, obwohl es ja nicht meine Schuld war.
»Ich muss zum Unterricht. Ich darf nicht zu spät zum Unterricht kommen.«
Damit schob sich Kara an den anderen vorbei und verschwand im Schulgebäude.
»Sag mal, spinnst du jetzt?«, fuhr ich David an. »Was hast du dir dabei gedacht? Macht es dir Spaß, dich über Schwächere lustig zu machen?«
»Nun reg dich doch nicht so auf.«
»Ja, ehrlich, wir haben ihr doch gar nichts getan«, mischte sich ein anderer Typ ein.
»Nichts getan?«, entgegnete ich. »Habt ihr nicht mitgekriegt, wie verzweifelt sie war? Das war Mobbing!«
»Hey, jetzt komm mal wieder runter«, sagte David. »Nur, weil dein Bruder behindert ist …«
Ich starrte ihn bloß an und mir war, als sähe ich ihn zum ersten Mal. Er kam mir auf einmal hohl vor wie eine gut aussehende Schaufensterpuppe, sein trainierter Körper und sein Lächeln unecht und leer. Manuel hatte verdammt recht, als er beim Frühstück behauptete, David sei ein Dummkopf.
»Das war’s«, erklärte ich ruhig. »Ich will mit dir nichts mehr zu tun haben.«
Nun war es an ihm, mich sprachlos anzustarren.
»W…was?«, brachte er heraus. »Echt jetzt? Du … du machst mit mir Schluss? Einfach so? Bloß, weil ich eine Behinderte verarscht habe?«
»Der Einzige, der hier behindert ist, bist du.«
»Autsch, das saß«, kommentierte Ricarda. Sie schien nicht traurig darüber zu sein, dass ich David den Laufpass gab.
Ich warf ihr einen giftigen Blick zu.
»Na … na gut, wie du willst«, sagte David mit einem Schulterzucken, drehte sich um und betrat das Schulgebäude. Wir haben seitdem kein Wort mehr miteinander gesprochen.
In der Pause suchte ich Kara auf dem Schulhof. Sie stand ganz allein in einer Ecke und schien mit sich selbst zu reden. Denn sie bewegte die Lippen, hatte aber kein Headset auf. Ich ging zu ihr und hielt ihr einen Zettel hin, den ich während des Matheunterrichts gezeichnet hatte.
»Hier, der ist für dich.«
Sie nahm das Blatt und betrachtete es mit gerunzelter Stirn.
»Die Gesichter sehen anders aus als auf dem richtigen Zettel«, stellte sie fest.
»Tut mir leid, ich kann nicht so gut malen. Kannst du trotzdem verstehen, was ich mit den Gesichtsausdrücken meine?«
»Ja.« Sie deutete auf das letzte Gesicht. »›Stinksauer‹ steht nicht auf dem richtigen Zettel.«
»Ich weiß.«
»Warst du stinksauer auf David?«
»Ja.«
»Warst du stinksauer auf David, weil er mir den Zettel weggenommen hat?«
»Ja.«
»Du bist nett. Ich bin Kara.«
»Ich finde dich auch nett, Kara. Ich heiße Julia.«
»Ich habe das Asperger-Syndrom«, erklärte sie. »Das ist keine Krankheit, sondern ein besonderes Persönlichkeitsmerkmal. Ich kann manche Dinge nicht so gut wie die meisten Menschen. Ich kann zum Beispiel Gesichtsausdrücke nicht so gut deuten. Ich nehme immer alles wörtlich, auch wenn es nicht so gemeint ist. Dafür kann ich mir ziemlich gut Dinge merken. Und ich habe 15 Punkte in Mathe.«
»Cool«, erwiderte ich.
Sie zog ihre Stirn kraus. »War das Sarkasmus?«
»Nein, das war mein Ernst. Ich finde Leute cool, die gut in Mathe sind. Mein Bruder ist auch ziemlich gut in Mathe. Jedenfalls war er es, als er noch zur Schule ging.«
»Warum geht er nicht mehr zur Schule? Ist er älter als du?«
»Er hat amyotrophe Lateralsklerose«, erwiderte ich. »Das ist eine Krankheit, bei der die Muskeln degenerieren. Man wird gelähmt und … und irgendwann versagen die Lungen und man stirbt.«
»Ach so«, sagte sie so unaufgeregt, als hätte ich ihr gerade erklärt, dass mein Bruder blonde Haare hat. Mir kam der Gedanke, dass die beiden sich gut verstehen würden.
»Würdest du meinen Bruder gern mal kennenlernen?«
»Nein«, sagte sie ungerührt. »Ich mag keine Fremden.«
»Wenn du ihn näher kennen würdest, wäre er kein Fremder mehr.«
»Ich weiß. Trotzdem … Ich muss jetzt nach Hause.«
Damit drehte sie sich um und verschwand mit staksenden Schritten, während ich ihr schulterzuckend nachsah.
»Hast du eigentlich schon mal darüber nachgedacht, was Zeit ist?«, holt mich Manuel ins Hier und Jetzt zurück. Es ist süß, wie er versucht, mich von meinem Kummer abzulenken.
»Ist Zeit nicht das, was die Uhr anzeigt?«, versuche ich mich an einer lustigen Antwort, obwohl mir nicht nach Scherzen zumute ist.
Manuel nickt anerkennend. »Das hat Albert Einstein auch gesagt.«
»Es ist 17 Minuten vor vier«, bemerkt Marvin, der entweder meinen Satz falsch interpretiert hat oder einfach irgendetwas zur Diskussion beitragen will.
Wir müssen beide lachen.
»Ich glaube, die Zeit ist nur eine Illusion«, meint Manuel. »Sie vergeht gar nicht wirklich. Es kommt einem nur so vor, als gäbe es einen Unterschied zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.«
Wie schon oft kann ich seinen Gedanken kaum folgen. Obwohl er drei Jahre jünger ist als ich, kommt er mir manchmal viel erwachsener vor und auf jeden Fall klüger.
»Wie meinst du das?«
»Denk doch mal nach: Es kann gar keine Gegenwart geben, denn jeder Gedanke ist in dem Moment, wo du ihn denkst, bereits gedacht und somit Vergangenheit. Und wenn es keine Gegenwart gibt, dann ergibt unsere ganze Vorstellung von Zeit, die vergeht, keinen Sinn. Ich stelle mir das ungefähr so vor wie bei einem Buch: Die Sätze stehen in einer Reihenfolge und wenn du sie liest, kommt es dir so vor, als entstünde eine lebendige Geschichte. Wenn du Seite 30 liest, dann scheint das die Gegenwart zu sein und das, was auf den Seiten davor steht, liegt scheinbar in der Vergangenheit, während Seite 34 und Seite 112 noch in der Zukunft sind. Aber in Wirklichkeit ist das ganze Buch schon geschrieben und alle Sätze sind gleichzeitig da.«
Wieder mal habe ich einen Kloß im Hals, als ich darüber nachdenke, was aus Manuel hätte werden können, was er hätte erreichen können, wenn ihm das verdammte Schicksal nur eine Chance gegeben hätte. Wer weiß, vielleicht hätte er sogar sein großes Vorbild Stephen Hawking noch übertroffen.
»Vielleicht … hast du recht«, sage ich, weil mir nichts Besseres einfällt. Dann wende ich mich ab und lasse ihn allein, damit er meine Betroffenheit nicht bemerkt.
Mama sitzt im Wohnzimmer, die Holobrille auf der Nase, und fuchtelt in der Luft herum. In den Gläsern spiegeln sich winzige Patiencekarten, die vor ihr in den Raum projiziert werden.
»Hallo«, sage ich.
»Hallo.«
Sie dreht sich nicht zu mir um, sondern beschäftigt sich weiter mit ihrem Spiel. Ich nehme es ihr nicht übel, denn ich weiß, dass sie ständig am Rand eines Nervenzusammenbruchs balanciert. Es muss schrecklich sein zuzusehen, wie das eigene Kind stirbt. Vielleicht sogar noch schrecklicher, als wenn es der eigene Bruder ist.
Einen Moment zögere ich, sie erneut zu unterbrechen, doch ich weiß, dass es ihr nicht wirklich hilft, wenn sie dauernd vor der Realität flieht. Mir geht es erst besser, seit ich das kapiert habe, und Manuel braucht sie mindestens so dringend wie mich.
»Wann kommt Papa wieder?«, unternehme ich einen Versuch, so etwas wie ein Gespräch mit ihr in Gang zu bringen.
»Morgen Abend, wie immer«, sagt sie, ohne mich anzusehen.
Wut keimt in mir auf und ich will ihr die blöde Brille von der Nase reißen. Stattdessen hole ich tief Luft. Wenn wenigstens mein Vater hier wäre und ihr beistünde. Aber der ist die Woche über unterwegs. Das war schon immer so. Er ist Unternehmensberater und arbeitet bei seinen Kunden vor Ort. Trotzdem habe ich den Verdacht, dass er sich in die Arbeit stürzt, um vor der traurigen Wirklichkeit zu fliehen. Ein paarmal haben wir darüber gesprochen, dass er sich mal eine Auszeit nehmen und sich mehr um die Familie kümmern wolle. Doch jedes Mal ging es gerade nicht, weil er unbedingt noch dieses eine absolut kritische Projekt zu Ende bringen musste.
Seufzend stehe ich auf, gehe in die Küche und mache mir einen Tee. Jetzt habe ich nicht mal mehr David, der mich aus meiner trüben Stimmung reißen kann. Er mag ein Dummkopf sein, aber er hat es trotzdem immer wieder geschafft, mich zum Lachen zu bringen. Vielleicht sollte ich ihm noch eine Chance geben. Aber was mache ich mir vor? Vermutlich ist er froh, dass er mich los ist, und hängt jetzt mit Ricarda ab oder einem anderen Mädchen aus unserer Klasse.
Das Leben kann manchmal ganz schön beschissen sein.
3. KAPITEL
Manuel
Als Papa am Freitag spätabends nach Hause kommt, wirkt er irgendwie verändert. Zuerst weiß ich nicht genau, was es ist: Er umarmt mich unbeholfen, so wie er es immer tut, seine Bartstoppeln kitzeln meine Wange und ich rieche die für ihn typische Mischung aus Schweiß und Aftershave. Er redet nicht viel mit mir, auch das ist normal – ich weiß, er hat Angst, unabsichtlich etwas zu sagen, das mich verletzen könnte. Doch als er sich an der Tür noch einmal zu mir umdreht, um mir eine gute Nacht zu wünschen, erkenne ich etwas in seinem Gesicht: eine Entspanntheit, die ich dort schon lange nicht mehr gesehen habe, ein Glimmen in seinen Augen.
Hat er die Situation endlich akzeptiert und sich mit meinem Schicksal abgefunden? Das wäre eine große Erleichterung. Oder hat er womöglich mit dem Neurologen gesprochen, der mich behandelt, und der hat ihm etwas gesagt, was ihm neuen Mut gemacht hat? Nein, das ist unwahrscheinlich. Als ich das letzte Mal dort war, konnte ich an der Miene des Arztes und seiner bemüht zuversichtlichen Stimme erkennen, dass er die Hoffnung aufgegeben hat. Selbst wenn es irgendeine neue Therapiechance gäbe, käme sie nicht mehr rechtzeitig.
Mir wird flau im Magen, als ich daran denke, wie wir das letzte Mal Hoffnung schöpften. Das war vor etwas mehr als einem Jahr. Papa kam damals nach Hause, ein breites Grinsen im Gesicht.
»Ich habe vorhin mit Dr. Klein telefoniert«, sagte er. »Es gibt da eine neue experimentelle Gentherapie. Sie wurde bisher noch nie an Menschen ausprobiert, aber in Tierversuchen hat sie sehr gut angeschlagen.«
Wenn man so verzweifelt ist wie wir, dann klammert man sich an jeden Strohhalm. Ich bekam regelmäßig Spritzen und eine Zeit lang sah es so aus, als würde die Therapie wirken. Wir waren voller Hoffnung und es schien, als würde wieder so etwas wie Normalität in unser Familienleben zurückkehren. Doch dann kam der Tag der Wahrheit. Wir fuhren außerplanmäßig ins Krankenhaus, weil sich meine Krampfanfälle in den letzten Tagen wieder gehäuft hatten. Dr. Klein untersuchte mich und sein Gesicht wurde immer ausdrucksloser. Schließlich brauchte er zwei Anläufe, um mir die Wahrheit zu sagen: Die Gentherapie hatte nicht nur nicht funktioniert, sie schien die Degeneration meiner Nervenzellen sogar noch zu beschleunigen.
Wir haben eine Woche lang fast überhaupt nicht miteinander gesprochen. Mein Vater verschwand in irgendeinem Projekt und Mama schlich mit ausdruckslosem Gesicht und leeren Augen durchs Haus, mechanisch wie ein Roboter. Irgendwann schafften wir es, wieder so miteinander umzugehen wie vor der missglückten Therapie. Julia machte sogar wieder ihre geschmacklosen Witze über meinen Zustand, von denen sie weiß, dass sie mir das Leben ein bisschen erleichtern. Doch Mama und Papa haben sich von diesem Rückschlag nie ganz erholt.
Wenn es nicht Hoffnung ist, was sonst könnte die Miene meines Vaters so aufhellen? Hat er womöglich eine Affäre? Eine Trennung meiner Eltern ausgerechnet jetzt wäre das Schlimmste, was passieren könnte. Auch wenn sie mir niemals die Schuld daran geben würden, wüsste ich doch, dass meine Krankheit und die Belastung, die ich für sie darstelle, der Auslöser wären.
Marvin löscht das Licht, doch ich kann nicht einschlafen. Während ich so daliege und sich meine Gedanken wieder mal im Kreis drehen, höre ich plötzlich Stimmen. Das Schlafzimmer meiner Eltern liegt am anderen Ende des Flures. Dass ich es mitbekomme, bedeutet, dass sie ziemlich laut reden.
Die Stimmen werden energischer und es wird deutlich, dass die beiden streiten, auch wenn ich nicht verstehe, worüber. Irgendwann verstummen sie. Dennoch hallt die verzweifelte Stimme meiner Mutter noch lange in meinem Kopf nach.
Am nächsten Morgen sitzen wir stumm am Frühstückstisch. Meine Eltern blicken sich nicht an und der Knoten in meinem Magen zieht sich weiter zusammen.
»Hast du Lust, spazieren zu gehen?«, fragt mich Julia, nachdem sie meinen Teller abgeräumt hat.
»Du meinst, du gehst und ich fahre«, stelle ich klar.
»Von mir aus«, sagt sie bloß. Dass sie keine ihrer Spitzen gegen mich abfeuert, zeigt, dass auch sie etwas belastet.
Von unserem Haus in Poppenbüttel im Hamburger Norden ist es nicht weit bis zum Alsterlauf. Es ist ein herrlicher Sommertag. Spaziergänger sind unterwegs, Hunde spielen miteinander, Drohnen schwirren durch die Luft.
Eine Weile geht Julia schweigend neben Marvin und mir her, bis ich endlich den Mut finde, sie zu fragen: »Weißt du, was los ist?«
»Das wollte ich eigentlich gerade dich fragen«, erwidert sie.
»Mit Papa stimmt irgendwas nicht. Er ist … seltsam. Und Mama wirkte heute Morgen sogar noch angespannter als sonst.«
»Hat er etwas zu dir gesagt, als er gestern Abend zu dir gekommen ist?«
»Nein. Aber er schien irgendwie verändert. Entspannter.«
Julia runzelt die Stirn. »Besonders entspannt kam er mir heute Morgen nicht vor.«
»Nein. Die beiden haben gestern Abend noch gestritten. Meinst du … meinst du, sie lassen sich scheiden?«
Sie bleibt stehen und sieht mich überrascht an. »Wie kommst du darauf?«
»Was könnte es denn sonst sein?«
»Keine Ahnung. Aber eins weiß ich: Papa und Mama werden sich garantiert nicht scheiden lassen. Schon dir zuliebe würden sie das niemals tun.«
»Vielleicht warten sie, bis ich tot bin.«
Endlich wieder ein frecher Spruch von ihr: »Dann stirb halt nicht.«
»Alles klar«, erwidere ich.
Eine Drohne schwebt heran und umkreist uns, während ihr Kameraauge auf mich gerichtet ist. Wahrscheinlich ein Streamer, der hofft, mit dem Freak im Rollstuhl ein paar zusätzliche Views zu erzielen.
»Verschwinde, du blöder Stalker!«, ruft Julia und schlägt mit dem Arm danach, doch die Drohne weicht ihr mühelos aus.
»Soll ich die Drohne identifizieren und den Besitzer wegen Verletzung der Privatsphäre melden?«, fragt Marvin.
»Nein, lass ihn«, sage ich. »Ich bin es gewohnt, dass mich irgendwelche Trolle anglotzen.«
Wer immer die Drohne steuert, scheint vor Marvins Drohung und meinen Worten zu erschrecken, denn das lästige Ding schwirrt mit einem Aufjaulen seiner Rotoren davon.
»Soll ich Papa einfach mal fragen, was los ist?«, schlage ich vor.
Sie zuckt mit den Schultern. »Du weißt doch, wie Papa ist.«
Ich versuche es trotzdem. Als wir nach Hause kommen, steuere ich Marvin ins Arbeitszimmer meines Vaters. Er klappt das Holodisplay hoch, als er mich sieht.
»Oh, hallo, Manuel. Wie geht … Äh, ich meine, was kann ich für dich tun?«
Als ich ihn genauer betrachte, wirkt er irgendwie nervös, als hätte er etwas zu verbergen. Er war schon immer ein schlechter Schauspieler. Schon als Vierjähriger habe ich ihm am Gesicht angesehen, dass die Sache mit dem Weihnachtsmann nicht stimmen konnte.
»Du hast dich gestern mit Mama gestritten.«
Er läuft rot an. »Das … das hast du gehört? Das tut mir leid. Wir hätten nicht so laut sein dürfen.«
»Wollt ihr euch trennen?«
Seine Augen weiten sich. »Was?«
»Ihr müsst keine falsche Rücksicht auf mich nehmen«, sage ich, kann aber nicht verhindern, dass sich Tränen in meine Augen drängen. »Ich weiß, dass ihr denkt, ich könnte das nicht verkraften, aber ich … ich bin stärker, als ihr glaubt. Und ich will nicht, dass ihr euch meinetwegen verstellen müsst.«
Er schüttelt den Kopf. »Woher hast du denn diesen Unsinn? Ich liebe deine Mutter! Wie kommst du darauf, dass wir uns trennen wollen?«
Ich kann keine Unaufrichtigkeit in seinem Gesicht erkennen.
»Was ist es dann?«
Er weicht meinem Blick aus. »Es ist doch ganz normal, dass sich Erwachsene mal streiten. Das haben wir schon in der ersten Woche gemacht, als wir ein Paar waren, und sogar in unserer Hochzeitsnacht. Mittlerweile sind wir 20 Jahre verheiratet und wir streiten uns immer noch regelmäßig. Da ist nichts dabei.«
Das war definitiv eine Lüge. Das gestern war kein gewöhnlicher Streit und er hatte etwas mit mir zu tun. Das spüre ich. Doch sosehr ich auch nachbohre, mein Vater bleibt ausweichend. Also versuche ich es bei Mama, aber alles, was ich damit erreiche, ist ein Heulkrampf.
Frustriert suche ich Julia auf. Sie liegt auf ihrem Bett und liest ein Buch – ein richtiges, aus Papier. Auf dem Cover ist ein halb nackter Mann zu sehen, der eine Frau in einem antiken Ballkleid im Arm hält. Als Julia meinen Blick bemerkt, legt sie das Buch rasch zur Seite, als wäre es ihr peinlich.
»Hast du was rausgekriegt?«
»Nein. Aber ich bin sicher, es hat etwas mit mir zu tun.«
Ich erzähle ihr, wie die beiden auf meine Fragen reagiert haben.
Julia runzelt die Stirn. »Das ist wirklich seltsam. Ich verstehe das nicht. Warum reagieren die beiden so unterschiedlich? Wenn es etwas mit dir zu tun hätte, dann müssten sie doch eigentlich einer Meinung sein. Jedenfalls waren sie das bisher immer. Über eine neue medizinische Chance würden sie sich doch auf jeden Fall beide freuen.«
»Vielleicht ist es irgendeine neue, unerprobte Therapie«, spekuliere ich, »und sie sind sich uneinig, ob man das Risiko eingehen sollte.« Ich kann nicht verhindern, dass mein Puls bei diesem Gedanken vor Hoffnung schneller wird.
»Quatsch. Was haben wir denn zu verlieren? Wenn es auch nur die geringste Chance gäbe, würden sie es beide versuchen wollen, da bin ich sicher.«
»Also doch eine Affäre?«
Julia schüttelt den Kopf. »Glaube ich nicht.«
Wir raten noch eine Weile herum, doch uns fällt nichts ein, was das seltsame Verhalten der beiden erklären könnte. Irgendwann taucht Julia wieder in die heile Welt ihres Liebesromans ab, während ich mich in die nicht ganz so heile, aber trotz aller bösen Überraschungen wenigstens berechenbare Welt von Team Defense zurückziehe. Dort ist stets klar, wer Feind und wer Freund ist, und der Tod nicht mehr als ein vorübergehendes Ärgernis.
Zum Mittagessen ist Papa nicht da. Mama ist nur die knappe Aussage zu entlocken, er habe einen Termin. Erst spätabends kommt er zurück. Ich liege bereits im Bett, aber natürlich kann ich nicht schlafen.





























