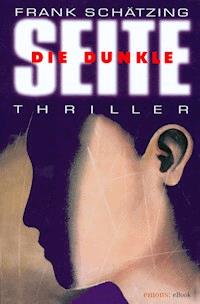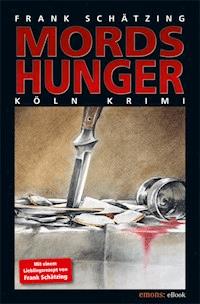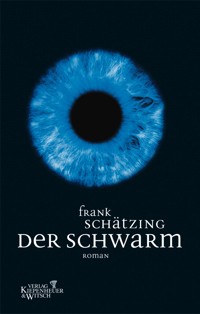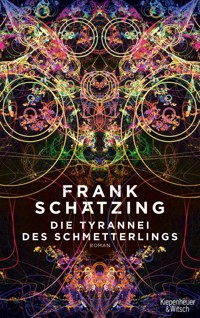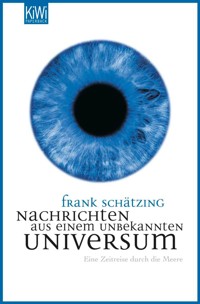10,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Thriller, Politdrama und Familiensaga – hart, rasant und berührend. Tom Hagen, gefeierter Star unter den Krisenberichterstattern, ist nicht zimperlich, wenn es um eine gute Story geht. Die Länder des Nahen Ostens sind sein Spezialgebiet, seine Reportagen Berichte aus der Hölle. Doch in Afghanistan verlässt ihn sein Glück. Eine nächtliche Geiselbefreiung endet im Desaster. Hagens Ruf ist ruiniert, verzweifelt kämpft er um sein Comeback. Drei Jahre später bietet sich die Gelegenheit in Tel Aviv, als ihm Daten des israelischen Inlandgeheimdienstes zugespielt werden. Hagen ergreift die Chance - und setzt ungewollt eine tödliche Kettenreaktion in Gang... Breaking News ist ein mitreißender Thriller vor dem Hintergrund einer epischen Saga. Zwei Familien wandern Ende der zwanziger Jahre nach Palästina ein – in eine von Legenden, Kämpfen und Hoffnungen beherrschte neue Welt, wo Juden, Araber und britische Kolonialherren erbittert um die Vorherrschaft ringen. Bis in die Gegenwart, über Generationen hinweg, spiegeln und prägen beide Familien Israels atemlose Entwicklung. Als Hagen in der jungen Ärztin Yael Kahn eine unerwartete Verbündete findet, erkennt er, dass auch sein Schicksal eng mit der Geschichte des Landes verbunden ist. Doch mit Yael an seiner Seite gehen die Probleme erst richtig los.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1456
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Frank Schätzing
Breaking News
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Frank Schätzing
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Frank Schätzing
Frank Schätzing, Jahrgang 1957, begibt sich mit Breaking News einmal mehr auf neues Terrain: »Mein Kopf fühlt sich dort am wohlsten, wo ich noch nie war.« Schätzing lebt und schreibt in Köln.
Von ihm sind u.a. erschienen: Tod und Teufel, 1995, Lautlos, 2000, Der Schwarm, 2004, Limit, 2009.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Tom Hagen, gefeierter Star unter den Krisenberichterstattern, ist nicht zimperlich, wenn es um eine gute Story geht. Die Länder des Nahen Ostens sind sein Spezialgebiet, seine Reportagen Berichte aus der Hölle. Doch in Afghanistan verlässt ihn sein Glück. Eine nächtliche Geiselbefreiung endet im Desaster. Hagens Ruf ist ruiniert, verzweifelt kämpft er um sein Comeback. Drei Jahre später bietet sich die Gelegenheit in Tel Aviv, als ihm Daten des israelischen Inlandsgeheimdienstes zugespielt werden. Hagen ergreift die Chance - und setzt ungewollt eine tödliche Kettenreaktion in Gang …
Breaking News ist ein mitreißender Thriller vor dem Hintergrund einer epischen Saga. Zwei Familien wandern Ende der zwanziger Jahre nach Palästina ein – in eine von Legenden, Kämpfen und Hoffnungen beherrschte neue Welt, wo Juden, Araber und britische Kolonialherren erbittert um die Vorherrschaft ringen. Bis in die Gegenwart, über Generationen hinweg, spiegeln und prägen beide Familien Israels atemlose Entwicklung.
Als Hagen in der jungen Ärztin Yael Kahn eine unerwartete Verbündete findet, erkennt er, dass auch sein Schicksal eng mit der Geschichte des Landes verbunden ist. Doch mit Yael an seiner Seite gehen die Probleme erst richtig los.
Inhaltsverzeichnis
Hinweise des Verlags
Karte
Widmung
2008
1929
1934
1935
1937
1939
1944
2011
1948
1953
2011
1967
2011
1975
1976
2011
1982
2011
1982
2011
1982
2011
2000
2011
2000
2011
2004
2011
2005
2011
2005
2011
2005
2011
Epilog
Glossar
Dank
Breaking News ist ein Roman und damit ein Werk der Fiktion. Die meisten Charaktere sind frei erfunden, andere basieren auf realen Personen des öffentlichen Lebens. Aber auch diese spielen nur Rollen in einem fiktiven Szenario, in dem die reale Geschichte lediglich der Ausgangspunkt für künstlerische Spekulationen ist. Insbesondere gilt dies für Ariel Scharon, auch wenn viele Äußerungen dieser Kunstfigur Originalzitate des realen Ariel Scharon sind und Lebenssituationen dieser fiktiven Figur auf der Basis authentischer Quellen des realen Ariel Scharon nachgezeichnet werden. Dies gilt im besonderen Maße für die fiktiven Ereignisse dieses Kapitels. Die dort geschilderte Einflussnahme durch erfundene Charaktere auf die Romanfigur Ariel Scharon entspringt der freien Fantasie des Autors. Frei erfunden sind darüber hinaus sämtliche Mitglieder der Familie Kahn (Rachel, Schalom, Jehuda, Phoebe, Benjamin, Leah, Miriam, Uri und Yael), ebenso David Cantor, Mansour al-Sakakini und seine Familie, alle Mitglieder des Schin Bet, alle Mitglieder von Samael, Krister Björklund, Inga Dorn sowie viele Nebenfiguren.
Ausführliches Glossar mit Begriffserklärung hier und zum Downloaden auf breakingnewsroman.com
Für Helge und Regina
2008
Unterwegs in einem Toyota Land Cruiser, sieben Uhr morgens, Sack überm Kopf, unter der Kinnlade zugebunden. Der offene Mund saugt Stoff an, da durch die Nase nicht genug Luft in die Lungen strömen will, doch tatsächlich ist es ein mentales Problem. Das Gewebe ist durchlässig, der Rest Gewöhnungssache.
Kann man sich daran gewöhnen? Seiner Sicht beraubt über Bergstraßen voller Schlaglöcher zu kacheln, während einem die Rückbank ins Kreuz drischt?
Hängt von den Umständen ab. Selbst in weniger zivilisierten Gegenden gibt es nicht viele Gründe, jemandem eine muffige schwarze Kapuze über den Kopf zu stülpen. Entweder wird man gleich darauf erschossen oder aufgehängt, womit sich die Frage nach der Gewöhnung erübrigt hat. Oder man wird verschleppt, hört den gelassenen Schritt des Folterers nahen, seine freundliche Stimme, bevor er einem die Hölle bereitet, solcherlei Unannehmlichkeiten.
Dritte Möglichkeit, man trägt das Ding freiwillig, weil der Fahrer nicht will, dass man sich später an die Route erinnert.
Hagen weiß, dass Björklund neben ihm weniger gut mit der Situation zurechtkommt. Sein Asthma macht ihm zu schaffen. Ihn selbst stört eigentlich nur, dass sich irgendwann mal jemand in seinen Sack erbrochen haben muss. Der Stoff ist sauber, also gewaschen, aber manche Gerüche setzen sich für alle Zeiten fest. Weniger die Moleküle selbst konservieren die Vergangenheit, als vielmehr die Umstände ihres Hineingelangens, etwa so, wie sich die Gedanken Verstorbener in einem Geisterhaus einnisten. Hagen mag sich nicht vorstellen, welches Schicksal der arme Teufel durchleiden musste, der die Kapuze vollgekotzt hat. Möchte glauben, dass er oder sie das Ding ebenso aus freien Stücken getragen hat wie sie beide in diesem Moment, und weiß es doch besser.
War es Marianne Degas, Max Keller oder Walid Bakhtari? Welchem der drei sind unter dem Stoff, der ihn vorübergehend erblinden lässt, Nerven und Magenwände entgleist?
Die Vorstellung beginnt von Hagen Besitz zu ergreifen, dass sie ihm genau einen der Säcke verpasst haben, unter denen sich die Entführten an den Szenarien ihres Sterbens abgearbeitet haben. Als seien nicht Hunderte solcher Säcke im Umlauf, Tausende. Wer stellt so was eigentlich her, denkt er. Gibt es einen Versandhandel für Geiselnehmer? – Aktionswochen, jetzt zugreifen! Kapuze, blickdicht, in S, M oder L, exzellente Qualität, ein Jahr Garantie, sofort lieferbar. Dazu Fußfesseln ›Dadullah‹ mit geräuscharmem Klickverschluss. Nie wieder Knotenmachen, wenn’s schnell gehen muss, klick, und die Fessel sitzt. Bei Abnahme von zehn Sets gibt es den Folterkasten ›Fromme Taten‹ als Gratisgeschenk dazu, also zögern Sie nicht! Rufen Sie jetzt an, verschlüsselt unter –
Degas. Keller. Bakhtari.
Seit Husain ihm eröffnet hat, den Aufenthaltsort der drei Entwicklungshelfer zu kennen, die seit anderthalb Monaten vermisst werden, denkt Hagen an nichts anderes. Zwei Mitarbeiter einer deutschen Hilfsorganisation und ihr einheimischer Fahrer, auf dem Weg nach Qowngowrat im nördlichen Kunduz-Delta verschollen, wohin sie mit einer Wagenladung Medikamente und Infusionslösungen aufgebrochen waren. Nie angekommen. Zuletzt gesehen in der Gegend um Aqli Bur, einem Kaff, das zwischen Reisfeldern und Melonenplantagen in eine Hügelkette gekrümelt liegt, keine zehn Kilometer von Kunduz-Stadt entfernt. Das Übliche. Lehmbauten, Strohdächer, Ziegen, winkende Kinder.
Dort sind sie verschwunden.
Drei Tage später informiert die Organisation – Heal Afghanistan, ein Name, dem das Odium der Selbstüberschätzung anhaftet – das Auswärtige Amt und gibt eine Pressemeldung heraus. Der Faktengehalt geht gegen null. Es gibt kein Bekennervideo, keine Forderung. Im Krisenreaktionszentrum halten sie pfleglich die Hände still. Was sollen sie auch groß unternehmen? Es gilt ja nicht mal als sicher, ob überhaupt jemand die drei hopsgenommen hat. Vielleicht düngen sie längst afghanisches Ackerland. Oder liegen eingebuddelt im Sand der Wüste, von 50 Grad Mittagstemperatur hübsch mumifiziert, die Ötzis kommender Generationen. Will jemand losziehen, sie zu suchen?
Schon besser gelacht.
Weil man den Vorfall andererseits nicht völlig ignorieren kann, veröffentlicht die Presse zehn Zeilen Text, in denen Heal Afghanistan seine Verluste beklagt. Die Meldung erscheint im Nachrichtenfriedhof des Panorama-Teils, als Hagen gerade in seiner Hamburger Wohnung hockt und für sich, Krister Björklund und Inga Dorn den Flug nach Kabul bucht. Von dort soll es weitergehen ins Feldlager Kunduz, Reportage über den Alltag der Bundeswehr.
Ein Job, auf den er nicht die geringste Lust verspürt.
Für Inga mag es ja ganz erhellend sein. Ihr erster Aufenthalt in einer Krisenregion. Aber er? Was zum Teufel soll er da? Wenn nämlich die dortige Informationspolitik der Doktrin des Verteidigungsministeriums folgt, kann er ebenso gut in Hamburg bleiben und seine Reportage googeln. Ihm als Repräsentanten des schandmäuligen Enthüllungsjournalismus, so viel ist sicher, werden sie den Presseoffizier gleich auf den Leib schweißen.
Er liest die Meldung. Liest sie noch einmal.
Dann ruft er Bilal Husain an.
Ob er Näheres über die Sache mit den Verschwundenen in Erfahrung bringen kann.
Bilal Husain ist Hagens Fixer, wie es im Journalistenjargon so schön heißt, sein pakistanischer Kontaktmann. Afghanistans Zukunft wird im Nachbarland verhandelt, und niemand ist so gut verdrahtet wie Husain. Als Berichterstatter für Zeitungen wie The Statesman und Independent News Pakistan hat er Zugriff auf nahezu jede Information, vor allem aber genießt er das Vertrauen der Taliban. Über ihn lancieren sie ihre berüchtigten Videos an die Medien, in denen zum Heiligen Krieg aufgerufen wird oder leichenblasse Ausländer vor von Parolen durchhängenden Fahnen hocken. Alle paar Tage trifft sich Husain mit dem Sprecher der für Kunduz zuständigen Gruppe und verschafft seinen Anliegen Geltung. Im Gegenzug fordert er, dass die Taliban ihn als Vermittler akzeptieren, wenn Verhandlungen mit ausländischen Krisenstäben anstehen. Inzwischen eilt ihm der Ruf voraus, einen gewissen Einfluss auf die Gotteskrieger zu haben, außerdem ist er notorisch klamm.
Husain freut sich, von Hagen zu hören. Was der Job macht, wie es der Familie geht. Eine Ouvertüre an Umständlichkeiten, orientalisch gedrechselt. Hagen ist es recht. Wenn sein pakistanischer Freund ihm eine Story liefert, die ihn aus dem Sommerloch katapultiert, kann er ihm den Koran in Endlosschleife vorlesen.
Endlich sagt Husain: »Klar, Tom. Ich hör mich mal um.«
»Gut. Danke, Bilal.«
»Und du bist sicher, dass sie im Kunduz-Delta verschwunden sind?«
»Zumindest wurden sie da zuletzt gesehen.«
»Verwunderlich.«
»Warum?«
Ständig entführen die Taliban Menschen.
»Aber nicht so hoch im Norden«, sagt Husain, als sie sich zwei Wochen später im pakistanischen Peschawar treffen und aus der Juwelierstraße auf den Chowk Yadgar treten.
»Seltener«, räumt Hagen ein.
Natürlich hat der Fixer recht. Die Netzwerke professioneller Entführer wie Haqqani verfilzen sich weiter im Osten zwischen Khowst und Jalalabad, wo sich Afghanistan einbeult und pakistanisches Grenzland hereinwuchert. Auch im Süden werden Ausländer verschleppt. Im Norden buddeln sie eher IEDs in den Sand und freuen sich wie die Kinder über jeden Soldaten, dem es die Beine wegreißt. Aber wer sagt, dass sie nicht auch da mit den Entführungen anfangen?
Husain schüttelt den Kopf. »Es passt nicht in ihre Strategie.«
»Hätte sich die geändert?«
»Sagen wir, sie schauen hin und lernen.«
»Von wem?«
»Ist das nicht offensichtlich?« Husain lächelt. »Von ihren Feinden natürlich.«
Die Sonne hat Peschawar seit den Morgenstunden gebacken. Jetzt, in der hereinbrechenden Dämmerung, steht die Hitze immer noch wie ein faulendes Gewässer in den Straßen und Plätzen der Altstadt. Jedes Sauerstoffatom scheint an eine Substanz gekoppelt, die beim Einatmen die Lebenserwartung herabsetzt. Der Smog der Zwei-Millionen-Metropole kann es mit Kuala Lumpur, Los Angeles und Peking locker aufnehmen.
»Das ISAF-Dezimierungsprogramm ist eine Sache«, sagt Husain. »Aber es bringt die Taliban auf Dauer nicht weiter.«
Hagen blickt sich um, während sie über den Platz schlendern. Der Chowk Yadgar macht einen heruntergekommenen Eindruck. Nur wenige Besucher schleichen um das berühmte Kuppelmonument herum, die Kameras halbherzig gezückt. Kaum ein Reiseveranstalter empfiehlt noch Trips in die Region, seit ein hochgiftiger Interessencocktail Anfang der Achtziger begonnen hat, den Tourismus nachhaltig zu zersetzen. Afghanische Mudschaheddin waren über die Grenze hierhergeflüchtet, um Kämpfer für ihre Sache zu rekrutieren und Strategien zu entwickeln, wie man der Roten Armee den Weg weisen könnte, in bestem Einvernehmen übrigens mit Onkel Sam. Der zeigte ihnen nicht nur, wie man sowjetische Jets vom Himmel holte, sondern förderte auch noch sehenden Auges die Verflechtung dschihadistischer Ideen zu einem Netzwerk, dessen Name nach dem 11. September 2001 die ganze Welt kennen sollte. Nirgendwo sonst hätte al-Qaida prächtiger gedeihen können als im intriganten Peschawar. Das Gästehaus eines gewissen Osama bin Laden avancierte zum Hotel Terror, Selbstmordattentäter wünschten einander dort gesegnete Himmelfahrt. Es wimmelte nur so von Agenten der CIA und des ISI in der Stadt, von Militärberatern, Journalisten, Dschihadisten, Gangsterbossen und Politikern, Letztere oft in Personalunion.
»Und was ist ihre neue Strategie?«
»Dir wird aufgefallen sein, dass sie versuchen, die Sympathien ihrer Landsleute zurückzugewinnen.«
Stimmt, denkt Hagen.
Dabei kommt es den Taliban zupass, dass sich die ANA, die Afghan National Army, als korrupter Haufen disqualifiziert und die Polizei keinen Deut besser dasteht. Wovon immer ISAF-Ausbilder träumen, wenn sie versuchen, aus Analphabeten, Arbeitslosen und Kriminellen ordnende Allianzen zu schmieden, es geht hoffnungslos schief. Ebenso gut könnten sie die Gefängnisse öffnen und jedem, der nach draußen läuft, eine Mütze, eine Dienstmarke und eine Knarre verehren.
Was nicht ganz stimmt. Es gibt durchaus afghanische Ordnungshüter, die willens sind, ihr Volk zu schützen.
Nur bitte, vor wem? Vor den Taliban? Vor der grassierenden Vetternwirtschaft, die sich wie ein Bandwurm durch alle politischen Institutionen zieht? Vor Hamid Karzai, dem Präsidenten, dessen Halbbruder von Kandahar aus die Drogenmafia regiert und sich von der CIA goldene Türklinken bezahlen lässt? Vor den eigenen Kollegen, die ihre Waffen, kaum dass sie sie erhalten haben, an jene verscherbeln, die sie damit bekämpfen sollen?
Die Antwort lautet: Ja.
Und noch was: Wenn du dich nicht kaufen lässt, braver Polizist, bist du morgen ein toter Polizist.
Kein Wunder, dass die meisten Afghanen jedem ISAF-Soldaten hundertmal mehr über den Weg trauen als den eigenen Sicherheitskräften, die ihre Gunst nach Höchstgebot verteilen, rund um die Uhr stoned sind und eines definitiv nicht tun:
Recht sprechen.
Aber die Taliban tun es.
Gezielt haben sie begonnen, das Vakuum staatlicher Gesetzlosigkeit zu füllen, Konflikte nach den Statuten des Paschtunwali zu schlichten, den Bedürfnissen von Menschen Rechnung zu tragen, die nichts anderes kennen, als im Matsch ihrer Felder zu schuften, ohne je weiter von zu Hause entfernt gewesen zu sein als zehn Kilometer. Menschen, die keinen Schimmer haben, was ein Wahlzettel ist, die Namen darauf nicht lesen und ihren eigenen nicht schreiben können, ganz zu schweigen davon, dass ihnen die Kandidaten nichts sagen und schon gar nicht dieser Hamid Karzai in einem Kabul, das auf dem Mond liegen könnte, so weit ist es von ihrem Leben entfernt. Deren berechtigte Frage lautet, wie Herr Karzai beispielsweise das Problem zu lösen gedenkt, das Abdullahs idiotischer Neffe der Gemeinschaft eingebrockt hat, indem er Ajmals Tochter länger anglotzte, als es feierlich war. Was durchaus ein Grund sein kann, Blut zu vergießen. Hätte Herr Karzai in der Sache nicht längst mal seinen Arsch herbewegen und mit allen Beteiligten sprechen müssen?
Nicht?
Wozu ihn dann wählen?
Man muss die Taliban nicht mögen. Aber sie lösen Probleme.
»Weil sie gut aufgepasst haben«, sagt Husain. »Weil sie die Strategien der ISAF sehr genau studieren.«
Dabei sind sie Zeuge geworden, wie die ISAF eine Charmeoffensive nach der anderen fuhr. Die Soldaten gingen in die Ortschaften, zogen sich die Sorgen der Einheimischen rein, studierten ihre Gebräuche, versuchten, wie Afghanen zu denken. Sie entwickelten sich zum lieben Onkel, der Geschenke mitbrachte, die Infrastruktur verbesserte, kleine Bündnisse schloss und den Gotteskriegern, die vorzugsweise aus Gewehrläufen predigten, langsam aber sicher die Sympathien abgrub.
»Also haben sie sich gesagt: Das können wir auch.«
Und die Strategie adaptiert.
Ganz schön schlau, denkt Hagen. Die Erfindung des Kuscheltaliban.
Na ja, vielleicht nicht ganz.
Aber für Leute, die mit Inbrunst Ehebrecherinnen steinigen, geben sie sich unerwartet flauschig. Und Blut ist dicker als Wasser, paschtunisches allemal. So hat sich die Stimmung langsam gedreht. Der Witz dabei ist, dass die ISAF anfangs nicht das Geringste von alledem mitbekam. Sie kannte es ja nicht anders, als dass die Menschen Angst vor den Taliban hatten. Erst als ihre Soldaten aus Dörfern beschossen wurden, in denen sie gestern noch Schulen gebaut hatten, ging den Befehlshabenden ein Licht auf, und sie fragten sich entgeistert, was da schieflief.
Hatte man sich nicht glänzend verstanden?
Man hatte. Und die meisten Afghanen mögen die ISAF-Soldaten ja auch, jedenfalls mehr als ihre eigene Regierung. Nur dass man hier überlebt, indem man Zweckbündnisse eingeht, und nicht, indem man jemanden mag.
»Inzwischen ist den Alliierten klar geworden, dass sie den Schacher um Sympathien verlieren werden. Das funktioniert nur in der Fläche, durch ständige Präsenz.«
»Und dafür sind sie zu wenige.«
»Tja«, lächelt Husain. »Die Geburtswehen der Erkenntnis.«
»Also geht die ISAF dazu über, den Schmusekurs der Mudschaheddin anderweitig zu hintertreiben, indem sie Jagd auf deren Führer macht und sie gezielt ausschaltet?«
Husain nickt. »So, wie es die Israelis mit der Hamas tun.«
Hagen betrachtet ihn. Was mag vorgehen im Kopf des Fixers? Zu fragen, auf wessen Seite er steht, wäre obsolet. Hier steht man auf der richtigen Seite, indem man sie wechselt.
Aber woran glaubt er?
Sie sind in die Marktstraße eingebogen, die zum Cunningham-Uhrturm führt, einem Relikt aus der Zeit, als die Briten noch von ihrem Weltreich träumten. Mit fortschreitender Abkühlung belebt sich das Viertel. Tuk-Tuks, die Scheiben unter Aufklebern verschwunden, schießen ihnen entgegen. Ins Knattern wartungsüberfälliger Zweitakter mischt sich das Hornissengebrumm der Mopeds, Fahrradfahrer trainieren den Überlebensslalom. Wer hupen kann, hupt: um Freunde zu grüßen, Fußgänger aufzuscheuchen, Verkehrsvergehen anderer zu kommentieren, eigene anzukündigen und schlicht, weil der Besitz einer Hupe impliziert, sie zu benutzen.
»Hunger?«
Husain stoppt vor einem der Stände. Gemüse, Früchte, Gewürze locken in flachen Schalen. Eine Duftwolke überlagert den Gestank der Abgase. Lebende Hühner drängen sich in gestapelten Käfigen. Der Fixer macht einen Scherz mit dem Händler auf Urdu, Mangos und Rupien wechseln den Besitzer. Der Händler schneidet die Früchte für sie auf, bevor sie weiterziehen.
»Das bereitet den Taliban Sorgen«, sagt Husain kauend. »Also was tun? Zurück zum Straßenterror? Sich weiter auf Marktplätzen in die Luft sprengen und hoffen, dass unter den Hunderten Zivilisten, die dabei draufgehen, auch ein paar ausländische Soldaten sind? Damit würden sie das Vertrauen der Bevölkerung nur wieder verspielen.«
»Ganz werden sie es nicht lassen«, meint Hagen, Saft in den Mundwinkeln.
»Nein, aber wie schon gesagt –«
»Es bringt sie nicht weiter.«
Und offene Kriegsführung ebenso wenig. Diesen Flächenkonflikt könnten die Taliban wiederum nicht gewinnen. Nicht gegen die Hightech-Maschinerie der ISAF. Wie also schwächst du einen Gegner, der deine Anführer mit Nachtsichtgeräten aus den Löchern treibt und abschießt wie Hasen? Indem du seine neue Strategie ebenso adaptierst wie seine vorherige, so wie du bislang noch jede seiner Strategien adaptiert hast.
Hinschauen und lernen.
Die Fläche opfern zugunsten eines gezielten Targeting.
»Und zwar High Targeting«, nickt Husain.
Weil die Taliban verstanden haben, dass dieser Krieg nur in den Medien zu gewinnen ist. Und die Medien sind es leid, den immer gleichen Blutfleck heranzuzoomen. So tragisch es sein mag, wenn Zivilisten zerfetzt werden und Gefreite in Särgen zurück nach Hause reisen, die Welt gewöhnt sich auch daran. Wer fragt noch nach der täglichen Autobombe im Irak? Das sind keine Meldungen mehr, das ist Hintergrundrauschen.
»Also setzt die Quetta Shura fortan auf Aktionen, die den Taliban eine 24-stündige Dauerpräsenz auf CNN gewährleisten. Das ist die neue Direktive.«
»Sieger nach Sendezeit.«
»Richtig.«
Quetta Shura. Was nach der US-Intervention vom Taliban-Regime geblieben war, hat sich unter Mullah Mohammad Omar ins pakistanische Quetta abgesetzt und dort neu formiert. Ein Krake, der unablässig neue Arme produziert, sich vom Nachbarland aus in eine afghanische Provinz nach der anderen schlängelt, um den Ungläubigen die Luft abzuschnüren und die alten Verhältnisse wiederherzustellen. Die Quetta Shura, das sind die Bosse. Sie geben den Kurs vor.
Hagen schnaubt geringschätzig. »Wenn sie es anfangen wie im April, werden sie mit ihrer Direktive nicht weit kommen.«
Da haben sie nämlich versucht, Karzai zu töten.
Und es vermasselt.
Aber was, wenn es gelingt? Den Präsidenten zu ermorden. Seine Gouverneure. Den Oberkommandierenden der ISAF! Das Kabul Hilton anzugreifen. Erlangen die Taliban erst mal die Hoheit über die Prime Time, haben sie im Prinzip gewonnen. Und die ISAF, dieser muskelbepackte Koloss in all seiner Ohnmacht, kann nach Hause wanken.
»Du weißt nicht zufällig, was sie gerade planen?«
Husain sieht ihn an. Hebt die Brauen.
»Ich frag ja nur.«
»Mann, Tom! Ich handele mit Informationen, nicht mit Menschenleben.«
Schön gesagt.
»Aber sie planen irgendetwas?«
»Ich weiß, dass sie alle Energie auf eine große Offensive richten. Mullah Omar selbst hat die Sache in die Hand genommen. Währenddessen wollen sie Ruhe halten. Nichts gefährden. Sich nicht in Nebenkriegsschauplätzen verlieren.«
»Vielleicht auch ein bisschen den Erschöpften spielen?«
»Auch das, ja.«
Hagen versteht. Plötzlich liegt alles offen vor ihm. »Und da, unpassend wie Herpes, sacken ein paar Bauernsöhne im Hinterland von Kunduz drei Entwicklungshelfer ein.«
»Das Ende der Erntezeit. Du hast es erfasst.«
Die Ernte endet.
Die Armut nicht.
Also kämpfen die Bauern jetzt für die ortsansässigen Taliban und verdienen sich ein paar Afghani dazu. Nichts Ideologisches. Es geht rein ums Überleben. Die ISAF kennt das. Immer nach der Ernte schießt die Zahl der Anschläge in die Höhe. Und die Bauernlümmel in Aqli Bur denken natürlich, drei Geiseln bringen gutes Geld, wenn sie sie an die Gotteskrieger verkaufen, und sperren sie fürs Erste in den Ziegenstall.
»Aber die Quetta Shura kauft gerade nicht.«
»Nein.«
Denn Geiselnahmen sind Spekulationsgeschäfte. Ebenso Angebot und Nachfrage unterworfen wie Südfrüchte, Rohstahl oder Wertpapiere. Manche Entführungen werden von ganz oben organisiert, oft aber stecken einfach nur verzweifelte Bauernfamilien dahinter oder schlicht Kriminelle. Sie verhökern die Geiseln an lokale Taliban, die verkaufen sie weiter, bis sie schließlich bei den professionellen Netzwerken landen. Entscheidend ist der Marktwert. Wie viele Millionen Dollar, inhaftierte Mudschaheddin, politische Zugeständnisse bekommt man für eine Geisel? Wie hoch ist der Druck der Medien auf ihre Regierung oder jeweilige Organisation, sie freizukaufen? Welchen Propagandaeffekt hat es, ihr vor laufender Kamera den Kopf abzuschneiden?
Heal Afghanistan kann keinen Marktwert geltend machen. Eine unbedeutende NGO mit Sitz in Aachen ohne medialen Einfluss, ohne Lobby, ohne Geld. Das Auswärtige Amt würde sie am liebsten vergessen. Hauptsache, nicht über sie reden. Und solange keine Forderung eingeht, muss man das ja auch nicht.
»Ein paar Tage haben die drei im Stall gehockt und den Bauern die Haare vom Kopf gefressen, bis sich ein Grüppchen Gotteskrieger erbarmte und sie übernahm. Untere Chargen, Provinzkrieger. Die Bauern waren froh, die Typen los zu sein, die neuen Besitzer bildeten sich ein, mit den Geiseln Ehre zu erlangen. Sie dachten, die Netzwerke würden sie mit Kusshand nehmen.«
»Falsch gedacht.«
»Ganz falsch. Erstens hatten sie minderwertige Ware eingekauft, zweitens hustet ihnen die Quetta Shura was, weil Geiselnahmen gerade nicht erwünscht sind.«
»Und wo stecken sie jetzt?«
»Sind etliche Male umgezogen. Seit letzter Woche hängen sie in einem Gehöft fest, irgendwo in den Bergen.«
»Hochgebirge?«
»Eher so was wie die afghanische Toskana.«
»Das könnte überall sein.«
»Mein Kontakt sprach von besiedeltem Gebiet. Auf dem Gelände eines Clanchefs, der mit den Taliban sympathisiert. Keine Ahnung, wo genau.«
Hagen streicht sich über den Schädel.
»Die Stimmung dort dürfte nicht gerade zum Besten sein.«
»Nein. Sie haben sich drei Ladenhüter eingefangen. Müssen sie füttern, am Leben halten. Noch hoffen sie, dass die Quetta Shura einlenkt und sie ihnen abkauft.«
Was erklärt, warum bislang keine Forderung eingegangen ist. Übernähme die Quetta Shura die Geiseln, wäre es an ihr, Forderungen zu stellen. Tut sie es nicht, muss die Gruppe, die sie jetzt am Bein hat, sich was anderes überlegen. Ob die oberste Führung ihr gestatten wird, die Sache im Alleingang durchzuziehen, ist fraglich, solange die Devise lautet, nicht am Schlaf der Welt zu rühren.
Drei Geiseln, nach denen kein Hahn kräht. Nicht in Deutschland, nicht am Hindukusch. Was für ein Schicksal.
Eine quietschgelbe Autorikscha hält wie besessen auf sie zu, hupt. Husain geht ohne Hast zur Seite, Hagen, in Gedanken, bringt sich mit einem Sprung in Sicherheit. Die Menge spült sie Richtung Karimpura Bazaar. Männer im Punjabidress eilen an ihnen vorbei, die Kappen leuchtend in der Dämmerung, Signale der Frömmigkeit an eine höhere Entscheidungsebene. Andere in Kaftans, selten ein Turban. Wenn, dann krönt er die verwitterten Züge eines Alten mit weißem Bart. Dazwischen Frauen im pluderigen Salwar Kamiz, bunte, halbtransparente Stoffe, die Konturen erahnen lassen. Ein bisschen Ali-Baba-Romantik, konterkariert vom Lianengewirr der Stromkabel, die zwischen monströsen Verteilermasten bedenklich in die Straßen hineinbaumeln. Bedruckte Fahnen blähen sich von den geschnitzten Holzbalkonen alter Kaufmannshäuser, Stern und Sichel, Koranverse, schnauzbärtige Filmstars, angehimmelt von Schönheiten mit wallender Mähne und vorgereckten, notdürftig verhüllten Brüsten.
Ein Panorama der Widersprüche.
Dann biegt ein Fahrzeug in die Straße ein. Auf den ersten Blick erheiternd. Als ginge es um eine Wette, wer die meisten Männer auf der Ladefläche eines Pick-ups unterbringt. Dicht gedrängt sitzen sie da, fast übereinander, die Beine nach allen Seiten hinausbaumelnd. Tragen schwarze, weiße und gemusterte Turbane, gepflegte Bärte. Ein Gebilde starrend wie ein Igel, weil praktisch jeder eine Panzerfaust oder Kalaschnikow gen Himmel reckt.
»Teerik-i-Taliban«, sagt Husain, und seine Lippen kräuseln sich.
Pakistanische Taliban.
Alles andere als erheiternd. Peschawar ist ein Pulverfass, die logistische Hochburg der Gotteskrieger. Sozusagen ihr Todesstern. So was von antiamerikanisch, dass das Wort Verbündeter aus Pervez Musharrafs Mund wie blanker Hohn klingt. Was immer Pakistans Regierung mit den Stammesältesten der Grenzprovinzen abzusprechen pflegte, muss sie heute mit den Taliban verhandeln.
»Die würden Peschawar am liebsten übernehmen«, sagt Husain und spuckt aus. »Aber das können sie nicht. Noch nicht.«
Egal, sie haben die Stadt auch so im Griff. 100 Kilometer von hier windet sich der strategisch wichtige Chaiberpass nach Afghanistan, eine Arterie des Terrors und zugleich Hauptversorgungsroute der NATO. Führt über eine Grenze, die de facto keine ist, weil unkontrollierbar. In den zerklüfteten Gebirgen ringsherum herrschen die Taliban im Verbund mit al-Qaida, Haqqani und usbekischen Dschihadisten, Arabern, Tschetschenen und Extremisten sämtlicher Couleur. Wer den Krieg in Afghanistan für sich entscheiden will, muss ihn in Pakistan gewinnen.
Sobald die drei Entwicklungshelfer erst mal in dieses Grenzgebiet verschleppt werden, sind sie verloren. Niemand kann ihnen dort helfen. Noch mauert die Quetta Shura. Was aber, wenn sie ihre Meinung ändert und die Geiseln doch noch übernimmt? Kein ISAF-Soldat würde sie im Hochgebirge je finden, dort, wo die richtig schlimmen Mistkerle sitzen. Die Köpfeabschneider.
Hagen überlegt.
Was Husain ihm bis jetzt verraten hat, reicht für einen Artikel.
Nicht für eine Story.
Der Fixer steuert ein Café an. In einer Theke prangen Süßigkeiten aus Nüssen, Mandeln und Karamell, Töpfchen mit Shahi Tukra. Hagen liebt Shahi Tukra, hoher Suchtfaktor, doch er bleibt stehen und hält Husain am Ärmel zurück.
»Sag mal, Bilal –«
»Was?«
»Kannst du mich hinbringen?«
»Wovon redest du?«
»In dieses Gehöft. Zu den Geiseln.«
Husain runzelt die Brauen. Er sagt nicht »Hast du sie noch alle?« oder »Schlag dir das aus dem Kopf!«. Er schaut Hagen einfach nur in die Augen und wartet.
»Ich will ein Interview. Mit den Entführern. Sag deinem Kontaktmann, ich werde in Deutschland den nötigen Druck erzeugen, den sie brauchen, damit ihre Geiseln was wert sind. Ich bringe diese Typen in die Medien. Verhelfe ihnen zu Ehre. Dafür darf ich mit allen sprechen und Fotos machen.«
»Hilfst du damit auch den Geiseln?«, fragt Husain.
»Denen verschaffe ich Öffentlichkeit.« Hagen lächelt. »In Berlin scheinen sie beschlossen zu haben, die Sache auszusitzen. Davon werden sie sich verabschieden müssen.«
Husain hebt das Kinn, schaut nach rechts und links. Bläht die Nüstern, als erwittere er Unheil. Ein Stück weiter verschwindet der Pick-up mit den Taliban hinter dem Cunningham-Uhrturm und hinterlässt ein Gefühl allgegenwärtiger Bedrohung.
»Du weißt, worauf du dich einlässt?«
»Ja.«
»Du legst Feuer. Vielleicht zündelst du an der richtigen Stelle. Vielleicht an der falschen.«
»Bilal, verdammt! Die hocken da, ohne dass sie einer haben will! Was meinst du, werden die Taliban mit ihnen machen? Sie adoptieren? Wer wird sie vermissen, wenn keine Zeitung über sie schreibt, sich keiner öffentlich für sie einsetzt, die Bundesregierung nicht den Arsch hochkriegt. Schlimmer kann es doch gar nicht kommen!«
Husain schürzt die Lippen.
»Warum habe ich bloß das Gefühl, dass irgendwas in deiner Gleichung nicht stimmt?«
»Die Kohle stimmt auf jeden Fall.«
Der Blick des Fixers verliert an Glanz. Ein kaum spürbarer Anflug von Resignation, weil er weiß, wie sehr er auf das Geld angewiesen ist.
»Was nun? Ja oder nein?«
»Ich hör mich mal um.«
Seitdem: Funkstille.
Zehn Tage nach ihrem Treffen in Peschawar steht Hagen auf einer Anhöhe in der Provinz Kunduz und schaut hinab ins Tal. Kubische Bauten schachteln sich auf einer Fläche von rund drei Quadratkilometern ineinander, geduckt und von Lehmmauern gesäumt. Afghanische Ländlichkeit. So archaisch in ihrer Anmutung, dass man meint, mit der Zeitmaschine hierhergereist zu sein. Sträucher und Matten aus hohem Gras sprießen entlang schnurgerader Bewässerungsgräben. Im Süden ein Weiher, filigrane, Schatten spendende Bäumchen. Äste, die im backofenheißen Wind fiebrig zittern. Jenseits der Felder endet die Vegetation fast übergangslos. Ein paar lindfarbene Schlieren noch, als habe der Maler dieses Bildes den letzten Rest Grün, das er so üppig ans Dorf verschwendet hat, aus den Borsten seines Pinsels in die mondartige Ebene geschmiert. Dann nichts mehr. Nur Staub und Geröll bis zum Fuß der Berge, die so sandfarben und kahl sind wie das Flachland.
Warum sie hier sind?
Gotteskrieger-Alarm.
Hagen reibt Staub aus seinen Augenwinkeln, denkt: Würden all die Heerscharen radikaler Islamisten, eifernder Ultraorthodoxer und fanatischer Christen erhört und der so innig herbeigesehnte Erlöser kehrte zu ihnen zurück – sie würden ihn totschlagen.
Er wäre ihnen nicht radikal genug.
Immer wieder verblüffend. Gedanken, ausformuliert und schlüssig, als habe sie jemand programmiert. Sein Hirn, eine Festplatte. Irgendwo Finger, die über ein Keyboard huschen: Würden all die Heerscharen – speichern, versenden –
Jemand schickt E-Mails an seinen Cortex.
Er blinzelt. Legt den Kopf in den Nacken. Fällt in die blaue Wüste des Himmels. Tarnblau. Gottes Tarnung, wenn er denn existiert.
Was Hagen bezweifelt.
Nicht, dass ihm der Glaube an den Fronten der Verelendung abhandengekommen wäre. Mit derartig larmoyantem Quatsch brüsten sich andere. Wichtigtuer, die ihr Erlebnisdefizit auszugleichen suchen, indem sie jeden Kadaver im Straßengraben zum Anlass nehmen, gleich die Sinnfrage zu stellen. Hagen hasst sie. Hasst ihre taumelige Betroffenheit, mit der sie Ahnungslose in Hotelbars zulabern. Die Typen rücken seinen Berufsstand in ein schlechtes Licht. Würden sich das Wort Krisenjournalist am liebsten auf die Stirn tätowieren lassen. Erzählen dir, angesichts Tausender Toter, die das Aufbäumen des Meeres in Südostasien, der blutige Wahnsinn afrikanischer Bürgerkriege, die Gefräßigkeit eines Virus hinterlassen haben, nicht mehr an Gott glauben zu können.
Als wäre der Chef verhandelbar.
Hagen sieht das anders. Wer aufrichtig an einen Schöpfer glaubt, muss aushalten können, dass er auch für den Mist verantwortlich ist. Kosovo. Somalia. Darfur. Tschad. Khao Lak. Irak. Afghanistan.
Den ganzen Mist.
Hagen hat nie an Gott geglaubt. Jedenfalls an keinen von denen, die im Angebot sind. Mit zehn, dem Katholizismus zwangsanvertraut und damit zur sakramentalen Sündenvergebung genötigt, hatte er es im Grunde schon hinter sich. Kroch in die drückende Schwüle des Beichtstuhls, ratlos, was er dem Schemen hinter dem Gitter erzählen sollte. Fragte sich schweißnass: Vergebung, wofür? War sich keiner Schuld bewusst. Das einzige echte Problem in der knappen Bilanz seiner kindlichen Verfehlungen würde entstehen, wenn er die Erwartungen des Schemens enttäuschte, indem er gar nichts sagte. Weil sich jener nämlich, sobald er der hölzernen Kiste mit ihren muffigen Vorhängen entstiegen wäre, in der er wie in einem Passbildautomaten hockte, umgehend wieder in das ganz und gar unschemenhafte, von allen gefürchtete Arschloch zurückverwandeln würde, das Ohrfeigen mit noch größerer Inbrunst austeilte als den Leib Christi.
Gottes Diener hatte Schwung im Handgelenk.
Also brachte Hagen seine Lippen ganz nah ans Gitter und wisperte hindurch, was ihm so in den Sinn kam. Eltern angelogen. Bei Rot über die Straße gelaufen. Reichte das? Er versuchte es mit Schweigen. Auch der Schemen schwieg, offenbar noch nicht zufrieden. Drei Sünden sollten es wohl sein, um die Fehlbarkeit eines Zehnjährigen hinreichend unter Beweis zu stellen, damit der Mann hinter dem Gitter was hatte, was er ihm vergeben konnte.
Na schön: Einem Jungen die Mütze vom Kopf gerissen und aufs Schuldach geworfen.
Das hatte er aus Tom Sawyer, was anderes fiel ihm nicht ein. Wenigstens klang es originell, auch wenn Sawyers Schule eingeschossig, jene hingegen, in die Hagen ging, ein fahler Klotz von sieben Stockwerken war, was die Glaubwürdigkeit der Geschichte unterhöhlte. Doch die Nachfrage blieb aus. Vielleicht freute sich der Priester sogar. Mal was anderes, da er sich den Quatsch von den angelogenen Eltern schon im Dutzend hatte anhören müssen. Das Urteil erging, und Hagen – zu zwei Vaterunser und einem Ave Maria verdonnert – räumte seinen Platz für den nächsten Schüler, damit der sich was aus den Fingern saugen konnte.
Sagte sich, na ja.
Wenn Gott Wert auf so was legt.
Und dachte im selben Moment, dass Gott nicht den geringsten Wert darauf legte, weil es ihn gar nicht gab. Nicht geben konnte. Der prügelnde Priester hatte ihn erfunden. Warum? Um Macht zu erlangen. Eindeutig ging es darum. Macht. Und wie jeder, der nach Macht strebte, war auch dieser Priester bestechlich. Korrumpierbar durch Kinderlügen.
Zum Totlachen.
Nie im Leben würde Gott einen solchen Schwachkopf in seinem Namen schalten und walten lassen, der sich mit einer Sündenpreisliste in eine Kiste setzte, um Halbwüchsigen ein schlechtes Gewissen zu machen.
Aber der Priester saß dadrin und tat genau das.
Und Gott war eine Erfindung.
Der Kampf um Macht, so viel war klar, wurde zugunsten desjenigen entschieden, der die beste Geschichte auf Lager hatte. Also beschloss Hagen, dass er derjenige sein würde.
Er würde Geschichtenerzähler werden.
Großartige Geschichten liefern.
Er würde die Wahrheit erzählen.
Sein Nacken knirscht, als er den Kopf weiter zurück biegt. Der Himmel saugt ihn ein. Schweiß überzieht seinen kahl rasierten Schädel. Er fährt mit der Rechten darüber hinweg, wischt die Finger an der Hose ab. Sofort kommt neue Flüssigkeit nach.
Schicht um Schicht verdampft er in der Mittagssonne.
Neben ihm bläst der Presseoffizier Luft durch die Backen.
»Scheißhitze.«
Hagen lächelt.
Du Clown, denkt er. Ich wette, du hast letzten Monat noch in Potsdam gesessen und einen Schreibtischsessel vollgefurzt. Dort im Einsatzkommando biegen sich die Schultern unter Gold und Silber, nur dass keiner von denen je sein Leben verteidigen musste. Nie unter Beschuss lag. Sich nie fragen musste, ob sein nächster Schritt sein letzter sein wird, weil er auf eine verdammte Personenmine latscht. Ein Horror, der das Feldlager Kunduz schockgefrostet hat: Minen und Improvised Explosive Devices. Wer will schon als Torso in einem Rollstuhl landen oder als Überrest seiner selbst aus einem Spähpanzer gezogen werden, den eine IED gerade in einen Haufen qualmendes Blech verwandelt hat? Dann lieber eine Kugel. Ehrenhaft sterben, mit der Waffe in der Hand.
Soldatenromantik?
Nicht im Mindesten. Mag sein, dass sie hier Bruce Willis auf ihren Laptops gucken – »Was denn sonst, Mann, wir sind im Krieg, natürlich gucken wir Kriegsfilme!« –, aber im Grunde will jeder nur nach Hause. Kann er nicht. Also beginnt er darüber nachzudenken, was wäre, wenn.
Wenn schon sterben, dann am liebsten –
Die Wahrheit ist, dass die meisten auf irgendwas treten oder über irgendwas fahren, das explodiert.
So wie vor zwei Tagen. District Chardara. Sprengfalle.
Wie vor drei Wochen.
Als Folge solcher Tragödien weiß jeder Gefreite am Hindukusch mehr vom Alltag des Tötens und Getötetwerdens und hat seinen eigenen Angstschweiß öfter gerochen als der komplette Generalstab im gemütlichen Deutschland, der seinerseits zu wissen meint, wie die Stationierten fühlen, welche Ausrüstung sie brauchen, was gut für sie ist und wie sie das aufsässige Kind Taliban zu schaukeln haben.
Der ihnen erzählt, das hier sei kein Krieg.
Es ist Krieg, denkt Hagen, und wenn ihr tausendmal behauptet, es wäre keiner. Und an Krieg gewöhnt man sich nie! An nichts, was er mit sich bringt.
Man hat nur einfach keine Wahl.
»Tal Gozar«, sagt er zu dem Presseoffizier. »Haben Sie noch mal darüber nachgedacht?«
»Tut mir leid, Tom.«
»Ich kenne das Risiko.«
»Trotzdem.« Der Mann schüttelt den Kopf. »Ich kann das nicht verantworten.« Er atmet schwer. Ist blass, wirkt ausgedörrt. Besonders gut geht es ihm nicht.
»Sie trinken zu wenig«, sagt Hagen und versucht, Besorgnis mitschwingen zu lassen.
»Eigentlich nicht, ich –«
»Doch. Ich war öfter in solchen Gegenden als Sie. Die meisten brauchen Wochen, um sich zu akklimatisieren. Also trinken Sie. Gehen Sie in den Schatten. Folgen Sie meinem Rat, vertrauen Sie mir.« Er grinst. »Sagen Sie einfach, Tom Hagen hat in allem mehr Erfahrung als ich. Den kann ich gehen lassen, wohin er will.«
Der Offizier grinst schwach zurück.
»Jetzt sagen Sie’s schon.« Inga neben ihm lacht. »Sagen Sie, Tom hat mehr Erfahrung als ich. Ein Teufelskerl, dieser Hagen! Er hat den Durchblick und ich hab Kreislaufprobleme.«
Fehler.
Die Stimmung schlägt um. Wahrscheinlich denkt der Mann, dass Hagen sich ihm gegenüber zackige Sprüche erlauben kann, nicht aber ein Gör mit der Welterfahrung eines frisch geschlüpften Kükens. Volontärin? Lachhaft. Dem Kerl an die Seite gestellt, damit er im Feldlager keinen Soldatinnen an den Drillich geht, das denkt der Mann, und dass Kunduz kein Kindergarten ist.
»Hier geht es nicht um journalistische Erfahrung«, sagt er verschnupft.
Sie schauen eine Weile hinab ins Dorf.
»Wo ist eigentlich das Problem?«, insistiert Inga. »Wenn der Norden so sicher ist, wie Sie sagen, kann uns doch gar nichts passieren, oder? Es sei denn, Sie sagen was Falsches. Dann hat die Öffentlichkeit ein Recht –«
»Inga.« Hagen zeigt auf das Pumpgebäude des Wasserwerks, das wie ein Bauklötzchen aus der Anhöhe sticht. Björklund lichtet dort die Soldaten der Schutzkompanie ab, die den Hügel nach Südwesten sichern, ihre schweren G36K am Schulterriemen. Die Mündungen der Gewehre zeigen zu Boden.
»Frag Krister doch mal, ob er was braucht.«
Die Volontärin verdreht die Augen. »Der braucht nichts.«
»Frag ihn trotzdem.«
Sie zuckt die Achseln, zockelt ab. Schwingt provozierend die Hüften, allemal lohnender anzuschauen als die Tristesse der Tiefebene ringsum. Wohl darum scheint der Presseoffizier zu denken, der Verlag habe sie Hagen als Groupie spendiert, aber das stimmt nur bedingt. Inga ist talentiert. Dass sie außerdem weiß, wie man ein gut proportioniertes Becken zum Einsatz bringt – und sei es nur, um einen staubigen Platz zu überqueren – , wird ihrer Karriere kaum hinderlich sein.
Im Camp haben ihr bislang noch alle auf den Hintern geschaut.
Und dabei vielleicht eine Kopfdrehung lang vergessen, wozu der Feind in der Lage ist. Für Sekunden die hypothekenbelasteten Reihenhäuser ausgeblendet, in denen ihre früh mütterlich gewordenen Frauen Erinnerungsfotos betrachten, das Kinderzimmer renovieren und sich den Tag seiner Rückkehr vorstellen. Ablenkung gefunden von der Freundin, die sich bei jedem Telefonat ferner anhört, nicht die erste wäre, die per SMS Schluss macht. Der Satellit, der sie alle miteinander verbindet, ist eine Schnittstelle der Einsamkeit und Inga ein Flashback aus einer Zeit, die Jungs ihres Alters nur noch aus Filmen kennen: 1954, Korea, Truppenbetreuung. Der Hüftschwung der Monroe. Der Arsch der Welt, wie er in den besten Momenten aussehen kann.
Heute guckt keiner.
Der Trupp hat sich verteilt, die Atmosphäre ist aufgeladen. So viele Male sind sie schon hier gewesen. Wann immer sie mit ihren Geländewagen reingerumpelt kamen, zogen sie einen Kometenschweif von Kindern hinter sich her. Haben das Wasserwerk wieder instand gesetzt, den Bau einer Mädchenschule in Angriff genommen. Waren gut gelitten. Freundliche Worte, Tee mit dem Malik.
Nie ein Problem.
Jetzt ist nichts so, wie sie es erwartet haben.
Gespenstische Stille liegt über der Ansiedlung. Ein paar Ziegen geraten ins Blickfeld, blöken verschreckt. Ein Junge treibt sie dem dunklen Schlund eines Stalls entgegen, augenscheinlich das letzte menschliche Wesen im Dorf. Die Art, wie er läuft, seine Blicke umherirren, lässt darauf schließen, dass er sich am liebsten in Luft auflösen würde.
Kein einziges Mal hebt er die Augen zur Anhöhe.
Er hat Angst.
Wovor? Die Kinder in diesen Dörfern haben keine Angst vor ISAF-Patrouillen.
»Schwarzer Rauch!«, ruft einer der Soldaten.
Das Vokabular des Widerstands. Hagen weiß, dass der Patrouillenführer gleich die Zelte abbrechen wird. Sieht ihn aus dem Schatten des Dingos treten, wo er während der vergangenen Minuten mit dem Kraftfahrtfeldwebel die Lage erörtert hat, startet einen letzten Versuch, den Presseoffizier umzustimmen.
Der Mann schüttelt müde den Kopf.
»Ich soll vom Alltag unserer Soldaten hier erzählen«, beharrt Hagen. »Dafür muss ich was zu erzählen haben.«
»Haben Sie doch.«
»Machen Sie Witze? Seit einer Woche werden wir Zeuge, wie das 13. Kontingent seine Panzer entstaubt, heimwehkranke Rekruten zur Poststelle rennen, Feldjäger versuchen, aus einem Haufen afghanischer Analphabeten Polizisten zu machen …«
»Das ist der Alltag unserer Soldaten.«
»Nicht zu vergessen die aufwühlenden Impressionen aus dem Betreuungszelt. Wie viele Dosen Bier darf ein Gefreiter am Tag gleich noch ausnuckeln? Zwei?«
»Das ist nicht fair, Tom.«
»Eben. Es ist nicht fair.« Hagen seufzt. »Dieser Einsatz ist saugefährlich, das ist euer Alltag! Darüber will ich berichten. Nicht, wie ihr im Camp Wasserschutzübungen durchführt für den Fall, dass im Stabszimmer die Kaffeemaschine durchbrennt.«
»Es gibt bestimmt andere Wege, Ihre Auflage zu erhöhen.«
»Das war auch nicht fair.«
»Keiner bezweifelt, dass Sie ein Held sind, Tom.«
»Darum geht es nicht. Die Soldaten hier haben verdient, dass wir davon berichten.«
»Nein. Bleiben wir ruhig mal bei Ihnen. Ich verstehe Sie ja. Im Ernst! Sie sind durch die Mohnfelder von Helmand gekrochen, während die Taliban versucht haben, Ihnen den Arsch wegzuschießen. Ihr Fotograf steckt Schwarzenegger in die Tasche. Und die Kleine da ist ganz gewiss die Hoffnungsträgerin Ihrer Zunft. Alles begriffen.« Er sieht Hagen in die Augen, macht keinen Hehl aus seiner Abneigung. »Aber wir halten es nun mal anders in der Bundeswehr. Wenn die Royal Marines kein Problem damit haben, Reporter in die Green Zone zu schleppen, ist das deren Sache. Mir wurde eingeschärft, Sie und Ihr Team zu schützen.«
»Es wäre unsere freie Entscheidung, wenn wir mitkämen.«
»Falsch. Solange Sie im Rahmen unserer Einsätze berichten, ist es meine Entscheidung. Der Ausflug nach Tal Gozar kann im Desaster enden. Wir wissen, dass der Malik dort einer ganzen Rotte Mudschaheddin Gastrecht gewährt. Die Einsatzleitung rechnet mit bewaffneten Auseinandersetzungen. Viel zu riskant, Sie einzubetten.«
»Es war abgesprochen, dass wir bei regulären Patrouillenfahrten dabei sind.«
»Bei regulären, ja.«
»Ich bitte doch nur darum –«
»Eigentlich dürften Sie hier schon gar nicht dabei sein.«
Hagen kämpft seinen Zorn herunter. Er weiß, dass er seine Gefühle im Zaum halten muss. Also schweigt er, während der Patrouillenführer zu ihnen tritt. In seiner sandfarbenen, dunkel gesprenkelten Montur mit der schweren Schutzweste sieht er aus wie eine Actionfigur aus einem Spielzeugladen. Nur das Sonnenhütchen mit der Schlabberkrempe, das sie hier alle tragen, will nicht recht dazu passen. Damit sieht er aus wie ein Tourist.
»Und?«, fragt der Offizier.
»Keine Chance.« Der Mann lässt einen Arm kreisen. »Selbst wenn wir pro Himmelsrichtung je einen Wolf postieren. Wir können die Zufahrten nicht einsehen.«
»Dafür haben Sie doch die Dingos.«
»Für die Hauptzufahrt, ja. Aber dann gibt’s immer noch ein Dutzend weitere Möglichkeiten, reinzukommen. Jede Menge Engpässe. Ich könnte keinen Dingo auch nur in die Nähe bringen, ohne den Leuten zwangsläufig durch die Küche zu fahren. Und wir sitzen hier oben auf dem Präsentierteller. Keine Gebäude, keine Dächer, auf denen ich Scharfschützen postieren kann. Außerdem –«
Er weist mit einem Kopfnicken ins Dorf.
Die Rauchfahne ist nun weithin zu sehen, ein mahnender Finger. Warnt die Gotteskrieger, dass eine Patrouille in der Gegend ist. Was bedeutet, dass auch sie in der Gegend sind. Nach zu vielen schmerzlichen Lektionen wissen die Soldaten die Zeichen zu deuten. Etwa, wenn Ansiedlungen plötzlich wie verödet daliegen, weil keiner mehr aus dem Haus geht oder sich über Nacht zu seinen Verwandten verkrümelt hat. Dann haben die Mudschaheddin unter Garantie einen Hinterhalt vorbereitet oder eine IED gelegt oder beides.
Auch der Junge ist verschwunden, mitsamt seinen Ziegen.
»25 Kilometer bis Lummerland«, sagt der Patrouillenführer fröhlich. »Packen wir’s.«
Lummerland. Die kleine Heimat.
Bier trinken, Bundesliga auf Großleinwand gucken, Billard spielen, kickern. Was offiziell unter ›Betreuungseinrichtung‹ firmiert, ist der Hotspot im Camp Kunduz, ein Zwitter aus Basar und Gartenkneipe, den sie den Soldaten spendiert haben, um den Kopf frei zu kriegen, wenn Terror und Langeweile wechselweise an den Nerven zerren.
Und genervt sind sie hier alle.
Der Presseoffizier schaut finster drein, während sie zum Geländewagen gehen und sich ins Innere schwingen. Er ist sauer, bräuchte dringend jemanden, an dem er sich abreagieren kann, hat aber nur die Umstände. Hagen weiß, dass der Zorn des Mannes nicht wirklich ihm gilt oder Inga. Er muss diesen vermaledeiten Besuch vorbereiten, das geht ihm an die Nieren. Eine Visite, von der kommende Woche zu lesen sein wird, sie sei völlig überraschend erfolgt. Der oberste Dienstherr der Bundeswehr wird sozusagen aus dem afghanischen Himmel fallen, »unerwartet wie Vogelscheiße«, um es mit Kristers Worten auszudrücken.
Hagen sieht Inga in den anderen Wolf steigen. Lachen klingt auf, tüncht die Anspannung. Soldaten, die sich freuen. Über die weibliche Begleitung und mehr noch über den Umstand, endlich von hier abhauen zu können. Als Letzter kommt Krister Björklund angelaufen und quetscht sich neben Hagen auf die Rückbank.
»Und was ist die Alternative?«, will der Presseoffizier wissen.
»Vielleicht die Mädchenschule in Aliabad?« Der Patrouillenführer wartet die Antwort nicht ab, spricht in sein Funkgerät. »An alle, geänderte Route. Wir fahren über die LOC Pluto zurück. Firm, fair, friendly, wenn’s durch Ortschaften geht, klar, Herrschaften? Der August war trocken, wir wollen die Leute nicht in Staubschwaden ersticken. Also runterschalten. Vollregelung Feuerverbot, wie gehabt.«
Geänderte Route. Die Taliban sollen nicht wissen, wo die Ungläubigen entlangfahren.
Sie wissen es trotzdem.
Kies knirscht unter den Reifen. Der Wolf rumpelt den Weg von der Anhöhe hinab in die Ebene, eine Staubfahne hinter sich herziehend. Die anderen Fahrzeuge folgen dichtauf.
»Das geht nicht«, nörgelt der Presseoffizier. »Wir haben schon die Jungenschule in Baghlan als ersten Besuchspunkt.«
»Die Mädchenschule ist besser.«
»Warum?«, fragt Hagen.
Der Kompaniechef wendet den Kopf nach hinten und lässt ein Lächeln spielen. Seine Sonnenbrille ist mit feinem Staub überpudert.
»Herzenssache.«
»Ach was.«
»Doch, ehrlich. Die Soldaten haben für den Wiederaufbau gespendet. Von ihrem Sold, den paar Kröten. Anders wäre es gar nicht gegangen. Ich sage Ihnen, die lieben diese Schule!«
»Er will aber nicht noch eine Schule«, murrt der Offizier. »Er will ein Wasserwerk. Er liebt Wasserwerke!«
»Das hier zeigen wir ihm jedenfalls nicht.«
Natürlich weiß der Presseoffizier, dass der Patrouillenführer recht hat, auch wenn er als ranghöherer Dienstgrad für den Moment erheblich mehr Theater machen könnte. Er ist Hauptmann, der andere Oberleutnant. Aber vielleicht hat der Schreibtischkrieger, jetzt wo ihm bei 45 Grad im Schatten die Puste ausgeht, doch einiges mehr von Afghanistan begriffen als die aufgeblasenen Säcke im Einsatzkommando. Außerdem ist der Presseverantwortliche nicht das Problem. Nur ein Typ, der noch mal befördert werden will. Um das Problem zu verstehen, muss man wissen, dass in die Luft gesprengte oder sonst wie getötete deutsche Soldaten nach dem Willen des amtierenden Verteidigungsministers Franz Josef Jung keine Gefallenen sind, sondern »einsatzbedingt ums Leben kamen«. Schließlich war der »Gefallene« auf dem besten Weg auszusterben. Nie wieder sollte er durch deutsche Befindlichkeiten geistern, weshalb das Ganze hier auch nicht Krieg heißen darf. Im Krieg gibt es »Gefallene«, das ist das Problem. Im Frieden nippelt man einsatzbedingt ab.
Macht es nicht besser, klingt aber besser.
So sind die Hindukusch-Befohlenen im blinden Fleck gelandet, da man zu Hause am liebsten überhaupt keine Geschichten über Soldaten hören möchte, ob tot, halb tot oder lebendig. Nirgendwo sonst wird einer Armee, die im Ausland den Kopf hinhält, so wenig Rückendeckung zuteil wie in Deutschland, wo einer, wenn er bloß in Uniform zu McDonald’s geht, schon angestarrt wird, als sei er zu blöde, seinen Burger aus dem Papier zu wickeln – sofern er nicht gleich in den Verdacht latenter Mordlust gerät.
Hagen schließt die Augen. Schreibt:
Wir schicken unsere Söhne und Töchter in einen Krieg, für dessen Führung wir sie verachten.
Könnte als Einstieg funktionieren. Weiter?
Sofern man von Führung reden kann. Noch mehr als fürs Kämpfen verachten wir sie dafür, dass sie versuchen, ihre Haut zu retten. Auftrag erfüllt, Auftrag verfehlt. Für beides, Soldat, straft dich der friedliebende deutsche Zivilist mit Verachtung.
Zu polemisch? Vielleicht.
Vietnam-Veteranen sahen sich nach ihrer Rückkehr alleinegelassen. Das ist in Deutschland anders. Als Soldat der Bundeswehr bist du schon vor dem Einsatz allein. Keiner bekundet öffentlich, stolz auf dich zu sein. Keiner will wirklich wissen, wie dein beschissener Alltag dort aussieht, wo sie dich hinmandatiert haben, fast 5000 Kilometer von zu Hause entfernt. Stolz auf die Armee? Nicht im Land der politisch Korrekten, von dessen Boden nie wieder bla bla bla, und so weiter und so fort –
Öffnet die Augen wieder, sieht krüppelige Bäume an sich vorbeiziehen, fahles Buschwerk, verbrannte Felder, ein Panzerwrack. Björklund schießt Fotos. Die Hauptstraßen sind gesäumt mit den rostenden Hinterlassenschaften der Sowjets. Stumme Zeugen dafür, dass in diesem Land kein Krieg und kein Frieden zu gewinnen ist.
Beschissen kann er nicht schreiben.
Zermürbend?
Das mit den Extremisten, die den Erlöser totschlagen, muss er sich auch noch auf den Rekorder sprechen. Schnell, bevor die Hitze sein Hirn so sehr durchgegart hat, dass er es wieder vergisst.
Die Kolonne fährt schneller. Solange keine Menschen am Straßenrand ihre Esel vor sich hertreiben oder sie eine Ortschaft durchqueren müssen, können sie aufdrehen. In diesem Land zwischen Moderne und Mittelalter hocken sie also, die uniformierten Brunnenbauer und Herolde der Demokratie, aufgerieben zwischen Nichtstun und Todesangst, und drehen langsam, aber sicher durch. Und genau darum wuseln Presseoffiziere wie Australian Shepherds um jeden Reporter herum, der anreist, um aus den Camps zu berichten, sorgen für seine Sicherheit, sein Wohlergehen und dafür, dass bloß keinem Gefreiten die Contenance abhandenkommt, wenn er gefragt wird, was er im Innersten empfindet. Und dass keiner der Pressetypen dabei ist, wenn eine simple Patrouillenfahrt zum Horrortrip wird.
Zu spät, denkt Hagen.
Ich war dabei. Unten in Helmand, in der Gegend um Musa Qaleh. Im klaustrophobischen ›Garten‹ der Taliban, inmitten des wuchernden Opiumdschungels. Hab das Gesicht in den Matsch gedrückt, wann immer der Schrei »RPG!« aufklang und die Granaten ranzischten. Hab gehofft, dass es nicht mich trifft, so wie jeder. Und gesehen, wie die Hoffnung starb. Was also wollt ihr vor mir verheimlichen? Dass sich die Verhältnisse hier oben dem Süden angleichen, mit jedem Tag mehr? Wer soll euch noch glauben, der Norden sei sicher, besiedelt von freundlich winkenden Afghanen, die es nicht abwarten können, dass ihnen wackere Bundeswehr-Pioniere Brunnen graben, Schulen bauen und mit den Stammesältesten Tee trinken, umlagert von frohgemut schnatternden Halbwüchsigen. Klar, so war’s mal. Während Briten und Dänen bis an die Zähne bewaffnet im Sperrfeuer der Mudschaheddin lagen, luden deutsche Feldwebel beherzt eine neue Mine im Kugelschreiber durch und schenkten ihn einem strahlenden Kind. Im Norden freute man sich über jeden Taliban, den sie da unten erledigten, aber das ist vorbei.
Lange vorbei.
Und als er gerade denkt, so kommen wir nicht weiter, wir vergeuden hier nur unsere Zeit, piepst sein Handy.
Er zieht es aus der Schutzweste.
Eine SMS. Bilal Husain.
Hagen wischt sich das Geschmier aus Schweiß und Wüstenstaub aus den Augen, lädt den Text aufs Display. Liest, worauf er seit zehn Tagen hofft:
Du bekommst Dein Interview. Alles Weitere mündlich. Bilal
»Nur ihr beide, du und Krister«, schärft Husain ihm am Telefon ein. »Keine Videokamera, keine Satellitenantenne, kein Laptop, keine Handys, klar? Sonst behalten sie euch gleich da.«
»Was ist mit Kristers kleiner Handkamera?«
»Auch die nicht. Fotoapparat und Diktafon, Schluss. Sie haben selbst ein Video produziert, das sie euch mitgeben werden. Eigens für euch gedreht! Ihr könnt stolz sein.«
Hagen weiß schon, warum die Kidnapper ihn nicht mit einer BGAM-Antenne anrücken sehen möchten. Er könnte den Satelliten dazu benutzen, ihren Standort zu bestimmen.
»Wo wechseln wir die Autos?«
»Langsam. Erst mal werdet ihr abgeholt. Der Mann heißt Afeef. Er fährt einen dunkelblauen Subaru. Fungiert als Dolmetscher und Fahrer. Eine Vertrauensperson aller Parteien. Er kennt den Weg.«
»Soweit möglich, würde ich ihn auch gerne kennen.«
»Ihr nehmt die A7 nach Kunduz-Stadt, vorbei an Mor Sheykh und Naqel. Kurz vor dem Zentrum geht es links nach Kholm, da biegt ihr ab und folgt der Straße über den Fluss, aus dem Delta heraus und –«
Mitten hinein in die Wüste.
Ins Niemandsland.
Afghanistan ist anders, als man es aus den Abendnachrichten kennt. Die zeigen es als riesiges Geröllfeld, umstanden von fernen, verwaschenen Bergen, mit einem Himmel über allem wie ein flirrender Bildschirm. Die Blaupause jeglicher Tristesse. Das Ruinenfeld namens Kabul im Zentrum scheint einzig dem Zweck zu dienen, dem Westen das Scheitern seiner Bemühungen vor Augen zu führen.
Doch manchmal ist Afghanistan grün.
Im Frühjahr verschwinden ganze Gebiete unter blühenden Wiesen. Imposante Gebirge durchziehen das Land, spektakulär zerklüftet. Mehr als sieben Kilometer ragt der Nowshak empor, Traum und Albtraum eines jeden Alpinisten, über sechs Kilometer messen Kuh-e Tuluksa und Kuh-e Bandaka. Es gibt Täler, die man nicht anders beschreiben kann als lieblich. Fruchtbare Deltas, von Bauern über Jahrhunderte in Mosaike verwandelt. Selbst jetzt, an der Schwelle zum Herbst, nachdem die Sonne den Boden geröstet hat, sind diese Regionen alles andere als trist.
Und es gibt die Wüsten.
Karg. Unwirtlich.
Kein Ort, an dem man stranden möchte.
Afeef ist ein freundlicher kleiner Paschtune, der einen heißen Stil fährt und sich unaufhörlich über irgendetwas amüsiert. Mit der Penetranz einer knackenden Platte kommentiert er die Art, wie Krister Björklund seinen Pakol trägt, seine afghanische Kappe.
»Wie ein Vogelnest! Wie ein Vogelnest!«
»Weil die Dinger nun mal aussehen wie Vogelnester«, brummt Björklund gleichmütig.
»Eher wie Käsekuchen«, grinst Hagen.
»Käsekuchen?« Afeef lacht. »Ihr nennt sie Käsekuchen?«
Sie haben wirklich eine Menge Spaß, indem sie sich übereinander lustig machen. Auch dass seine Passagiere im Salwar Kamiz so afghanisch aussehen wie Wikinger, stimmt Afeef fröhlich. Stimmt ja auch. Die blonden Vollbärte, die sie sich vor der Abreise haben wachsen lassen, machen nicht gerade Paschtunen aus ihnen. Allenfalls würden sie als welche durchgehen, wenn sie sich Tücher um den Kopf und vors Gesicht binden, doch der Salwar Kamiz dient nicht der Verkleidung, sondern als Zeichen des Respekts vor hiesigen Bräuchen. Gesten sind wichtig in diesem Land, sogar Bärte fördern die Vertrauensbildung.
Alles kann wichtig sein.
Nachdem sie gestartet sind, hat Afeef Hagen und Björklund eine knappe Stunde durch die Farmkulturen des Deltas gefahren, vorbei an abgeernteten Feldern und Plantagen. Sie haben die Abzweigung nach Kholm genommen und die Brücke überquert. Wieder Gehöfte. Dann der abrupte Wechsel zu Bergland, dessen kahl gebrannte Massive auf dem Mars liegen könnten, bleich, abweisend, fremdartig. Entlang verfallener Karawansereien sind sie der Straße nach Westen gefolgt, haben eine Hochebene überquert, die wie ein riesiger, geronnener Wellenberg daliegt, zernarbt von sowjetischen Bombentrichtern.
Und sich gefragt: Warum Westen?
Irgendwie passt es nicht.
Entführerbanden, seien es Taliban oder gewöhnliche Verbrecher, bevorzugen den Osten.
Eine ganze Weile ist es, als reisten sie in der Zeit zurück. Die Lehmhütten mit ihren rissigen Kuppeldächern scheinen einer versunkenen Epoche zu entstammen. Fast erwartet man mythische Tiere zu sehen, die sich im Schutz des kargen Dickichts heranpirschen.
Dann plötzlich Zweckbauten.
Ein Ort klafft auseinander. Beiderseits der Straße Werbetafeln, geparkte Lastwagen. Strommasten in endloser Reihung.
»Das ist Abdan.«
Abdan, aha. Nichts, was man gesehen haben muss.
»Dort fahrt ihr durch«, hat Husain gesagt. »Bis hinter die Tankstelle. Wenige Meter weiter geht rechts eine Straße ab.«
Straße? Eine Musterkollektion Schlaglöcher. Ein Albtraum.
»Die fahrt ihr geradeaus.«
Abdan diffundiert am Horizont. Wird zur flimmernden Fata Morgana, ist nicht mehr zu sehen.
Sie fahren weiter, immer weiter nach Westen.
Nach einer Weile steigt feiner Staub empor.
Gewaltige Dünen streben einer weiträumigen Senke zu, eine wogende See aus Sand, und der Weg, kaum noch als solcher zu bezeichnen, windet sich abwärts.
Es ist unendlich einsam hier.
Bis auf den Land Cruiser.
Drei Männer mit Kalaschnikows übernehmen sie von Afeef. Vermummte, deren einer gebrochen Englisch spricht. Sie werden gefilzt, dann händigt man ihnen die Säcke aus, damit sie sich die Dinger selbst über die Köpfe ziehen können. Der Englisch Sprechende entschuldigt sich für die Unannehmlichkeiten.
»Und genau hier hole ich euch wieder ab«, strahlt Afeef.
Falls ihr zurückkehrt.
Es klingt unausgesprochen mit.
»Natürlich kehrt ihr zurück«, hat Husain Hagen erklärt. »Ihr fallt unter paschtunisches Gastrecht, Melmastya. Das Afghanyat ist für eure Gastgeber bindend. Sie würden euch sogar mit ihrem Leben verteidigen, solange ihr auf ihrem Grund und Boden weilt. Immer vorausgesetzt, ihr haltet euch an die Regeln.«
»Und was genau sind die Regeln?«
»Tja.« Kurzes Schweigen. »Die sind wie das Wetter.«
»Na klasse.«
»Hör auf, Tom. Was soll ich sagen? Du kennst doch die Regeln.«
Jedenfalls kennt er genügend Leute, die sich nicht daran halten.
»Seid einfach auf alles vorbereitet. Ihr werdet die Gastfreundschaft eines Stammesführers genießen, der selbst kein Talib ist, aber mit den Taliban sympathisiert. Er gewährt den Gotteskriegern und ihren Geiseln Unterschlupf.«
»Was weißt du über den Kerl?«
»Nichts. Das heißt, er scheint ein Experte für Sprengstoff zu sein. Mein Kontakt hat sich mal dahingehend verplappert. Schätze, seine Leute beliefern die Taliban mit IEDs und Ähnlichem.«
»Okay.«
»Also lass dich überraschen. Entspann dich.«
»Keine Sorge.«
»Du hast es so gewollt.«
Hat er das?
Da sitzen sie nun.
Hagen atmet in seine Kapuze, versucht den säuerlichen Geruch zu ignorieren. Unterhaltung dringt vom Vordersitz herüber. Lachen, entspanntes Schwatzen, konterkariert vom gequälten Brüllen eines Getriebes, das jeder Prophezeiung zum Trotz, es nicht mehr lange zu machen, noch in zehn Jahren nicht auseinandergeflogen sein wird. In der Staubhölle Afghanistans fragt niemand nach kultiviert schnurrenden Sechszylindern. Hier müssen Autos die Robustheit von Kakerlaken besitzen.
Das Radio flutet die Kabine mit arabischem Pop.
Was eine interessante Information birgt.
Offenbar sind keine Taliban an Bord.
Denn die Gotteskrieger verbieten Musik, was sie eigenartigerweise nicht daran hindert, mit Begeisterung zu singen: melancholische, aus der Zeit gefallene Gesänge, verschlungene Rezitative von eigenartig besänftigender Wirkung ohne jede Instrumentalbegleitung. Wie immer in diesem erstaunlichen Land ist die Faktenlage nicht ganz eindeutig. Mullah Mohammad Omar, das geistliche Oberhaupt der Taliban, hat Musik als Mittel zur Vergnügung untersagt, fromme Gesänge hingegen sind erlaubt, was die Frage aufwirft, ob der Fromme im Zustand des Vergnügtseins noch fromm sein kann.
Egal. Arabischen Pop hat Omar ganz sicher nicht im Sinn gehabt.
Ob Jung solche Dinge weiß?
Franz Josef Jung, das Überraschungsei.
Natürlich wussten die Reporter, dass er kommen würde. Im Moment, als sie in Berlin zu der Auffassung gelangten, die jüngsten Debakel erforderten den ministerialen Gang nach Canossa – ein Ort, der zunehmend in Afghanistan verortet wird –, waren sie im Bilde. Und haben den Mund gehalten, schon weil man sie andernfalls ans Kreuz genagelt hätte. Nicht mal die exzellent vernetzten Taliban können schließlich einen Anschlag auf jemanden planen, den sie nicht erwarten.
Allerdings können sie ihn verüben, sobald er im Lande ist.
Entsprechend schwierig geriet die Beweisführung, was deutsches Geld und deutsche Soldaten am Hindukusch alles bewirken. Das meiste dessen, was einen Besuch gelohnt hätte, durften sie Jung nicht zeigen, des hohen Risikos wegen. Am Ende schafften sie es, ihn und seine Entourage in einem Tross rollender Panzerschränke so durch die Gegend zu schaukeln, dass er später erzählen konnte, die Nordprovinzen seien sicher und nur zwölf Prozent des deutschen Verantwortungsbereichs akut bedroht. Ein Gebiet, von dem die Verantwortlichen albträumten, der Minister werde ausgerechnet dort auf eine IED fahren, da keiner zu sagen vermochte, wo genau die beschissenen zwölf Prozent eigentlich lagen. Sie waren vom Rest in etwa so einfach zu separieren wie Kondensmilch von Kaffee nach mehrmaligem Umrühren.
Doch alles blieb ruhig.
Am Ende gab, was Jung erblickte, ihm die Kraft, vor 600 Soldaten der Patrouille zu gedenken, die vergangene Woche südlich von Kunduz-Stadt in eine Sprengfalle geraten war. Drei Männer verletzt, einer tot. Nicht einfach, der demoralisierenden Wirkung solcher Vorfälle Herr zu werden. Der Minister gab sein Bestes. Er sagte, die Opfer hätten die Freiheit verteidigt. Die Stimmung blieb gedrückt, aber wenigstens taxierte ihn während seiner Ansprache keiner, als wolle er ihn ins Jenseits befördern. Sich bei paschtunischen Stammesführern dafür zu entschuldigen, dass deutsche und afghanische Polizisten tags darauf an einem Checkpoint die Nerven verloren und das Feuer auf zwei Autos eröffnet hatten, gestaltete sich da schon schwieriger. Vier Kinder waren im Kugelhagel gestorben. Ein tragischer Unfall, ein Missverständnis, das Begriffe wie Ehrverletzung und Blutrache aufklingen ließ.
Und das war ein verdammtes Desaster!
Wenn sie hier irgendetwas überhaupt nicht brauchen konnten, dann diesen Blutrachemist.
Der Gouverneur von Kunduz fand beschwichtigende Worte. Die Bundeswehr träfe keine Schuld. Wie es denn um Entschädigung bestellt sei? Entschädigung helfe immer. Das sahen die Stammesführer ähnlich, und die Wogen glätteten sich. Jung war nicht mit leeren Händen gekommen, jedenfalls waren sie weniger leer als seine Worte. Außerdem muss man sagen, Soldaten lieben Truppenbesuche. Sie freuen sich grundsätzlich über jeden, der nachschauen kommt, ob es sie noch gibt.
Also auch über Politiker.
Gut, vielleicht hätten sie sich über Lady Gaga mehr gefreut.
Oder wenigstens über Verona Pooth.
Oder Xavier Naidoo!
Dieser Weg wird kein leichter sein –
Aber Jung war schon okay.
Inzwischen ist der Verteidigungsminister in der beruhigenden Gewissheit, den Erfordernissen nach besten Kräften Genüge getan zu haben, zurück nach Deutschland geflogen. Und Hagen, der die ganze traurige Farce pflichtschuldigst dokumentiert hat, befindet sich auf dem Weg zu seinem Interview.
In einem fremden Fahrzeug.
In fremder Hand.
Der Land Cruiser knallt in ein Schlagloch, schießt wieder heraus. Kämpft sich eine Anhöhe hinauf. Vorne quasseln sie unermüdlich weiter, junge, kraftvolle Stimmen, auf Paschtu. Hagen versteht kein Wort, aber die Typen scheinen guter Dinge zu sein.
Er wechselt ein paar Worte mit Björklund. Erstaunlich, wie wenig sie während der vergangenen Stunden miteinander gesprochen haben, andererseits, worüber sollen sie reden? Dass es im Wagen stickig ist? Dass die Kapuzen ihnen keine Möglichkeit lassen, sich auf die Unwägbarkeiten des Geländes einzustellen, sodass jede Bodenwelle die Wirkung einer Überraschungsattacke auf ihre Lendenwirbel entfaltet? Dass es riskant ist, worauf sie sich einlassen?
Natürlich ist es das. Was denn sonst? Was gibt es darüber zu reden?
Seine Gedanken wandern zu Inga.
Sie wollte unbedingt mit.