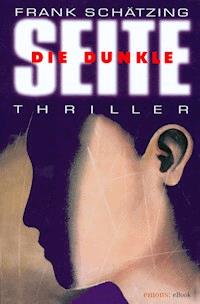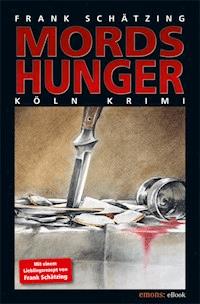Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Jacop der Fuchs-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Schätzings Welterfolg in ganz neuem Look In seinem Weltbestseller »Tod und Teufel« erzählt Frank Schätzing fesselnd von einer tödlichen Intrige im mittelalterlichen Köln. Vor dem Hintergrund gewaltiger politischer und gesellschaftlicher Umwälzungen entbrennt ein erbitterter Kampf um die Vormacht am Rhein – und ein Fuchs hat einen schlechten Tag … 1260: In Köln strebt die spektakulärste Kathedrale der Christenheit dem Himmel entgegen. Glanz und Bedeutung wachsen mit jedem Tag. Für Abenteurer und Pilger aus aller Welt wird die Stadt zur Verheißung – für Jacop den Fuchs, liebenswerter Herumtreiber und Dieb, wird sie zur Hölle. Ungewollt beobachtet er, wie ein riesiger Schatten den Dombaumeister in die Tiefe stößt. Er hat den Mord als Einziger gesehen. Aber der Schatten hat auch ihn gesehen. Wenig später ist jeder, dem Jacop davon erzählt, tot. Von Verschwörern und dem gespenstischen Mörder gejagt, findet er schließlich Unterschlupf beim versoffenen Kleriker Jaspar und seiner Nichte Richmodis. Sie beschließen, Jacop zu helfen – in einem Kampf David gegen Goliath! Doch Richmodis ist smart, Jaspar schlau, und der Fuchs trägt seinen Beinamen nicht von ungefähr ... Anlässlich Frank Schätzings neuem Roman »Helden«, der die Geschichte von Jacop kongenial fortführt, erscheint »Tod und Teufel« in einer vollkommen neu gestalteten Ausgabe. Einzigartiger Thriller und opulentes Historien-Abenteuer zugleich, wird »Tod und Teufel« nunmehr zum Beginn einer atemberaubenden Trilogie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 689
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Sammlungen
Ähnliche
© 2024 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: buerogroll.com
Illustrationen: © Frank Schätzing x Midjourney
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-98707-230-7
Roman
Überarbeitete Neuausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß §44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Eine Erläuterung der Namen, Begriffe und Zitate finden Sie im Anhang.
Für Jürgen,
DRAMATIS PERSONAE
Fuchs und Freunde
Jacop der Fuchs
Dieb und Herumtreiber, zur falschen Zeit am falschen Ort
Jaspar Rodenkirchen
Physikus, Pleban von St.
Maria Magdalena, gelehrt
Goddert von Weiden
Jaspars Schwager, Färber, gemütlich
Richmodis von Weiden
Godderts Tochter, Färberin, klug
Rolof
Jaspars Knecht
Bodo Schuif
Brauer, Schöffe
Maria
Hure, träumend
Clemens Brabanter
Hurenwirt
Tilman
Bettler
Die Vergangenheit
Jacops Vater, Mutter und Geschwister
Worringer Bauern, arm, tot
Isabella Plantagenet von England
Prinzessin, engelsgleich
Der Landesherr
Konrad von Hochstaden
Kölner Erzbischof, skrupellos, schlau
Monsignore di Castellofiore
Konrads Sekretarius, verschlagen
Der Architekt
Gerhard Morart
Dombaumeister, baut hoch, stürzt
Der Mörder
Urquhart von Monadhliath
Nihilist, rätselhaft
Die Zeugen
Justinius von Singen
Wanderprediger, gekauft
Andreas von Helmerode
Justinius’ Komplize, gekauft
Die Patrizier(auch: Edle, Geschlechter, Meliores) Kölner Oberschicht reicher Kaufleute
Johann Overstolz
Patriarch, hadernd
Blithildis Overstolz
Johanns Mutter, Patriarchin
Daniel Overstolz
Johanns Sohn, hitzig
Mathias Overstolz
Kopf der Kaufmannsvereinigung, Drahtzieher
Heinrich von Mainz
Kaufmann
Kuno Kone
Kaufmann, Ziehsohn Gerhard Morarts
Theoderich Overstolz
Kaufmann, letzter patrizischer Schöffe
Die Weisen von der Mühlengasse
alte Rivalen und Erzfeinde der Overstolzen
Sonstige
Hieronymus
Veteran, wirr
Aussätzige von Melaten, Mönche und Schöffen, Häscher und Soldaten, Stadtvolk
»Die Sprache ist nicht der Schleier des Wirklichen, sondern sein Ausdruck.«
PROLOG
Der Wolf stand auf der Anhöhe und fixierte den goldbeschienenen Ring der großen Mauer.
Sein Atem ging gleichmäßig. Die mächtigen Flanken zitterten leicht. Er war den ganzen Tag gelaufen, von der Gegend um Jülichs Burgen herab über das Hügelland bis hierher, wo das Dickicht endete und den Blick freigab auf die entfernt liegende Stadt. Trotzdem fühlte er sich weder erschöpft noch müde. Während der Feuerball der Sonne hinter ihm den Horizont berührte, warf er den Kopf in den Nacken und erkundete witternd seine Umgebung.
Die Eindrücke waren übermächtig. Er roch das Wasser vom Fluss, den Schlamm an den Ufern, das faulige Holz der Schiffsrümpfe. Er sog die Melange der Ausdünstungen in sich hinein, in der sich Tierisches mit Menschlichem und Menschgemachtem mischte, parfümierte Weine und Fäkalien, Weihrauch, Torf und Fleisch, das Salz verschwitzter Leiber und der Duft teurer Pelze, Blut, Honig, Kräuter, reifes Obst, Aussatz und Schimmel. Er roch Liebe und Angst, Furcht, Schwäche, Hass und Macht. Alles dort unten sprach eine eigene, duftende Sprache, erzählte ihm vom Leben hinter den steinernen Wällen und vom Tod.
Er drehte den Kopf.
Stille. Nur das Flüstern der Wälder ringsum.
Reglos wartete er, bis das Gold von der Mauer gewichen war und nur noch auf den Zinnen der Torburgen schimmerte. Eine kurze Weile, und es würde ganz verlöschen und den Tag der Erinnerungslosigkeit preisgeben. Die Nacht käme, um das Tal mit neuen, dumpfen Farben zu überziehen, bis auch diese den Schatten weichen und das Glühen seiner Augen die einzigen Lichter sein würden.
Die Zeit war nahe, da die Wölfe Einzug in die Träume der Menschen hielten. Die Zeit des Wandels und der Jagd.
Mit geschmeidigen Bewegungen lief der Wolf die Anhöhe hinunter und tauchte ein ins hohe, trockene Gras. Wenig später war er darin verschwunden.
Vereinzelt begannen die Vögel wieder zu singen.
10.SEPTEMBER
Ante portas
»Ich finde, es ist kalt.«
»Ihr findet immer, es ist kalt. Ihr seid weiß Gott eine erbarmungswürdige Memme.«
Heinrich zog den Mantel enger um seine Schultern und funkelte den Reiter neben ihm zornig an.
»Das meint Ihr nicht so, Mathias. Ihr meint nicht, was Ihr sagt. Es ist kalt.«
Mathias zuckte die Achseln. »Verzeiht. Dann ist es eben kalt.«
»Ihr versteht mich nicht. Mir ist kalt im Herzen.« Heinrichs Hände beschrieben eine theatralische Geste. »Dass wir zu solchen Mitteln greifen müssen! Nichts liegt mir ferner als die Sprache der Gewalt, so wahr der barmherzige Gott mein Zeuge ist, jedoch –«
»Er ist nicht Euer Zeuge«, unterbrach ihn Mathias.
»Was?«
»Warum sollte Gott seine kostbare Zeit auf Euer Zetern und Jammern verschwenden? Es wundert mich, dass Ihr überhaupt aufs Pferd gefunden habt um diese Stunde.«
»Mit Verlaub, Ihr werdet unverschämt«, zischte Heinrich. »Zollt mir gefälligst ein bisschen Respekt.«
»Ich zolle jedem den Respekt, den er verdient.« Mathias lenkte sein Pferd um einen gestürzten Ochsenkarren herum, der unvermittelt aus der Dunkelheit vor ihnen aufgetaucht war. Die Sicht nahm rapide ab. Den ganzen Tag über hatte die Sonne geschienen, aber es war September, und abends wurde es jetzt schneller kalt und dunkel. Dann stiegen Nebel empor und verwandelten die Welt in ein düsteres Rätsel. Kölns Stadtmauer lag inzwischen mehr als einen halben Kilometer hinter ihnen, und sie hatten lediglich die Fackeln. Mathias wusste, dass Heinrich sich vor Angst fast in die Hosen machte, und das erfüllte ihn mit einer grimmigen Belustigung. Heinrich hatte seine Vorzüge, aber Mut gehörte nicht dazu. Er trieb sein Pferd zu größerer Eile und beschloss, ihn zu ignorieren.
Im Allgemeinen fiel es niemandem ein, um diese Zeit die Stadt zu verlassen, es sei denn, man warf ihn hinaus. Die Gegend war unsicher. Überall trieben sich Banden von Strolchen und Tagedieben herum, ungeachtet des Landfriedens, den der Kölner Erzbischof Konrad von Hochstaden im Einklang mit den geistlichen und weltlichen Fürsten der umliegenden Gebiete ausgerufen hatte. Das war 1259 gewesen, nicht mal ein Jahr zuvor. Es gab ein Papier darüber, schwer von Siegeln. Glaubte man dem Wisch, konnten Wanderer und Kaufleute nun das Rheinland durchqueren, ohne von Raubrittern und anderen Wegelagerern ausgeplündert und umgebracht zu werden. Aber was tagsüber einigermaßen funktionierte, vor allem, wenn es darum ging, die Kaufleute für das magere Schutzversprechen zur Kasse zu bitten, verlor nach Sonnenuntergang jede Gültigkeit. Erst kürzlich hatte man den Körper eines Mädchens gefunden, draußen auf dem Feld und nur wenige Schritte von der Friesenpforte entfernt. Sie lag auf dem Gelände eines Pachthofs, vergewaltigt und erdrosselt. Ihre Eltern waren angesehene Leute, eine Dynastie von Waffenschmieden, seit Generationen wohnhaft Unter Helmschläger gegenüber dem erzbischöflichen Palast. Es hieß, der Leibhaftige habe die Kleine mit einem Zauber hinausgelockt. Andere wollten den Bauern aufs Rad geflochten sehen, in dessen Feld sie den Leichnam gefunden hatten. Dabei ging es weniger um die Schuld des Bauern; aber was hatte eine anständige Bürgertochter tot auf seinem Grund und Boden zu liegen! Zumal sich kein Christenmensch erklären konnte, was sie so spät dort draußen gesucht hatte. Hörte man allerdings genauer hin, wusste plötzlich jeder, dass sie sich mit Spielleuten herumgetrieben hatte und noch schlimmerem Pack, Fetthändlern aus der Schmiergasse und Gesindel, das man besser gar nicht erst in die Stadt ließ. Also doch selber schuld. Wer glaubte schon dem Landfrieden.
»Wartet!«
Heinrich war weit hinter ihm. Mathias stellte fest, dass er dem Vollblut zu sehr die Zügel gelassen hatte, und ließ es in ein gemächliches Schritttempo zurückfallen, bis sein Begleiter wieder neben ihm ritt. Sie hatten jetzt mehrere Höfe zwischen sich und die Stadt gebracht und den Hag erreicht. Der Mond erhellte die Gegend nur schwach.
»Sollte er hier nicht auf uns warten?« Heinrichs Stimme zitterte fast so sehr wie er selber.
»Nein.« Mathias spähte zwischen den ersten Baumreihen des Hags hindurch. Der Weg verlor sich in völligem Schwarz. »Wir müssen bis zur Lichtung. Hört, Heinrich, seid Ihr sicher, dass Ihr nicht umkehren möchtet?«
»Was denn, alleine?« Heinrich biss sich verlegen auf die Lippen, aber es war raus. Kurz besiegte der Zorn seine Feigheit. »Ständig versucht Ihr mich zu provozieren«, schimpfte er laut. »Als ob ich umkehrte! Als ob mir ein solcher Gedanke überhaupt käme, hier im Finstern mit Euch eingebildetem Pfau an meiner Seite, der das Maul zu weit aufreißt –«
Mathias zügelte sein Pferd, langte herüber und packte Heinrich an der Schulter.
»Betreffs des Mauls, da solltet Ihr das Eure vielleicht halten. Wäre ich derjenige, den wir treffen wollen, und ich hörte Euch lamentieren, würde ich mit Kopfschmerzen das Weite suchen.«
Der andere starrte ihn wütend und beschämt an. Dann riss er sich los und ritt geduckt unter den Bäumen durch. Mathias folgte ihm. Die Äste warfen im Licht der Fackeln tanzende Schatten. Nach wenigen Minuten erreichten sie die Lichtung und ließen die Pferde halten. Der Wind rauschte durchs Holz, sonst war nichts zu hören als ein monotoner Uhu.
Sie warteten schweigend.
Nach einer Weile begann Heinrich unruhig in seinem Sattel hin- und herzurutschen.
»Und wenn er nicht kommt?«
»Er wird kommen.«
»Was macht Euch da so sicher? Solche Leute taugen nichts. Sie sind heute hier und morgen da.«
»Er wird kommen. Wilhelm von Jülich hat ihn empfohlen, also wird er kommen.«
»Der Graf von Jülich wusste nicht das Geringste über ihn.«
»Es ist nicht von Bedeutung, was man über solche Leute weiß, nur, was sie tun. Er hat Wilhelm gute Dienste geleistet.«
»Ich hasse es aber, nichts über andere zu wissen.«
»Warum? Es ist bequemer so.«
»Trotzdem. Wir sollten vielleicht umkehren und das Ganze noch einmal durchdenken.«
»Und was wollt Ihr dann erzählen? Wie Ihr Euer Pferd durchnässt habt vor Angst?«
»Dafür werdet Ihr Euch entschuldigen!«
»Schweigt endlich.«
»Ich bin nicht so alt geworden, um mir von Euch den Mund verbieten zu lassen.«
»Vergesst nicht, ich bin drei Jahre älter«, spottete Mathias. »Und der Ältere ist immer weiser als der Jüngere. Da ich mich persönlich nicht für weise halte, könnt Ihr ungefähr ermessen, wo Ihr steht. Und jetzt Ruhe.«
Bevor Heinrich etwas entgegnen konnte, war Mathias abgestiegen und hatte sich ins Gras gesetzt. Heinrich beobachtete nervös den Scherenschnitt der Kiefern um sie herum und spähte nach dem Mond. Er verbarg sich hinter Schlieren. Hier und da wurde die Wolkendecke von ein paar Sternen unterbrochen. Diese Nacht gefiel ihm nicht. Genau genommen gefiel ihm keine Nacht, sofern er sie nicht im eigenen Bett verbrachte oder in den Armen einer Kurtisane.
Missmutig schaute er hinter sich und kniff die Augen zusammen, um sich zu vergewissern, dass niemand ihnen gefolgt war.
Ein Schatten huschte unter den Bäumen hindurch.
Heinrich fuhr der Schreck so sehr in die Glieder, dass er an sich halten musste, um seinem Pferd nicht die Fersen zu geben. Seine Kehle war plötzlich unangenehm trocken.
»Mathias –«
»Was?«
»Da ist etwas.«
Mathias war im Nu auf den Beinen und spähte in dieselbe Richtung.
»Ich kann nichts erkennen.«
»Aber es war da.«
»Hm. Vielleicht hat Euch der tiefe Wunsch nach Kampf und Heldentaten einen Feind sehen lassen. Manchmal sollen hier auch Hexen –«
»Macht jetzt keine Witze. Da, seht!«
Im Dunkeln tauchten zwei schwach glimmende gelbe Punkte auf und kamen langsam näher. Etwas hob sich kaum wahrnehmbar gegen das dunkle Unterholz ab, noch schwärzer als schwarz, drehte einen massigen Schädel.
Es beobachtete sie.
»Der Teufel«, entsetzte sich Heinrich. Seine Rechte tastete fahrig nach dem Schwertgriff und verfehlte ihn.
»Unsinn.« Mathias hielt die Fackel vor sich und trat einen Schritt auf den Waldrand zu.
»Seid Ihr von Sinnen? Kommt zurück, um Gottes willen.«
Mathias ging in die Hocke, um besser sehen zu können. Die Punkte verschwanden so schnell, wie sie aufgetaucht waren.
»Ein Wolf«, konstatierte er.
»Ein Wolf?« Heinrich schnappte nach Luft. »Was tun Wölfe so nah bei der Stadt?«
»Sie kommen, um zu jagen«, sagte jemand.
Beide fuhren herum. Dort, wo Mathias gesessen hatte, stand ein hochgewachsener Mann. Üppiges blondes Haar fiel über seine Schultern und lockte sich fast bis zur Taille. Sein Umhang war schwarz wie die Nacht. Keiner hatte ihn herantreten hören.
Mathias kniff die Augen zusammen.
»Urquhart, vermute ich?«
Der Blonde neigte leicht den Kopf.
Heinrich saß wie zur Salzsäule erstarrt auf seinem Pferd und begaffte den Ankömmling mit offenem Mund. Mathias sah geringschätzig zu ihm hoch.
»Ihr könnt jetzt absteigen, edler Herr und Ritter, reich an Jahren und Todesmut«, höhnte er.
Ein Zucken ging durch Heinrichs Gesichtszüge. Er schloss mit einem Klacken die Kiefer und rutschte mehr aus dem Sattel, als dass er stieg.
»Setzen wir uns«, schlug Mathias vor.
Sie ließen sich ein Stück von den Pferden entfernt nieder. Heinrich fand die Sprache wieder, straffte sich und setzte eine würdige Miene auf.
»Wir hörten Euch nicht kommen«, sagte er nörgelig.
»Natürlich nicht.« Urquhart entblößte zwei makellose Reihen weiß schimmernder Zähne. »Ihr hattet genug mit Eurem Wolf zu tun. Wölfe sind schnell zur Stelle, wenn man sie ruft, war Euch das nicht bekannt?«
»Wovon redet Ihr?«, fragte Mathias mit einem Stirnrunzeln. »Niemand ist so verrückt, Wölfe herbeizurufen.«
Urquhart lächelte unergründlich.
»Ihr habt vermutlich recht. Am Ende war es nur ein Hund, der Euch mehr fürchtete als Ihr ihn. Falls Euch das beruhigt«, fügte er höflich an Heinrich gewandt hinzu.
Heinrich starrte zu Boden und begann, Grashalme auszurupfen.
»Wo ist Euer Pferd?«, forschte Mathias.
»In Reichweite«, sagte Urquhart. »Ich werde es in der Stadt nicht brauchen.«
»Täuscht Euch nicht. Köln ist größer als die meisten Städte.«
»Und ich bin schneller als die meisten Pferde.«
Mathias betrachtete ihn abschätzend. »Soll mir recht sein. Der Graf von Jülich hat mit Euch über den Preis gesprochen?«
Urquhart nickte. »Wilhelm erwähnte tausend Silbermark. Ich halte das für angemessen.«
»Wir erhöhen unser Angebot«, sagte Mathias. »Eure Aufgabe hat sich erweitert. Doppelte Arbeit.«
»Gut. Dreifacher Lohn.«
»Das halte ich für unangemessen.«
»Und ich halte mangelnde Präzisierung für unangemessen. Wir feilschen hier nicht um Handelswaren. Dreifacher Lohn.«
»Seid Ihr das überhaupt wert?«, fragte Heinrich scharf.
Urquhart sah ihn eine Weile an. Seine Mundwinkel zuckten in milder Belustigung. Dann hob er die buschigen Brauen.
»Ja.«
»Also gut«, nickte Mathias. »Dreifacher Lohn.«
»Was?«, begehrte Heinrich auf. »Aber Ihr habt doch eben noch selber –«
»Es bleibt dabei. Besprechen wir die Einzelheiten.«
»Ganz wie Ihr wünscht«, sagte Urquhart.
Kultiviert und höflich, dachte Mathias. Ein eigenartiger Bursche. Leise begann er auf Urquhart einzureden. Sein Gegenüber hörte reglos zu und nickte verschiedene Male.
»Habt Ihr noch Fragen?«, schloss Mathias.
»Nein.«
»Gut.« Mathias stand auf und klopfte sich Gras und Erde von den Kleidern. Er brachte eine Schriftrolle aus seinem Mantel zum Vorschein und reichte sie dem Blonden. »Hier ist ein Empfehlungsschreiben vom Abt der minderen Brüder versus St. Kolumba. Macht Euch nicht die Mühe einer frommen Visite, niemand erwartet Euch dort. Ich glaube zwar nicht, dass man Euch kontrolliert, aber angesichts der Referenzen wird Euch keine Stadtwache den Zugang verwehren.«
Urquhart pfiff leise durch die Zähne. »Ich brauche kein Papier, um reinzukommen. Trotzdem, wie habt Ihr den Abt dazu bringen können, sein Siegel in Euren Dienst zu geben?«
Mathias lachte selbstzufrieden. »Unser gemeinsamer Freund Wilhelm von Jülich ist stolzer Besitzer eines Hofes Unter Spornmacher. Das ist um die Ecke gespuckt, und der Abt der minderen Brüder schuldet ihm verschiedene Gefallen. Wilhelm hat ihm ein paar Kostbarkeiten für die Sakristei überantwortet, wenn Ihr versteht, was ich meine.«
»Ich dachte, die Minoriten seien nach dem Willen des barmherzigen Gottes arm und mittellos.«
»Ja, und darum gehört alles auf ihrem Grund und Boden einzig dem Herrn. Aber solange der’s nicht abholt, muss es ja verwaltet werden.«
»Oder gegessen?«
»Und getrunken.«
»Wollt Ihr endlich ein Ende machen?«, zeterte Heinrich gedämpft. »Die porta hanonis wird Schlag zehn geschlossen. Nichts reizt mich weniger, als die Nacht vor den Toren zu verbringen.«
»Schon gut.« Mathias betrachtete Urquhart. »Entwickelt Euren Plan. Wir treffen uns morgen Abend an St. Ursula um die fünfte Stunde, um alles Weitere zu besprechen. Ich nehme an, Ihr wisst bis dahin für Eure Sicherheit zu sorgen.«
»Macht Euch keine Gedanken«, lächelte Urquhart. Er reckte die Glieder und sah zum Mond auf, der scheu zwischen den Wolken hervorlugte. »Ihr solltet reiten, Eure Zeit wird knapp.«
»Ich sehe Euch ohne Waffen.«
»Wie ich bereits sagte, macht Euch keine Gedanken. Ich pflege meine Waffen zu benutzen, nicht öffentlich auszustellen. Aber sie liegen bereit.« Er zwinkerte Mathias zu. »Ich führe sogar Vellum und Feder mit.«
»Das sind keine Waffen«, bemerkte Mathias.
»Doch. Das geschriebene Wort kann sehr wohl eine Waffe sein. Alles kann eine Waffe sein, wenn man es entsprechend einzusetzen weiß.«
»Ihr werdet’s wohl wissen.«
»Sicher. Reitet.«
Heinrich wandte sich missmutig ab und stapfte hinüber zu den Pferden. Mathias ging ihm nach. Als er sich noch einmal umdrehte, war Urquhart wie vom Erdboden verschluckt.
»Habt Ihr seine Augen gesehen?«, wisperte Heinrich.
»Was?«
»Urquharts Augen!«
Mathias versuchte, seine Gedanken zu sammeln. »Was ist mit seinen Augen?«
»Sie sind tot.«
Mathias starrte auf die Stelle, an der Urquhart zuletzt gestanden hatte. »Ihr träumt, Heinrich.«
»Augen wie von einem Toten. Er macht mir Angst.«
»Mir nicht. Reiten wir.«
Sie ließen die Pferde ausgreifen, so schnell es die Dunkelheit und das Wurzelgewirr im Hag erlaubten. Als sie freies Feld erreichten, schlugen sie den Tieren die Fersen in die Seiten und erreichten die porta rund zehn Minuten später. Langsam schlossen sich die Torflügel hinter ihnen, als sie in den Schutz der großen Mauer entkamen.
Die Nacht hatte wieder einmal gewonnen.
11.SEPTEMBER
Forum feni
Jacop der Fuchs schlenderte über die Märkte und stellte sein Mittagessen zusammen.
Den Beinamen hatte er nicht von ungefähr. Für gewöhnlich leuchtete sein Kopf wie ein Burgfeuer. Klein und schlank von Statur, wäre er niemandem weiter aufgefallen, wenn nicht dieser unbändige Schopf roter Haare nach allen Himmelsrichtungen gegriffen hätte. Jede der drahtigen Strähnen schien einem eigenen Verlauf zu folgen, dessen Hauptmerkmal darin bestand, dass sie ihn mit keiner anderen teilen wollte. Das Ganze als Haartracht zu bezeichnen, war mehr als abwegig. Trotzdem, oder gerade deshalb, übte es auf Frauen den Zwang aus, hineinzugreifen und daran herumzuzerren, mit den Fingern hindurchzufahren, als gelte es, einen Wettstreit zu gewinnen, wer dem Gestrüpp zumindest ansatzweise so etwas wie Disziplin beizubringen vermochte. Bis jetzt hatte noch keine gewonnen, wofür Jacop seinem Schöpfer laut dankte und ein ums andere Mal für reichlich Unordnung auf der Kopfhaut sorgte. Das Interesse war entsprechend unvermindert groß, und wer sich einmal in der roten Hecke verfangen hatte, lief Gefahr, im hellblauen Wasser seiner Augen endgültig allen Boden unter den Füßen zu verlieren.
Heute allerdings, angeknurrt von seinem Magen, zog Jacop es vor, sich mit einem alten Fetzen zu bedecken, der nicht mal in seinen besten Zeiten den Namen Kapuze verdient hatte, und den Wunsch nach weiblicher Gesellschaft hintanzustellen. Kurzfristig wenigstens.
Der Geruch teuren holländischen Käses stieg ihm in die Nase. Schnell drängte er sich zwischen den geschäftigen Ständen hindurch und versuchte, ihn zu ignorieren. Er konnte sich allzu lebhaft vorstellen, wie die Mittagssonne die oberste Schicht des Anschnitts schmolz, sodass sie von einem fetten Glanz überzogen war. Welcher Teufel auch immer den Duft geradewegs zu ihm herüberlenkte, auf dem Käsemarkt war augenblicklich zu viel los für einen schnellen Griff.
Der Gemüsemarkt gegenüber bot da schon bessere Möglichkeiten. Überhaupt war die nördliche Seite des Forum feni geeigneter, ohne Geld einzukaufen, weil sich hier die unterschiedlichsten Fluchtmöglichkeiten auftaten. Man konnte zwischen den Haufen der Kohlenhändler und dem Salzmarkt, wo das Forum in die Passage zum Alter Markt mündete, in tausend Gassen verschwinden, etwa zwischen den Häusern der Hosenmacher und der Brothalle hindurch, dann hoch zu den Hühnerständen und in die Judengasse. Andere Möglichkeiten boten sich zum Rhein hin. Die Salzgasse oder besser noch die Lintgasse, wo sie draußen Körbe und Seile aus Lindenbast flochten und die Fischverkäufer vor der Ecke Buttermarkt ihre offenen Buden hatten. Weiter zum Ufer hin lagen die Salmenbänke. Hier, im Schatten der mächtigen Klosterkirche Groß St. Martin, begann der eigentliche Fischmarkt und Köln nach Hering, Wels und Aal zu stinken, sodass die Verfolger spätestens an dieser Stelle umkehrten, die ehrwürdigen Brüder der Martinskirche arg bedauerten und Gott den Herrn gnädig priesen, dass sie ihre Waren nicht am Rheinufer feilbieten mussten.
Aber Jacop wollte keinen Fisch. Er hasste den Geruch, den Anblick, einfach alles daran. Nur Lebensgefahr konnte ihn so weit bringen, über den Fischmarkt zu laufen.
Er drängte sich zwischen Gruppen schnatternder Mägde und Schwestern von der heiligen Jungfrau hindurch, die lautstark um die Kürbispreise feilschten, übertönt vom melodischen Lärm der Ausrufer, rempelte einen reich gekleideten Kaufmann an und stolperte, Entschuldigungen brabbelnd, gegen einen Stand mit Möhren und Bleichsellerie. Das Manöver trug ihm drei Schimpfnamen ein, darunter erstaunlicherweise einen, mit dem man ihn in der Vergangenheit noch nicht bedacht hatte, sowie ein paar schöne, glatte Karotten, prall vor Saft. Schon mal nicht schlecht.
Er sah sich um und überlegte. Er konnte einen Abstecher zu den Apfelkisten der Bauern vom Alter Markt unternehmen. Das war der sichere Weg. Ein paar Stücke reifes Obst, die Möhren. Hunger und Durst gestillt.
Aber es war einer dieser Tage – Jacop wollte mehr. Und dieses Mehr lag leider auf der weniger sicheren Seite des Forums, im Süden, bezeichnenderweise dort, wo die Zahl der Geistlichen unter den Marktgängern zunahm. An den Fleischbänken.
Die Fleischbänke –
Dort war erst letzte Woche einer zum wiederholten Male erwischt worden. Sie hatten ihm etwas vorschnell die rechte Hand abgehackt und ihn tröstend darauf hingewiesen, jetzt habe er Fleisch. Im Nachhinein stellte die Kölner Gerichtsbarkeit klar, es habe sich hierbei um einen keineswegs gebilligten Akt der Selbstjustiz gehandelt, aber davon wuchs die Hand auch nicht mehr an. Und letzten Endes: selber schuld! Fleisch war nun mal kein Essen für die Armen.
Und doch, hatte nicht der Dekan von St. Cäcilien erst kürzlich erklärt, unter den Armen sei nur der mit Gott, der seine Armut ehrlich trage? War Jacop also gottlos? Und konnte man einem Gottlosen vorwerfen, dass er der Versuchung des Fleisches nicht zu widerstehen vermochte? So, wie ihn das Fleisch versuchte, war die Versuchung des heiligen Johannes jedenfalls ein Dreck dagegen.
Aber es war gefährlich.
Kein Gewimmel wie im Norden, wo man untertauchen konnte. Weniger Gässchen. Nach den Fleisch- und Speckbänken nur noch die öffentliche Tränke und gleich im Anschluss der fatale öffentliche Platz am Malzbüchel, wo sie den armen Kerl von letzter Woche gestellt hatten. Besser vielleicht doch die Äpfel? Fleisch lag ohnehin zu schwer im Magen.
Andererseits lag es in seinem Magen besser als in einem Pfaffenmagen. Fand Jacop.
Sehnsüchtig schielte er hinüber zu den Ständen, wo die roten Stücke mit den fetten, gelben Rändern gehandelt wurden. Es war schon in Ordnung so. Das Schicksal hatte eben nicht gewollt, dass er ein Richer wurde. Aber dass er an gebrochenem Herzen starb, konnte es noch viel weniger gewollt haben.
Während er schwermütig zusah, wie die Objekte seiner Begierde munter die Besitzer wechselten, bemerkte Jacop Alexianer, Franziskaner und Konradiner, Prioren von den Kreuzbrüdern und die schwarzen Kutten der Minoriten zwischen stolzen Bürgerfrauen in weinroten Roben mit goldenen Schnallen, die hocherhobenen Häupter gekrönt von reich bestickten Seidenhauben.
Seit Erzbischof Konrad der Stadt im vergangenen Jahr endgültig das Stapelrecht verliehen hatte, gab es keinen glanzvolleren Markt als den zu Köln. Leute aller Stände trafen sich hier, niemand war sich zu schade, seinen Reichtum zur Schau zu stellen, indem er vor den Augen seiner Nächsten die Gademen leer kaufte. Der ganze Platz wimmelte zudem von Kindern, die ihre Standesunterschiede mit Holzstecken ausfochten oder einträchtig Schweine über den festgestampften Lehm jagten. Gegenüber dem von Bettlern umlagerten Kaufhaus der Leinwandhändler an der Ostseite des Forums begann der Rindfleischverkauf. Dort hingen getrocknete Würste, von denen ein rundes Dutzend soeben im Korb eines teuer gekleideten Alten mit spitzem Hut verschwand, und Jacop wäre am liebsten mit hineingekrochen.
Beziehungsweise es verschwand nicht ganz. Als der Mann nämlich knöchern weiterschlurfte, baumelte eine der Würste keck heraus.
Jacop sah sie mit aufgerissenen Augen an.
Sie sah zurück. Sie versprach ihm den Vorhof zum Paradies, das himmlische Jerusalem, die Seligkeit auf Erden. Sie platzte fast vor Schönheit. Im dunkelrotbraun geräucherten Fleisch unter der strammen Pelle blickten freundlich Hunderte kleiner, weißer Fettstückchen zu ihm hin und schienen ihm vertraulich zuzuzwinkern. Ihm war, als rufe ihn die Wurst zur kühnsten aller Taten, sie einfach abzuzwicken und das Weite zu suchen. Er sah sich in seinem Verschlag an der Stadtmauer sitzen und darauf herumkauen, die Vorstellung wurde zur Wahrheit und die Wahrheit zur Besessenheit. Seine Füße setzten sich wie von selber in Bewegung. Alles war vergessen, die Gefahr, die Angst. Die Welt war eine Wurst.
Gleich einem Aal flutschte Jacop zwischen den Leuten hindurch und gelangte hinter den Alten, der jetzt stehen blieb und ein Bratenstück vom Pferd begutachtete. Offenbar sah er schlecht, weil er sich dafür weit über den Brettertisch beugen musste.
Jacop drückte sich dicht an ihn heran, ließ ihn ein Weilchen tasten und schnüffeln und schrie dann aus Leibeskräften:
»Ein Dieb! Seht nur, dahinten! Er macht sich mit dem Filet aus dem Staub, der Schweinehund.«
Die Köpfe der Menschen ruckten hin und her. Die Fleischer, da sie ja annehmen mussten, der Dieb befinde sich in entgegengesetzter Richtung, drehten sich hastig um, sahen natürlich nichts und blieben irritiert stehen. Jacops Finger brauchten keine Sekunde, dann glitt die Wurst in seinen Mantel. Jetzt nichts wie weg.
Sein Blick fiel auf die Fleischbank. Koteletts zum Greifen nahe. Und immer noch starrten die Fleischer ins Nichts.
Er streckte die Hand aus, zögerte. Gib dich zufrieden, raunte eine Stimme in ihm, hau endlich ab.
Aber die Versuchung war zu groß.
Er packte das zuvorderst liegende Kotelett in dem Moment, da sich einer der Fleischer wieder umdrehte. Der Blick des Mannes traf seine Hand wie die Axt des Henkers, während ihm das Blut zu Kopfe schoss.
»Halunke«, keuchte er.
»Dieb! Dieb!«, krähte der Alte neben ihm, verdrehte die Augen, ließ ein rasselndes Ächzen hören und kippte zwischen die Auslagen.
Jacop zögerte nicht länger. Er holte aus und warf dem Fleischer das Kotelett mitten ins Gesicht. Die Umstehenden begannen zu kreischen, Finger krallten sich in seinen alten Mantel, zerrten ihm die Kapuze weg. Sein Haar loderte in der Sonne auf. Er trat um sich, aber sie ließen ihn nicht entkommen, während der Fleischer mit einem Wutschrei über die Theke setzte.
Jacop sah sich ohne Hand, und das gefiel ihm nicht.
Mit aller Kraft riss er die Arme hoch und vollführte einen Satz in die Menge. Verblüfft stellte er fest, dass es leichter ging, als er dachte. Dann wurde ihm bewusst, dass er geradewegs aus seinem Mantel gesprungen war, den sie jetzt zerfetzten, als sei das jämmerliche Kleidungsstück der eigentliche Übeltäter. Er schlug um sich, bekam Luft und rannte über den Platz Richtung Malzbüchel. Zurück konnte er nicht. Der Fleischer war immer noch hinter ihm, und nicht nur der. Den Geräuschen der trappelnden Füße und den aufgebrachten Stimmen nach zu urteilen, hatte er das halbe Forum auf den Fersen, und alle schienen seine Hand dem Scharfrichter überantworten zu wollen. Was eindeutig nicht in Jacops Interesse lag.
Er schlitterte durch matschige Furchen und Geröll über den Malzbüchel und entging nur knapp den Hufen eines scheuenden Gauls. Weitere Leute drehten sich nach ihm um, angezogen von dem Schauspiel.
»Er ist ein Dieb!«, brüllten die anderen.
»Was? Wer?«
»Der mit den roten Haaren. Der Fuss!«
Und schon erhielt die Meute Verstärkung. Sie kamen aus der Rheingasse, der Plectrudis- und der Königstraße, selbst die Kirchgänger schienen aus St. Maria im Kapitol zu strömen, um ihn in Stücke zu reißen oder mindestens zu vierteilen.
Allmählich bekam er es tatsächlich mit der Angst zu tun. Der einzig offene Fluchtweg, durch die Malzmühlengasse unter der Kornpforte durch zur Bach, war blockiert. Jemand hatte ein Fuhrwerk dermaßen dämlich über den Weg gestellt, dass niemand dran vorbeikam.
Aber vielleicht drunter durch.
Jacop ließ sich im Lauf fallen, rollte sich unter der Deichsel hindurch auf die andere Seite, kam wieder auf die Beine und hastete rechts hoch auf die Bach. Der Fleischer versuchte, es ihm gleichzutun, aber da er dreimal so dick war wie Jacop, blieb er stecken und musste von den anderen unter Gezeter und Mordioschreien wieder hervorgezerrt werden. Die Bluthunde verloren wertvolle Zeit.
Schließlich kletterten drei von ihnen beherzt über den Kutschbock und hefteten sich Jacop wieder auf die Spur.
Auf der Bach
Aber Jacop war verschwunden.
Nachdem sie einige Male hin- und hergelaufen waren, gaben die Verfolger auf. Obgleich sich der Verkehr die Bach hinauf in Grenzen hielt und nur wenige Färber um die Mittagszeit draußen arbeiteten, hatten sie ihn verloren. Sie schauten links in den Filzengraben, aber auch da war niemand zu sehen, den man hätte festnehmen können.
»Rote Haare«, murmelte einer der drei.
»Wie meint Ihr?«, fragte ein anderer.
»Rote Haare, verdammich! Er kann uns nicht entwischt sein! Wir hätten ihn sehen müssen.«
»Der Karren hat uns aufgehalten«, sagte der Dritte beschwichtigend. »Gehen wir. Soll er am Jüngsten Tage sehen, was er davon hat.«
»Nein!« Der erste Sprecher hatte sich einen Ärmel zerrissen, als er über den Wagen gesprungen war. Seine Augen sprühten vor Zorn. »Jemand muss ihn gesehen haben.«
Er stapfte die Bach hinauf, von seinen Begleitern widerwillig gefolgt. Die Straße entsprach dem Verlauf des Duffesbachs entlang der alten Römermauer. Hier waren sie im Viertel Oursburg. Sie fragten verschiedene Bürger, bis sie den Waidmarkt erreichten. Niemand wollte den Rotschopf gesehen haben.
»Lassen wir’s«, sagte einer. »Mir jedenfalls ist nichts gestohlen worden.«
»Nie und nimmer!« Der mit dem zerrissenen Wams sah sich wild um. Sein Blick fiel auf eine junge Frau, die am Bach kniete und ein riesiges, blau gefärbtes Tuch darin wässerte. Sie war auf eigenwillige Weise hübsch, mit einer leicht schiefen Nase und aufgeworfenen Lippen. Er stellte sich vor sie hin, ließ die Brust schwellen und trompetete:
»Wir suchen einen Dieb, der ungeheuren Schaden angerichtet hat.«
Sie sah zu ihm hoch, nicht sonderlich interessiert, und widmete sich wortlos wieder ihrem Tuch.
»Wollt Ihr uns behilflich sein«, donnerte er, »oder müssen wir Euch mit dem Gefühl verlassen, dass man hier den Taugenichtsen Schutz gewährt?«
Die Frau machte ein erschrockenes Gesicht und riss die Augen auf. Dann holte sie tief Luft, was angesichts ihres Brustumfangs reichte, um den selbst ernannten Inquisitor alle Diebe der Welt vergessen zu lassen, stemmte die Arme in die Hüften und rief:
»Welch eilfertige Unterstellung! Hätten wir einen Dieb gesehen, säße er längst im Weckschnapp.«
»Da gehört er auch hin! Er hat mir das Wams zerrissen, ein halbes Pferd gestohlen, ach, was sage ich, ein ganzes, ist darauf hinfortgeritten, und es sollte mich nicht wundern, wenn er unterwegs den einen oder anderen ermordet hat.«
»Unglaublich!« Die Frau schüttelte in ehrlicher Entrüstung den Kopf, was zur Folge hatte, dass Massen dunkelbrauner Locken hin- und herflogen. Angesichts dessen fiel es dem Befrager immer schwerer, sich auf die Angelegenheit der Verfolgung und Ergreifung zu konzentrieren. »Wie sieht er denn aus?«, hakte sie nach.
»Feuerrote Mähne.« Der Mann schürzte die Lippen. »Nebenbei, seid Ihr nicht mitunter sehr alleine hier am Bach?«
Ein honigsüßes Lächeln breitete sich auf den Zügen der Frau aus. »Aber sicher.«
»Nun ja –« Er legte die Fingerspitzen aufeinander.
»Wisst Ihr«, fügte sie hinzu, »manchmal denke ich, es wäre schön, jemanden zu haben, der einfach dasitzt und mir zuhört. Denn wenn mein Gatte, Ihr müsst wissen, er ist ein angesehener Prediger der Dominikaner, auf der Kanzel spricht, dann bin ich ganz alleine. Sieben Kinder habe ich geboren, aber sie treiben sich rum und suchen wohl die anderen fünf.«
»Was?«, stammelte der Mann. »Welche anderen fünf? Ich denke, Ihr habt sieben.«
»Sieben aus der ersten Ehe. Mit dem Kanonikus sind’s noch mal fünf, macht gemeinschaftlich zwölf hungrige Mäuler und nichts zu essen, denn glaubt ja nicht, dass das bisschen Färberei was abwirft.« Sie schaffte es, noch strahlender zu lächeln. »Nun frage ich mich, ob es sinnvoll wäre, dem Antoniter den Laufpass zu erteilen.«
»Äh – war’s nicht eben noch ein Dominikaner?«
»Ja, vorhin. Aber jetzt spreche ich von meinem Antoniter. So ein schlapper Hund! Wenn ich dagegen Euch betrachte –«
»Nein, wartet.«
»Ein Mann von Eurer Größe, gebaut wie ein Heiliger, ein Quell der Weisheit, ganz anders als der Weinhändler, mit dem ich –«
»Ja, gewiss. Habt einen guten Tag.« Der Mann beeilte sich, seinen Kameraden zu folgen, die kopfschüttelnd zurück in Richtung Kornpforte gegangen waren. »Und solltet Ihr den Dieb sehen«, rief er ihr im Davonlaufen zu, »dann bestellt ihm – also, sagt ihm – fragt ihn –«
»Was, edler Herr?«
»Genau. Genau das.«
Sie blickte den dreien nach, bis sie verschwunden waren. Dann musste sie furchtbar lachen.
Ihr Lachen war lauter als die Glocken von St. Georg. Nach einer Weile taten ihr die Seiten weh, und die Tränen liefen ihr übers Gesicht, sodass sie kaum sah, wie sich das blaue Tuch aus den Fluten erhob, abgestreift wurde und ein tropfnasser, verzweifelt nach Luft japsender Jacop der Fuchs zum Vorschein kam.
Richmodis von Weiden
»Ihr seid also ein Dieb?«
Jacop lag neben ihr, immer noch benommen, und hustete den letzten Rest Wasser aus seinen Lungen. Es hatte einen scharfen Beigeschmack. Weiter oberhalb der Blaufärber hatten die Rotgerber ihr Quartier, und da geriet einiges in den Bach, was man besser nicht herunterschluckte.
»Ja«, keuchte er. Sein Brustkorb hob und senkte sich. »Und ein ganz schlimmer obendrein!«
Sie zog einen Schmollmund.
»Mir habt Ihr weisgemacht, selber vor Dieben und Mördern auf der Flucht zu sein.«
»Irgendwas musste ich ja erfinden. Tut mir leid.«
»Ach was.« Sie versuchte, sich ein Kichern zu verkneifen, aber es gelang ihr nicht. »Pontius Pilatus wusch seine Hände in Unschuld. So wie Ihr gebadet habt, seid Ihr reif zum Predigen.«
Jacop stemmte sich hoch und schüttelte das Wasser aus seinen Haaren.
»Ich bin reif für was zu beißen. Mein Mittagessen war in dem Mantel.«
»Welchem Mantel?«
»Dem – na, meinem Mantel halt. Ich musste ihn auf dem Forum lassen. Widrige Umstände.«
»Wohl in Gestalt diverser Leute, die wiederhaben wollten, was Ihr ihnen nicht ganz rechtmäßig abgenommen habt.«
»Im weitesten Sinne – ja«, gab Jacop zu.
»Was war denn drin?«
»Im Mantel? Karotten, eine Wurst. Egal.«
Sie musterte ihn sichtlich amüsiert.
»So egal scheint Euch das aber nicht zu sein. Und viel geblieben ist Euch auch nicht«, feixte sie. »Immerhin eine Hose. Wenn auch keine, die ich meinem ärgsten Feind verkaufen würde.«
Jacop sah an sich herunter. Seine neue Freundin hatte nicht ganz unrecht. Aber Hose und Mantel waren das Einzige, was er an Kleidungsstücken besaß. Das heißt, besessen hatte. Er rieb sich die Augen und stocherte mit einem Finger im linken Ohr, das noch vom Wasser brauste.
»Habt Ihr sie eigentlich geglaubt?«, fragte er.
»Was?«
»Meine Geschichte.«
Sie sah ihn unter halb geschlossenen Lidern an und grinste spöttisch, während ihre Hände das blaue Tuch durch und durch walkten.
»Wenn Ihr nur halb so schlecht im Klauen wie im Lügen seid, rate ich Euch, den Markt für die nächsten paar Jahrzehnte zu meiden.«
Jacop zog geräuschvoll die Nase hoch.
»Ich bin gar nicht so schlecht in diesen Dingen.«
»Nein. Ihr geht dabei nur baden.«
»Was wollt Ihr?« Er versuchte mehr schlecht als recht, sich den Anschein von gekränkter Eitelkeit zu geben. »Jeder Beruf hat seine Risiken. Außer vielleicht der des Färbers. Eine in höchstem Maße anregende Tätigkeit. Blaue Farbe morgens, blaue Farbe mittags, blaue –«
Ihr Zeigefinger spießte ihn fast auf.
»Was du nicht sagst, du hohle Nuss! Ich sitze friedlich hier am Wasser, und da kommt so ein abgebrochener roter Blitz wie du und will versteckt sein. Zu allem Überfluss muss ich mich deinetwegen in ein überflüssiges Palaver mit diesem Hahnrei einlassen, nur um schlussendlich festzustellen, dass der eigentliche Lump gleich vor mir in der Bach liegt. Und das nennst du kein Risiko?« Jacop schwieg, während seine Gedanken zu dem entgangenen Mittagessen zurückwanderten.
»Was ist?«, schnauzte sie ihn an. »Hat’s dir die Sprache verschlagen? Hat dir die lange Zeit im Wasser Kiemen wachsen lassen?«
»Ihr habt ja recht! Was soll ich sagen?«
»Wie wäre es zur Abwechslung mit Danke?«
Jacop sprang in die Hocke und setzte seinen Hundeblick auf.
»Ihr wollt ein Dankeschön?«
»Das wäre ja wohl das Mindeste!«
»Alsdann. Ich werde sehen, was sich tun lässt.«
Zu ihrer Verwunderung begann er in den unergründlichen Weiten seiner Hose zu kramen, krempelte unter Murmeln und Flüchen das Innerste nach außen und das Zuvorderste nach hinten, bis ein Leuchten über seine Züge ging. Er zog etwas hervor und hielt es ihr triumphierend unter die Nase.
»Sie ist noch da!«
Die Färberin runzelte die Stirn und nahm das Ding in Augenschein. Ein löcheriges Stöckchen von der Länge ihres Zeigefingers.
»Na und? Was soll das sein?«
»Passt auf.«
Er setzte das Stöckchen an die Lippen und blies hinein. Eine helle, wunderliche kleine Melodie erklang.
»Eine Flöte!«, rief sie entzückt.
»Ja.« Schnell ließ er den Hundeblick fahren. Die Zeit schien gekommen für den Augenaufschlag des unwiderstehlichen Halunken. »Und ich schwöre beim Erzengel Gabriel, dass ich diese Weise soeben einzig und allein für Euch erdacht und niemals einer anderen vorgespielt habe oder jemals vorspielen werde, oder der heilige Petrus soll mir die Geister der Löwen aus dem Circus Maximus auf den Buckel schicken.«
»Was Ihr alles wisst! Im Übrigen glaube ich Euch kein Wort.«
»Wie dumm. Also muss ich noch mehr des Guten tun.« Jacop warf das Stöckchen in die Luft und fing es mit der Rechten auf. Als seine Finger auseinanderfuhren, war die Flöte verschwunden.
Ihre Augen wurden zunehmend größer, bis Jacop fürchtete, sie würden aus den Höhlen kullern.
»Wie habt Ihr –?«
»Und nun gebt acht.«
Rasch griff er hinter ihr Ohr, hexte die Flöte hervor, nahm ihre Linke aus dem Wasser und legte das winzige Instrument in ihre Handfläche.
»Für Euch«, strahlte er.
Sie errötete, schüttelte den Kopf und lachte leise. Jacop stellte fest, dass er ihr Lachen mochte.
Er strahlte noch mehr.
Sie betrachtete eine Weile ihr Geschenk, dann fixierte sie ihn nachdenklich und krauste die Nase.
»Seid Ihr wirklich so ein Erzverbrecher?«
»Aber gewiss! Ich habe Dutzende von Männern erdrosselt, und das nur mit meinem kleinen Finger. Man nennt mich das Joch!« Wie zum Beweis spreizte er den kleinen Finger ab, kam zu dem Schluss, dass es der Geschichte an Ernst und Wahrhaftigkeit gebrach, und ließ die Schultern hängen.
Sie bedachte ihn mit einem strafenden Blick, während ihre Lippen zuckten vor verhaltener Heiterkeit.
»Schon gut.« Er warf ein Steinchen ins Wasser. »Ich versuche einfach, am Leben zu bleiben. Das ist alles. Ich finde das Leben schön, was nicht immer leicht ist. Und ich denke, der da oben wird das verstehen. Es sind ja nicht die Äpfel aus dem Paradies, die ich mitgehen lasse.«
»Aber es sind Gottes Äpfel.«
»Schon möglich. Aber mein Hunger ist nicht Gottes Hunger.«
»Was Ihr alles so daherredet! Helft mir lieber mit dem Tuch.«
Gemeinsam nahmen sie das vom Wasser schwere Leinen hoch und trugen es zu einem aus Holzstecken errichteten Gerüst vor dem Haus, in dem sie offenbar wohnte. Weitere Stoffe trockneten dort bereits in der Sonne. Es roch nach Waid, dem Farbstoff aus dem Jülicher Land, dank dessen die Blaufärber überhaupt blau färben konnten.
»Wie heißt Ihr eigentlich, da ich Euch nun schon mal das Leben gerettet habe?«, fragte sie, während sie den Stoff auf dem Gitter glatt zog und achtgab, dass die Ränder nicht den Boden streiften.
Jacop fletschte die Zähne.
»Ich bin der Fuchs!«
»Man sieht’s«, gab sie trocken zurück. »Habt Ihr auch einen Namen?«
»Jacop. Und Ihr?«
»Richmodis.«
»Was für ein schöner Name.«
»Was für ein einfallsloses Kompliment.«
Jacop musste lachen. »Lebt Ihr hier ganz alleine?«
Sie schüttelte den Kopf. »Nein. Ihr seid heute schon der Zweite, der mir die Frage stellt. Was muss ich eigentlich noch alles für Geschichten erfinden, damit ihr Strolche mich endlich zufriedenlasst?«
»Also wohnt Ihr mit Eurem Gatten hier?«
Sie verdrehte die Augen. »Ihr lasst nicht locker, was? Ich lebe bei meinem Vater. Eigentlich ist er der Färber, aber der Rücken macht ihm immer mehr zu schaffen, und seine Finger sind krumm vom Rheuma.«
Rheuma war die typische Färberkrankheit, dem ständigen Umgang mit Wasser geschuldet, gleich zu welcher Jahreszeit. Im Allgemeinen lebte man als Blaufärber nicht schlecht, weil aus den Stoffen Arbeitskittel geschnitten wurden, und über Mangel an Arbeit konnte sich im Reich keiner beklagen. Der Tribut dafür war eine ruinierte Gesundheit. Aber letzten Endes ruinierte jedes Handwerk die Gesundheit, jedes auf seine eigene Weise, und die reichen Kaufleute, die ihr Geld mehr mit dem Kopf verdienten, wurden fast ausnahmslos von der Gicht geplagt. Erst kürzlich, hieß es, hätte der Leibarzt König Louis’ IX. von Frankreich in Royaumont öffentlich konstatiert, die Gicht erwachse aus dem übermäßigen Genuss von Schweinefleisch, doch die Medici vom Heiligen Stuhl hätten dem entgegengehalten, wer reich sei, habe mehr Gelegenheit zur Sünde und dementsprechend mehr zu büßen. Was als Beweis dienen möge für die Gicht als einen Akt von Gottes Gnaden, der Selbstzucht und Kasteiung dienend, womit einhergehend der Herr in seiner unendlichen Güte immerhin den Aderlass erfunden und so ein Licht entfacht habe im hohlen Schädel der Medizin. Darüber hinaus sei nicht einzusehen, was dieses Forschen nach Ursachen überhaupt bezwecke – als diene Gottes Wille konzilischen Disputen oder gar dazu, die Vermessenheit der Ketzer und Häretiker zu nähren!
»Tut mir leid für Euren Vater«, sagte Jacop.
»Wir haben einen Physikus in der Familie.« Richmodis betrachtete prüfend das Tuch und zupfte eine Falte heraus. »Da ist er gerade und verschafft sich Linderung. Ich vermute aber sehr stark, dass es Linderung von jener Sorte ist, die man Rebsorte nennt und zu der mein Onkel eine überaus innige Beziehung pflegt.«
»Dann preist Euren Vater glücklich, dass er wenigstens den Becher halten kann.«
»Das kann er offenbar am besten. Und seine Kehle hat das Rheuma auch noch nicht betroffen.«
Damit schien die Unterhaltung einen toten Punkt erreicht zu haben. Beide warteten, dass der andere etwas Kluges sagte, aber eine Zeit lang hörte man auf der Bach nur das Bellen eines Hundes.
»Darf ich Euch etwas fragen?«, begann Jacop schließlich.
»Ihr dürft.«
»Warum habt Ihr keinen Mann, Richmodis?«
»Gute Frage. Warum habt Ihr kein Weib?«
»Ich – ich habe ein Weib.« Jacop fühlte Verlegenheit in sich aufsteigen. »Nein, eigentlich nicht. Wir verstehen einander nicht mehr so besonders. Nennt sie meinethalben eine Freundin.«
»Sorgt Ihr für sie?«
»Einer sorgt für den anderen, na ja. Sofern einer gerade was übrig hat.«
Jacop hatte nicht beabsichtigt, traurig zu klingen, aber zwischen Richmodis’ Brauen bildete sich eine steile Falte. Sie lächelte nicht mehr, betrachtete ihn vielmehr, als wäge sie die unterschiedlichsten Möglichkeiten ab, auf das Gehörte zu reagieren. Ihr Blick wanderte die Bach hoch. Von den Nachbarn, die gerade draußen waren und ihre Färberbottiche füllten, sah einer zu ihnen herüber und dann schnell wieder weg.
»Sie werden sich das Maul zerreißen, was Goddert von Weidens Tochter alldieweil mit einem halb nackten Rotschopf zu schaffen hat«, schnaubte sie verächtlich. »Und bei der nächsten Gelegenheit erzählen sie’s dann meinem Vater.«
»Schon gut«, sagte Jacop hastig. »Ihr habt genug getan. Ich verschwinde.«
»Ihr werdet nichts dergleichen tun«, fuhr sie ihn an. »Um den Alten braucht Ihr Euch nicht zu sorgen. Wartet hier.«
Ehe Jacop etwas sagen konnte, war sie im Haus verschwunden. Er wartete also.
Jetzt, da er alleine war, starrten mehr Leute zu ihm herüber. Unverhohlene Neugier mischte sich mit offenem Misstrauen. Jemand zeigte auf ihn, und Jacop überlegte, ob es nicht doch besser sei, einfach zu verschwinden.
Aber was sollte Richmodis denken, wenn er das Weite suchte? Wie könnte er das überhaupt angesichts der schönsten schiefen Nase, deren Besitzerin ihm je ihre Aufmerksamkeit gezollt hatte?
Versonnen nestelte er an dem Tuch herum.
Die Blicke der Nachbarn wurden sofort bedrohlich, und er zog die Hand weg. Jemand trieb eine Schar Gänse des Wegs daher und musterte ihn verstohlen.
Jacop begann zu pfeifen und vergnügte sich einstweilen damit, das Haus der von Weidens näher in Augenschein zu nehmen. Es war nicht unbedingt das prächtigste, stellte er fest. Sein vorkragender erster Stock wies sich durch zwei kleine Fenster aus, und mit dem gedrungenen Spitzdach darüber schien es zwischen den anliegenden Bauten beinahe zu verschwinden. Aber das Fachwerk war gepflegt, die Balken erst vor Kurzem dunkel nachgestrichen, und neben der Türe blühte unter dem Fenster zur Stube ein Busch fetter, gelber Blumen. Offenkundig war das Richmodis’ Werk.
Richmodis, die Entschwundene.
Er sog laut die Luft ein und trat von einem Bein aufs andere. Unklug, länger zu verweilen. Besser, er –
»Hier!« Richmodis erschien wieder unter dem Türbalken, einen Packen Zeug vor sich hertragend, wohinter sie fast vollständig verschwand. »Nehmt das. Der Mantel ist alt, aber immer noch besser, als dass Ihr ständig die Weiber erschreckt. Und da« – ehe Jacop sich’s versah, fühlte er etwas auf seinen Kopf gedrückt und verlor jede Sicht – »ein Hut gegen Regen und Schnee. Die Krempe hängt ein bisschen, aber dafür ist er dicht.«
»Die Krempe hängt ein bisschen sehr«, bemerkte Jacop und schob mit einer Hand das unförmige Ding in den Nacken, während er mit der anderen bemüht war, festzuhalten, was sie ihm auflud.
»Meckert nicht! Des Weiteren ein Wams und eine Hose. Mein Vater wird mich in den Kacks wünschen. Nehmt außerdem die Stiefel mit. Und jetzt macht Euch aus dem Staube, bevor sich halb Köln zu der Idee versteigt, Ihr wolltet um meine Hand anhalten.«
Jacop hatte eigentlich gedacht, dass ihn so schnell nichts aus der Fassung bringen könne. Jetzt starrte er auf seinen neuen Besitz und war entgegen seiner Natur sprachlos.
»Warum tut Ihr das?«, brachte er endlich heraus.
Ein spitzbübisches Lächeln zauberte winzige Fältchen um ihre Augen.
»Niemand schenkt mir ungestraft eine Flöte.«
»Oh!«
»Natürlich seid Ihr jetzt in der Verpflichtung, mir das Spielen beizubringen.«
Plötzlich hatte Jacop das innige Bedürfnis, den Fleischer und alle, die ihn auf die Bach gejagt hatten, an sein Herz zu drücken.
»Ich werde es bestimmt nicht vergessen.«
»Das will ich Euch auch nicht geraten haben.«
»Wisst Ihr was?«, krähte er übermütig. »Ich liebe Eure Nase!« Dunkles Rot überzog ihre Wangen.
»Los jetzt. Ab mit Euch!«
Jacop grinste breit. Er machte auf dem nackten Absatz kehrt und sah zu, dass er Land gewann.
Richmodis schaute ihm nach, die Hände in die Hüften gestemmt. Ein hübscher Bursche, dachte sie. Dann fiel ihr ein, dass sie zu gerne in sein Haar gefasst hätte. Schade, dass er nicht zurückkommen würde. Kerle wie er waren niemandem verpflichtet außer sich selber. Der würde seinen roten Schopf so bald nicht wieder durch die Bach tragen.
Melancholisch bis vergnügt ging sie zurück ans Wasser, gewaltig im Irrtum.
Rheingasse
Die alte Frau saß im Schatten. Nur das Relief ihrer Hände hob sich fahl vom schwarzen Samt des Kleides ab, bizarr im schräg einfallenden Licht der Nachmittagssonne.
Der Raum, in dem sie saß, war groß und hoch. Er lag im ersten Stock und verfügte an der nördlichen Längsseite über fünf eng beieinanderliegende Arkadenfenster zur Straße hin. Bis auf die prachtvollen Wandteppiche an der Rückfront und den Seitenwänden enthielt er fast kein Mobiliar. Lediglich ein wuchtiger, schwarzer Tisch und einige Lehnstühle verliehen ihm eine Andeutung von Wohnlichkeit. Im Allgemeinen wurde er als Festsaal oder für offizielle Zusammenkünfte benutzt.
Rechts von der alten Frau saß ein Mann Ende fünfzig und trank Wein aus einem gehämmerten Pokal. Ein jüngerer stand reglos neben ihm.
Im Türrahmen lehnte Mathias und fixierte nachdenklich einen Burschen Anfang zwanzig, der mit unruhigen Schritten den Raum entlang der Fensterfront durchmaß und schließlich vor dem Sitzenden stehen blieb.
»Gerhard wird schweigen«, sagte er. Seine Stimme war ein einziges Flehen.
»Ich bezweifle nicht, dass er schweigen wird«, entgegnete der Mann mit dem Pokal nach längerer Pause, während der nichts als das rasselnde Keuchen der Alten zu hören war. »Ich frage mich nur, wie lange.«
»Er wird schweigen!«, wiederholte der Bursche eindringlich.
Mathias stieß sich vom Türrahmen ab und ging langsam in die Mitte des Raumes.
»Kuno, wir alle wissen um Eure Freundschaft mit dem Meister. Ich bin ebenso wie Ihr der Überzeugung, dass Gerhard keinen von uns verraten wird. Er hat mehr Ehre im kleinen Finger als sämtliche Pfaffen in ihren klerikalen Bälgern.« Er blieb vor dem Jungen stehen und sah ihm geradeheraus in die Augen. »Aber was ich glaube, muss nicht unbedingt den Tatsachen entsprechen. Wir haben alles zu gewinnen, aber auch alles zu verlieren.«
»In ein paar Tagen wird ohnehin alles ausgestanden sein«, sagte Kuno beschwörend. »Gerhard wird bis dahin nichts unternehmen, was uns schaden könnte.«
»Und hernach?« Der andere junge Mann, der bis dahin geschwiegen hatte, trat neben dem Lehnstuhl hervor und ballte wütend die Faust. »Was nützt uns alle Umsicht, wenn wir dann das Gelingen unseres Planes auf dem Rad bedauern dürfen, mit zerschmetterten Knochen, derweil sich die Raben an unseren Augen gütlich tun? Ha, und an Euren, Kuno! Sie werden Euch die verträumten Äuglein aus den Höhlen picken, die mit der Blödheit eines Neugeborenen die Welt betrachten.«
»Genug, Daniel.« Der Ältere hob die Hand.
»Genug?« Daniel ließ seine Faust auf die Tischplatte krachen. »Während dieser sentimentale Narr uns alle dem Verderben preisgibt?«
»Ich sagte, es ist genug!«
»Hör auf deinen Vater«, sagte Mathias beschwichtigend. »Wir dienen unserer Sache nicht mit Streit. Mir reicht es, einen Esel wie Heinrich in unseren Reihen zu wissen.«
»Das war ja nun mal nicht zu vermeiden«, brummte Daniel.
»Manchmal können auch Dummköpfe von Nutzen sein«, gab Mathias zu bedenken. »Und sein Gold ist ein wertvoller Verbündeter. Du siehst also, ich hadere nicht mit den Unwägbarkeiten des Schicksals. Allerdings«, er legte den Zeigefinger an die Lippen, wie er es zu tun pflegte, wenn er sich einer Sache nicht hundertprozentig sicher war, »müssen wir Gerhards Vertrauen suchen.«
»Wir haben es«, sagte Kuno leise.
»Wir haben einen Dreck«, schrie Daniel.
»Schluss jetzt!« Der ältere Mann sprang auf und knallte seinen Pokal auf den Tisch. »Benutzt gefälligst Euren Grips statt Eurer Trompeten, es kommen mir da zu viele Misstöne heraus. Wo liegt denn das Problem? Wir beraten gemeinsam eine Sache, und Gerhard, den wir alle schätzen, ein hochgeachteter Bürger dieser Stadt und lieber, enger Freund, mag sich uns nicht anschließen. Sein gutes Recht, sage ich. Wir hätten es wissen sollen, anstatt in seiner Gegenwart so leichtfertige Reden zu führen. Wenn es nun Probleme gibt, dann durch unsere Schuld.«
»Es geht hier nicht um Schuld«, sagte Daniel.
»Doch. Darum geht es das ganze Leben. Aber gut, es ist passiert. Kuno hier reklamiert, in Gerhard einen Freund zu haben, für dessen Verschwiegenheit er sich verbürgt.«
»Das kann er nicht«, stieß Daniel hervor. »Gerhard hat uns klar zu verstehen gegeben, was er von unserem Unterfangen hält.«
»Er hat unser Angebot, ihn in die Gruppe aufzunehmen, abgelehnt. Das heißt noch lange nicht, dass er uns verraten wird.«
Daniel sah mürrisch vor sich hin.
»Na gut, Johann«, seufzte Mathias. »Es heißt aber auch nicht, dass wir uns auf sein Schweigen verlassen können. Was schlägst du also vor?«
»Wir reden noch mal mit ihm. Prüfen seine Ergebenheit und Treue. So, wie ich ihn einschätze, werden wir danach ruhig schlafen können.« Johann sah zu Kuno hinüber, auf dessen Zügen sich ein Anflug von Erleichterung bemerkbar machte. »Ich denke, das wird auch im Interesse unseres jungen Freundes sein.«
»Ich danke Euch«, flüsterte Kuno. »Ihr werdet es gewiss nicht bereuen.«
Johann nickte ernst.
»Dann lasst auch Eure Brüder wissen, dass sie sich keine Sorgen mehr machen sollen.«
Der junge Mann zögerte, beugte kurz das Haupt und verließ den Raum. Zurück blieben Johann, Mathias, Daniel und die Frau im Schatten.
Von draußen erklang das schürfende Geräusch eines vorbeirollenden Fuhrwerks. Stimmen drangen schwach nach oben, Fetzen von Konversation. Eine Schar Kinder rannte lärmend und streitend vorbei.
Nach einer Weile sagte Johann tonlos: »Was sollen wir tun, Mutter?«
Die Hände begannen sich zu bewegen. Dürre Finger zuckten, krabbelten übereinander, raschelten in den Falten des schwarzen Brokats wie Spinnen.
Ihre Stimme war nicht mehr als ein Knistern.
»Bringt ihn um.«
Die große Mauer
Als Jacop zu dem Platz, den er seinen Wohnsitz nannte, zurücklief, beschloss er kurzfristig, Tilman zu besuchen, einen Freund, der in einer weniger feinen Gegend wohnte.
Die Klassifizierung war ein Witz. Keiner von ihnen wohnte in einer annähernd guten Gegend. Aber unter den Bettlern und Ärmsten der Armen, die nicht mal einen Platz in einem der Hospitäler und Konvente fanden, hatten sich während der letzten Jahre merkwürdige Hierarchien herausgebildet – und dazu gehörte auch das Mauerrecht oder Status muri.
Die Geschichte des Status begann genau genommen Ende des vorangegangenen Jahrhunderts, als die Kölner aus der schwelenden Feindschaft zwischen Kaiser Barbarossa und Heinrich dem Löwen Konsequenzen zogen, die das Erscheinungsbild der Stadt nachhaltig verändern sollten. Heinrich, Herzog von Sachsen, der Welfe war, hatte dem Staufer Barbarossa nämlich kurzerhand die Freundschaft aufgekündigt. Was nichts anderes hieß, als dass Barbarossa seine waffenstarrende Fehde mit Papst Alexander III. gefälligst ohne ihn auszufechten habe.
Das eigentlich Vertrackte an der Sache war, dass der damalige Kölner Erzbischof, Philipp von Heinsberg, in Barbarossas Kriegen fleißig mitmischte und den Löwen nun des Vertrauensbruchs auch gegen ihn bezichtigte. Erfahrungsgemäß führten solche Zwistigkeiten zu Mord und Totschlag, allerdings primär an denen, die für die Misere nicht das Mindeste konnten. Für die Bauern machte es keinen Unterschied, ob das jeweils durchziehende Heer ihrem oder dem feindlichen Herrscher diente. So oder so wurden ihre Frauen vergewaltigt, ihre Kinder erschlagen und sie selber mit den Füßen ins Feuer gehalten, bis sie verrieten, wo ihr bisschen Erspartes war. Ihr Hof wurde niedergebrannt, die Vorräte konfisziert oder an Ort und Stelle aufgegessen, und weil die Soldaten durchaus einsahen, dass ein Bauer ohne Hof nicht überlebensfähig war, hängten sie ihn der Ordnung halber an den nächsten Baum und zogen weiter.
Niemand regte sich groß darüber auf.
Kritischer wurde es allerdings, wenn sich der ständige Hader auf dem Rücken des Klerus entlud. Als Philipp von Heinsberg im Mai 1176 nach Italien gezogen war, hatte der Löwe soeben auf Gegenkurs geschwenkt. Philipp reagierte, indem er das welfische Kloster Weingarten dem Erdboden gleichmachte, einschließlich eines gründlichen Gemetzels an den heiligen Brüdern. Das hielt Papst Alexander III. zwar nicht davon ab, ihn als Kölner Erzbischof zu bestätigen und mit Barbarossa Frieden zu schließen, aber der Löwe, Verlierer auf der ganzen Linie, kochte vor Wut und schlug nun seinerseits den Staufern die Schädel ein, wohlweislich aus dem Hinterhalt. Philipp nahm das zum Anlass, Westfalen zu verwüsten. Höfe und Klöster brannten. Der arg in Bedrängnis geratene Löwe entsann sich besserer Tage und versuchte, sich bei Barbarossa wieder einzuschmeicheln, was ihm durch eigene Schuld gründlich misslang. Ungefähr zu dieser Zeit mussten Gespräche zwischen Barbarossa und Philipp stattgefunden haben, was eine eventuelle Neuverteilung der Herzogtümer des Löwen anbetraf, jedenfalls witterte Philipp Morgenluft und zog nun erst recht mit Heerscharen Bewaffneter plündernd und brandschatzend gegen den Löwen, um ihn endgültig in die Knie zu zwingen.
Wie es aussah, konnte der Löwe nur noch beten.
Dann jedoch machte Philipp einen Fehler. Er wurde größenwahnsinnig und verscherzte es sich mit seinen Verbündeten, sodass sie ihn mitten in seinem Feldzug gegen den Löwen sitzen ließen. Nur das Kölner Fußvolk blieb ihm, aber damit alleine war kein Krieg zu gewinnen. Zerknirscht befahl er den Rückzug. Die allgemein schlechte Stimmung führte zum Desaster. Die kölnischen Streiter für den Herrn erschlugen jeden, der das Pech hatte, gerade in Sichtweite zu sein. Damit forcierten sie die Gefahr, dass sich die Kämpfe auf Kölner Boden fortsetzten, beträchtlich. Was, wie man wusste, vor allem wieder das Leben jener kosten würde, die nichts weniger gewollt hatten als diesen vermaledeiten Unsinn von Krieg.
Jetzt aber hatten sie ihn am Hals.
In dieser Situation wurde es dem Kölner Stadtrat, der Philipp von Heinsberg bis dahin unterstützt hatte, endgültig zu bunt. Der Erzbischof war gerade nicht in der Stadt. Sofort begann man mit dem Bau einer neuen, erweiterten Befestigungsanlage, um die Stadt zu schützen, was von Rechts wegen nur dem Erzbischof oder dem Kaiser zustand. Wie erwartet gab es einen Riesenkrach. Philipp von Heinsberg tobte, verbot die Mauer, wurde ignoriert, schrie nach Barbarossa und ließ sich am Ende durch die Zahlung von zweitausend Mark besänftigen.
Damit stand der großen Mauer nichts mehr im Wege.
Jetzt, Anno Domini 1260 und gut achtzig Jahre nach Baubeginn, erklärte der Rat der Stadt das Werk für vollendet. Mit einer Länge von sechs Meilen, zwölf gewaltigen Torburgen und zweiundfünfzig Wehrtürmen stellte sie jede andere Stadtmauer im wortwörtlichsten Sinne in den Schatten. Ihr Lauf umfasste nicht nur das städtische Leben, sondern auch einen erheblichen Teil der Ländereien und Klosteranlagen, die bis dahin ungeschützt vor den Toren Kölns gelegen hatten. An den Rheinufern durch den wehrhaften Bayenturm und die Kunibertspforte begrenzt, zog sie sich halbkreisförmig um die Liegenschaften von St. Severin und St. Pantaleon im Süden, St. Mauritius im Westen und St. Gereon auf der nordwestlichen Seite, schloss viele der ertragreichen Obst- und Rebgärten mit ein und verwandelte die Stadt in eine eigene, beinahe autarke Welt.
Für die Kölner war die Mauer das Resultat einer klugen und mutigen Sicherheitspolitik, die ihr Selbstbewusstsein zum Leidwesen des jetzigen Erzbischofs Konrad von Hochstaden ungemein stärkte.
Für Jacop war sie ein Segen.
Weder verstand er sonderlich viel von Politik, noch wollte er etwas davon verstehen. Aber die Konstrukteure der Mauer hatten eine architektonische Besonderheit erdacht, die ihm und anderen außerordentlich zustattenkam. In regelmäßiger Folge wies sie nämlich an der Innenseite Rundbögen auf, tief und hoch genug, um darunter Schutz zu suchen vor den Unbilden des Wetters und der Jahreszeiten. Irgendwann war jemand auf die Idee gekommen, sich aus Brettern, Ästen und Lumpen eine provisorische Hütte in einen der Bögen zu bauen. Seither hatte es eine Handvoll Nachahmer gegeben. Einer davon war ein alter Tagelöhner namens Richolf Wichterich gewesen, der auf der Dombaustelle hin und wieder ins Schwungrad für die Winden stieg und auf seine bescheidene Weise überlebte. Als Jacop vor wenigen Monaten wieder nach Köln gekommen war, hatte er sich mit dem Alten angefreundet, aber Richolf war kurz darauf gestorben, und so hatte Jacop die Hütte bezogen. Damit besaß er, was in der Stadt bald nur noch spöttisch Status muri genannt wurde – das Privileg, unter allen jämmerlichen Daseinsformen zumindest eine leidlich trockene fristen zu dürfen, im Schutz einer Mauer, die selbstverständlich nur für seinesgleichen errichtet worden war.
Jacops Mauerbogen lag nicht weit von der nova porta eigelis, abseits genug, um den Männern des Burggrafen kein Dorn im Auge zu sein.
Im Gegensatz zu Jacop, der fast nichts hatte, hatte sein Freund Tilman gar nichts. Er schlief meistens am Entenpfuhl, der rückwärtigen Seite einer Mauererweiterung aus dem 10. Jahrhundert, die St. Maximin und St. Ursula sowie die Klöster der Machabäer und Dominikaner umfasste. Dort gab es keine schützenden Bögen. Die Gegend war elend. Im gemächlich abfallenden Graben hatten sich faulige Tümpel gebildet, auf denen Enten dümpelten, dahinter ragten Weiden und Pappeln aus dem Schlamm, dann begannen die ausgedehnten Obstgärten der Klöster und Stifte. Es stank erbärmlich. Tilman pflegte zu sagen, dass es sich am Fuße seiner Mauer wohl noch erbärmlicher stürbe als auf freiem Feld, und unterstrich seine Ansicht mit einem bellenden Husten, der klang, als müsse er sich über solche Fragen nicht mehr lange Gedanken machen.
Als Jacop ihn nach einigem Suchen endlich fand, saß er mit dem Rücken zur Mauer auf dem Pfuhl und schaute in den Himmel. Sein magerer Körper steckte in einem langen, zerfetzten Hemd, die Füße waren mit Lumpen umwickelt. Tilman hätte ein stattlicher Mann sein können, aber er war dürr wie ein Stecken.
Jacop setzte sich neben ihn. Eine Zeit lang betrachteten beide die langsam treibenden Wolken.
Am Horizont zog eine schwarze Wand herauf.
Tilman hustete und drehte den Kopf zu Jacop. Seine geröteten Augen musterten ihn von oben bis unten.
»Steht dir«, meinte er.
Jacop schaute an sich herunter. In den Kleidern seines unfreiwilligen Wohltäters sah er immerhin aus wie ein einfacher Mann und nicht mehr wie ein Bettler, ungeachtet des Ungetüms von Hut. Beim Gedanken an sein Bad im Duffesbach musste er plötzlich lachen.
»Ich war auf der Bach«, sagte er.
»So?« Tilman grinste matt. »Möglich, dass ich auch mal auf die Bach gehen sollte.«
»Untersteh dich! Oder meinetwegen untersteh dich nicht. Man braucht gewisse Eigenschaften, um in den Genuss solcher Geschenke zu kommen. Wenn du verstehst, was ich meine.«
»Verstehe. Wie heißt sie?«
»Richmodis«, sagte Jacop stolz. Nur anständige Mädchen hießen Richmodis.
»Was tut sie?«
»Ihr Vater ist Färber. Aber sie macht alles alleine.« Jacop schüttelte den Kopf. »Tilman, das war eine vertrackte Geschichte. Ich kann dir nur empfehlen, die Finger von den Fleischbänken zu lassen. Es steht ein Unstern über allen Schinken und Würsten.«
»Sie haben dich erwischt«, konstatierte Tilman nicht sonderlich überrascht.
»Sie haben mich über das halbe Forum gejagt! Ich musste am Ende auf die Bach entweichen. Bin untergetaucht.«
»Und Frau Richmodis hat dich rausgeangelt, was?«
»Sie ist keine Frau.«
»Was dann?«
»Ein Geschöpf von höheren Gnaden.«
»Du lieber Himmel.«
Jacop dachte an ihre schwellende Figur unter den züchtigen Kleidern und die schiefe Nase. »Und sie ist noch zu haben«, ergänzte er, als verkünde er seine Vermählung.
»Ach, Jacop.«
»Na und? Warum denn nicht?«
Tilman beugte sich vor. »Wenn ich dir einen Rat geben darf, meide das Forum ebenso wie die Bach und schlag dir den Wanst in nächster Zeit woanders voll. Deinen Haarschopf erkennt man bis nach Aachen.«
»Nur kein Neid! Ich hab bezahlen müssen für die Kleider.«
»Wie viel?«
»Viel.«
»Gib nicht so an. Was besitzt du schon?«
»Ich besaß. Drei Karotten und eine Rinderwurst.«