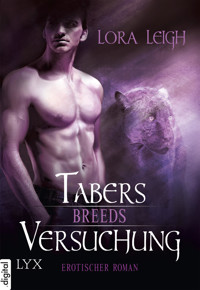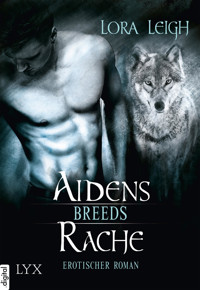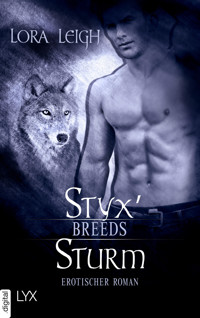9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Breeds-Serie
- Sprache: Deutsch
Im Netz von Lügen und Verrat
Die Reporterin Cassa Hawkins gilt als loyale Unterstützerin der Breeds. Doch als diese beschuldigt werden, eine Reihe von brutalen Morden begangen zu haben, weiß sie nicht mehr, was sie glauben soll. Zusammen mit dem Tiger-Breed Cabal St. Laurents macht sie sich auf die Suche nach den Tätern. Und bevor die beiden es sich versehen, stecken sie mitten in einem Dschungel aus Lügen und Verrat.
"Knisternde Erotik, Spannung und tolle Charaktere. Suchtgefahr!" Lovelybooks
Band 14 der erfolgreichen Breeds-Serie von Bestseller-Autorin Lora Leigh
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 592
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Inhalt
Cover
Titel
Zu diesem Buch
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Epilog
Danksagung
Die Autorin
Die Romane von Lora Leigh bei LYX
Impressum
Lora Leigh
Cabals Herz
Roman
Ins Deutsche übertragen von Silvia Gleißner
Zu diesem Buch
Die Reporterin Cassa Hawkins gilt als loyale Unterstützerin der Breeds. Doch als diese beschuldigt werden, eine Reihe von brutalen Morden begangen zu haben, weiß sie nicht mehr, was sie glauben soll. Zusammen mit dem Tiger-Breed Cabal St. Laurents macht sie sich auf die Suche nach den Tätern. Und bevor die beiden es sich versehen, stecken sie mitten in einem Dschungel aus Lügen und Verrat.
Prolog
DAUERTRAININGSEINRICHTUNG FÜR BREEDS; DEUTSCHLAND
Es war eine Szene wie aus einem Albtraum. So entsetzlich und blutig, dass sie jeder Vorstellungskraft spottete und Cassa geschockt nach Luft schnappen ließ.
„Wir müssen den Öffnungsschalter finden“, schrie sie entsetzt, während ihr Mann neben ihr stand, die Kamera auf der Schulter auf den Sichtbereich der Todesgrube gerichtet, von der man bisher nur in Gerüchten gehört hatte.
Es war mehr als eine Grube des Todes. Es war ein Ort solcher Todesqual und Bösartigkeit, dass Cassa kaum begreifen konnte, was dort geschah.
Ein Dutzend Breeds, nackt, schimmernde Tigerstreifen auf der Haut, versuchten verzweifelt, den langen, tödlich scharfen Klingen auszuweichen, die ein grauenvolles Spiel mit ihnen trieben.
Blut spritzte an die Stahlwände, bildete Pfützen auf dem Boden unter den Leibern derer, die das Pech gehabt hatten, nicht schnell genug ausgewichen zu sein. Und noch immer kämpften die anderen darum, zu überleben und einander zu schützen.
Ein wildes Brüllen, von dem größten und stärksten der todgeweihten Tiger-Breeds, war durch die Sprechanlage zu hören. Er gab sich alle Mühe, die anderen beiseitezustoßen, um sie zu schützen und einen Weg zu finden, das mechanische Hauen und Stechen aufzuhalten, das sich in wehrloses Fleisch schnitt.
„Douglas, hilf mir“, schluchzte Cassa, als ihr Mann nur wort- und reglos dastand und mit der Kamera die Brutalität des Genetics Councils und dessen sogenannten progressiven Trainings aufzeichnete.
Wie konnte das nur geschehen? Sie drückte einen Schalter und schlug mit den Händen auf die Öffnungskolben, doch die Klingen schnitten und stachen weiter auf die Breeds ein.
Das wütende Brüllen wurde lauter, und die reine animalische Raserei darin jagte ihr Schauer des Entsetzens über den Rücken, als sie ihren Mann am Arm packte und zu sich zog.
Und da sah sie es. Wie erstarrt, reglos vor Schock, sah sie die kranke Freude in seinem Blick, die Zufriedenheit in seinem Gesicht.
Als habe ein Schlüssel endlich die Tore geöffnet zu dem, was sie seit Monaten geahnt hatte. Cassa blinzelte, als die Realität endlich mit voller Wucht ihren Verstand traf. Die Gruppe Männer und Frauen, die in dieses kleine Land gekommen war, um genau dieses Labor zu finden und die Breeds hier zu befreien, hatte mit viel zu vielen bedauernswerten Unglücksfällen und falschen Spuren zu kämpfen gehabt. Schon seit Tagen hatte der Befehlshaber, Jonas Wyatt, die gesamte Gruppe mit eisigem Misstrauen behandelt. Wegen eines einzigen Mannes.
„Du.“ Sie spürte, wie sie innerlich zerfiel, wie etwas in ihr zerbrach, als ihr klar wurde, dass auch sie eine Rolle gespielt hatte in der Täuschung, die nun genau die Männer und Frauen tötete, zu deren Rettung sie gesandt worden waren. „Was hast du getan?“ Sie schrie ihm ihre Beschuldigung entgegen und sah das spöttische Grinsen um seine Lippen, während fanatische Vorfreude in seinen blassblauen Augen glänzte.
„Was ich getan habe? Nein, Cassa, die Frage ist, was du getan hast? Ohne deine Hilfe wäre ich nie Teil dieses Teams geworden.“ Er lachte ihr offen ins Gesicht. Sie fühlte die Erheiterung, die verhasste spöttische Arroganz in seinem Tonfall. Und immer noch hallten Schreie durch den Kontrollraum.
Er war ihr Ehemann. Er hatte ihre Verbindungen und ihre Freunde benutzt, um zu erreichen, dass er ihr Kameramann wurde, um die Befreiung der seltensten Breeds, die je erschaffen worden waren, zu dokumentieren. Die Bengalen – Tiger-Breeds.
„Hilf mir, sie zu befreien!“, schrie sie, und ihre Schläge gegen seine Schultern lockerten die Kamera und rissen sie aus der Verankerung an seiner Schulter.
Das Krachen, mit dem die Ausrüstung zu Boden fiel, war nur ein weit entferntes Geräusch von Zerstörung, als Douglas mit seinen Fäusten eine Explosion brutalen Schmerzes durch ihren Kopf jagte und sie auf den Zementboden fallen ließ.
Qualvoller Schmerz raste durch ihren Leib, und sie konnte das schmerzerfüllte Wimmern, das ihr über die Lippen kommen wollte, nicht aufhalten. Okay, Hilfe von seiner Seite konnte sie vergessen.
Sie zog sich zum Bedienpult hoch, und Tränen liefen über ihre Wangen, als sie anfing, auf jeden Hebel oder Knopf, den sie finden konnte, zu drücken, zu schlagen oder zu boxen.
Sirenen plärrten los, und rote und blaue Blinklichter blitzten auf. Eine mechanische Stimme gab Warnungen und Richtungsangaben in verschlüsseltem Kauderwelsch von sich, das den Schmerz in ihrem Kopf nur noch verschlimmerte.
„Du verdammtes, dämliches Miststück!“
Unbarmherzige Hände griffen in ihr Haar und rissen sie auf die Füße.
Cassa hielt sich nicht mit Schreien auf. Hier war niemand, der sie schreien hören, niemand, den es kümmern würde. Sie packte die Hand, die ihr Haar festhielt und krallte mit den Nägeln nach deren Fingern.
Sie schlug um sich und registrierte dabei nur undeutlich das ungehaltene, erschreckende Brüllen, das viel zu nahe und viel zu wütend zu hören war.
„Du ignorante kleine Hure!“, brüllte Douglas wieder, die Züge wutverzerrt, als er sie mit der Hand im Haar durchschüttelte. „Weißt du, was du da tust? Das sind Scheusale. Verdammte Tiere, die so tun, als seien sie Menschen.“ Mit der freien Hand schlug er ihr ins Gesicht, sodass grelle Lichter in ihrem Kopf explodierten, während eine weitere Warnung durch den Kontrollraum plärrte, gefolgt von einem Brüllen voll animalischer Wut, anders als alles, was sie je gehört hatte.
Cassa fuhr zusammen, als sie den Laut hörte – und plötzlich erstarrte Douglas.
„Du hast es doch gewusst“, fauchte er und schleuderte sie von sich.
Ihre Beine wollten sie nicht mehr tragen. In ihrem Kopf war dröhnendes Scheppern, das vor Qual vibrierte. Sie sank zu Boden und schüttelte den Kopf. „Ich wusste es nicht“, rief sie und zwang sich, zu ihm hochzublicken. „Du bist ein Monster, Douglas.“
Das Lächeln, das um seine Lippen spielte, war triumphierend. „Von dir habe ich die Pläne, wie man hier reinkommt, Cassa. Du hast mir von den Tieren erzählt, die die hier befreien wollten, und du, mein liebes Eheweib, hast mir von den Konsequenzen für das Council erzählt, falls sie freikommen.“ Er trat nach ihr und lachte, als seine Stiefelspitze sie in die Seite traf und sie eilig davonkroch, um aus seiner Reichweite zu kommen.
„Zehn Millionen Dollar auf ein Überseekonto, Cassa. Wer braucht da noch dich oder deine Verbindungen? Du hast mir die Mittel geliefert, um diese idiotischen Spinner zu verraten, die irgendwelchen Tieren in den Arsch kriechen wollen. Jetzt kannst du damit leben.“
Ein durchdringender animalischer Schrei hallte wie eine Explosion durch den Raum. Durch ihr Haar, das wie ein Schleier vor ihrem Gesicht hing, und die Tränen in ihren Augen sah Cassa, wie Douglas blass wurde, einen Blick auf die versiegelten Türen zur Grube warf und sich dann umdrehte, um zu fliehen.
Es passierte so schnell, und doch schwor Cassa, dass sie jede noch so kleine Bewegung wie in Zeitlupe sah. Sie sah den einzigen noch aufrecht stehenden Tiger-Breed, dessen wütende dämonische Augen bernsteinfarbenes Feuer sprühten. Blut rann ihm über den Körper. Sein Gesicht, seine Schultern, die Streifen, die ihm über die Pobacken und um die Oberschenkel liefen – Blut rann über die schweren Muskeln und schlanken Umrisse seines goldfarbenen Körpers. Er hob ein abgebrochenes Stahlrohr auf und schleuderte es an der langsam aufgehenden Käfigtür vorbei, wo es mit tödlicher Kraft durch die Fenster zum Kontrollraum brach.
Die scharfe Klinge bohrte sich in Douglas‘ Rückenansatz. Schreiend ging er zu Boden, und sein Kopf fiel in den Nacken, als er weiterschrie.
Das Rohr ragte aus seinem Rücken, und Blut spritzte aus der Wunde. Er verfiel in Zuckungen, und qualvolle Laute voll Entsetzen und Schmerz drangen über seine Lippen, während Cassa den einzigen Bengalen musterte, der der Grube entronnen war.
Er war derjenige, den die anderen mit allen Mitteln zu schützen versucht hatten. So viel hatte sie gesehen. Sie hatte gesehen, wie sie sich geopfert hatten, um diesen einen zu retten.
Eine mechanische Warnung hallte durch den Raum. „Achtung! Achtung! Feindliche Kräfte erreichen den Erdgeschosskorridor. Fünfzehn Sekunden Zeit zur Evakuierung. Vierzehn. Dreizehn.“
Cassa starrte das Geschöpf an, das sich nun ihr zuwandte. Langes, einst goldenes Haar, nun mit Blut verschmiert. Es hing schlaff bis auf seine Schultern, und die goldenen Flecken in den waldgrünen Augen blitzten vor Wut.
Der Bengale fletschte die Zähne und knurrte, und die bösartigen Reißzähne an der Seite wurden sichtbar.
Sie schüttelte entsetzt den Kopf. Jetzt würde er sie töten. Er hatte jedes Wort gehört, das Douglas gesagt hatte, jeden Vorwurf. Sie hatte genau die Geschöpfe verraten, um deren Rettung sie so hart gekämpft hatte. Es spielte keine Rolle, dass sie es unwissentlich getan hatte. Und es spielte keine Rolle, dass sie ihr Leben gegeben hätte, um sie zu schützen.
„Es tut mir leid“, rief sie heiser, als er näher kam. „Oh Gott, es tut mir so leid.“
„Tut mir leid ist die Ausrede schwacher Menschen“, grollte die Kreatur, finstere Entschlossenheit in der Stimme.
Ihre Schultern bebten von dem Schluchzen, das sie so mühsam zurückhielt, und dem Entsetzen, das über sie hereinbrach. Vor ihr tropfte Blut auf den Boden, jeder Tropfen ein leuchtendes wütendes Rot, als er näher kam.
Es tropfte auf ihre Schuhspitze, den Saum ihrer Jeans. Der nächste fiel auf den Jerseystoff des T-Shirts über ihren Brüsten.
Sie schwor, dieser kleine Tropfen versengte ihre Haut, als sie zu ihm aufblickte und Kummer und Schmerz durch jeden Nerv in ihrem Leib jagte.
„Vierundzwanzig Breeds sind tot“, grollte er, und der Klang seiner Stimme, so rau und dunkel, zerrte an ihren Nerven. „Bengalen. Sie alle haben jede einzelne Sekunde ihrer elenden Existenz um Freiheit gekämpft.“ Seine Lippen verzogen sich zu einem Knurren, als er einen Blick zur Grube warf und dann wieder sie ansah. „Alle tot.“
Ein Schluchzen drang aus ihrer Kehle, nur eine Sekunde bevor sich seine Finger um ihren Hals legten und sie auf die Füße zogen, noch während sie sich gegen die Gewissheit des Todes wehrte.
Aber er tat ihr nicht weh, obwohl er es doch sollte. Sie war verantwortlich. Sie hatte vertraut – und dadurch verraten.
„Ich sollte deinen Körper da hinein zu ihnen werfen“, brüllte er ihr ins Gesicht, und sie schrie angstvoll auf.
Er fletschte die Zähne, und fast konnte sie seine scharfen Reißzähne am Hals spüren.
Sie wollte sich für den Verrat entschuldigen. Sie wollte erklären, doch es gab nichts, was sie sagen konnte, nichts, was sie tun konnte, um das zu entschuldigen. Sie hatte ihrem Mann von der Mission erzählt. Hatte sich mit ihm besprochen. Sie hatte die Tatsache übersehen, dass er nicht der Mann war, für den sie ihn einst gehalten hatte; sie hatte an jenen letzten Rest Menschlichkeit glauben wollen, den sie noch in ihm zu finden hoffte.
Sie hob die Hand und berührte das Blut, das in einem langsamen, gewundenen Rinnsal über seine harte Wange lief. Sie berührte es mit bebenden Fingern, führte es an ihre Lippen und schloss die Augen.
Sie kostete das Blut, das sie vergossen hatte. Ihr Vater hatte vor seinem Tod gesagt, dass Männer gezwungen sein sollten, das Blut zu kosten, das sie vergossen, um den Tod zu erfahren und den Schrecken kennenzulernen, den sie verbreiteten.
Sie wusste es. Sie akzeptierte ihr Schicksal. Sie schmeckte sein Blut und ein weiteres Schluchzen schnürte ihr die Kehle zu, doch kam nie über ihre Lippen. Sie hing in seinem alles andere als sanften Griff und rechnete jeden Augenblick mit dem Schmerz. Und sie erwartete den Tod. Sie hatte dem Mann vertraut, dem sie ihr Herz geschenkt hatte, und nun hatte sie erfahren, was ihr Vertrauen sie kostete.
„Du gehörst mir.“
Cassa riss die Augen auf und blickte in die seinen, die sie, viel zu nahe, viel zu finster, ansahen. Fast Nase an Nase, während sein warmer Atem über ihre Wange streifte und seine scharfen Reißzähne ihrer Haut viel zu nahe waren.
„Was?“ Die Frage kam instinktiv.
„Du gehörst mir“, grollte er noch einmal. Es war das Tier, dem sie sich hier gegenübersah, nicht der Mann. Dieser Breed war in nichts so wie die zivilisierten Breeds, die sie so viele Monate im Dienst der Zeitung, für die sie arbeitete, verfolgt hatte.
„Nein.“ Sie wollte den Kopf schütteln, doch die Finger, die so unnachgiebig um ihren Hals lagen, gestatteten keine Bewegung.
„Ich kenne deine Geheimnisse“, knurrte er. „Und ich werde noch mehr erfahren. Dies hier.“ Er sah sich im Kontrollraum um, und Wut blitzte in seinem Gesicht auf, als sein Blick einmal mehr auf dem Eingang zur Grube landete. Seine Augen richteten sich wieder auf sie. „Du stehst in meiner Schuld für ihre Leben. Und für seine Sünden.“ Er warf noch einen Blick auf den am Boden liegenden Douglas.
Wieder wollte sie den Kopf schütteln, doch sein Griff wurde nur noch erbarmungsloser und seine Miene härter und kälter.
„Brüder und Schwestern“, fauchte er. „Familie, nicht mein Rudel, und durch seine Niedertracht sind sie nun tot.“
Noch mehr Tränen flossen. Ihre Schuldgefühle waren wie ein Feuerball in ihrer Brust. Ihr Kummer war ein Knoten aus Todesqual in ihrer Kehle, umklammert von seinen Fingern.
Sie würde hier sterben. Sie konnte es fühlen, und vielleicht wäre es einem Teil von ihr sogar lieber so. Wenn sie weiterlebte, würde sie sich dem hier stellen und damit umgehen müssen. Sie hatte das Blut gesehen, die vergeudeten Leben in dieser Grube, und sie wusste nicht, ob sie die Last des Wissens ertragen konnte, dass diese Leben ihrer Unwissenheit und Gutgläubigkeit wegen geendet hatten.
Lieber Gott. Da hätte sie sie auch gleich mit eigenen Händen töten können.
Cabal St. Laurents. In diesem Labor hatten sie Namen. Man gab ihnen eine Identität, obwohl es doch weit gütiger gewesen wäre, wenn nicht. Es war eine Erinnerung daran, was sie nicht waren: frei. Und eine Erinnerung daran, was sie waren: ewig gebunden an ihre Schöpfer.
Er war ein Tiger-Breed, und das Tier in ihm weigerte sich, nachzugeben. Es jubelte über das Blut des Feindes. Es verschwor sich mit seiner Menschlichkeit, plante und strebte nach dem Tod jeder Kreatur, die seiner Flucht im Wege stand.
Nun war der Mann bereit zu töten. Der Mensch wollte das Blut kosten, und das Tier hielt sich zurück.
Seine Gefangene war eine Frau. Das gewissenloseste Mitglied jeder Spezies. Der Grund dafür, dass jene, die sein Blut teilten, nun in dem Blut lagen, das aus ihren Leibern geflossen war. Und jetzt hielt er sie fest, die Finger um ihre Kehle, fühlte schmerzhafte Sehnsucht in den Zähnen, und seine Zunge kostete fast ihre Haut. Aber er konnte ihr nicht wehtun. Das Tier zog sich zurück und die animalische Kraft, die ihn zur Flucht getrieben hatte, schwand.
Langsam ließ er sie los und sah zu, wie sie zu seinen Füßen zusammensackte. Sie bat nicht schluchzend um Gnade. Sie senkte den Kopf, und langes glänzendes, dunkelblondes Haar umfloss sie. Es berührte den Boden, und sein Blut befleckte seine Spitzen.
Qualvolle Wut erschütterte ihn. Das Brüllen, das durch seine Kehle raste und über seine Lippen brach, ließ ein unfreiwilliges Schluchzen über die Lippen der Frau dringen. Aber er schlug immer noch nicht zu. Das Tier wich zurück, beobachtete, wartete. Er war nicht sicher, worauf es wartete, doch er räumte ein, dass er nicht den Wunsch hatte, das Blut dieser Frau zu vergießen.
Sie war töricht gewesen. Er konnte den Geruch ihres Mannes an ihr wittern, und er kannte den Schmerz, der sie quälte. Sie hatte sie unwissentlich verraten, doch wie konnte er je den Tod jener vergeben, die ihm lieb waren?
„Du gehörst mir“, wiederholte er und trat einen Schritt weg von ihr, als er spürte, wie sich die Schwäche durch den Blutverlust in seinem Organismus ausbreitete. „Wenn ich dich rufe, wirst du kommen. Du wirst geben, worum auch immer ich dich bitte.“ Er streckte die Hand aus, und sanft, ganz sanft, während Wut und das Verlangen nach Gewalt in ihm tobten, nahm er ihr Kinn und hob ihren Kopf, bis er in ihre taubengrauen Augen sehen und ihren Duft inhalieren konnte, um sie für immer wiederzuerkennen. Um sie zu erkennen und sich immer an diesen Tag zu erinnern. An den Tag, an dem eine Frau alles vernichtet hatte, was ihm teuer war.
„Und eines Tages“, schwor er, „wirst du bezahlen.“
Er stolperte. Die Schwäche übermannte ihn.
Er hatte zu viel Blut verloren. Seine Kraft war aufgebraucht. Es war nichts mehr übrig als die schmerzende Wut, die Qual des Verlusts und der Geschmack der Niederlage. Er hatte geschworen, die anderen zu retten, doch durch die Gedankenlosigkeit dieser Frau, durch ihr Vertrauen in den falschen Mann, hatte er alles verloren.
Erneut stolperte er und fiel beinahe auf die Knie, bevor er sich wieder fing. Schwankend zwang er sich, aufrecht zu bleiben, als die Metallschiebetüren zum Kontrollraum aufgestoßen wurden, und der Duft von Breeds den Raum erfüllte.
Es gab keine Bedrohung, kein Gefühl von Gefahr. Das Tier in ihm erkannte die anderen hereinstürmenden Tiere. Die Retter, die den Wissenschaftlern solche Sorgen gemacht hatten. Angeführt von einem Breed, den laut Gerüchten sogar das Genetics Council fürchtete: Jonas Wyatt.
Cabal hob den Kopf und starrte die Neuankömmlinge an, registrierte deren Ausdruck von Ungläubigkeit beim Anblick des sterbenden Mannes auf dem Boden und der Frau, die mit Angst und Zorn zugleich zu ihm aufstarrte.
Sie erkannte das Tier in ihm, und sie wusste, er hatte sie mit seinem Besitzrecht gezeichnet. Sie würde nach seiner Pfeife tanzen, und bei allem, was heilig war, würde er dafür sorgen, dass sie den Preis zahlte, sollte sie je einem anderen gestatten, sie zu berühren.
Der Gedanke ließ ihn fast geschockt innehalten. Fast, denn da ging einer der Männer zu der Frau. Er streckte die Hand aus, um sie am Arm zu nehmen und auf die Füße zu ziehen. Und Cabal war da.
Er packte das Handgelenk des Mannes und knurrte warnend. Ein instinktiver, animalischer Laut, bei dem die Frau zusammenzuckte.
Was war das für ein drängendes Verlangen in ihm? Was ließ das Tier wieder wütend vorpreschen, wenn es um diese Frau ging? Aus den Augen und aus dem Sinn – das sollte er doch wollen. Niemals wollte er an die Schrecken denken müssen, die er hier gesehen hatte, oder an die Verstümmelungen, die in dieser teuflischen Todesgrube stattgefunden hatten.
Er konnte immer noch das Blut seiner Familie wittern. Sie waren von seinem Blut. Jeder Einzelne erschaffen aus derselben DNA von demselben Bengalen, erschaffen aus dem Sperma desselben Spenders. Sie waren eine wahre Familie. Blutsverwandte. Und er hatte sie alle verloren.
„Meins“, knurrte er den anderen Breed an und ignorierte die Überheblichkeit, die Dominanz in den sturmgrauen Augen, die seinem Blick begegneten. „Ihre Schuld ist mein.“
Der Mann hob den Blick von seinem Handgelenk, das Cabal in festem Griff hielt, wieder zu Cabals Augen. In den silbernen Augen des Fremden lag ein Hauch von Gefahr. Ein Hauch reiner, instinktiver Befehlsgewalt. Ihr Duft lag in der Luft, und Cabal war bewusst, dass er es selbst im Vollbesitz seiner Kräfte schwer hätte, die Kraft und Macht des Tieres zu überwinden.
„Du irrst dich.“ Der finstere, gleichmütige Tonfall ließ Cabal warnend die Nackenhärchen aufstellen. „Du bist verletzt und geschwächt, Tiger“, sagte der Mann leise. „Dieses eine Mal lasse ich dir noch durchgehen. Aber sie ist keine Frau, die du benutzen kannst, und sie ist niemand, den du verletzen darfst.“
„Ihre Schuld ist mein“, zischte Cabal wieder, entblößte die Reißzähne und näherte sich dem Gesicht des anderen Breeds. Fast Nase an Nase standen sie, und Cabal fürchtete, dass er diesen Kampf der Willenskräfte durchaus verlieren konnte, wenn er dazu gedrängt wurde. Doch kämpfen würde er. Bis zum letzten Blutstropfen.
„Sie ist gar nichts schuldig“, warnte ihn der andere mit noch leiserer Stimme. „Mach den Fehler nicht.“
Cabals Blick wanderte zu Cassas Mann und dann wieder zu dem Breed, der ihm nun entschlossen im Weg stand.
„Sie hat ihm vertraut.“ Seine Zunge fühlte sich dick und plump an. „Sie hat ihn berührt, sie ist ihm gefolgt. Er hat euch alle verraten.“ Inzwischen lag Spott in seiner Stimme. Ihn hätte dieser Bastard nie verraten. Cabal hätte den Duft seiner Täuschung gleich bei der ersten Begegnung gewittert. Er hätte einer solchen Kreatur nie gestattet zu leben.
„Seine Schuld ist nicht ihre“, wiederholte der andere.
„Sie gehört mir!“, fauchte Cabal daraufhin. „Komm diesem Breed hier in die Quere, und du stirbst.“
Er konnte die Waffen wittern, die auf ihn gerichtet waren, konnte die anderen Breeds wahrnehmen, die die Konfrontation verfolgten.
„Bitte.“ Ihre Stimme berührte seine Sinne. Schwach, heiser von Tränen und bebend vor Angst. „Er hat recht, Jonas“, flüsterte sie da. „Lass es gut sein. Bitte.“
Jonas. Der Jonas Wyatt. Die Bengalen hatten ihn als den dominierendsten der Breed-Generäle eingestuft, als einen ihrer stärksten Strategen. Na, war der nicht gerade total zufrieden? Wyatts Strategie hatte zur Ausrottung einer ganzen Breed-Rasse geführt.
„Ja, Wyatt, lass es verdammt gut sein“, grollte er böse, obwohl er sich nur noch wankend auf den Beinen halten konnte.
Er verfluchte die Schwäche seines Körpers. Er wünschte Wyatt in die Hölle, weil der nicht besser vorgeplant hatte, und als er die Frau ansah, die seinen Blick erwiderte, Tränen und Reue in den Augen, verfluchte er sich dafür, dass er sie nicht getötet hatte wie ihren Bastard von Ehemann.
Er holte hörbar Luft. Sie stank nach diesem Menschen. Sein Geruch war eine Beleidigung für Cabals Sinne und eine Beleidigung für seinen Gerechtigkeitssinn.
„Vergiss mich nicht.“ Sein Flüstern war mehr ein Zischen. „Vergiss es nie, Frau, denn ich werde es nicht vergessen. Und der Tag wird kommen …“ Urplötzlich wurde ihm schwarz vor Augen. Seine Knie gaben nach. Er hatte eine Unze seines kostbaren Bluts zu viel verloren.
Ihm war nicht bewusst, dass er zu Boden fiel und die Frau aufschrie und ihn aufzufangen versuchte. Er spürte ihre Hände nicht, fühlte nicht das Hämmern ihres Herzens oder die Tränen, die auf seine Wange tropften.
„Cassa, wir haben ihn.“
Cassa registrierte kaum, dass Jonas sie von der liegenden Gestalt wegzog und einem anderen Breed übergab. Sie fühlte sich innerlich betäubt, noch während sich die Angst explosionsartig in ihr ausbreitete. Ihr war kalt, doch zugleich war sie erhitzt. Sie fühlte sich tot, und doch wusste sie, dass sie immer noch lebte.
Krämpfe schüttelten sie, als der Breed, der sie hielt, ihr aus dem Raum half. Er hob sie auf seine Arme und stieg über die Leiche ihres Mannes hinweg. Cassa wollte Reue empfinden. Sie hätte Kummer empfinden sollen. Doch sie empfand nur Hass und ein Gefühl von Freiheit.
Douglas war tot. Er selbst war die Ursache für seinen eigenen Tod, so wie er so viele Monate lang die Ursache ihrer Ängste gewesen war.
Gott, sie hätte es wissen müssen. Als er für dieses Team ausgewählt worden war, hätte sie die Breeds warnen müssen, dass sie ihm nicht länger als ihrem Ehemann vertraute. Das Problem war, dass sie darauf vertraut hatte, dass er ein Unterstützer der Breeds sei. Er war mit ihr dabei gewesen, als die ersten Nachrichten über diese unglaublichen Geschöpfe an die Öffentlichkeit kamen. Er war da gewesen bei den ersten Aufständen gegen das Breed-Law und hatte seinen Zorn und seine Besorgnis um sie zum Ausdruck gebracht. Und die ganze Zeit hatte er sie hintergangen.
Sie hätte Verdacht schöpfen müssen. Es war nicht die erste Mission, die schrecklich schiefgegangen war. Jedes Mal war die Schuld jemand anderem zur Last gelegt worden. So wie die Schuld dieses Mal sie treffen würde.
Sie hatte ihm vertraut, genau wie der Tiger-Breed es gesagt hatte. Sie hatte ihn hierhergeführt, sie hatte ihm die Gelegenheit geboten, gegen die Breeds zu intrigieren und alle zu täuschen. Er hatte von deren Tod profitieren wollen, und er hatte dafür bezahlt.
Als sie aus dem Raum und durch die Korridore liefen, registrierte sie, dass die Mehrheit der Breeds zurückblieb. So waren sie. Sie vertrieben jene, die keine Breeds waren und trauerten um die Verlorenen, bevor sie ihre Körper verhüllten und an einen Ort brachten, an dem sie in ewig währender Sicherheit waren. Der Breed-Friedhof in Virginia, nicht weit von Arlington, war ein Zeugnis der Hingabe, die die Breeds füreinander empfanden. Sie hatten darum gekämpft, ihn erhalten, und sie vollzogen ihre eigenen Zeremonien, ohne die Hilfe von irgendwelchen anwesenden Menschen. Wie in Sanctuary, der Basis der Raubkatzen-Breeds, betrauerten sie den Verlust der Ihren und begruben sie mit aller Behutsamkeit und Menschlichkeit, die sie in ihrem Leben nie erfahren hatten.
„Er wird mich nicht am Leben lassen“, flüsterte sie, mehr an sich selbst gerichtet als an den Breed, der sie langsam wieder auf die Füße stellte und durch jene Korridore führte, durch die sie zuvor gerannt war.
Ihr Leben war verwirkt. Sobald dieser Breed geheilt war und seine Kraft wiedergewonnen hatte, würde sie sterben. Sie hatte es in seinen Augen gesehen. Hölle, sie hatte es in seinem Blut geschmeckt. Sie konnte es immer noch schmecken. Dunkel und wild auf ihrer Zunge. Sie war gezeichnet, und sie wusste es.
„Breeds haben einen erstaunlichen Sinn für Gerechtigkeit“, konstatierte der Breed sanft, der sie durch die Einrichtung führte. „Du wirst am Leben bleiben. Doch nur weil er weiß, dass es das größere Leid für dich ist.“
Sie blickte zu ihm auf. In seinen Bernsteinaugen lagen ein Anflug von Weisheit und ein Gefühl von Bedauern. Mercury Warrant. Seine löwenartigen Züge waren stoisch und ernst, und sein Blick war verständnisvoll, trotz der Tatsache, dass sie fürchtete, dergleichen nicht zu verdienen.
„Ich habe keinen Zweifel, dass er recht hat“, antwortete sie tonlos und zwang sich, weiterzugehen, einen Fuß vor den anderen zu setzen, um die Einrichtung zu verlassen und sich Blut und Tod zu stellen, die auch draußen warteten.
Breeds und Menschen gleichermaßen waren hier gestorben, weil das Labor vor der Ankunft der Rettungstruppen gewarnt worden war. Die Soldaten – Kojoten und Menschen –, die sie erwarteten, hatten keine Gnade gezeigt. Nicht dass der Rettungstrupp nicht damit gerechnet hätte, sobald ihnen klar wurde, womit sie es zu tun hatten.
Viele hatten gewusst, dass sie sterben würden. Es war klar geworden im Laufe der vergangenen Monate, als ein Verrat auf den anderen gefolgt war, bei jeder einzelnen Einrichtung, die sie gestürmt hatten. Es schien, als gebe es ebenso viele Menschen, die die Breeds töten wollten, wie es Menschen gab, die sie retten wollten. Und den Unterschied zwischen den einen und den anderen zu erkennen, würde nie einfach sein.
„Er war mein Ehemann“, flüsterte sie.
„Das sind für gewöhnlich die, denen man am wenigsten trauen kann“, antwortete er.
Jetzt musste sie fast lachen. Und woher sollte er es wissen? Wie konnte er je begreifen, dass Douglas, obwohl er kein guter Ehemann gewesen war, dennoch nicht derjenige gewesen war, den sie als böse angesehen hatte?
War er ein Mensch, der andere missbrauchte? Ja. War er ein Killer? Nein. Sie hätte sich nie vorgestellt, dass er den Tod als profitabel ansehen könnte.
„Ich bin so was von geliefert“, flüsterte sie schmerzerfüllt.
„Daran habe ich keinen Zweifel“, stimmte der Breed zu, mit nun kühlerer Stimme. „Das ist der Preis, den man zahlt, Cassa. Und es ist nicht immer ein gütiger.“
Nein, der Preis, den sie zahlen würde, wäre nicht gütig.
Kapitel 1
WOLF MOUNTAIN, COLORADOWOLF-BREED-BASIS HAVENELF JAHRE SPÄTER
Lautlos glitt Cassa Hawkins in Haven, der Basis der Wolf-Breeds, durch die Schatten und versuchte den nebligen Regen und ihr eigenes Gefühl von Vorahnung zu ignorieren. Sie kam sich wie ein Geist vor, wie ein Schatten, ungesehen und ungehört. Es war ein berauschendes Gefühl, unentdeckt an einem Breed nach dem anderen vorbeizuschleichen.
Die kalte Nachtluft hüllte sie ein und drang durch ihre schwarze Kleidung. Sogar die eng anliegende schwarze Mütze über ihrem Haar half nur wenig, um Kälte oder Feuchtigkeit abzuhalten. Es steigerte den Nervenkitzel, das Gefühl von Ungläubigkeit und drohender Gefahr. Sie war verrückt, hier so herumzuschleichen, das war ihr klar. Sie konnte nicht weit kommen. Es konnte doch nicht sein, dass tatsächlich jemand eine Droge entwickelt hatte, die die Sinne der Breeds täuschen konnte und ihr gestattete, so viel weiter an den Wachen vorbeizukommen, die überall in Haven postiert waren.
Jemand spielte mit ihr und erlaubte ihr, gerade so weit zu kommen. Das war die einzige Erklärung für die Entfernung, die sie zwischen der ihr zugewiesenen Hütte und den Hauptbüros der Basis zurückgelegt hatte, denn dort waren viel zu viele Breed-Wachen postiert. Breeds mit einem unglaublichen Geruchssinn. Sie waren für ihre Positionen ausgewählt worden, weil es schlicht unmöglich war, an ihnen vorbeizukommen.
Die Entwicklung einer solchen Droge, die die überlegene Fähigkeit eines Breeds, andere zu wittern, täuschen konnte, war unmöglich. Oder?
Laut der Mails, die sie erhalten hatte, zusammen mit dem kleinen Fläschchen mit runden weißen Pillen darin, das vor einer Woche in ihrem Apartment aufgetaucht war, war es definitiv möglich. Und heute Abend war sie verrückt genug gewesen, tatsächlich eine zu nehmen. Sie auf ihre Zunge zu legen, damit sie sich auflöste und ihren Wirkstoff in Cassas Organismus verteilte, bevor sie ihre Hütte verließ.
Der Leichtsinn ihrer Entscheidung hatte sie beunruhigt, aber nur kurz. Wie viele ihrer Reporterkollegen wussten, war Cassa bekannt dafür, dass sie öfter den Tod herausforderte. Einer ihrer Fehler, sagten viele. Sie betrachtete es als eine ihrer Stärken. Immerhin wusste sie, dass ihre Tage gezählt waren. Dann konnte sie auch mit so viel wie möglich davonkommen, bis der Tag der Abrechnung kam. Cabal mochte ihr erlaubt haben, so lange zu leben, aber sie bezweifelte, dass er noch lange bei seiner Entscheidung bleiben würde.
In diesem Fall hatte ihre Intuition sie getrieben. Die Bilder blutiger Körper, die Mails, die sie gewarnt hatten, dass ein abtrünniger Breed Rache nahm für irgendwelche unbekannten Verbrechen, und dann die Droge, die bei ihr auftauchte, mit einer Notiz ohne Unterschrift, in der stand, dass die Vergangenheit immer wiederkehrte, egal wie sehr man dagegen ankämpfte. In der Tat war die Vergangenheit immer präsent. Sie schwebte über ihr, beherrschte ihre Albträume und glitzerte in den goldenen Flecken von Cabal St. Laurents‘ Augen, jedes Mal, wenn er sie ansah. Die Vergangenheit war gesund und munter, und Cassa brauchte keinen Killer, der sie daran erinnerte. So wie sie auch niemanden brauchte, der sie an die Wahrheit ihrer eigenen Handlungen erinnerte.
Die Wahrheit.
Die Wahrheit war: Cassa hatte selbst Blut vergossen. Die Wahrheit war: Sobald ihre Geheimnisse ans Licht kamen, würde sie sterben. Die Breeds würden sie nie am Leben lassen, sobald sie die Wahrheit erfuhren. Sie hatte Glück, dass das kleine Team der Breeds, das die Wahrheit kannte, all die Jahre den Mund gehalten hatte.
Sie schlich am nächsten Wachposten vorbei. Mordecai. Einer ihrer besten Fährtenleser und laut Gerüchten einer der gnadenlosesten Kojoten-Breeds. Mit lautlosen Schritten bewegte sie sich langsam durch die Schatten, über nassen Boden, mit hämmerndem Herzen und trockenem Mund, bis sie sich in sicherer Entfernung zu ihm befand.
Die kalte Winterluft lieferte kein Anzeichen dafür, dass der Frühling direkt vor der Tür stand. Die Kälte drang durchs Fleisch bis an die Knochen, aber nichts konnte die Aufregung dämpfen, die sie inzwischen beherrschte. Es funktionierte. Sie hatten sie nicht gewittert, ihre Präsenz nicht wahrgenommen.
Gott, das konnte doch nicht möglich sein.
Cassa drückte ihren Rücken fest gegen den dicken Stamm einer Kiefer, starrte zum mondlosen Himmel hinauf und flüsterte ein lautloses Gebet, dass keiner der Breeds, die auf dem Gelände patrouillierten, sie wittern würde.
Eine solche Droge konnte tödlich sein, genau wie ihre Quelle sie gewarnt hatte.
Dann stieß sie sich vom Baum ab, schlich um einige blattlose Ahornbäume herum, von denen kalter Regen tropfte, und glitt durch die Nacht.
Vor ihr waren flüsternde Stimmen und leise Schritte zu hören, die sich näherten. Cassa duckte sich hinter die immergrünen Büsche, die um einen abgelegenen Picknickplatz wuchsen, und wartete darauf, dass sie vorbeigingen.
„Bist du sicher, was die Informationen angeht?“ Jonas Wyatts Stimme drang deutlich durch die Nacht, als das Paar näher kam.
„Fünf Tote, Jonas, das ist nur schwer falsch zu verstehen. Jeder von ihnen gehörte Gerüchten zufolge zu einer Jagdgruppe, bestehend aus zwölf Männern, die mehrere Male im Jahr zusammenkam, um Jagd auf entflohene Breeds zu machen. Jeder von ihnen wurde auf dieselbe Art getötet, nach demselben Muster. Irrtum ausgeschlossen.“
Als Cassa die antwortende Stimme hörte, setzte ihr Herz einen Schlag lang aus und raste dann los. Sie wehrte sich gegen die Reaktion ihres Körpers, biss sich auf die Lippe und betete, dass die kleine Wunderpille auch den Duft von Erregung verdeckte.
Cabal St. Laurents hatte eine Stimme, bei der eine Frau in orgasmischer Verzückung zu Boden sinken und dahinschmelzen wollte. Diese Stimme glitt mit einem samtigen Rhythmus über die Sinne, den Cassa nie ignorieren konnte. Es war die Stimme eines Verführers, und sie war schon vor langer Zeit verführt worden – obwohl er sie mit Tod in den Augen angeblickt hatte.
„Hölle.“ Jonas blieb stehen, keine anderthalb Meter von der Stelle entfernt, wo sie hockte.
So gern sie über das Gebüsch spähen wollte, wagte sie es dennoch nicht. Ihr Duft mochte getarnt sein, aber dem außergewöhnlichen Sehvermögen der Männer würde sie auf gar keinen Fall entgehen.
„Das ist eine ziemlich gute Beschreibung für das, was uns bevorsteht“, antwortete Cabal. „Es ist noch nicht vorbei. Die Jäger werden zur Beute, und wenn die ersten fünf ein Hinweis sind, könnten wir uns ein paar ziemlich prominenten Individuen gegenübersehen. Der ehemalige Bürgermeister, der letzte Woche verschwand, war eine wohlbekannte Persönlichkeit im ganzen Land. Wir haben hier einen PR-Albtraum vor uns.“
Cassa fühlte, wie ihr Mund trocken wurde. Bei dem kürzlich verschwundenen ehemaligen Bürgermeister handelte es sich um David Banks, einen Verfechter für die Rechte der Breeds. Er war für das Breed-Law eingetreten und dafür bekannt gewesen, dass er zu Ehren der Breeds mehrere Wohltätigkeitsveranstaltungen im Jahr gab. Und nun kursierten Gerüchte, die behaupteten, er sei Mitglied einer Gruppe gewesen, die einst Jagd auf Breeds gemacht hatte?
Cassa konnte es durchaus glauben. Sie hatte Banks nie sonderlich gemocht, aber sie wusste, wie beliebt er war. Sein glattes, charmantes Lächeln und seine sanfte Stimme hatten schon mehr als einen Journalisten getäuscht.
„Für PR ist dein Bruder zuständig“, grollte Jonas. „Ich lasse Tanner für den Zuckerguss sorgen. Ich will, dass der Killer gefasst wird, Cabal. Das ist dein Job.“
Jonas‘ Stimme klang befehlend, schroff in ihrer Mahnung. Ja, das war Cabals Job: die Dinge zu tun, welche Enforcer, die mehr in der Öffentlichkeit standen, nicht tun konnten.
„Es ist schwer, einen Job zu machen, wenn es keine Beweise gibt, denen man nachgehen kann, Jonas“, konterte Cabal mit deutlicher Verärgerung in der Stimme. „Am Tatort gibt es weder DNA- noch Duftspuren. Wir wurden nur Stunden nach dem Verschwinden des Bürgermeisters benachrichtigt. Als wir eintrafen, konnte man sein Entsetzen wittern, aber nicht den Duft seines Entführers.“
„Finde etwas, Cabal“, kam die Anweisung. „Wir arbeiten hier mit geborgter Zeit. Wenn du den Mörder nicht findest, bevor die Informationen über diese Morde, möglicherweise von einem Breed begangen, an die Presse durchsickern, dann sind wir geliefert.“
„Für mich sieht es so aus, als wären wir so oder so geliefert“, erklärte Cabal mit kalter Stimme. „Dafür sorgen schon Horace Engalls und Philip Brandenmore.“
Brandenmore und Engalls, die Eigentümer eines Pharma- und Medikamentenforschungsunternehmens, standen unter Anklage, die Breed-Ärztin Elyiana Morrey unter Drogen gesetzt sowie sich zum Mord an mehreren Breeds verschworen zu haben. Man hatte sie bei dem Versuch erwischt, von Dr. Morrey durchgeführte Forschungsarbeiten von deren beiden Assistenten zu erwerben, und Gerüchte besagten, dass sie an einem Phänomen der Alterungsunterdrückung forschten, das die Breeds und deren Partnerinnen angeblich durchlebten.
Das war keine bloße Hypothese. Cassa kannte die Wahrheit. Die Breeds durchlebten eine Verlangsamung des Alterungsprozesses, sobald sie in den Paarungsrausch eintraten. Der Versuch, das Phänomen zu entschlüsseln, machte die Breed-Ärzte schier verrückt und versetzte den Regierungsrat der Breeds jedes Mal in Rage, wenn die Geschichte wieder mal aus einem anderen Blickwinkel in der Klatschpresse erschien.
Bisher wurde sie nicht ernst genommen. Doch so konnte es nicht mehr lange weitergehen. Elf Jahre waren vergangen, seit der Alpha der Raubkatzen-Breeds die Existenz der Breeds öffentlich gemacht hatte. Zehn Jahre, seit er oder seine Frau irgendwie erkennbar gealtert waren.
Cassa war einer der wenigen Menschen, die die Wahrheit kannten, und sie wusste um die Konsequenzen, sollte sie je darüber schreiben oder ihr Wissen offenbaren. Die Geheimhaltungsvereinbarung, die sie als Gegenleistung für eine besondere Bevorzugung bei Interviews und exklusiven Artikeln über die Breeds unterschrieben hatte, war beängstigend gewesen. Sie war überzeugt, dass sie damit wohl ihre Seele, ihr erstgeborenes Kind und das Blut ihrer Katze verpfändet hatte. Oder etwas, das dem sehr nahekam.
„Um Engalls und Brandenmore wird man sich kümmern“, meinte Jonas in eisigem Tonfall. „Mir machen die willkürlichen Morde eines abtrünnigen Breeds mehr Sorgen. Finde ihn, Cabal, oder wir landen noch bis zum Hals in der Scheiße.“
Darauf schnaubte Cabal. „Ich dachte, das sind wir schon.“
„Nein, im Moment guckt der Hals noch raus“, klärte Jonas ihn sarkastisch auf. „Und jetzt finde den Bastard, bevor er wieder tötet. Ich will verdammt sein, wenn ich noch mal ein Chaos wie das letzte beseitigen muss. Ich bin sicher, dass immer noch Teile von ihm fehlen.“
Cassa zwang sich, still zu bleiben. Sie hatte die Fotos von diesem Mord, da war sie sicher. Von diesem und drei anderen. Fotos, die ihr über verschlüsselte, nicht verfolgbare Mails geschickt wurden, in denen die Breeds beschuldigt wurden, einen Killer zu decken.
Cassa hatte nicht bezweifelt, dass sie dazu fähig waren. Sie hatte nur gedacht, dass nicht einmal ein Breed den Schaden anrichten konnte, der auf diesen Fotos zu sehen war.
Beklemmung stieg in ihr auf, als sie langsam den Schweiß über ihre Schläfe tropfen fühlte bei dem Gedanken, was passieren würde, wenn sie jetzt entdeckt würde. Sie kannte das Breed-Law, und sie kannte den Preis für das Belauschen dieser Unterhaltung. Wie David Banks konnte auch sie verschwinden, und niemand würde je von ihrem Schicksal erfahren.
Einmal war ein Gerücht umgegangen, dass Jonas eine Schwäche dafür habe, seine Feinde in Vulkanen zu entsorgen. Daran hatte sie nun wirklich keinen Zweifel. So etwas klang sehr nach Jonas.
„Du verschwendest deine Zeit, Jonas“, erklärte Cabal. „Wir haben nichts, worauf wir hier aufbauen können. Keine Verdächtigen, keine Hinweise. Bis ich das eine oder das andere habe, kann ich nicht viel tun.“
„Dann besorge es dir.“ Jonas‘ Stimme klang gefährlich, und er war kurz angebunden. „Und zwar schnell, Cabal.“
„Ja, ich mache mich sofort daran, Direktor, sobald du mir mal sagst, nach wem zum Teufel ich eigentlich suchen soll.“ Cabals Stimme wurde leiser, bis sie vor unterdrückter Drohung vibrierte. „Bis dahin gibt es nicht gerade viel mehr, was ich tun kann.“
„Banks stammte aus Glen Ferris. Geh dorthin zurück und schau, was du herausfinden kannst. Man erwartet, dass wir nach ihm suchen. Beginne deine Ermittlungen damit.“
„Na, das ist genau das, was ich brauche, dass du mir erzählst, wie ich meinen verdammten Job machen soll“, schnaubte Cabal.
„Ich könnte dir auch erzählen, wie du deine Gefährtin finden sollst“, meinte Jonas daraufhin mit einem Anflug von Belustigung. „Ich bin sicher, sie steckt hier irgendwo in der Nähe. Was meinst du?“
Ein gefährliches Knurren war zu hören, und Cassa spürte, wie ihr das Herz in die Hose rutschte. Cabal hatte sich gepaart? Nein, das konnte nicht wahr sein. Breeds ignorierten ihre Gefährtinnen nicht, und sie vögelten auch todsicher nicht mit allem, was einen Rock trug, durch die Gegend, wofür Cabal ja bekannt war. Der Mann hatte einen regelrechten Harem zu seinen Füßen knien, der ihn um das Privileg anbettelte, ihm Lust zu bereiten. Es reichte aus, um sie ärgerlich die Zähne zusammenbeißen zu lassen.
Jonas musste nur Gefährtin im Allgemeinen gemeint haben, aber keine konkrete Person. So im Sinne von wer suchet, der findet, oder wieso suchst du nicht nach deiner Gefährtin. So musste es sein.
„Treib keine Spielchen mit mir, Jonas“, warnte Cabal. „Dazu bin ich nicht in Stimmung.“
Jonas lachte leise, doch es war weder ein angenehmer noch ein belustigter Laut. Offen gestanden, war es beängstigend.
„Dass ich es mit dir treibe, da musst du dir keine Sorgen machen, mein Freund“, meinte Jonas lachend. „Aber ich glaube sehr, dass unsere unerschrockene kleine Reporterin Ms Hawkins dir da Nachhilfe geben könnte.“
Cassa merkte, wie ihr vor Schock der Mund offen stand. In Jonas‘ Stimme lag ein Anflug von Belustigung, in Cabals grollendem Knurren jedoch nichts dergleichen. Doch es war sexy ohne Ende, noch während es Cassa kalte Schauer über den Rücken jagte – und Wärme zwischen die Beine.
Jonas wusste genau, welche Gefühle Cabal für sie hegte; er war dabei gewesen an jenem Morgen, als Cabal ihren Mann getötet hatte und sie beinahe auch. Immer noch konnte sie seine Hände um ihren Hals spüren und die Wut und das Verlangen nach Blut in seinen Augen sehen.
„Lass es gut sein, Jonas“, warnte ihn Cabal.
Oh ja, Jonas, bitte lass es gut sein, stöhnte Cassa lautlos. Seine Stimme versetzte sie in Erregung, trotz all ihrer Anstrengung, sich dagegen zu wehren. Sie sorgte sich, dass die Pille trotz allem, was sie bewirkte, nur wenig Schutz gegen den Duft ihres Verlangens bieten würde. Und Verlangen verspürte sie eindeutig. In den elf Jahren seit dem Tod ihres Mannes war sie nie derart erregt gewesen wie in der Gegenwart von Cabal St. Laurents.
„Na schön, betrachte das Thema als fallen gelassen.“ Sie hörte das Schulterzucken in Jonas‘ Stimme. „Der Helijet wird dich am Morgen nach Glen Ferris fliegen. Untersuche weiter Banks‘ Verschwinden. Vielleicht haben wir Glück und du findest einen Verdächtigen, wenn du dort bist.“
„Hoff weiter“, schnaubte Cabal. „Vertrau mir, falls die einen wild gewordenen Breed in ihrer Mitte verstecken, dann liefern sie ihn nicht einfach aus, nur weil ich nett frage.“
Die Einwohner von Glen Ferris würden einen wilden Breed eher beherbergen und schützen als ihn zu bekämpfen, ungeachtet der Risiken für sich selbst. Himmel, das taten sie schon seit Jahren; es gab keinen Grund anzunehmen, dass sie es jetzt nicht tun würden.
„Du weißt, wie man nett fragt?“ Jonas‘ Stimme klang sarkastisch.
„Fahr zur Hölle“, reagierte Cabal reichlich arrogant.
Cassa wollte am liebsten laut loslachen, als sie die Auseinandersetzung hörte, noch während sie die überraschenden Informationen, die ihr da in den Schoß fielen, verarbeitete. Jeder ging davon aus, dass Banks inzwischen tot war. Seit seinem Verschwinden war eine Woche vergangen und es gab keine Anhaltspunkte, was mit ihm passiert war. Man hatte den Fluss durchkämmt und suchte weiter nach ihm, aber es gab keine Hinweise, wo er sein könnte.
David Banks hatte seinen Abendspaziergang gemacht, in der Kleinstadt Glen Ferris, West Virginia. Danach hatte man ihn nicht mehr gesehen. Seine Leiche war nicht gefunden worden. Es gab keine Spur, keinen Hinweis, wohin er verschwunden oder was ihm zugestoßen sein könnte. Bis jetzt.
„Ich gehe zurück in die Hölle, und du siehst nach unserer neugierigen Reporterin.“ Wieder klang Jonas‘ Stimme befehlend, und Cassa zuckte angstvoll zusammen. „Sie war viel zu nervös bei dem Empfang heute Abend. Stell sicher, dass sie da ist, wo sie sein soll, und nicht irgendwo, wo sie nichts zu suchen hat.“
Cassa fühlte die Aura des Zögerns, die auf der anderen Seite des Gebüschs herrschte.
„Wird sie zu einem Problem?“
Der ausdruckslose, kalte Tonfall, der jetzt in Cabals Stimme lag, gefiel ihr definitiv nicht. An dem Morgen seiner Flucht aus dieser Grube hatte er behauptet, sie gehöre ihm, und er ergriff jede Gelegenheit, um sie daran zu erinnern, dass er seinen Anspruch durchsetzen konnte, wann immer er wollte.
„Sie ist immer ein Problem, egal ob sie hier ist oder in Sanctuary“, antwortete Jonas.
Cassa runzelte die Stirn. Sie war nie ein Problem in Sanctuary. Die Festung der Raubkatzen-Breeds war gemütlicher und ihr ein weit willkommenerer Anblick als die Basis der Wolf-Breeds, in der sie sich derzeit aufhielt.
„Du weißt nicht, wie du sie handhaben musst“, warf Cabal ein.
Sie handhaben? Niemand handhabte sie, basta!
„Nur mit einer Peitsche und einem Stuhl“, knurrte Jonas. „Callan und Merinus lassen ihr zu viel Freiheit in Sanctuary. Also glaubt sie, sie hätte dasselbe auch anderswo verdient.“
„Und das ist jetzt mein Problem?“, widersprach Cabal. „Sie ist Reporterin. Du hättest es besser wissen müssen, als zuzulassen, dass die Einladung, die sie bekommen hat, weiter besteht.“
Körper bewegten sich. Cassa hätte sonst was dafür gegeben, über das Gebüsch zu spähen, doch stattdessen lehnte sie sich zur Seite und versuchte durch das dichte Laub der dicken Äste einen Blick zu erhaschen.
Der Lichtschein von einem Gebäude in der Nähe offenbarte die beiden Männer. Jonas trug immer noch seinen Smoking. Cabal dagegen steckte nun in Jeans, T-Shirt, einer regendichten Jacke und Stiefeln. Sein goldblondes Haar mit den schwarzen Streifen tropfte vom nebligen Regen und fiel ihm bis auf die Schultern.
Er hatte breite Schultern, eine schmale Taille, muskulöse Oberschenkel und lange Beine. Als er so im Regen stand, sah er aus wie das Tier, das er war. In der Blüte seines Lebens und einsatzbereit. Sexy wie Hölle und so männlich, dass einem das Wasser im Mund zusammenlief.
Cassa atmete langsam und vorsichtig ein und fühlte die vertraute feuchte Wärme zwischen ihren Beinen.
„Stell einfach sicher, dass sie in ihrer Hütte ist, und zwar gut bewacht, wenn es dir nichts ausmacht“, befahl Jonas mit vor Spott triefender Stimme.
„Und wenn es mir etwas ausmacht?“, fragte Cabal vorsichtig.
Jonas‘ Zähne blitzten in einem harten Lächeln auf, während der kalte Regen über sein Gesicht lief und sein kurz geschnittenes Haar tränkte.
„Dann teile ich dich vielleicht ihrer Wachtruppe zu, statt dich nach Glen Ferris zu schicken. Wenn ich so darüber nachdenke, könnte das am Ende eine gute Idee sein.“
Cabals leuchtend grüne Augen wurden schmal, und Cassa hätte schwören können, dass sie das Glitzern der Bernsteinflecken im Grün sah, als er sein Gegenüber anstarrte.
„Ich sehe nach ihr.“ Die blanke Wut in seiner sonst so kalten Stimme überraschte Cassa und jagte ihr einen kalten Schauer über den Rücken. Schön, dann wollte er also nicht in ihrer Nähe sein. Sie wollte ihn auch gar nicht in ihrer Nähe haben. Sie würde sich glücklich schätzen, wenn sie ihm nicht wieder über den Weg laufen müsste, basta. Und sie schätzte es gar nicht, dass Jonas einen Babysitter losschickte, um sicherzustellen, dass sie da war, wo sie sein sollte.
Sie musste zurück in ihre Hütte, bevor Cabal dort ankam. Wenn er entdeckte, dass sie nicht da war oder, Gott bewahre, draußen im Regen herumschlich, konnte sie sich die Konsequenzen ganz gut ausmmalen. Sie würde alle Privilegien verlieren, die sie in den letzten Jahren in Sanctuary errungen hatte. Ganz zu schweigen davon, dass sie sich mit noch mehr Du-gehörst-mir-Mist herumplagen müsste. Bei dem Gedanken musste sie fast schnauben.
Lautlos entfernte sie sich von ihrer Position. Ihr Herz schlug ihr bis zum Hals, als sie sich alle Mühe gab, langsam und vorsichtig vorwärtszukommen.
In Bezug auf die einzelne Pille, die sie genommen hatte, lief ihr ohnehin die Zeit davon. Zwei Stunden, hatte die Information sie vorgewarnt. Den größten Teil dieser Zeit hatte sie damit verbracht, sie an den Breeds zu testen, die auf der Basis patrouillierten.
Sobald das Zeitlimit erreicht war, würde ihr natürlicher Duft rasch zurückkehren, was bedeutete, dass sie weniger als eine halbe Stunde hatte, um zurück zur Hütte zu kommen.
Sie konnte nicht zulassen, dass Cabal erfuhr, dass sie nicht die ganze Zeit dort gewesen war, und sie konnte sich ihm auf keinen Fall stellen, solange die Droge noch in ihrem Organismus kursierte.
Sehr zu ihrer Bestürzung diskutierten die beiden Männer noch weiter über sie, während sie sich langsam zurückzog. Sie konnte die Stimmen hören, aber nicht, was sie sagten. Sobald sie sich in sicherer Entfernung befand, richtete sie sich auf und lief eilig durch die Schatten zur Hütte zurück.
Sie nutzte die dicken Bäume, die überall auf der Basis wuchsen, um ihre Rückkehr zu tarnen, umging die Bereiche, die die Breeds ihres Wissens schwerer bewachten, und schaffte es innerhalb von zwanzig Minuten zurück zur Hütte. Die untätigen Momente waren nervenaufreibend für sie, wenn sie warten musste, bis Wachposten langsam an ihr vorbeigegangen waren, oder wenn sie gezwungen war, wieder ein Stück zurückzugehen, um auszuweichen.
Hastig schlüpfte sie durch das entriegelte Fenster ihrer Hütte hinein und rannte ins Badezimmer, als sie auch schon ein Fahrzeug in der kleinen Auffahrt draußen halten hörte.
Himmel noch mal. Ausnahmsweise hatte Cabal einmal keine Zeit dabei verloren, Jonas‘ Anweisungen zu befolgen.
Cassa drehte den Wasserhahn der Dusche auf, passte eilig die Wärme an und riss sich die nassen Sachen vom Leib. Sie warf die Sachen in einen Schrank in der Nähe, schnappte sich ihr Duftshampoo, drückte eine große Portion in ihre Handfläche und verteilte sie hastig im langen Haar, bevor sie die Flasche Duschgel vom Regal nahm und damit einen Schwamm einseifte.
Sie brauchte Duftstoffe, und zwar jede Menge. Shampoo mit Pfirsichduft im Haar, Duschgel mit Apfelduft. Seifenschaum verteilte sich von Kopf bis Fuß, als sie sich alle Mühe gab, um nur ja sicherzustellen, dass Cabal jede Menge zu wittern hatte, wenn sie ihm begegnete.
Sie spülte sich ab, kämpfte gegen das Rasen ihres Herzens, zwang sich, ruhig zu bleiben und versicherte sich, dass die Droge genug Zeit gehabt hatte, aus ihrem Organismus zu verschwinden, als sie die Haarspülung mit Pfirsichduft in ihr Haar gab, dann ausspülte und das Wasser abdrehte.
Minuten später verließ sie das Badezimmer, ein Handtuch ums Haar, eingehüllt in einen schweren Bademantel und jede Menge Bodylotion mit Apfelduft aufgetragen. Sie roch wie ein verdammter Obstgarten.
Normalerweise hätte sie die Pflegeprodukte sparsam verwendet. Sie bevorzugte unparfümierte Shampoos und Spülungen, sogar die Seifen. Schwere Düfte störten sie ebenso sehr, wie sie die Breeds störten, die sie interviewte oder mit denen sie arbeitete. Heute Abend war eine Ausnahme, und sie war dankbar, dass ihre Assistentin ihr wieder einmal das parfümierte Zeug ins Nachtgepäck geschmuggelt hatte.
Kelly dachte, nur weil sie selbst roch wie ein Obststand, sollte jeder andere das auch.
Ruhig und selbstsicher kam Cassa aus dem Schlafzimmer in das große Wohnzimmer und blieb dort stehen beim Anblick eines viel zu gut aussehenden Breeds mit nassen Haaren, der ihr gegenüber im bequemen Sessel saß.
Es war nicht mehr als sie erwartet hatte, und es war auch nicht das erste Mal, dass sie in ein Zimmer kam, das sie eigentlich allein für sich haben sollte, um dort einen Breed vorzufinden, der auf sie wartete. Auch wenn es sich dabei zugegebenermaßen nur selten um diesen speziellen Breed handelte. Zum Glück hatte Cabal in den letzten elf Jahren so viel Distanz wie möglich zwischen ihnen beiden gehalten.
„Ein wenig spät für einen Besuch, oder?“ Sie zog das Handtuch vom Haar, als sie spöttisch die Frage stellte.
Ihr entging nicht, dass sein Blick zu ihrem Haar huschte, als es ihr über die Schultern fiel, sich über ihren Rücken kräuselte und genau über ihrer Taille aufhörte. Feuchte, unbändige Locken schlängelten sich über ihre Schultern und fielen vorn über den Bademantel bis auf ihre Brüste. Dort landete sein Blick, und urplötzlich war Cassa dankbar für den dicken Stoff. Er verbarg, dass ihre Brustwarzen fest wurden, doch sie wusste, dass nun nichts mehr den Duft ihrer Erregung verbergen konnte.
Cabals Nasenflügel bebten, seine Augen wurden schmal und seine Muskeln wölbten sich, als er sich langsam aus dem Sessel zu einer überaus beeindruckenden Größe von zwei Metern erhob. Zu groß für sie, dachte Cassa.
Trotz ihrer eigenen ein Meter zweiundsiebzig Körpergröße fühlte sie sich klein neben ihm. Zu weiblich und zu schwächlich. Sie kam sich vor wie die dummen Hühner, die bei seinem Anblick in Ah und Oh ausbrachen. Sie hasste diese Weiber, weil sie ihm so hartnäckig nachstellten. Die aufreizenden Rotschöpfchen, die ihm am Arm hingen. Die faden Brünettchen, die sie in seiner Begleitung gesehen hatte. Cassa verabscheute jede Einzelne von ihnen.
„Normalerweise bist du doch eher bis spätabends auf“, stellte er mit halblauter Stimme fest, während sein Blick zu ihrem Laptop huschte. Den sie den ganzen Tag noch nicht eingeschaltet hatte. „Ich hatte damit gerechnet, dass du an irgendeinem Artikel arbeitest, den du dir gerade ausdenkst.“ In seiner Stimme lag ein Anflug von Misstrauen.
Konnte er wittern, dass sie nicht nur erregt, sondern auch nervös war? Wahrscheinlich, aber wer war denn in seiner Gegenwart nicht nervös?
„Ich denke nicht, dass dich der Artikel oder meine Arbeitszeiten etwas angehen.“ Sie zuckte mit den Schultern und ging durchs Zimmer zur offenen Küche. „Ich mache mir eine Kanne Kaffee. Interessiert?“ Am Kaffee, hätte sie sagen sollen. Es war nur selten gut, in Gegenwart eines Breeds eine Frage oder einen Satz offenzulassen.
Sie nahm wahr, dass er ihr folgte. Wie ein heißer Atemzug in ihrem Rücken konnte sie ihn hinter sich ahnen, als sie in die Küche zum Tresen ging.
„Für mich nichts.“
Nicht Kaffee, nicht Tee, nicht sie, dachte Cassa sarkastisch.
Sie hob lässig die Schultern. „Wie du willst.“
Schweigen, als sie den Kaffeeautomaten programmierte und einschaltete. Innerhalb von Sekunden verbreitete sich der Duft von reichhaltigem, heißem Kaffee.
Dann drehte Cassa sich zu dem einen Mann um, dem Breed, von dem sie offenbar fasziniert war, ohne es verhindern zu können, trotz aller Anstrengungen ihrerseits.
Inzwischen sah er ganz anders aus als vor elf Jahren bei seiner Befreiung aus dem Labor in Deutschland, wo er gefangen gehalten worden war.
Damals war er voller Blut gewesen, voller Schnittwunden, Blutergüsse, dem Tod geweiht, doch immer noch hatte er ums Überleben gekämpft, in einer Grube, die voll war mit Spießen und scharfen Klingen. Sein Rudel war um ihn herum gefallen. Frauen, Kinder, junge Männer. Sein Brüllen der Wut verfolgte sie immer noch in ihren Albträumen, so wie das Wissen, dass sie eine Rolle gespielt hatte in dem Grauen, das er überlebt hatte. Und er wusste das.
Schuldgefühle brannten in ihr, und ein scharfer Schmerz jagte ihr durch die Brust zugleich mit einem Gefühl von Furcht, das ihr todsicher immer die Knie weich werden ließ. Und er nahm es wahr, so wie immer. Sie sah, wie seine Augen dunkler wurden und sein Körper sich anspannte, als der Duft ihn erreichte.
„Ich habe dich immer noch nicht getötet“, grollte er. „Ich denke, du könntest die Angst langsam ablegen, Cassa.“
„Vielleicht ist es ja nur ein Fall von weiblicher Vorsicht?“ Sie formulierte die Antwort eher als Frage denn als Feststellung. Breeds konnten eine Lüge wittern, und sie würde ihm nicht die Befriedigung verschaffen, eine bei ihr zu wittern.
„Und Erregung?“ Er legte den Kopf schief, als wäre das Wissen darum etwas Merkwürdiges für ihn.
„Ich wette, eine Menge Frauen sind in deiner Gegenwart erregt.“ Sie achtete sorgfältig auf einen gleichmütigen und ruhigen Tonfall. Bloß keine Nervosität zeigen, keinen Hinweis auf Schuldgefühle geben. Über die Jahre hatte sie gelernt, wie man die meisten Reaktionen kontrollierte, wenn man sich in Gesellschaft von Breeds befand. Die nahmen zu viel wahr und wussten zu viel. Und Cassa hatte zu viele Geheimnisse.
„Das ist keine Antwort auf meine Frage“, konstatierte er und musterte sie dabei weiter viel zu eindringlich. „Warum solltest du jetzt noch Angst vor mir haben?“
Cassa konnte nur den Kopf schütteln. Und ihn anstarren. Sie starrte die goldenen Flecken in seinen Augen an und konnte sich der Faszination nicht entziehen, die diese auf sie ausübten. Sie wollte, nein, sie sehnte sich danach, ihn zu berühren, und das war bei Weitem der gefährlichste Impuls, den sie je gekannt hatte. Der Gedanke an dieses Verlangen machte sie wütend. Er war der letzte Mann auf der Welt, nach dem sie sich sehnen sollte. Der Letzte, nach dem sie Verlangen verspüren sollte, das war ihr klar.
„Was willst du, Cabal?“ Sie stieß die Worte hervor und versuchte dabei ihren Zorn und ihr Verlangen zu verdrängen.
Seine Augen wurden schmal. Der Blick war eine Warnung, und ihr gesunder Menschenverstand riet ihr dringend, diese zu beherzigen. Unglücklicherweise war gesunder Menschenverstand noch nie ihre Stärke gewesen.
„Ich höre, du hast ziemlich viel Zeit mit der Breed-Ärztin Ely Morrey verbracht“, erklärte er. „Warum?“
Warum? Weil sie befallen war, deshalb. Weil ihr Körper darauf bestand, ein gewisses verdammtes Hormon in sich zu behalten, das sie sich eingefangen hatte, als sie vor elf Jahren ihre Zurechnungsfähigkeit verlor.
Sie erinnerte sich deutlich an den Moment. Die Sekunde, als sie die Finger an ihre Lippen geführt und Cabals Blut daran gekostet hatte. Nur eine Kleinigkeit. Es hätte gar nicht ausreichen dürfen, und es war tatsächlich nicht genug gewesen, um den Paarungsrausch auszulösen. Doch es hatte gereicht, um sie auf eine eigenartige Weise zu beeinflussen, die Dr. Morrey immer noch zu entschlüsseln versuchte.
Der Paarungsrausch war der Fluch der Breeds. Manche Breeds behaupteten, er sei ihre Stärke; andere sahen ihn als Schwachpunkt an. Natürlich kam das darauf an, ob der jeweilige Breed gepaart war oder nicht.
„Ich arbeite gerade an einer Story.“ Das war eindeutig eine Lüge, und ihr Duft ließ sich auf keinen Fall verbergen.
Cabal zog eine dunkelblonde Augenbraue in spöttischer Neugier nach oben.
„Ich hasse es, wenn du mich belügst“, warnte er sie sanft. „Du besuchst Ely regelmäßig seit mehreren Jahren. Inzwischen hättest du den Artikel längst geschrieben.“
Cassa hob trotzig das Kinn, als sie die wohlüberlegte Überheblichkeit in seinem Tonfall hörte.
„Ely ist eine Freundin von mir, Cabal, genau wie die anderen Ehefrauen in Sanctuary Freundinnen sind. Ich brauche keine Ausrede, um sie zu besuchen, so wie du keine brauchst, um deinen Rudelführer Callan zu besuchen.“
Es war ein Versuch, ihn vom Thema Ely abzubringen. Jeder wusste, dass Cabal keinen Breed als seinen Rudelführer anerkannte. Er hatte sein Rudel, seine Familie, bei einer Befreiungsaktion verloren, die gründlich schiefgegangen war, und er wollte kein anderes.
„Hör auf, mich ablenken zu wollen“, grollte er und kam näher.
Cassa konnte seine Nähe spüren. Sie schwor, dass ihr um einige Grade wärmer wurde, als er näher kam.
„Ich würde gar keinen Versuch wagen, dich abzulenken.“ Sie schob die Hände in die Taschen ihres Bademantels und sah ihn finster an. „Hast du nichts Besseres zu tun, als mich zu belästigen? Solltest du nicht draußen sein und auf die Feinde der Breeds schießen oder aus irgendeinem Grund im Schatten lauern?“
Seine Kinnmuskeln spannten sich an. Zu sagen, er wäre ungehalten, wäre milde ausgedrückt. Doch diesem speziellen Breed war sie nie in irgendeiner Weise gefällig gewesen. Und sie bezweifelte, dass sie heute Abend damit anfangen würde.
„Befindest du dich im Paarungsrausch?“
Daraufhin starrte sie ihn geschockt an. Aufregung raste durch ihren Leib, so wie immer, wenn sie auch nur ansatzweise in eine Auseinandersetzung gerieten. Sie konnte spüren, wie Hitze in ihr aufwallte und ihr Herz wütend hämmerte.
„Und wenn, würde ich es dann hier mit dir diskutieren?“, fauchte sie zurück. „Dann wäre ich doch bei meinem Gefährten, oder nicht?“
Leider nicht. Ihr Gefährte stand vor ihr, und der war als Aushängeschild der Breeds für sexuelle Eskapaden bekannt. Der Hundesohn hatte in den letzten elf Jahren mehr Frauen flachgelegt, als die meisten Männer in zwei Leben für sich gewinnen konnten. Ein räudiger Kater eben, ganz einfach.
Sie sah, dass er die Zähne noch fester zusammenbiss und seine Nasenflügel bebten, als er den Duft des Paarungsrausches einzufangen versuchte.
Cassa fragte sich, wie die Gefährtinnen von Breeds es nur aushielten, dass jeder Breed in ihrer Nähe erkennen konnte, wann sie im Paarungsrausch und erregt waren. Das musste doch furchtbar unangenehm sein. Cassa wusste genau, dass das körperliche Unbehagen überaus schmerzhaft und, in manchen Fällen, gefährlich werden konnte.
Sie hätte es vorgezogen, sich vom Paarungsrausch so weit wie möglich fernzuhalten.
„Du führst etwas im Schilde.“ Ärgerlich zog er die Lippe hoch. Es war unglaublich sexy, wenn er sie so finster ansah und dabei einen einzelnen Reißzahn aufblitzen ließ.
Sie schnaubte und erinnerte ihn: „Ich bin investigative Reporterin fürs Fernsehen. Wir führen immer etwas im Schilde, Cabal. Das gehört zur Jobbeschreibung.“
Aus irgendeinem Grund vergaß er diese Tatsache gern. Doch dann, als er näher kam, vergaß sie sie auch. Und in Sekundenschnelle befand sich sein härterer und kräftigerer Körper ganz dicht vor dem ihren, als sie sich rücklings an die Wand drückte.