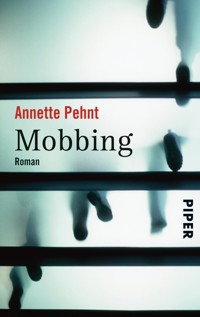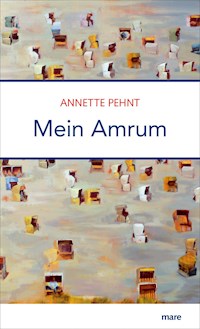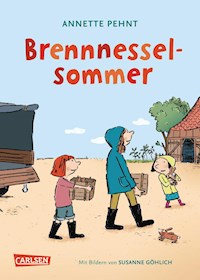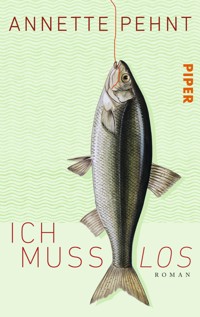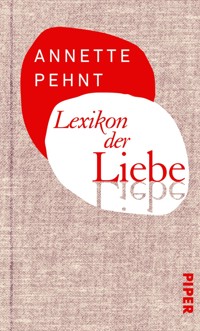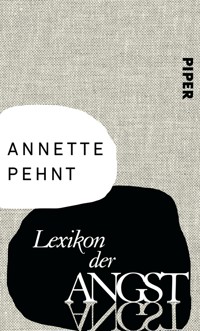15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Charley ist weg, schon lange. Aber seine Gefährtin lässt nicht ab von ihm. Zwar hat Charley sie verlassen, aber sie verlässt ihn noch lange nicht. Immer noch ist er ihr Gegenüber, ihr Gesprächspartner, sie denkt für ihn mit, sie sammelt Fundstücke für ihn, sie liest ihm vor, schreibt ihm Geschichten und führt Listen. In ihren Briefen an ihn dreht und wendet sie die gemeinsame Zeit. Wut, Verlassenheit, Sehnsucht und Erinnerungen wechseln einander ab. So erfindet sie Charley jeden Tag neu. Und mit dem Schreiben wächst die Macht über ihren Geliebten: Die Erzählerin allein bestimmt, wer Charley war und ist. Zugleich geraten für alle Beteiligten Gewissheiten ins Rutschen: Wie war es damals wirklich? Die mit zahlreichen literarischen Preisen bedachte Erzählerin Annette Pehnt legt ihren so vielschichtigen wie virtuosen Roman vor.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
ISBN 978-3-492-97238-3 © Piper Verlag GmbH, München/Berlin 2015 Covergestaltung: Rothfos & Gabler, Hamburg Covermotiv: plainpicture Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
… vielleicht hatte ich mir das alles nur eingeredet, vermutlich alles erfunden von mir, existent nur in meiner Vorstellung nämlich in einem Wunsch daß es sei.
Friederike Mayröcker, brütt oder Die seufzenden Gärten
Wissen, daß man nicht für den Anderen schreibt, wissen, daß diese Dinge, die ich schreibe, mir nie die Liebe dessen eintragen werden, den ich liebe, wissen, daß das Schreiben nichts kompensiert, nichts sublimiert, daß es eben da, wo du nicht bist, ist – das ist der Anfang des Schreibens.
Roland Barthes, Fragmente einer Sprache der Liebe
2.Januar
Ich halte dem Abwesenden unaufhörlich den Diskurs seiner Abwesenheit – eine ganz und gar unerhörte Situation; der Andere ist abwesend als Bezugsperson, anwesend als Angesprochener. Aus dieser eigentümlichen Verzerrung erwächst eine Art unerträgliches Präsens; ich bin zwischen zwei Zeitformen eingekeilt, die der Referenz und die der Anrede: du bist fort (und darüber klage ich), du bist da (weil ich mich an dich wende). Ich weiß also, was das Präsens, diese schwierige Zeitform, ist: ein unverfälschtes Stück Angst.
RB
Das neue Jahr, schreibe ich an CHARLEY, hat dreckig angefangen. Aber ich schreibe wieder an dich. Ja, ich fange wieder an zu schreiben. Gestern noch überall Schnee hingepudert, jetzt sind die Straßen nass und bloß an den Rändern von schwarzen Wülsten gesäumt, Matsch und Silvesterasche. Nur die Autos beim Gebrauchtwagenhändler noch mit weißen Hauben besahnt.
Eigentlich, schreibe ich an CHARLEY, kann ich mir nicht anmaßen, von unserer Geschichte zu schreiben. Ich habe damals etwas mit dir erlebt, das ist meine Geschichte; du etwas mit mir, das ist deine, und ob sich Überschneidungen ergeben, können wir nicht mehr nachprüfen. Am Ende wird meine Geschichte von mir und CHARLEY eine meiner Lebensgeschichten sein, schreibe ich an CHARLEY, sehr viele davon gibt es ja nicht, mach dir nichts vor. Und wenn wir alt werden, schrumpfen die sieben oder acht auf ein oder zwei, wie bei Frau Becker, die ich früher gehütet habe, wenn ihre Tochter in die Oper oder mit ihrem lieben Herrn, wie sie ihren Verehrer nannte, essen gehen wollte. Ich saß bei Frau Becker, einer winzigen ledrigen Person, der ihre Tochter die dünnen Haare sorgfältig in der Mitte gescheitelt hatte, so dass längs über ihren Schädel eine nackte rosa Schneise die Haarfederchen teilte. Die ersten Male sprach sie nicht mit mir, wollte aber auch nicht, dass ich in die Zeitung schaute oder aus dem Fenster. Ich sollte ihr gegenübersitzen, an einer Art Pult, auf das die Tochter einen Teller mit Apfelschnitzen gestellt hatte. Frau Becker hatte eine geräuschvolle Art zu schweigen, sie räusperte sich, sie knirschte mit dem Unterkiefer und zupfte sich die Ärmel zurecht, in dem einen hatte sie ein Stofftaschentuch verborgen, das sie manchmal herauszog, um sich damit die doch völlig trockene Stirn abzutupfen. Auch ihre Hände waren trocken und rissig, mit den Fingern spielte sie an der Armlehne und fuhr an der Tischkante entlang, und die Füße setzte sie immer neu nebeneinander, während ihr Blick über mich hinwegglitt, im Raum herumfuhr und wieder rasch zu mir schwenkte, als ob sie kontrollieren wollte, dass ich noch anwesend sei. Dann und wann schob sie sich einen Apfelschnitz zwischen die Zähne. Ich versuchte, mit höflichen Fragen ein Gespräch in Gang zu bekommen, und später gelang das auch, aber die ersten Male gab es nur ein langsames, abfälliges Kopfschütteln, ich hatte mich noch nicht genügend bekannt gemacht, so schien es. Bei Frau Becker lernte ich, dass es genügt, immer wieder zu kommen, still dazusitzen und durch beharrliche Anwesenheit einen höheren Bekanntheitsgrad zu gewinnen. Es war wie ein Preis, als sie mir zum ersten Mal etwas erzählte, ganz ohne dass ich gefragt hätte.
Ich habe einmal Jesus getroffen, sagte sie. Ich schrak hoch, ich hatte wie immer nichts erwartet, auf der Kommode im Flur lag mein Geld, das ich nachher würde einstecken können, wenn die Tochter aus der Oper zurückkam, mit leuchtenden Lippen und vor Dankbarkeit glitzernden Augen und mit Zigarettenrauch in den Haaren. Frau Beckers Stimme war tiefer, als ich gedacht hatte, und während sie sprach, schaute sie auf meine Stirn. Später erzählte die Tochter, Frau Becker sei fast blind und könne nur noch sehr helle und sehr dunkle Flecken unterscheiden. Meine Stirn muss sehr hell gewesen sein damals.
Jesus, rief ich, wirklich, wann war das denn. Aber sie hörte mich gar nicht, sie hatte schon weitergeredet.
Er ging durch die Fußgängerzone in Oslo, sagte sie, ich wusste gleich, dass er es war, dabei trug er gar keinen Bart.
Warum sollte er denn auch einen Bart tragen, murmelte ich, aber ich hätte es mir sparen können, ich hatte schon begriffen. Von nun an war ich Frau Beckers schweigendes Publikum.
Er ging an den Geschäften vorbei und schaute in kein Schaufenster, sagte sie. Aber wo er vorüberkam, hoben die Menschen ihre Köpfe. Außer mir wusste natürlich niemand, warum. Ich wusste es sofort und winkte ihm zu. Auf einmal zwinkerte Frau Becker, sie legte ihren Kopf schief und hatte plötzlich einen raffinierten Zug um die Lippen, sie hat es, dachte ich plötzlich, ja faustdick hinter den Ohren, und ihre papierhafte Knittrigkeit ist womöglich nur eine Verkleidung. Und hat er Ihnen zurückgewinkt, fragte ich eingeschüchtert. Aber die Geschichte war schon zu Ende. Frau Becker nickte noch einige Male zufrieden, dann löste sich ihr Blick von meiner Stirn, der Auftritt war vorüber. Als die Tochter an dem Abend zurückkam, etwas außer Atem, weil sie beinahe die letzte Straßenbahn verpasst hätte, müssen wir, einander gegenübersitzend an dem kleinen Pult wie Schachspieler, jede tief in Gedanken, anders ausgesehen haben als sonst, jedenfalls rief sie, oh, ihr beiden habt es gemütlich. Ich verabschiedete mich bei Frau Becker, wie immer reichte sie mir nur langsam die Hand und drückte nicht zu, und die Tochter schob mir das Geld in die Jackentasche und schaute mich fragend an, mit erhobenen Brauen, als könnte sie als Zugabe zu ihrem atemberaubenden Opernabend noch etwas von mir bekommen, eine Geschichte, einen Augenblick, irgendetwas. Aber ich hielt dicht, meine Auszeichnung behielt ich für mich und zwinkerte Frau Becker noch zu, obwohl sie es sicher nicht sehen konnte.
Jedes Mal, wenn ich nun kam, überprüfte die Tochter die Gemütlichkeit, bevor sie davoneilte oder von ihrem lieben Herrn abgeholt wurde, der sich immer so hinter der Wohnungstür verbarg, dass ich ihn nie zu sehen bekam. Sie schob den Teller mit den Apfelstücken in die Mitte des Pultes, schloss noch das Fenster, fuhr der regungslosen Frau Becker durch die Haare und nickte mir verschwörerisch zu, bevor sie endlich die Tür zuzog. Ich setzte mich zurecht. Eine Weile würde es dauern, Frau Becker würde an ihren Kleidern nesteln und hin und her schauen, bis sie sich räusperte und die Geschichte von Jesus in Oslo erzählte. Mit der Zeit kamen noch zwei weitere Geschichten hinzu. In der einen ging es um einen Apfel, den ihr ein Mann geschenkt hatte. Er war in die Knie gegangen und hatte der jungen Frau Becker einen Apfel gereicht, der an Schönheit und Glanz nicht zu übertreffen war. Sie hatte ihn genommen und gleich hineingebissen, dass ihr der Saft übers Kinn spritzte. Aber geheiratet habe ich ihn nicht, sagte sie dann, es war ein triumphaler Satz, und sie rieb ihre Hände und stemmte sich vorsichtig in die Höhe. Nun mussten wir in die Küche gehen, wo sich Frau Becker ohne meine Hilfe, schwankend am Küchentresen und mit einem stumpfen Messer, einen Apfel schnitt, obwohl wir doch schon den Teller der Tochter hatten, aber es hatte keinen Sinn, sie daran zu erinnern. Das Apfelschneiden gehörte noch zu der Geschichte, sie schälte dünn und in einer großen Spirale, und ich stand hinter ihr und hielt die Arme auf, falls sie nach hinten kippen würde, wovor mich die Tochter ausdrücklich gewarnt hatte. Lassen Sie sie niemals allein gehen, sagte sie jedes Mal, sie schlägt hin, und dann ist alles aus. Von Stehen hatte sie nichts gesagt, und ich traute Frau Becker einen festen Stand zu, zumindest bis die Geschichte und der Apfel beendet waren. Ich traute mir auch zu, ihren Fall aufzuhalten.
Die dritte Geschichte war beinahe genauso kurz und handelte davon, dass auf den Lofoten niemand sein Haus abschloss.
Niemand, raunte Frau Becker. Wenn beim Kochen etwas fehlte, konnte man hinübergehen zu den Nachbarn und es aus der Küche holen.
Wie praktisch, murmelte ich und wartete auf den Satz, mit dem diese Geschichte immer zu Ende ging. Lorbeer, sprach ich leise mit, immer hat der Lorbeer gefehlt. Als ich später wegzog und nicht mehr auf Frau Becker aufpassen konnte, schenkte ich ihr zum Abschied ein Sträußchen Lorbeer, aber sie wusste nichts damit anzufangen und reichte mir nur stumm ihre warmen Finger.
Jetzt habe ich dir Frau Beckers drei Geschichten aufgeschrieben, so dass eine einzige daraus geworden ist, schreibe ich an CHARLEY, so wird alles immer weniger, und wenn noch etwas übrig bleibt, kann man sehr froh sein.
3.Januar
SCHREIBEN. Illusionen, Auseinandersetzungen und Sackgassen, denen das Begehren Gelegenheit gibt, das Liebesgefühl in einer ›Schöpfung‹ (namentlich schriftstellerischer Art) ›auszudrücken‹.
RB
Ehrlich, ich sollte in den drei oder vier Geschichten vorkommen, die du am Ende erzählen wirst. (Ich weiß übrigens nicht, ob ich ehrlich bin, ich schreibe so, dass ich mir gefalle und dir gefalle, ich werde nicht von dem anderen schreiben, vom alternden Körper, nicht von Warten und Vermissen.) We are lost things, hast du in England gesagt, als wir uns verlaufen hatten: wir sind verloren? Wir sind verlorene Geschöpfe? Dinger?
We are lost things.
Ob du es auch so siehst: Silvester ein jämmerliches kleines Fest, ungeschicktes Silvester, Brot in heißen Käse halten und Blei in kaltes Wasser werfen. Aber fällt dir etwas anderes ein? Gut, man könnte es ignorieren. Aber ich kann mir nicht dauernd frische Menschen suchen. Und so: wie jedes Jahr Pappbecher gehoben zur unscharfen Mitternacht, Jubel über die ganze Wiese asynchron getaktet, die einen waren noch im Alten, die anderen schon im Neuen, ein seltener Zustand der öffentlichen Ungleichzeitigkeit. Aber warum selten: eigentlich sind Menschen ja nie gleichzeitig, vor allem dann nicht, wenn sie es wirklich darauf anlegen, beim Turmspringen und beim Sex. Gespräche: große Feste des ungleichen Sprechens und verschobenen Denkens, der eine ist noch beim letzten Satz, bei dem er aber zugleich an den Sommer in Schweden, die Brüste der jungen Lehrerin seines Sohnes, die überteure Zuckerwatte im Europapark und an noch sonst wie viele Dinge denkt, während der andere zwar eifrig zuhört, aber nur darauf wartet, etwas ganz anderes zu sagen, das in so lockerem Zusammenhang zum Vorredner steht, dass eine Videoaufzeichnung großes Lachen hervorrufen könnte über die Dreistigkeit der Gesprächswendung. Aber als dreist wird Ungleichzeitigkeit ja nicht empfunden, schreibe ich an CHARLEY, oder bist du im Bett schon mal von deiner Gefährtin beschimpft worden, weil ihr ungleichzeitig wart? Man hält wohl eher die Gleichzeitigkeit für ein solches Wunder, dass man sie gar nicht zu erwarten wagt. Und so ist es ja vielleicht auch, schreibe ich, ein Wunder, wie die Töne einer Sonate sich im letzten Akkord in einem klaren G-Dur übereinanderlegen und genau gleichzeitig in völlige Stille münden; ein Wunder, wie zwei sich anschauen und gleichzeitig in Lachen ausbrechen; oder wie ich am Weidenzaun hochblicke, meine Hose im Stacheldraht verhakt, um nach dir zu rufen, und du dich in eben dem Moment umdrehst; oder überhaupt auch, wie zwei Menschen den gleichen Satz in einem Buch bemerken, in dem es Zehntausende von Sätzen gibt, ihn unterstreichen und herausschreiben, um ihn sich gegenseitig vorzulesen, aber damit verlasse ich vielleicht schon das Terrain, schreibe ich, das ist etwas anderes als Gleichzeitigkeit, vielleicht sollte es Gleichsinnigkeit heißen, und wir könnten Gleichzeitigkeit eher für Dinge reservieren: Eiszapfen, die im gleichen Moment von der Dachrinne brechen, Kugelschreiber, die in der gleichen Sekunde auf zwei verschiedenen Tischplatten landen, draußen ein Feuerwerk, während drinnen das Wasser überkocht, solche Sachen, was meinst du, CHARLEY.
Du wirst natürlich nicht antworten, ich weiß, und selbst wenn du zurückschriebest, was du nicht tun wirst, würdest du ja wohl nicht speziell auf diesen einen Satz antworten, so ist das beim Schreiben, das kann man eben nicht verlangen, dass dieser eine Satz so heraussticht, dass ihn der Leser sich vornimmt und durchdenkt und dann eine Antwort formuliert; es hieße ja auch, dass andere Sätze in dem Geschriebenen weniger bedenkenswert wären, und das würde ich als eine Kränkung empfinden, wie ich ja überhaupt in diesen Dingen sehr erregbar und leicht zu kränken bin, sonst nicht, aber in diesen Schreibdingen schon. Neulich hat Franz der Sprachsammler mich darauf hingewiesen, dass ständig sinnlose Doppelpunkte in die Texte hineingestreut werden. Das war mir nicht aufgefallen, aber einmal gewarnt: finde ich sie natürlich stets und überall. Aber bei mir haben sie, musste ich Franz belehren, auf jeden Fall einen Sinn, sie sind eigentlich mein Zeilenumbruch, weil ich mich nicht traue, Lyrik zu schreiben, also muss ich eben orthografische Mittel finden, um Atempausen zu setzen und kleine Lücken in die Texte zu reißen, und das geht sehr schön mit dem Doppelpunkt. Das ließ Franz durchgehen, es gefällt mir, dass er sehr streng in diesen Schreibdingen ist, er findet auch, alle Welt würde unnötig ›sozusagen‹ sagen, er kam darauf, weil ich ihn in der Stadt traf und begrüßte mit dem Ausruf, ich hätte leider kaum Zeit, ich müsse sozusagen schon woanders sein. Mit dem ›sozusagen‹ wollte ich vermutlich die Peinlichkeit ausdrücken, die es mir bereitet, mich als eine dieser abgehetzten Vorweihnachts-Kaufirren zu zeigen, ich musste zwar wirklich woanders sein, aber ein Schwätzchen wäre angebracht, vielleicht sogar nötig gewesen, um dem irrsinnigen Kaufen einen Augenblick der Ruhe und des gemeinsamen Gespräches (=Fest der Ungleichzeitigkeit) entgegenzustellen. Das alles steckte vermutlich in dem ›sozusagen‹, müsste ich Franz eigentlich noch sagen, schreibe ich an CHARLEY, und nun sage ich es dir, und damit ist es zumindest einmal gesagt. Franz sammelt diese Begebenheiten, und einer muss das auch tun. Er kommt gelegentlich aus Irland rüber, geht hier durch die Straßen mit frischem entwöhnten Gehör, gierig nach German, und so entgeht ihm kaum etwas, er schreibt alles auf sehr kleine Zettel, Einkaufszettel wohl, und ich hoffe für die Sprache, dass er diese Zettel aufbewahrt und ordnet (warum sollte Franz’ Zettelkasten der Sprache helfen? Würde er, wenn überhaupt, dann nicht ungeordnet genauso helfen wie geordnet? Warum sollte mein Schreiben der Sprache helfen? Braucht die Sprache Hilfe, und was ist sie? Ist ›sozusagen‹ etwa keine Sprache?).
Ich denke, CHARLEY, dieses verschärfte Sammeln und Aufschreiben ist vergleichbar mit den Lesungen, die mein Freund Toni auf Friedhöfen veranstaltet. Er geht etwa einmal die Woche auf einen möglichst alten, vermoosten und vergessenen Friedhof und liest die Namen der Toten auf den Grabsteinen laut vor. Man darf ihn dabei nicht stören, es ist eine Aufgabe, die er übernommen hat, weil auch er sich wünscht, in dreißig oder fünfzig Jahren noch einmal beim Namen gerufen zu werden, und weil außer mir niemand von seinem Wunsch weiß, werde ich diese Aufgabe übernehmen müssen, es sei denn, du leistest mir Gesellschaft, CHARLEY.
So wie auch heute Nacht, wo ich nicht aufhören kann, an dich zu schreiben, dabei ist mir noch müde im Hirn von Silvester, Alkohol spüre ich noch Tage später (obwohl ich gern trinke und viel: wem sage ich das). Ich spüre ihn in den Augen, die sich langsamer als sonst bewegen und sich vielleicht deswegen nicht schließen wollen heute Nacht, auch nicht, wenn ich durch die billigen Nachtsendungen rausche oder die immergleichen Webseiten über heimatlose Streunerhunde und Fluxus und seufzende Gärten. Ich könnte ja auch neue heraussuchen oder dich googeln, aber in mancher Hinsicht bin ich, sozusagen: eine treue Seele, und so auch dir.
4. Januar
Die Nacht hat ja kaum stattgefunden, schreibe ich an CHARLEY, ich weiß nicht, ab wie vielen Stunden man überhaupt von ernst zu nehmender Nacht sprechen kann, die Stunden ohne Licht müsste man wohl zählen oder die ohne Bewusstsein, von beidem habe ich sehr wenig gehabt, was genauso folgenreich ist wie Weintrinken oder jedenfalls Rotweintrinken (mehr als zwei Viertel und ohne ordentlich was im Magen). Jedenfalls hängt hier schon wieder ein Morgen unentschlossen vor dem Fenster herum, eher milchig gibt er sich bisher, und wenn ich einen der Millionen Streunerhunde adoptiert hätte, müsste ich nun aus dem dicken Deckenhaufen heraussteigen und mit ihm in diese klamme Angelegenheit raus, ich weiß nicht, ob das gut für mich wäre, aber vielleicht ist das auch schon, wie Friederike Mayröcker schreibt (im besten Buch, das ich jemals gelesen habe), zu viel Introspektion.
Es gibt mehrere dieser besten Bücher, du weißt es, schreibe ich, einige davon haben wir uns geschenkt, Sätze darin gefunden und einander geschrieben, und diese Bücher würde ich am liebsten ganz komplett nachdrucken, also Wort für Wort, allerdings wäre es dazu wohl vonnöten, dass ich sie geschrieben hätte. Träum weiter, wirst du sagen, CHARLEY, aber du würdest dir meinen Wunsch anhören und mich auch nicht damit aufziehen, sonst könnte ich ihn ja niemandem gestehen, am allerwenigsten Frau Mayröcker, die ich, sehenden Auges in die immer gleiche uralte Falle aller Leser tappend, blindlings liebe, in diesem Buch liebe, also ihre Sprache liebe, aber während ich dieses Buch lese, ist mir egal, dass sie vermutlich nicht nur aus der Sprache dieser 275 Seiten besteht. Ich würde im Moment trotzdem behaupten, dass sie zu großen Teilen daraus besteht, gut, bestand, das Buch ist elf Jahre alt; kurz: es ist mir egal.