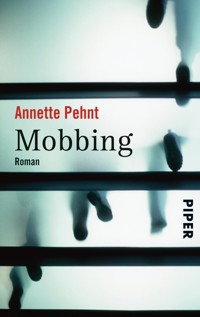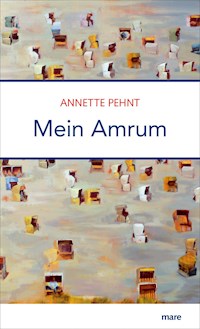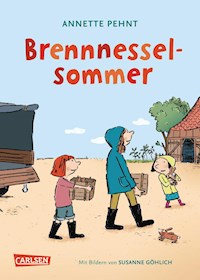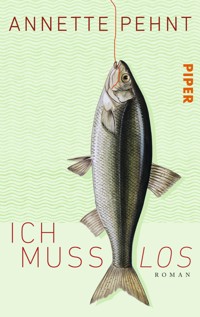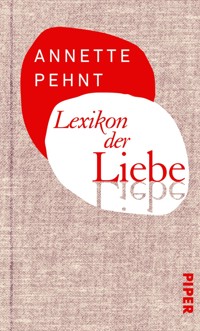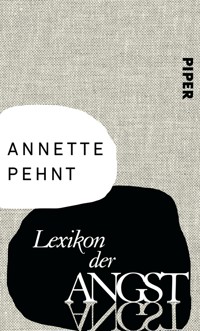8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Annette Pehnt erzählt die Geschichte einer Familie. Und es ist eine Familie von Frauen. Wortgewaltige Lästermäuler, nicht auf den Mund gefallen, Plaudertaschen. Großmutter, Mutter, Tochter. Schwierig wird es nur, wenn das Schweigen ausbricht. Das war so zwischen der Großmutter und der Mutter. Und auch bei Mutter und Tochter ist es so. Sie schweigen, bis eine kleinbeigibt, bis eine die Stärkere ist und ihren Willen bekommt. Aber wie wollen sie so eine Antwort auf die Frage finden: Liebst du mich auch? Auf einer Reise lässt sich das vielleicht besser herausfinden. Bevor die Mutter stirbt. Aber ob der Ausflug nach Rügen hält, was sich die Tochter von ihm verspricht? »Chronik der Nähe« ist der Roman dreier Generationen von Frauen und eine kurze Geschichte Deutschlands zugleich.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für Uli
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
1. Auflage 2012
ISBN 978-3-492-95522-5
Deutschsprachige Ausgabe: © Piper Verlag GmbH 2012 Umschlaggestaltung: Kornelia Rumberg, www.rumbergdesign.de Umschlagmotiv: plainpicture / Hellwig
Das Schreiben versagt sich mir. Daher Plan der selbstbiographischen Untersuchungen. Nicht Biographie, sondern Untersuchung und Auffindung möglichst kleiner Bestandteile. Daraus will ich mich dann aufbauen, so wie einer, dessen Haus unsicher ist, daneben ein sicheres aufbauen, womöglich aus dem Material des alten. Schlimm ist es allerdings, wenn mitten im Bau seine Kraft aufhört und er jetzt statt eines zwar unsichern aber doch vollständigen Hauses, ein halbzerstörtes und ein halbfertiges hat, also nichts.
Franz Kafka
Dienstag
Ein Tag ohne Sprechen gilt nicht. Heute Morgen warst du wie zugenäht, nichts gesagt, aber auch gar nichts, so etwas von nichts. Ich wollte deine Lippen auseinanderzerren und die Augenlider hochstemmen, einfach nichts zu sagen, das geht in unserer Familie nicht, vieles geht, aber nicht sprechen: nicht. Großmutter Mutter Kind: wortgewaltig, Lästermäuler, nicht auf den Mund gefallen, Quasselstrippen, Plaudertaschen, Zwitschermaschinen, redselig. Plötzlich schweigen gilt nicht. Wenn du nichts sagst, mache ich es für dich.
Mutter bedroht Annie mit dem Tod, das kann sie gut.
Ich sterbe, sagt sie zunächst leise, aber es genügt, um den Herzschlag des Kindes zu beschleunigen, um Annie an Mutters Seite zu holen, sie nimmt Mutters Hand und presst sich an ihre Schulter.
»Ich sterbe, das fühle ich, diesmal sicherlich, es ist so weit.«
Annie wird totenblass und hängt an Mutters Lippen. Mutter sieht rosig aus, aber ihre Lippen sind trocken, weil sie stoßweise ein- und ausatmet, sie atmet so rasch, dass sie irgendwann keine Luft mehr bekommt und anfängt zu zittern. Da weiß Annie, dass Mutter diesmal wirklich recht hat, jemand, der stöhnt beim Einatmen und stöhnt beim Ausatmen, der macht es nicht mehr lange, Mutter macht es nicht mehr lange.
»Mutter«, sagt Annie angstvoll. Mutter sinkt in einen Sessel und packt Annie am Arm, sie hält sie sehr fest, damit sie sich nicht aus dem Staub macht, aber das würde sie nie tun, sie wird die sterbende Mutter nicht allein lassen, sie wird alles für Mutter tun und sie vielleicht retten, wenn sie es erlaubt.
»Ganz allein bin ich«, stöhnt Mutter, und nun weiß Annie endlich wieder, was sie zu tun hat. Sie hatte es nur vergessen, das letzte Mal ist eine Weile her, damals hat es geholfen, und es wird wieder helfen, und schon ist Annie nicht mehr so angst und bange, denn sie wird sich anstrengen und wird Mutter wieder retten, wie beim letzten Mal. Auf einmal spürt sie eine Freude, dass sie so viel tun kann für ihre sterbende Mutter.
»Mutter«, ruft sie und drängt sich an die Mutter, die sie gleich noch fester umfasst, als wollte der Tod sie von ihrem Kind wegreißen, »ich habe dich doch so lieb, du darfst nicht sterben.«
»Nein«, murmelt die Mutter, »das glaube ich nicht, keiner ist für mich da, am Ende ist man allein.«
»Doch«, ruft Annie triumphierend, sie erinnert sich nun sehr gut an die Worte, die sie zu sprechen hat und immer wieder sprechen wird, »doch, ich bin bei dir, Mutter, ich liebe dich.« Mutter macht abwehrende Bewegungen mit der Hand und dreht kraftlos den Kopf zur Seite, vom Kind weg. Annie tänzelt auf die andere Seite, hinüber in Mutters Blick, und fasst die abwehrende Hand, hält sie fest und fängt an, Mutter zu streicheln. Mutter atmet laut und schnell, ihre trockenen Lippen stehen halb offen, sie gurgelt aus der Kehle, das gehört alles dazu, wie konnte Annie es vergessen. Sie lässt schnell die Hand los, rennt in die Küche, befeuchtet ein Geschirrhandtuch mit Wasser und ist schon wieder an Mutters Seite, tupft ihre Lippen ab mit dem feuchten Tuch, fasst die Hand, die nun endlich zugreift und das Kind festhält. Mutters Stöhnen wird leiser, sie öffnet die Augen und schaut Annie an, die dem Blick nicht ausweicht.
»Du bist meine Tochter«, murmelt Mutter, »du lässt mich nicht allein.« Annie nickt, drückt die Hand und sinkt an Mutters Schulter. Nun, da sie weiß, dass Mutter diesmal wieder nicht sterben wird, ist sie auf einmal sehr müde.
Und jetzt bedrohst du mich mit dem Tod.
Weil ich gelernt habe, dass wir über alles reden außer über die schlechten Dinge, konnte ich heute Morgen in der Klinik nicht mit dir sprechen. Du hast die Augen gar nicht erst geöffnet. Deine Hände: dicker als früher und fest, die Haut wie eine Folie über die prallen Handrücken gespannt, sie liegen ruhig auf der Decke. Fast hätte ich danach gegriffen, aber solche Liebkosungen sind zwischen uns nicht üblich. Haben sie dich hier gemästet, sagte ich zaghaft und lächelte in dein geschlossenes Gesicht, jemand musste ja etwas sagen in diesem stillen Zimmer, die Schwester sorgt dafür, dass die Tür immer offen bleibt. Ich wollte mit meinem Blick deine Augenlider hochziehen, die auch dick waren, kleine, blickdichte Wülste. Sprechen Sie ruhig mit Ihrer Mutter, meinte die Schwester, die nach den Geräten schaute, einfach reden, die hört das sicher.
Aber sie hört doch gar nicht zu, oder.
Immer geschrien soll ich haben, als Kind, als Baby: geschrien, geschrien, nach Luft geschnappt, noch mehr geschrien, bis der Kopf lila war.
– Das ist doch nicht normal.
Ich war, hast du mir immer wieder erzählt, ich war so ein anstrengendes Kind, so, so anstrengend, immer nur geschrien, ganz steif war ich vom vielen Schreien.
– Ja, konntest du mich denn nicht beruhigen, Mama.
Eine Frage, die verboten ist, was meine ich denn mit dieser Frage, wie kann ich mir anmaßen, so etwas zu fragen. Meine ich etwa damit, dass du es nicht geschafft, nicht gewollt oder gar versäumt hast, mich zu beruhigen oder was. Natürlich hast du es versucht, du hast alles versucht. Ob ich etwa glaube, du hättest mich da herumliegen lassen. Du hast mich hochgenommen, herumgetragen, etwas vorgesungen hast du mir, mich dann wieder herumgetragen in der Wohnung, mich nie, aber wirklich nie allein gelassen, gesprochen mit mir, ja alle Hebel in Bewegung gesetzt, was man eben so macht mit Babys: alles gemacht bis zum Abwinken, und wer hat noch immer geschrien.
– Das war kein unschuldiges Schreien, das war schon fast, also, man darf das ja bei Babys nicht sagen, das ist ja tabu, aber das war schon fast ein bösartiges Geschrei, ja eigentlich Folter, so. Jetzt ist das mal gesagt. Schlafentzug ist Folter.
Zum Arzt gegangen bist du, dem Familienarzt, einem hageren verständigen Menschen, der dem ansonsten doch gut gelungenen Kind eine Weile beim stoßweisen Brüllen zuhörte und dann beruhigend zu dir herübernickte.
– Ist das denn normal, dass so ein Baby schreit, immerzu. Kann man da was machen, was kann ich denn tun, ich kann nicht mehr.
– Das ist eben ein nervöses Kind, ein feinfühliges sensibles Kind, das schreit eben etwas mehr als andere.
– Was kann ich denn bloß tun.
– Sie müssen ruhig bleiben, dann wird das Kind sich auch beruhigen, das wächst sich aus.
Du hast nie geschlafen, weil ich geschrien habe, also: Folter. Nicht extra, keine Absicht, gut, dann gibt es eben auch absichtslose Folter, jedenfalls hast du dich gefoltert gefühlt, oder was ist das sonst, wenn man sich die Haare nicht mehr waschen kann.
– Wieso die Haare.
Na, weil ich ja nie Ruhe gegeben habe, konntest du dir nicht die Haare waschen, ganz einfach. Also ranntest du mit Fettsträhnen durch die Gegend, tagelang, wochenlang, wie feuchter Schnittlauch auf dem Kopf: ganz erbärmlich, während ich fröhlich vor mich hin schrie, eigentlich hätte ich Sängerin werden können bei den Lungen.
Einmal im Monat zum Friseur, wenn Papa mal früher zu Hause war. Der musste eben arbeiten, so wie das damals war, nicht wie heute, wo die Väter die Kinder den lieben langen Tag durch die Gegend tragen und zwischendurch am Computer Geld verdienen mit dem Baby auf dem Schoß. Da hast du dir dann die Perücke gekauft, ich habe sie mal gefunden hinter den Socken. Warum hast du die denn aufbewahrt: ein dunkelbrauner Pagenkopf, akkurat geschnitten, der kam auf den Kopf wie ein Helm, da konnte das Baby brüllen, wie es wollte: Du warst frisch frisiert.
Als sie vom Haus in den Bunker laufen, wollen Annies Beine auf einmal nicht mehr weiter. Weit ist es nicht, in dem kleinen Ort liegt alles nah beieinander. An der Ecke bei den Wohnblocks ist der Bunker, sie müssen nur am großen Haus der Lüthens vorbei, das mit seinem steilen Dach im Dunkeln aussieht wie eine Bergwand, an zwei Obstgärten und dem Hexenhäuschen von Frau Hellwiger. Eben noch rannte Annie durch den Abend, schneller, als Kinder sonst laufen, die Tasche mit dem Nötigsten schlug ihr in die Kniekehlen. Mutter zieht sie voran, es reißt in den Achselhöhlen. Vater ist noch im Haus, warum ist er noch dort, es ist doch Alarm, aber so macht er es immer. Er wartet und wartet, bis man schon die Flieger hört, dann kommt er nach, aber manchmal auch nicht. »Einmal im eigenen Bett schlafen«, sagt er, »es passiert ja doch nichts, oder ist was passiert.« Annie muss zugeben: »Nein, Papa, nichts ist passiert, noch nicht.« Dann kommt das Heulen, und Annie schließt die Augen, betet nicht, zählt nicht die Sekunden, denkt nicht an Vater, der oben im Wohnzimmer auf und ab geht, vielleicht sogar das Fenster geöffnet hat für die gute würzige Abendluft, und solange sie nicht an ihn denkt, wird nichts passieren. Auch heute bleibt er oben, Mutter zerrt Annie über die Straße, leise auf Vater schimpfend, »im eigenen Bett schlafen«, murmelt sie, »dass ich nicht lache. Schlafe ich etwa im eigenen Bett. Oder du, schläfst du etwa im eigenen Bett«, und sie reißt an Annies Arm, ohne auf eine Antwort zu warten, weil sie schnell weiter müssen, niemand trödelt und auch sie nicht, man muss Schritt halten mit den anderen, sonst ist nachher womöglich kein Platz mehr für sie. »Komm rasch, sonst stehen wir draußen, wenn die Bomben losgehen.« Frau Hellwiger hat ihre Katze unter der Jacke, der Kopf schaut heraus wie ein Teufelsgesicht. Die Lüthens zerren ihre Instrumente durch die Nacht, »das sind ja Werte, soll das alles zu Sperrholz werden, das Cello, die Bratsche aus dem 19. Jahrhundert«, ein ganzes Streichquartett schleppen sie mit sich herum, sie könnten Musik im Keller machen, aber die Kästen lehnen nur still in der Ecke und vibrieren, wenn die Flieger kommen.
Alles ist wie immer, bis plötzlich die Beine unter Annie wegsacken, sie stolpert, lässt die Tasche fallen und bleibt stehen.
»Jetzt komm«, fährt Mutter sie an, »oder willst du hier Wurzeln schlagen.« »Meine Beine gehen nicht mehr«, flüstert Annie, aber die Mutter kann sie nicht hören, es ist viel zu laut um sie herum, die Sirenen, die vielen Schritte der Nachbarn, Rufe, Keuchen. Mutter legt einen Arm um sie und schiebt sie grob nach vorne, »komm schon, die Lüthens sind längst unten.« Annie sträubt sich ja gar nicht, aber die Beine tun nicht, was sie sollen, weich und nachgiebig zittern sie unter ihr weg, und wieder sackt sie gegen Mutter. Mutter bleibt stehen und reißt ihr die Tasche aus der Hand. »Was ist los mit dir«, schreit sie Annie an, »kannst du noch nicht einmal laufen.« Annie lehnt sich gegen Mutter und drückt den Kopf in ihren Mantel. Mutter wehrt sie mit dem Ellbogen ab, reißt Annies Kinn hoch und sagt ihr ins Gesicht, so leise, dass Annie es nicht überhören kann: »Du quälst mich. Du bringst uns beide um. Willst du das.« Annie schließt die Augen, schüttelt den Kopf und lässt sich ohne Beine von Mutter bis zum Bunker zerren.
Angst, ja Angst habe ich immer. Immer noch, jeden Tag. Zuletzt heute Morgen in der Klinik: dass du mich nicht anschaust.
Woher ich das nur hätte, hast du immer wieder gefragt, als ob ich das wüsste.
– Woher hast du das bloß, also von mir hast du es nicht, ich hatte nie Angst, das durfte ich gar nicht. Im Krieg Angst haben, das ging nicht. Aber du, du Mimose. Schon als Baby: vor allem und jedem. Vor Fremden, Hunden, Flugzeugen, Dunkelheit, vor allem Dunkelheit, vor Autos, Motorenlärm, vor Träumen, Feuer, vor dem Mond und manchmal sogar vor mir.
Jedenfalls: Seit ich sprechen kann, spreche ich von Angst. Um sie zu vertreiben natürlich, oder warum spricht man überhaupt. Allein ging es aber nicht, die Wörter reichten nicht, auch wenn ich sie noch so oft wiederholte: Also musstest du sie vertreiben, immer und immer wieder, jetzt sogar manchmal noch, du musst sie vertreiben, mein Mann reicht nicht aus, er schafft das nicht, weil nur du es schaffst.
– Bist du erwachsen oder nicht.
– Schon, oder.
Die Angst, du wärst nicht mehr da. Oft stand ich auf, lauschte auf eure Stimmen im Wohnzimmer, da sprach jemand, also war da jemand, aber ganz sicher war ich nicht, es konnte ein Trick sein, ein Traum, Einbildung. Nur eines war ganz sicher: Wenn die Schuhe im Flur standen, musstest du da sein, ohne Schuhe geht niemand aus dem Haus, vor allem nicht im Winter. Du trugst ja Seidenstrumpfhosen, die zerreißen auf dem Kies, dem Pflaster, der Straße, also nur mit Schuhen. Ich starrte auf die Schuhe im Flur, manchmal fasste ich sie an, nur um ganz sicherzugehen, immer aus Leder, immer Halbschuhe, immer sehr sorgfältig geputzt, Papa machte das, er polierte sie fein mit Fett und einem weichen Stück Stoff, das du ihm aus seinen alten Unterhosen zurechtschnittest. Und da standen sie einträchtig unter dem großen Spiegel, deine Schuhe und Papas dazu, und diese Eintracht verschmolz mit euren Stimmen von oben zu einem sicheren Bilderrahmen, in den ich mich legen konnte und endlich schlafen.
Ein Kind wie gemalt, die roten Backen, die blonden geringelten Haare, schau, wie ruhig es schläft, nichts kann es aus der Ruhe bringen, wenn es nur nicht so ängstlich wäre.
– Ihr geht doch nicht weg.
– Wir gehen nicht weg. Wir trennen uns nicht.
Und wirklich habt ihr euch nicht getrennt. Viele andere um uns herum gingen auseinander, mal der Mann zuerst, mal die Frau.
– Weg, die ist einfach abgehauen, der hat eine Jüngere, die armen Kinder. Mit wem fahren die jetzt in Ferien, wer schmiert denen jetzt ein Butterbrot.
Und wirklich, die armen Kinder, dachte ich, untergründig glühte die Angst: Was machen denn die Kinder, wenn sie Angst haben, wer passt auf sie auf und auf mich.
– Meine Mutter war auch weg, sagtest du, und fast klang es wie eine Errungenschaft, auf die du stolz warst: Sie war weg, und du warst da und nicht vor Angst vergangen.
Warum bin ich dann so ängstlich, wo es doch nichts gab, keinen Krieg, kein Weggehen, kein Feuer, einfach gar nichts in meinem glatten, stillen, beschützten Leben.
– Wovor musst du denn Angst haben, sagtest du verächtlich, du wolltest mich nicht verachten, aber meine Angst war doch zu erbärmlich: Was hatte ich denn erlebt?
Die Angst, dir könnte etwas abbrechen. Wir saßen auf dem Sofa, ein Bilderbuch auf deinem Schoß, beide Hände umfassten das Buch. Ich lehnte mich gegen dich, drückte die Nase in deinen Pulli, leichter Rauchgeruch, schob mein Kinn auf deine Schulter, hörte kaum noch der Geschichte zu, die ich auswendig kannte, bis du endlich den Arm leicht um mich legtest. Jetzt lag er da, wo ich ihn wollte, umarmt wollte ich sein. Aber es konnte doch sein, dass er abbrach, einfach abfiel. Vorsichtig drehte ich den Kopf, um zu sehen, ob er immer noch fest in deiner Schulter saß. Es sah gut aus, aber so ein Arm konnte schnell abgehen, wie ein fauler Ast konnte er sich lösen und aus dem Gelenk bröckeln, und dann hättest du nur noch einen Arm, um zu kochen und zu saugen und mich zu umarmen.
– Mama, können Arme einfach abfallen.
Du schautest mich spöttisch an, du konntest ja versuchen, mit Spott mir etwas auszutreiben, aber dass es nicht half, wussten wir beide.
– Was meinst denn du, sagtest du schön spöttisch, um mich die Dummheit meiner Frage spüren zu lassen, nicht um mich wirklich zu verhöhnen, sondern gegen meine Angst. Was meinst du, kann so ein Arm abgehen, und du schwenktest deinen Arm vor meinem Gesicht hin und her.
– Nein, sagte ich beschämt, aber im Einkaufszentrum ist einer ohne Bein, der stützt sich auf Krücken und hat lila Hände.
– Dem ist es ja nicht einfach abgefallen, sagtest du, der hat es im Krieg gelassen.
Im Krieg ließ man also Beine liegen, so wie ich den Turnbeutel nach dem Kindersport. Dort lagen sie herum und wurden lila, bis jemand sie aufsammelte und wegschmiss.
– Oder, sagte ich zu meiner Freundin Karin, mit der ich gern über eklige Sachen redete, es gibt ein Heim für verlassene Beine. Einbeinige Leute können hinkommen und schauen, ob sie eins finden, das ihnen passt. Karin kicherte und nahm mich mit ins Einkaufszentrum, wo wir den Mann mit den Krücken suchten. Diesmal lehnte er neben der Apotheke an einem Blumenkübel, die lila Hände um die Handgriffe geklammert. Nie saß er, obwohl die Bank neben ihm auch diesmal wieder frei war. Er könnte sich einfach in dem Heim ein neues Bein holen, kicherten wir. Vielleicht ein Frauenbein, so ein langes dünnes mit einem Stöckelschuh. Wir trieben uns bei der Apothekerin herum, sie steckte uns Traubenzucker zu und beobachtete uns, ob wir etwas klauen wollten, aber dafür waren wir zu klein, wir wollten nur den einbeinigen Mann aus der Nähe studieren, den Schauder des mit einer Sicherheitsnadel hochgesteckten Hosenbeins und eines Krieges, in dem Körperteile herumlagen. Der Mann schob sich eine Zigarette in den Mund und schaute verdrossen zu uns herüber, er merkte, dass wir ihn anstarrten, und nun spielten wir mit ihm, drehten uns weg, schlenderten davon, nur um uns wieder anzupirschen, halb versteckt hinter den Drehständern mit den Hustenbonbons und den Heftpflastern, das Bein war uns schon fast egal, er sollte uns mal kennenlernen, von dem ließen wir uns gar nichts vormachen, wir waren schnell und klein, und hinter uns her käme er sowieso nie.
Das Einkaufszentrum, labyrinthisch und blendend neu, lockte dich beinahe jeden Tag. Damals ganz neu: alles unter einem Dach. Mit deinem schicken schwarzen Einkaufswagen zogst du los, mal mit mir, mal ohne mich, und wenn ich nicht mitwollte, gingst du trotzdem, damit genug im Haus war: die Fächer der Tiefkühltruhe zum Bersten gefüllt mit Rotkraut, Apfeltorte, Ofenpommes, Butter, geschichtet wie eine Wand aus Ziegelsteinen, mit Erbsen, Zwiebelsuppe, Pizza Margherita, Pizza Funghi, Pizza Vier Jahreszeiten, mit Kaiserschmarren für Papa und Eiswürfeln für Besuch; die Schublade mit nicht verderblichen Taschentüchern, Dr. Oetker Puddingpulver, Trockensuppe, Brühwürfeln und Knäckebrot; und im Keller noch mehr, Klopapier, Tomatensuppe, Marmelade, aber nicht selbst gemacht, niemals. Das hattest du nicht nötig, zum Glück kein Einkochen mehr, keine Pflaumenbäume, das Gärtchen war viel zu klein. Lieber im Katalog alles ankreuzen, den gedeckten Apfelkuchen, die Reibekuchen, und den Mann von Bofrost anrufen. Und jeden Tag den schwarzen Einkaufswagen füllen, nicht besinnungslos, nicht hemmungslos, verständig kauftest du ein, jeden Tag von Neuem, damit immer alles im Haus war, und lachtest manchmal über dich selbst.
Weil Annies Beine nachts beim Alarm nicht mehr gehen, muss sich Mutter etwas anderes einfallen lassen. Sie findet einen halbsicheren Keller bei den Nachbarn nur fünf Häuser weiter, also praktisch direkt um die Ecke, aber auch fünf Häuser sind für beinlose Kinder zu weit. Jede Nacht ist nun Alarm, sie kann das Kind nicht durch die Straßen zerren, lieber soll Annie gleich abends runter in den halbsicheren Keller und über Nacht dort bleiben. So kann sie schlafen und muss niemanden quälen mit ihrer Langsamkeit, und die Puddingbeine kann sie ausstrecken auf dem Lager, das Mutter für sie bereitet hat. Das Grundwasser der Nachbarn steht so hoch, dass die alten Möbel, die in eine Ecke gerückt sind, und die Vorratskisten und die Werkzeuge auf Holzpaletten ruhen. Auch das Lager steht auf einer Holzpalette, Annie kann, wenn sie sich über den Rand der Pritsche beugt, durch die Latten auf das Wasser sehen. Aber, sagt Mutter, da solle sie sich mal keine Gedanken machen, sie solle lieber schön still auf dem Lager liegen bleiben, sonst bekomme sie noch nasse Füße. Außerdem soll sie ja sowieso schlafen. Mutter wünscht ihr Gute Nacht und verschließt die Tür. Natürlich muss sie auch abschließen, denn sonst könnte ja jeder hineinkommen, man weiß ja nie, wer in diesen Zeiten nachts unterwegs ist. Mutter schließt also ab und geht hinüber, nur fünf Häuser weiter, sie kann ja Vater nicht den ganzen Abend allein lassen. Wenn Alarm kommt, ist sie im Handumdrehen wieder zurück, damit Annie keine Angst bekommt.
Annie liegt still auf dem Lager, horcht auf das Glucksen des Wassers unter den Holzpaletten und wartet auf ein Geräusch an der Tür. Weil sie nicht einschlafen kann, reißt sie die Augen auf und wieder zu, um müde zu werden, aber es macht keinen Unterschied, die Dunkelheit ist überall.
Wenn irgendwo eine Sirene ertönt, eine Fabriksirene oder auch nur eine Feuerwehr, wirst du stumm und ziehst die Schultern hoch. Nicht, dass du Angst hast, das nicht. Als ich klein war, gab es oft Probealarm.
– Ein Probealarm, das müssen die machen, um zu sehen, ob die Sirenen funktionieren.
– Aber warum müssen die Sirenen überhaupt funktionieren. Wenn kein Krieg kommt, müssen sie auch nicht funktionieren, dann ist es egal.
– Na, weil man ja nie weiß, was passiert.
– Gibt es denn bald Krieg.
– Nein, hier nicht, sicher nicht.
Der Probealarm konnte beim Mittagessen ausbrechen, während du die Nudeln austeiltest oder wenn du am Telefon warst mit der Oma, eines dieser Endlostelefonate:
– Nein, Mutter, so habe ich das nicht gesagt, nein, hör mir doch einen Moment zu, nein, so kannst du das wirklich nicht sagen, Mutter, aber wenn du mir nicht zuhörst. Mutter, ich versuche schon seit Stunden, auch mal etwas –
Da kam der Alarm. Und du ließest den Hörer sinken, stumm geworden, klein geworden, da konnte die Oma deine Mutter durch den Hörer krakeelen, wie sie wollte, du warst in einer anderen Zeit: Nächte allein im Keller, eingefroren auf der Holzpalette.
Auch die Oma muss diese Nächte noch gekannt haben, auch sie hatte schließlich ihr Haus verloren, das schöne Elternhaus mit den grünen Fensterläden und dem Obstgarten, all die Pflaumenbäume, ihre Kleider, das eierschalenfarbene Hochzeitskleid, das alte schwarz gewölkte Silber, das Annie, meine Mutter, früher polieren durfte. Aber sie sprach einfach weiter, so laut, dass ich durch den Hörer mithörte, weil ich daneben stand:
– Hörst du, Anne, also, Anne, wenn du mir überhaupt nicht antwortest, du schuldest mir eine Entschuldigung, Anne.
Aber du standest oder saßest, wo du gerade warst, einen langen Moment eingefroren, bis ich rief und an dir zupfte und schon Angst hatte, du könntest in Tränen ausbrechen: weil das das Allerschlimmste war, um jeden Preis zu verhindern.
Oft sind deine Augen etwas hervorgetreten, als drückten von hinten, von innen die Tränen und fänden keinen Durchlass. Aber du durftest nicht weinen und eigentlich auch nicht stillsitzen, du musstest ja mich halten, denn ich hatte solche Angst vor Alarm, nicht du.
– Es könnte Krieg kommen, das Haus, es könnte doch brennen, Mama, hörst du den Alarm, warum guckst du so komisch.
Du standest noch einen Augenblick verloren, dann legtest du den Arm um mich: Schon war der Alarm fast verklungen.
Einmal Alarm in der Grundschule, die Lehrerin schob uns nach draußen, geprobt hatten wir es, wussten, dass wir uns an den Händen nehmen sollten, dass wir durchzählen mussten, an welchem Strauch im Pausenhof wir uns versammeln sollten, die Lehrerin drehte sich an der Tür des Klassenzimmers noch einmal um, bückte sich und schaute prüfend unter die Tische, so genau wusste sie, was zu tun war, sah auch die Tränen in meinen Augen, nahm mich an der Hand, wir bildeten das Schlusslicht unserer kleinen Prozession. Aus jeder Klasse kam ein Zug von Mädchen und Jungen in schönster Ordnung, sanft vorangetrieben von einer ruhig lächelnden Lehrerin, während die Sirene mich an der Gurgel hatte, bis ich würgte und weinte, na na, sagte die Lehrerin, das ist doch nur eine Probe, gleich hört es doch auf, weißt du, jetzt beruhige dich doch.
Ein Elterngespräch: über meine Angst. Das Kind, wusste die Lehrerin, braucht Hilfe. Allein kann es das nicht überwinden. Ihren Familienhintergrund kenne ich ja, sagte die Lehrerin freundlich, wie kommt das Kind nur auf diese Ängste. Mit therapeutischen Maßnahmen muss man da vorgehen.
Was? Das musstest du erst mal verdauen, hast du mir erzählt, das war ja allerhand, so ein kleines Kind und schon zum Therapeuten, zu dem dich ja keine zehn Pferde jemals hin bekämen, nicht gegen Geld, aber ganz ehrlich, schon als Baby hatte ich ja nur geschrien, nicht normal war das, und dazu passt doch die Angst wie die Faust aufs Auge. Nicht dass ich krank war, aber doch über die Maßen ängstlich und verängstigt, eine Störung lag da schon vor, und die konnte man behandeln, das war keine Schande und sowieso ja auch nur ein Vorschlag, den du annahmst für mich.
Also ging ich zum Therapeuten und redete von der Angst, und weil ich gern redete, erzählte ich ihm lange Geschichten in seine sanften braunen Augen hinein, die mich nie aus dem Blick ließen, Geschichten von Alarm und dem Mann, der sein Bein im Krieg gelassen hatte, von Feuer und den Eltern, die vielleicht weggingen, obwohl sie das nie tun würden, und dass man ja nie wusste, was passieren könnte.
Ich hatte kein Recht, so viel Angst zu haben, ich ging allen auf die Nerven damit. Der Psychologe war noch besser als du, weil eine Stunde nur für meine Ängste zuständig. Er hatte so wie du immer warme Hände. Er schaute mich an, wenn ich sprach, ein fester warmer Blick, gut gegen Angst und überhaupt so warm, dass ich mich tagelang darauf freute, in diesen Blick wieder einzutauchen, und nicht gehen wollte, wenn die Stunde vorbei war. Ich sollte nicht gleich von der Angst sprechen, weil sie zu groß war. Wir fingen anders an, mit einer Wiese, auf der ich in Gedanken spazieren ging, und ich schlenderte herum, die Gedanken waren meine Hunde, die um mich herumsprangen, es gab Quellen, Moos, viele kleinere Nagetiere und Vögel, Felsen, an die ich mich lehnen konnte und die Füße in den Bach strecken, die Tiere um mich herum, ich brauchte nur eine Hand auszustrecken, schon spürte ich Fell und Federn. Keine Wolke am Himmel, keine Angst in Sicht. Die Angst wegreden und wegspazieren, er ließ mich weiterspazieren, ich genoss die Wortspaziergänge und den Zuhörer, der mich anschaute, immerzu anschaute, es gab mich also, und es ging mir gut, er fragte auch immer, ob es gut gehe, das fragte sonst niemand. Dann lenkte er meine Gedanken und mich an die Ränder der Wiese, dahin, wo das Gebüsch dichter wurde und größere Tiere hausten, die sich nicht zeigten, weil sie scheu und vielleicht auch gefährlich waren, und die Quelle, das Bächlein wurde reißender. Mehr Wasser stürzte hindurch und riss an der Böschung, der Boden wurde steiniger und abschüssig, und wie geht es dir jetzt. Mir ist ein bisschen unheimlich, sagte ich, und das wollte mein Zuhörer, er lockte mich ins Unheimliche, immer tiefer ins Unterholz, er dachte, er könnte mich mit Bären und Wölfen erschrecken, aber das war es nicht. Tiere waren in Ordnung, man konnte sie zähmen, sogar die großen. Aber ich hörte schon ein Knacken, das Gestrüpp war so verdorrt, ein Funken nur, und ein Feuer könnte ausbrechen, ein gewaltiges Feuer sich ausbreiten, in Windeseile, schneller, als du schauen kannst, prescht so ein Feuer voran, frisst das Holz, verdunkelt die Luft, du kannst versuchen zu rennen, aber schneller als die Flammen ist niemand, Tiere nicht und auch kein Mensch. Ich war außer Atem, ich rannte, ich war so schnell wie nie und wusste doch, ich würde es nicht schaffen, ja, sagte mein Zuhörer. Also, was kannst du machen. Er bremste mich aus, hielt meine Geschichte an: einen Augenblick überlegen, was kannst du machen, schau dich um. Ich war verschwitzt, kein Wunder: Das Feuer stand um mich herum, eine tosende Wand. Ich kann, sagte ich außer Atem, ich kann vielleicht in den Bach und in dem Bach weiterlaufen. Ja, sagte mein Zuhörer, das Wasser schützt dich, steig doch hinein in den Bach. Das machte ich, ging in den Bach, so wie ich war, Schuhe und alles. Er war tiefer, als ich dachte, bis zu den Waden, Knien, bis zur Hüfte, kühles Wasser: kein Feuer. Ich watete hindurch, es ging schwer voran, gegen das Wasser an, tauchte auch einmal ganz unter, damit die sprühenden Funken mich nicht in Brand setzen konnten, sie taten es nicht. Ich kam immer weiter weg, die Flammen wurden leiser, ich streifte mir den Ruß aus den Haaren, die tropfend um mein Gesicht hingen, nass vom Schutzwasser. Du hast es geschafft, sagte mein Zuhörer, du bist gerettet. Ja, sagte ich, noch erstaunt, wie unversehrt ich geblieben war. Ganz allein, sagte der Zuhörer, hast du aus dem Feuer herausgefunden, niemand anders hat dir geholfen. Ja, sagte ich.
Mein Zuhörer wuchs mir ans Herz, so sehr, dass ich die Tage zählte, bis er mir wieder zuhören würde. Du wolltest immer wissen, was ich denn so machte bei dem Psychologen und ob er nett zu mir sei und was er mit mir denn so tue und ob es helfe. Das kannst du mir doch erzählen, sagtest du, wir reden doch über alles. Ich erzählte nichts und weiß nicht, ob es half, ich weiß nur, dass ich in den Geschichten, die ich meinem Zuhörer erzählte, immer mutiger wurde. Immer ging ich zuerst auf der Wiese spazieren. Dann geschah etwas Schreckliches, ein Sturm, Unfall, Steinschlag, Feuer, immer wieder Feuer, und mein Zuhörer, der mir so zuhörte wie später nie wieder jemand, hörte mir zu beim Davonlaufen oder sogar Dableiben: Wasser holen, einen Elefanten zähmen, der dann mit seinem Rüssel große Mengen Wasser auf die Flammen prustete und sie zu einem jämmerlichen Gluthaufen zusammenschrumpfen ließ. Ich erzählte mit geschlossenen Augen. Manchmal, wenn ich rasch zum Zuhörer hinüberblickte, um sicherzugehen, dass er richtig zuhörte, schaute er nachdenklich aus dem Fenster, die Beine immer übereinandergeschlagen, ein wenig in den Sessel gesunken. Ich zweifelte nie daran, dass er mit den Gedanken bei mir und meinen Flammen war.
Ende der Leseprobe