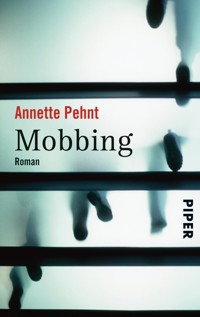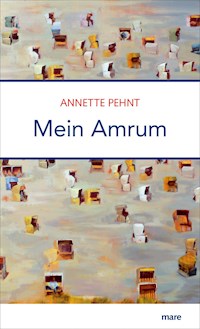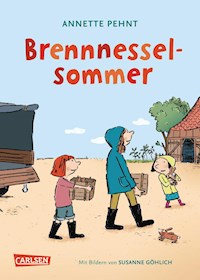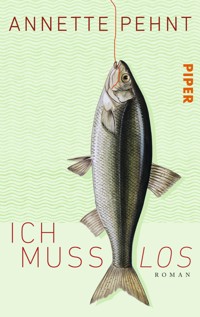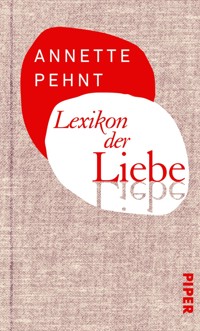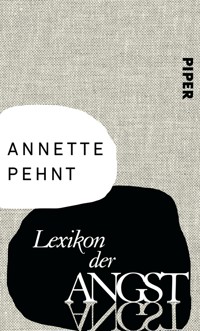
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Angst ist ein Alleskönner, deshalb kennt sie jeder: Sie lähmt uns, sie hält uns den Spiegel vor, sie frisst uns auf, und sie befeuert uns. Dabei nimmt sie jede nur erdenkliche Gestalt an, lauert uns auf oder schlägt uns in die Magengrube. Annette Pehnt hat sie beobachtet und belauscht, sie kennt die Angst von A bis Z: Mit schriftstellerischer Leidenschaft nimmt sie alles auf in ihr »Lexikon der Angst«, was das Leben zu bieten hat - von der Existenzangst bis zur Todesangst. Und in kurzen Geschichten lesen wir von leisen, lächerlichen, bestürzenden Momenten der Angst zwischen Müttern und Kindern, der Angst vor Tsunamis, der Finanzkrise und, natürlich, Fahrstühlen, Hunden und Einsamkeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
1. Auflage 2013
ISBN 978-3-492-96389-3
© 2013 Piper Verlag GmbH, München
Umschlaggestaltung: Kornelia Rumberg, www.rumbergdesign.de
Datenkonvertierung E-Book: Kösel, Krugzell
»Meine Arbeiten sind eine Serie von Exorzismen.«
Louise Bourgeois
A
Aal Ein Glas Milch ist eine Mahlzeit, hat schon die Großmutter behauptet. Deswegen gab es Milch nicht zum Essen, denn eine Mahlzeit genügt. Am Nachmittag, wenn sie vom Spielen kam, die Rufe der anderen Kinder noch in der dämmrigen Luft, wusch sich die Großmutter die Hände, wischte sie an der Schürze ab und stellte ein frisch gespültes Glas vor sie auf den Tisch. Jetzt ist es Zeit, sagte die Großmutter, du hast Hunger. Es war keine Frage, sie wusste es. Sie nickte und schaute zur Großmutter hoch, die mit beinahe feierlich zusammengepressten Lippen die Milchflasche öffnete und das Glas voll schenkte und neben ihr stehen blieb, die Hände in die Hüften gestemmt, während sie beide Hände um das Glas schloss, es an ihre Lippen hob und es in kleinen Schlucken leerte. Danach war sie satt bis zum Abend, weil Milch eine Mahlzeit ist, bläulich schimmernd im Glas, eine weiße Schliere über der Lippe.
Später waren sie in den Herbstferien in Venedig, ohne die Großmutter, die nun in einem Heim lebte und keine Schürze mehr brauchte, weil sie im Heim vollständig verpflegt wurde, und sahen im Seitenschiff einer Barockkirche ein Bild mit einer üppigen Maria. Das Jesuskind zupfte mit prallen Fingern an ihrer Brust, aus deren Brustwarze ein gelblicher Milchtropfen quoll, und sie war, während ihre Eltern peinlich berührt und leicht angewidert den Blick von Marias tropfender Brust nicht lösen konnten, nicht überrascht. Auch das Jesuskind brauchte eine Mahlzeit.
Die Milch, die sie nun zu Hause im Kühlschrank hatten, war in Plastikschläuche abgefüllt. Man musste den Schlauch, der kühl und prall war und von alleine nicht stehen konnte, in einen Plastikhalter zwängen, der Schlauch bäumte sich auf wie ein fetter Aal, ein ungebärdiger Körperteil oder eine riesige Made. Mit der Schere musste man ihm eine Ecke abschneiden, aus der sofort Milch schwappte, als hätte der Schlauch es gar nicht erwarten können. Sie trank nun Milch auch im Kaffee und im Tee.
Später zog sie aus und mochte plötzlich keine Milch mehr. Sie aß unregelmäßig, kam oft spät in ihre Wohnung und trank dann lieber ein Glas Wein, morgens reichte es oft nicht zum Frühstück, sie machte sich schnell einen Espresso und kaufte auf dem Weg zur Straßenbahn ein Croissant auf die Hand. Trotzdem hatte sie meistens eine Flasche Milch im Kühlschrank, die nach einer Weile versauerte und ihr käsig entgegenstank, wenn sie vorsichtig den Verschluss aufschraubte. Wenn sie Kinder hätte, dachte sie manchmal, während sie im Supermarkt an der Kühltheke vorbeischob, müsste sie mehr Milch kaufen, die gut für die Knochen ist und warm mit Honig auch gut gegen Halsweh.
Dann saß sie irgendwann abends allein am Küchentisch und lauschte. Aus der Nachbarwohnung hörte sie schwaches Fernsehwimmern, unten auf der Straße bellte ein Hund. Sie spürte Hunger, obwohl sie vorhin noch beim Metzger zwei Frikadellen geholt und sie gleich mit spitzen Fingern gegessen hatte, sie hätte satt sein müssen, durstig war sie auch nicht. Sie stand auf, holte die Milchflasche aus dem Kühlschrank und schnupperte daran. Die Milch roch frisch, ein wenig buttrig und ehrlich.
Sie schenkte sich ein Glas ein, ein weißer Schwall schäumte ins Glas wie frisch gemolken und stürzte ihr plötzlich ins Gesicht, ein weißer Vogel, und sie konnte nichts mehr sehen. Sie presste die Augen zu, bis sie die Feuchtigkeit spürte, die ihr über die Finger rann und auch schon auf den Boden troff, schnell riss sie die Augen auf und sah eine Milchlache auf dem Tisch, auf den Fliesen, ihre Finger wie kleine Landzungen auf die Tischplatte gestemmt. Sie wich zurück und wischte die Hände unwillkürlich am Pullover ab, obwohl sie keine Schürze trug. Rasch griff sie nach einem Lappen, schleuderte ihn in die Milchlache und schaute, bevor sie alles wegputzte, im Badezimmer ihr Gesicht an. Keine Milchspuren, ein Schreck in den Augen, die Lippen etwas verwischt. Sie atmete langsamer, wusch die Hände und ging langsam zurück in die Küche. Nachdem sie alles gereinigt hatte, leerte sie die Milchflasche ins Spülbecken. Diesmal hatte sie sich schon unmerklich geduckt, als mit dem weißen Strahl wieder eine heftige helle Bewegung aufzuckte und ihr grell über die Augen fuhr. Die Flasche glitt ihr aus den Händen und knallte in die Spüle. Sie hielt sich an der Anrichte, mit fest geschlossenen Augen, zitternd.
Später spülte sie die Flasche aus und stellte sie zum Altglas. Sie beschloss, eine Weile auf frische Milch zu verzichten, schließlich trank sie die Flaschen nie aus, es lohnte sich nicht und war auch ungesund. Den weißen Angriff noch im Blut, wandte sie den Blick ab, wenn sie im Fernsehen Reklame mit saftigen Wiesen und melkenden Bäuerinnen sah, lachte aber zugleich über die unziemliche neue Furcht, von der niemand wusste.
In der Cafeteria ihrer Firma trank sie den Kaffee nur noch schwarz. Meistens saß sie alleine, aber einmal setzte sich jemand zu ihr, der das Milchkännchen anhob, kurz hineinspähte, Kondensmilch, Kaffeesahne oder einfach Milch, ein Schuss in den sämigen Kaffee, den der teure Kaffeeautomat, eigens für die Mitarbeiter angeschafft, seitdem der Aufschwung sich endlich ordentlich bemerkbar machte, besonders kräftig aufbrühte, man konnte ihn fast ohne Milch nicht trinken, oder, meinen Sie nicht auch, ich nehme ja sonst den Kaffee eher schwarz, zu Hause, meine ich, oder in der Stadt, wenn ich mir am Samstag mal einen gönne, erst über den Markt, dann einen guten Kaffee, sich ruhig mal etwas Gutes tun am Wochenende, oder, da schlug die Milch schon über ihrem Gesicht zusammen, ihr süßer weißer Tsunami, und sie sprang auf und wich zurück.
Ist etwas mit Ihnen.
Ich habe – ich habe einen Termin vergessen.
Sie haben ja Ihren Kuchen gar nicht aufgegessen.
Nicht nötig, weil die Milch ihr das Maul stopft und in die Augen blendet, und nun muss sie schnell weg, zu ihrem Termin.
AbendlichtDie Sonne ist ein großes Geschäft, sagt er, unbezahlbar ist sie, und er lacht kurz über seinen Scherz.
Wie meinst du das, fragen die Bekannten, meinst du, jemand macht mit der Sonne Geschäfte, oder meinst du, dass man ohne die Sonne gar keine Geschäfte machen könnte, oder dass wir froh sein können, dass die Sonne scheint.
Er lacht geheimnisvoll und nickt in die Abendsonne, die alles, die Terrasse, die Bekannten und ihn selbst, in ein gnädiges aprikosenfarbenes Licht taucht, ein Licht, wie es nur am Ende des Sommers möglich ist, getränkt mit langen Tagen, späten Nächten, Sommerlieben, ein Licht, das ihnen allen mindestens zehn Extrajahre schenkt, ja, sagt er wissend, ein großes Geschäft.
Die Bekannten schauen sich ratlos an, dann heben sie die Gläser, die er vorhin zum zweiten oder dritten Mal gefüllt hat, sie sind hier, um auf die Bekanntschaft anzustoßen, auf das Ende des Sommers, auf die vielen Sommer, die noch vor ihnen liegen, auch auf die schönen Urlaube, die sie ohne größere Zerrüttungen, vielleicht sogar mit wachsender Gelöstheit überstanden und in die sie ja auch eine Menge investiert haben, und warum sollen sie nicht auch auf die Sonne und ihre Geschäfte anstoßen.
Jetzt fällt es ihnen ein: Sicher hat ihr Gastgeber, der auch nach der Finanzkrise noch über beträchtliches Eigenkapital verfügt, in alternative Energien investiert, ein kluger Schachzug trotz des Rückgangs an staatlicher Unterstützung und trotz des umweltpolitischen Richtungswechsels. Darauf lässt sich fürwahr anstoßen, die Sonne als Geschäft, ein Geschäft, das für schwarze Zahlen sorgt und zugleich den Planeten schont, ja, fallen sie also ein, unbezahlbar ist die Sonne, recht hast du.
Da sehen sie, dass er sein Glas nicht erhebt, er hat es wieder abgestellt und das Gesicht auf die Hände gestützt und runzelt auf einmal düster die Stirn. Heute können sie sich keinen Reim auf ihn machen, erst diese Begeisterung, dieses geheimnisvolle Triumphieren, dann die zusammengezogenen Augenbrauen, nicht dass sie nicht gern mit ihm feiern, vor allem unternehmerische Risikobereitschaft sind sie jederzeit bereit zu unterstützen, aber wieso brütet er auf einmal vor sich hin.
Also raus mit der Sprache, drängen sie und lehnen sich zurück, sein Garten im Abendlicht ein festlicher Park, sie wüssten schon gern, was es in einem solchen Ambiente zu grübeln gibt.
Er antwortet nicht gleich, er scheint zu überlegen, was er ihnen preisgeben kann, dabei kennen sie sich schon seit Jahren, seit Jahrzehnten, eigentlich schade, dass man einander nach so langer Zeit nicht einfach das Herz öffnen kann, Sonne hin oder her.
Zögernd sagt er schließlich, als wüsste er schon, dass man ihm vermutlich nicht glaubt, ich weiß nicht, sagt er, ob ihr informiert seid, aber die Sonne wird uns geliehen, jeden Tag von Neuem.
Sie lachen auf, sie mustern sein Gesicht, um zu sehen, ob er es ernst meint, sie werfen sich Blicke zu. Aber er verzieht keine Miene, zwinkert ihnen nicht zu, kein schelmisches Zucken der Mundwinkel.
Und was meinst du, wer ist der große Sonnenverleiher, fragen sie lächelnd, bereit, sich auf sein Hirngespinst einzulassen, wer hat sich das Monopol gesichert.
Sie wird uns geliehen, wiederholt er, und wir zahlen dafür. Jeden Tag.
Und was zahlen wir, wollen sie wissen, das ist ja sicher nicht ganz billig, jeden Tag die Sonne auszuleihen.
Unbezahlbar, sagt er. Wir sind schwer verschuldet. Dann steht er auf und geht langsam ins Haus. Einen Moment lang ist es still am Tisch. Sie schauen ihm hinterher, jemand erhebt sich halb, um ihm nachzueilen und ihn zu beschwichtigen, aber die anderen halten ihn zurück.
Lass ihn mal. Das wird gleich wieder.
Wir sollten dann auch allmählich aufbrechen.
Sie trinken ihre Gläser aus, werfen noch einen Blick auf die gepflegten Staudenbeete, Astern im Abendlicht, der Zierahorn verfärbt sich schon, das wird bald ein Farbenspiel, noch zwei oder drei Wochen, dann kommt der Herbst.
AnwesenheitDer Vermieter wartet auf sie. Im Flur. Er hat seine Sachen gleich mitgebracht, damit er alles zur Hand hat, in großen Koffern steht sein ganzes Hab und Gut im Treppenhaus. Im Grunde wohnt er vor ihrer Haustür. Dabei ist er doch der Vermieter und könnte ganz gemütlich mit seiner Frau in seiner weitläufigen Vermieterwohnung in seinem eigenen großen, teuren Haus wohnen, das er sich vom Geld seiner Mieter gebaut hat, anstatt seinen Mietern aufzulauern. Dort könnte er auch fernsehen und Wäsche waschen, Dinge, zu denen er vor ihrer Tür natürlich keine Gelegenheit hat. Deswegen riecht es auch etwas streng im ganzen Treppenhaus, was nicht im Interesse des Vermieters sein kann.
Selbstverständlich hat sie versucht, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Sie ist ein friedfertiger Mensch und setzt ganz auf die Kraft des Wortes. Erwachsene Personen werden es ja wohl fertigbringen, sich an einen Tisch zu setzen und die Dinge miteinander zu klären. Nicht so der Vermieter. Zwar sieht er erwachsen aus, verhält sich aber wie ein trotziger Junge, und das ist noch untertrieben.
Es fing an mit einigen Unstimmigkeiten, die Mülltage und andere Kleinigkeiten betreffend. Der Vermieter behauptete, sie stelle die Mülleimer immer am falschen Tag an die Straße, nämlich von Dienstag auf Mittwoch statt von Mittwoch auf Donnerstag. Sie zeigte ihm den Plan, den sie von den städtischen Müllwerken bekommen hatte. Eindeutig: Mittwoch. Der Vermieter riss ihr den Plan aus der Hand, beugte sich darüber und fuchtelte dann rechthaberisch vor ihrer Nase herum: Der Plan sei vom Vorjahr, hier stehe es doch, er könne ihr gern den aktuellen Plan zukommen lassen. Aber Plan ist Plan, sie ließ sich natürlich nicht beirren von seinen wirren Vorwürfen und stellte die Mülleimer weiterhin von Dienstag auf Mittwoch an die Straße.
Von da an hatte er es auf sie abgesehen. Als Nächstes behauptete er, diesmal telefonisch, sie habe ihren Namen nicht korrekt am Briefkasten angebracht. Sie legte sofort auf. Sie wusste doch, dass sie gleich nach ihrem Einzug einen Zettel geschrieben und ihn an den Briefkasten geklebt hatte, außerdem kam die Post regelmäßig, also war offensichtlich alles in bester Ordnung. Nein, rief der Vermieter, der gleich am nächsten Morgen vor ihrer Tür stand, das Namensschild müsse computergedruckt sein, nicht handgeschrieben. Und wie soll sie das bitte sehr bewerkstelligen? Denkt er etwa, dass jeder Mensch unter Gottes Sonne einen Computer besitzt? Ihr Sohn hat natürlich einen, aber soll sie ihren Sohn, der in einer anderen Stadt wohnt und sein eigenes Leben führt, damit behelligen? Soll ihr Sohn auf dem Computer ein Namensschild schreiben, es ausdrucken und ihr schicken, nur damit der Vermieter endlich Ruhe gibt? All das sagte sie ihm ins Gesicht, und er bot sofort an, das Namensschild selbst zu schreiben und an ihrem Briefkasten anzubringen. Da blieb ihr die Luft weg. Sofort schlug sie die Tür zu, auch wenn sie sonst kein aufbrausendes Temperament besaß, lehnte sich von innen dagegen und atmete schwer. Allein der Gedanke, dass der Vermieter mit seinen wurstigen rosa Fingern ihren Namen tippte, verursachte ihr Übelkeit, ganz zu schweigen davon, dass er nichts an ihrem Briefkasten zu suchen hatte, wer weiß, was er damit anstellen würde. Nicht dass sie ihm Diebstahl oder Zerstörungswut unterstellte, aber schließlich war er ein Fremder, und da war Misstrauen nur gesund.
Dass es gefährlich ist, sich einem Vermieter zu widersetzen, begriff sie erst nach und nach. Für sie war die Angelegenheit erledigt; Müll und Post reibungslos, ansonsten nur nette Mieter im Haus, man grüßte sich, in der spätsommerlichen Wärme genoss sie den Balkon, den sie in der alten Wohnung nicht gehabt hatte, es hätte alles sehr friedlich sein können.
Eines Tages trug sie die Wäsche nach unten in den Waschkeller und traf den Vermieter auf der Treppe. Auch er grüßte mit überraschender, beinahe schon sonderbarer Herzlichkeit und folgte ihr in den Waschkeller. Als sie sich irritiert umdrehte, weil es keinen Grund gab, warum der Vermieter ihr hinterhersteigen sollte, rief er ihr zu, sie solle nur vorangehen, er wolle ihr die schwere Kellertür aufhalten, weil sie ja keine Hand freihabe. Da durchschaute sie ihn. Wenn sie ihm den Rücken zuwandte, würde er sie angreifen, sie wusste es, ihr ganzer Körper wusste es, sie ließ den Wäschekorb fallen, der die Treppe hinunterkrachte, presste sich ans Geländer, und obwohl der Schreck gewaltig war, schaute sie dem Vermieter immerzu ins Gesicht, um ihn in Schach zu halten, und spürte zugleich, wie mutig sie war und dass er ihr nichts würde anhaben können.
Was ist denn mit Ihnen, murmelte er, was haben Sie denn bloß. Lassen Sie mich, stieß sie hervor und ging rückwärts die Treppe hinunter, ließ ihn aber nicht aus den Augen, bis er endlich abdrehte und irgendwo im Haus verschwand, wo, war eine andere gute Frage, denn schließlich wohnt er nicht hier, jemand musste ihm also Einlass gewährt haben, denn als sie später, nachdem sie langsam und schwer atmend die Waschmaschine in Gang gesetzt hatte, wieder hoch in ihre Wohnung stieg, war er nicht mehr zu sehen.
Sie hatte gedacht, dass es schlimmer nicht mehr kommen könnte. Der Mut auf der Kellertreppe war inzwischen einer gewissen Verzagtheit gewichen, das gab sie zu, aber sie beruhigte sich damit, dass der Spätsommer wirklich betörend war und dass die Wohnung so viele Vorteile hatte, dass man diesen Vermieter schon in Kauf nehmen konnte, zumal er ja den Gipfel der Unverschämtheiten bereits erklommen hatte.
Da kannte sie den Vermieter schlecht.
Einige Wochen später, als sie sich wieder einmal in den Waschkeller gewagt hatte, mit feuchten Händen, dagegen konnte sie nichts machen, und die saubere Wäsche aus der Trommel in den Waschkorb räumte, um sie dann aufzuhängen, machte sie eine verstörende Entdeckung. Ihre Unterwäsche fehlte. Blusen, die helle Hose, auch die Söckchen, alles vollständig, aber die Höschen, die Mieder und der neue Büstenhalter waren verschwunden. Sie schüttelte alle Kleider gründlich aus, vielleicht hatten sich die Sachen in den feuchten Falten verborgen, aber es war so, wie sie es gleich befürchtet hatte: alles weg. Und sie wusste auch schon, wer sie entwendet hatte, nur einer kam infrage. Sie ließ die Wäsche, wo sie war, eilte gleich hoch, rief nun doch mit brennendem Gesicht ihren Sohn an, den sie ja eigentlich nicht hatte behelligen wollen, und erzählte ihm alles. Er schwieg lange, vermutlich fehlten ihm die Worte. Sie wollte es noch etwas ausführlicher schildern, da unterbrach er sie auf unhöfliche Weise und herrschte sie an. Das sei Unsinn, sie solle sich nichts einreden, was der Vermieter denn mit ihrer Unterwäsche anfangen solle, und jetzt sei Schluss mit dem Quatsch. Sofort kamen ihr die Tränen. Niemals hätte sie gedacht, dass ihr Sohn sich gegen sie stellen würde. Wie konnte er es wagen, ihre Angst einfach abzutun. Früher war er einfühlsam und liebevoll gewesen; diese harte Seite hatte er noch nie gezeigt, und wenn sie ehrlich war, erinnerte er sie in diesem, aber natürlich nur in diesem Moment an den Vermieter. Als sie gerade auflegen wollte, rief er noch, sie solle doch den Vermieter mal zu Kaffee und Kuchen einladen, dann würde sich sicher alles klären. Fast musste sie lachen, weil dieser Vorschlag so demütigend war; gerade hatte der Vermieter ihr die Kleider gestohlen, die sie an den privatesten Stellen ihres Körpers trug, hatte sie also praktisch entehrt, und da sollte sie ihm Erdbeertorte mit Schlagsahne auftischen. Nicht Erdbeertorte, rief der Sohn, es ist doch gar keine Erdbeerzeit mehr, mach ihm doch Pflaumenkuchen vom Blech, den wünsche ich mir auch, wenn ich mal wieder auf Besuch komme, hörst du. Fast hätte sie noch gesagt, am Sankt-Nimmerleins-Tag meinst du, aber diese Spitze verbot sie sich, sie legte einfach auf und schaute weinend in der Küche, ob sie alle Zutaten für einen Pflaumenkuchen beisammen hatte, Zwetschgen waren noch genug da, die hatte sie um diese Zeit immer im Haus, alles andere reichte auch, und unter bitteren Tränen band sie sich die Schürze um und backte für den Vermieter ihren besten Zwetschgenkuchen. Als er fertig war, schlug sie Sahne, der hefige Duft ließ sie nur noch heftiger schluchzen, setzte Kaffee auf und rief den Vermieter an.
Ja hallo, sagte eine fremde Stimme.
Nein, sagte sie, ich muss den Vermieter sprechen.
Ich bin seine Frau, sagte die Stimme, er ist gerade nicht da, mit wem spreche ich denn.
Nein nein, rief sie noch einmal, ich habe gerade den Kuchen aus dem Ofen geholt, er muss jetzt kommen, das hat auch mein Sohn gesagt.
Ich verstehe nicht ganz, sagte die Stimme freundlich, sagen Sie mir doch einfach Ihren Namen, ich richte dann gern etwas aus.
Da legte sie auf. Den Kuchen aß sie allein, obwohl ihr der Appetit vergangen war. Drei Stücke brachte sie noch ihrer Nachbarin, die sich freudig bedankte und den Kuchen lobte, aber trösten konnte sie das nicht.
Seitdem versucht sie, mit dem Vermieter zu leben. Sie sieht ihn nie, aber sie spürt seine Gegenwart ständig. Morgens holt sie die Zeitung nicht mehr hoch, um ihn nicht zu wecken. Während sie frühstückt, hört sie, wie er draußen aufwacht und in seinen Habseligkeiten kramt. Manchmal fragt sie sich, was seine Frau wohl dazu sagt, dass er nun bei ihr lebt. Wenn sie nachmittags einkaufen geht, warnt sie ihn laut durch die Tür, und er schafft es jedes Mal, alles rechtzeitig frei zu räumen, als hätte es ihn nie gegeben. Abends, wenn sie fernsieht, hat sie sich angewöhnt, den Fernseher lauter als nötig zu stellen, damit auch der Vermieter da draußen im dunklen Treppenhaus etwas hört. Und wenn ihr Sohn, der sie seit dem Spätsommer noch nicht besucht hat, am Telefon mit einem scherzhaften Unterton fragt, wie es denn dem Vermieter gehe, ob der Pflaumenkuchen ihm denn geschmeckt habe, dann sagt sie nur, so ruhig wie möglich: Es geht ihm gut.
Demnächst wird sie ihn fragen, ob sie seine Wäsche mitwaschen soll. Wenn sie sich traut.
AusgangDu musst besser zuhören, herrscht sie die alte Dame an. Sie sitzen in einem Teehaus mit Blick auf das Watt, Tochter und Mutter, jede einen Pott frisch aufgebrühten Tee vor sich, es ist sehr still. Draußen fährt der Wind durch die Büsche, über die Salzwiesen und durch die Haare der unermüdlichen Touristen, die im Garten Tee trinken, aber die Fenster sind geschlossen, und man hört nur die Schritte der Aushilfskellnerin auf dem dunklen Parkett, manchmal das Rascheln einer Zeitung oder ein Husten.
Bisher waren auch die Tochter und die Mutter still, sie haben sich Tee eingeschenkt und über das Watt geblickt, wie es alle tun, die hierher kommen, aber dann hat sie etwas gesagt, die Mutter hat nichts gehört, und nun beugt sie sich vor und wiederholt sehr laut, was sie gesagt hat: Die Leute draußen sitzen im Wind.
Ja, sagt die Mutter, im Wind.
Du brauchst nicht zu wiederholen, was ich gesagt habe, sagt sie. Es ist eine Schärfe in ihrer Stimme, unter der man sich wegducken will, aber die Mutter hält sich weiterhin aufrecht, sie hat einen schmalen, geraden Rücken und einen ausgetrockneten, knöchernen Kopf mit wenigen Haaren, die sorgfältig zu einem Scheitel gekämmt sind.
Ja ja, macht die Mutter. Es ist eher ein Geräusch als eine Bemerkung, ein geduldiges, vorwurfsfreies stimmhaftes Seufzen. Es versetzt sie in kalte Rage.
Wie, ja ja, stößt sie hervor, warum sagst du ja ja, was soll das heißen. Jetzt sag doch auch noch so so, na mach schon, ein sinnloses Gequassel ist das, warum machst du das.
Die Mutter schaut ratlos in ihr Gesicht, dann auf die blau gemusterte Teetasse. Sie nimmt ein Stück Kandis und lässt es in den Tee gleiten, dann ein zweites, das sie sich in den Mund schiebt.
Ende der Leseprobe