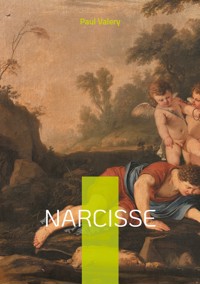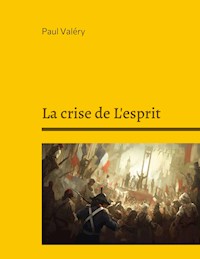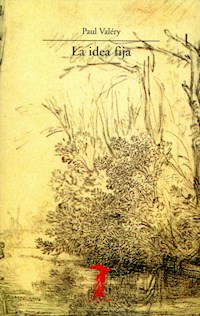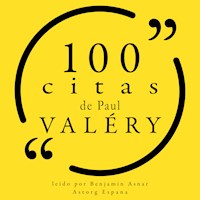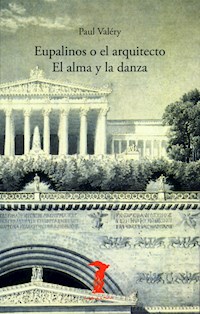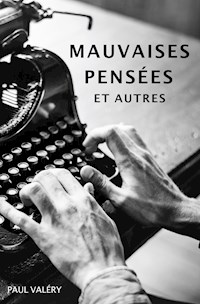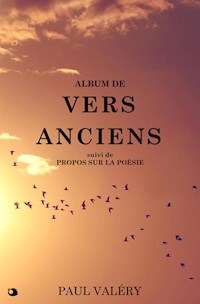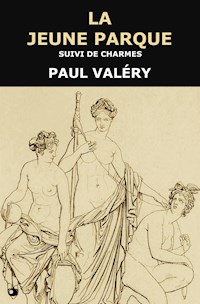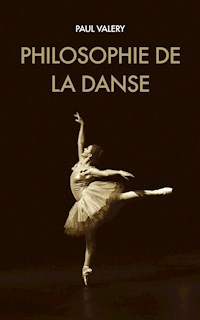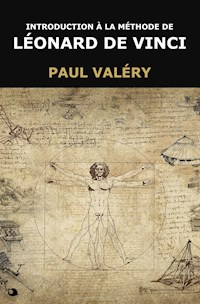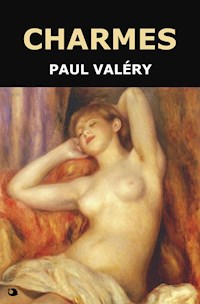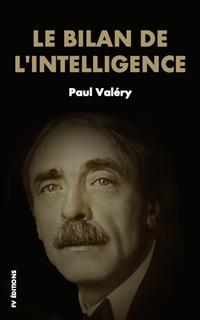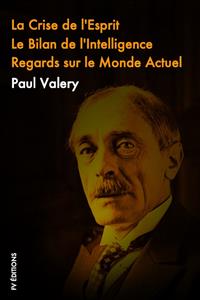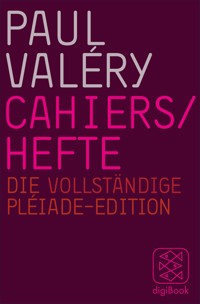
99,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER digiBook
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Eines der größten Gedankenexperimente des 20. Jahrhunderts – zum ersten Mal gesammelt in einem E-Book! Zu Lebzeiten galt Paul Valéry als größter französischer Lyriker seiner Zeit. Sein eigentliches Hauptwerk sind aber die postum veröffentlichten ›Cahiers‹. Fast täglich und über ein halbes Jahrhundert lang begann er jeden Morgen damit, dass er sich in seine »Denkhefte« Notizen, Beobachtungen und Einfälle notierte. Sie sind ein einzigartiges Denklaboratorium des modernen Menschen und nicht nur ein Paradebeispiel lebensphilosophischer Selbsttherapie, sondern eine Antwort auf die große Frage: »Was kann ein Mensch?« In der E-Book-Edition liegt die gefeierte deutsche Edition der ›Cahiers‹ wieder geschlossen vor, zum ersten Mal mit Volltextsuche!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 4406
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Paul Valéry
Cahiers/Hefte
Die vollständige Pléiade-Edition
Über dieses Buch
Eines der größten Gedankenexperimente des 20. Jahrhunderts – zum ersten Mal gesammelt in einem E-Book.
Zu Lebzeiten galt Paul Valéry als größter französischer Lyriker seiner Zeit. Sein eigentliches Hauptwerk sind aber die postum veröffentlichten ›Cahiers‹. Fast täglich und über ein halbes Jahrhundert lang begann er jeden Morgen damit, dass er sich in seine »Denkhefte« Notizen, Beobachtungen und Einfälle notierte. Sie sind ein einzigartiges Denklaboratorium des modernen Menschen und nicht nur ein Paradebeispiel lebensphilosophischer Selbsttherapie, sondern eine Antwort auf die große Frage: »Was kann ein Mensch?« In der E-Book-Edition liegt die gefeierte deutsche Edition der ›Cahiers‹ wieder geschlossen vor, zum ersten Mal mit Volltextsuche!
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Paul Valéry, geboren am 30. Oktober 1871 in Sète, Languedoc-Roussillon, starb am 20. Juli 1945 in Paris. Er war ein französischer Lyriker, Philosoph und Essayist. Seine Gedichtsammlung ›Charme‹ wurde 1925 von Rainer Maria Rilke ins Deutsche übertragen. Zu seinen bekanntesten Werken gehören, neben den ›Cahiers‹, ›Monsieur Teste‹ und ›Mein Faust‹.
Impressum
Die hier zugrundegelegte französische Ausgabe der Cahiers erschien 1973 und 1974 in der Bibliothèque de la Pléiade in zwei Dünndruck-Bänden
© Editions Gallimard, Paris, 1973 und 1974
Für die deutsche Ausgabe: © S.Fischer Verlag GmbH, Hedderichstraße 114, D-60596 Frankfurt am Main
ISBN 978-3-10-403486-7
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Danksagung
Einleitung zur deutschen Ausgabe
Funktion und Möglichkeit des Denkens
Dichtung und Wissenschaft
Das Instrument des Bewußtseins
Welche literarische Gattung?
Ein Denken ohne Poesie?
Titel und Themen
Denken und Schrift
Zur Übersetzung
Textgestalt und Anmerkungen
Vorwort zu diesem Band
DIE HEFTE
EGO
Kapitelfortsetzung
Kapitelfortsetzung
EGO SCRIPTOR
GLADIATOR
SPRACHE
ANHANG
II
Vorwort zu diesem Band
Zu den Illustrationen
PHILOSOPHIE
Kapitelfortsetzung
Kapitelfortsetzung
Kapitelfortsetzung
SYSTEM
THETA
Kapitelfortsetzung
ANHANG
Danksagung
III
Vorwort zu diesem Band
PSYCHOLOGIE
Fortsetzung des Kapitels
Fortsetzung des Kapitels
SOMAUNDKÖRPER/GEIST/WELT
SENSIBILITÄT
GEDÄCHTNIS
ANHANG
IV
Vorwort zu diesem Band
Zu den Illustrationen
ZEIT
Fortsetzung des Kapitels
TRAUM
Fortsetzung des Kapitels
BEWUSSTSEIN
AUFMERKSAMKEIT
DAS ICHUND DIE PERSON
AFFEKTIVITÄT
ANHANG
V
Vorwort zu diesem Band
EROS
Fortsetzung des Kapitels
BIOS
MATHEMATIK
WISSENSCHAFT
GESCHICHTE UND POLITIK
Fortsetzung des Kapitels
UNTERRICHT
ANHANG
VI
Vorwort zu diesem Band
Zu den Illustrationen
KUNST UND ÄSTHETIK
POIETIK
POESIE
LITERATUR
GEDICHTE UND KLEINE ABSTRAKTE GEDICHTE
THEMEN
Homo
ANHANG
Übersetzungsnachweis
Danksagung
Die Herausgeber möchten an dieser Stelle allen Übersetzern, die an den Übertragungen der Gedanken Valérys ins Deutsche mitgearbeitet haben, für die große Mühe danken, der Klarheit der französischen Vorlage gerecht zu werden.
Für mannigfache Unterstützung, Ermutigung und Beratung gilt unser besonderer Dank den Angehörigen Valérys: Frau Agathe Rouart-Valéry, Herrn Claude Valéry und seiner Frau Judith Robinson-Valéry sowie Herrn François Valéry. Die Erben des Autors haben uns in liebenswürdiger Weise die Wiedergabe von Illustrationen und Handschriften gestattet.
Die Initiative zu dieser Ausgabe der Hefte (Cahiers) von Paul Valéry in deutscher Sprache ging von Herrn Günther Busch, Wissenschaftslektor im S. Fischer Verlag, aus. Ihm sei hier für die gute Zusammenarbeit gedankt.
Verlag und Herausgeber danken dem Deutsch-Französischen Institut in Ludwigsburg und der Robert-Bosch-Stiftung in Stuttgart für die freundliche Unterstützung des Projekts.
Einleitung zur deutschen Ausgabe
»Diese Arbeiten präsentiere ich als einen Versuch und diesen Versuch als das Zeichen der Verwunderung, die mich überkam, als ich feststellte, daß man ihn niemals zuvor unternommen hatte.«
Paul Valéry, 1898
»Was Valéry gemacht hat, mußte einmal versucht werden.«
Henri Bergson, 1935
»Und es wird dies sein eine Sammlung ohne Ordnung, zusammengeholt aus vielen Blättern, welche ich hier abgeschrieben habe, hoffend, sie später jedes an seinen Platz zu bringen gemäß der Materie, von der sie handeln; aber ich glaube, daß ich vorher eine selbige Sache noch mehrmals werde zu wiederholen haben, wofür du, Leser, mich nicht tadeln mögest, denn der Sachen sind viele, und das Gedächtnis kann sie nicht alle behalten und sagen: das will ich nicht mehr schreiben, weil ich es früher schon geschrieben habe.«
Leonardo da Vinci,Traktat über Malerei
Das Unternehmen der Cahiers entzieht sich schnellem Zugriff. Weder das Ziel noch die Methoden, weder der Stil noch die Gattung sind eindeutig. Nur soviel schält sich bald schon heraus: die Methoden sind wichtiger als das Ergebnis, Stil und Gattung bilden sich im Prozeß des Schreibens, allmählich, Zug um Zug.
Das Ganze hat den Charakter einer weit ausholenden Geste, eines langen Umwegs, auf dem man das Ziel immer vor Augen hat, es aber mit sich trägt – und eben deswegen niemals erreicht. Ein moderner Weltentwurf, bei dem das Instrument der Erkenntnis zugleich das vornehmste Objekt der Erkenntnis ist. »Meint ihr denn, ich sei mein Leben lang vor Tau und Tag aufgestanden, nur um zu denken wie alle anderen …?« In diesem Satz eines alten Gelehrten, den Valéry belustigt notiert, erscheint in ironischer Verkürzung etwas von den eigenen Energien, die das Projekt der Cahiers vorangetrieben haben: die ebenso unersättliche wie skrupulöse Neugier des Denkens auf sich selbst, die allmorgendliche Experimentierlust mit Ideen und Worten, das lebensnotwendige Ausspielen des Möglichen gegen das Wirkliche.
Funktion und Möglichkeit des Denkens
Was Valéry beschäftigt, ist die Ergründung des Denkens. Damit nimmt er teil an dem durchaus unabgeschlossenen Abenteuer des absoluten Bewußtseins, das von Descartes (den er verehrte) begonnen und von den Denkern des Deutschen Idealismus (die er ignorierte) fortgesetzt worden war. Daß er den Anstoß dazu nicht aus den Schriften des Cartesius, sondern aus einem Satz Edgar Allan Poes empfing, ist akzidentell, ist lächelnd vermerkte Anekdote. Valéry macht vorsätzlich und hartnäckig die res cogitans zur res extensa. Was ihn interessiert, was ihn im zweiten und dritten Drittel seines Lebens täglich für einige Morgenstunden an den Schreibtisch treibt, er nennt es »fonctionnement de l’esprit«, die Funktionstätigkeit des Geistes. Die Art und Weise, wie er sich den Grundfragen: »Was tue ich, wenn ich denke?« und: »Was kann ich überhaupt?« nähert, hat zwei biographische Komponenten. Er handelt einerseits als ›Kind seiner Zeit‹, der Epoche nämlich, in der die neuen Wissenschaften und ihr Aufschwung die Menschen faszinieren. Eigentlich ist er darin der Erbe eines früheren, von ihm geliebten Zeitalters: des 18. Jahrhunderts. Als Deuter und Praktiker des Denkens ist Valéry Szientist, genauer: ein extrem skeptischer Wissenschaftsverehrer. Andererseits liegt über seiner Analyse des Geistes ein traumatischer Erlebnisschatten, der Schmerz einer Lebenskrise, die den Zwanzigjährigen nach einer Liebesbeziehung, welche »verunglückt« gar nicht genannt werden kann, weil sie nie wirklich begonnen hatte, während einer Gewitternacht in Genua in einen derartigen Wirbelsturm der Gefühle hineinriß, daß er alsbald zu einer verheerenden »Idolzertrümmerung« schritt: er stieß für sich die Literatur vom Sockel, und fortan war er lebenslang damit befaßt, sein Wesen »neu zu errichten«. Was er später – zögernd, weil verfänglich – sein »System« nennen wird, ist in seinem eigenen Bewußtsein und erklärtermaßen immer ein »System ’92« (die hier weit geöffneten Türen zum Unbewußten sind seither mehrfach durchschritten worden; zurückgebracht wurde wenig mehr, als auch in den Heften steht).
Dichtung und Wissenschaft
So könnte denn diese Revolte, diese Umwertung der Werte, als der Ausdruck einer Adoleszenzkrise erscheinen, hätte sie sich nicht zu einer unvergleichlichen geistigen Anstrengung verdichtet, die allerhöchstes Interesse beanspruchen darf, und zwar sowohl wissenschaftliches als auch – nach einem langen Transformationsprozeß – wiederum literarisches Interesse. In der Verbindung von beidem liegt Valérys wirkliche, in ihren ganzen Dimensionen erst heute allmählich aufdämmernde Einzigartigkeit, die über die traditionellen Abgrenzungen zwischen den Einzelwissenschaften beharrlich hinausweist und den einen Menschen in allen Lebens- und Denkbezügen zum Gegenstand einer einheitlichen wissenschaftlichen Erkundung zu machen strebt. Damit wird auch eine Neubewertung des Gesamtwerkes dieses Autors erforderlich – das Bild von Valéry als einem Traditionalisten, Rationalisten und Formalisten läßt sich nicht länger aufrechterhalten.
Welche literarische Gattung?
Angesichts dessen ist es kaum verwunderlich, daß man auf die Frage nach der Gattungszugehörigkeit der Hefte in Verlegenheit gerät und mit Hapax oder Novum oder sui generis antworten möchte.
Ein »Tagebuch«, ein Journal intime sind sie jedenfalls nicht; ihr Autor war davon überzeugt, das in den Heften Aufgezeichnete sei das eigentlich Wichtige an seinem Werk. Die Wiedergabe der Ereignisse vom Tage, die Selbstoffenbarung gar fehlen zwar nicht ganz (Valéry notierte derlei unter dem Titel Ephemeriden, und wir wissen nur, daß davon vieles noch unveröffentlicht ist), aber erscheinen beiläufig, am Rande. Bezeichnend wohl, daß die Eintragungen morgens und nicht abends erfolgten: sie waren der Zukunft zugewandt. Sie haben kaum etwas gemein mit den Tagebüchern eines Camus, eines Pavese, eines Léautaud oder Julien Green, eines Kafka, Döblin oder Thomas Mann, auch nicht mit dem Tagebuch André Gides, das Valéry selbst in seinen späten Jahren mehrfach zum Vergleich heranzieht, freilich nur, um mit Verwunderung die Unvergleichbarkeit zu vermerken. Allenfalls zu Musils Ingenieursmentalität und ihrem Reflexionsgestus gibt es eine Art Nachbarschaft. Eine andere Konstante differenziert noch stärker: Valéry lamentiert kaum einmal über Schriftstellerkollegen. Das hat mit der besonderen Auffassung von Stolz zu tun, die Valéry entwickelt, mit seinem Autonomiestreben – und mit seiner Einsamkeit, einer erschreckenden, grandiosen Einsamkeit, die – wahrhaft erstaunlich – die Voraussetzung gewesen zu sein scheint für seine ungewöhnliche Geselligkeit. Eitelkeit, Geltungsbedürfnis und Scheelsucht scheinen ihn nicht bestimmt zu haben. Er war einsam und soziabel zugleich – darüber hat er sich selbst immer von neuem gewundert. Ist in den meisten modernen Schriftstellerkladden schließlich das wichtigste Anliegen ein Grübeln über den Tod, so ist dieses Thema in den Heften nur eines unter anderen.
Aus älteren Epochen mag man zum Vergleich auf Lichtenbergs Sudelbücher verweisen. Darin hätte Valéry wohl manches finden können, was ihn verwandt angemutet haben würde, doch er kannte sie nicht. Und Lichtenbergs Schreibweise steht in der Tradition der humanistischen Aphorismen und Adagia, der Maximen und Reflexionen, der Apophthegmata und Sentenzen der Moralistik, mit denen Valéry zwar manches Stilistische verbindet, aber nicht mehr die Intention. Montaigne scheidet gänzlich aus, Valéry hat ihn mit fast befremdlicher Verachtung belegt. Der große Gedankensteinbruch Leopardis, der Zibaldone, mag in Erwägung kommen, doch nimmt man einen zentralen Satz heraus wie diesen: »Die Vernunft ist die Feindin der Natur; dieser exzessive Gebrauch der Vernunft, der nur dem Menschen eigen ist, und zwar dem verdorbenen Menschen«, so erkennt man sofort, wie unvereinbar dies mit Valérys Auffassungen ist. Bleiben als einziges wirkliches und auch anerkanntes Vorbild die Notizbücher Leonardos: kein Wunder, wenn Valéry 1896 und auch später in immer neuen Ansätzen sich mit dem bewunderten Konstrukteur identifiziert, vielmehr diesen mit sich. Bleibt, was Umfang und Universalität eines nachgelassenen Werkes angeht, unter den Zeitgenossen dasjenige von Charles Sanders Peirce, das jetzt allmählich ans Licht kommt.
Verfolgt man aus einigem Abstand die anhaltende Befriedigung eines tief rätselhaften Bedürfnisses nach Autopsie, wie sie sich in den Heften abbildet, ein Geschehen, das gelegentlich Züge der Selbstkasteiung annimmt, so festigt sich der Eindruck, man wohne einem Prozeß der Selbstreinigung und Selbstaufklärung bei. Durch zähe Arbeit an sich selbst gewinnt hier jemand – wider alle Wahrscheinlichkeit – eine außerordentliche innere Freiheit, in manchen Momenten fast so etwas wie irdisches Glück, was gewiß durch Einsamkeit teuer erkauft wurde, aber um so unanfechtbarer ist, als es auf keines anderen Kosten ging.
Ein Denken ohne Poesie?
Dieser Gesundungsprozeß, so hypothetisch er sein mag, ist eine Konstante der Hefte, und er ist untrennbar verknüpft, ja vielleicht identisch mit der Wiedergewinnung der dichterischen Dimension. Nichts falscher als die These von den Cahiers sans poésie, aus denen die Einbildungskraft verbannt wäre. Valéry war nicht das, was Leonardo – reichlich unglaubhaft – zu sein behauptete: ein uomo senza lettere. Der Leser sei eingeladen, seine Aufmerksamkeit gerade für die Textstellen zu schärfen, an denen es Valéry gelingt, seine Begriffe und Analysen »zum Singen« zu bringen. In jedem beliebigen Zusammenhang kann es geschehen, daß der Ton sich plötzlich verändert, hebt, Rhythmus und Melodie annimmt und uns teilhaben läßt an jenem état chantant, der Valéry so viel bedeutet. Wo dieser Gestaltwandel von strenger Analyse zu poésie brute – meist unvermutet – stattfindet, haben wir es mit den schönsten und eigentümlichsten Elementen dieser Notizen zu tun, mit der »Vollkommenheit des Unvollkommenen«, dem charakteristischen Glück des »endgültig Vorläufigen«, des »Könnens-ohne-zu-müssen«, des Potentiellen.
Und nichts sollte den Leser hindern, sich von dieser Erfahrung aus den großen Dichtungen Valérys zu nähern, sich aufgefordert zu wissen zu einer neuen Lektüre der Jungen Parze oder des Friedhof am Meer, der Dialoge oder des Faust-Zyklus, sie zu lesen als »Abscheidungen« aus der Funktionstätigkeit des Geistes, als je besondere Phasen der allgemeinen Poiesis.
Denken und Schrift
Bereits die erste gedruckte Ausgabe der Cahiers in der Bibliothèque de la Pléiade machte deutlich, wieviel von der originalen Handschrift (Phänomene des Schreibprozesses, Anordnung der einzelnen Seite, Skizzen, Entwürfe, Aquarelle, die Ästhetik der Schriftzüge) verloren gegangen war, wenn man auf die Faksimile-Ausgabe des Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S.) zurückblickte. Das stimulierend Fragmentarische der Gedankenblöcke, die Chronologie des Gedachten, die direkte Formulierung im Soge des Denkens lassen sich im Druckbild nicht bewahren. Valérys Vorgehen hat ja darin bestanden, das »wahre Denken« so authentisch wie irgend möglich schriftlich zu protokollieren (darin teilt er das Bemühen anderer Zeitgenossen). Ist das gesprochene Wort ein Transportvehikel, mittels dessen der Gedanke aus einem Kopf in einen anderen gelangen kann, so ist die Schrift, die diesen Transport auch für eine spätere Zeit garantieren soll (sagte Valéry nicht, er arbeite für jemanden, der später kommen werde?), gleichzeitig mit dieser Garantie eine zweite Reduzierung, Verarmung.
Die Handschrift freilich läßt den aufregenden Verschriftungsprozeß erkennen. Wie im Gebrauch der Sprache gibt es auch beim Schreiben ein Aufbegehren gegen die »von anderen« gesetzten Regeln und Zwänge. Vor allem durch eigenwillige Interpunktion – den typischen eiligen, daher gestreckten Gedankenstrich –, durch Ellipsen, Inzisen, Abstände, Ergänzungen usw. versucht die Handschrift sich zusätzliche Ausdrucksmittel zu verschaffen, die Graphie zum Graphischen hin zu überschreiten, Platz für das Ungedachte zu reservieren, den Leser nach- und vordenken zu lassen. Die Typographie kann da kaum mithalten. Ihre Bemühung, qualitative Garantie in quantitative zu verwandeln, geht unweigerlich mit weiterer Verarmung einher. Dies war ja der Grund, weshalb der C.N.R.S. seinerzeit die Cahiers in Faksimile ediert hatte. Auch die große kritische Ausgabe (einstweilen der ersten zwanzig Jahre), die ab 1987, herausgegeben von Judith Robinson und Nicole Celeyrette-Pietri in Zusammenarbeit mit einer internationalen Forschergruppe, am C.N.R.S. in zwanzig Bänden erscheinen und viele Abbildungen, Handschriften usw. enthalten wird, kann die unmittelbare Anschauung der Handschrift nicht ersetzen.
Diesem zunehmend Fragmentarischen, dieser Entropie (die ja schon in den älteren auszugsweisen Veröffentlichungen zu spüren war: Cahier B 1910, Schlechte Gedanken und andere, Windstriche u.a.) steht indessen die Zusammenfassung in thematischen Rubriken mildernd gegenüber. Jede einzelne Rubrik durchläuft die volle Periode der Hefte von 1894 bis 1945, markiert also neben der thematischen Ordnung jedesmal eine geschlossene Chronologie. Es sind so nicht weniger als einunddreißig längsschnittartige, spezialisierte Denk- und Lebensläufe, denen der Leser nachgehen kann, und er wird schon nach dem dritten oder vierten sich in die Lage versetzt sehen, Querverbindungen zu ziehen, zu den Ketten das Schußgarn zu liefern, die »Phasen« und ihre Ablösung zu erkennen, Phasen der Anspannung und der Lockerung, der Geselligkeit und der Isolierung, der Weltverfluchung und der Weltzuwendung, der »Reinheit« und der »Mischung«, der Einsamkeit und der Hinwendung zum Eros, ja sogar zur Liebe, der Einsamkeit in der Liebe und der Liebe in der Einsamkeit. Und wenn er den Stoff, die Textur gewoben hat, wird er sie wohl bald als bloßen Kanevas empfinden und auch die Zwischenräume füllen wollen, wird das Vorgedachte und das Nachgedachte zu erraten, zu ergänzen trachten und dabei, ohne es zu wollen und zu merken, seine eigenen Fäden verwenden …
Zur Übersetzung
»Jede Übersetzung, die ihre Aufgabe ernst nimmt, ist klarer und flacher als das Original.« Ob wir dieses Diktum Hans Georg Gadamers für uns in beiden Teilen in Anspruch nehmen dürfen, ist nicht sicher. Flacher gewiß: das wäre – nach Sprache, französischer Sprache, Schrift und Typographie – ja nur der unvermeidliche weitere Abstieg auf die fünfte Stufe der Entropie. Ob auch klarer? Valéry ist – das muß zu unserer Entlastung zunächst gesagt werden – auch im scheinbar ekstatischsten Moment der Niederschrift so gut wie nie unklar. Hier war nichts zu klären. Allerdings stellt sich die Klarheit durchaus nicht immer sofort ein. Valéry – dieser Virtuose, Gladiator – läßt häufig mit spürbarem Behagen die wohltrainierten Muskeln seines Geistes spielen. Und der Leser, der das gesamte syntagmatische, paradigmatische, assoziative Geflecht des Diskurses mit einem Blick erfassen sollte, der müßte eigentlich, wenigstens asymptotisch, der Autor sein. Das kann man nicht verlangen. Und man sollte es daher füglich beim Lesen der Übersetzung auch nicht erwarten. Valéry ist kompliziert, oft sehr kompliziert. Man braucht bei etlichen Passagen zwei oder auch drei, vier Anläufe. Im übrigen gilt es, niemals aus dem Auge zu verlieren, daß diese Eintragungen gar nicht für Leser geschrieben worden sind (oder allenfalls zu einem sehr geringen Teil) und insofern eine ganz besondere Textsorte darstellen.
Unnötig zu betonen, daß das Bruchstückhafte, das Steno- oder Telegraphische einiger Passagen, die Haltung des »Je me comprends« (»Ich weiß ja, was ich sagen wollte«) uns Übersetzer in die Vertracktheiten des verstehenden Rekonstruierens gezogen hat. Man kann den Übersetzer hierbei vielleicht mit dem Interpreten einer älteren Partitur vergleichen, in der bezifferte Bässe, Stimmen, Instrumentation etc. nicht ausgeschrieben sind.
Nicht, daß wir etwa alle Kürzel in Langschrift umgeschrieben hätten. Nur materiell abgekürzte Wörter sind ausgeschrieben worden, wie auch schon in der Pléiade-Ausgabe, und wir haben dazu noch die eckigen Klammern in allen eindeutigen Fällen weggelassen (z.B. phil[osophie]). Solange es das Deutsche erlaubte, sind wir streng nach dem Grundsatz größtmöglicher Textnähe – gerade im Syntaktischen – verfahren. Wenn dennoch die eine oder andere Stelle – und sei es aus Gründen der eigenen Verständigung – »ausgeschrieben« sein sollte, dann, so meinen wir, ausschließlich mit Notenmaterial, das wir an anderer Stelle gefunden haben. Sollte das Ergebnis bisweilen »klarer« ausgefallen sein, als es das Original ist, so muß darin kein Verdienst gesehen werden, wenn man sich die Struktur der Hefte wie oben vorgestellt vergegenwärtigt.
Die übersetzerischen Schwierigkeiten sind nicht zuletzt durch die erstaunliche gedankliche Konsistenz und Persistenz einer Denk-Sprache, die einen hohen Grad an Homogenität der Begrifflichkeit und Terminologie aufweist, gemildert worden. Daß wir dem gerecht zu werden uns nach Kräften bemüht haben, verstand sich von selbst, hat es uns doch oft entscheidend die Orientierung erleichtert. Deshalb steht nicht nur ein Namens-, sondern auch ein Begriffsregister am Schluß jedes Bandes. Starrheit wäre allerdings auch hier vom Übel gewesen – einen Begriff unbedingt immer mit demselben Äquivalent zu übersetzen wäre gegen den Geist der Sache. Valéry selbst hat dazu den Hinweis gegeben: Ein Wort ist, was es ist, nur in seinem Satz. Sonst wird es eine Chimäre, und oft genug eine gefährliche.
Textgestalt und Anmerkungen
Über die Prinzipien der Drucklegung der Cahiers nach den Originalmanuskripten hat Judith Robinson im Vorwort zu ihrer Ausgabe in der Bibliothèque de la Pléiade ausführlich Rechenschaft abgelegt. Diese Prinzipien haben wir für die deutsche Ausgabe übernommen, aber in Zweifelsfällen die Faksimile-Ausgabe herangezogen. Da wir hier jedoch keine kritische, sondern eine Lese-Ausgabe vorlegen wollten, haben wir den Beschreibungsapparat vereinfacht, beispielsweise die Hinweise auf Hervorhebungen durch Randstriche von der Hand Valérys sowie auf die besonderen Arten von Randbemerkungen weggelassen. Mit anderen Worten: jede mit A, B … bezeichnete Fußnote entspricht einer Randbemerkung. Wörter, die in der Handschrift durch großen Anfangsbuchstaben hervorgehoben sind, erscheinen entweder in Kapitälchen oder mit Initialen.
Unser Anmerkungsteil baut dankbar auf den Anmerkungen von Judith Robinson auf, geht jedoch erheblich darüber hinaus; er verzichtet allerdings in der Regel auf die Wiedergabe von Textvarianten. Die Verweise auf veröffentlichte Werke Valérys (wir glaubten, sie dem Leser nicht schuldig bleiben zu dürfen) beziehen sich überwiegend auf die von Jean Hytier besorgte zweibändige Ausgabe der Œuvres (Bibliothèque de la Pléiade) sowie auf die Werke in deutscher Übersetzung, die bereits vorliegen oder in Kürze als »Frankfurter Ausgabe« erscheinen werden.
Hartmut Köhler
Jürgen Schmidt-Radefeldt
Vorwort zu diesem Band
Der vorliegende Band enthält die fünf Rubriken HEFTE, EGO, EGO SCRIPTOR, GLADIATOR und SPRACHE. Ihr inhaltlicher Zusammenhang soll kurz charakterisiert werden.
DIE HEFTE. – Diese ist die einzige der einunddreißig Rubriken, die nicht schon von Valéry selbst erwogen war. Die Einträge wurden von Judith Robinson als eine Art Eingangsreflexion über Sinn und Schicksal der Cahiers zusammengestellt und überwiegend den Rubriken EGO und EGO SCRIPTOR entnommen. So zeigt eine archäologische Ausstellung eingangs Bilder von den Ausgrabungen, ein Cineast seine Arbeitsphotos, ein Theatermacher das Bühnenbauen. Das Durchbrechen oder Überspielen fester Illusionsrahmen, dieses Einblickgewähren, diese Geste des »Seht her – so mache ich es«, gehört zu unserem Jahrhundert.
Man weiß freilich, wie geschickt die Kunst gerade beim Aufzeigen der Illusion neue Illusionen schuf; man weiß auch, wieviel sich mancher auf das Aufzeigen zugute tat. Valéry tut sich nichts zugute: er spricht ja nur zu sich selbst. Der erste Satz der Rubrik, in dem es heißt, auf diesen Seiten wolle er niemandem etwas vormachen, ist auch schon das Programm der geplanten Desillusionierung. Und sich selbst? Kann man denn ein halbes Jahrhundert lang für sich selbst schreiben, ohne sich selbst etwas vorzumachen? Die Frage stellen – so können wir einen berühmten, mit Eleganz ausweichenden Satz von Herrn Teste abwandeln – heißt, sich ein wenig schon in Valéry verwandeln …
EGO. – Was den Leser hier erwartet, ist eine Reise durch das innerste Bewußtsein, das ein Mensch, ein reflexives Wesen, von sich selbst hat. Und der Leser wird sich im Verlauf dieser Katabasis fragen: steht hier die Leidenschaft eigentlich im Dienste der Hellsicht oder umgekehrt? Er wird keine eindeutige Antwort bekommen, wird aber doch wohl zunehmend gewahr werden, daß Ratio stets um so triumphierender auftritt, je dringender Passio nach ihr verlangt, nach Steuerung, Bändigung, Befriedung.
Das, wonach gesucht, gerufen wird, ist im Grunde immer dasselbe: Ideen, »Mittel«, Fähigkeiten. Wozu? Auch das ist einfach zu sagen: zur Befreiung von den »Erpressungen« der Sensibilität. Das ich kann soll an die Stelle des ich bin treten, das Potentielle, das Vermögen an die Stelle des Aktuellen, des Seienden und, vor allem, des Gewesenen. Dies ist Valérys grand design, sein dauerhafter, dauerhaft unmöglicher Daseinsentwurf. Ein asymptotisches Streben: ständig unterwegs zu einer äußersten Grenze. Eine einzigartige Form des Extremismus. Unvermeidlich begleitet von vibrierender Unruhe, die sich in dramatischen Ausbrüchen von Selbsthaß entlädt und durch ganz seltene Augenblicke nicht minder extremen Glücks belohnt, nein: kompensiert wird. Hegels Satz »Die Ungeduld verlangt das Unmögliche, nämlich das Ziel ohne die Mittel« hätte Valéry – nach Weglassen des moralisierenden Teils – sehr wohl für sich meditieren können. Der Kampf gegen die »Erpressungen« der Sensibilität wurde geführt unter der Devise Allem entgehen durch Ideen und verfolgte die Herausbildung einer besonderen »intellektuellen Sensibilität«, die freilich auch eine besondere Art der Kälte und Illusionslosigkeit unter der Gegendevise Tun ohne daran zu glauben hervorrief. Der enormen Anstrengung blieb auf die Dauer der Erfolg in Form einer gewissen Stabilisierung und Verstetigung nicht versagt. Immer noch delikat und fragil genug. Die Abstoßung von der »Person«, vom Jemand, die Aufgabe aller Eigenschaften – keine Rasse, kein Metier, keine Vergangenheit – war der Preis. Oder besser gesagt: die Überführung alles dessen in den Status von Möglichkeiten. Doch diese Möglichkeiten hatten ein Zentrum, einen Sammelpunkt, den Valéry das reine Ich nannte. Und das war für ihn unleugbar eine lebenswichtige Entdeckung, durch welche das bisweilen äußerst bedrohliche Gefühl der Fremdheit gegenüber dem Dasein gebannt werden konnte. Aus der Erkenntnis »Man hat Angst nur vor sich selbst« gelangte das Bewußtsein nach und nach zu einem ungeahnten Grad von Autonomie. Gewiß auch von Autismus. Indessen war der Satz »Meine Methode bin ich« denn doch so etwas wie ein Triumph, oder zumindest das Empfinden, aus einer zerstörerischen in eine aufbauende Phase übergegangen zu sein.
Die zahlreichen methodischen Hilfsmittel bei dieser Ars Magna in Gestalt von Anleihen, analogischen Übertragungen aus Naturwissenschaft und Mathematik – Phase, Reizschema, Invariante etc. – werden später auch zu eigenen Erkenntniszielen. Die Isolierung der Ich-Analyse in einer Rubrik hat die darstellerische Berechtigung einer Allegorie – nicht mehr und nicht weniger. Allerdings ist es die Hauptallegorie, die alle anderen umkreisen.
EGO SCRIPTOR war ursprünglich eine Unterrubrik zu EGO. Der erste Eintrag mit dem Klassifizierungszusatz Ego Scriptor ist von 1930, also erstaunlich spät. Der eigentliche Anlaß zur Verselbständigung der Rubrik dürfte darin gelegen haben, daß das Scriptor-Ich inzwischen wenigstens drei Funktionen zu erfüllen hatte, und zwar sehr verschiedene, die miteinander in Konflikt lagen: das Schreiben der Denk- und Ich-Analysen, das Schreiben von Dichtung und das Schreiben von »Literatur«. Das aber mußte verteidigt, gerechtfertigt werden, denn es kam einem Abstieg durch ebenso viele Weltenalter gleich: die goldene Zweckfreiheit, die silberne Bindung an die Form, die eiserne Fron der Auftragsprosa. Reinheit, Kompromiß, Kompromittierung … Genus sublime, medium, humile … Und im letzten Eintrag der Rubrik, April 1945, wird es eingestanden: alle drei Genera haben dennoch in engstem Austausch miteinander gestanden.
Das Geheimnis der Dreifaltigkeit des Schreibens – für sich, für ideale und für andere Leser – ist in seinem tiefsten Ausdruck vielleicht in der Gegenüberstellung zweier Einträge dieser Rubrik faßbar: »Die schönste Dichtung hat immer die Form eines Monologs«. – » Das Denken in der Einsamkeit kennt keine Phrasen. Es kennt nur Sätze von schrecklicher Nacktheit. Es gibt Dinge, die sind für den wirklich Alleinseienden unmöglich. Und je schöner sie sind, desto weniger sind sie für sich; und um so mehr verlangen sie nach einem Anderen.« Das Problem des Schreibens, das Hin- und Herwandern zwischen Einsamkeit und Markt, zwischen Mystik und Ästhetik, zwischen Sein und Scheinen kann kaum zutreffender, ehrlicher ausgedrückt werden.
GLADIATOR. – Das Thema dieser Rubrik ist durch Gestalten der Mythologie Valérys (Herr Teste, Leonardo) schon vorgezeichnet, bevor der Gladiator in seiner ganzen Größe (ausgeschrieben seit 1916) auf den Plan tritt. Ein zentraler Ausgangspunkt ist die Idee vom Übermenschen, vom Willen zur Macht des Intellekts, vom Ecce homo und der Umwertung aller Werte; so gesehen, gewinnt Gladiator die Züge eines Zarathustra, der dem Leser/Hörer die Maximen einer »sportlichen Philosophie« nahelegt: Körper, Geist und Sinne müssen in höchstem Maße trainiert und dressiert werden wie bei einem »animal intellectual« oder Rassepferd. Bewußtsein und Bewußtheit, Denken und Handeln müssen durch gezielte Erziehung zu einem Höhepunkt an Reinheit, Einzigartigkeit und Wirtschaftlichkeit gebracht werden. Welche Mittel das Ich zu diesem Ziel fuhren? Übungen in Mathematik (Analysis, Kopfrechnen), in der Musik (Kombinatorik von Noten, Beherrschung eines Instruments), im Zeichnen (modellartiges Abbilden der Wirklichkeit), in der Sprachverwendung (Verse machen, Sprachkritik).
Damit werden die Grenzen des Möglichen angegriffen, das Ich steigert sich im Anspruch an sich selbst, an sein rational gesteuertes Denken; es wird gottähnlich (Jupiter), Idol und Genie, erkennt sich aber kritisch in seinem Stolz und Größenwahn. An Vorbildern ist kein Mangel: Cäsar, Tiberius, Leonardo, Goethe, Wagner, Poe, Mallarmé, Nietzsche …
SPRACHE. – Was ist und wozu dient mir und meiner Erkenntnis die Sprache? Inwiefern determiniert eine bestimmte Sprache mein Denken, und welchen Einfluß kann ich meinerseits auf die Sprache und meinen Sprachgebrauch nehmen? Derartige Fragen stellt sich Valéry notwendigerweise beim Schreiben seiner Hefte, ist ihre Antwort doch entscheidend für Erfolg oder Mißerfolg seiner Forschungen: vermittels Schrift das Gedachte zu übersetzen, Gedanken über das »nachgedachte Denken« einem möglichen Leser zu vermitteln.
Eines seiner ersten Hefte (1897) ist ausschließlich der Analyse der Sprache gewidmet, ein anderes wird später (1911) Sprache (L Langage) genannt, und das Sigel L bezeichnet den Stein des Anstoßes, der immer dann wieder ins Rollen kommt, wenn das reine Denken auf die unzulängliche Umgangssprache zurückgreifen muß. Ständig versucht Valéry, den eigenen Sprachgebrauch zu präzisieren, Begriffe zu definieren, die Sprache von Vagheit und falschen Problemen zu reinigen, und er kritisiert scharf den – vor allem philosophischen – Sprachgebrauch.
Das wahre Denken verbirgt sich hinter allem Sprachlichen, wird durch Sprache gefiltert und verfälscht; die innere Sprache und ihre interne Kommunikationsstruktur haben nur entfernt Bezug zur geäußerten Sprache. Ein Ziel muß also darin gesehen werden, die mentalen Funktionsabläufe der Versprachlichung des wirklich Gedachten zu rekonstruieren, der Mechanik des Denkens und der Konstitution von Bedeutung und Sinn der Wörter und Sätze nachzuspüren. Sprache ist aber wesentlich ein transitives Mittel, das nur im Durchgang eine Aufgabe erfüllt, denn vor der Verschlüsselung (vom reinen Denken zum Sprechen) und bei der Entschlüsselung (vom Gehörten zum Verstehen) der Umgangssprache müssen sich Phänomene der Nicht-Sprache einstellen oder wiederherstellen lassen. Verstehen vollzieht sich im Bereich der alltäglichen Kommunikation, indem die sprachlichen Mittel nach Erfüllung ihrer Aufgabe annulliert werden; was jedoch für die poetische Funktion der Sprache keineswegs zutrifft. Sprache ist ein Zeichensystem unter anderen – etwa Musik, Algebra, Gesten, Uniformen, Geld u.a.m. Sie muß somit über zeichenhafte und systematische Eigenschaften verfügen (vgl. Rubrik SYSTEM, Band II). In unterschiedlichen Zeichenmodellen (triadisch etwa: Wort, Sache, Bild) gründet Valéry eine seiner semantischen Theorien auf den Referenzbegriff, unterscheidet jedoch immer wieder zwischen dem formal-funktionalen, dem signifikativen und dem akzidentellen Gesichtspunkt derartiger Zeichenprozesse und -phänomene.
Sofern man nach wissenschaftsgeschichtlichen Bezugspunkten dieser Sprach- und Zeichentheorie fragt, könnte man Namen nennen wie Leibniz, Mallarmé, Bréal, F. de Saussure und die Ideen des Wiener Kreises, L. Wittgenstein u.a. Über die vor allem diachron orientierte Sprachwissenschaft war Valéry zeitlebens enttäuscht. Sein mentalistischer Ansatz, den er auf eigener Intuition begründet, kann für die Psycholinguistik ebenso befruchtend sein wie für die allgemeine Sprachwissenschaft und Sprachphilosophie.
Bei der Erforschung der wahren Elemente und der klaren, einfachen Operationen des Denkens war es Valérys Maxime, »sich nicht durch die Zeichen täuschen zu lassen«. Diese Aufforderung sollte der Leser dieser Rubrik nicht außer acht lassen: kritische Haltung gegenüber allem Zeichenhaften.
Hartmut Köhler
Jürgen Schmidt-Radefeldt
Fußnoten
[1]
Diese Sätze lassen sich als Selbstdefinition für das »Unternehmen« der Cahiers auffassen. Sie lassen sich freilich auch auf Mallarmés Würfelwurf und das dort im Vorwort formulierte Kunstziel einer Annäherung des Schreibens an die Denk- oder Hirnvorgänge »in ihrer Nacktheit« beziehen. Eine folgenreiche Zielsetzung, die Valérys »Unternehmen« prägte und die beispielsweise noch für André Bretons Definition des Surrealismus bestimmend wirkte.
[2]
Zu der von Valéry häufig gebrauchten Begriffstrias »formell – signifikativ – akzidentell« (die »3 Gesetze«) siehe vor allem die Rubrik SYSTEM in Band 2 dieser Ausgabe.
[3]
Valéry hatte leidlich gute Kenntnisse im Englischen und sprach italienisch mühelos. Des Deutschen war er nicht mächtig (im Gegensatz zu André Gide), doch finden sich gelegentlich deutsche Ausdrücke und Begriffe (besonders der Philosophie) in den Cahiers. Alle fremdsprachigen Wörter in den Cahiers haben wir ebenso wiedergegeben, bisweilen mit einer Übersetzung versehen, jedoch nicht im Falle der englischen Begriffe (z.B. egotism, mind, self-cousciousness, strange oder objectivity).
[4]
Dieser Eintrag ist – mit Varianten – abgedruckt in den 1944 erschienenen Propos me concernant (Oe., Band II, 1524; Werke, Band 2, in Vorb., Zu dem was mich betrifft). Dies gilt auch für einige weitere Einträge dieser und der folgenden Rubrik, wird jedoch nicht mehr im einzelnen verzeichnet.
[5]
Nach Voltaire. Vgl. dazu Rubrik EGO, Anm. 208.
[6]
Vgl. die Rubrik SYSTEM in Band 2 dieser Ausgabe.
[7]
Vgl. die Rubrik PHILOSOPHIE in Band 2 dieser Ausgabe.
EGO
Cahiers Bd. XVIII, 537 (1935). Selbstportrait
Strenge der Phantasie ist mein Gesetz. (1894. Journal de bord, I, 25.)
Verstanden habe ich etwas, wenn mir scheint, ich hätte es erfinden können. Und ich weiß es ganz und gar, wenn ich zuletzt glaube, ich sei selbst daraufgestoßen. Die Variationen. Methode. (Ebenda, I, 53.)