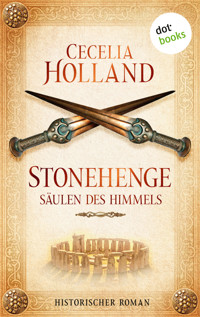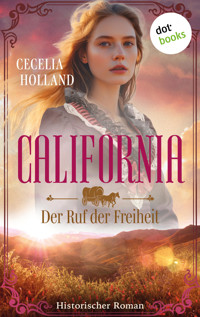
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Liebe in den Stürmen der kanadischen Revolution Kalifornien, 19. Jahrhundert: In der Hoffnung auf ein besseres Leben begibt sich die junge Witwe Cat O'Reilly auf den beschwerlichen Treck in Richtung Westen. In der Kolonie Sutter's Fort kann sie sich die Position als Buchhalterin erkämpfen – doch die Männer im Fort sehen in ihr nur eine schwache Frau, die sich unterzuordnen hat. Allein der stoische Graf Sohrakoff bringt Cat Respekt entgegen und nach und nach entspinnt sich eine zarte Liebe zwischen den beiden. Als der Konflikt zwischen den Siedlern und den mexikanischen Dons um den Westen sich zuspitzt, entschließt Cat sich, um ihre neugewonnene Freiheit zu kämpfen – doch wird dieser Krieg sie und Sohrakoff für immer auseinanderreißen? Ein mitreißender historischer Roman für alle Fans von Karin Seemayer.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 708
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Kalifornien, 19. Jahrhundert: In der Hoffnung auf ein besseres Leben begibt sich die junge Witwe Cat O'Reilly auf den beschwerlichen Treck in Richtung Westen. In der Kolonie Sutter's Fort kann sie sich die Position als Buchhalterin erkämpfen – doch die Männer im Fort sehen in ihr nur eine schwache Frau, die sich unterzuordnen hat. Allein der stoische Graf Sohrakoff bringt Cat Respekt entgegen und nach und nach entspinnt sich eine zarte Liebe zwischen den beiden. Als der Konflikt zwischen den Siedlern und den mexikanischen Dons um den Westen sich zuspitzt, entschließt Cat sich, um ihre neugewonnene Freiheit zu kämpfen – doch wird dieser Krieg sie und Sohrakoff für immer auseinanderreißen?
Über die Autorin:
Cecelia Holland wurde in Nevada geboren und begann schon mit 12 Jahren, ihre ersten eigenen Geschichten zu verfassen. Später studierte sie Kreatives Schreiben am Connecticut College unter dem preisgekrönten Lyriker William Meredith. Heute ist Cecelia Holland Autorin zahlreicher Romane, in denen sie sich mit der Geschichte verschiedenster Epochen und Länder auseinandersetzt.
Die Website der Autorin: thefiredrake.com/
Bei dotbooks veröffentlichte die Autorin ihre historischen Romane »Im Tal der Könige«, »Die Königin von Jerusalem«, »Die Ritterin«, »Stonehenge: Die Säulen des Himmels«, »Im Schatten der Borgias«, »California: Der Ruf der Freiheit«, sowie ihre Norsemen-Saga mit den Einzelbänden »Der Thron der Wikinger« und »Der Erbe der Wikinger«.
***
eBook-Neuausgabe August 2024
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1990 unter dem Originaltitel »The Bear Flag« bei Houghton Mifflin Company, Bosten. Die deutsche Erstausgabe erschien 1993 unter dem Titel »California« bei Hestia.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1990 by Cecelia Holland
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1993 bei Hestia Verlag KG, Rastatt
Copyright © der Neuausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Covergestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung eines Motivs von © Adobe Stock / MaryAnn sowie mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (lj)
ISBN 978-3-98952-175-9
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Bei diesem Roman handelt es sich um ein rein fiktives Werk, das vor dem Hintergrund einer bestimmten Zeit spielt oder geschrieben wurde – und als solches Dokument seiner Zeit von uns ohne nachträgliche Eingriffe neu veröffentlicht wird. In diesem eBook begegnen Sie daher möglicherweise Begrifflichkeiten, Weltanschauungen und Verhaltensweisen, die wir heute als unzeitgemäß oder diskriminierend verstehen. Diese Fiktion spiegelt nicht automatisch die Überzeugungen des Verlags wider oder die heutige Überzeugung der Autorinnen und Autoren, da sich diese seit der Erstveröffentlichung verändert haben können. Es ist außerdem möglich, dass dieses eBook Themenschilderungen enthält, die als belastend oder triggernd empfunden werden können. Bei genaueren Fragen zum Inhalt wenden Sie sich bitte an [email protected].
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »California – Der Ruf der Freiheit« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Cecelia Holland
California – Der Ruf der Freiheit
Historischer Roman
Aus dem Amerikanischen von Werner Peterich
dotbooks.
Widmung
Für Carolly,
weil es – wie ein weiser Mann einmal sagte – recht selten vorkommt, daß man eine gute Autorin findet, die gleichzeitig eine gute Freundin ist.
Kapitel 1
Unter einem wolkenlos klaren Himmel schritt Catharine Reilly den graubraunen Pfad des South Pass hinan.
Brausend kam der Wind vom Westen herunter, ein mächtiges Wirbeln, das nach hochgerissenem Gras und feuchtem Fels roch. Sie stemmte sich der Wucht des Windes entgegen, der ihr das Haar aus dem Gesicht wehte. Die Sturmböen zerrten an ihrem Mieder, so daß es eng am Körper anlag, und rissen ihre Röcke hoch, die sie schließlich mit beiden Händen unten halten mußte.
Sie hob das Gesicht dem Wind und seiner heftigen Liebkosung entgegen, bis ihre Haut kribbelte. Ihre Haube hatte es längst nicht mehr auf ihrem Kopf gehalten; Catharine hielt sie fest in der Hand und kämpfte sich weiter bis zu ihrem Mann hinauf.
Oben am Hang saß John Reilly, breitbeinig den Skizzenblock auf den Schenkeln, auf einem Felsblock. Den Rock hatte er hinter sich auf den Felsen geworfen und die Ärmel des Hemdes hochgekrempelt. Der Wind hatte sein gelocktes Haar völlig zerzaust. Behände fuhr die Hand mit dem Bleistift über das weiße Blatt vor ihm. Er sah nicht einmal auf, als seine junge Frau neben ihn trat, so vertieft war er in seine Arbeit.
Einen Moment stand sie still da und blickte ihm stirnrunzelnd über die Schulter. Die Zeichnung war gelungen. Mit wenigen kühnen Strichen hatte er den großen, breiten, glattgeschliffenen Trog des South Pass auf das Papier geworfen. Jetzt tauchten unter seiner Hand Bruchstücke des Auswanderercamps auf, die Planwagen und Karren, die für die Nacht zu einer Wagenburg angeordnet worden waren, die kleinen Gruppen von Ochsen und Pferden, die an dem kurzen braunen Gras rupften. In der Ferne sah man die Figur eines Kindes, das mit rudernden Armen den Hang hinunterlief. In diesem Moment hörte Catharine ganz schwach das Jauchzen eines Kindes.
Sie wandte sich vom Camp ab und blickte nach Nordwesten.
In einer langen sanften Steigung führte der South Pass von den Hochebenen des Wind River Range herauf. Tagelang auf dem Wagen sitzend, hatte sie das, was in der Ferne vor ihr aufstieg, beobachtet; angestrengt hatte sie in die Weite geschaut, so, als könnte sie die lang erwarteten Berge mit einem Ruck über den Horizont heben. Im Näherkommen waren sie zwar an kleinen Vorboten vorübergekommen, an mächtigen Felsen, die aus der Ebene hervorbrachen, an flachen, sandigen Hügeln, die ihr die Sicht versperrten. Aber erst jetzt, da sie sich zur Höhe des Passes hinaufgekämpft hatte und dem wilden Wind entgegenstemmte, sah sie sich endlich den Gipfeln gegenüber.
Tief holte sie Atem und ließ die frische Brise in ihre Lungen strömen. Das Land vor ihr fiel so steil ab, als öffnete sich eine Tür vor dem Nichts. Eine ungeformte, chaotische Welt lag im reinen Licht der Sonne vor ihr.
Unterhalb der gleißenden Gipfel ging es in blaues Dunkel hinab, in ein Tal oder eine Ebene, die man mehr ahnte als sah. Dann, aus nicht einzusehender Tiefe, warf sich eine neue steile, schroffe und gezackte Felswoge auf, die wiederum abfiel und sich abermals auftürmte, bis der Horizont alles mit seinem dunstigen Blau verschluckte. Der Wind kam aus diesem Raum heraufgefegt, als wäre er der Atem des großen Felsengebirges.
»Warum zeichnest du das hier nicht?« fragte sie und wandte sich wieder John Reilly zu. Der hob das Gesicht, worauf sie sich hinunterbeugte, ihm die Arme um den Nacken schlang und ihn küßte. Die Wangen an seinem Haar, wiederholte sie: »Warum nicht die Berge zeichnen? Bist du die Wägen denn immer noch nicht leid?«
»Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll«, entgegnete er. Immer noch von ihr umarmt, zückte er wieder den Bleistift und zeichnete ein Stück der vertrauten, schmutziggrauen Planen.
Sie sank neben ihm nieder, schlang die Arme um die Knie und wandte den Blick wieder dem überwältigenden Anblick des Gebirges zu. »Es ist großartig!«
»Es ist zu groß, Cathy. Zu kompliziert zu zeichnen.«
Sie schmiegte sich zufrieden an ihn, den Blick weiter auf die Gipfel gerichtet. Zum ersten Mal auf dieser langen Reise hatten sie einen Ort erreicht, den zu erreichen sich lohnte.
Die Sonne ging unter. Der gezackte Rand des Himmels verfärbte sich nach und nach, die niedrig hängenden Wölken erglühten in einem zarten Rosa, und die Sonne schien mit Pinselstrichen reinsten Goldes das Innere einer Muschel nachzuzeichnen. Unter diesem strahlenden Spiel des Lichts wurde die Erde schwarz, die Schatten wurden vom Dunkel verschluckt, als sammelte die Nacht sie ein.
Plötzlich unruhig geworden, steckte ihr Mann den Bleistift weg und machte den Skizzenblock zu. »Komm, es wird spät!« Er stand auf, reichte ihr die Hand und zog sie hoch.
Hand in Hand gingen sie den Hang hinunter in Richtung Camp. Der Wagen mit all ihrem Hab und Gut bildete die hintere Ecke. Catharine blickte hinauf zu ihrem Mann. Sie waren erst so kurz verheiratet, daß er ihr oft immer noch faszinierend fremd erschien.
Am Lager angekommen, schlug er einen Bogen zur Weide, um ihre Ochsen ins Nachtquartier zu treiben, während sie der Mitte der Wagenburg zustrebte, um die Abendmahlzeit vorzubereiten. Nancy Kelsey war bereits beim Feuer und schnitt Speck in Scheiben; Catharine kniete sich neben sie und begann Maisfladen zu backen.
»Wohin will John eigentlich – nach Oregon oder nach Kalifornien?« fragte Nancy.
Ungeduldig drückte Catharine den Fladenteig in die rechteckige Pfanne. Anfangs hatte ihr die Arbeit im Camp Freude gemacht – ihr, die nie eigenhändig etwas gekocht, nie eine Möhre geschnitten oder eine Kartoffel geschält hatte, machte es plötzlich Spaß zu kochen und zu backen. Inzwischen jedoch versuchte sie, dies so schnell wie möglich hinter sich zu bringen. Hinter sich konnte sie die Männer hören; sie trafen sich am anderen Ende des Lagers und stritten lautstark über das Ziel ihrer Reise.
»Sie müssen sich zu einer Entscheidung durchringen«, meinte Nancy. Sie war eine große Frau mit breiten Hüften und nie ruhenden, tüchtigen Händen. Sie war zwar ein Jahr jünger als Catharine – neunzehn –, aber bereits Mutter; ihr Baby lag auf einer Wolldecke hinter ihr. »Hat John noch nicht mit dir darüber gesprochen?«
»Nicht richtig.« Sie ging davon aus, daß John genau wußte, was zu tun war. Beide hatten sie immer nach Kalifornien gewollt, von Anfang an.
»Ben weiß immer noch nicht recht, was er machen soll, aber schau, Cathy, an dieser Ecke mußt du die Pfanne höherstellen, sonst verteilt sich die Hitze nicht gleichmäßig.« Das klang leicht amüsiert. Vorsichtig hob Catharine die Pfanne an der einen Seite an, so daß die Glut den Teig auch von oben bestrich.
Immer mehr Männer kamen jetzt zusammen. In der Mitte erkannte sie Broken Hand, ihren Führer, dessen richtiger Name Captain Fitzpatrick lautete. Seine Linke war verkrüppelt, seine Kleidung bestand aus zusammengenähten Tierfellen, wie Indianer sie trugen; sein Haar hing ihm zu einem dicken Strang geflochten über den Rücken. Auch John Bidwell war da und Nancys Mann, Ben; gleich darauf sah Catharine mit weit ausgreifenden Schritten auch John kommen. Neugierig geworden, stand sie auf und ging näher heran.
Catharine und John Reilly waren erst seit vier Monaten verheiratet. Zwar stammten sie beide aus Boston, doch war er ein Ann-Street-Ire, sie hingegen eine Mather vom vornehmen Franklin Place; von Rechts wegen hätten sie nie heiraten dürfen.
Kennengelernt hatten sie sich in New Bedford bei einem Vortrag über die Rechte von Farbigen und Frauen in einer Buchhandlung; als Catharine einen Gedichtband kaufen wollte, sahen sie sich wieder. Sie mochte seine Skizzen, und auch sein überlanges blondes Haar und seine breiten Schultern gefielen ihr. Als er von seinem Traum erzählte, in den Westen zu ziehen und selbst Land in der Wildnis urbar zu machen, war tief in ihr etwas erwacht. Plötzlich kam ihr das Elternhaus am Franklin Place wie ein Gefängnis vor.
Wie es sich ziemte, hielt John bald nach dieser ersten Begegnung bei Catharines Vater um ihre Hand an, doch Edward Mather wies ihm die Tür und schloß seine Tochter in ihrem Zimmer ein. Catharine floh über die Dienstbotentreppe und bestieg zusammen mit John Reilly die nächste Postkutsche in Richtung Westen. In New York wurden sie von einem Friedensrichter getraut und reisten weiter nach Saint Louis, wo sie sich von den letzten Ersparnissen einen Planwagen samt Ochsengespann und Vorräten kauften. Für einen Dollar versetzten sie dann Catharines Ehering, um die Fähre über den Missouri bezahlen zu können.
John hatte von einer Gruppe von Auswanderern gehört, die sich an einem Ort namens Sapling Grove irgendwo in Kansas sammeln und nach Oregon aufbrechen wollte. Mit ihrem Wagen und ihren Ochsen trafen John und Catharine im späten Frühjahr in Sapling Grove ein und stießen auf über sechzig Menschen, die bereit waren, in den Westen zu ziehen.
Die meisten von ihnen waren Farmer aus Ohio oder Kentucky, laute, ungestüme Menschen mit schwieligen Händen, die hart zupacken konnten. Angesichts des großen Trecks, der vor ihnen lag, erfaßte sie ein Fieber der Aufregung. Sie tanzten und rannten und schrien aus Leibeskräften, und an dem Morgen, da sie endlich aufbrechen wollten, entdeckten sie plötzlich, daß keiner von ihnen den genauen Weg nach Oregon kannte.
Zum Glück konnten sie sich einer Gesellschaft von katholischen Missionaren anschließen, die Broken Hand nach Westen bringen sollte. Auf diese Weise hatten sie es immerhin bis zum South Pass geschafft. Doch von hier aus mußten die Missionare nach Norden ziehen, um zu den Flachkopf-Indianern zu gelangen, die sie bekehren sollten. Broken Hand begleitete sie selbstverständlich dorthin. Von jetzt an mußten die Siedler also auf eigene Faust weiterziehen.
Broken Hand überragte sie alle. Er hatte sein Leben lang am Rande der Zivilisation gelebt und sah mit seiner Fellkleidung und seinen geschundenen, knotigen Händen aus wie ein Tier dieses Landes.
»Der Weg nach Fort Hall ist von hier aus nicht zu verfehlen. Von dort aus geht’s weiter nach Soda Springs; danach müßt ihr nur noch den Wagenspuren folgen bis ihr zu den ... «
Catharine näherte sich der Gruppe langsam und trat hinter ihren Mann, der bei Broken Hands Worten immer ungeduldiger wurde.
»Wenn ihr an den Snake River kommt, müßt ihr nach der Furt Ausschau halten.«
»Schreibt denn irgendjemand das mit?« rief John Bidwell; allgemeines Gelächter war die Folge. Auch Catharine lachte. Fitzpatrick schien sie alle zu verwirren.
Eine Schulter hochgezogen, den massigen Körper in seine filzigen und abgetragenen Felle gehüllt, hüstelte der alte Präriebewohner und spuckte aus. »Die schwierigste Strecke habt ihr dann hinter euch. Von dort nach Oregon ist es ein Kinderspiel. Auch für so’n unerfahrenes junges Völk wie ihr es seid.«
»Und was, wenn wir nicht nach Oregon wollen?« fragte Ben Kelsey.
»Halt den Mund!« gellte es von der anderen Seite des Kreises. »Ich hab’ nichts gegen Oregon.« Ringsum zustimmendes Gemurmel.
In der Gruppe um Reilly sagte John Bidwell: »Daheim, in Ohio, als wir diesen Treck ins Auge faßten, wollten wir noch nach Kalifornien.«
Mit müder Stimme fuhr Broken Hand fort. »Kalifornien, das is’ was anderes als Oregon. Fast ’n Ding der Unmöglichkeit, dorthin zu kommen, und die spanischen Dons nehm’ auch nich’ gern Amerikaner. Sobald ihr da auftaucht, werf’n sie euch in Kett’n. Hab’ von weißen Männern gehört, die in Mexiko in Kett’n verreckt sind.«
»Die Briten bilden sich ein, ihnen gehört Oregon. Aber das ist auch nicht so sicher, scheint es mir«, warf Ben Kelsey ein.
Aufmerksam geworden, lehnte Bidwell sich vor. »Jetzt paßt mal gut auf! Ich habe gehört, daß der Boden in Kalifornien so fruchtbar ist, daß man bloß auf die Erde zu spucken braucht, und schon wächst’s. Sollte man da nicht ein bißchen was riskieren?«
Fitzpatrick sah ihn wortlos an. Er verfügte über die unendliche Geduld dessen, der genau wußte, was möglich war. Warum sollte er also Mühe in sinnlose Überlegungen stecken? Catharine warf einen raschen Blick auf ihren Mann, der still inmitten der Gruppe saß.
»Hey, Bidwell, wenn du so wunderschön von Kalifornien redest, dann zeig uns mal, wie man dorthin kommt«, ließ sich jemand anders vernehmen.
Genau das war das Problem. Von Sapling Grove an wußte kein Mensch weiter.
Bidwell schob sich in die Mitte des Kreises. Er war ein schlanker junger Mann mit pechschwarzem Haar und einer rastlosen Energie, die ihn selten stillhalten ließ. »Soviel ich gehört habe, gibt es südwestlich von hier einen See ... «
»Einen See gibt es«, lachte Fitzpatrick kurz auf. »Soweit bin ich auch schon gekomm’n.«
»Und einen Fluß, der von dort ausgehend durch die Berge fließt, durch Kalifornien, und dort in den Pazifischen Ozean mündet. Den Rio Buenaventura.«
»Den ›Glücksfluß‹«, übersetzte John Reilly. »Das klingt vielversprechend.«
Aber Broken Hand entgegnete: »Niemand kennt diesen Fluß wirklich. Den See hab’ ich zwar mit eigenen Augen geseh’n, aber da kann kein Mensch leben. Außer Seemöwen und Salzhändlern vielleicht.«
»Wie sieht denn die Strecke bis Oregon aus?« wollte jemand wissen.
»Nicht leicht zu bewältigen«, befand Fitzpatrick. »Erst führt sie durch Snake-River-Land. Mörderisch für Tiere und Wagen, sage ich euch. Aber immerhin, es gibt den Pfad, und den kann keiner verfehlen. Und das will schon was heißen in so einem Land.« Seine Stimme wurde heiser, und er mußte husten. »Die Indianer sind zwar unfreundlich, aber nicht besonders gefährlich.«
John Reilly lehnte sich vor. »Und was ist mit den Indianern, die am Glücksfluß leben?«
Fitzpatrick grunzte. »So ein’ Fluß hab’ ich nie gesehen. Westlich vom Großen Salzsee gibt es nichts weiter als Digger-Indianer. Vor denen braucht man aber keine Angst zu haben – sie sind viel zu arm, um groß Schwierigkeiten zu machen.«
»Nach Kalifornien ist es etwa genauso weit wie nach Oregon, stimmt’s?« fragte Kelsey.
Reilly wandte sich an Bidwell: »Wo hast du von diesem Glücksfluß gehört?«
»Von einem Kerl namens Roubideux oder so.« Aufgeregt fuhr Bidwell zu ihm herum. »Der kennt das Land hier und war schon überall. Er sagt, Kalifornien wär’ das reinste Schlaraffenland, ewig scheint da die Sonne, und es ist warm, kein Winter, wirklich ’n einfaches Leben dort, sagt er. Man reitet aus, erlegt Wild fürs Mittagessen und pflückt Obst von den Bäumen.«
»Du gehst also bestimmt hin, oder?«
Bidwell zuckte nur mit den Achseln. »In Oregon sitzen die verdammten Briten. Wir haben jetzt zweimal Krieg gegen die geführt; kann sein, daß es noch zu einem dritten kommt, und wenn wir den verlieren, werden wohl sämtliche Amerikaner in Oregon gezwungen abzuziehen – oder sie werden wieder Engländer.« Er nickte John Reilly zu. »Kelsey geht, nicht wahr, Ben?«
Rechter Hand von Catharine ertönte Ben Kelseys tiefe Stimme.
»Ich hält’ schon große Lust, es zu wagen. Ich und mein Bruder Jack hier.«
John Reilly nickte Bidwell zu. »Ich schließ’ mich euch an.«
»Freut mich zu hören, Reilly. Wird gut sein, dich dabeizuhaben.« Bidwell drückte ihm kurz die Hand, drehte sich dann um und rief jemand anders etwas zu.
Reilly rieb sich die Hände. Unvermittelt machte er dann kehrt und sah Catharine vor sich. Er trat einen Schritt zurück, griff nach ihrer Hand und zog sie an sich. Sie schmiegte sich an ihn, und er umfaßte ihre Taille. Ringsum vernahmen sie die rauhkehligen Stimmen der Männer, die wie Rauch zum Sternenhimmel aufstiegen. Reilly sah Cathy fest in die Augen. »Wir versuchen hinzukommen, Cathy. Bald werden wir unser eigenes Anwesen haben.« Dann drückte er sie fest an sich.
»Cathy!«
Catharine machte sich los und schaute zu Nancy hinüber. »Ach, du liebe Güte – mein Maisfladen!« Eilends kehrte sie ans Feuer zurück, um ihr Abendessen zu retten.
Kapitel 2
Außer Bidwell, den Brüdern Kelsey und den Reillys beschloß noch ein Mann namens Bartleson, den Aufbruch nach Kalifornien zu wagen. Er brachte seine Söhne, einen Bruder und sechs Büchsen mit. Vornehmlich aufgrund der sechs Gewehre wurde er zum Anführer des Wagentrecks gewählt. Auf einem großen Schecken setzte er sich an die Spitze. Die einzige Frau neben Catharine war Nancy Kelsey mit ihrem Baby.
Fitzpatrick hatte sie auf einen Pfad gewiesen, der in südwestlicher Richtung über eine unfruchtbare Ebene führte. Hier wuchs kein Gras, sondern nur niedriges Buschwerk mit silbrigen Blättern, die das kräftige, wilde Aroma eines Heilkrauts verströmten. Broken Hand hatte ihnen eingeschärft, auf reitende Indianer achtzugeben, da die Arapahos auf ihren Raubzügen manchmal bis hierher in den Westen vorstießen, doch nach ein paar Tagen wurden sie zunehmend sorglos. Sie lagerten bis weit nach Einbruch der Dunkelheit am Feuer und stritten darum, ob sie es ausmachen sollten oder nicht.
Bartleson knurrte: »Dieser Fitzpatrick war schon ein komischer Kauz. Habt ihr irgendwelche Indianer gesehen? Ich glaube, hier gibt es gar keine.« Er wandte den Kopf und spuckte aus. Im Schein des Feuers leuchteten seine roten Backen wie eine Kriegsbemalung. »Dabei hätte ich noch nicht einmal was dagegen. Ich hab’ ein Fäßchen Whiskey auf meinem Wagen, und ein Rudel Indianer könnte mich reich machen – Biber- oder Fuchsfelle gegen Schnaps.«
Wie hingegossen lagerten die Männer bequem um das Feuer. Nancy und Catharine griffen ihre Töpfe und Messer.
Bartleson schielte tückisch nach den anderen Männern. Um ihn herum bildeten seine Söhne und sein Bruder eine dichte Mauer. »Nun? Was sagt ihr?«
Auf der anderen Seite des Feuers, das immer noch hoch zwischen ihnen loderte, schlug Ben Kelsey geräuschvoll die fleischigen Hände zusammen. »Broken Hand war weder alt noch dumm, und du hast ihm nichts von diesem Fäßchen gesagt. Du kennst die Gesetze, die verbieten, den Indianern Whiskey zu verkaufen.«
»Gesetze! Wer spricht denn von Gesetzen? Hier draußen gibt es keine Gesetze. Das hier ist Gottes Land«, lachte Bartleson, bis sein Bauch bebte.
Nancy packte Catharine beim Arm. »Komm mit! Sollen sie sich doch gegenseitig beschimpfen.«
Widerstrebend folgte Catharine ihr hinunter ans Flußufer. Nancy kniete nieder, um einen Topf mit Sand auszuscheuern. Catharine warf einen Blick zurück. »Whiskey verkaufen – die Vorstellung gefällt mir aber gar nicht.«
»Ben sorgt schon dafür, daß daraus nichts wird«, erwiderte Nancy ungerührt.
Und in der Tat vernahmen sie Kelsey in diesem Augenblick. »Es gibt keinen Grund, die ganze Sache noch komplizierter zu machen, als sie es ohnehin ist. Whiskey verkaufen kommt nicht in Frage.« Er stand auf und begann, mit dem Stock die Glut des Feuers auseinanderzuschieben. John Reilly bückte sich, um die Flammen mit Sand zu ersticken. Der Lichtkreis wurde kleiner, und die Männer standen jetzt dichter beisammen. Catharine ging wieder ein Stück näher heran.
Nancy trat neben sie und berührte sanft ihre Schulter. »Halt dich da raus, Cathy.«
»Jetzt mach aber mal ’n Punkt! Du bist schließlich nicht der Anführer hier. Das bin ich«, entgegnete Bartleson wütend.
Kelsey richtete sich auf; die halberstickte Glut beschien ihn kaum bis zu den Knien. Im Dunkel hinter ihm nahmen sein Bruder Jack sowie John Bidwell Aufstellung. Kelsey schob die Daumen in den Gürtel und schaute Bartleson finster an. »Du bist zwar zum Anführer gewählt worden, Bartleson, aber du kannst auch wieder abgewählt werden.«
»Das bildest du dir ein!« Bartleson schob jetzt seinerseits die Daumen in den Gürtel.
»Ob sie jetzt wohl aufeinander losgehen?« fragte Catharine erschrocken.
Beruhigend legte Nancy ihr den Arm um die Taille. »Nein, nein, die brüllen sich bloß an.«
Kelsey und Bartleson standen sich einen Moment Auge in Auge gegenüber, dann schob sich John Reilly zwischen sie.
»Verdammt, was macht ihr? Fitzpatrick hat gesagt, wir wären unbeleckt und junges Gemüse – recht hat er gehabt! Da sitzen wir mitten in der Wildnis und haben nichts Besseres zu tun, als über den Schnaps verkauf an Indianer zu streiten, als wären wir Barkeeper in Boston. Schaut mal dort hinauf!« Er zeigte gen Himmel, woraufhin alle gehorsam den Blick hoben.
»Erkennt ihr den rötlichen Stern dort? Das ist Antares, der Sommerstern. Er wird bald verschwinden. Ihr braucht euch bloß umzusehen: Der Winter naht. Wir sitzen mit Frauen und einem Baby hier, haben nichts zu essen außer dem Wild, das wir schießen können – und da wollt ihr mit Schnaps ein paar lumpige Dollars verdienen?«
Herausfordernd ließ er den Blick in die Runde gehen. Bartleson trat einen Schritt zurück. Das Lächeln war ihm vergangen, er schien ganz klein. Einer seiner eigenen Männer hatte ihm die Hand auf den Arm gelegt und hielt ihn fest. Auch Kelsey sah nicht mehr streitlustig aus; als Reilly ihn ansah, schaute er weg. Es herrschte eine angespannte Stille. Unvermittelt trat Bidwell vor, um das Feuer auszutreten. Ein paar von den anderen halfen ihm. Dunkelheit herrschte plötzlich um sie her, und die Kälte machte sich bemerkbar.
»Gehen wir!« sagte Reilly in die Nacht hinein. »Schlafen wir lieber, damit wir morgen eine gute Strecke schaffen!«
»Ganz meine Meinung«, murmelte jemand, und damit suchten alle ihre Wagen auf.
Später, im Dunkeln, flüsterte sie: »Du bist ein Held.«
Er wiegte sie in den Armen; warm strich sein Atem über ihre Stirn.
»Nein, Cathy! Ich habe mir nur große Sorgen gemacht.« Sein Bart kratzte an ihrer Wange. »Es tut mir leid, dich hier mit reingezogen zu haben, Liebling.«
»Ich bin aber lieber mit dir hier draußen als in Boston beim Kuchenessen«, lachte sie.
»Wir könnten zurückkehren«, schlug er plötzlich ernst geworden vor.
»Nein!« Sie erstarrte und stieß sich von ihm ab. »Nein, zurück auf keinen Fall.« Jetzt umzukehren käme dem Eingeständnis einer Niederlage gleich; damit würden sie zugeben, unrecht gehabt zu haben, und das kam überhaupt nicht Frage.
Er zog sie wieder an sich. »Du bist sehr mutig, Cathy. Aber du weißt nicht, was uns noch bevorsteht. Ich natürlich auch nicht, aber gerade das ist es, was mir Sorgen macht.«
»Kalifornien«, sagte sie. »Vor uns liegt Kalifornien. Erinnerst du dich noch an den Vortrag?« Während ihrer Verlobungszeit waren sie einmal nach Cambridge hinübergegangen, um den Vortrag eines ehemaligen Harvard-Studenten über seine Reisen an den Pazifik zu hören. Sein Schiff hatte in Kalifornien Felle und Talg eingehandelt, und es hatte sich angehört, als herrschten hier in einer gewissen Weltabgeschiedenheit Ruhe und Frieden. Ein verschlafenes Paradies mit Orangenhainen und Lehmziegelhäusern und einer sanft rauschenden Brandung schien auf sie zu warten. »Kalifornien liegt irgendwo dort draußen, wir müssen bloß weiterziehen.«
»Ist es das, was du möchtest?« fragte ihr Mann.
In der dunklen Enge ihres Wagens lag sie an ihn geschmiegt da und dachte über seine sonderbaren Fragen nach. »Ich bin bei dir, und das ist alles, was ich mir wünsche.«
»Du hast mich, trotzdem fehlt dir was. Solange ich dich kenne,
habe ich immer gewußt, daß dir irgendetwas fehlt. Ich wünschte, ich wüßte, was es ist.«
Für einen Moment war sie erschrocken über diese befremdliche Meinung, die er von ihr hatte. Weit draußen in der Wüste ließ ein Wolf sein durchdringendes Heulen vernehmen. Sie legte die Hand auf seine Brust. »Ich möchte etwas Großes tun«, sagte sie. »Etwas Edles. Wie die Menschen, die für die Revolution gekämpft haben. Oder Kolumbus.« Sie mußte über sich selbst lachen. »Aber weißt du, ich geb’ mich auch mit dir zufrieden.«
»Hhmm!« Dieser Humor versetzte ihm doch einen Stich. »Das sind Männerträume. Frauen sind allein deshalb schon edel, weil sie sich mit uns abfinden.« Noch einmal umarmte er sie zärtlich. »Schlaf jetzt, Cathy! Und träum etwas Schönes!«
Sie fanden einen seichten Fluß und folgten seinem Lauf, bis sie auf eine steinige, nur von Beifuß bewachsene Ebene gelangten. Tag für Tag versanken die Berge wieder hinter dem Horizont, und vor ihnen dehnte sich ein flaches, baumloses, trockenes Land. Die Tiere hielten sich an die Flußufer, wo wenigstens ein bißchen Gras wuchs. Tagsüber, wenn sie unterwegs waren, hielt Catharine Ausschau nach kleinen Flächen Gras, schnitt es und hob es im Wagen für die Fütterung der Ochsen auf. Mit jeder Meile wurde der Fluß seichter, und das trübe Wasser roch zunehmend modrig. Das Ufer war jetzt versumpft und starrte von hartem Schilf wie von Speeren. Zwei ihrer Wägen sanken bis an die Radnabe ein, und sie mußten haltmachen, um sie freizuschaufeln, während die Tiere unruhig auf der Suche nach Freßbarem umherzogen. Catharine saß auf Kelseys Wagensitz und hielt Nancys Baby auf dem Schoß, während Nancy selbst den Rock ihres Mannes flickte. Bei der Arbeit stritten die Männer so laut, daß ihre Stimmen über das Knirschen der Schaufelblätter hinweg zu hören waren.
»Herrgott, dies Land ist so sauer wie meine Schwiegermutter. Verdammt noch mal, Bidwell, wo bleibt denn nur dein Glücksfluß?«
»Und ich sag’, wir sollten geradewegs nach Westen halten. Und zwar so schnell wie möglich.«
»Dann veranstalte doch ein Rennen – wirst schon sehen, was du davon hast.«
»Typisch du, Bartleson: klein beigeben!«
»Sie streiten ununterbrochen«, klagte Catharine.
»So sind Männer. Sie bringen den größten Teil der Zeit damit zu, sich herumzuschubsen und dafür zu sorgen, daß keiner aus der Reihe tanzt.« Nancy sah das Ganze viel gelassener.
Ihre Hände bewegten sich kraftvoll und flink, was Catharine richtig neidisch machte. Sie hatte nie nähen gelernt. Könnte sie Nancy nur etwas am Klavier vorspielen, damit ihre Freundin sie auch einmal bewunderte.
Nancy unterbrach ihre düsteren Gedanken. »Ich werde dein Kleid flicken, Cathy, wenn du solange was anderes anziehen würdest?«
Catharine nahm das Baby auf den anderen Arm. »Ist schon in Ordnung.« Sie wollte nicht, daß Nancy auch noch für sie arbeitete. Das Baby rührte sich, wurde wach; warm und schwer lag es in Cathys Armen.
»Du hast so hübsche Sachen«, sagte Nancy. »Du solltest achtsamer damit umgehen.« Da sie lächelte, traf der Vorwurf Cathy nicht so sehr.
»Du mußt mir zeigen, wie ich sie wickeln soll. Sie wacht auf. Was für ein süßes Baby Sarah ist.« Sie liebte das Baby; kein Mensch daheim hatte ein Baby. Sarah schlug die blauen Augen weit auf und setzte ein weinerliches Lächeln auf.
»Hey!« Ein Schrei entrang sich Nancy. »Indianer ... schau ...!«
Catharine riß den Kopf hoch und blickte in die von Nancy angegebene Richtung. Auf dem Kamm der nächsten Hügelkette, die sich wie eine Sandwoge aus dem flachen Bett der Wüste auftürmte, trabten unerschrocken sechs kleine Reiter. Nancy nahm Catharine schnell das Baby aus dem Arm und verbarg es unter ihrem Umschlagtuch.
Die Männer brüllten: »Indianer!«
Bartleson zog mit einem Ruck sein Gewehr aus einer der Satteltaschen und fuchtelte damit in der Luft herum, während Ben Kelsey aus dem Schlamm des Flusses aufsprang. Ohne Umstände griff er an Catharines Rock vorbei unter den Sitz und holte eine Pistole heraus.
»Sie sind weg.« Catharine atmete erleichtert auf.
Kelseys Atem entwich mit einem Grunzton. Er war um einige Jahre älter als Nancy und lächelte nie. Sein strenges breites Gesicht war so stoppelig wie ein abgemähtes Feld. »Die sind nich’ weg. Man sieht sie bloß nich’ mehr.« Er ging hinunter zu den anderen Männern, die oberhalb der eingesunkenen Wagen nebeneinander Aufstellung genommen hatten und nach Westen starrten.
Als die Indianer sich nicht wieder blicken ließen, machten sich die Männer erneut daran, die Wagenräder freizuschaufeln. Es dauerte nicht lange, und sie stritten schon wieder. Die Frauen machten Feuer und buken kleine Maisfladen. Catharine hatte nur noch wenige Maß Mehl, dafür jedoch noch eine größere Menge Bohnen. Wenn man diese allerdings in dem nicht trinkbaren Wasser einweichte, schmeckten sie hernach modrig und verursachten stundenlang unangenehmste Blähungen. Was die Indianer wohl essen mochten? Außer Sand, Beifuß und Geiern schien es in diesem Land nichts zu geben.
Endlich waren die Wagen bereit, und sie rollten weiter. Der Fluß wand sich durch trügerische Schlammflächen dahin und wurde immer breiter und seichter. Selbst die Tiere saßen bisweilen in dem sumpfigen Boden fest, der das Ufer säumte. Einmal kreiste eine Schar Seemöwen über dem Wagen; die Vögel kreischten und flogen in südlicher Richtung davon. Das war für die Männer das untrügliche Zeichen dafür, daß der Salzsee nicht mehr fern war.
Auf der Hut vor den Sumpfflächen und das übelriechende Wasser gründlich leid, beschloß der kleine Treck, sich nach Westen zu halten. Die Männer hofften inständig, auf den Rio de Buenaventura zu stoßen. Also füllten sie die Wasserfässer und schnitten Gras für die Tiere. Dann zogen sie weiter.
In der Ferne, im Westen, lagen die blauen Bergzüge wie Säbelklingen vor dem Himmel. Die Sonne brannte unerbittlich auf den kleinen Treck hernieder, in dem die Ochsen mit knochigen Hüften stetig dahinstapften. Bartleson auf seinem Schecken und Bidwell auf einem Maultier machten sich auf, die weite, unfruchtbare Ebene nach dem Fluß abzusuchen. Auf dem steinigen und rauhen Boden wuchs selbst Beifuß nun kaum noch. Von Wasser natürlich keine Spur.
Als sie an diesem Abend das Lager aufschlugen und die Tiere zusammentrieben, bemerkten sie, daß drei oder vier Ochsen fehlten. Am nächsten Tag geschah das gleiche: Wieder hatten sie Tiere verloren. Ein Maultier fanden sie durch einen Pfeil im Bein schwer verletzt. Also waren die Indianer doch da – irgendwo.
Bartleson und Bidwell kehrten zurück; sie hatten keine Spur vom Glücksfluß gefunden.
Früher hatte es hier einmal Wasserläufe gegeben. Die Gruppe stieß auf ein altes, ausgewaschenes Flußbett, dem sie von nun an folgte; Kiesflöze und Sandablagerungen trugen die vom Wind verwischten Zeichen von Wellen, die bewiesen, daß das Wasser hier früher hoch gestanden haben mußte. Irgendwann brach wieder einmal ein Rad von Bidwells offenem Karren. Der junge Mann verstaute all seine Lebensmittel und die wenigen Kleider auf seinem Ochsenkarren; den kaputten Wagen ließen sie am Wegrand liegen.
Das Flußbett wand sich nach Süden und führte jetzt ein klägliches Rinnsal Wasser. Spärliches hartes Gras wuchs, doch wollten die Tiere seltsamerweise nicht davon fressen. Als Catharine das Gelände einmal nach Futter absuchte, erblickte sie ein wundersames Glitzern zwischen den Gräsern. Sie bückte sich, um einen Halm abzurupfen, und siehe da, er war von winzigen Kristallen über und über bedeckt. Sie leckte mit der Zunge am Gras: Es schmeckte salzig.
Sie blieb augenblicklich stehen und spähte das tief eingegrabene Bett des versiegenden Flusses hinab. Weit in der Ferne meinte sie, eine Reihe Bäume und den Schimmer einer Wasserfläche zu erkennen. Doch dann wurde wieder alles graubraun und staubfarben, bis der Horizont unmerklich in den Himmel überging. Sie machte kehrt und stapfte zurück zu den anderen.
John saß auf dem Wagensitz und zeichnete, während sich die anderen Männer einmal wieder über die nun einzuschlagende Richtung stritten. Die Zugtiere hatten lange nichts gefressen und waren geschwächt; indem sie dem alten Flußlauf folgten, gerieten sie immer tiefer in die unfruchtbare Salzebene hinein, und die niedrigen Berge, die vor ihnen aufragten, machten auch keinen grüneren Eindruck.
»Laßt uns weiter nach Westen halten«, schlug Kelsey vor. »Dann kommen wir den Bergen näher.«
Bartleson kratzte sich den Bauch. »Und wie sollen wir die Wagen über diese Berge kriegen?« Mit einem Rucken des Kopfes wies er nach Westen.
Catharine warf einen Blick auf das weiße Blatt Papier auf Johns Knien. Aus wenigen gekonnt hingeworfenen schwarzen Strichen funkelte Bartleson sie unter seinem breitrandigen Strohhut hervor an; daneben lachte John Bidwell, ewig gut gelaunt, mit strahlenden Augen. »Das ist gut«, lobte sie ihren Mann.
»So, meinst du?« John sah sie verschmitzt an, und dann entstand unter seinem furios hin und her fahrenden Bleistift ihr Gesicht mit ihren großen Augen, ihrer kleinen Stupsnase und dem scharfen Kinn. Das Haar war sittsam unter der Haube versteckt. Sein Bleistift hob sich für einen Moment und blieb über dem kleinen Porträt stehen – und dann zauberte er ihr mit einem unwiderstehlichen Schlenker einen Schnurrbart auf die Oberlippe.
Sie rammte ihm den Ellbogen in die Rippen. »Du Schuft!«
Sanft zog er sie an sich und küßte sie. Die anderen juchzten vor Vergnügen.
Später, im Dunkeln, liebten sie sich leise; die anderen, die draußen ganz in ihrer Nähe saßen, sollten sie nicht hören. Eingeklemmt zwischen einem Kleiderkoffer und Johns Werkzeugkiste, lag sie dicht an seinen Leib gedrängt und bis zur Ekstase erregt. Sie biß die Zähne aufeinander, sonst hätte sie laut losgeschrien.
»Mein Gott«, stöhnte er, auf ihr liegend, »was gäbe ich für ein richtiges Bett.«
»Laß uns doch einfach umkehren und nach Boston zurückgehen!«
Er lachte. Sich hin und her schiebend, kämpften sie in der dunklen Enge um mehr Raum. Der Wagen ächzte. John Bidwell draußen in seiner Decke wußte, daß die Reillys miteinander schliefen. Der fette, häßliche Bartleson wußte es auch. Er drehte sich auf die Seite und zog die Wolldecke hoch.
»Ein Bett«, murmelte er schläfrig. »Eine Kanne Bier, sauberes Waschwasser, gepflasterte Straßen, die man kennt, frisches Brot, noch warm vom Ofen, und Butter ... «
»John«, sagte sie.
»Saubere Sachen zum Anziehen, keine Blasen an den Händen, keine sturen Ochsen, keine Indianer ... «
Mit einem Kuß brachte sie ihn zum Schweigen. Seine Hände zeichneten behutsam die Konturen ihrer Gestalt nach, und plötzlich ergriff sie eine Welle der Dankbarkeit. Sie brauchte ihn so sehr und war sich ganz gewiß, daß auch er sie brauchte.
Was sie taten und was sie getan hatten, war richtig. Es mußte richtig gewesen sein. Am Ende würde alles gut werden. Warm und geborgen in seinen Armen, schloß sie die Augen.
Kapitel 3
Es dauerte Stunden, bis sie die Fässer aus dem träge dahinfließenden Rinnsal mit Wasser gefüllt hatten. Sie schleppten die Wagen über das Flußbett und zogen in westlicher Richtung weiter über eine weite, mit dickem, ineinander verhaktem Beifuß bewachsene Ebene. Die Männer gingen vorneweg und hackten mit gewaltigen Schlägen einen Pfad durch den Miniaturwald.
Nach ein paar Minuten scheuchte ein wutentbrannter Bartleson die anderen Männer aus dem Weg und trieb sein Gespann erbarmungslos durch das zähe Gesträuch, als könnte er die Durchfahrt mit seinem Zorn erzwingen.
Unter dem unablässigen Knallen seiner Peitsche zogen die Ochsen die Wagen im Beifußgestrüpp voran. Die Wagenräder quietschten und glitten auf ihren eisernen Rädern über das federnde Strauchwerk dahin, während sich die biegsamen Äste in den Speichen verhedderten. Nicht einmal unter dem Gewicht der Wagen brach das Gestrüpp, sondern bog sich nur, um kurz darauf federnd wieder emporzuschnellen. Nach kurzer Zeit schon blockierten die Räder und schleiften über das elastische Gestrüpp dahin, während Bartleson schrie und seine Peitsche schwang. Die Ochsen muhten, bis der Wagen langsam und überaus würdevoll seitwärts auf die große federnde Matratze kippte.
Bartleson und seine Peitsche landeten in hohem Bogen im Beifuß. Während der fette Mann sich aus dem Gestrüpp zu befreien versuchte, standen die anderen grinsend um ihn herum. Von da an handhabte Bartleson die Axt wie die anderen.
Den ganzen Tag über mühten sie sich einen Hügelzug hinauf, der sich wie eine Woge aus der Erde aufwarf. Kurz unterhalb des Kamms stießen sie auf eine Weide mit hohem Gras und einem kleinen Quell. Catharine trank von dem klaren, süßen Wasser und trat zurück, um den Blick nach Westen schweifen zu lassen.
Sie standen auf einer dem eigentlichen, freilich nicht wesentlich höheren Gebirgszug vorgelagerten Hügelkette. Hinter den zerklüfteten Gipfeln war nichts als eine unergründliche Weite.
Der Wind war kalt. Catharine zog das Umschlagetuch fester um sich. Die Sonne stand im Begriff, am dunstig gezackten Horizont unterzugehen, als Cathy zu ihrer Überraschung nur wenig weiter einen Berg entdeckte, der von einer weißen Schneekuppe gekrönt war.
»Siehst du den da?« fragte John Bidwell. Die Worte waren an Cathys Mann gerichtet, der Beifuß für das Lagerfeuer schlug. »Du hattest recht: Es wird Winter. Wir müssen uns beeilen.«
Reilly stützte sich auf seine Axt. »Ich hab’ schon überlegt, ob wir nicht ohne Wagen schneller vorankommen.« Catharine bückte sich und las das holzige Gesträuch auf, das er geschlagen hatte. »Ihr seid doch schon weiter nach Süden runtergeritten. Was habt ihr gefunden?«
Bidwells Finger zupften an seinem dünnen schwarzen Bart. »Je weiter man nach Süden kommt, desto trockener wird das Land. Du denkst vielleicht, diese Hügel hier wären schwer zu bewältigen – weiter unten im Süden ragen die Felswände steil wie Mauern auf, und von Bäumen, Gras oder Wasser ist weit und breit keine Spur.« Er hielt inne und schaute mit leerem Blick durch sie hindurch. »Da unten liegt der Steinbruch des Teufels.«
Catharine trug das Holz zum Feuer. Bartleson saß bereits mit gespreizten Beinen daneben und stocherte mit einem Stecken in der Glut herum, während Nancy auf der anderen Seite den Teig für einen Maisfladen knetete.
»Du hast uns ganz schön in die Bredouille gebracht.« Bartleson funkelte Bidwell wütend an.
»Hey«, verwahrte dieser sich. »Ich habe euch nicht gezwungen mitzukommen. Das habt ihr aus freien Stücken getan.« Es wurde jetzt langsam dunkler, und so gingen sie alle ans Feuer.
Das Baby schrie. Nancy beugte sich über die Pfannen und bat: »Nimm sie doch mal hoch, ja, Cathy?« Catharine ging zum Wagen der Kelseys und nahm Sarah auf den Arm.
»Zurück können wir nicht. Bis hierher haben die Tiere das Gras ratzekahl gefressen. Wir müssen weiter nach Westen. Immer weiter Richtung Westen und es hinter uns bringen«, erklärte Kelsey.
Bartleson hieb mit seinem Stecken ins Feuer. »Wir sitzen tief in der Tinte«, stellte er resigniert fest.
»Die Wagen verlangsamen unser Weiterkommen«, bemerkt John Reilly. »Die Berge werden steiler. Ich bin dafür, daß wir die Wagen zurücklassen und unsere Tiere mit dem Nötigsten beladen.«
Kelsey nickte langsam. »Daran hab’ ich auch schon gedacht.
Warum nicht die schlachten, die es sowieso nicht schaffen, und das Fleisch an der Luft trocknen?« Fragend sah er in die Runde. »Hier oben ist genug Gras für ein paar Tage Rast.«
Bartleson schürzte die Lippen. »Ich hab’ allerlei Zeugs in meinem Wagen.« Die Augen zu Schlitzen verengt, sah er rasch von einem zum anderen.
»Laß es zurück! Versteck’s! Vielleicht kannst du später herkommen und es holen.« Kelsey würdigte ihn kaum eines Blickes. Er hatte nur Augen für Bidwell und Reilly. »Laßt uns gleich morgen früh anfangen!«
Die Hälfte ihrer Tiere schlachteten sie, schnitten das Fleisch in Streifen und hängten es zum Trocknen in den Beifußrauch. Nach drei Tagen war das Fleisch zusammengeschrumpft und zäh wie Leder. Sie verstauten es in den Säcken, die ihnen von ihren Vorräten geblieben waren, räumten ihre Habseligkeiten aus den Wagen und beluden Ochsen und Maultiere damit.
Die Reillys hatten einen ihrer beiden Ochsen geschlachtet. Jetzt holte Catharine ihre Kleider aus dem Koffer und stopfte sie zusammen mit Johns Sachen in einen Sack. Danach streichelte sie voller Bedauern das hübsche Papier, mit dem der Koffer ausgekleidet war. John strich ihr über die Wange. Seinen Skizzenblock steckte er neben die Werkzeugkiste und die Axt und band alles zusammen auf ihrem nunmehr einzigen Ochsen fest.
Die Bartlesons trieben ihre Zugtiere am Rand der Weide zusammen. Sonderbar sahen sie aus, die Ochsen samt ihren ungewohnten Lasten. Catharine kletterte noch einmal in ihren Wagen und sah sich suchend um, ob sie nicht doch etwas vergessen hatte.
John beugte sich herüber. »Es ist, als ob man sein Zuhause noch einmal aufgeben müßte«, sagte er und setzte ein gequältes Lächeln auf. »Es tut mir leid, Cathy.«
»Was tut dir leid?« Sie kletterte hinunter und legte ihm die Hände auf den Arm.
»Dich hier herausgebracht und so viel aufgegeben zu haben.«
Sie schlang die Arme um ihn und drückte ihn. »Ich gebe nichts auf, was ich wirklich haben will.«
»Hey!« Der Ruf kam vom Kamm des Hügels hinter ihnen – es klang zornig. »Hey ... verdammt, Mann ...!«
»Wir haben keine Zeit, noch lange zu warten, Kelsey.«
»Das hier ist aber auch unser Fleisch!« rief Bidwell erregt.
John fluchte halblaut. Mit weit ausgreifenden Schritten ging er an Catharine vorüber um den Wagen herum. »Aufhören!« schrie er.
»Verdammt noch mal, aufhören, Bartleson!« Dann setzte er sich in Trab.
Den langen Hang hinauf lief Catharine hinter ihm her. Sie hörte das dumpfe Getrappel der davongaloppierenden Tiere. Wieder schrien die Männer. Durch den zähen Beifuß, der sich in ihrem Rock verhakte, kämpfte sie sich hügelan.
Über die ganze zertrampelte Weide verstreut rauften die Männer, während ganz am anderen Ende die Tiere der Siedler dicht gedrängt davonstoben. Kelsey hielt den Zaum von Bartlesons steigendem Pferd in der Hand. Mit weichen Knien stand Cathy da und überlegte, was tun. Zehn Schritte von ihr entfernt lehnte Bartleson sich aus dem Sattel und schlug Kelsey mit dem Ende seiner Zügel übers Gesicht, woraufhin Kelsey den Zaum fahrenließ und zurückwankte.
»Wiederseh’n in Kalifornien!« Bartleson riß sein Pferd herum und sprengte davon.
Catharine beeilte sich, den steilen Hang entlangzulaufen; sie rutschte aus, fiel und schürfte sich an einem Stein das Knie auf. Ganz am anderen Ende des Hügelzuges konnten sie ihre ganze Herde erkennen – sämtliche Tiere, die sie nicht geschlachtet hatten, stampften dahin. Die Lasten hüpften ihnen wie verrückte Jockeys auf dem Rücken. Bartleson und seine berittenen Männer scheuchten sie voran und versuchten, sie mit Stecken und Stricken zusammenzuhalten. John Reilly fuhr herum, sprang den Hang wieder hinunter und band ihren Ochsen fest, bevor er mit den anderen davonstürmte.
»Was geht denn eigentlich vor?« rief Catharine erschrocken.
John Bidwell warf seinen Hut zu Boden. »Er hat uns übers Ohr gehauen!« schrie er außer sich.
Kelsey sah funkelnd hinter den verschwindenden Bartlesons her. »Haben sie das ganze Fleisch?« rief Nancy klagend am Rand der Weide.
John Reilly kam mit seinem Ochsen näher, gefolgt von Kelseys Bruder, der vergeblich versucht hatte, die Verfolgung der Bartlesons aufzunehmen. »Ich hab’ gewußt, daß denen nicht zu trauen war.« Fast versagte John Reilly die Stimme.
»Haben sie alles mitgenommen?« fragte Catharine fassungslos.
Fest mit den Füßen aufstampfend, trat Nancy Kelsey in ihre Mitte. Tränen liefen ihr über die geröteten Wangen. »Ich hoffe, sie ersticken daran!«
»Komm schon!« sagte John Reilly und zupfte Bidwell am Ärmel. »Sie können die Herde ja nicht ewig im Galopp gehen lassen. Laß uns hinterher!«
Kelsey knurrte: »Richtig!« Dann wandte er sich an seine Frau. »Pack ein paar Sachen zusammen! So schlimm ist das nun auch wieder nicht. Wir holen uns was von der Herde zurück, das schwöre ich dir. Kommt, Männer!« Er nahm einen Strick, der von der Rückseite seines Wagens herunterhing.
John Reilly wandte sich an Catharine: »Bleib hier! Bevor es dunkel wird, sind wir zurück. Mach ein Feuer!« Die anderen liefen bereits den Hang hinunter und machten sich an die Verfolgung von Bartleson und der Herde.
Die beiden Frauen sahen ihnen lange nach. Das Baby greinte im Schatten von Kelseys Wagen, und sein Wimmern war jetzt das lauteste, was man in der Wüste hörte.
»Wir hätten Bartleson zusammen mit seinem Vieh umbringen sollen.« Nancy konnte das Ausmaß der Katastrophe immer noch nicht begreifen. Catharine bückte sich, nahm das Baby auf und wiegte es, um es zu beruhigen. Nancy setzte sich auf den Boden und starrte ins Leere.
Catharine wusch das Baby im Quellwasser, wie Nancy es ihr beigebracht hatte. Die Sonne senkte sich bereits auf den gezackten Rand der Welt, als die Männer endlich zurückkehrten.
Nancy sah sie zuerst und stieß einen lauten Freudenschrei aus. Noch waren die Männer nicht mehr als kleine schwarze Punkte, die sich mühselig den Weg zurück durch die Wüste bahnten und ein Pferd, ein Maultier und vier Ochsen vor sich hertrieben. Ein paar von den Tieren trugen noch ihre Last auf dem Rücken. Catharine hielt nach ihrem Mann Ausschau, zählte die Männer, hielt besorgt inne und zählte sie noch einmal.
»John ist nicht dabei«, stellte sie schließlich fest.
»Wahrscheinlich haben sie ihn als Späher ausgeschickt oder so.« Nancy legte Catharine den Arm um die Taille.
Catharine wankte zwei Schritte auf die mitgenommene kleine Schar zu, die sich durch den Beifuß voranarbeitete. Ihr Herz begann zu hämmern. Sie hob den Blick und ließ ihn über die leere, dunstbedeckte Wüste schweifen. Wo war John? Als Bidwell den Hang zum Camp heraufstieg, hob er den Blick und sah Catharine direkt an; die Veränderung in seinen Zügen traf sie wie ein Schlag.
»John!« Wie im Sturm rannte sie den Hang hinunter.
Bidwell streckte ihr die Arme entgegen und fing sie auf. »Es tut mir leid. Ach, Mrs. Reilly, es tut mir ja so leid.«
»Was tut Ihnen leid?« fragte sie wie von Sinnen und sah den anderen Männern entgegen. Erst jetzt begriff sie, was sie dort auf dem Rücken des Pferdes zurückbrachten.
»Oh, bitte!« Sie streckte die Hände aus. »Oh, bitte ... «
Bidwell hielt sie fest; sie wollte sich aus seinen Armen befreien, doch ließ er sie nicht gehen. »Er ist in eine Schlucht gestürzt und hat sich den Hals gebrochen. Er war sofort tot.«
»O Gott ... « Sie riß sich von ihm los, flog über den Beifuß und den unebenen Boden den Hügel hinunter und warf sich auf das Pferd, das John Reilly trug.
Sein Kopf hing an der Flanke des Tieres herunter, die langen blonden Locken waren verklebt. Er war kalt. Ihre Hände zuckten zurück, als sie das tote Fleisch berührten.
»Oh, Gott«, wiederholte sie. Plötzlich drehte sich ihr alles, und für einen Moment wurde ihr schwarz vor Augen. Sie wandte sich an Nancy Kelsey, die neben ihr stand: »Was soll ich jetzt tun?«
»Ist ja gut, ist ja gut!« Nancy nahm sie in den Arm. Steif streckte Catharine die Hände noch einmal aus und legte sie auf John Reilly.
»Wir werden uns um dich kümmern, Cathy«, versprach Bidwell, »das hier betrifft uns alle.«
Sie schloß die Augen. Kein Mensch würde sich um sie kümmern. Hier, in diesem gleichgültigen, unfruchtbaren Land, würden sie alle zugrunde gehen, und niemals würde jemand von ihrem Schicksal erfahren. Sie hatte das Gefühl, nur mehr Hülle zu sein, während ihre Seele fast schon tot war und ihrem Mann folgte.
Ganz entfernt hörte sie Bidwell: »Wir müssen ihn begraben.«
»Ich habe eine Schaufel«, erklärte Kelsey.
»Cathy«, bat Nancy. »Cathy, setz dich hierher!«
»Mit mir ist alles in Ordnung«, sagte sie wie benommen. »Alles in Ordnung.« Widerstandslos ließ sie sich von den Händen der Freundin führen. Warum konnte sie nicht auch sterben? Jetzt sofort.
Sie schaufelten eine Grube in den harten, trockenen Boden; sie war gerade groß genug, um John hineinzubetten; dann standen sie um das kalte Erdloch herum, und keiner sagte ein Wort. Nancy weinte. Catharine riß sich von der Leiche ihres Mannes los und sah auf; die Hände unbeholfen an den Körper gelegt, beobachteten die Männer sie. Niemand wollte den Toten mit Erde bedecken, bevor sie nicht das Zeichen dazu gab.
»Wartet!« Die Kehle schmerzte ihr. Sie ging hinüber zu dem Ochsen, der den Rest ihrer Habe zusammenhielt, und nahm den Skizzenblock aus der Traglast. Dann kniete sie am Grab nieder und schob dem Toten den Block unter den Kopf wie ein Kissen.
»Willst du es nicht behalten, Cathy?« fragte Nancy verwundert.
»Ich könnte es verlieren.« Sie strich ihm über das Haar. Er war so gut gewesen, so aufrichtig, und sie hatte ihn so geliebt; es war nicht gerecht. Sie beugte sich über ihn, knickte in der Mitte ein, und ein ungeheurer Schmerz erfüllte sie. Nancy hob sie auf und hielt sie umfangen. Sie häuften Erde und Steine auf John Reilly und zogen weiter durch die Wüste.
Von dem sorgfältig in Streifen geschnittenen und getrockneten Fleisch hatten sie nichts wiederbekommen. Alles hatte Bartleson mitgenommen, und das bißchen Wasser war auch bald verbraucht. Am Nachmittag stießen sie auf einen kleinen Quell, dessen Wasser stank und ölig schillerte. Das Pferd war nicht zu bewegen, davon zu saufen, doch das Maultier und die Ochsen verschmähten es nicht. Catharine nahm einen Mundvoll und trank. Hinterher brannte ihr die Kehle, und ihr Magen verkrampfte sich. Ihr Gemüt war eine offene Wunde, die mit jedem Atemzug schmerzte.
Kelsey hatte sich aufgemacht, das Gebüsch abzusuchen, und kam jetzt zurück. »Dort oben ist ein Pfad. Gehen wir!«
Sie trotteten hinter ihm her. Nancy hatte ingrimmig die Zähne zusammengebissen; ihre Augen waren tief in den Höhlen eingesunken, Catharine nahm ihr das Baby ab, doch schon bald darauf taten ihr die Arme weh, die Beine sowieso und der Kopf auch.
Die Spur, die Kelsey gefunden hatte, war tief in den trockenen Boden eingegraben: eine Rinne, nicht breiter als Catharines Fuß. Rings um sie her nichts als unentwirrbares niedriges Strauchwerk mit kleinen, harten, staubbedeckten Blättern. Die Pferde vor sich hertreibend, stapften sie weiter in westlicher Richtung voran. Das Baby begann zu schreien, und es klang nach einem langgezogenen Stöhnen. Nancy nahm die Kleine und gab ihr die Brust. Keiner sprach ein Wort.
Als das Maultier zum ersten Mal stehenblieb, ging Kelsey um das Tier herum und prügelte es mit einem Stock. Daraufhin wankte das Muli noch drei oder vier Schritte weiter, blieb dann aber wieder stehen. Kelsey hob den Stecken. Mit wutverzerrtem Gesicht versetzte er dem Tier wieder und immer wieder Schläge über die knochigen Flanken. Ein Zittern durchlief das Tier, aber es war nicht zum Weitergehen zu bewegen.
»Schlachte es!« Bidwells Stimme war nur noch ein trockenes Krächzen. »Wir können es aufessen.«
»Ich hole etwas Holz«, beeilte sich Nancy zu sagen.
»Nein. Erspar dir das!« Kelsey hob abermals den Stecken und schlug das Maultier, bis das Holz zersplitterte und das sterbende Tier nochmals vorwärts wankte; der Kopf hing ihm dabei so tief, daß die schlaffen Lippen fast den Boden berührten.
»Ben«, sagte Nancy, »wir müssen etwas essen.« Ihr Baby an der Brust, setzte sie sich auf den Boden; dann zog sie dem Kind ihre Rockschürze über den Kopf.
»Geh weiter!« befahl Kelsey.
Catharine reichte Nancy die Hände, um ihr aufzuhelfen. Das Baby saugte mit aller Macht, noch während die Mutter sich hochraffte. »Ich habe keine Milch mehr.« Nancys Stimme war nicht laut. Das Baby immer noch an der Brust, ging sie zu ihrem Mann hinüber.
Auch das Kind würde sterben. Catharine ballte die Hände vor der Brust. Das Baby war bestimmt als nächstes dran. Irgendetwas in ihr verkrampfte und entzog sich dabei jedem Gefühl. Sie zwang sich mit aller Macht, klar zu denken.
Mühsam kämpften sie sich weiter ein ausgetrocknetes Bachbett entlang, bis dieses vom westlichen Kurs abbog; daraufhin zogen sie weiter durch dichtes Beifußgestrüpp einen kleinen Hang hinauf. Die Tiere wankten vor ihnen her, das Muli schleifte das Maul über den Boden. Der Widerschein des Sonnenuntergangs lag lange auf ihren Gesichtern, als am Himmel über ihnen plötzlich ein Geier auftauchte und seine Kreise zog. Bald gesellte sich ein zweiter dazu.
»Warten die auf das Maultier oder auf uns?« fragte Catharine, und zu ihrer Verwunderung lachte Bidwell.
»Suchen wir nach einem Lagerplatz!« Kelseys Lippen waren aufgesprungen, und als er sprach, sickerte Blut in den Staub seines Barts. Bei Sonnenuntergang kam Wind auf und blies ihnen scharf ins Gesicht.
Einer der Ochsen hob den Kopf und muhte. Bidwell fragte blöde: »Was ist das?« Das Pferd warf den Kopf hoch und schnupperte im Wind. Die Nüstern gebläht, setzte sich der Ochse schwerfällig in Bewegung, und auch die anderen Ochsen beschleunigten ihren Schritt. Selbst das Maultier fiel in eine schnellere Gangart.
»Sie wittern Wasser.« Kelsey lief augenblicklich hinter den Tieren her. Catharine wandte sich Nancy zu; sich gegenseitig stützend, taumelten sie hinter den anderen einen buschbestandenen kleinen Hang hinunter und landeten an einem winzigen Wasserlauf.
Eigentlich war es mehr ein langgezogener Morast als ein Bach. Das Wasser floß so seicht und war so sandverschmutzt, daß niemand eine Stelle zum Trinken fand. Das Pferd knickte ein, steckte das Maul in die blinkende Oberfläche und saugte tief in sich hinein. Neben dem Pferd in die Knie gehend, scharrte Bidwell ein Loch frei. Rasch füllte es sich mit schlammigem Wasser. Catharine tat es ihm gleich. Auch sie scharrte und schabte und schöpfte schließlich eine Handvoll nach der anderen. Und trank, obwohl der feine Schlamm sich an Zunge und Zähnen festsetzte.
Sie benetzte mit dem Wässer Arme und Gesicht; zwar roch es moderig, aber es schmeckte süß, und so trank sie mehr davon, geduldiger jetzt und bereit zu warten, bis die Sickerstoffe sich auf dem Boden des Loches abgesetzt hatten; danach genoß sie jeden Schluck.
Bidwell stand auf. »Und jetzt schlachte das Maultier!« Kurz darauf donnerte Kelseys Büchse.
Kapitel 4
Die Nacht war überwältigend. Der unendlich weite Himmel war mit silbernem Feuer gesprenkelt, und der Wind blies in starken Böen. Manchmal vernahmen sie nur ein Gemurmel, manchmal ein lautes Geheul, das zum Fürchten war und sogar die Männer enger zueinander trieb. Immer, wenn der Wind aufheulte, warf Nancy weiteres Holz aufs Feuer, als wolle sie den bösen Spuk damit vertreiben.
Ihre Wangen waren eingefallen. Die Brust, die sie dem Kind reichte, sah aus wie ein leerer Schlauch. Die Arme stützend um das Baby gelegt, bettete sie sich zum Schlafen neben ihren Mann, den Kopf auf seinen Schenkel gelegt.
Catharine saß vor dem Feuer; sie trug Johns Rock und hatte die Füße ganz nahe der Glut. Die Menschen um sie herum waren ihr ferner als Boston. Sie konnte es immer noch nicht fassen, daß John tot war; immer wieder ertappte sie sich dabei, wie sie ihm etwas erzählte oder auf seine Stimme lauschte und in der Wüste nach ihm Ausschau hielt; immer wieder fragte sie sich, wo er nur blieb, und hatte Angst, er würde sie in der Dunkelheit nicht finden.
Bidwell ließ sich neben ihr nieder. »Ein wirklich elendes Land.« Er packte sie am Arm. »Auch alles in Ordnung mit dir, Cathy?«
»Ich kann mich nicht daran gewöhnen. Eben war er noch so lebendig.«
»Ich habe ihn sehr gemocht; er war ein guter, solider Mann; wir brauchten ihn«, beteuerte Bidwell.
Ben Kelsey saß ihnen gegenüber am Feuer und kaute auf einem Zweig. Einen Arm hatte er seiner schlafenden Frau um die Schultern gelegt.
Sein Bruder stapfte herzu und sank neben ihm nieder. »Man hat das Gefühl, diese Berge sind genauso weit entfernt wie vor zehn Tagen.«
»Wir müssen eine Wache aufstellen«, sagte Bidwell. »Das Feuer lockt bestimmt die Indianer an.«
»Vielleicht können die Indianer uns einen Weg hier heraus zeigen«, feixte Kelseys Bruder und lachte.
Kelseys Nerven waren zum Zerreißen gespannt. »Du kannst immer noch lachen, ja? Da sterben wir hier, einer nach dem anderen. Ich kann nichts weiter machen als zusehen, wie meine Frau und mein Kind sterben, und du lachst.«
»Aber, aber!« schlichtete Bidwell. Kelsey sank wieder nieder, ließ den Kopf hängen und brummelte undeutlich vor sich hin.
»Ich helfe beim Wacheschieben.« Catharine meinte es durchaus ernst.
»Mach dir darüber jetzt keine Gedanken, Cathy«, erwiderte Bidwell. »Das ist Männersache.«
»Ich muß aber etwas zu tun haben. Ich kann nicht einfach nur dasitzen und nichts tun.« Cathy hielt seinem Blick stand.
Bidwell legte ihr wieder die Hand auf den Arm. Von der anderen Seite des Feuers her sagte Kelsey: »Und was soll das für einen Sinn haben? Sollen die Hunde doch kommen, wenn sie wollen. Unsere Leichen werden sie ohnehin fleddern.«
Bidwell beugte sich zu ihm hinüber. »Nun hör mal zu, Ben! Du hast eine Frau und ein Baby; du mußt dich jetzt zusammenreißen. Ihr alle müßt das. Wir können es schaffen. Alles nicht unbedingt Notwendige haben wir zusammen mit Bartleson abgestoßen. Es ist uns nicht viel geblieben, aber wenn wir zusammenhalten, schaffen wir es.« Mit leuchtenden Augen wandte er sich an Cathy: »Komm schon, Cathy! Soll John denn noch einmal sterben?«
Ruckartig hob sie den Kopf; sie war erschrocken und ärgerlich. Bidwells Gesicht sah verzweifelt aus, doch was er gesagt hatte, traf sie tief. Wenn auch sie starb, war John Reillys Traum für immer verloren. Sie streckte John Bidwell die Hand hin. »Ich werde helfen. Soll ich die erste Wache übernehmen?«
Kelsey hob den Kopf; seine Augen flackerten nervös im Schein des Feuers. Nach einer Weile wischte er sich mit der Hand über den Mund. »Ja, ich übernehm’ die zweite.« Allerdings klang das ziemlich schwunglos.
»Gut.« Bidwell erhob sich und streckte Catharine die Hand hin, um ihr aufzuhelfen. »Ich zeig’ dir, was zu tun ist.«
Tagelang folgten sie dem Bach nach Westen. Im Allgemeinen war der Wasserlauf kaum mehr als feuchter Sand. Erst säumte sprödes Schilfrohr die Ufer, dann Binsen. Überall zirpten schwarze Grillen. Bidwell und Kelsey versuchten, sich an Sumpfhühner heran-
zupirschen. Sie feuerten mehrere Schüsse ab, brachten aber nur einen einzigen Vogel zur Strecke.
Sie kauten den Rest des Maultierfleisches, löschten den Durst mit dem schlammigen Wasser des Baches und gingen noch einmal die ihnen verbliebenen Tiere durch. Welches wollten sie als nächstes schlachten und wovon leben, wenn das letzte aufgegessen war?
Einmal kamen sie spätnachmittags an einem Indianerdorf vorüber. Zuerst wußte Catharine gar nicht, was sie da sah, denn die Indianer waren verschwunden. Ganz offensichtlich hatten sie ihr Kommen beobachtet und waren geflohen. Am Ufer entdeckten sie ein Dutzend kleiner Erdbuckel, die sich als Hütten entpuppten: das Schilfgerüst mit langem Gras verwoben. In der Dorfmitte schwelte noch ein Feuer, und Bidwell, der rasch einen Rundgang machte, entdeckte einen Korb mit bereits geschälten Nüssen und ein gehäutetes Kaninchen. Sie brieten das Kaninchen, verzehrten heißhungrig die Nüsse und teilten sich dann das noch halbrohe Fleisch; Blut rann ihnen übers Kinn. Die Ochsen und das Pferd machten sich an die Grasdächer.
Die Hütten schienen winzig und eigentlich viel zu klein, um darin zu leben. Catharine fragte sich, ob Indianer wohl so klein wären. Im Geist sah sie sie klein wie Kaninchen vor sich im Gras. Sie betrachtete die zarten Knochen in ihrer Hand, schloß die Augen und mußte würgen.