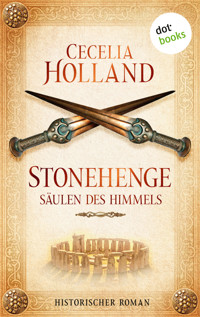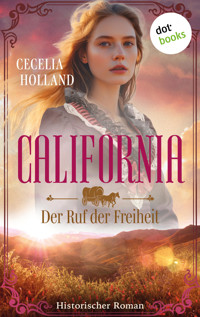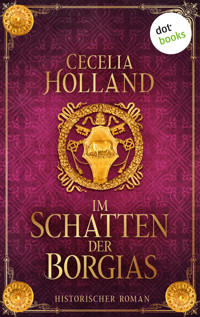
5,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwischen Macht, Lust und tödlicher Gier … Anfang des 16. Jahrhunderts befindet sich die Familie der Borgias in Rom auf dem Höhepunkt ihrer Macht: Papst Alexander VI. regiert auf dem göttlichen Thron die Katholiken, während er sich von seiner Geliebten umgarnen lässt. Seine verwitwete Bastardtochter Lucrezia sucht wiederum Trost in den Armen ihres eigenen Bruders Cesare, der mit seinem Heer die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzt. An diesen sündigen Hof des Vatikans gerät Nicholas Dawson, Sekretär des florentinischen Botschafters. Der junge Gelehrte kennt die Tücken der Staatspolitik nur allzu gut und ist deshalb auf der Hut vor den Intrigen des römischen Adels – doch als der machthungrige Cesare auf seinen scharfen Verstand aufmerksam wird, macht er Nicholas schon bald zum Spielball seiner Intrigen – mit fatalen Folgen … »Cecelia Holland ist eine erstklassige Geschichtenerzählerin.« People Magazine Ein atemberaubendes Historienepos für alle Fans von Matteo Strukul und der erfolgreichen TV-Serie »Die Borgias«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 441
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über dieses Buch:
Anfang des 16. Jahrhunderts befindet sich die Familie der Borgias in Rom auf dem Höhepunkt ihrer Macht: Papst Alexander VI. regiert auf dem göttlichen Thron die Katholiken, während er sich von seiner Geliebten umgarnen lässt. Seine verwitwete Bastardtochter Lucrezia sucht wiederum Trost in den Armen ihres eigenen Bruders Cesare, der mit seinem Heer die Bevölkerung in Angst und Schrecken versetzt. An diesen sündigen Hof des Vatikans gerät Nicholas Dawson, Sekretär des florentinischen Botschafters. Der junge Gelehrte kennt die Tücken der Staatspolitik nur allzu gut und ist deshalb auf der Hut vor den Intrigen des römischen Adels – doch als der machthungrige Cesare auf seinen scharfen Verstand aufmerksam wird, macht er Nicholas schon bald zum Spielball seiner Intrigen – mit fatalen Folgen …
Über die Autorin:
Cecelia Holland wurde in Nevada geboren und begann schon mit 12 Jahren, ihre ersten eigenen Geschichten zu verfassen. Später studierte sie Kreatives Schreiben am Connecticut College unter dem preisgekrönten Lyriker William Meredith. Heute ist Cecelia Holland Autorin zahlreicher Romane, in denen sie sich mit der Geschichte verschiedenster Epochen und Länder auseinandersetzt.
Bei dotbooks veröffentlichte die Autorin ihre historischen Romane »Im Tal der Könige«, »Die Königin von Jerusalem«, »Die Ritterin«, »Stonehenge: Die Säulen des Himmels«, »Im Schatten der Borgias«, »California: Der Ruf der Freiheit«, sowie ihre Norsemen-Saga mit den Einzelbänden »Der Thron der Wikinger« und »Der Erbe der Wikinger«.
Die Website der Autorin: thefiredrake.com/
***
eBook-Neuausgabe Oktober 2024
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1979 unter dem Originaltitel »City of God« bei Alfred A. Knopf, New York City. Die deutsche Erstausgabe erschien 1995 unter dem Titel »Die Kerkermeister Gottes« im Hestia Verlag.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1979 by Cecilia Holland
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1995 by Hestia Verlag KG, Rastatt
Copyright © der Neuausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Paulrommer SL (Rahmen), Sam2211 (Muster) und AdobeStock/e55evu (Goldarbeit)
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (lj)
ISBN 978-3-98952-206-0
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Cecelia Holland
Im Schatten der Borgias
Historischer Roman
Aus dem Amerikanischen von Werner Peterich
dotbooks.
Widmung
Für Bob Gottlieb, in Liebe
Kapitel 1
Die Nacht hatte sich herniedergesenkt. Nicholas Dawson, der wartend am steinigen Tiberufer stand, begann zu frösteln. Er steckte die Hände tief in die Falten seines Rocks und sah, sich von einem Fuß auf den anderen wiegend, vom Fluß hinüber zu der morastigen und moderig riechenden Wiese. Dann warf er noch einen aufmerksamen Blick in die Runde.
Für gewöhnlich mied er selbst tagsüber diesen Teil von Rom, doch der Bote hatte gesagt: »Kommt allein!« Auch hatte er einen gewissen Namen genannt. Und nur dieser Name hatte Nicholas dazu gebracht, allein in stockfinsterer Nacht hierherzukommen.
Fast eine Stunde hatte er gewartet. Bald würden die Glocken die Mitternacht verkünden. Er zitterte inzwischen vor Kälte und spielte mit dem Gedanken, einfach fortzugehen – das Ganze als einen Schabernack zu betrachten, den jemand ihm gespielt hatte. Der Tiber rauschte im Dunkeln vorüber; dort, wo der Fluß ans Ufer schwappte, hatte sich Unrat angesammelt. Vor ihm brach sich das schwarze, übelriechende Wasser an den Pfeilern einer antiken Brücke, die im Laufe der Jahre immer mehr verfallen war und von der nur zwei Pfeiler und ein Bogen übriggeblieben waren.
In der Nähe der Brücke im dichten Gesträuch bewegte sich etwas.
Nicholas Dawson sah auf und versuchte, die Gestalten zu erkennen, die da aus dem Dunkel auf ihn zukamen. Steine klickten auf dem Pfad. Nicholas trat zur Seite, auf die schützenden Schatten des Röhrichts zu. Gleichzeitig wandte er sich zur Flucht, hielt jedoch den Blick weiterhin auf die Männer gerichtet, die sich ihm näherten.
Hätte ich doch bloß einen Degen mitgenommen oder zumindest meinen Spazierstock, dachte er. Vom Fechten verstand er zwar nichts; dennoch wünschte er sich etwas, womit er sich der Fremden notfalls hätte erwehren können.
Es waren zwei Männer, die hintereinander das Flußufer entlangkamen. Möglicherweise führten sie ja nichts Böses im Schilde. Vielleicht würde Nicholas in ein paar Minuten über Cesare Borgia – Herzog von Valentinois oder kurz Valentino genannt – erfahren, was ganz Italien brennend gern gewußt hätte.
Der Gedanke an Valentino ließ ihn hellwach werden. Er rief den beiden ihm entgegenkommenden Männern zu: »Halt! Nicht näherkommen! Wer seid ihr?«
Die Männer blieben stehen. Der Vorangehende mit den breiten Schultern und einem Schlapphut streckte seitlich die Hand aus und hielt den hinter ihm gehenden, großen, hageren Mann zurück. Die Gesichter der Männer waren nicht zu erkennen.
»Wer seid Ihr?« rief der eine.
»Man hat mir eine Nachricht zukommen lassen«, antwortete Nicholas.
Seine Hände verkrampften sich; sein Mund war trocken vor Nervosität.
»Ihr wollt wissen, wohin Cesare Borgia marschiert und wen er angreifen wird«, sagte der Mann mit dem Hut. »Dafür werdet Ihr fünfzig Kronen zahlen.«
»Einverstanden«, sagte Nicholas.
Die Steine knirschten. Die beiden Männer kamen wieder auf ihn zu. Sie trennten sich und nahmen ihn gewissermaßen in die Zange. Dawson sträubten sich die Nackenhaare. Eine Falle! Er wirbelte herum, dabei rutschte er auf dem glitschigen Boden aus. Doch wohin sollte er sich wenden? Die beiden Unbekannten hatten ihn praktisch in die Mitte genommen.
»Das Geld!« forderte der Mann mit dem Hut.
»Das habe ich nicht mitgebracht«, erwiderte Nicholas. »Ich habe nichts bei mir.«
Der größere von den beiden fluchte gotteslästerlich. Er packte Nicholas am Revers und stieß ihn zurück, fast in das seichte, nach Abwässern stinkende Wasser hinein. Der andere tastete wenig feinfühlig Dawsons Rock ab und suchte offensichtlich nach dessen Börse.
»Ich habe kein Geld bei mir«, beteuerte Nicholas.
»Mach ihn kalt!« zischelte der große Hagere.
Sie nahmen ihn in den Schwitzkasten. Nicholas biß die Zähne aufeinander. Der üble Gestank des Flusses schien wie ein böses Omen.
»Bringt mich nicht um. Ich will euch gern fünfzig Kronen dafür zahlen, daß ihr mich nicht tötet.«
Der Hochaufgeschossene machte eine jähe Bewegung. Nicholas zuckte in Erwartung des Schlages zusammen, fuchtelte mit den Armen und hätte um ein Haar das Gleichgewicht verloren. Der Breitschultrige packte ihn und hielt ihn am Arm fest. Seine Hand war wie ein Schraubstock.
»Ihr habt kein Geld«, sagte der lange Kerl. Er hatte plötzlich einen Dolch in der Hand.
Auf der anderen Seite des Flusses stimmten unversehens fünfzig Stimmen einen Bußgesang an, wie in der Fastenzeit üblich. Nicholas fuhr sich mit der Zunge über die Lippen. »Nicht hier«, sagte er. »Ich habe ein Haus – hinter dem Palatin, in der Nähe des Kolosseums.« Unter Aufbietung aller Selbstbeherrschung sprach er gedämpft. Obwohl sich die Wörter förmlich überschlugen, gelang es ihm, gleichmäßig leise zu sprechen. »Ich werde euch hinbringen und euch das Geld dort geben.«
»Töte ihn!« forderte der Hagere erneut.
»Wenn ihr mich umbringt, bekommt ihr nichts.«
Der mit dem Schlapphut stellte sich zwischen Nicholas und seinen großgewachsenen Gefährten und schob sie auseinander. Als der Hagere einen Schritt zurücktrat, erkannte Nicholas die schmale Klinge des Dolches. Am anderen Tiberufer sangen die Büßer ein Miserere nobis. Der Breitschultrige hielt Nicholas immer noch mit schmerzhaftem Griff am Arm gepackt.
»Aber wenn wir zu Eurem Haus gehen, werdet Ihr Eure Männer auf uns hetzen.«
»Ich habe keine Männer«, sagte Nicholas. »Einer von euch kann mit hineinkommen, um das Geld zu holen. Der andere kann draußen warten und Wache halten.«
»Ich werde mit Euch hineingehen«, erklärte der Mann mit dem Hut.
Erleichtert seufzte Nicholas. Der Wind kühlte seine schweißnasse Stirn. Der Mann mit dem Hut stand zwischen ihm und dem Dolch.
»Laßt uns gehen!« sagte der mit dem Hut.
»Wer sagt denn, daß ich da mitmache?« ließ die Stimme des Hageren sich vernehmen. »Du gehst rein, und ich warte auf der Straße, bis ich schwarz werde. Hast du dir das so gedacht?«
Nicholas sah zwischen den beiden hin und her. Vielleicht konnte er, während sie sich stritten, entkommen. Er schob sich ein Stück seitlich vom Fluß fort und entdeckte ein flackerndes Licht. Er drehte den Kopf weit genug, um zu sehen, daß auf dem Wasser der anderen Seite sich der Widerschein einer Fackel brach. Etwas weiter entfernt erblickte er die Büßerkolonne. Aber der Fremde hielt ihn immer noch fest am Arm gepackt.
»Ich werde mit ihm gehen«, sagte der Mann mit dem Hut zu dem Hochgewachsenen. »Kehr du zurück zum ›Fuchs und den Trauben‹. Dort treffen wir uns später.«
»Vielleicht. Wer weiß.«
Der Dolch funkelte zwischen den beiden Männern. Der Breitschultrige riß Nicholas herum, so daß er die Balance verlor, und ließ ihn los. Nicholas fiel auf die Knie, rappelte sich aber schnell hoch und floh am Ufersaum entlang, während er hinter sich Keuchen und Gescharre hörte. Plötzlich ertönte wie eine Stimme vom Himmel die erste Mitternachtsglocke. Nicholas schlitterte über das feuchte Ufer. In seiner Nase hatte er den modrigen Gestank des Flusses.
Als er über einen morastigen Weg vorwärtshastete, holte der Mann mit dem Hut ihn ein.
»Nicht schlecht«, sagte er und drehte Nicholas wieder den Arm auf den Rücken. »Aber wenn Ihr nächstes Mal wegrennt, zieht Euch besseres Schuhwerk an.«
Nicholas war außer Atem. Er blickte die Strecke zurück, die er gelaufen war, und suchte nach dem anderen Mann.
»Um den macht euch keine Sorgen«, sagte der mit dem Hut. »Ihr schuldet mir fünfzig Kronen.«
»Ich werde zahlen«, sagte Nicholas. »Bitte, laßt meinen Arm los!«
Der Räuber lachte und schubste Nicholas auf dem Weg vor sich her. Mit einer Hand schob Nicholas Röhricht und Ranken von sich weg, die zu beiden Seiten den schmalen Pfad säumten. Der Fremde hielt seinen Arm immer noch schmerzhaft fest. Aus allen Himmelsrichtungen drang das Geläut der römischen Kirchenglocken und maß die Zeit.
Nicholas kämpfte sich durch das Dickicht bis zu der breiten, vielbefahrenen Straße, die am Palatin vorüberführte. Rechter Hand, hinter ein paar Pinien, stand eine kleine Kirche, vor der sich Menschen zur Messe versammelten. In diesem Moment ließ der Mann seinen Arm los.
Nicholas streckte ihn kurz, und prickelnd kehrte das Blut wieder in ihn zurück, so daß er sich bis zur Achselhöhle erwärmte. Er schüttelte die Hand, um auch in die abgestorbenen Finger wieder Leben zu bringen.
»Bringt mich unverzüglich zu Eurem Haus!« sagte der Mann mit dem Hut. »Und keine Sperenzchen!« Er warf einen langen Blick zurück ins Dunkel am Fluß.
»Habt Ihr ihm was angetan?« fragte Nicholas. Das Wort ›töten‹ oder ›umbringen‹ wollte ihm nicht über die Lippen.
Wieder lachte der Kerl. Er war größer als Nicholas und massig, zumindest wirkte er in seinem weiten Rock und dem breitrandigen Schlapphut so. Er antwortete: »Nein, ich habe ihm bloß eine verpaßt. Ich ersteche keinen. Blutvergießen ist viel zu gefährlich. Aber jetzt bewegt Euch, er könnte bald zu sich kommen!«
Nicholas beschleunigte den Schritt, und der Räuber grinste hämisch. Sie kamen an der Kirche vorüber.
Die Häupter gebeugt und die Hände zum Gebet gefaltet, betraten die Menschen das Gotteshaus. Hinter der Kirche erstreckte sich der obere Rand des Palatins, nur unterbrochen von den schirmartigen Kronen der Pinien und den Mauerresten.
»Wißt Ihr überhaupt irgendwas vom Herzog Valentino?« fragte Nicholas Dawson.
»Nicht mehr als jeder andere«, erwiderte der Räuber und zog die weiche Krempe seines Hutes zurecht. Daran festgesteckt war eine Medaille, die er im Vorübergehen wie einen Talisman berührte. Nicholas verfolgte diese eigentümliche Geste, die sein Interesse erregte.
»Erzählt mir«, sagte er, »was Ihr über Cesare Borgia wißt.«
»Valentino hat sich der Hälfte aller Städte in der Romagna bemächtigt«, begann der Räuber. »Forli, Imola, Cesena ... Und jetzt marschiert er mit seiner Armee auf Florenz zu. Er behauptet zwar, er habe nichts Böses im Sinn, doch plündern seine Soldaten jedes Dorf, durch das sie kommen. Und wer traut schon einem Borgia, was seine Absichten betrifft?« Der Fremde sah Nicholas flüchtig von der Seite an. »Ihr seid der florentinische Gesandte.«
»Nur sein Sekretär«, wandte Nicholas ein.
»Wir haben die Botschaft aber dem Gesandten geschickt.«
»Seine Exzellenz, der Illustrissimo Ercole Bruni, trifft sich nicht zu nächtlicher Stunde mit Unbekannten am Fluß.« Nicholas berührte den Arm des Räubers und drängte ihn nach links durch dichtwachsende, immergrüne Bäume. Er zog die Hand zurück. Mit den Fingerspitzen streifte er den Rockärmel des Mannes; er war aus billigem Samt. »Hättet Ihr es wirklich gewagt, einen Gesandten am päpstlichen Hof zu bedrohen? Das ist riskant.«
»Die Dunkelheit verkleinert das Risiko«, entgegnete der Räuber. »Ich brauche Geld.«
Vor ihnen ragten die Bäume auf den ausgedehnten Weiden und Wiesen am Kolosseum auf. Ein kalter Wind peitschte ihre Gesichter. Schafe grasten hier, ihre Glöckchen bimmelten. Nicholas führte den Räuber um die Terrassen und zerbrochenen Säulen herum, die den Rand des Forums markierten und wo die Feuer der Kalköfen noch brannten. Die beiden Männer umrundeten das Kolosseum, das mit Sträuchern und Kletterpflanzen bedeckt war. Keiner von den Großen Roms erhob Anspruch auf dieses Bauwerk – vielleicht, weil man wußte, daß es von bösen Geistern heimgesucht wurde. Die Perleones hatten es einst als Festung benutzt, doch längst hatte man das Innere den Eulen, Katzen und Totenbeschwörern überlassen. An die Außenwände duckten sich elende Hütten. Für Nicholas’ Begriffe ging von dem Ort etwas Unheimliches aus.
Als sie das Bauwerk halb umrundet hatten, wurden sie von einer Wache angerufen.
»Messer Dawson«, sagte der Anführer der Wache, als er ihn erkannte. Der Mann hatte seinen Speer geschultert, einer seiner Gefolgsleute trug an einer langen Stange eine Laterne.
»Ja«, sagte Nicholas. »Mein Gefährte und ich wollen zu meinem Haus. Ist alles ruhig?«
»Nichts rührt sich«, antwortete der Wächter und faßte mißtrauisch den großen Mann ins Auge, der bemüht war, sein Gesicht aus dem Licht der Laterne herauszuhalten. »Und wer seid Ihr? Ihr stammt nicht aus diesem Viertel.«
»Stefano Baglione«, erklärte der Fremde gelassen. »Ich wohne im Trastevere.«
Nicholas hütete sich, seine Überraschung zu zeigen. Die Bagliones waren Gebieter der Stadt Perugia. Wenn dies eine Lüge war, dann eine mutige. Er warf nochmals einen forschenden Blick auf den Mann neben sich, seine Neugier war kaum noch zu bändigen. Große Männer waren sie schon, die Baglioni.
Vielleicht stimmte es.
Der Wachmann glaubte es nicht und stieß einen rauhkehlig-höhnischen Laut aus. Sein Atem roch nach Wein, und die Augen waren blutunterlaufen. Vermutlich kam er gerade aus der Weinschenke, eine Straße weiter. Er sagte: »Ein Baglione? Und dann in Trastevere?«
»Hütet Eure Zunge!« stieß Nicholas hervor.
»Verzeihung, Messer Dawson.«
Der Wachmann nickte ihm zu und trollte sich; seine Untergebenen zogen über die morastige Weide auf der anderen Seite des Kolosseums hinter ihm her. Nicholas ging weiter ins Dunkel hinein, die Laterne blieb hinter ihnen zurück.
»Saufbrüder!« bemerkte Stefano Baglione wütend. »Die bilden sich ein, ihnen gehöre die Straße.«
»Ihr solltet Euch einen anderen Namen zulegen.«
»Ich heiße nun aber mal so.«
»Trotzdem, die Leute könnten skeptisch werden.«
Stefano schwieg. Nicholas führte ihn die Gasse entlang hinunter zu seinem Haus. Sie gingen zwischen zwei Reihen kleiner Läden hindurch und überquerten einen gepflasterten Platz vor einer Weinschenke. Auf der einen Seite der Straße stand ein verlassenes Lagerhaus, auf der anderen dehnten sich Weideflächen. Schmutzwasser stand im Rinnstein, und Nicholas gab acht, wohin er die Füße setzte. Die Vorderfront des Lagerhauses lag zur Straße hin. Wo es endete, wuchs eine dichte Dornenhecke von über zwei Metern Höhe.
In der Mitte der Hecke befand sich ein eisernes Tor. Nicholas nestelte seinen Schlüssel aus dem Hemd und schloß auf.
»Ihr hättet die Wache auf mich hetzen können«, sagte Stefano.
»Und Ihr hättet zulassen können, daß Euer Freund mich unten am Tiber erdolchte.«
Durch das Tor betrat Nicholas den wild wuchernden Garten. Der Vorbesitzer des Hauses hatte Rebstöcke und Obstbäume angepflanzt und sie beschnitten und gewässert. Nicholas jedoch hatte kein Interesse an dem Gepflanzten und seit zwanzig Jahren alles völlig sich selbst überlassen. Es war ein großer Garten, der förmlich erstickte unter Unkraut, Dornenranken und trockenen Ästen. Das Haus lag in der Mitte dieses Gewirrs versteckt. Ein plattenbelegter Weg führte durch hohes Gras und wilde Rosen darauf zu. Es gab weder eine Treppe noch eine Veranda. Die Tür war einfach in die nackte Hauswand eingesetzt.
»Ich mache Euch einen Vorschlag«, sagte Nicholas und klopfte an die Tür.
»Und der wäre?«
Die Tür ging auf, und über eine Kerze hinweg sah Dawsons alter Diener sie an. Er sagte kein Wort, trat beiseite, um sie passieren zu lassen. Das Alter hatte seine Schultern gebeugt, so daß er nicht mehr aufrecht stehen konnte, und sein Kopf stieß vor wie der eines Hundes. Während er im Raum umherschlurfte, um die Kerzen an den Wänden anzuzünden, legte Nicholas seinen Rock ab, und Stefano Baglione nahm endlich den Hut vom Kopf. Nicholas hängte den Rock über einen neben der Tür stehenden Stuhl, dessen Sitzfläche noch vom Gewicht des alten Mannes eingedellt war. Beim Eintreten war Stefano einen Schritt an ihm vorbeigegangen, so daß Nicholas ihn nun mustern konnte, ohne daß ihm das als zudringliche Dreistigkeit ausgelegt wurde. Die Baglioni waren bekannt für ihr gutes Aussehen. Nicholas wollte feststellen, ob man das auch in diesem Falle behaupten konnte.
»Was für einen Vorschlag?« fragte Stefano erneut und drehte sich um. Nicholas fühlte sich ertappt und senkte den Blick. »Kommt, setzt Euch!«
Der alte Diener Juan hatte den Raum verlassen. Nicholas verriegelte die Haustür. Stefano schlenderte durch den Raum und betrachtete die Fresken an den Wänden. Die Decke war sehr hoch, und die ausgedehnten Wandflächen waren mit hügeligen Landschaften bemalt. Die kleinen leichten Möbelstücke waren ein gutes Stück von der Wand abgerückt, offensichtlich, weil sie die Wirkung der Fresken nicht stören sollten. Der Betrachter sollte das Gefühl haben, draußen auf einer Anhöhe zu stehen. Nicholas war so sehr daran gewöhnt, daß er längst verlernt hatte, sich daran zu ergötzen. Er trat auf eine Kommode zu und zog die oberste Schublade auf.
»Das ist prachtvoll«, sagte Stefano.
»Meint Ihr?« Nicholas entnahm der Lade eine Börse. »Früher habe ich auch meine Freude daran gehabt, doch jetzt ist alles so selbstverständlich für mich geworden. Hier sind fünfzig Kronen.«
Er hielt ihm die Börse hin. Nach einigem Überlegen trat Stefano einen Schritt vor und nahm sie in Empfang. Nicholas hatte schon eine ganze Reihe von Familienangehörigen der Baglioni gesehen, von denen jedoch keiner so stattlich gewesen war wie dieser mit seinem rötlich-braunen Haar, den hellen, fast bernsteinfarbenen Augen und dem feinen, sinnlichen Mund.
»Wie ich Euch schon sagte, bin ich der in Rom ansässige Sekretär der Gesandtschaft der florentinischen Signoria beim Heiligen Stuhl. Ich sammle Informationen. So würde ich dafür bezahlen, das Neueste aus Trastevere zu erfahren.«
Der Anflug eines Lächelns huschte über Stefanos Gesicht. Die Geldbörse verschwand in seinem Rock. »Getreide ist teuer und der Wein ständig gepanscht. Warum sollte Florenz sich für Trastevere interessieren? Dort lebt keiner – keiner von den Großen, nur Huren, Räuber und Tagelöhner.«
»Cesare Borgia besitzt einen Palazzo in Trastevere«, sagte Nicholas. »Nehmt doch bitte Platz und laßt uns ein Glas Wein trinken – unverdünnten.«
Sie setzten sich auf zwei sich gegenüberstehende Lehnstühle in der Mitte des Raums. Schweigend trat der alte Diener mit bereits gefüllten Weingläsern ein.
Stefano hockte unbehaglich auf der Vorderkante seines Stuhls. Sein Blick wanderte über die bemalten Wände. Er hielt das Glas eine Weile in der Hand, bevor er ohne Genuß trank, als wäre es Wasser. Die feinen Manieren eines Mannes aus fürstlichem Haus besaß er nicht. Aber auch nicht die Hautfarbe eines Bauern. Weit standen die Augen über einer geraden Nase und einem Kiefer auseinander, der sich wie ein aggressiver Keil vom Kinn nach hinten verbreiterte. Nicholas genoß diese Schönheit. Er ließ den Wein lange auf der Zunge zergehen, ehe er ihn hinunterschluckte.
»Oh!« Stefano Baglione stand vom Stuhl auf und richtete den Blick quer durch den Raum. »Das ist hübsch, das habe ich bisher noch nie gesehen.«
Er meinte den römischen Tempel, der zwischen Olivenbäumen an die Westwand gemalt war.
»Freut mich, daß er Euch gefällt«, entgegnete Nicholas.
Schwerfällig ließ Stefano sich wieder auf den Stuhl fallen. Irgendetwas machte ihn nervös. Vielleicht war es Nicholas’ Stimme. Das leere Glas, das er immer noch in der Hand hielt, stellte er auf den Fußboden neben sich.
»Ich habe Euch doch schon gesagt, ich weiß nichts von Valentino.«
»Und was haltet Ihr von ihm?«
»Von Valentino? Daß er ein Mann ist – ein Mann von echtem Schrot und Korn.«
»So.«
»Was war er denn noch vor ein paar Jahren?: Der Bastard eines spanischen Kardinals. Und heute?: Gonfaloniere der Kirche, Bezwinger der Romagna ... «
»Dafür ist sein Vater ja auch nicht mehr nur Kardinal, sondern Papst. Es hat schon mehr Männer gegeben, die wie die Sterne erstrahlten, solange ihre Verwandten auf dem Stuhle Petri saßen – und deren Glanz beim Tod ihrer Gönner erlosch wie eine Kerze. Girolamo Riario, zum Beispiel.«
Stefano zuckte mit den Schultern. Seine Kleider waren schlecht geschnitten und aus billigem Tuch genäht. Eigentlich paßten sie nicht. »Das mag in der Zukunft so sein«, meinte er, »aber im Augenblick ist Valentino der Größte in Italien.«
Nicholas stützte das Kinn auf die Faust und ließ den Ellbogen auf der Stuhllehne ruhen. »Ich möchte wissen, was man in Trastevere so über ihn spricht. Um zu erfahren, was die Leute glauben, aber auch, um die Wahrheit herauszubekommen.«
»Ich tue alles, wofür ich bezahlt werde.«
Stefano legte eine Hand auf die Stelle, wo der Rock wegen der Geldbörse sich wölbte. Die Tür zur Küche quietschte. Juan trat ein, nahm ihre Gläser und ging wieder.
»Wenn Ihr mich sehen wollt, hinterlaßt eine Nachricht im ›Fuchs und den Trauben‹«, sagte Stefano. »So heißt eine Taverne in der Nähe der Santa Maria. Kennt Ihr sie?«
»Ein bißchen kenne ich mich in Trastevere schon aus.«
Mit gefüllten Gläsern kam Juan zurück. Stefano richtete den Blick auf den alten Mann, als der quer durch den Raum auf sie zustrebte. Nicholas fuhr sich mit dem Finger über die Wange, sanft streichelte er seine Haut. Er überlegte, wie Stefano wohl auf einen anderen Vorschlag reagieren mochte.
Der alte Mann brachte ihm das Glas. Nicholas bedachte ihn mit einem vielsagenden Blick, und Juan ließ sie allein. Er würde heute abend nicht noch einmal hereinkommen.
»Mich freut, daß mein Haus Euch gefällt«, sagte Nicholas.
»Ja.« Stefano lehnte sich, das Glas in der Hand, zurück. »Ihr müßt viel Geld haben, um Euch ein Haus wie dieses leisten zu können.«
»Ich wünschte, das stimmte. Es wäre mir ein Vergnügen, Euch den Rest zu zeigen.«
»So? Gibt es denn noch andere Räume wie diesen?«
»Nur die Schlafkammer.«
Der Kopf des jüngeren Mannes zuckte hoch. Schockiert starrte er Nicholas an, und das Blut schoß ihm in die Wangen.
»Ach? So einer seid Ihr also. Das hatte ich mir fast schon gedacht, als ich Euch das erste Mal sah. Nun, ich bin aber keiner von der Sorte.«
»In Ordnung«, murmelte Nicholas.
»Ich liebe Frauen – viele Frauen. Ich verstehe mich gut auf sie, und sie sind ganz wild auf mich.«
»Ich mag Frauen nicht«, warf Nicholas ein.
»Ja, die mögen Männer Eurer Art nicht.«
Hinter vorgehaltener Hand brummelte Nicholas irgendetwas. Er bedauerte, dem Gespräch diese Wendung gegeben zu haben.
»Trotzdem – wie schon gesagt«, erklärte Stefano, »für Geld tue ich alles.«
Nicholas lächelte, entspannte sich und rutschte, eine Hand auf der Armlehne, unruhig hin und her. Er fragte sich, warum Stefano es sich anders überlegt hatte, wenn überhaupt. Vielleicht hatte er nur seine Ehre verteidigt.
»Wieviel?«
»Einhundert Kronen.«
»Per Bacco!« entfuhr es Nicholas. »Wir sind hier schließlich in Rom. Für zehn Kronen könnte ich mir einen Kardinalshut kaufen. Also, zwanzig Kronen, was schon sehr großzügig ist.«
»Haltet Ihr mich für eine Hure? Außerdem bin ich noch Jungfrau.«
»Das ist für mich kein Vorteil.«
»Vierzig Kronen.«
»Dreißig.«
Stefano ließ seinen Blick wie beiläufig schweifen und wandte sich interessiert wieder der Wandmalerei zu. »Sei’s drum!«
Kaum merklich strich Nicholas mit den Fingerspitzen über das geölte Holz seines Stuhls. »Wir werden noch etwas Wein trinken«, sagte er und stand auf.
Um neun Uhr am nächsten Morgen begab Nicholas Dawson sich in die den Vatikan und die Engelsburg umfassende Città Leonina, um Papst Alexander seine Aufwartung zu machen.
Den Spazierstock unter den Arm geklemmt, wartete er in einem der Gänge des vatikanischen Palastes auf die Ankunft seines Gesandten. An den Wänden des Korridors hingen Bilder mit mythologischen Szenen. Durch ein offenes Fenster schaute Nicholas auf einen halb in der Sonne, halb im Schatten einer Pinie gelegenen, ziegelgepflasterten Hof hinab. Zu Füßen des schlanken Baumstamms waren eine Menge tönerner Weinkrüge gestapelt. Nicholas stand da und bewunderte das Bild, das sich seinen Augen durch das Fenster bot. Er verglich die sonnenwarmen Töne der Ziegel und der Pinie mit dem leblosen Gemälde des Minotaurus, das neben dem Fenster an der Wand hing.
Bald kam Bruni, der florentinische Legat bei der Kurie. Er war ein großer, kompakter Mann. »Ich bin spät dran«, sagte er lächelnd, als machte ihm das Vergnügen. »Wie gewöhnlich. Was hat sich gestern abend bei unserer Verabredung ergeben?«
Nicholas räusperte sich. »Nichts.«
»Es ist keiner gekommen?« fragte Bruni mit einer gewissen Schärfe.
»Doch. Aber es war eine Falle. Sie wollten nur das Geld.«
»Und haben sie es bekommen?«
Außerstande, Bruni in die Augen zu sehen, richtete Nicholas den Blick zum Fenster hinaus. »Ja.« Das Geld stammte aus Brunis Privatschatulle.
»Fünfzig Kronen!« empörte Bruni sich lauthals.
»Ich hätte mich weigern können, es herauszurücken«, erwiderte Nicholas, »aber dann hätten sie mir die Kehle durchgeschnitten. Und das Geld wäre obendrein verloren gewesen.«
Bruni knurrte. Eine Faust auf der Hüfte, warf er einen Blick in die Runde, um zu sehen, wer wohl mithören könnte. »Wie viele waren es?«
»Zwei.«
»Nur zwei? Und da konntet Ihr nicht entwischen? Ich habe von Anfang an gewußt, daß es ein Fehler war. Nun, lassen wir das, so was läßt sich in unserer Position wohl nicht vermeiden. Gehen wir rein. Vielleicht erfahren wird dort etwas.«
Nicholas folgte ihm den Korridor hinunter bis an die Tür am Ende, durch welche sie in einen Raum voller Menschen gelangten, in dem es sehr laut zuging. Bruni rümpfte die Nase. Wie stets in der Menge, legte er den Kopf in den Nacken und reckte das Kinn in die Luft. »Schleust uns durch diesen Pöbel!« flüsterte er, bahnte sich jedoch selber den Weg bis zum nächstgelegenen Fenster, entnahm seinem Rock ein Schnupftuch, schaute hinaus und wedelte dabei mit dem Tuch vor seiner Nase herum. Nicholas drang bis an die Stirnseite des Raums vor.
Das hier war nur das Vorzimmer, weniger formelle Audienzen gab der Papst nebenan. An der Verbindungstür hielten sich etliche Pagen auf, von denen einige die Livree der Borgias trugen, andere solche in unterschiedlichen Farben. Nicholas schob sich zwischen ihnen bis zur Tür durch. War es im Vorraum düster gewesen, so war der Raum nebenan von goldenem Sonnenlicht durchflutet. Seine Wände waren mit höfischen Szenen bemalt, auf denen sich Menschenmengen tummelten wie diejenigen, die sich hier im Raum befanden. Wegen der vielen sich drängenden Männer und Frauen konnte Nicholas den Papst nicht sehen, er kannte hier jedoch jeden. Schon nach einer halben Minute hatte er die Aufmerksamkeit von drei oder vier Leuten erregt. Sich von der Tür abwendend schob er sich ein paar Schritte die Wand entlang.
Brunis Bemerkung über die fünfzig Kronen fuchste ihn immer noch. Es ärgerte ihn, nicht mehr zu seiner Rechtfertigung vorgebracht zu haben. Er wollte nicht mehr daran denken, wie er sich Stefano Bagliones bedient hatte, der nun Brunis Geld besaß. Bruni stand vor dem Fenster. Er trug einen prachtvollen Rock aus grünem mailändischem Tuch mit einem verschlungenen, in Silberfäden ausgeführten Muster darin. Das fand bestimmt nicht die Billigung der Florentiner Signoria, die von ihren Vertretern ein nüchternes, eher kaufmännisches Aussehen erwartete.
Jemand zupfte Nicholas am Ärmel.
Es war ein Page in den Farben der Borgias, der an seiner sich bauschenden Samtkappe kleine Stiere eingestickt trug. »Seine Heiligkeit sind bereit, den Legaten aus Florenz zu empfangen.«
Nicholas informierte Bruni. Der Gesandte setzte sein Lächeln auf und schritt – Nicholas im Kielwasser – auf die Tür zu.
Um diese Stunde duldete der Papst nur wenige Menschen um sich, die nicht zu seinem Hofstaat gehörten. Tatsächlich saß er nicht einmal in dem goldenen Raum hinter der Anticamera. Der Page geleitete sie durch eine ganze Reihe von Leuten, die sich hier aufhielten und sich ununterbrochen unterhielten. Zur gegenüberliegenden Tür hinausgehend bog der Page um eine Ecke und durchschritt noch eine weitere Tür.
Bruni und Nicholas warteten in dem winzigen leeren Raum, in dem der Page sie zurückgelassen hatte. Gedämpft klang das Stimmengewirr aus dem großen Saal.
»Kommt Ihr mit hinein?« fragte Bruni mit zusammengebissenen Zähnen.
»Vielleicht erreichen Eure Exzellenz mehr, wenn ich nicht dabei bin.«
»Sehr wohl«, sagte Bruni mit einer huldvollen Geste, die wie ein Segen aussah. Der Page kehrte zurück, und Bruni folgte ihm durch die schmale Tür, die zum Papst führte.
Nicholas blieb zurück und spitzte die Ohren. Durch die Tür vernahm er noch die schnellzüngige Ankündigung des Pagen und dann das volltönende Organ von Papst Alexander.
»Da seid Ihr ja, Monsignore Bruni. Ein Jammer, daß Ihr kein Tarock spielt, mit Euch würde das bestimmt mehr Spaß machen.«
Nicholas fragte sich, mit wem der Papst wohl Karten spielte, und vermutete, daß es seine Mätresse Giulia war. Des Papstes liebste Partnerin, seine Tochter Lucrezia, weilte nicht in Rom. Vor der Tür hingen Portieren, und so bekam Nicholas nur sehr wenig von dem mit, was Bruni dem Papst salbungsvoll vortrug. Monatelang hatte die Florentiner Gesandtschaft versucht, den Papst zu bewegen, eine Gefangene aus den Verliesen der Engelsburg freizulassen. Auch bei der heutigen Audienz sollte es um dieses Thema gehen, nicht um die unmittelbare Bedrohung von Florenz durch Valentino.
Nicholas entfernte sich von der Tür, kehrte allerdings nicht durch den sonnendurchfluteten Raum mit den vielen Leuten zurück, sondern ging tiefer hinein in die Privatgemächer der Borgias.
Im angrenzenden Raum, der von einer anderen Seite auf den reizvollen kleinen Hof hinausging, den er vom Korridor aus bewundert hatte, war weißgekleidetes Küchenpersonal dabei, den Tisch mit Tellern und Gläsern zu decken. Er wandte sich dem nächsten Raum zu, hörte Musik und das Lachen einer Frau. Doch ehe er weitergehen konnte, kam ein kleiner, in rosa Seide gekleideter Page aus der Tür gelaufen und stieß mit ihm zusammen.
Überrascht sah der Page ihn an. »Messer Dawson!«
»Guten Morgen, Piccolo!«
Der Page zuckte verwirrt mit den Schultern. Selbstverständlich hatte er Nicholas hier nicht erwartet. Dann sagte er: »Kommt bitte mit mir!«
»Ich bin auf der Suche nach ... «
»Meine Herrin möchte Euch dringend sprechen.«
Nicholas hob fragend die Augenbrauen und folgte Piccolo ins nächste Zimmer. Damit erklärte sich der Ausdruck der Überraschung auf dem Gesicht des kleinen Jungen, als er Nicholas bereits auf dem Weg hierher gefunden hatte. Sie durchquerten den nächsten Raum, in dem ein Mann in Arbeitskleidung dabei war, die Wand abzuschrubben. Der Papst hatte vor, alle Wände in seinen Gemächern ausmalen zu lassen. Der Page führte ihn in die Richtung, aus der die Musik kam.
Sie drang aus einem schmalen, sonnenhellen Raum – die Klänge von Flöten und eines kleinen Clavicémbalos. Auf der Schwelle blieb Nicholas stehen. Der Fußboden bestand aus schwarzen und weißen Fliesen – wie ein Schachbrett. Ein Paar tanzte gleich schwebenden Schachfiguren darüber hin. Der Page ging zu den Musikanten, und Nicholas blieb stehen, um zu warten, bis man ihn bemerkte.
»Ah!« Die Frau hielt unvermittelt im Tanz inne und löste sich aus den Armen ihres Partners. »Messer Nicholas.« Ihr glockenförmig geschnittener, von Juwelen und Metallfäden strotzender Rock schwang um sie herum. »Ihr dürft mir den Fuß küssen«, sagte sie kichernd und raffte den Rock bis zu den Knien, um ihren pantoffelbewehrten Fuß vorstrecken zu können.
Nicholas verbeugte sich tief über einem Knie. »Wie Ihr gesagt habt, Madonna Angela, betrachtet es als geschehen.«
»Werdet jetzt nicht frech«, fauchte sie. »Ich hebe einen der Schlüssel unter meinem Kopfkissen auf. – Ceceo, du kannst gehen.«
»Madonna.« Ihr Tanzpartner verneigte sich und verließ den Raum. Die Musikanten folgten ihm.
»Ich fordere etwas von Euch«, sagte Angela Borgia zu Nicholas.
»Madonna, Euer Wunsch ist mir Befehl.«
»Besitzt Ihr immer noch Euer abgeschiedenes Haus neben dem Kolosseum?«
»Jawohl, Madonna.«
»Könnt Ihr es mir für morgen nacht überlassen?«
»Ich werde Euch den Schlüssel persönlich bringen. Braucht Ihr auch meinen Hausdiener?«
»Nein. Schickt ihn fort. Und Ihr selbst kommt gleichfalls nicht in die Nähe, Nicholas!«
»Wie Madonna wünschen.«
»Ich schicke Piccolo hin, den Schlüssel abzuholen.« Tänzelnd näherte sie sich ihm. Am Gürtel trug sie an einer dünnen Kette einen kleinen Handspiegel. Den nahm sie und betrachtete sich darin, dann vollführte sie eine Wendung, um Nicholas darin anzusehen. »Und Ihr, mein Lieber, braucht Ihr einen anderen Platz für die Nacht? Den kann ich Euch besorgen.« Mit der emaillierten Rückseite des Spiegels berührte sie ihn am Arm.
»Ich bleibe in der Gesandtschaft«, sagte Nicholas.
Madonna rümpfte die Nase, und ihre schwarzen Brauen zogen sich zusammen. Sie war die Einzige von den Borgias, die nicht blond und groß war. Den Spiegel auf Armeslänge von sich haltend, betrachtete sie sich wieder darin und sagte: »Ich werde Piccolo schicken.« Langsam fing sie mit wogenden Röcken wieder an zu tanzen und verfolgte dabei ihre Schritte im Spiegel-
Nicholas verneigte sich und ging hinaus. Kaum hatte er ein paar Schritte gemacht, tauchte der Page wieder auf und führte ihn durch die noch unausgemalten Gemächer zu den bereits fertiggestellten.
In der Sala grande zog Nicholas sich an die Wand zurück und stützte sich auf seinen Spazierstock. Vor ihm gingen die anderen Höflinge umher und redeten miteinander. Nicholas dachte darüber nach, was Angela Borgia von ihm erbeten hatte. Da sie sich außer für sich selbst und ihr Vergnügen im Grunde für gar nichts interessierte, brauchte sie das Haus wohl einerseits nur zu dem einen, auf der Hand liegenden Zweck. Andererseits verfügte sie persönlich über genügend Wohnungen und Häuser und war nicht auf ihn angewiesen. Offenbar steckte mehr hinter der ganzen Sache, als es zunächst den Anschein hatte.
»Gehen wir«, sagte Bruni, der plötzlich neben ihm stand.
Nicholas hatte ihn nicht kommen hören. Er blickte auf und zog die Brauen zusammen, als er sah, wie Bruni die Stirn runzelte.
»Was hat er gesagt?«
Bruni zuckte mit den Schultern, die wegen der in seinem Rock eingenähten Polster noch breiter wirkten. Die Ketten um seinen Hals klirrten. »Er meinte, er könne für die Dame von Forli nichts tun, sie sei nun mal in der Obhut seines Sohnes.«
»Habt Ihr ihn auf das Thema von Valentinos Einmarsch in die Toskana bringen können?«
»Ich konnte ihn gar nicht davon abbringen. Er wollte nicht aufhören, davon zu reden – sagte, wir sollten lieber um unsere eigene Sicherheit besorgt sein als um die der Dame von Forli. Schließlich hätten wir seinen Zorn erregt, weil wir in der Vergangenheit seine Feinde unterstützt hätten. Dann hat er mich wieder rausgeschickt.« Verärgert sah er sich im Kreis der anderen Höflinge um.
»Wieso hat es denn so lange gedauert?« wollte Nicholas wissen.
»Ich mußte warten, bis er sein Kartenspiel zu Ende gebracht hatte.«
»Und mit wem hat er gespielt?«
Bruni bedachte ihn mit einem Seitenblick. »Was spielt das schon für eine Rolle? Mit der göttlichen Giulia.« Er versuchte, seinen Worten einen ironischen Klang zu verleihen.
Nicholas wandte sich zum Gehen. Bruni an seiner Seite schwieg. Sie verließen die Anticamera und traten auf den Korridor hinaus. Die meisten derer, die gewartet hatten, um zur Audienz vorgelassen zu werden, hatten sie entweder bekommen oder waren unverrichteter Dinge nach Hause gegangen. Drei oder vier leichtbewaffnete Männer, die bändergeschmückten Speere in der Hand, lehnten an der Wand und warteten auf ihren Wachdienst, der nach dem Ende der Audienzzeit beginnen sollte. Auf halbem Weg den Korridor hinunter standen in der Nähe eines sonnigen Fensters mehrere Männer und redeten miteinander. Nicholas berührte Bruni am Arm.
»Die Franzosen.«
Plötzliche Lebhaftigkeit im Gesicht, straffte der florentinische Gesandte sich. Die Franzosen beendeten ihre Beratung und kamen im Dämmerlicht auf die Florentiner zu, woraufhin Bruni sich ihnen breitbeinig in den Weg stellte. Von seinem buntgekleideten Gefolge umringt, sah der Kardinal von Rouen den Gesandten Bruni, lächelte, neigte den Kopf, murmelte eine unbestimmte französische Begrüßung, ging um die Florentiner herum und betrat die Sala grande.
»Jetzt ist unser Schicksal besiegelt«, sagte Bruni.
Nicholas nahm ihn beim Arm und führte ihn fort. Als sie einen Teil des Weges bis zum Hof hinter sich hatten, fügte Bruni hinzu: »Sie sind jetzt alle gegen uns. Habt Ihr ihn gesehen? Er hat nicht mal den Anstand besessen, sich nach meinem Wohlergehen zu erkundigen.«
In Wirklichkeit hatte der Kardinal aber genau das getan, allerdings auf französisch, eine Sprache, die Bruni nicht beherrschte. »Ach, vielleicht hatte er es eilig.« Sie gelangten an die Doppeltür, die zum Hof hinausführte.
Es war ein windiger, kalter Tag. Nicholas warf einen Blick zum Himmel, wo sich graue Wolken vor die Sonne geschoben hatten, und überlegte, ob es wohl Regen geben würde.
»Was denkt Ihr?« fragte Bruni.
»Meine Meinung?« Nicholas sah ihn kaum an. »Ein Schranze wie ich hat keine Meinung. Ich tauge nur dazu, Nebensächlichkeiten zu erledigen und dabei mein Leben zu riskieren.«
Lächelnd strich sich Bruni über seinen Bart. »Wie empfindlich Ihr heute seid, Nicholas. Sagt mir Eure Meinung!«
»Glaubt Ihr, sie wäre es wert, daß Euer Gnaden sie sich anhören?«
»Selbstverständlich gebe ich was auf Eure Ansichten, mein Lieber. Aber Ihr müßt zugeben – fünfzig Kronen zu verlieren, kann jeden verleiten, ein unbedachtes Wort zu sagen. Es war nicht Eure Schuld, darüber bin ich mir im Klaren. Und jetzt redet schon!«
»Papst Alexander würde Euch kaum zum Kartenspiel auffordern, wenn er Euren Sturz betreiben wollte.«
»Pah! Ihr seid kleinlich in Eurem Denken.«
»Außerdem haben die Borgias mich gerade um einen Gefallen gebeten.«
»Was für einen Gefallen?«
»Das weiß ich noch nicht.«
»Nicholas, gleich fahre ich aus der Haut. Was für einen Gefallen?«
»Die Nichte des Papstes bittet mich, mein Haus benutzen zu dürfen.«
»Ach, die.« Mit weit ausholender Armbewegung fegte Bruni die ganze Angelegenheit beiseite. »Diese Schlampe! Ihr legt zu viel in die Launen einer Hure hinein.«
Es wurde kalt. Die schräg nach oben sich verjüngende hohe Wallmauer des Vatikans zu Nicholas’ Rechter, strebten sie dem Fluß zu. Nur ein Dutzend Schritte schützte die Mauer sie vor dem schneidenden Wind. Als sie in die Straße unten einbogen, fegte er ihnen mitten ins Gesicht. Ein Stück weiter gabelte die Straße sich, wobei ein Teil unter einem Bogen hindurch zum Ponte Elio führte und der andere den Hang hinauf zurück nach San Pietro. An der Gabelung, in einer Taverne mit Sitzplätzen im Freien, lehnten sich Ausländer in fremdländischer Kleidung über einen Tisch und diskutierten heiß in einer fremden Sprache. Zwei Franziskaner, offensichtlich auf dem Weg zum Vatikan, kamen an Nicholas vorüber.
»Ich glaube nicht, daß sie vorhat, mein Haus selbst zu benutzen«, sagte Nicholas.
»Und ich denke, Ihr seid ein Narr. Ist Euch denn eigentlich nicht aufgefallen, daß die Franzosen uns im Grunde geschnitten haben?«
»Florenz ist ein alter Bundesgenosse Frankreichs. Hätten sie vor, uns zu verraten, würden sie uns mit Aufmerksamkeiten überschütten.«
Wieder machte Bruni eine wegwerfende Handbewegung. »Ich kann Euren Überlegungen nicht folgen.«
»Was haben Seine Heiligkeit noch gesagt?«
»Ich habe Euch alles berichtet.«
»Gestattet er uns denn wenigstens, mit der Dame von Forli zu sprechen, ihr etwas Trost zu spenden? Die Verliese von Sant’Angelo sind die reinste Hölle. Vielleicht könnten sie die Frau dazu bringen, für ihre Freilassung etwas von Wert zu geben; obwohl sie wohl schon so gut wie alles verloren hat, was sie einstmals besaß.«
»Ich sage Euch doch, er will einfach nicht über sie reden. Diesmal hat man uns eine unmögliche Aufgabe gestellt, Nicholas. Eine wirklich unmögliche.«
Sie durchschritten den Torbogen. Vor ihnen drängten sich auf der schmalen Straße Mönche – wieder eine Büßerprozession. Vor Erreichen der Brücke war keine Möglichkeit vorbeizukommen, und Bruni schäumte, derart aufgehalten zu werden.
»Ich verstehe ihn nicht«, sagte Bruni.
»Wen, Exzellenz?«
»Den Papst. Er ist immer derselbe. Was auch geschieht, er lacht, reißt seine Witze, spielt Karten, ist hinter Weiberröcken her. Er besitzt nicht das geringste Gefühl für das, was wichtig ist in der Welt.«
Endlich hatten sie die Brücke erreicht. Nicholas trat an das Geländer, wo sie um die Mönche herumkommen konnten, und blieb stehen, um Bruni den Vortritt zu lassen. In dessen Rücken grinste er, genoß die Bemerkungen seines Dienstherrn über den Borgia-Papst.
»Merkur ist im Verschwinden begriffen«, sagte Bruni über die Schulter hinweg. »Mars steht im Haus des Löwen. Wenn die Sterne gegen einen sind, kann man nichts machen.«
»Die Sterne sind gegen Florenz.«
»Das kann man wohl sagen.«
Nicholas hatte das eher witzig gemeint. Sie waren kurz vorm jenseitigen, mit Läden und Kirchen bestandenen Ufer. Unrat häufte sich unter der Brücke; brauner Schaum ließ erkennen, wie weit das Wasser ging. Das Fährboot nach Trastevere war gerade vorübergefahren; die leichten Wellen des Kielwassers schwappten an den Ufersaum.
»Ihr macht Euch lustig über die Sterne«, meinte Bruni. »Und ich sage Euch, Nicholas, das ist Wahnsinn!«
»Ich sehe nicht ein, wieso ein paar helle Punkte am Himmel den Lauf meines Lebens bestimmen sollen.«
»Dann versteht Ihr die Natur nicht.« Nach Verlassen der Brücke verlangsamte Bruni den Schritt, um sich von seinem Sekretär einholen zu lassen und weiter mit ihm streiten zu können. »Ich sage Euch, die Natur ist aus einem Stück; was in einem Teil geschieht, hat seine Auswirkungen in jedem anderen Teil. Daher der Nutzen, den das Studium der Sterne bringt.«
Nicholas rieb den Daumen am Goldknauf seines Spazierstocks. Brunis Leidenschaft für die Astrologie konnte er nicht verstehen.
»Was soll ich der Signoria mitteilen?« fragte Bruni. »Daß bei der Audienz nichts herausgekommen ist? Sie müssen es unsäglich leid sein, das wieder und immer wieder zu hören.«
»Wie Ihr schon erwähntet, haben sie das Unmögliche verlangt. Nichts wird Valentino zwingen, Caterina Sforza freizulassen.«
»Ach, die. Was kümmert uns die noch? Valentino ist uns an der Gurgel.«
»Doch wohl nicht Valentino selber, oder? Nur ein paar von seinen Leuten.«
Bruni fauchte ihn förmlich an: »Vitelli! Und Oliverotto!«
Valentinos beide Capitani lagen seit eh und je mit Florenz in Fehde. Plötzlich kam Nicholas ein Gedanke. Keiner von Valentinos Capitani war größer und stand mehr in der Gunst seines Herrn als Gianpaolo Baglione. Er blieb stehen.
»Was soll das nun wieder?« fragte Bruni in quengelndem Ton.
Nicholas beugte sich über seinen Spazierstock und richtete den Blick hinunter auf den Fluß. »Ich habe vor kurzem jemanden kennengelernt. Vielleicht ... « Er biß sich auf die Unterlippe.
»Was habt Ihr denn?«
»Ich muß zurück. Da gibt es jemanden in Trastevere, der Licht in unsere Schwierigkeiten bringen könnte.«
»Wann kommt Ihr wieder? Mein Schreiben an die Signoria muß mit dem nächsten Kurier fort.«
»Schreibt den Brief nur, ich werde ihn bei meiner Rückkehr verschlüsseln.«
Nicholas wandte sich in Richtung Ponte Sisto.
Trastevere lag, wie der Name sagte, von Rom getrennt und unterhalb der Cittä Leonina an einem Flußbogen auf der anderen Tiberseite. Es war ein Stadtviertel voller Tavernen und Mietshäuser, Kuhweiden und Befestigungsanlagen, das sich den steinigen Hügel über den Morästen hinaufzog. Cesare Borgia besaß dort einen Palazzo, und das Viertel stand auf der Seite des Papstsohnes. An der ersten Piazza fragte Nicholas nach dem Weg zum ›Fuchs und den Trauben‹. Hinter einem auf quietschenden Rädern dahinrumpelnden Heuwagen schickte man ihn eine vielfach gewundene Gasse hinunter.
Sie führte über die Hügelkuppe hinweg. Auf der anderen Flußseite ertönte eine Glocke, der sich andere zugesellten, um die Mittagsstunde anzuzeigen. Bald würde jeder in Rom heimgehen, um zu essen und den Nachmittag über Siesta zu halten. Nicholas setzte sich in Trab, um den Heuwagen zu überholen, und lief dann die andere Seite des Abhangs hinunter.
Im Gewirr der Straßen und Gassen verlief er sich, wandte sich zwischen baufälligen Häusern hierhin und dorthin. Die Straßen füllten sich rasch mit Frauen, die mit Brotlaiben in den Händen vom Bäcker kamen, und Männern, die Hacken und Rechen geschultert hatten. Die Straße mündete in eine Piazza mit einem alten versiegten Brunnen in der Mitte, der wie eine Kamm-Muschel geformt war. Dort fragte Nicholas nach dem Weg.
Die Taverne lag nur drei Straßen entfernt. Munter schritt Nicholas aus. Es gab an diesem Tag noch viel zu tun. Der offizielle Brief nach Florenz und der Geheimbrief, der ihn begleiten sollte und von dem Bruni nichts wissen durfte, mußten geschrieben und verschlüsselt werden. Die Signoria erwartete von Nicholas, daß er unabhängig berichtete und über jeden Schritt Brunis seine Meinung abgab. Natürlich unternahm Bruni nur sehr selten etwas, da die Sterne ständig gegen ihn standen. Nicholas wurde bewußt, daß er sich nach dem ›Fuchs und den Trauben‹ sehnte – weil er Stefano Baglione wiedersehen wollte.
Er verlangsamte den Schritt. In der schlaglochübersäten Straße vor ihm spielten Kinder Ball. Zu beiden Seiten erhoben sich honigfarben die Häuser, von deren Wänden die Stimmen der Kinder widerhallten. Als er das Ende der Straße erreicht hatte, blieb er stehen.
Eine steile Treppe führte zur nächsten Gasse hinunter. Unten ritt auf einem Esel ein Priester vorbei. Der ›Fuchs und die Trauben‹ lag an der dahinterliegenden Piazza. Nicholas krallte die Finger um den Knauf seines Spazierstocks. Er hatte dort nichts zu suchen. Selbst wenn Stefano wirklich ein Vetter von Gianpaolo Baglione war – woher sollte er wissen, welche Gedanken und Schachzüge dem mächtigen Condottiere durch den Kopf gingen? Nicholas schluckte und fragte sich, was er hier eigentlich tat, da er doch so viel Wichtigeres zu tun hatte. Er eilte wieder die Treppe hinauf, lief zurück in die Richtung, aus der er gekommen war.
Kapitel 2
Die Ständige Vertretung der Republik Florenz beim Heiligen Stuhl hatte in dem im Banchi-Viertel Roms gelegenen Palazzo der Familie Savelli Geschäftsräume gemietet. Vom zweiten Stock des Gebäudes aus konnte Nicholas über die Ziegeldächer der Nachbarschaft hinweg bis zum Tiber hinuntersehen und auf der anderen Seite des Flusses den langen, geschützten Gang erkennen, den der Papst vom Vatikanischen Palast bis zur Festung Sant’Angelo hatte bauen lassen. Das runde Gebäude innerhalb der zinnenbewehrten Mauern hatte, wie andere römische Bauten, einer Vielzahl von Zwecken gedient. Ursprünglich war Sant’Angelo Grabstätte eines frühen Kaisers gewesen. Während der großen Pest, ein paar Jahrhunderte vor Dawsons Zeit, war der Erzengel Gabriel auf der flachen Kuppel des Gebäudes erschienen, um Gottes Barmherzigkeit zu verkünden. Daher der heutige Name: ›Sant’Angelo‹ oder ›Engelsburg‹.
Das Gesicht der Stadt zugewandt, schritt Nicholas die Loggia entlang und versuchte, sich nach dem langen Marsch, der letztlich zu nichts geführt hatte, wieder zu fassen. Am äußersten Ende der Loggia stieß er auf den gebückt die Topfpflanzen begießenden Bruni. Ein Rinnsal Wasser lief unter dem Boden des nächsten Topfes heraus.
»Was habt Ihr herausgefunden?« fragte Bruni.
»Nichts. Seid Ihr mit dem Brief fertig?«
»Er liegt auf meinem Schreibtisch. Urteilt selbst – vielleicht sind die Formulierungen nicht elegant genug, oder alles ist zu ungeschliffen. Die endgültige Fassung erwarte ich noch vor fünf.« Bruni hängte die Gießkanne an einen Haken. »Wie Ihr feststellen werdet, habe ich angedeutet, daß wir die Lage unterschiedlich beurteilen.«
»Verbindlichen Dank«, sagte Nicholas.
Er zog sich in den nächsten Raum zurück, das Hauptarbeitskabinett der Gesandtschaft. Für gewöhnlich waren die Schreiber emsig beschäftigt; über die langen Tische gebeugt, schrieben sie Dokumente und Kopien, was die Müllsammler des Viertels reichlich mit Papier versorgte. Jetzt jedoch waren die Schreiber fort und hielten bis zum späten Nachmittag Siesta. Erst hinterher wurde die Arbeit des Tages wiederaufgenommen. Stapel von Büchern und Stöße von Papier bedeckten die Tische. Die Schemel waren daruntergeschoben, und die Federn ragten aus den Gläsern wie Schwanzfedern eines Vogels. Der Kalfaktor war bereits dagewesen, und der Boden glänzte an bestimmten Stellen noch feucht von seinem Mop. Tintengeruch hing in der Luft. Nicholas hinter sich, öffnete Bruni die Tür, durch die man auf den langen Korridor gelangte, an dem beider Arbeitszimmer lagen.
Die Familie des Gesandten war sehr wohlhabend. An den Wänden seiner Gemächer hingen Wandteppiche aus den Niederlanden. Das reichgeschnitzte und gelegentlich mit Goldtupfern aufgehellte Mobiliar stammte aus Deutschland. An der einzigen fensterlosen Wand standen auf Reihen von Regalbrettern Brunis Bücher. Die Fenster waren alle von dicken Portieren verdeckt, was zur Folge hatte, daß der Raum dämmrig, muffig und eng wirkte. Nicholas ging zum Schreibtisch hinüber. Unter einem Buch lagen zwei mit Brunis zwar liederlicher, aber flotter Handschrift bedeckte Blätter. Nicholas nahm sie und ging in sein Kabinett hinüber, das ganz hinten im Gebäude lag.
In dieser Kammer war nur Platz für einen Schreibtisch und einen Stuhl sowie ein Bücherregal – und Raum für die nach innen aufgehende Tür. Ursprünglich, als er hier eingezogen war, hatte es noch einen zweiten Stuhl gegeben, doch den hatte er herausnehmen lassen, um Besucher abzuschrecken und den Schreibtisch anders hinstellen zu können. Nicholas setzte sich auf den Schreibtischstuhl und las Brunis Brief.
Anschließend wandte er den Kopf und schaute nach draußen. Einer der Fensterläden stand offen. Nicholas konnte über den kleinen, mit roten Ziegeln gepflasterten und von weißem Taubendreck gesprenkelten Hof hinwegsehen, der vier oder fünf Fuß unter seinem Fenster lag, doch hatten die Rebstöcke bereits das sommerliche Laub herausgebildet und trieben ihre Ranken. Nicholas stützte die Ellbogen auf die Schreibtischplatte.
Brunis Brief war ein Meisterwerk der Mehrdeutigkeit. Grundprämisse war, daß Valentino entweder angreifen oder sich zurückziehen würde, es sei denn, er blieb, wo er war. Der Gesandte riet der Signoria, mit dem Borgia-Prinzen zu verhandeln, aber nichts abzuschließen. Das jedoch war ohnehin die traditionelle Strategie der Signoria: abwarten und zusehen, was geschah.
Nicholas konnte sich nicht erinnern, wer im Moment die Hauptverantwortlichen im Stadtstaat waren. Wahlen brachten alle zwei Monate eine völlig neue Regierung an die Macht. Da Nicholas Florenz vor gut zehn Jahren das letzte Mal besucht hatte, waren die meisten dieser Staatsbediensteten bloß Namen für ihn. Bei dem ständigen Wechsel der maßgeblichen Männer an der Spitze traf niemand Entscheidungen, es sei denn, er konnte nicht anders. Gleichwohl haßten die Florentiner Unentschiedenheit bei ihren Untergebenen. Falls die Bedrohung durch die Borgias die Republik teuer zu stehen kam, mußte irgendjemand den Kopf dafür hinhalten, und da Bruni nicht in der Stadt weilte, war er verwundbar.
Auf der anderen Seite vom Hof erschien auf einem Balkon einer von Brunis jungen Gehilfen und hängte Wäsche zum Trocknen auf. Als er Nicholas sah, lächelte er und winkte. Nicholas betrachtete den Brief auf seinem Tisch. Er war ständig bemüht, den Rest der Gesandtschaft auf Distanz zu sich zu halten, doch manche von ihnen lenkten ihn unermüdlich ab. Er wandte sich wieder dem eigentlichen Problem zu, das darin bestand, Ercole Bruni zu einem Helden zu machen.
Nicholas zog seine Code-Bücher hervor und machte sich daran, Brunis Brief zu verschlüsseln. Dabei rückte er Brunis Mehrdeutigkeiten so hin, daß sie seiner eigenen Auffassung entsprachen, der zufolge Cesare Borgia Florenz nicht angreifen würde, sondern nur hoffte, die Signoria ausreichend einzuschüchtern, so daß diese sich von ihm freikaufte. Seit Jahren damit beschäftigt, Brunis Berichte seinen Vorstellungen und Wünschen entsprechend zu frisieren, hatte Nicholas darin eine solche Geschicklichkeit entwickelt, daß er nur eines von zehn Wörtern zu verändern brauchte, indem er etwa eine Zeitbestimmung ausließ oder einen Nebensatz zu einem gewichtigen Hauptsatz machte. Nach einer Weile hielt er inne und schnitt sich einen neuen Federkiel zurecht. Ohnehin würde niemand in der Signoria sich um den Brief scheren, doch durfte hinterher keiner Bruni etwas anhaben und ihn etwa hängen können.
Leider geriet das Schreiben seiner Eingriffe wegen viel kürzer als Brunis Original, und so füllte Nicholas den noch verbliebenen Platz mit einem allgemeinen Überblick über das, was die Borgias seiner Meinung nach mit der Romagna vorhatten.
Dann schrieb er Brunis Original in der blumigen Sprache um, die der Gesandte für einen eleganten Stil hielt.
Als er seine Ausarbeitung in Brunis Gemächer hinübertrug, kam Angela Borgias kleiner Page Piccolo auf seinen bemalten hochhackigen Schuhen den Korridor heruntergeklappert. Nicholas ließ ihn warten. Den Brief gab er Bruni, der gerade las. Indem er vorgab, daß der Schlüssel in seinem Schreibtisch liege, ließ er den kleinen Knaben im seidigen Gewand vor der Tür stehen, ging hinein, zog ein paar Schubladen auf und schob sie wieder zu. Es mußte doch herauszufinden sein, warum die Borgias sein abgelegenes Haus für eine Nacht benutzen wollten. Sie rundheraus auszuspionieren, fürchtete er sich. Angela hatte ihn gewarnt, und die Borgias machten mit Spitzeln kurzen Prozeß. Nicholas beschloß, dem Pagen bis zur Cittá Leonina nachzugehen und festzustellen, wohin er den Schlüssel brachte. Dann nestelte er diesen von seinem Schlüsselbund in der Tasche und gab ihn dem Pagen.
Piccolo brachte den Schlüssel jedoch nicht in die Leoninische Stadt.