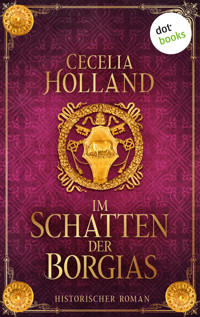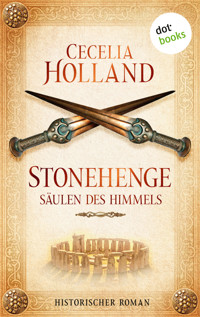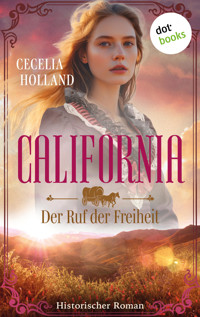Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ein Krieg, der alles verändern könnte: Der historische Roman »Der Erbe der Wikinger« von Cecelia Holland jetzt als eBook bei dotbooks. Im weit entfernten Vinland glaubt der unbeugsame Krieger Corban die Schatten seiner Vergangenheit endlich hinter gelassen zu haben: den dunklen Tag, als Wikinger seine Heimat verwüsteten. Doch dann erreicht ihn eine dringende Nachricht aus Jorvik – und er hat keine andere Wahl als in das Land seiner Todfeinde zurückzukehren. Zusammen mit seinem Sohn Conn und seinem Neffen Raef setzt Corban Segel in Richtung Nordeuropa, wo ein grausamer Mann sich als König von Norwegen ausgerufen hat und Angst und Schrecken unter den Menschen verbreitet. Schon bald bricht ein erbitterter Kampf um den Thron aus, der droht, die Wikingerclans zu entzweien. Corban weiß: Er muss alles tun, um Norwegen vor seinem grausamen Tyrannen zu befreien – denn nur der wahre Erbe kann den Norden wieder vereinen … »Ein fantastisches Werk, das Hollands Status als eine der bedeutendsten Autorinnen Historischer Romane erneut unter Beweis stellt.« Newsweek Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der Wikingerroman »Der Erbe der Wikinger« von Cecelia Holland ist die fesselnde Fortsetzung der Norsemen-Saga, die alle Fans von Bestsellerautor Bernard Cornwell und des Serien-Hits »Vikings: Valhalla« begeistern wird. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 590
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Im weit entfernten Vinland glaubt der unbeugsame Krieger Corban die Schatten seiner Vergangenheit endlich hinter gelassen zu haben: den dunklen Tag, als Wikinger seine Heimat verwüsteten. Doch dann erreicht ihn eine dringende Nachricht aus Jorvik – und er hat keine andere Wahl als in das Land seiner Todfeinde zurückzukehren. Zusammen mit seinem Sohn Conn und seinem Neffen Raef setzt Corban Segel in Richtung Nordeuropa, wo ein grausamer Mann sich als König von Norwegen ausgerufen hat und Angst und Schrecken unter den Menschen verbreitet. Schon bald bricht ein erbitterter Kampf um den Thron aus, der droht, die Wikingerclans zu entzweien. Corban weiß: Er muss alles tun, um Norwegen vor seinem grausamen Tyrannen zu befreien – denn nur der wahre Erbe kann den Norden wieder vereinen …
Über die Autorin:
Cecelia Holland wurde in Nevada geboren und begann schon mit 12 Jahren, ihre ersten eigenen Geschichten zu verfassen. Später studierte sie Kreatives Schreiben am Connecticut College unter dem preisgekrönten Lyriker William Meredith. Heute ist Cecelia Holland Autorin zahlreicher Romane, in denen sie sich mit der Geschichte verschiedenster Epochen und Länder auseinandersetzt.
Die Website der Autorin: thefiredrake.com/
Bei dotbooks veröffentlichte die Autorin ihre historischen Romane »Im Tal der Könige«, »Die Königin von Jerusalem«, sowie ihre Norsemen-Saga mit den Einzelbänden »Der Thron der Wikinger« und »Der Erbe der Wikinger«. Weitere Bücher sind in Vorbereitung.
***
eBook-Neuausgabe Mai 2024
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 2004 unter dem Originaltitel »The Witches Kitchen« bei Forge Books, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 2005 unter dem Titel »Die Gefangenen des Meeres« bei Lübbe, Bergisch Gladbach.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 2004 by Cecelia Holland
Copyright © der deutschen Erstausgabe 2005 by Verlagsgruppe Lübbe GmbH & Co. KG, Bergisch Gladbach
Copyright © der Neuausgabe 2024 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung eines Motives von © Adobe Stock / Nejron Photo sowie mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ah)
ISBN 978-3-98952-192-6
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Norsemen Saga 2« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Cecelia Holland
The Norsemen Saga: Der Erbe der Wikinger
Roman
Aus dem Amerikanischen von Dr. Rolf Tatje
dotbooks.
Für meine Mutter, für Bob Batjer, John Jackson,
David Anderson, Helen Beall, Mike Allen,
und für all die anderen Wandelsterne, die in letzter
Zeit am Ende ihres Weges angelangt sind.
ERSTER TEIL:Die verlorene Insel
Kapitel 1
Bis zum Vormittag hatten sie so viel Kabeljau aus dem Meer gezogen, dass das Boot keinen Fisch mehr tragen konnte. Die Jungen holten ihre Angelschnüre ein und wickelten sie auf, und Corban verstaute den Fischhaken neben dem Mast. Er ging zum Ruder zurück, froh, sich setzen zu können. Die Jungen kletterten im Boot umher, verstauten die Fische und holten die Ruder hervor, wobei sie fröhlich ihre Stimmen erhoben.
»Warte nur, bis Mutter all die Fische sieht!« Conn steckte den letzten der ausgenommenen Fische in einen Korb und klemmte diesen unter den Rand des Dollbords. Er hatte den Fang aufgeschlitzt, und seine Unterarme waren blutverschmiert; auch der Bootskörper, der hölzerne Rahmen, die Ruderbänke, sogar der Mast glitzerten vor Fischschuppen und Blut. Conn zog sein Ruder unter der Bank hervor.
Raef sagte: »Ich habe jetzt schon genug von Fisch, dabei haben wir noch gar keinen gegessen.« Sein Haar glänzte in der Sonne. Er trug kein Hemd und seine Schultern waren krebsrot.
Conn schnaubte verächtlich. »Du findest auch immer was zu meckern. Schnapp dir lieber dein Ruder.«
»Erzähl du mir nicht, was ich zu tun habe.«
Corban, der am Heck an der Ruderpinne saß, blickte auf die See hinaus. Das Gezänk der Jungen ging ihm auf die Nerven. Er griff in den Hohlraum unter dem Heck und zog sein Hemd heraus, schüttelte es aus und streifte es über den Kopf. Schon bei der leichten Berührung durch das weiche Hirschleder zuckten seine sonnenverbrannten Schultern. Wieder ließ Corban den Blick weit hinaus bis zum östlichen Horizont und auf das offene Meer schweifen.
Der Tag war herrlich, warm und ruhig, der Himmel blau und klar, und das Wasser hob und senkte sich in einer sanften Dünung, als würde das Meer gigantische Atemzüge tun. Ein Schwarm Seemöwen erschien hinter dem Boot und stritt sich kreischend um die Fischabfälle, die Corban und die Jungen über Bord geworfen hatten. Corban wartete, bis die Dünung ihn höher hinauftrug, sodass er sich orientieren konnte,- vom Kamm der Welle aus konnte er gerade noch die dunkle Linie des Landes am nördlichen Horizont erkennen.
»Wir werden den ganzen Weg zurück rudern müssen«, bemerkte Raef, der sich mittschiffs auf die Ruderbank gehockt hatte. »Es geht kein Lufthauch. Ich glaube nicht, dass das gut ist ...« Er blickte argwöhnisch aufs Meer hinaus.
»Dann fangt schon mal an zu rudern«, sagte Corban.
Conn setzte sich auf die vordere Bank und senkte sein Ruder in die Dolle. Eine Locke seines schwarzen Haares fiel ihm in die Stirn, und er schleuderte sie mit einem Kopfrucken zurück. »Zieh kräftig durch, Raef.«
Corban lenkte das Boot mit der Ruderpinne auf den dunklen Landsaum zu. Wenn die Jungen sich erst an die Arbeit gemacht hatten, würden sie sich nicht mehr streiten. Sie hatten sich beim Fischen gut gehalten, und Corban war stolz auf seinen Sohn und seinen Neffen, die beide kräftig und bereitwillig und hilfsbereit waren, als er sie brauchte,- sie hatten gut zusammengearbeitet, unermüdlich und zuverlässig.
Das Boot folgte unter der Last der Fische nur zögernd Corbans Hand. Er bewegte das Ruderblatt ein wenig hin und her, um zu sehen, wie es im Wasser lag.
»Wir könnten morgen wiederkommen. Woher hast du eigentlich gewusst, dass die Fische hier sind, Vater?«, fragte Conn.
»Als ich gestern bei der Südspitze war, habe ich gesehen, wie die Wale ihnen folgten«, erklärte Corban. »Legt euch ins Zeug, wir bekommen sicher gleich Wind.« Zu dieser Jahreszeit gab es nachmittags oft Gewitter,- bis dahin wollte er an Land sein. Er sah zum Himmel, wo sich weitere Seemöwen versammelten, deren Kreischen ihm in den Ohren gellte. Eine braune Jungmöwe strich an ihnen vorbei, fast auf Augenhöhe. Mehr als nur eine Kreatur lebt vom Fischfang, dachte er. Eine lange Dünung hob das Boot und rollte unter ihm hindurch auf den fernen Strand zu;unter Corbans Füßen erbebte der hölzerne Rumpf.
»Das Boot ist schwer«, sagte Conn, der angestrengt am Ruder zog. »Das muss der viele Fisch sein.«
»Machen wir, dass wir hier wegkommen«, sagte Raef.
Ein Kribbeln lief Corban über den Rücken, als das Boot sich eine weitere lange Dünung hinunterwälzte und dann den Aufstieg auf die nächste Woge begann.
Plötzlich waren seine Füße nass. Sein Magen zog sich vor Furcht zusammen. »Das Boot läuft voll!« Er hakte die Ruderpinne fest und griff sich den Schöpfeimer. »Es ist wieder leck.« Er blickte sich im Boot um und suchte nach der Stelle, an der das Wasser einströmte. Die Bootshaut, aus Tierhäuten zusammengenäht, bekam immer wieder Löcher; Corban hatte sie so oft geflickt, dass er wusste, wo sich jedes einzelne Loch befand.
»Es ist wieder die Stelle im Bug«, sagte er.
Raef ließ die Arme hängen. »Ich wusste es! Wir sinken!«
Conn fragte: »Können wir das Loch abdichten?«
Corban drückte ihm den Eimer in die Hand. »Du musst schöpfen, Junge!« Er arbeitete sich zum Bug des Bootes vor, zog einen großen Fischkorb zur Seite, während das Wasser seine Füße umspülte, und griff an weiteren Fischkörben vorbei nach der Kiste, in der er sein Ersatzsegel aufbewahrte.
»Raef! Hilf mir!«
Sein Neffe kam mit unruhigem Gesichtsausdruck durch das Boot zu ihm. Sie breiteten das Segeltuch zwischen sich aus und jeder nahm ein Ende. Sie falteten es längs und legten die gefaltete Mitte über den stumpfen Bug des Bootes. Corban beugte sich herunter, zog das untere Ende des Segels unter dem Bootsrumpf hindurch und breitete es über die undichte Stelle im Rumpf. Dann zog er die untere Ecke straff übers Dollbord halb bis zur Mitte des Bootes, zurrte sie fest und ging wieder zum Bug zurück, um Raef auf der anderen Seite zu helfen.
Am Heck bewegte Conn sich auf und ab und schöpfte unermüdlich. Der Eimer in seiner Hand schwang in einem Bogen, der in einem langen braunen Wasserschwall endete, der in die See hinausflog.
Corban befestigte den unteren Rand des Segeltuchs, lehnte sich über die Bootsflanke, packte den oberen Rand des Segels und zog es fest um den Bugrand. Mit halb erstickter Stimme rief Raef: »Onkel, pass auf.«
Corban hob den Kopf. Draußen auf dem glänzenden Wasser durchschnitt eine schwarze Rückenflosse die Wellen und kam auf ihn zu. Mit einem Ruck richtete Corban sich auf, kam auf die Füße und wich ein gutes Stück ins Boot zurück. Eine Gänsehaut überlief ihn. Plötzlich drehte die Flosse ab und umrundete den Bug.
Corban zurrte den Rand des Segeltuchs so fest, wie er konnte. Als er fertig war, ging er zum Mast und nahm den Fischhaken aus der Halterung. Conn schöpfte weiter das Bilgenwasser über Bord.
»Hört erst mal auf«, sagte Corban. »Holt die Riemen und rudert.«
Die Jungen sprangen zu den Ruderbänken und legten ihre Ruder an. Corban stand mit dem Fischhaken in der Hand am Mast. Das Boot schien nun trockener zu sein; offenbar hielt das Segel alles zusammen, jedenfalls für den Augenblick. Die Jungen zogen die Ruder zweimal lang und kräftig durch; die Haifischflosse glitt durchs Wasser und ließ das Boot hinter sich.
Raef atmete durch die Zähne aus. »Die Haie können den Fisch riechen.«
»Red nicht«, sagte Conn. »Rudere.«
Corban setzte sich auf die Heckbank, den Fischhaken auf den Knien. Raef hatte Recht: Das Wasser, das sie aus dem Boot geschöpft hatten, war voller Kabeljaublut gewesen, und das hatte die Haie herbeigelockt. Der lange dunkle Landstreifen vor ihnen schien nicht näher zu kommen. Corban ließ den Blick über das glatte Wasser schweifen und suchte nach Anzeichen für Wind, entdeckte jedoch eine weitere Flosse, die langsam auf sie zu glitt. Einen Augenblick später stieß irgendetwas mit Wucht gegen den Bootsrumpf.
»Vater!«
»Ich sehe schon ...» Corban stand auf, den Fischhaken in der Hand. Er beobachtete, wie der lange graue Körper direkt unter der Wasseroberfläche vorbeiglitt, und stieß kräftig zu. Der Haken rutschte am Körper des Haies ab, worauf er floh. Doch wieder wurde das Boot gestoßen und schwankte. Zwei weitere Flossen glitten durchs Wasser und umkreisten das Boot. Dann kam die größere der beiden Flossen plötzlich auf sie zu.
»Um Himmels willen, rudert!«, rief Corban. Er hielt den Fischhaken bereit und beobachtete den riesigen Hai, der sich langsam dem Boot näherte.
Dann schoss der Hai heran. Seine spitze Nase durchstieß die Wasseroberfläche, und seine Kiefer öffneten sich weit. Die scharfen Zähne rissen die Bootsseite auf wie eine Säge. Corban schwang den Fischhaken und stach die eiserne Spitze auf die Nase des Hais. Die See kochte. Der Hai warf sich herum und verschwand in der Dunkelheit, während das grüne Wasser über seine weiße Flanke rollte.
»Rudert«, brüllte Corban. »Schnell, schnell!« Er starrte auf das große Loch in der Bootsseite. Auf der steifen, harzgetränkten Bootshaut waren die Spuren scharfer Zähne zu sehen,- ein Fuß breit war das Leder vom oberen Rand des Rumpfes abgebissen, und nur das provisorische Dollbord hielt das Boot zusammen.
»Vater ...«
»Ich bekämpfe die Haie, ihr rudert!«
Die Jungen beugten sich wieder über ihre Ruder. Sie bewegten sich taumelnd voran. Wieder lief Wasser ins Boot. Corban griff sich den Eimer und schöpfte, wobei er in der linken Hand den Fischhaken hielt. Sein Blick lag auf der flachen, ruhigen See um sie herum, wo er jetzt fünf Haie umherstreifen sah, dünne und schwarze, nicht den großen Grauen, der sie angegriffen hatte.
»Onkel!«, rief Raef.
Etwas traf das Boot hart von unten und drehte es zu dem beschädigten Dollbord. Wasser strömte ins Leck. Corban verlor das Gleichgewicht und konnte sich gerade noch abfangen, wobei er den Fischhaken in seiner Hand umklammerte. Er ließ den Schöpfeimer fallen und lehnte sich mit seinem ganzen Gewicht gegen die obere Seite des geneigten Bootes. Hinter sich hörte er Conn schreien. Das Boot richtete sich wieder auf und wurde aus dem Meer gehoben. Corban sah, wie der Rumpf sich durchbog, sodass er befürchtete, das Boot würde endgültig auseinanderbrechen und sie alle in das haiverseuchte Wasser werfen.
Der Rumpf hielt. Die Jungen ließen ihre Ruderblätter vor- und zurückfliegen, trafen auf Luft, trafen auf Wasser, schoben das Boot voran. Corban kämpfte sich gebeugt zu dem Leck in der Bootswand vor und sah sich nach etwas um, womit er es flicken konnte. Im selben Augenblick schob sich ein riesiges Maul durch das gezackte Loch, und eine spitze Nase und ein nasser, rosafarbener Schlund hinter einem riesigen Kreis aus Zähnen kam auf ihn zu.
Corban konnte nicht entkommen. Das Maul näherte sich. Ein Gestank wie von Aas überfiel ihn. Er dachte an seine Frau. Er dachte an die Jungen, die ins Meer geworfen wurden. Er schwang den Fischhaken in seiner Hand, und als die Kiefer des Hais sich öffneten, um ihn zu packen, stieß er den Haken in das riesige Maul.
Der Hai biss zu. Der hölzerne Griff wurde in Corbans Hand hin- und hergerissen. Er sah, wie die Kiefer, die vom Fischhaken auseinandergehalten wurden, sich nicht weiter schlossen. Corbans Arm wurde von feuchter Hitze umhüllt. Er riss ihn frei, sodass er zwischen den Zahnreihen herausglitt und sah, dass der Arm so schleimig war wie der Schlund des Haies.
Plötzlich wurde Corban nach hinten gerissen, als Conn ihn am Hemdkragen packte und zur Mitte des Bootes zerrte. Der Kopf des Hais steckte noch in der Lücke an der Bootsflanke; noch immer konnte er die Kiefer nur halb schließen. Der Bootsrahmen bog sich unter seinem Gewicht. Grünes Wasser spülte ins Boot. Plötzlich beulte sich der Rücken des Hais dicht vor der großen Rückenflosse aus. Abrupt brach die eiserne Spitze des Fischhakens durch die Haut. Blut spritzte aus dem Maul des Hais und quoll aus den langen Kiemenschlitzen. Krampfartig zuckend, rutschte der Hai ins Wasser zurück und verschwand. Das Boot richtete sich wieder auf.
»Weg hier!«, rief Corban, setzte sich neben Raef und packte das Ruder.
»Sinken wir?«
»Wir müssen weg hier!«
»Bist du verletzt?«
Corban blickte auf seinen linken Arm: Der durchweichte, hirschlederne Ärmel seines Hemdes war von der Schulter bis zum Handgelenk zerfetzt. Schweigend und verbissen ruderte er weiter. All seine Muskeln zuckten und verkrampften sich. Wieder und wieder sah er das breite rosa Maul vor sich, feucht und schleimig und alles verschlingend. Er stellte sich vor, wie er ganz und gar in diesem engen Schlund verschwand. Raef holte sich den Eimer und schöpfte. In ihrem Kielwasser stürzten sich die kreisenden Rückenflossen plötzlich zu einer einzigen Stelle, an der das Wasser zu kochen begann. In der Mitte der schäumenden Fluten erschien plötzlich wieder der große Hai, oder ein Teil von ihm, von Blut verschmiert. Corban ruderte mit aller Kraft, während sein Arm vor Schmerzen pochte, sein Herz raste und sein Blut rauschte durch die Adern.
Er konnte die Beschädigung des Bootes fühlen. Bei jedem Ruderschlag sah er, wie sich der offene Bootsrahmen öffnete und streckte, wie die Haut sich aufbeulte und Wasser einströmte. Doch den Schaden konnte er beheben. Er musste den Rahmen zusammenbinden und sein Hemd in das Loch stopfen. Aber jetzt ging das nicht; jetzt wollte er nur von den Haien weg. Er beugte seinen Rücken und ruderte.
»Er war so groß wie das Boot, nicht wahr, Vater?«
»Ich hab nicht darauf geachtet«, antwortete Corban. Sie hatten das Boot an der Südspitze seiner Insel auf den Strand gezogen, nahe der Mündung der großen Bucht, und Corban strich Harz auf die neuen Flicken. Sein Körper schmerzte, und er war erschöpft, doch die Arbeit war fast abgeschlossen: Er hatte den Rahmen mit Seil und grünem Kiefernholz ausgebessert, und die Löcher im Bug hatte er mit Moos abgedichtet und kalfatert. Seine Hände und Arme waren bis zu den Ellbogen mit Pech verklebt.
»Es war der größte Fisch, den ich je gesehen habe, nicht viel kleiner als ein Wal«, sagte Conn.
»Ich glaube nicht, dass er so groß war«, entgegnete Raef.
»O doch, und du warst sehr mutig, Raef!«, sagte Conn und stieß ihn an. »Ausnahmsweise.«
»Macht Feuer, ihr zwei«, unterbrach Corban sie.
Er dachte nicht gerne an den Hai und fragte sich sogar, ob es wirklich nur ein Hai gewesen war. Er hatte viele alte Feinde, von denen er hoffte, dass sie ihn vergessen hatten. Dann zwang er sich, an angenehmere Dinge zu denken. Während er das Boot in Stand gesetzt hatte, hatten die Jungen den Kabeljau aufgeschlitzt und mit den Schwanzflossen nach oben an langen Schnüren in der Sonne aufgehängt. Jetzt machten sie Feuer, um die Fische schneller zu trocknen. In ein paar Tagen würden sie so viel getrockneten Fisch haben, dass er für lange Zeit reichte, wenn erst die Kälte eingesetzt hatte. Zwar mochte niemand getrockneten Fisch, doch wenn es nichts anderes gab, aßen ihn alle.
Es war noch viel zu tun, doch Corban hatte nicht die Absicht, die Arbeit nur mit den beiden Jungen allein zu erledigen. Er würde das geflickte Boot um die Insel herum zu seinem Heim an der Bucht im Norden bringen, um seine Frau und seine anderen Kinder herzuholen, damit sie helfen konnten.
Schließlich war er mit dem Boot fertig, setzte sich und rieb sich die Hände und Arme mit Sand ab, doch ohne großen Erfolg. Voller Sehnsucht dachte er an seine Frau, die sich am anderen Ende der Insel befand. Raef kam mit Ästen und Zweigen herbei und ließ sie auf der Feuerlinie fallen. Als er sich suchend nach Conn umblickte, entdeckte er Corban und reckte sich.
»Ich hatte keine Angst heute, draußen auf dem Meer«, sagte er.
Corban lachte und empfand plötzlich eine tiefe Liebe für den unbeholfenen, oft melancholischen Sohn seiner Schwester.
»Ich schon. Bist du ein Dummkopf, Junge, dass du keine Angst hattest?«
Raef errötete, seine Haut hob sich leuchtend rot gegen sein weißblondes Haar ab. »Ein bisschen hab ich mich schon gefürchtet, aber ich ...«
Corban tätschelte seinen Arm. »Du hast dich gut gehalten. Wir leben und wir haben den Fisch. Hol noch mehr Holz. Es wird bald dunkel. Benna wird sich fragen, wo wir bleiben.« Conn kam mit müden Schritten über den Strand auf sie zu, einen großen Stoß Holz auf den Armen. Corban lächelte. Conn versuchte, in allem stets der Beste sein.
Raef druckste herum. »Du segelst heute noch, oder?«
»Nein«, sagte Corban. Er war nicht so verrückt, im Dunkeln mit einem lecken Boot durch flaches Wasser zu segeln. Es war ohnehin nicht die richtige Tide. »Lasst uns ein Feuer machen. Wir können von unserem Fisch essen.«
Sie brieten ein Stück Kabeljau. Corban saß mit dem Rücken an einen Holzklotz gelehnt. Bald war sein Bauch gefüllt und er fühlte sich viel besser. Das sommerliche Zwielicht wurde dunkler und ging in ein nächtliches Blau über. Die Sterne erschienen, und hier und da leuchteten auf dem dunklen, gekräuselten Wasser der Bucht geisterhaft die untergegangenen Lichter. Die Welt war voller Dinge, die Corban nicht verstand, und doch schien es ihm jetzt, dass der Hai doch nur ein Hai gewesen war. Das Boot war in Stand gesetzt; morgen würde er Benna und die Mädchen sehen. Es ärgerte ihn, dass er den Fischhaken verloren hatte, denn er besaß nur wenige Eisenwerkzeuge.
Conn sagte: »Wenn das neue Boot fertig ist, werden wir jedes Mal, wenn wir rausfahren, doppelt so viel Fisch fangen wie heute.«
Corban lächelte erheitert. Raef sagte: »Ich hasse Fisch, Onkel. Wenn das neue Boot fertig ist, benutzen wir es dann nur zum Fischen?«
Corban schlug nach einer Stechmücke auf seinem Arm. »Ist wohl schwierig, mit einem Boot Eichhörnchen zu jagen, Raef.«
Conn brach in lautes Gelächter aus. Raef wurde röter als das Licht des Feuers, doch er blieb beharrlich bei seinem Lieblingsthema. »Können wir nicht woanders hinsegeln?« Seine Augen glänzten. »Könnten wir nicht übers Meer segeln?«
Doch Corban hatte das Thema satt. »Das Boot ist noch längst nicht fertig.«
»Wir haben das meiste geschafft«, sagte Conn. In diesem Punkt waren er und Raef sich ausnahmsweise einmal einig. Sie beugten sich beide zu Corban vor, der eine dunkelhaarig, der andere blond, und in beider Augen spiegelten sich ihre Sehnsüchte und Träume. »Das Boot wird zuverlässig und schnell sein. Warum könnten wir damit nichts übers Meer fahren?«
»Wir müssen noch das Dollbord anbringen und die Ruderbänke einsetzen. Es ist noch lange nicht fertig.«
»Warum willst du nicht dahin zurück, wo wir hergekommen sind?«, fragte Raef.
»Weil es da Könige und Priester gibt«, sagte Corban. »Hier gibt es Haie. Ich ziehe die Haie vor.«
Die beiden Jungen sahen sich an. Corban sagte: »Wir müssen Ruder schnitzen, den Mast aufrichten und ein Segel machen. Das wird harte Arbeit.«
Bedächtig meinte Conn: »Ulf hat gesagt, dass er uns ein Segel mitbringt.«
»Ulf ist jetzt schon seit zwei Jahren nicht mehr gekommen.« Corban stand auf, hob die Arme und streckte sich. »Helft mir beim Feuer.« Sie hatten die Zweige am Ende der Feuerlinie zu einem großen Haufen aufgeschichtet. Corban nahm sich einen Arm voll Zweige, ging an der Reihe von Feuern entlang und beugte sich unter die auf gereihten Kabeljauhälften, um Holz in die Flammen zu werfen.
Er hatte in der letzten Zeit viel an Ulf gedacht, den dänischen Kapitän, der sie hierhergebracht hatte, damals, als sie ihr altes Land hinter sich ließen. Am Anfang war Ulf jedes Frühjahr um diese Zeit herum zurückgekehrt und hatte ihnen Nahrungsmittel und Vorräte und Neuigkeiten mitgebracht; so hatte er Corban stets aufs Neue an die alten Orte erinnert, an Jorvik und Hedeby, und an die Menschen dort.
Damals war ihnen ihr Leben hier vorläufig erschienen, eine Wanderung, keine Ansiedlung. Aber letztes Jahr war Ulf nicht gekommen, und auch nicht in dem Jahr davor, und nun, im dritten Jahr, war der Frühling bereits weit fortgeschritten, fast schon Sommer – und wieder war die Zeit, in der sein Schiff normalerweise in der großen Bucht vor Corbans Insel auftauchte, beinahe schon vorbei.
Es war eine harte und gefährliche Reise, und vielleicht hatte Ulf das Interesse daran verloren. Oder er war tot, und mit ihm war auch das Wissen verloren gegangen, wie man hierherkam, und die letzte Verbindung zwischen diesem Ort und der alten Welt war abgeschnitten.
Wenn es so war, dann war Corban froh darüber. Er konnte sich nun völlig seinem Leben hier widmen und musste seine Gedanken nicht ständig zurück nach Jorvik und Hedeby schweifen lassen. Er kehrte zu seinem Lager zurück, legte sich hin, bettete den Kopf auf den Arm und dachte einen süßen Augenblick lang an seine Frau und an das Haus, das sie gebaut hatten. Doch als er schlief, träumte er immer wieder von dem riesigen Hai, der aus dem Meer gestiegen war, um ihn zu verschlingen.
Am Morgen stieg Benna mit den kleinen Mädchen in die Wälder zum Teich hinauf und holte Wasser. Als sie aus dem Wald zurückkam und auf dem Berggipfel stand, ließ sie den Blick über die Bucht schweifen, doch es war immer noch kein Zeichen von Corban zu entdecken.
Sie blieb eine Zeit lang stehen, schaute zu der langen Meerenge zwischen der Insel und dem Ostufer der Bucht und suchte angestrengt nach Corban. Er und die Jungen waren zum Fischen gefahren; Corban hatte gesagt, dass sie einige Tage fortblieben. Einen Augenblick ließ Benna den Gedanken zu, wie es ohne Corban und die Jungen wäre ... wie es wäre, allein zu sein, für immer. Dann schob sie den Gedanken rasch beiseite. Sie würden wiederkommen. Wenn nicht heute, dann morgen. Benna starrte noch eine Weile auf die Meerenge, als könne sie Corban und die Jungen mit Blicken zurückholen.
Aelfu, die den Säugling trug, folgte Benna, als diese nun die beiden Wassereimer zum Haus trug. Sie ging zwischen dem Haus und ihrem kleinen Garten hindurch und an dem neuen Boot vorbei, das auf stämmigen Holzstützen stand. Die langen Planken des Rumpfes waren fast alle befestigt; wie ein riesiger Fisch hing das Boot an dem Gerüst und verströmte den würzigen Geruch von frischem Holz. Unter dem bauchigen Kiel stand ein Korb voller Nägel, die aussahen wie Eulenköttel; damit wurden die Planken festgemacht. Das Boot zog Benna beinahe magisch an. Sie hatte sogar geträumt, es würde für sie singen.
Außer Atem rief Aelfu nach ihr. Benna blieb stehen und nahm ihr den Säugling ab. Sie ließ einen Wassereimer zurück und ging weiter zum Haus. Aelfu lief ihr hüpfend voraus.
Der Tag war warm und ruhig. Sie hatte genug Beeren gepflückt, um die Mädchen glücklich zu machen, und sämtliche Unkräuter im Garten gejätet; nun blieb nichts anderes zu tun, als in der Sonne zu sitzen und zu zeichnen, während Aelfu und Miru Sandkuchen buken und in der schmutzigen Erde gruben.
Benna zeichnete auf allem, was als Maluntergrund dienen konnte: auf abgeschabten Häuten, wenn sie welche bekommen konnte, auf Holzscheiten und Muscheln und Baumrinde. Nun ließ sie sich neben dem Haus nieder, holte einen flachen Stein, den sie gefunden hatte, und nahm ihren Pinsel.
Sie dachte an Corban, der übers Meer segelte, und zeichnete einen Stör, der aus dem Wasser sprang, wie sie es manchmal gesehen hatte. Der Körper war gekrümmt wie ein Regenbogen. Mit kurzen Pinselstrichen versah sie den Stör mit den Streifen seines Hornpanzers – wodurch sie ihn zu einem kriegerischen Fisch machte -, und malte seine langen Bartfäden. Auf die eine Seite des Störs, neben seiner gespreizten Schwanzflosse, setzte sie die Küste der Insel, drei Linien, die für das Wasser, die Brandung und das Land standen. Auf die andere Seite, unter das breite, offene Maul des Fisches und sein starres Auge, malte sie weitere Linien, die das gegenüberliegende Ufer darstellten.
Sie betrachtete den Stör eine Zeit lang und erfreute sich am schwungvollen Bogen seines Körpers. Dann nahm sie wieder den Pinsel und verlieh dem Fisch über den Bartfäden mit ein paar Strichen Corbans Gesicht.
Aelfu hatte derweil eine kleine Figur aus nassem Sand geformt und setzte sie nun auf die Erde, doch Miru griff prompt danach und zerbröselte sie mit ihren winzigen Fingern. Benna ging rasch dazwischen, lenkte Aelfus Blick auf die Zeichnung und fragte: »Wohin soll ich das hier tun? Sag du es mir.«
»Sie hat meine Frau kaputt gemacht«, jammerte Aelfu.
Benna nahm Miru auf den Arm. Das Kind war schwer und strampelte; es wollte wieder herunter. Benna sagte: »Du kannst dir eine neue Figur machen. Du darfst Miru nur nicht mehr heranlassen.« Sie erinnerte sich, wie sie als Kind Bilder gemalt und wie ihre Schwestern diese zerstört hatten, und Benna hatte sie geschlagen und geschrien und ihnen büschelweise Haare ausgerissen. Nun beugte sie sich zu Aelfu hinunter, fasste sie am Kinn und hob ihr schmollendes Gesicht hoch.
»Nächstes Mal wird die Figur noch schöner.«
»Das sagst du immer.« Aelfu schluchzte. »Aber es stimmt nie!« Sie stampfte mit dem Fuß auf. Böse funkelte sie Bennas Fisch an. »Das da sollten wir ins Wasser werfen. Da gehören Fische hin.« Sie beobachtete ihre Mutter genau, um zu sehen, wie diese die Worte aufnahm.
»Gut«, antwortete Benna. »Ich glaube, du hast Recht. Also los – du trägst den Stein, und ich trage Miru.«
Aelfus Augen wurden ganz groß. Nach einem Augenblick beugte sie sich vor, ergriff den Stein und stapfte zum Strand.
Benna folgte ihr, den Säugling an der Hüfte. Von ihrer Tür fiel das Land über grasbewachsene Hügel zum Strand der Bucht hin ab – ein Wirrwarr aus Felsen, von den Gezeiten aus dem Stein gewaschen und mit Algen und Seepocken bedeckt; dazwischen Streifen und Flecken von Sand. Es war Ebbe. Als sie zum Strand gelangten, flitzten Horden kleiner Krabben in ihre Löcher. Aelfu hielt den Stein mit beiden Händen und stapfte quer über den Strand direkt zum Wasser. Schließlich drehte sie sich um und blickte zurück, um zu sehen, ob Benna sie aufhalten würde; dann, die Füße bis zu den Knöcheln von kleinen Wellen umspült, schleuderte sie den Stein von sich. Kaum einen Meter entfernt platschte er ins Wasser der Bucht.
Stolz sagte Aelfu: »Wenn du willst, kannst du ihn wieder herausholen.« Sie rieb die Hände aneinander.
»Lass ihn, wo er ist«, sagte Benna. Ihr Bild war schon verschwunden, hatte sich im Wasser aufgelöst.
Benna streckte sich. Von hier aus konnte sie über die schmälste Stelle der Meerenge sehen, dort, wo der Fluss in die Bucht mündete. Das letzte Winterhochwasser hatte Unmengen altes Holz angeschwemmt, dazu zwei große Bäume, die nun im flachen Wasser am Ufer auf der anderen Seite gestrandet waren, sodass ihre Wurzeln wie hölzerne Arme in die Höhe ragten. Hier, an der Nordspitze, kam die Insel dem Festland fast bis auf einen Steinwurf nahe. Auf dem schmalen, gelben Strand oberhalb der Flussmündung und des Treibholzes konnte Benna Menschen erkennen – zwei Männer, wie es schien -, die dort standen und zu ihr herüberstarrten.
Benna wusste, wer sie waren. Sie kamen aus einem Dorf in der Nähe, wo sie ein-, zweimal mit Corban gewesen war. Damals hatten die Dorfbewohner sie angestarrt, hatten getuschelt und gelacht, bis Bennas Haut ganz heiß geworden war und sie den Blick nicht mehr vom Boden hatte losreißen können. Diese Leute wohnen hier, hatte sie sich immer wieder gesagt, während ich und Corban Fremde sind und nicht hierhergehören.
Doch die Leute hatten sie und Corban niemals belästigt – keinen aus ihrer Familie -, und Corban kam recht gut mit ihnen aus. Doch Benna selbst war froh, dass zwischen ihnen und ihrem Heim ein Streifen Wasser war.
Plötzlich rief Aelfu: »Guck mal, Mama!«
Benna drehte sich um und blickte in die Richtung, in die das Mädchen wies,- die Brise wehte ihre Haare ins Gesicht, und sie schob sie mit einer Hand zurück. Ihr Herz machte einen Sprung, und voller Freude rief sie: »Corban!«
Unten auf dem frischen, blauen Wasser kam schaukelnd das Boot in Sicht; das Segel blähte sich im Wind. Selbst von hier aus konnte sie Corban an der Ruderpinne sitzen sehen, mit schwarzen Haaren und flatterndem Hemd. Ihr wurde warm ums Herz und sie atmete ganz tief ein.
»Papa!«, rief Aelfu und hüpfte auf und ab. »Papa!«
»Corban«, sagte Benna. Sie bückte sich, nahm Miru auf den Arm und warf noch rasch einen Blick über die Schulter auf die beiden Menschen, die sie vom Strand aus beobachteten. Doch jetzt, da Corban kam, hatte sie Wichtigeres zu tun. Sie nahm Aelfu an die Hand und machte sich auf den Weg, um ihren Mann zu begrüßen.
Kapitel 2
»Da sind sie«, sagte Tisconum. »Jedenfalls ist dort ihr Haus.« Mit dem jungen Fremdling an seiner Seite betrachtete er das Gebäude, als wäre es das erste Mal. Wieder wurde ihm bewusst, wie seltsam dieser Hügel auf der Wiese war, gedrungen und eckig; auf den schrägen Dachplacken wuchs frisches, grünes Gras.
Er hatte Miska so dicht herangebracht, wie er nur wagte, bis an den Rand des Strandes, sodass nur noch der schmale Meeresarm zwischen ihnen und der Insel war. Auf der anderen Seite des kabbeligen Wassers, oberhalb der geschwungenen Bucht, konnte er über die gesamte Lichtung blicken und sah nicht nur das Haus mit seinen Wänden aus verflochtenen Zweigen, sondern auch die anderen merkwürdigen Dinge in dessen Umgebung.
»Da ist eine von den Frauen«, sagte er und deutete mit einer Bewegung des Kinns dorthin. Er blieb vorsichtig, denn er hatte bemerkt, dass sie weit blicken konnten.
Miska knurrte, ging einen Schritt weiter nach vorn, schob den Kopf vor und blinzelte.
»Es hieß, dass sie so weiß wie Birken sind. Ich wusste gleich, dass es nicht so ist.«
Doch Miska sah längst nicht so gut wie Tisconum, und von hier aus konnte er die Gestalt der Frau nur schemenhaft erkennen. Sie stand am Strand an der Mündung der Bucht und hielt einen Säugling auf dem Arm.
Einen Augenblick lang hatte Tisconum das unangenehme Gefühl, dass sie ihn anstarrte. Er wandte den Blick von ihr ab; er wusste auch so, wonach er suchen musste. Er schaute über den Strand und entdeckte das andere Kind.
Miska gab ein harsches Knurren von sich. »Sie sieht uns«, sagte er. »Aber sie hat keine Angst.«
Tisconum blickte wieder zu der Frau. Sie hatte sich vorgebeugt, um das Kind in ihren Armen auf den Strand zu setzen. Der schlaksige Fremdling an seiner Seite drehte sich um und beobachtete den Strand auf dieser Seite. Sie standen auf einer schmalen Landzunge oberhalb der Flussmündung. Miska ging in die Hocke, steckte die Finger ins Wasser, probierte und zog die Augenbrauen hoch.
»Können wir dichter heran?«, fragte er dann und erhob sich.
»Nein«, antwortete Tisconum.
»Am Flussufer da hinten habe ich einen Einbaum gesehen.«
»Nichts da«, sagte Tisconum scharf. »Ich gehe nicht in ihre Gewässer. Und du solltest es auch nicht tun, wenn du klug bist.« Er schnaubte, denn er bezweifelte, dass Miska jemals besonders klug gewesen war.
Miska blickte stirnrunzelnd über die Meerenge, und seine Hand wanderte zu dem Beutel, der an seinem Hals hing. Seine Brust war wie aus Marmor gemeißelt; er war hager und fast so groß wie der hoch gewachsene Tisconum.
»Sieh mal«, sagte Miska. »Was ist das? Ha!«
Tisconum hob den Kopf. Drüben am Strand hatte die Frau sich umgedreht, riss plötzlich die Arme hoch und blickte auf die Meerenge zwischen der Insel und der Küste der Bucht.
»Ja, da kommt er.«
Am Ende der Meerenge kam das kleine Boot in Sicht. Rasch glitt es durchs Wasser, das Segel im Wind gebläht. Ein steifer Wind blies aus Südwesten und die Flut kam. Das dunkelblaue Wasser war von weißen Kronen übersät, wo der Wind den Schaum von den Wellenkämmen riss. Das Boot schaukelte und tanzte und ließ eine dünne weiße Spur hinter sich, während es übers Wasser glitt wie eine Feder im Wind.
Miska murmelte etwas und umklammerte den Fetischbeutel, der an einem Band um seinen Hals hing. Zufrieden verschränkte Tisconum die Arme vor der Brust. »Sie haben viele magische Dinge«, sagte er. »Auch einen Kasten, der Feuer macht. Stein, der kein Stein ist.«
Miska starrte zu dem Boot hinaus. Er hatte den Arm sinken lassen. »Wir haben auch viel Macht. Unser Volk.« Seine Stimme klang halb erstickt.
Tisconum machte ein verächtliches Geräusch. Er hasste Miskas ganzen Stamm, die sich selbst das »Volk der Wölfe« nannten. Sie hatten nicht so viel Macht wie Corban. Sie lebten im Westen, einen langen Marsch entfernt, tief in den Wäldern. Selbst dort waren sie Neulinge, obwohl sie sich aufführten, als wären sie überall die Ersten; sie drängten sich in die alten Jagdgründe anderer und suchten stets den Kampf.
Erst vor wenigen Sommern war das Volk der Wölfe aus dem Westen gekommen; doch ihr Ruf war ihnen vorausgeeilt, und Tisconum hatte schon vor langer Zeit von ihnen gehört. Seitdem sie gekommen waren, hatte ihr Häuptling Brandfuß sich beharrlich in Beratungen und Versammlungen nach vorn gedrängt. Nun hatte er Miska geschickt, diesen grünen Jungen, um nach den Weißen zu sehen, die jedoch Tisconums Sache waren und niemandes sonst, und über die nur Tisconum zu entscheiden hatte.
»Warum interessiert Brandfuß sich überhaupt für sie?«, fragte er. »Sie richten keinen Schaden an. Sie sind nur ... merkwürdig. Und es sind sehr wenige.« Er wich einen Schritt vor einer Welle zurück. Die Flut lief auf und überspülte den Strand. Einen Augenblick spürte er, wie die große, dunkle, kalte, salzige Bucht nach ihm griff, und er zog sich hastig auf die trockene Erde hinter ihm zurück.
Das Boot tanzte auf ihn zu, an der Flussmündung vorbei in die Meerenge, wo es aus dem Wind fuhr. Ein einzelner Mann saß hinter dem Segel. Während das Boot in der Strömung voranglitt und das Segel erschlaffte, stand der Mann auf, ging zum Mast in der Bootsmitte und holte das Segel ein. Tisconum sah, dass es Corban war, und hoffte, dass der ihn nicht bemerkte. Corban saß nun in der Mitte des Bootes, legte zu beiden Seiten Paddel aus und ließ sich vom Tidestrom helfen, das Boot zum Strand zu lenken, wobei er mit den Paddeln steuerte.
Miska atmete seufzend aus. Tisconum warf ihm einen scharfen Blick zu. Das Gesicht des entschlossenen jungen Mannes leuchtete. »Ich will es machen.«
»Das ist ganz und gar nicht unsere Art«, entgegnete Tisconum verärgert. »Das ist alles Magie, und wer weiß, was es bedeutet. Komm schon. Ich will nicht hierbleiben,- die Flut kommt, und die Marsch läuft voll. Wenn wir zu lange warten, wird uns der Weg abgeschnitten.«
Doch Miska bewegte sich nicht, starrte immer noch über das Wasser. Die Frau war zum Boot gewatet. Der Mann sprang hinaus. Einen Augenblick standen er und sie zusammen bis zur Hüfte im Wasser, und ihre Gesichter berührten sich. Am Strand hinter ihnen hüpften und schrien die beiden Kinder. Der Wind verwehte ihre Stimmen.
Miska fragte: »Sind das alle?«
»Nein«, antwortete Tisconum. »Es gibt noch zwei Jungen, die alt genug für die Feuerzeremonie sind, obwohl diese Leute ...« Er winkte ab, als ihm einfiel, dass auch Miskas Volk keine Feuerzeremonie kannte. »Sie sind hier geboren. Alle Kinder sind hier geboren. Und es gibt noch eine weitere Frau.«
Auf der anderen Seite liefen der Mann und die Frau nun aus dem Wasser. Die Frau hatte den Mann am Ärmel gefasst, zog daran, redete zu ihm. Als sie beinahe die Wasserlinie erreicht hatten, drehte er sich zu ihr und streifte das Hemd ab.
Miska unterdrückte einen Schrei. »Er ist weiß!«
Tisconum lachte erheitert. »Das hast du mit eigenen Augen sehen müssen, nicht wahr? Sie sind alle so. Einer der Jungen hat Haare, so weiß wie Eulendaunen. Und in ihren Augen ist ein blasser Ring. Man kann in ihre Augen sehen, als würde man in Wasser blicken.« Er lächelte und sah mit Befriedigung, dass Miska wieder den Fetischbeutel um seinen Hals umklammerte. Er warf einen Blick zu Corban hinüber, der sich auf den Sandstrand gehockt hatte, um seine kleinen Kinder zu begrüßen, während seine Frau mit dem Hemd zum Haus hinaufging.
»Sie sind Dämonen«, sagte Miska. Er umklammerte fest den Beutel. »Sie sind böse. Es ist abscheulich.«
Tisconum schnaubte. »Ach, komm schon. Du hast sie gesehen. Was willst du noch?«
Endlich folgte Miska ihm vom Wasser weg. Sie gingen auf einem gewundenen Weg über den schwarzen, sumpfigen Boden, der dicht mit hohen Binsen bestanden war und vor Krabben wimmelte. Tisconum fragte sich, wie viele Nächte er Miska noch in seinem Haus beherbergen musste,- er wünschte, er wäre geblieben, wo er hingehörte.
»Wie hat Brandfuß eigentlich von ihnen gehört?«, fragte er.
Miska hatte in Gedanken auf den Boden gestarrt. Nun hob er den Kopf und blickte auf Tisconum. »Jeder weiß von ihnen. Sogar weit im Westen bis zum Land des Großen Stromes wird von ihnen gesprochen.«
Tisconum runzelte die Stirn. »Und warum interessiert er sich plötzlich für sie? Gerade jetzt? Sie sind schon seit Jahren hier.« Länger als das Volk der Wölfe, hätte er beinahe hinzugefügt.
Tisconum und Miska gelangten auf höheres, trockeneres Gelände, wo kleine runde Felsen durch die angeschwemmten Blätter lugten; der Pfad wurde schmaler, und Miska lief hinter Tisconum.
»Wie sind sie hergekommen? In dem Boot?«
Tisconum knurrte. Er wollte keine Fragen mehr beantworten. Besonders keine offensichtlichen: Corban und seine Leute hatten die Insel tatsächlich in einem Boot erreicht – nicht mit diesem, sondern mit einem viel Größeren, das aus dem Weltwasser kam, von weit hinter den Inseln, wo das Land endete.
Viel mehr gab es allerdings nicht zu berichten. Corban und seine Leute waren ruhig und friedlich und machten keine Schwierigkeiten, auch wenn überall im Umkreis der großen Bucht in den Dörfern hier und da die Leute zornig von Fischgründen raunten, in denen es kaum noch etwas zu fangen gäbe, und dass niemand mehr zur großen Insel gehen könne. Tisconum war langsam und behutsam vorgegangen, um festzustellen, welcher Nutzen sich daraus ergeben könnte. Durch Vorsicht und Geduld hatte er Corbans Vertrauen gewonnen – hatte ihn sogar gelehrt, Geschenke zu machen, darunter die großen Venusmuscheln aus dem Herzen der Bucht, in denen man die besten Perlen fand. Natürlich gab es stets Leute, die in allem nur das Schlechte sahen, doch Tisconum hatte sie inzwischen zum Schweigen gebracht. Und er musste unbedingt Brandfuß aus der Sache heraushalten, denn er wollte nicht, dass Brandfuß oder Miska Corban von Angesicht zu Angesicht gegenübertraten, vielleicht mit schöneren Geschenken als er selbst.
Tisconum schritt schneller aus, als sie den Wald erreichten. Rasch führte er den jungen Fremdling zurück in sein Dorf auf dem höher gelegenen Land hinter der Marsch.
Miska verschwand bei Anbruch der Morgendämmerung.
Der Wald hier war nicht wie in seiner Heimat. Es gab mehr Kiefern, besonders in der Nähe des Wassers, und die große Bucht, die sich mit ihren verstreuten Inseln landeinwärts erstreckte, ließ alles offener und weiter erscheinen. Auch die Gerüche waren anders. Die Kiefern und der Wald im Landesinnern machten die Luft angenehm und würzig, doch über allem lag der durchdringende, scharfe Salzgeruch des Meerwassers und der Gestank verrottender Pflanzenteile, die an den Strand gespült worden waren. Miska hatte das Wasser probiert: Es war Salzwasser, das man unmöglich trinken konnte.
Er war ganz nah am Weltwasser, von dem er nur in Legenden gehört hatte. Irgendetwas ließ seine Haut kribbeln, wenn er nur daran dachte.
Der Boden war nass und schwarz. Unter den Bäumen wuchsen Blumen, die er nie zuvor gesehen hatte. Er erkannte einige der Vögel, die im Wald um ihn herum sangen und schrien, aber nicht alle – nicht dieses plötzliche Kreischen, und auch nicht das seltsame, hohe, wunderschöne Trillern.
Miska entfernte sich von Tisconums Dorf. Er wollte nie wieder dorthin zurückkehren. Und er hatte alles mitgenommen, was er von daheim mitgebracht hatte. Er verstaute sein Bündel zwischen den knorrigen Wurzeln einer hohen Kiefer und ging am Flussufer entlang zu der Stelle, wo er am Vortag einen Einbaum gesehen hatte.
Das Boot, das aus einem Baumstamm gefertigt war, befand sich noch an Ort und Stelle, und es lag sogar ein Paddel darin. Miska zog den Einbaum den Fluss hinunter zur Bucht.
Die Sonne ging gerade auf. Das dunkle Wasser, über dem Nebelschwaden trieben und wie Rauch in die Luft aufstiegen, breitete sich glatt und ruhig vor ihm aus. Der Dunst ließ die Insel vor seinen Augen verschwimmen, sodass sie über dem Wasser zu schweben schien. Das Licht der aufgehenden Sonne verbreitete sich auf der Wasseroberfläche und der Nebel wurde zusehends dünner. Die Spitzen der Bäume auf der Insel glühten.
Wind kam auf und wehte ihm plötzlich wärmer ins Gesicht.
Schließlich stieg Miska in den Einbaum und ruderte ins tiefe Wasser hinaus. Sein Leben lang hatte er Flussboote benutzt und hatte deshalb keine Schwierigkeiten mit dem Einbaum, auch wenn er im Vergleich zu den schlanken Kanus seines Volkes träge und langsam war. Der Himmel über ihm wurde strahlend blau, während der Dunst, der aus dem Wasser stieg, immer noch die ganze Insel verhüllte; nur die Spitzen der Bäume auf dem Hügel schauten heraus. Weit hinter ihm, in der Marsch, begannen Kraniche zu schreien. Ganz in seiner Nähe platschte ein Fisch. In den oberen Ästen der Bäume sah er die großen Zweighaufen der Fischadlernester. Durch den Dunst konnte er jetzt den eigentümlichen Umriss des Hauses ausmachen, das hoch oben auf dem sanften Abhang stand, oberhalb des Strandes.
Die Leute schienen fort zu sein, denn das Boot war nirgends zu sehen, und die Wiese war leer. Miska roch auch keinen Rauch und sah keinerlei Bewegung. Er berührte den Fetischbeutel um seinen Hals und bat um ein Zeichen, was er jetzt tun sollte. Er wollte auf der Insel landen und so dicht an das Haus heran, wie er nur konnte. Wenn die Bewohner nicht da waren, würde es einfacher sein.
Er erinnerte sich an den Mann, den er am Tag zuvor gesehen hatte, und wie fremdartig er war. Eigentlich kein Mann: eine Art Tier. Ein Bär vielleicht. Sein dichtes schwarzes Haar bedeckte seinen Kopf und sein Gesicht, wie bei einem Bären. Miska beneidete den Mann, wie rasch und sicher er mit dem Boot umgegangen war; der Einbaum schien im Vergleich dazu beinahe unbrauchbar. Vor allem aber erinnerte er sich an die kalkweiße Haut des Mannes.
Er hatte die ganze Nacht daran gedacht, als er diese Fahrt zur Insel ins Auge gefasst hatte. Vielleicht war es ein Fluch – diese Leute waren verflucht, verstoßen,- das erklärte viel. Oder sie waren Geister, die nicht wussten, wie Menschen unter ihren Kleidern aussahen. Oder sie waren einfach nur Betrüger. Miska war ein wenig wütend, dass Tisconum sie duldete.
Jedenfalls waren sie keine richtigen Menschen, selbst wenn sie keine Geister waren, nur verfluchte Ausgestoßene. Vielleicht waren sie hier gewachsen, so wie Pilze, von denen manche ja ebenfalls weiß waren. Oder sie waren aus dem Meer gekrochen und vom Wasser gebleicht wie Fische.
Was auch immer er war – Miska hasste den Mann. Wenn er ihn auf der Insel antraf, könnte er versuchen, ihn zu töten.
Der Einbaum pflügte gleichmäßig durch das flache Wasser. Der Nebel lichtete sich, und bald sah Miska das Haus viel näher – den Eingang, die Büsche gelber Wildblumen, die auf seinem Dach wuchsen. Dahinter, auf der zertrampelten Wiese, befand sich eine kleine, viereckige Hütte; ein wenig abseits stand ein großer, langer, hohler Gegenstand auf stelzenartigen Beinen, dessen Körper an beiden Enden spitz auslief, wie eine Art hölzerner Fisch.
Miska stach das Paddel ein und bewegte den Einbaum in Richtung des Strandes.
Plötzlich rollte eine Welle auf ihn zu, und der Einbaum ruckte und zuckte und schaukelte vor und zurück. Miska stieß das Paddel in die Fluten und suchte nach ruhigerem Wasser. Das Paddel zuckte und drehte sich in seinen Händen, als wäre es lebendig.
Plötzlich richtete der Bug des Einbaums sich auf, und das Boot drehte sich in einem Wirbel, bevor es in einen Schlund aus Wasser gesogen wurde: Der Einbaum kippte vornüber und schoss auf der Innenseite des Schlundes herunter bis auf den Grund der Bucht.
Miska kamen die Eingeweide hoch. Er ließ das Paddel fallen, klammerte sich an die hölzernen Flanken des Bootes, lehnte sich zurück, um aufrecht zu bleiben, und sah direkt in den tosenden Wirbel hinein. Der kalte und feuchte Wind, der ihm ins Gesicht schlug, trieb seinen Schrei in die Kehle zurück.
Dann rauschte das Wasser aus der Mitte des Loches direkt zu ihm hinauf. Eine riesige, schäumende Fontäne explodierte aus dem Auge des Strudels, erfasste den Einbaum und schleuderte ihn empor.
Miska verlor den Halt. Er segelte durch die Luft und schlug mit dem Rücken so hart aufs Wasser, dass es ihn benommen machte. Dumpf hörte er den Einbaum neben ihm aufschlagen. Die wirbelnden Fluten zerrten an seinen Füßen wie eisige Hände und zogen ihn hinunter. Das Wasser schlug über seinem Kopf zusammen. Er sah, wie das Sonnenlicht, fahl und grün und verschwommen, über ihm verblasste. Salzwasser sickerte in seine Lungen. Dann trafen seine Füße auf festen Untergrund, er stieß sich ab und schoss zur Wasseroberfläche, als ihm von Atemnot schon schwarz vor Augen wurde.
Sein Kopf durchbrach die Wasseroberfläche; keuchend sog er die frische, reine Luft ein, füllte seine Lungen. In seinem Kopf drehte sich alles. Das Wasser war nun wieder ruhiger; mit den Händen rudernd, drehte Miska sich um die eigene Achse und suchte nach dem Strudel.
Er war verschwunden. Die Bucht lag glatt und still da. Ein kleines Stück entfernt trieb der gekenterte Einbaum. Miska schwamm dorthin und hielt sich daran fest. Er war immer noch außer Atem und seine Haut war rau vor Kälte und Furcht.
Er berührte den Fetischbeutel an seinem Hals und flüsterte einen Dank an seine Großmutter, deren machtvoller Zauber ihn gerettet hatte. Dann legte er erschöpft den Kopf auf den Einbaum und versuchte eine Zeit lang, nicht daran zu denken, wie nahe er dem Tod gewesen war.
Er war nicht gestorben. Und nun schämte er sich, dass er Angst gehabt hatte.
Miska beobachtete, wie ein riesiger, entwurzelter Baum an ihm vorübertrieb. Die langsame Strömung trug auch Miska mit sich und an der Mündung des Flusses vorbei, die von Treibholz verstopft war. Er drehte sich um und sah in die Gegenrichtung, zur Insel hin. Durch das überflutete Schilf erblickte er die Öffnung einer kleinen Bucht, die von der Landzunge beschützt wurde, auf der das merkwürdig gebaute Haus stand. Er zog sich höher auf den Einbaum, mehr in die Sonne, und fühlte sich gleich besser. Über ihm auf dem Abhang sah er das Haus,- dahinter, halb verborgen, stand dieses seltsame hölzerne Ding, das ihn ein wenig an das Boot erinnerte. Es war nicht die geringste Spur von Menschen zu entdecken.
Zumindest hatte ihn niemand gesehen, dachte er erleichtert. Er hatte wie ein Dummkopf ausgesehen, aber niemand hatte es mitbekommen.
Sein Brustkorb schmerzte. Das Wasser war kalt, und er war kein guter Schwimmer, und so trug die Strömung ihn und den Einbaum weit von dem kleinen Strand fort, wo er losgefahren war. Er fragte sich furchtsam, was unter ihm leben mochte, in der Kälte und Dunkelheit. Verbissen zog er sich ganz auf den gekenterten Einbaum, streckte sich auf dessen Boden aus und paddelte mit Händen und Füßen.
Während er sich dem Strand näherte, ging er im Geiste immer wieder durch, was passiert war, sodass er Brandfuß und den anderen davon berichten konnte, wenn er zurückkehrte.
Miska fragte sich, ob sie ihm glauben würden. Wahrscheinlich nicht.
Auf dem Einbaum ausgestreckt, versuchte er mühsam, den plumpen Holzklotz in Richtung Strand zu drehen, wobei sich in seine Verzweiflung heißer Zorn auf den weißhäutigen Mann mischte, der ihn wie einen Dummkopf hatte aussehen lassen.
Als Miska schließlich den Strand erreichte, waren seine Arme so kraftlos, dass er sie kaum heben konnte. Als er den Einbaum auf den Strand hievte, entglitt er seinen tauben Fingern und fiel in den Sand. Miska ließ ihn liegen. Er war froh, dass er nicht in Tisconums Dorf zurückkehren musste, wo jemand seinen Fehlschlag beobachtet haben konnte und wo sie jetzt vielleicht schon die Geschichte erzählten und über ihn lachten.
Er hätte den weißhäutigen Mann am liebsten getötet und seine Leiche in den Staub getreten.
Miska ließ den Einbaum zurück und überquerte die Marsch, nahm sein Bündel und machte sich auf den Weg nach Westen. Er war triefnass, doch beim Marschieren würde er trocknen. Er erreichte den Waldrand und wanderte unter den Bäumen entlang, wobei er einem alten, schmalen Hirschpfad folgte, der durchs dichte Unterholz führte. Im tiefen Schatten der Bäume stand er plötzlich einer Frau gegenüber, die so weiß war wie eine Holunderblüte.
Wie angewurzelt blieb er stehen und hielt den Atem an. Tisconum hatte gesagt, dass es noch eine andere Frau gab, und Miska wusste sofort, dass es diese hier war. Sie stand vor ihm, ohne Angst, blickte ihn an und ließ weder Willkommen noch Furcht erkennen. Ihr wildes, schwarzes Haar war zerzaust; Blätter hatten sich darin verfangen. Ihr Gesicht war hager und ihre Augen so riesig, als ob sie nur lebte, um zu sehen. Um die schwarzen Pupillen lagen hellgraue Ringe, die wie Sturmwolken aussahen. Miska konnte ihren Atem hören. Er sah, wie sich ihre Nasenlöcher blähten, während sie ihn anschaute.
Miska blickte in ihre grauen Augen, in denen ein unbestimmbares Versprechen lag, das ihn schwindlig machte und leicht schwanken ließ.
Dann drehte sie sich um, und ihr Blick ließ ihn los. Augenblicke später war sie verschwunden, als würde sie sich in Luft auflösen, sobald sie ihn nicht mehr ansah.
Miska stieß einen Schrei aus. Er sprang mit ausgestreckten Händen vor, um sie zu packen, und griff in die Luft. Er wirbelte herum, ließ den Blick in die Runde schweifen. Fort. Sie war verschwunden. Miska ließ sich auf die Knie fallen und senkte das Gesicht auf die Erde, dort, wo sie gestanden hatte; dann nahm er einen tiefen Atemzug von ihr, einen Duft nach Frau und Moos und Zeit.
Schließlich erhob er sich wieder und streckte sich; sein Herz schlug wild. Sie war fort. Und doch hatte sie sich ihm absichtlich gezeigt. Eine Warnung. Er griff nach dem Beutel an seinem Hals, der voller Zauber war, die versagt hatten ...
Nein, sie hatten nicht versagt. Sie hatten ihn vor dem Strudel beschützt, und sie hatten ihn auch beschützt, als sich ihm diese Geisterfrau gezeigt hatte. Ihr Duft lag noch in seiner Nase, und seine Augen brannten, weil er sie angeschaut hatte. Sie hatte sich nicht gefürchtet; sie hatte gewollt, dass er sie sah.
Er beugte sich wieder zur Erde und fuhr mit den Fingerspitzen über die Stelle, wo sie gestanden hatte. Etwas Kleines, Scharfes drehte sich unter seiner Berührung, und Miska hob einen weißen Kieselstein auf. Er öffnete seinen Fetischbeutel und tat den Kiesel hinein.
Er würde die Frau wiedersehen. Er musste sie Wiedersehen. Eine plötzliche Woge der Begierde erfasste ihn. Irgendwie hatte sie ihn mit ihrem Blick in sich aufgenommen.
Miska beschloss, den Mann zu töten, die Frau aber nicht. Er umklammerte den Fetischbeutel und gab sich selbst dieses Versprechen. Er würde sie nehmen, wie sie ihn genommen hatte.
Der Wind frischte auf und bewegte die Äste und Zweige der Bäume um ihn herum. Ihm war kalt. Rasch ging er den kleinen Pfad weiter, immer in Richtung Westen, um die Neuigkeiten über all diese Geschehnisse zu Brandfuß und dem Volk der Wölfe zu tragen.
Kapitel 3
Es war Ebbe. Das Boot lag wie eine gestrandete Qualle auf dem schwarzen Schlick des Strandes. Raef folgte Corban zu den Sanddünen hinauf, die direkt über der Hochwasserlinie kleine Hügel bildeten und von Büscheln aus Schneidegras gekrönt waren.
Sie hatten den gesamten Fisch getrocknet und im Lagerhaus verstaut, und zur Belohnung hatte Corban den Jungen bis zum Einbruch der Dunkelheit das Boot überlassen. Conn hatte sich sofort zur Mündung der Bucht aufgemacht, wo der lange Strand auf der Seeseite an einen breiten Streifen aus Wald und Wiesen grenzte. Im Herbst und Winter hatten er und Raef dort oft gejagt, aber im Sommer zog die einheimische Bevölkerung dorthin, baute ihre Fischerdörfer und jagte selbst, und Corban hatte die Jungen gewarnt, diesen Leute nicht in die Quere zu kommen.
Dennoch hatte Conn vor, ein paar Schlingen auszulegen, und Raef konnte ihn nicht davon abbringen.
Raef folgte seinem Vetter den sanften Abhang des Strandes hinauf. Weiter oben verwandelte sich das Land in Streifen aus Marschland und Wiesen,- der Wald – Ahorn und Kiefern – bedeckte die höheren Hänge weiter im Binnenland. Raefs Füße versanken im trockenen, lockeren Sand oberhalb der Hochwasserlinie, über die im Zickzack die gegabelten Spuren der Seevögel verliefen. Hier und da spross das Schneidegras hervor wie große grüne Haarbüschel. Am Rand der Marsch lag ein riesiger grauer Felsblock. Conn kletterte hinauf, richtete sich auf und beschattete mit der Hand die Augen, um landeinwärts zu blicken.
Raef setzte sich an den Fuß des Felsblocks und blickte auf die See zurück, die in langen, hohen Wellen von Süden auf den Strand lief. Weiter draußen gab es noch andere Inseln. Es strengte seine Augen an, nach Osten in die dunstige Ferne zu blicken. Früher am Tag hatte Raef nach Venusmuscheln getaucht, und jetzt verbrannte die Sonnenglut seine nackten Arme und Beine, doch er zitterte trotzdem und bekam eine Gänsehaut, und es juckte ihn überall.
Er kämpfte gegen dieses Gefühl an. Er hasste es, so zu sein. Niemand sonst fühlte sich so – außer seiner Mutter, die sang und schrie und in den Wäldern lebte,- nie bekam jemand sie zu Gesicht, und alle sagten, dass sie verrückt wäre. Kurz bevor der Hai das Boot angegriffen hatte, hatte auch er sich so gefühlt. Raef erinnerte sich daran – es war mit Bissen und Zuckungen über ihn gekommen. Damals hatte er es nicht begriffen, aber jetzt, im Rückblick, wusste er es.
Es hatte nichts genützt. Corban hatte sie gerettet, wie immer. Er schüttelte das Gefühl ab und verschloss seinen Verstand davor.
Conn rutschte von dem Felsblock herunter. »Ich sehe nichts. Da ist bloß ein Dorf, weit weg von hier, fast oben auf der Hügelkette. Lass uns weitergehen« Er rieb seine großen Hände an der Brust und blickte sich um.
»Meinst du?«
»Stell dich nicht so an, Raef.«
Conn hatte vor nichts Angst. Conn zitterte nie. Er stand neben dem großen Felsen und zeigte über die Marsch.
»Da ist keine Spur zu entdecken, siehst du? Wir könnten zu dem Bach da drüben und am Ufer entlang zum Wald gehen. Solange die Sonne so hoch steht, wird es auf dem nassen Boden nicht viel Wild geben, wir aber können leicht erkennen, ob die anderen hier sind. Wir könnten aber auch direkt zu dem Ahornwald da drüben gehen. Vielleicht stöbern wir einen Hirsch auf.«
Stur sagte Raef: »Der Onkel sagt ...«
Conn fuhr zu ihm herum. »Willst du dir dein Leben lang von meinem Vater sagen lassen, was du zu tun hast?«
Raef erwiderte nichts. Sie waren niemals in der Lage, einen Hirsch zu erlegen, selbst wenn sie tatsächlich einen aufstöbern sollten. Der braune Panzer einer Krabbe lag halb vergraben im krustigen Sand vor seinen Füßen, und er grub ihn mit den Zehen aus.
»Also, ich geh meinen eigenen Weg«, fuhr Conn fort, dreht sich wieder um und starrte über die Wiese hinweg zu den Bäumen, wo jetzt lärmend ein Vogelschwarm wie wirbelnde, braune Blätter in die Luft aufstieg. Das Vogelgeschrei wehte schwach aus der Ferne herüber. »Ich will nicht ohne Fleisch nach Hause kommen.«
Raef hob den alten Panzer auf. Der größte Teil war zerbröselt; nur der runde Rand und eine Schere waren noch übrig. Raef brach die Schere vom Krabbenpanzer ab und steckte sie in den Sand.
»Vater geht überall hin«, sagte Conn, »den ganzen Sommer. Warum sollten wir das nicht auch können?«
Raef dachte über Corban nach. Dann fragte er plötzlich: »Was denkst du, warum er über das alte Land nicht einmal reden will?«
»Du hast ihn doch gehört«, antwortete Conn. »Könige und Priester. Komm schon.« Er lief die Flanke der Düne hinunter und seine Füße wirbelten den Sand auf.
In Bennas Geschichten gab es auch Könige und Priester, und nicht alle waren so böse, wie Corban sagte. Benna erzählte Geschichten von wunderbaren Ländern, von Hedeby und Jorvik, Dänemark und England, wo riesige Tiere die Menschen auf ihren Rücken trugen, wo die Männer mit Zauberwaffen kämpften und die Menschen in großen Dörfern und Städten lebten und jeden Tag tanzten und feierten. Manchmal malte sie Bilder, um sie ihnen zu zeigen, doch Raef glaubte, dass Benna sich das meiste bloß ausdachte.
Er folgte Conn in die sumpfige Marsch, in der Büschel des scharfen Schneidegrases wuchsen.
Er dachte immer noch an Corban, und woher er gekommen war, und warum er nicht mehr in seine Heimat zurückkehren wollte. Ohne nachzudenken, sagte er: »Er muss da drüben irgendwas Schreckliches getan haben.«
Er duckte sich, doch Conns Schlag traf ihn trotzdem hart. »Sag niemals etwas Schlechtes über meinen Vater, hörst du?«
Raef drehte Conn den Hinterkopf zu. Er hatte keinen Vater, was ihm als größte Ungerechtigkeit der Welt erschien.
Sie gingen über die Wiese auf die ersten Kiefern zu. Der schwarze Schlickboden unter dem spitzen Gras der Marsch war gespickt mit Treibholzstücken, zerbrochenen Muschelschalen, Resten toter Krabben und verschmutzten Möwenfedern. Wo der Boden trockener wurde, überquerten sie eine kleine Tierspur, die auf dem mit harten Kiefernnadeln bedeckten Boden kaum zu erkennen war.