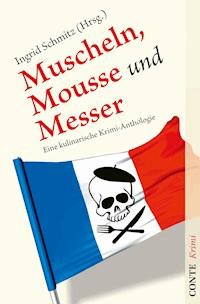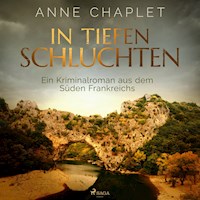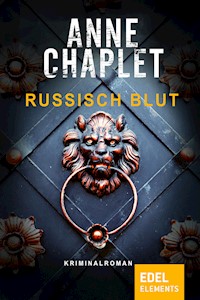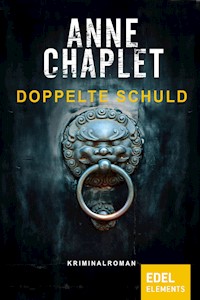4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Krimi
- Serie: Stark & Bremer
- Sprache: Deutsch
Der erste Fall für Stark und Bremer: Paul Bremer, Exwerbefachmann, ist aus Frankfurt aufs Land gezogen, wo er sich in die Bio-Bäuerin Anne Burau verliebt. Als ihr Ehemann auf brutale Weise umgebracht wird, macht der ermittelnde Inspektor Gregor Kosinski eine bestürzende Entdeckung: Der Tote hieß mit Decknamen Caruso und war ein ehemaliger Stasi-Spitzel ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 408
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
"Das ist hohe Krimikunst, und nur wenige beherrschen sie hierzulande so gut wie Anne Chaplet." (Tagesspiegel)
Paul Bremer, Ex-Werbefachmann, ist von Frankfurt aufs Land gezogen, wo er sich in die Bio-Bäuerin Anne Burau verliebt. Als ihr Ehemann auf brutale Weise umgebracht wird, macht der ermittelnde Inspektor Gregor Kosinski eine bestürzende Entdeckung: Der Tote hieß mit Decknamen Caruso – und war ein ehemaliger Stasi-Spitzel...
"Anne Chaplet schreibt virtuos: dicht, mit ironischen Wendungen und einem unerbittlichen Scharfblick für Milieus ... Ein Glücksfall für die deutsche Kriminalliteratur."(SPIEGEL)
Anne Chaplet
Caruso singt nicht mehr
Der erste Fall für Stark & Bremer
Edel Elements
Edel Elements Ein Verlag der Edel Germany GmbH
© 2015 Edel Germany GmbH Neumühlen 17, 22763 Hamburg
www.edel.com
Copyright © 1997 by Anne Chaplet
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Michael Meller Literary Agency GmbH, München
Covergestaltung: Anke Koopmann, Designomicon
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-95530-671-7
www.instagram.com
www.facebook.com
www.edelelements.de
Der Beginn aller Schrecken ist Liebe. Helke Sander
Aber ich liebe euch doch alle. Erich Mielke
Te voglio bene assai – ma tanto tanto bene sai ...
WASSER
PAUL BREMER
1
Man konnte zusehen, wie die braune, zähe Suppe näher gekrochen kam. Zweige und Zigarettenschachteln wälzte sie mit sich, eine zerdrückte Bierdose, blaue Plastikfetzen. Bremer zuckte zusammen, als er den kleinen schwarzen Katzenkörper sah, der sich am Rande der stinkenden Brühe näher schob. Schon wieder eine. Er schüttelte sich. Nasser Wind blies ihm ins Gesicht, und das Wasser stieg noch immer.
»Du siehst doch, das erledigt sich von ganz allein!« würde Marianne sagen, wenn er ihr von der Katzenleiche erzählte. Er hatte seiner Nachbarin noch vor einer Woche vorgeschlagen, wenigstens ihre Kater kastrieren zu lassen – damit in Zukunft ein paar weniger Tiere in seinem Garten Vögel jagten und Gemüsebeete verwüsteten und morgens und abends darauf lauerten, daß er die tägliche Dose Katzenfutter öffnete. Aber eine sparsame Landfrau setzte nicht auf den Tierarzt, sondern auf Schicksal und Natur. Womit sie recht hatte: Der Katzensegen erledigte sich wirklich von ganz allein – unter tätiger Mithilfe von Traktoren, Greifvögeln, Katzenschnupfen und gelegentlichem Hochwasser.
Nur sentimentale Städter investieren langfristige Gefühle in kurzlebige Kreaturen, sagte sich Paul Bremer resigniert und watete in seinen Gummistiefeln durchs Wasser. Bis zum Friedhofsweg, der auf der Höhe seines Hauses von der Dorfstraße abzweigte und leicht anstieg, war die Brühe noch nicht vorgedrungen. Über ihm schwang leise krächzend die Leuchtstoffröhre, die zwischen seinem und Erwins Haus über der Straße hing. Er ging den Weg hoch, an den letzten fünf Fachwerkhäusern vor dem Dorfende vorbei, bis kurz vor die Friedhofskapelle. Der Regen ließ nach. Der Wind war abgeebbt. Durch die Wohnzimmerfenster seiner Nachbarn sah er bläulich die Tagesschau flackern.
Von hier oben aus hatte man den besten Blick auf Bremers Haus. Und auf die braune Schlammzunge, die sich langsam die Dorfstraße heranschob und bereits auf der Höhe seines Gartentors angelangt war. Noch war, wie Bremer feststellte, nichts entschieden.
Er fühlte sich unnütz. Denn tun konnte er rein gar nichts. Das Hochwasser kam – oder es kam nicht. Kein anderer der gleichmütigen Nachbarn ließ sich bei diesem Sauwetter hier draußen blicken. Gegen sechs war Erwin kurz aus dem Haus getreten, um zu gucken, wie weit das Wasser schon gekommen war, hatte einen tiefen Zug aus der Zigarette genommen, gehustet, ausgespuckt und »Wird schon werden!« gemurmelt. Seither saß er vor dem Fernseher wie alle anderen auch.
Die alljährliche Überschwemmung mußte man hinnehmen. Das Wasser kam – und ging. Es würde in die Keller laufen – oder nicht. Und wenn, dann würde man es herauspumpen und die Fenster öffnen, zum Lüften. Und auf die Bürokraten und anderen Idioten in der Kreisverwaltung schimpfen, wo man seit dreißig Jahren der Meinung war, ein Dorf von zwölf Häusern und Höfen müsse damit leben, daß alle Jahre wieder im Frühjahr und im Herbst das Wasser aus den drei Bächen in die Auwiesen floß, über die Hauptstraße bis ins Dorf, in die Keller und Scheunen.
Dieses Jahr kam das Hochwasser besonders früh. Nach einem verregneten Sommer, an dessen Ende das Grundwasser außergewöhnlich hoch stand, hatten schon fünf Tage Dauerregen gereicht, um die Auwiesen unter Wasser zu setzen und die Landstraße zu überspülen. Bremer schob die Kapuze zurück und blickte prüfend nach oben. Es regnete nicht mehr. Aber das Wasser stieg weiter. Noch immer war nichts entschieden. Er schlurfte mißmutig zurück auf die Dorfstraße und sah dem trägen, braunen Wirbel zu, der sich über dem Gully vor seinem Haus gebildet hatte. Ein Wunder, daß der Kanal überhaupt noch Wasser fassen konnte.
Um seinen Keller fürchtete Paul Bremer nicht. Sein Haus hatte gar keinen Keller. Was von der stinkenden Suppe in sein Fachwerkhäuschen eindrang, indem es sich unter der Haustür hindurchschlängelte, würde sich als erstes im Flur und als nächstes in Küche und Wohnzimmer breitmachen. Bremer fand die Vorstellung rührend, daß hier, im kleinen Kaminraum zur Straße heraus, Marianne und Willi geheiratet hatten – vor einem Vierteljahrhundert, vor der Gebietsreform, als das Dorf noch einen eigenen Bürgermeister hatte. Paul wohnte in der ehemaligen Bürgermeisterei. Das sah man, fand er, seiner Hütte wirklich nicht an.
Die braune Suppe stand noch etwa zehn Zentimeter unter dem Niveau seiner Türschwelle. War sie erst mal im Haus, konnte man die drei Wochen Arbeit vom vorigen Jahr abhaken. Er hatte das Haus innen frisch verputzt und gestrichen, den Holzböden oben und den alten rotgebrannten Bodenfliesen unten mit Leinöl einen honigfarbenen Glanz gegeben. Schon ein paar Zentimeter Hochwasser im Haus bedeuteten tagelange Putzorgien; die ganze Anstreicherei wäre umsonst gewesen. Lehmwände saugen alles Feuchte in Minutenschnelle auf, die Brühe würde die Wände hochkriechen und dort bräunliche Ränder hinterlassen, die nur schlecht zu übertünchen waren. Stinken würde es auch. Wochenlang. Er fröstelte beim Gedanken an einen feuchten, klammen und übelriechenden Winter. Das Wasser hatte draußen im Hof bereits den Deckel von der Hausgrube hochgedrückt und sich mit dem Inhalt vermischt. »Scheiße«, sagte Bremer laut. Was ja zutreffend war. Noch schätzungsweise acht Zentimeter. Er sehnte sich nach der Stadt.
Von der Landstraße her bog ein Auto in die Dorfstraße ein und schob sich zwischen meterhohen Bugwellen langsam auf Paul zu. Der hatte sich eben noch als einsamster Hund in ganz Oberhessen gefühlt und merkte plötzlich, daß er das auch gern geblieben wäre. Was half ihm irgendein gutgemeinter Katastrophentourismus? Der schwarze Audi kam näher. Erst als das Auto vor ihm stand, erkannte er Bürgermeister Bast.
Dem war nicht entgangen, wie gespenstisch die Szene wirkte. Das Dorf wie ausgestorben, von Hochwasser fast eingeschlossen – und mitten auf der Dorfstraße stand wie ein einsamer Wolf der verrückte Städter: Paul Bremer, eher klein, fast zierlich, in großen Gummistiefeln und grüner Regenjacke, breitbeinig, beide Hände in die Jackentaschen gestopft, trotzig, traurig. Als ob er sich aufbäumen wollte gegen etwas, das andere längst als schicksalhaft hinnahmen. Bast schüttelte den Kopf. Er war in seiner Gemeinde für neun Dörfer zuständig, und Klein-Roda war keineswegs der einzige Ort, dem jährlich Hochwasser drohte. Aber dieses kleine Kaff hier lag ihm aus irgendeinem Grund besonders am Herzen.
Bast ließ das Wagenfenster herunter. »Ist es schon drin?« Bremer legte den rechten Ellenbogen auf das sauber gewachste Wagendach, von dem die Nässe perlte, beugte sich zum Bürgermeister hinunter und schüttelte den Kopf. »Noch schätzungsweise acht Zentimeter. Wenn es nicht wieder regnet, könnte mir die Soße im Wohnzimmer noch mal erspart bleiben.«
Bast nickte langsam, ein bißchen mitleidig, ein bißchen abwesend. Das Hochwasser war schlimm, weshalb er noch abends um halb neun eine Art von Patrouille fuhr. Um wenigstens Trost zu spenden, wenn er sonst schon nichts tun konnte. Aber noch schlimmer war etwas anderes.
»Sie haben das sicher schon gehört«, sagte Bast. Bremer entging das Fragezeichen ebensowenig wie die Müdigkeit im Gesicht des Mannes.
»Nichts habe ich gehört.« Marianne, sonst für jeden Tratsch gut, hatte sich heute noch nicht blicken lassen.
»Diesmal hat es die Kramers vom Auwiesenweg erwischt. Eine Palomino-Stute, eine dreijährige. Gestern nacht. Die gleiche Handschrift, um es mal so zu sagen.«
Paul seufzte, trat einen Schritt zurück und fuhr sich mit der rechten Hand durch sein kurzes graues Haar. »Er kommt also näher, der Pferdeschlitzer.«
»Sieht so aus.« Bast schlug mit der flachen Hand auf das Lenkrad. Zweimal. Paul fiel auf, was für eine seltsam hilflose Geste das war.
»Als ob’s uns nicht langsam reicht. Brandstiftung in Laufelden, eine abgefackelte Scheune in Streitbach und vier tote Pferde innerhalb von anderthalb Monaten«, sagte der Bürgermeister bitter. »Ich dacht, ich sag’s Ihnen lieber. Was so was anrichtet hier auf dem Land! Das Mißtrauen überall. Jeder beäugt jeden. Es könnte ja der Nachbar sein, der beste Freund ...«
»Ich weiß«, sagte Paul. »Man merkt es schon.«
Auf dem Land war man gewohnt, alles Schlechte dieser Welt in ihren Großstädten oder wenigstens weit entfernt zu vermuten. Weshalb man die kleineren und größeren Verbrechen immer erst den Fremden anzuhängen versuchte – den Rumänen, den Asylanten, allen Osteuropäern, irgendwelchen Städtern auf Durchreise. Dieser rettende Ausweg galt neuerdings nicht mehr: Brandstiftung war eine ländliche Spezialität. Und auch das Pferdeschlitzen ließ sich nicht so ohne weiteres Fremden in die Schuhe schieben. Die regionale Verteilung bestimmter Verbrechensarten war da eindeutig. Deshalb mußte man eigentlich davon ausgehen, daß es »einer von uns« war. Aber die Sturköppe und Dorfromantiker mochten das natürlich nicht einsehen.
Was vielleicht sogar verständlich war. Denn in einer Stadt wie Frankfurt, der nächstgelegenen Großstadt, ist auch das Verbrechen anonym. Auf dem Dorf aber, wo jeder jeden kannte, zerstörte der Verdacht, es könne »einer von uns« sein, jene Eintracht, mit der man nach innen zusammenhielt, um nach außen die Zähne zu zeigen. Bremer spürte die allgemeine Verunsicherung auf Schritt und Tritt: an der Tankstelle, im Tante-Emma-Laden im Nachbarort, beim Heimwerkermarkt, beim Gärtner.
Bast nickte, klopfte mit der behandschuhten Hand noch einmal nachdrücklich auf den Lenker, seufzte und nickte wieder. »Wir hoffen auf Ermittlungsergebnisse.«
»Wir hoffen mit«, sagte Paul. Er meinte das ganz ernst.
Ein Windstoß trieb den kleinen schwarzen Katzenkörper unter das Auto des Bürgermeisters. »Ich drück Ihnen die Daumen«, sagte der, bevor er den Gang einlegte. Bremer fröstelte unter seiner Regenjacke. Es war jetzt völlig dunkel geworden, und nur bei Erwins Haus waren die Rolläden noch nicht heruntergelassen, so daß aus dem Fenster zur Straßenseite hin das bläuliche Licht von Erwins Großbildfernseher herüberflackerte, sein ganzer Stolz, der Draht zur Welt.
Alle haben hier direkten Anschluß an die Welt, dachte Paul, der sich plötzlich nur noch allein, aber nicht mehr einsam fühlte. Und war das dem allzu engen Kontakt mit der Realität nicht manchmal vorzuziehen? Er beschloß, sich ins Unvermeidliche zu schicken. Die Ankunft des Wassers bekam man auch von innen mit.
2
Am nächsten Morgen quälte sich ein milchiges Licht durch die schon lange nicht mehr geputzten Fenster in Bremers Haus, der am Abend zuvor eine Flasche Rotwein auf die glückliche Fügung geleert hatte, daß das Wasser gerade rechtzeitig wieder gesunken war. Paul hatte die Augen geöffnet und gleich wieder zugemacht. Er wußte auch so, wie spät es war. Gegen sechs Uhr kam der Tankwagen von der Molkerei, um die Milch vom Hof der Nachbarn abzuholen. Der Fahrer ließ alle wissen, daß er eine leistungsstarke Autostereoanlage besaß, und scherzte meistens fast ebenso laut mit Marianne, Pauls schöner Nachbarin, die sich durch keine EG-Norm von ihren Milchkühen abbringen ließ. Jetzt konnte Paul noch eine knappe halbe Stunde weiterdösen, bis pünktlich um halb sieben Erwin mit seinem Morgenritual einsetzte. Das begann mit einem bellenden, röchelnd verebbenden Husten, gefolgt von schleimförderndem Räuspern und Ausspucken, gefolgt von heftigem Rütteln am ewig klemmenden Schacht des Zigarettenautomaten an der Straße. Man konnte sich auf seine Nachbarn verlassen. Danach dauerte es noch etwa dreißig Minuten, bis der Bäckerwagen laut hupend um die Ecke bog.
Auch Paul hatte seine Morgenrituale. Die erste Kanne Darjeeling nahm er im Bett zu sich, zusammen mit der Zeitung von gestern. Danach mußten Nachbars Katzen gefüttert werden, die ihn ungeduldig draußen vor der Haustür erwarteten. Die Katzenbelagerung begann meistens schon vor Tau und Tag, wie er feststellen konnte, wenn er in den frühen Morgenstunden vom Schlafzimmer im ersten Stock aufs Klo im Erdgeschoß mußte. Während er sich später in der Küche den Tee kochte, begann draußen das Geplärre. Und spätestens wenn er sich oben angezogen hatte und wieder die Treppe herunterkam, war auf dem Fußabtreter vor der Haustür die Hölle los.
Heute waren die Zwillinge, zwei schwarze, besonders gefräßige Brüder, die ersten. Sie warfen sich ihm entgegen, sobald er aufgeschlossen, die Klinke herabgedrückt und die Tür einen Spaltbreit geöffnet hatte. Auch der Graugetigerte und die Schwarzweiße strichen ihm um die Beine, während er in der Küche die erste Dose des Tages öffnete – obwohl keines der Tiere ins Haus durfte. Wenigstens, sagte Bremer sich und fixierte den Grauen strafend, guckten sie schuldbewußt dabei. Voller Gier scharten sich schließlich alle um die beiden Näpfe, die er ihnen gefüllt vor die Tür stellte, und versuchten, ihre dicken Köpfe möglichst gleichzeitig hineinzustecken. Die kleine schwarze Kätzin kriegte nur deshalb etwas ab, weil sie sich die Brocken mit der Pfote aus dem Freßgeschirr angelte und daneben, auf dem Boden, verspeiste. »Könnt ihr nicht mal manierlich essen?« brummelte Paul. »Immer muß man hinter euch aufwischen!«
Nachbars Katzen mußten zu Hause nicht hungern. Aber nur bei Bremer gab es etwas, wofür kein Bauer auch nur eine müde Mark ausgeben würde: Dosenfutter eben. Das war das elementare Katzenbedürfnis. Weshalb Bremer in Windeseile zum beliebtesten Dosenöffner des Dorfes aufgestiegen war. Im Gegenzug ließen sich die Tiere gnädig zum Schmusen herab. »Ihr alten Erpresser«, sagte Paul, der dem Grauen über die Nase strich und der Schwarzweißen, die gerade erst handzahm wurde, die andere Hand hinhielt. Zwei Blaumeisen hüpften laut schimpfend von Birke zu Birnbaum. Paul genoß beruhigt das Gefühl, daß die Welt wieder in Ordnung war.
Das gestern noch so totenstarre Dorf hatte sich aus seiner Verpuppung befreit und schüttelte die Schmetterlingsflügel. »Hast schon gehört?« rief ihm Marianne zu, die, wie jeden Morgen, die Gass’ fegte. Bis zu ihr hatte das Hochwasser es nicht gebracht, sie beseitigte nur die dicken Fladen, die ihre Kühe hinterlassen hatten auf dem Weg vom Stall auf die Wiese.
»Bast hat es mir gestern erzählt.« Paul stand ans Gartentörchen gelehnt und sah Wilhelm zu, dem Ortsvorsteher, der mit der Kehrmaschine die Dorfstraße heraufkam.
»Verdammte Rumänen!« sagte Marianne mit Überzeugung. Seit es um Klein-Roda herum einmal eine wilde Verfolgungsjagd gegeben hatte, lebte Marianne in der beruhigenden Gewißheit, daß die Schuldfrage ein für allemal geklärt war. Eine rumänische Bande hatte damals die Gegend unsicher gemacht, sie war auf das Knacken von Geldsafes und Tresoren spezialisiert. Nach einem Überfall auf das Postamt von Engelen hatten sich die Banditen erst im Wald versteckt und dann versucht, mit rauchenden Reifen zu fliehen. Seither gab es bei der Polizei eine »Arbeitsgruppe Moldau«.
»Ach, Marianne, komm«, winkte Paul ab. »Die halten sich doch nicht mit Brandstiften und Pferdeschlitzen auf!«
»Weiß man’s?« Marianne schob resolut einen Kuhfladen auf die Schippe.
»Das Asylantenpack! Alle abschieben!« Vom Zigarettenautomaten her hörte Paul die heisere Stimme vom alten Alfred, genannt »das Ekel Alfred«. Der Mann schlug seine Frau, wenn er gesoffen hatte, wie jeder im Dorf sah und hörte. Er war ein Querulant, ein Störenfried: Den Bauern Knöß hatte er angezeigt, weil der nachts und illegal Gülle in der naturgeschützten Flußaue abgeladen habe. (»Das würde Bauer Knöß natürlich niemals tun«, hatte Paul gespöttelt, als sich alle über Alfred aufgeregt hatten.) Und die Kinder von Karlheinz und Lieselotte Becker, Kevin und Carmen, hatte er in einem Brief an den Bürgermeister beschuldigt, am Hochwasser schuld zu sein, weil sie Steine in eins der drei Flüßchen geworfen hätten. Kevin und Carmen mochten an vielem schuld sein, daran aber gewiß nicht.
Eigentlich mochte ihn niemand. Und dennoch, stellte Paul mit einem Anflug von Neid fest, gehörte er zum Dorf. Unauflöslich. Bei Alfred waren es nicht die Rumänen, sondern die Asylanten, die an allem schuld waren. Insbesondere die koreanische Familie, die jenseits der Flußaue in einem alten, heruntergekommenen Dreiseitenhof lebte, dessen eine Seite unlängst in Flammen aufgegangen war. In diesem Fall waren die Täter bald und eindeutig identifiziert: Die älteren der sechs Kinder hatten in der Scheune gekokelt. Was lag näher, als die Kinder auch anderer Taten zu verdächtigen?
Erwin war bei der schätzungsweise vierten Zigarette heute morgen angekommen, das Husten und Röcheln klang merklich gedämpfter. Auch er stand am Zaun, einem »Rancher-Zaun«, wie er Paul mal erklärt hatte, den er in liebevoller Eigenarbeit um sein schmales Fachwerkhäuschen und das peinlichst gepflegte Rasengrundstück gezogen hatte, beides gegenüber Bremers Haus, auf der anderen Seite der Dorfstraße gelegen.
Ein knappes »Gude!« war der einzige Gruß, den er um diese frühe Morgenstunde, noch völlig nüchtern, fertigbrachte. »Ei, Erwin«, rief Marianne zu ihm hinüber, »hast schon gehört?« Erwin räusperte sich und spuckte. »Hör mir uff«, sagte er kopfschüttelnd, »hör mir bloß uff.«
Paul winkte der alten Martha zu, die auf ihrem auch schon sehr antiken Fahrrad vorbeiradelte, die schlohweiße Mähne im Wind. »Kerle! Daß ich das noch erleben muß!« rief sie kopfschüttelnd der Straßenversammlung zu und entschwand um die Ecke. »Soll sie froh sein«, kommentierte Gottfried, der seinen betagten Jagdhund Fritz zum Morgenspaziergang ausführte. »Sie wird bald achtzig.« Das hätte bei jedem anderen herzlos geklungen. Bei Gottfried nicht.
Paul merkte plötzlich, wie ihm die Kehle eng wurde. Der Friede täuschte. Nichts war in Ordnung. Das jährliche Hochwasser war man gewöhnt, das steckte man weg wie nix; das fiel alles unter Naturgewalten; Schicksal; Gottes unergründbarer Ratschluß. Aber die Pferdemörder und Brandstifter, die waren nicht gottgesandt: Sie waren die Urschurken des Landlebens. Sie legten ihre Hand nicht nur an die Fundamente bäuerlicher Existenz, sondern erschütterten auch den Seelenfrieden der ländlichen Gemeinde: durch den ständigen, den allgegenwärtigen Verdacht. Bremer spürte fast am eigenen Körper, wie sich Angst in die Selbstverständlichkeit einmischte, mit der jeder seiner Tätigkeit nachging.
Auch Marianne mußte etwas gespürt haben. Sie lehnte sich auf ihren Besen und sah ihn prüfend an. »Heute schon radeln gewesen?« Paul lächelte dankbar zurück. »Du meinst, das empfiehlt sich, oder?«
Marianne nickte. »Dringend, würde ich sagen.«
»Alte Klatschbase«, dachte er liebevoll, während er ins Haus ging, sich umziehen. Ihr hatte er unvorsichtigerweise im letzten Frühjahr anvertraut, was ihn täglich aufs Rennrad trieb. Seither wußte es jeder. »Er muß einfach fahrradfahren«, hatte er sie mit verschwörerischer Stimme zu Gottfried sagen hören. »Es ist, hat er gesagt, wie ein ... wie ein ...«
»Zwang«, hatte Paul für sich ergänzt, bei dessen Anblick sie schuldbewußt zusammengezuckt war. Und das war die reine Wahrheit: Er fuhr geradezu zwanghaft Fahrrad, seit er vor fünf Jahren hierhergezogen war, nach Klein-Roda, in das, was auch er ein gottverlassenes Kaff genannt hatte. Wegen der Kondition, gegen das Älterwerden, weil der Arzt es empfohlen hat? Das würde jeder hier verstehen. Aber aus »Selbstvergewisserung«? Marianne hatte ihn damals zweifelnd angeschaut. »Ich muß gucken, ob noch alles da ist«, war sein zweiter Versuch. Das leuchtete ihr seltsamerweise schon eher ein. Vielleicht, weil auch sie ihn, wie alle hier, für einen mehr oder weniger netten Spinner hielt.
In Wirklichkeit war mittlerweile er es, den jeder im Umkreis von zwanzig Kilometern vermißt hätte, wenn er einmal länger ausgeblieben wäre. Der drahtige Mann mit der grauen Bürstenfrisur, dem schnellen Rad und den muskulösen Beinen war eine den Hausfrauen, Treckerfahrern, Postboten und Warenauslieferern vertraute Erscheinung. Er grüßte alle. Ihn grüßten alle. »Der tägliche Beweis, daß es mich gibt«, hatte Bremer gesagt. Daraufhin hatte Marianne mitleidig geguckt.
Paul stieg in die Fahrradklamotten und holte sein Rennrad aus dem Schuppen. Radfahren war die beste Therapie – gegen Melancholie, Lebensüberdruß, Existenzangst und Übergewicht. Morgens, im ersten, zögernden Sonnenlicht, auf seiner Lieblingsstrecke, die ihn einen steilen Anstieg über einen Bergrücken Richtung Streitbach führte, wehte ihn regelmäßig eine leise Ahnung von dem an, was andere wohl Heimatgefühl genannt hätten. Die rötlich angestrahlten Wolkenschleier, die sich frühmorgens über die Talsenken legten, von denen sie sich schon gegen neun Uhr wieder erhoben, um sich aufzulösen im blauesten Himmel von ganz Hessen, kamen ihm überirdisch schön vor, und die Wälder, die über Paul den Tau der Nacht von ihren Blättern schüttelten, strahlten ihn in den leuchtendsten Farben an, die Gott erschaffen hatte.
Kürzlich war er im Morgenlicht an der Kramerschen Pferdekoppel entlanggefahren, als plötzlich die ganze Herde mit fliegenden Mähnen am Gatter entlanggaloppierte, ihn begleitete auf seinem eigenen Ritt, bis die falben, roten, grauweißen, schwarzglänzenden Körper wie eine Rauchwolke abdrehten und am Horizont verschwanden. Für solche Momente kloppte er Tag für Tag seine dreißig, vierzig Kilometer herunter, für den Anblick des Graureihers über der Flußaue und des Bussardpärchens auf der Koppel, die er dort schon seit Tagen gravitätisch herumschreiten sah, immer zu zweit. Für den Anblick der windgebeugten Apfelbäume an der Straße nach Waldburg, deren rote Früchte in diesem Jahr besonders stark zu leuchten schienen. Für den Duft: Gras, Kuh, Asphalt, Heu, Gülle, Diesel, Pferd, sonnenerwärmte Luft.
Als er heute, hinter dem Friedhof von Streitbach, die Straße nach Rottbergen hochgefahren war, eine kurze, harte Steigung hinauf, einer berauschenden Aussicht auf gleich sieben Windräder am Horizont entgegen, als sein Atem schneller ging, als sich ein fast beseligtes Lächeln auf seinem Gesicht zeigte – da spätestens machte sie sich wieder bemerkbar, diese beruhigende Leere in seinem Kopf. In diesem Zustand mußte er nicht mehr grübeln. Über die Vergangenheit. Über die Zukunft. Über eine gescheiterte Ehe. Über seine gescheiterte Existenz.
Was soll sein, Bremer? sagte er sich in solchen Momenten. Das Leben ist gut. Hart, aber ungerecht. Und voller Überraschungen.
Bremer fuhr dampfend in Klein-Roda ein und stellte sein Rad in den Schuppen. Auf der Straße klappte eine Autotür, die Falle am Gartentörchen klickte, und Ernst, der Postbote, hielt am langgestreckten Arm Pauls Zeitungen und die Post, so als wolle er mit solcherlei dorfunüblichen Druckerzeugnissen wie der FAZ und dem Manufactum-Katalog möglichst wenig in Berührung kommen.
»Der alte Noth ist tot«, rief er im Gehen Paul zu, kurz bevor er durchs Törchen verschwand, das er wieder, wie eigentlich immer, sperrangelweit offengelassen hatte – extra für Bello, nahm Paul mittlerweile an, den Riesenbernhardiner mit der Riesenneugier und dem Hang zu Riesenscheißhaufen, die er mit Vorliebe in Pauls Garten zu hinterlassen pflegte.
In diesem Moment öffnete sich im Nachbarhaus knarrend ein Fenster und auch Marianne rief: »Hast du schon gehört? Der alte Noth ist gestorben, irgendwann heute nacht.«
Als Paul, mit zwei Mark fünfzig und einem gebrauchten Eierkarton in der Hand, zu Gottfried rüberschlenderte, rief er schon von weitem: »Der alte Noth ist tot.« Aber Gottfried wußte das natürlich längst.
Paul kannte den alten Noth nur als alten Noth – als uraltes Männchen mit eingefallenem Mund über einem zahnlosen Gaumen, das morgens und abends gebeugt über die Dorfstraße schlurfte. Die abgewetzte Kordhose, die an dunkelroten, ausgeleierten Hosenträgern um die ausgemergelte Gestalt schlotterte, war verschmutzt, zerrissen und hing im Hosenboden auf eine Weise herunter, die den Verdacht erhärtete, der jedem kam, dem der alte Mann vor die Nase geriet. Der alte Noth pflegte sich offenkundig vollzuscheißen und sich in diesem Zustand völlig wohl zu fühlen – selbst dann, wenn die Masse erkaltet und steif geworden war und ihn zu einem verräterischen Watschelgang zwang.
An Bremer hatte er einen Narren gefressen – vielmehr an dessen Garten, aus dem der alte Mann mit kindlicher Freude zu klauen pflegte, was gerade besonders schön blühte. Die Familie, fand Paul, kümmerte sich nicht genug um den alten Knacker. Und wo blieb eigentlich die Gemeindeschwester, um dem Kerl wenigstens mal den Hintern zu putzen?
Aber nun war er tot – und Zeit war’s. Das fanden alle hier, vorab Marianne, die lauthals auf Söhne und Enkel des Veteranen schimpfte, die es fertiggebracht hätten, den alten Zausel völlig verkommen zu lassen. »Ich möcht nicht wissen, wie das bei denen zu Hause aussieht, seit die Berta nicht mehr da ist.«
Seit die einzige Frau im Hause, die Schwiegertochter vom alten Noth, oben auf dem Friedhof lag, schienen sich die Männer aufs gemächliche Verkommen eingestellt zu haben.
»Die lassen doch niemanden rein«, ergänzte Gottfried, vor dessen Hoftor, unter der schönen großen Linde, unter der die Feierabendbank nicht fehlte, sich alle einzufinden pflegten, wenn es was zu besprechen gab. Hier war sozusagen der informelle Thing-Platz der Gemeinde. »Die sind doch völlig verhockt.«
Seit dem Tod der Berta konnte man dem Untergang der Familie Noth zusehen. Der »Oppa« schlurfte übelriechend und unrasiert durch die Gegend, der »Vatta« fuhr jeden Tag, morgens und abends, mit einem klapprigen alten Fahrrad zum Friedhof hoch und ließ seiner Frau nach ihrem Tod eine Anteilnahme zukommen, die sie sich im Leben nicht hätte träumen lassen. Der dickliche Jüngste war etwas beschränkt, aber es reichte zu Hilfsarbeiten im Sägewerk. Und der Älteste war ein verkniffener Typ mit Wieselgesicht, wie Paul fand, der den Burschen haßte. Der Knabe fuhr nicht nur die paar Meter zum Zigarettenautomaten mit dem Auto und ließ seine Rostlaube fröhlich weiterdieseln, während er den Zigarettenautomaten mißhandelte, sondern warf auch noch regelmäßig den Zellophanüberzug der Kippenschachtel, die er unter Fluchen, Rütteln und Klopfen dem Apparat abgezwungen hatte, in Pauls Vorgarten. Bremer fischte wöchentlich zehn bis zwölf dieser widerlichen Überzieher aus seinen Rosen. Zu seinem Leidwesen hielten alle ortsansässigen Raucher seinen Garten für eine besonders formschöne Zellophanhüllendeponie.
»Vielleicht hätte man rechtzeitig etwas unternehmen müssen«, meinte Marie, die gutherzige Frau von Gottfried. Ortsvorsteher Wilhelm widersprach. »Da kannst du gar nichts machen, des Menschen Wille ist sein Himmelreich, und my home is my castle. Die haben noch nicht einmal die Gemeindeschwester reingelassen.«
Paul streichelte den Alten Fritz, Gottfrieds Jagdhund – »ein reinrassiger Weimaraner«, wie Gottfried gern betonte –, der seinen schönen samtgrauen Kopf auf Pauls Knie gelegt hatte und ergeben zu ihm hoch schaute. Von wegen dörfliche Gemeinschaft, nachbarschaftliche Solidarität und was die Städter noch so alles hineinphantasieren in die angeblich heile Welt auf dem Dorf, dachte er. Soziale Kontrolle verhindert höchstens das Allerschlimmste. Und das auch nicht immer.
Die Verunsicherung war mit Händen zu greifen. Daß der alte Noth, wie Wilhelm erzählte, halbnackt und auf dem Boden liegend gefunden worden war, ganz kalt und steif schon, war seinen Nachbarn nur ein vorerst letzter Beweis für den Zerfall aller Werte, die man hier hochhielt. Irgend etwas lief schief. Aber was?
Paul dankte Gottfried für die zehn Eier – Zwerghuhneier, aber von garantiert glücklichen Tieren – und ging nach Hause. Erst ein bißchen Holz hacken. Das lenkte ab. Und dann gab es keinen Grund mehr, sich länger vor der Arbeit zu drücken.
»Was würde über den heutigen Tag in meinem Tagebuch stehen?« dachte Bremer, der aus guten Gründen keines schrieb, wenige Stunden später. »Katzen gefüttert. Rad gefahren. Depression gekriegt.« Er spürte, wie ihn die Stimmung im Dorf einzufangen begann. Wie das Wetter: tief gehängtes Grau, düster. Mißtrauen hatte sich über alles gelegt, durchdringend wie der Schweinegestank, der aus dem Stall von Bauer Knöß herüberwehte. Selbst die Alltagsgeräusche – und das Landleben ist laut! – kamen Bremer heute merkwürdig gedämpft vor. Normalerweise dröhnten hier die Trecker, jaulten die Hunde, röchelten die Hähne. Ständig rief jemand: nach Kevin und Carmen, die auf nichts und niemanden hörten. Nach dem Riesenbernhardiner Bello, für den das ebenfalls galt.
Wenigstens das in Pauls Ohren schönste Geräusch unter all den vielfältigen Landlauten näherte sich auch heute wieder vom Friedhof her. Es klang wie das vielstimmige Knacken dünner, dürrer, trockener Hölzer, begleitet von sattem Klatschen, wie der müde Beifall nach einer Festansprache, und von einem unnachahmlichen Ruf, der das ganze Dorf durchhallte: »Aa-auf!«
Aa-auf. Marianne trieb ihre Kühe von der Weide zurück zum Melken, große, braunweiße, brunzdumme Tiere, die gelangweilt auf die Straße brezelten, jedes Jahr im Spätsommer Pauls kleinen Spalierapfelbaum zu schänden versuchten und von Marianne mit Stockhieben und jenem durchdringenden Ruf angetrieben werden mußten, der das Knacken ihrer Hufe auf dem Asphalt höchstens für Minutenbruchteile schneller werden ließ.
Aa-auf.
Das war, für Paul, der Ruf der Geborgenheit. Er unterteilte den Tag wie anderswo das Glockengeläut. Er brachte Ordnung ins Leben.
Vom Apfelbaum fiel eine dicke, grüne Reinette und zerbarst mit einem trockenen Schmatzen auf dem Asphalt. Zeit für die Apfelernte. Nicht heute. Vielleicht morgen.
3
Die kleine Pendeluhr unten im Wohnzimmer schlug halb. Seit vier Uhr morgens schon lag Bremer wach und wartete auf das erste Gurgeln und Röcheln von Gottfrieds preisgekrönten Zwergwyandottenhähnen. Entweder war der Rotwein schuld. Oder es hing, wie er insgeheim fürchtete, mit dem Älterwerden zusammen. Man vertrug nichts mehr – weder Alkohol noch gutes Essen, konnte nicht mehr schlafen und wurde grau und grämlich.
Paul hing der Albtraum noch in den Knochen, der ihn aus dem Schlaf gerissen hatte, schweißnaß war er aufgewacht, mit rasendem Herz. An Details erinnerte er sich nicht, an die Art des Schreckens nur vage: irgend etwas aus alten Zeiten, wahrscheinlich Sibylle, womöglich das frühere Leben. Zur Strafe für die Vergangenheit lag er nun wach und fürchtete sich vor der Zukunft.
Wer mitten in einer gepflegten Karriere den radikalen Bruch vollzieht, hat zwar die öffentliche Meinung auf seiner Seite, die nichts schicker findet als Männer in der Midlife-crisis, die beschließen, ihr Leben zu ändern. Aber die Lebenswirklichkeit war weniger romantisch. Als er sich vor fünf Jahren von seinem gutbezahlten Job in einer Frankfurter Kommunikationsagentur verabschiedete (man spricht ja heutzutage nicht mehr von Werbung), hatte er genug zurückgelegt, um sich zwei Jahre über Wasser zu halten. Aber nach zwei Jahren angeblich das Nachdenken fördernder Idylle auf dem Land hatte er sich selbst die Frist verlängert. Und wieder verlängert. Sich mit Berateraufträgen in der Stadt Bedenkzeit finanziert. Und auf die Eingebung gewartet: Was tun mit einem Leben wie dem seinen – viel erfahren und wenig erlebt? Sein »Enthüllungsbuch« über die Werbebranche war fast fertig – das gehörte ja wohl zu einem ordentlichen Abschied dazu. Aber üppig fließende Tantiemen versprach er sich davon nicht.
»I’m a loser«, sang er leise vor sich hin und stieg aus dem Bett, bevor er sich allzusehr als gescheiterte Existenz bemitleiden konnte. Komisch, dachte er, als er sich angezogen und in der Küche zu schaffen gemacht hatte, wie gut ein ganz banaler Alltag wirkt gegen Wehwehchen aller Art. Nichts ist beruhigender als, zum Beispiel, Abwaschen. Das bißchen von gestern abend. Dann den Rest von der Suppe mit den bunten Bohnen einfrieren, die er sich gestern gemacht hatte. Die leeren Katzendosen ausspülen (aus Solidarität mit den Müllsortierern) und zur Recyclingmülltonne bringen, die Gemüseabfälle auf den Kompost werfen. Die ausgelesenen Zeitungen in den überfüllten Papiereimer stopfen, die ausgeleerten Flaschen zum Wegbringen bereitstellen. Einmal durch den Flur fegen und die Küche feucht aufwischen.
Nach diesem Programm war Bremer hellwach und nicht bester, aber wenigstens besserer Laune. Draußen war es für die Jahreszeit entschieden zu kalt, glitzernder Tau lag auf den windschiefen Rosenkohlpflanzen und den gelben Zucchiniblüten, die sich schon halb entfaltet hatten. Aus dem Schornstein im Nachbarhaus gegenüber quoll eine schwarze Rauchwolke: Marianne heizte den Küchenofen an. Immerhin schien es ein sonniger Tag zu werden – am Morgenhimmel hinter dem Nachbarhaus sah er einen rosigen Widerschein. In diesem Licht hatten die Herbstfarben seines Gartens einen besonderen Zauber: die zarte Nachblüte seiner rosaroten Strauchrosen ergänzte das dunkle Karmesinrot der Clematis, die sich über den Zaun hinter der Sitzecke gelegt hatte, und das stumpfe Rotbraun der riesigen Büschel der Fetthenne, die sich vor den Rosen ausfächerten. »Herbstfreude« hieß diese Sorte, die er mindestens so schön fand wie die schon etwas verblichenen Samthortensien im Beet rechts von der Haustür. Hortensien, hatte ein gärtnernder Schriftsteller mal behauptet, verblühten so, wie manche Frauen älter würden: Ihre riesigen bläulichroten Tellerblüten nähmen unmerklich sanftere Farben an und verlören die Prallheit der Jugend, blieben aber bezaubernd, bis der Frost sie von den Stengeln knickte. »Na ja«, dachte Paul. »Hier spricht der Dichter.«
Ziemlich früh, sogar für seine Verhältnisse, warf er sich heute in die Fahrradklamotten und aufs Rad. Eine mäßig harte Tour vertrieb ziemlich unfehlbar auch die allerschwärzesten Spinnweben nächtlicher Albträume.
Danach: an den Schreibtisch. Wie immer.
Am späten Nachmittag, als Bremer das erste Mal mit echtem Interesse an so etwas wie ein Abendessen dachte, hatte sich ein neuer Ton in das Gemurmel und Geplätscher geschlichen, das von draußen an sein Ohr drang. Irgendwer stand immer auf der Dorfstraße und schwätzte: Marianne mit Gottfried, Alfred mit jedem, der sich nicht wehrte, Bauer Knöß mit Erwin, die alte Martha mit Willi, Mariannes Mann. Bremer hatte sich längst daran gewöhnt – er hatte mittlerweile sogar das Gefühl, daß ihn dieses Hintergrundgeräusch geradezu beflügelte bei der Arbeit. Manche brauchten die Szenekneipe oder das Café als akustische Kulisse für ihre geistigen Prozesse. Ihm genügte, vielen Dank, die Dorfstraße.
Doch jetzt war das gemütliche Geplauder entgeisterten Ausrufen gewichen. Bremer speicherte ab, klappte sein Notebook zu und öffnete das Fenster seines Arbeitszimmers im ersten Stock, das auf die Dorfstraße hinausging.
»Mord«, sagte Gottfried, den Paul, aus dem Fenster gelehnt, fragend ansah. »Mord«, wiederholte Marianne, fast andächtig.
»Wer?« fragte er. »Wo?«
»Bei Ebersgrund.« Der Nachbarort war vier Kilometer entfernt. »Im Weiherhof.«
Paul fühlte, wie er blaß wurde. »Anne!«
Marianne guckte ihn neugierig an und schüttelte den Kopf. »Die nicht«, sagte sie mit boshaftem Bedauern. »Die nicht.«
Anne? dachte Paul hilflos.
4
Die Jüngste war sechs, der Älteste zwölf Jahre alt. »Die Kiste hoch, Maximilian!« rief Rena ihm zu, als er mit dem kleinen Trupp, den er auf dem Apfelschimmel anführen durfte, näher kam. »Uuuund Tempo, uuund alle«, kommandierte Rena lautstark und näselnd, ganz so, wie schon Tausende von Reitlehrern ihre Schützlinge gequält hatten.
»Wieder ein neuer Haufen Unbelehrbarer?« fragte Alexander mitfühlend, der neben ihr stand und wie sie die Arme auf den obersten Balken der hölzernen Balustrade aufgestützt hatte, die den Exerzierplatz in der Reithalle umgab. Es schien ihm keine sehr dankbare Aufgabe zu sein, den von ihren städtischen Eltern auf dem Weiherhof abgestellten Bälgern in drei Wochen alles Pferdgemäße beizubiegen.
»Ich halt’s aus.« Rena war sichtbar geschmeichelt, daß sich Alexander für sie interessierte. »Es ist ja das letzte Mal in dieser Saison.«
Leider, dachte Anne Burau, die den beiden zusah, und trocknete sich die langen, schmalen Finger an der Küchenschürze ab. Die große Reithalle, die sie vor drei Jahren hatte bauen lassen, um müde Städter mit »Ferien auf dem Bauernhof« locken zu können, hatte sich noch längst nicht amortisiert.
Anne gefiel es, daß Alexander sich seit einigen Wochen angewöhnt hatte, ihre Tochter zu besuchen. Zugleich wunderte es sie ein bißchen, daß der gutaussehende, gut gekleidete, immer höfliche junge Mann sich ausgerechnet für Rena interessierte. Ihre Tochter, fand Anne, war ein kluges, sensibles, gutherziges, ein geradezu großartiges Exemplar. Aber selbst die liebende Mutter mußte zugeben, daß es ihr ein bißchen fehlte an, na ja, sagen wir mal, klassisch weiblicher Attraktivität. Rena war von allem ein bißchen zuviel: zu blaß, zu dünn, zu blond, zu linkisch. Oder will wer noch immer behaupten, eigentlich komme es nur auf den guten Charakter an? fragte sich Anne, die mit dieser verlogenen Behauptung aufgewachsen war, und schickte einen Stoßseufzer hinterher. Hoffentlich war er nett zu ihr. Hoffentlich enttäuschte er sie nicht. Hoffentlich war er ein verläßlicher Freund. Hoffentlich passierte der Tochter nicht, was der Mutter widerfahren war.
Alexander hatte sich umgedreht und winkte ihr zu. Anne hob die Hand und winkte zurück. Die Eltern hatten sich vor einigen Jahren ein Fachwerkhaus in Ebersgrund ausgebaut. Der Junge hatte, wie Rena, gerade das Abitur hinter sich gebracht und überlegte noch, ob er ein Studium beginnen oder sich freiwillig bei der Bundeswehr verpflichten sollte. Alexander war ein netter Kerl, bestimmt. Anne Burau runzelte die Stirn. Zu nett?
Sie stöhnte innerlich auf. Verdammtes Mißtrauen. Nicht alle Männer sind Lügner und Betrüger! Oder? fragte eine kleine mißtrauische Stimme spitz zurück.
Sie gab sich einen Ruck und kehrte zu ihrer Kundschaft zurück, der sie draußen auf dem Hof Apfelwein ausschenkte. Irgendwie war ihr heute alles zu laut und zu anstrengend. »Reiß dich zusammen«, forderte sie sich mit gewohnter Härte auf, »sonst kannst du gleich den Beruf wechseln.« Besonders eine Blondgefärbte um die Dreißig ging ihr auf die Nerven. »Rotti! Bei Fuß!« herrschte die Dame den völlig unterdrückten Rottweiler an, den sie an kurzer Leine neben sich hielt (Warum nicht gleich Pavarotti? dachte Anne). Ob Anne denn qualifiziert sei für einen Ökobauernhof, wollte sie wissen. Ob sie denn alles ganz allein machen müsse. Anne zwang sich zu Höflichkeit und antwortete ausweichend. Schließlich wollte die Frau auch noch das Kühlhaus besichtigen. »Der Hund bleibt draußen!« sagte Anne bestimmt.
Sie verarbeitete auf ihrem Hof mit Bioland-Gütesiegel nicht nur die eigenen Charolais-Rinder, ihre das ganze Jahr über im Freien lebenden Schweine, die zahllosen Lämmer, Gänse, Enten und Truthähne, die sich um den Löschteich herum vergnügten, sondern verkaufte auch Wild. Aus allererster Hand: von den beiden Jagdpächtern aus dem angrenzenden Revier. Rudolf und Werner hatten einen Schlüssel zum Kühlhaus und hängten ihr frühmorgens an den Haken, was sie nachts erlegt hatten. In der linken Kühlkammer hing das kleine Wildschwein, noch in der Decke, das die beiden gestern abgeliefert hatten. Der rote Zettel des Fleischbeschauers steckte auf dem Fleischerhaken, »beschlagnahmt bis ...« stand oben rechts in der Ecke. Erst wenn sie bis morgen früh nichts vom Veterinäramt gehört hatte, war das Fleisch freigegeben.
Die Rottweilerin, wie Anne sie ungnädig getauft hatte, legte theatralisch die Hand vor den Mund, als sie den Kadaver sah. Na ja, dachte Anne. Tote Tiere in gekachelten Kühlkammern haben ja auch wirklich keinen Charme. »Also, einfach ein Stückchen Filet, das tät mir reichen!« verkündete der ungeliebte Gast. Einfach Filet. Schau an. Nur vom Feinsten. »Die Lende hängt in der Kühlkammer rechts«, sagte Anne, schloß die eine und drückte den Hebelarm der anderen Kühlkammer nach unten. Hier hingen Lammkeulen und Lammrücken, eine halbe Hausschweinseite, ein Rinderfilet. Eine Gans im Federkleid. Und noch etwas anderes. Etwas ganz anderes. Aus weiter Ferne hörte sie neben sich die andere Frau aufschreien. Ihr wurde erst flau, dann übel, dann weich in den Knien. So ist das also, dachte sie erstaunt.
Sie mußte, machte sie sich später klar, wie von Furien gehetzt aus den Wirtschaftsräumen hinausgestürzt und zum Reitstall gelaufen sein. Zu Rena.
Alexander rief den Arzt. Und die Polizei.
Die Gäste waren gegangen, die blonde Hundebesitzerin hatte vom Arzt ein Beruhigungsmittel erhalten. Anne fühlte sich völlig gefaßt, als sie oben im Wohnhaus die Polizei erwartete. Gregor Kosinski stand auf dem Ausweis, den der große, schlaksige Mann ihr hinhielt. Ein für diesen Landstrich ziemlich ungewöhnlicher Name, dachte sie flüchtig, bevor sie ihn in den großen Wohnraum einlud, in dem er sich ihr gegenübersetzte und sie lange und freundlich ansah.
»Es ist Leo«, sagte Anne, jetzt plötzlich doch nervös. »Er ist mein Mann. Er war mein Mann.«
»Herzliches Beileid!« sagte der Polizist. Das kam ihr so grotesk vor, daß sie kicherte. Jetzt keinen hysterischen Anfall! beschwor sie sich, reiß dich zusammen, verdammt! Der Mann wartete geduldig, bis sie sich wieder beruhigt hatte.
»Haben Sie die Leiche angefaßt oder bewegt?« fragte Kosinski und hielt fragend eine Schachtel Ernte 23 in die Höhe. »Natürlich nicht!« wehrte Anne ab und stand auf, um einen Aschenbecher zu holen.
Wieso eigentlich »natürlich« nicht, fragte sie sich im selben Moment. Hätte sie nicht seinen Puls fühlen müssen, nachprüfen, ob er vielleicht noch lebte? Hätte sie nicht einen kühlen Kopf bewahren müssen bei seinem Anblick? Wiederbelebungsversuche machen?
Zwecklos, das hatte sie seltsamerweise sofort gewußt.
Sein Mörder hatte Leo in die Kühlkammer gehängt, neben das Schlachtvieh. An einen Fleischerhaken. Vielmehr, man hatte den Fleischerhaken hinten durch seine Weste gestoßen, in der er hing, als wolle er mit den Flügeln schlagen. Seine Füße berührten den Boden, Leo war viel zu groß für die geringe Höhe, in der die Stange die Kühlkammer durchquerte. Das eine Knie war abgewinkelt, das andere durchgedrückt. Das weiße Oberhemd hatte sich nach oben geschoben, die elegante, jetzt schlammverschmutzte Hose war ihm auf die Knöchel gerutscht.
»Haben Sie eine Vorstellung, wer Ihrem Mann übelwollte?« fragte der Landpolizist. »Übelwollte«? Elegant ausgedrückt für den Tatbestand eines Mordes. »Nein«, antwortete Anne. Und fügte zögernd hinzu: »Oder jedenfalls nicht so, daß man ihn hätte umbringen wollen.«
Jemand hatte Leo erwürgt. Und dann in ihre Kühlkammer gehängt. Wie das Schlachtvieh. Erstaunt merkte Anne, daß ihre Zähne klapperten.
Gregor Kosinski betrachtete Anne Burau mit freundlicher Distanz. Die Frau war blond, lang und schlank. Ein bißchen nervös, aber ziemlich gefaßt. Ungerührt? So weit würde er nicht gehen. Kosinski musterte ihre Hände. Zu schlank, um den Gatten selbst erwürgt und an den Haken gehängt zu haben? Wohl kaum. Landfrauen waren Schwerarbeiterinnen. Sie hatten Kraft.
»Wann waren Sie das letzte Mal in dem Raum?« Er versuchte es noch einmal.
»Gestern«, sagte Anne und rückte ihre Brille zurecht. »Gestern abend. Vor dem Abendessen.«
Sie konnte sich nicht wehren gegen das Bild vor ihrem inneren Auge. Wie er da hing, den Kopf auf die Brust gesunken, die Haut unter dem unrasierten Kinn ziehharmonikaförmig zusammengeschoben. All die Schönheit dahin ... Anne schluckte. Fast hätte sie doch noch geweint. Sie versuchte sich einzureden, daß sie das alles nichts mehr anging. Schon lange nichts mehr anging. Leo war tot. Und für sie war er kaum lebendiger gewesen, als er noch lebte.
Kosinski drückte seine dritte Zigarette aus und betrachtete abwesend die Fliege, die neben dem Aschenbecher lag und mit rasend schlagenden Flügeln erst größere, dann immer kleinere Kreise zog. Immer noch abwesend, nahm er seine Zigarettenschachtel und beendete den Todeskampf. Leo Matern, der Mann von Anne Burau, hatte schon länger im Kühlraum gehangen, das sah man auch ohne gerichtsmedizinische Untersuchung. Er war, darauf ließ der Zustand seiner Kleidung schließen, nicht am Fundort gestorben. Dorthin hatte man ihn offenbar geschleppt, um die Leiche zur Schau zu stellen. Gebrandmarkt.
Anne hatte es auch gesehen: An der einen, der linken, der eingefallenen Pobacke der Leiche prangte leuchtend blau etwas, das wie das Prüfsiegel des Fleischbeschauers aussah. Als ob man ihn noch im Tod hatte demütigen wollen.
»Und wann haben Sie Ihren Mann das letzte Mal gesehen?«
Anne fuhr nervös durch ihr Haar, das sich aus der Spange zu lösen begann, mit der sie es im Nacken zusammengefaßt hatte. »Ich glaube«, sagte sie und zögerte. »Vielleicht am Mittwoch?«
5
Nicht Anne, ihren Mann hatte es erwischt. Paul schloß das Fenster, ging die Treppe hinunter in die Küche und goß sich einen Whisky ein. Einerseits war er erleichtert. Anne lebte. Er atmete tief ein. Das war die gute Nachricht. Die schlechte: Irgendeiner mußte ja ihren Mann umgebracht haben – und Familienmitglieder, vor allem Ehefrauen, lagen nun mal vorn als Tatverdächtige. Paul stellte mit leisem Erschrecken fest, daß er es gar nicht sonderlich verwunderlich finden würde, wenn sie ihren unangenehmen Kerl von Ehemann ... Er hob das Glas, nahm einen tiefen Schluck und sandte ein Stoßgebet hinterher – »Laß es nicht Anne sein, Herrgottnochmal.«
Und da war noch etwas anderes, was ihn beunruhigte. Er war sich nicht ganz sicher, aber er glaubte, sie heute früh um kurz vor sechs gesehen zu haben. Dort, wo der Feldweg zum Weiherhof auf die Landstraße nach Ebersgrund mündete. Hinter einer Staubwolke.
Bremer versuchte die Szene zu rekonstruieren. Er war heute morgen eine seiner härteren Touren gefahren und hatte die langgezogene Steigung vier Kilometer vor Ebersgrund ganz manierlich, wie er fand, hinter sich gebracht – die meiste Zeit im Stehen, im langen Wiegetritt. Wenigstens diesmal hatte ihn der Rennradfahrer in der schwarzen Balaklava nicht überholt, der ihm in den letzten Wochen häufig beim Fahrradfahren begegnet war. Der Mann, in langer schwarzer Hose, schwarzem, langärmeligem Hemd und schwarzem Windbreaker hatte zwar immer freundlich gegrüßt, wenn er an Paul vorbeizog. Aber die Tatsache, daß man ihn, der sich einiges auf seine Kondition einbildete, so leicht abhängen konnte, hatte sein Selbstbewußtsein ziemlich demoliert. Wer war der Typ? »Angeber«, murmelte er und nahm einen zweiten Schluck. Und fiel nicht eine Balaklava, eine Mütze, die man über den Kopf zog und die nur schmale Schlitze für Mund, Nase und Augen ließ, eindeutig unters Vermummungsverbot? »Feiger Kerl«, brummelte Paul. Heute war ihm sein unbekannter Gegner nicht hinterhergefahren, sondern entgegengekommen: mit enormem Tempo, gesenktem Kopf und ohne Gruß.
Der unbekannte Rennfahrer irritierte ihn, wie er sich mit leiser Verwunderung eingestehen mußte. Gekränkter Stolz, männlicher Neid? Bestimmt. Paul war noch immer nicht wieder völlig konzentriert gewesen, als er auf der Höhe des Feldwegs angelangt war, der von der Straße zum Weiherhof führte. Nur so erklärte er sich im nachhinein seine Überreaktion: Als ein Geländewagen mit gar nicht mal überhöhter Geschwindigkeit in einer großen Staubwolke vom Feldweg aus in Gegenrichtung zu Paul auf die Landstraße einbog, betätigte Bremer mit beiden Händen die Bremsen. Fast wäre er über den Lenker gegangen.
Es hatte natürlich nicht den geringsten Grund gegeben, dafür den armen Jeepfahrer zu beschimpfen, gab Bremer im Rückblick grinsend zu – ohne irgend etwas zu bedauern. Denn wenn er etwas innig haßte, dann waren das Geländewagen, Jeeps, Cruisers und andere Fun-Cars in all ihren Erscheinungsformen, mit Sonnenuntergängen, Palmen oder der Anschrift eines Bodybuilding- oder Boxclubs auf dem Reserveradüberzieher. Dieser hier hatte, wie er gerade noch erkennen konnte, »Der Flug des Falken« in tannengrüner Schrift auf dem ansonsten unauffälligen Reserveradbezug stehen. Und hinter der Staubfahne, die der Jeep auf dem Feldweg aufgewirbelt hatte, glaubte er beim Blick zurück Anne Burau zu erkennen, die Weiherhofbäuerin. Für zehn Sekunden bezog er sogar sie in seinen Zorn ein. Was machte sie um diese Zeit, um kurz nach sechs Uhr früh, mit so einem blöden Motorterroristen?
Es war ihm heute früh verdächtig erschienen. Das hatte er auf Eifersucht geschoben. Aber jetzt schien es ihm noch verdächtiger zu sein. »Verdammt!« Bremer leerte sein Glas und goß sich nach. Er mochte Anne – eine Untertreibung, wenn er ehrlich mit sich war. Er machte sich Sorgen um sie. Sorgen? Schon wieder gelogen. Er hatte Angst um sie.
Seine Nachbarn hatten sich mittlerweile unter der Linde versammelt, bei der Bank vor Gottfrieds Hof. Fast automatisch griff sich Paul etwas Kleingeld und einen leeren Eierkarton, bevor er hinüberlief. Glaubst du denn noch immer, du bräuchtest einen Vorwand, um dich am Nachbartratsch beteiligen zu dürfen? dachte er kopfschüttelnd. Offenbar ja. Immer noch.
»Erst tote Pferde, dann tote Menschen«, sagte Alfred genießerisch, mit mißtrauischem Seitenblick auf Paul.
»Ich muß erst gucken, ob sie welche gelegt haben«, sagte Gottfried, dem Paul den Eierkarton in die Hand gedrückt hatte. »Im Herbst nimmt’s ab mit dem Legen.«
»Laß dir Zeit«, erwiderte Paul, der ja nicht der Eier wegen gekommen war.
»Ich hab der Burau nie getraut«, sagte Marianne mit leisem Triumph in der Stimme. Immerhin hatte sie den Anstand, wie Paul bemerkte, ihm einen leicht schuldbewußten Seitenblick zuzuwerfen.
»Aber es gibt doch noch nicht einmal Verdachtsmomente!« Für diese Rettung der Unschuldsvermutung hätte Paul dem braven Ortsvorsteher am liebsten auf die Schultern geklopft.
»Wer Feuer legt und Pferde umbringt, bringt auch Menschen um«, urteilte Erwin knapp und zündete sich eine an.
Schön, dachte Paul, daß nicht alle gleich ans Lynchen der Ehefrau denken. Aber an Erwins Variante glaubte er nicht.
»Wer auf Brandstiften steht«, wandte er behutsam ein, »ist selten ein Mörder. Oder ein Tierquäler. Wahrscheinlich haben wir es mit mindestens drei Tätern zu tun. Vielleicht sogar mit mehr – wenn man Nachahmungstäter dazurechnet.«
Daß man mittlerweile davon ausgehen mußte, daß in seiner geliebten Heimat mehr als ein, ja mehr als zwei Wahnsinnige frei herumliefen, erschien selbst dem gelassenen Gottfried eine gewagte, eine schreckenerregende Vorstellung zu sein.
»Ich bleib nachts daheim«, sagte Martha. Erwin räusperte sich und spuckte professionell an der alten Futtertränke vorbei, in der Gottfrieds Frau Marie wuchernde rote Geranien hielt.
»Hatte der Mann von der Burau nicht ziemlich oft in Frankfurt zu tun?« Ortsvorsteher Wilhelm versuchte die Aufmerksamkeit auf den in Klein-Roda zweitbeliebtesten Repräsentanten allen Unheils zu lenken: auf den Frankfurter. Ein um so schrecklicheres Phänomen, als es stets im Singular auftrat. Aber heute zündete die Idee nicht.
»Es muß einer aus der Gegend sein«, widersprach Willi, Mariannes Mann, der sich in seiner üblichen Aufmachung zu ihnen gesellt hatte – unten Gummistiefel, dazwischen einen verblichenen Overall, oben ein topfförmiges, lappiges Stück Stoff, in Form gehalten von einer schmalen, gesteppten Krempe, eine Art Hütchen, das Paul nur von Spanientouristen und Anglern vertraut war und dessen Funktion er nicht verstand. »Wer wäre denn sonst auf die Idee mit der Kühlkammer gekommen?«
Bestimmt kein Frankfurter. Willi hielt, wie er Paul einmal gestanden hatte, die Bewohner der Mainmetropole nicht nur für gesamtheitlich kriminell, sondern auch für beschränkt. »Ausnahmen bestätigen die Regel!« hatte Willi nach diesem Bekenntnis herzlich lachend ausgerufen und den Exfrankfurter Bremer kräftig in die Seite geboxt.
»Ich bleib heut nacht daheim!« beharrte Martha. Alles andere hätte ihre Nachbarn allerdings auch verwundert. Die alte Martha ging mit dem Sonnenuntergang ins Bett und war beim ersten Hahnenschrei wieder auf den Beinen, um geschäftig über die Dorfstraße zu laufen, von Bauer Tröller zum Backhaus und zurück. Wenn sie nicht gerade mit dem Fahrrad vorbeisauste.
»Die Burau hat Feriengäste. Und jede Menge Kunden«, widersprach Paul. »Die wissen alle, wo die Kühlkammern sind.«
»Wer Pferde tötet, tötet auch Menschen«, dröhnte Alfred und nickte begeistert mit dem Kopf. »Das waren die Kameltreiber! Islamistisches Pack! Alles Kannibalen!« Ortsvorsteher Wilhelm legte Alfred mäßigend die Hand auf den Arm, womit er sich ein mürrisches »Pfoten weg!« einhandelte.
Willi kratzte sich am Kopf, Gottfried streichelte geistesabwesend den Alten Fritz, die alte Martha lehnte müde an ihrem Fahrrad. Seine Nachbarn boten ein Bild der Entwurzelung, dachte Paul.
»Ach was! Natürlich war sie’s! Klar hat die Burau ihren Alten um die Ecke gebracht!« Mariannes lauter Ausbruch wunderte Paul. Nicht nur, weil sie so ungewohnt höhnisch klang. Als ob sie eifersüchtig wäre – auf Anne? Wieso auf Anne? Er war verwirrt. Viel mehr aber erschütterte ihn, daß er ihr heimlich recht geben mußte. Daß Brandstifter, Pferdeschlitzer oder »der Frankfurter« den Mord begangen hatten, war weit weniger wahrscheinlich, als daß der Täter aus dem allerengsten Umfeld des Opfers kam. Aus der Familie.