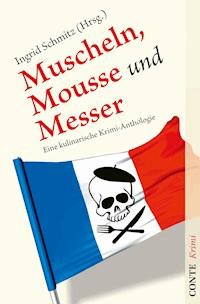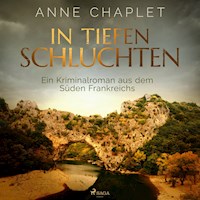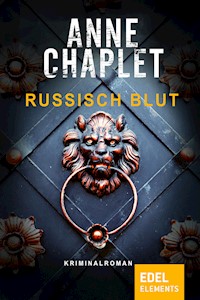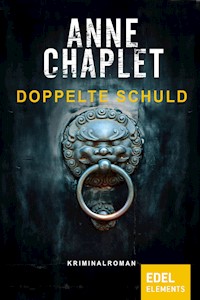
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ermittlerin Katalina Cavic
- Sprache: Deutsch
Mary Nowak legte die Zeitung zur Seite. Sie hatte den Toten sofort wiedererkannt: Benjamin Dimitroff. Vor 17 Jahren hatte sie ihn das letzte Mal gesehen, kurz nach der Wende. Nun war er im Schlosspark von Blanckenburg gefunden worden. Was steckte dahinter? Der lange Arm der Firma? Hatten die alten Kader einen ehemaligen Mitarbeiter aus dem Weg räumen lassen? Und war es weise von Mary Nowak, sich nach über 50 Jahren ausgerechnet hierhin, nach Schloss Blanckenburg, locken zu lassen, an einenOrt der Erinnerungen? Am liebsten wäre sie sofort wieder verschwunden. Aber man hatte sie in der Nähe der Leiche gesehen, Blanckenburgs TierärztinKatalina Cavic hatte sie beobachtet. Doch Katalina schien der Polizei nichts von ihrer Beobachtung mitteilen zu wollen … »Doppelte Schuld« ist der zweite Fall für die Tierärztin Katalina Cavic, die bereits in Ann Chaplets Roman "Russisch Blut" die Leser faszinierte. Auch hier wird ein brisantes Kapitel der deutsch–deutschen Geschichte erzählt. Einmal mehr packend und höchst authentisch verwebt Anne Chaplet das Geheimnis um die verschwundenen SED–Millionen mit dem Schicksal einer Spionin im aus Kalten Krieg und der Lösung eines mysteriösen Mordfalls.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 349
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Anne Chaplet
Doppelte Schuld
Kriminalroman
Edel:eBooks
Copyright dieser Ausgabe © 2013 by Edel:eBooks, einem Verlag der Edel Germany GmbH, Hamburg.
Copyright © 2007 by Cora Stephan
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Michael Meller Literary Agency GmbH, München.
Covergestaltung: Agentur bürosüd°, München
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-95530-213-9
edel.comfacebook.com/edel.ebooks
Inhalt
Vol de Nuit
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Schwarzer Samt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Sirius
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Textnachweis und empfohlene Literatur
Zu diesem Buch
Mary Nowak legte die Zeitung zur Seite. Sie hatte den Toten sofort wiedererkannt: Benjamin Dimitroff. Vor siebzehn Jahren hatte sie ihn das letzte Mal gesehen, kurz nach der Wende. Nun war er im Schloßpark von Blanckenburg gefunden worden. Was steckte dahinter? Und war es weise, sich nach so langer Zeit ausgerechnet in das Schloß Blanckenburg locken zu lassen, an einen Ort der Erinnerungen? Am liebsten wäre Mary Nowak sofort wieder verschwunden. Aber Blanckenburgs Tierärztin Katalina Cavic hatte sie in der Nähe der Leiche beobachtet ... »Doppelte Schuld«, der neue Fall für Katalina Cavic, erzählt ein brisantes Kapitel der deutsch-deutschen Geschichte. Packend und höchst authentisch verwebt Anne Chaplet das Geheimnis um die verschwundenen SED-Millionen mit dem Schicksal einer Spionin im Kalten Krieg und der Lösung eines mysteriösen Mordfalls.
Selbst Gold setzt Rost an Im Blattwerk bergen sich
Vol de Nuit
1
Kühl war es geworden in den letzten Tagen. Katalina blinzelte in die altersmilde Morgensonne und dachte an Herbst und Abschied. Es wurde Zeit, Blanckenburg zu verlassen. Höchste Zeit.
Sie ließ Zeus von der Leine und folgte ihm in den Schlosspark. Der Hund schnürte im Zickzack über den Weg, die Nase hier und dort im Gestrüpp am Wegesrand, über dem sich die Zweige der Wildrosen unter der Last dunkelroter Hagebutten bogen. Es roch nach feuchtem Waldboden unter dem Blätterdach der verschorften und zerborstenen Baumveteranen. Das würde sie am meisten vermissen: die Spaziergänge morgens und manchmal noch spätabends durch den Park.
Doch sie war nicht wegen der Naturschönheiten geblieben. So lange. So viel länger als üblich.
Zu lange.
Der Weg führte immer tiefer hinein in ein ungeordnetes Stilleben von Baumriesen. Ein Schwarm von Herbstfliegen fiel torkelnd über sie her und drehte wieder ab. Katalina ging langsamer, um den Moment auszukosten: Hinter der Wegbiegung traten die zottigen Giganten unverhofft zurück und der Blick öffnete sich auf eine weite Wiesenfläche, hinter der es in die Tiefe ging. Schloss Blanckenburg und sein Park lagen auf einem Felsen hoch über der Stadt, von hier aus überblickte man die Landschaft bis zum Horizont. Und am Horizont hockte der Harz mit dem sagenumwobenen Brocken, auf dem sich die Hexen zur Walpurgisnacht trafen.
Zeus, der von einer verlockenden Fährte im Park aufgehalten worden war, stürmte heran, an ihr vorbei und hinaus auf das lichte Plateau. Katalina folgte langsamer, setzte die Füße fast liebevoll in die Rasendaunen. Dieser Platz war wie geschaffen für Brockengeister und ihre Tänze. Sie bekreuzigte sich gegen den Zauber dieser ketzerischen Vorstellung. Schließlich hatte es hier nicht immer einfach nur eine ebene Rasenfläche gegeben. Bis kurz nach dem Krieg erhob sich an diesem Ort eine Kirche, die Schlosskirche von Blanckenburg. Jetzt lagen deren zertrümmerte Überreste unter dem Rasen, meterhoch aufgeschichtet über der Krypta und den Sarkophagen mit den Toten.
Katalina zögerte. Noch immer schreckte sie die Vorstellung, über Gräber zu gehen; insbesondere über diese uralte Grabkammer. Sie machte einen Schritt zur Seite. Die Krypta gab es noch und es gab auch einen Weg hinein – man musste ihn nur kennen.
Zeus hielt sich jetzt neben ihr, während sie weiterging. Als im Sommer 1945 die Kirche gesprengt und der Boden planiert wurde, hatte man ein paar uralte Steine vom ehemaligen Friedhof stehengelassen. Wenigstens sie erinnerten noch an eine Vergangenheit, die zurückreichte bis ins 12. Jahrhundert. Fast achthundert Jahre. Unvorstellbar.
Katalina hatte sich angewöhnt, die Worte ihrer Großmutter zu murmeln, wenn sie sich den verwitterten Grabsteinen näherte. Großmutter pflegte beim Anblick eines Grabes stets höheren Schutz anzurufen. Wenn sie noch gelebt hätte, als Jugoslawien auseinanderbrach, beim gegenseitigen Schlachten und Morden, beim Verscharren der Leichen in Massengräbern – wenn sie das noch erlebt hätte, wäre viel zu tun gewesen für die jeweils zuständigen Heiligen.
Sie blieb stehen. Es war nicht gut, an einem Ort zu leben, an dem man auf Schritt und Tritt Vergangenheit atmete. Da mochten sie sagen, was sie wollten: dass man nicht verdrängen dürfe, dass man sich erinnern müsse. Aber sie empfand das anders. Es tat wohl, zu vergessen. Man musste vergessen. Sie wollte vergessen.
Ein weiterer Grund, zu gehen.
Katalina fuhr sich durchs dichte dunkle Haar und setzte sich wieder in Bewegung. Früher war sie stets schon fort, bevor es auch nur anfing, nach Heimat zu riechen, oder sie einen Hauch jener unsichtbaren Netze spürte, die umgarnen, verführen, festhalten. Katalina Cavic hieß: immer auf der Flucht. Seit sie 1982 das erste Mal Glogovac verlassen hatte, ehemals Schutzberg, später eine jugoslawische Kleinstadt, heute bosnisch. Als Tierärztin hatte sie sich angewöhnt, ihre Wirkungsstätte eher früher als später zu wechseln. Umso verdächtiger, dass sie jetzt schon seit fast drei Jahren Beichtmutter aller Haustierbesitzer im romantischen Blanckenburg im Harz war.
Auf den Spitzen der Grashalme wiegten sich glitzernde Tautropfen. Sie sah in die bernsteintreuen Hundeaugen von Zeus und lächelte zurück. Dann hob sie den Blick. Ein Rebhuhn trippelte über die Wiese und stieg knatternd auf. Zeus muckte, blieb aber sitzen. Von der Stadt her klang das Achtuhrläuten von St. Bartholomäus herauf. Vor ihr lag die Wiese im Schatten der Bäume, rechts die Grabsteine, kein Stein vom Morgenlicht berührt. Und daneben...
Jetzt ist es soweit, dachte sie. Du hast Visionen.
Die langen weißen Haare, die eine weiche Brise packte und auffächerte. Das weiße Gewand, eine Tunika über einer Hose. Die feinen Nebelschwaden, die aus der feuchten Wiese wie Weihrauchschleier aufstiegen und die Gestalt umhüllten, die breitbeinig dastand, das eine Bein angewinkelt, das andere gestreckt. Der linke Arm war auf das Knie des angewinkelten Beins gestützt, der rechte streckte sich, mit der Handfläche voraus, der aufgehenden Sonne entgegen.
Zeus hob das Hinterteil und bewegte die Rute, langsam, bedächtig. Katalina verstand seine Sprache, sie beide hatten schnell gelernt, seit sie ihn eines Abends als Hundebaby in einem Karton vor ihrer Haustür gefunden hatte. Er drückte sich so präzise aus wie kein anderer Hund.
Ich bin interessiert und beunruhigt, signalisierte die Rute. Da ist etwas ... es ist fremd ... man sollte es untersuchen ... Seine Schnauze hob sich, die Nasenspitze bewegte sich. Aber es könnte auch – gefährlich sein ... Er senkte die Schnauze wieder.
Dann sah auch sie es, das, was der weißen Gestalt gegenübersaß, aufrecht, aufmerksam und reglos.
Der Schakal. Schwarz, mit spitzer Schnauze und spitzen Ohren. Anubis, Sohn des Osiris, Gott der Toten, der die Fürbitte für sie entgegennimmt. „Heilige Jungfrau von Medjogorje“, flüsterte Katalina und fügte vorsichtshalber noch Sveti Ante hinzu, den heiligen Antonius von Padua, einen Mann für alle Fälle. In ebendieser Sekunde berührten die Strahlen der Morgensonne den Scheitel des größten der Grabsteine und bekränzten Anubis.
Die weiße Gestalt stand noch im Schatten. Wie eine Skulptur. Ein Götzenbild. Eine altägyptische Hohepriesterin. Wie etwas Uraltes, aufgestiegen aus der Krypta unter ihren Füßen. Und dann drehte sie sich, wandte Katalina langsam das Gesicht zu, ein Gesicht mit dunklen Tälern und scharfen Kanten unter den weißen Haaren, darin Spuren von Schönheit und Ebenmaß. Ein Gesicht, dessen Augen geschlossen zu sein schienen. Katalina hielt die Luft an.
Im nächsten Moment war die Vision vorbei. Anubis verwandelte sich in einen schwarzen Schäferhund, der sich niedersinken ließ und den Kopf auf die Vorderpfoten legte. Er trug ein weißgelbes Ledergeschirr, das Katalina vertraut war. Ein Hund, der so etwas trug, war etwas Besonderes. Anubis, der Gott der Toten, begegnete dem Reich der Lebenden als Blindenhund. Und die Gestalt, die sich in einer fließenden Bewegung wieder von Katalina abgewandt hatte, konnte nicht sehen.
Sie trat ein paar Schritte zurück. Selbst der sonst so neugierige Zeus schien die Magie der Szene zu spüren und folgte ihr bereitwillig, fort von der Wiese, die jetzt im frischen Sonnenlicht schimmerte. Katalina fröstelte. Was für ein starker Zauber. Die weiße Frau übte ihren Kult ausgerechnet über der Stelle aus, unter der die Krypta lag. Und der schwarze Hund hatte direkt vor dem größten und ältesten der Grabsteine gesessen. Natürlich ein Zufall, alles andere wäre Aberglauben.
Natürlich, tönte ein spöttisches Echo in ihrem Inneren.
Auf dem Rückweg gingen sie am Schloss vorbei. Die Sonne stand inzwischen hoch genug, um hier und da das Blätterdach der alten Bäume zu durchdringen, das sie so eifersüchtig zusammenhielten. Zeus trabte ebenso entschlossen nach Hause, wie er vorhin nach dem allmorgendlichen Spaziergang verlangt hatte. Nur Katalina zögerte, sie kämpfte mit dem Gefühl, auf Watte zu gehen. Oder auf Scherben. Die weiße Gestalt beunruhigte sie. Sie kam ihr vor wie ein Bote mit schlechten Nachrichten.
Das Zeichen an der Wand.
Zeus hob das Bein am großen Wegstein vor dem Traiteurshaus, das war ein feststehendes Ritual. Das Traiteurshaus lag direkt an der Schlossmauer, vor dem Tor zum Hof; hier wohnte einst der Koch, der, wenn man nach Pracht und Größe des Hauses ging, etwas dargestellt haben musste im gräflichen Haushalt. Katalina schaute hoch zu den Fenstern im ersten Stock und bildete sich ein, das weiße Licht des Computerbildschirms zu sehen. Sie klingelte nicht. Früher wäre Moritz längst heruntergekommen, um Zeus und sie beim Morgenspaziergang zu begleiten. Früher. Aber seit Wochen schon saß er von morgens bis abends vor dem Computer und forschte in den Weiten des Netzes nach seiner seit Jahrzehnten verschollenen Mutter. Als ob ein Mann in den besten Jahren nicht auch noch anderes im Kopf haben sollte.
Mich, zum Beispiel, dachte sie. Aber vielleicht hatte er längst genug von der Beziehung zu einer Tierärztin mit Neigung zu Schwermut?
Zeit zu gehen. Neue Stadt, neues Glück. Sie war schon viel zu lange hier und auch noch aus dem falschen Grund: ein Mann.
Katalina folgte Zeus durch das große Tor in den Schlosshof. Neben Bergen von Sand und Kies blitzte die neue orangefarbene Mischmaschine. Der rechte Flügel des hufeisenförmig angelegten Barockbaus, der Gartentrakt, leuchtete frisch verputzt in warmen Ockertönen, auch die Rahmen der bodentiefen Fenster waren frisch gestrichen. Aus der Kapelle gegenüber wehte ein kühler Hauch. Nasses Mauerwerk. Der Putz, den man drinnen abgeschlagen hatte, wartete draußen neben dem Dixiklo auf den Abtransport. Es musste jahrelang hineingeregnet haben in die Familienkapelle, die Bücher aus der Bibliothek im ersten Stock hatte man wegwerfen müssen.
Katalina war der Geruch vertraut. Nichts konnte ihn auslöschen. Sie war mit ihm aufgewachsen, im Bauernhaus der Großeltern bei Glogovac. Wie armselig das Häuschen gewesen war, sah man an dem kümmerlichen Schutthaufen, den eine Panzerfaust an einem Frühjahrsmorgen daraus gemacht hatte. Aber über dem Geröll aus Steinen, Mörtel und Holz schwebte noch immer der Geruch nach Schimmel in den Wänden – obwohl keine einzige Wand mehr stand.
Auch das war etwas, das sich gegen das Vergessen sträubte, obwohl es zu den Erinnerungen gehörte, auf die sie keinen Wert legte.
Katalina hob den Blick. Die Uhr am Turm stand noch immer auf halb sechs, und die Statuen auf dem Sims darunter sahen grau und gebrechlich aus. Doch es war nicht zu übersehen: die Rettung von Schloss Blanckenburg hatte Fortschritte gemacht. Ein Wunder, denn seine beiden Bewohner hatten bereits ihr ganzes Vermögen in den alten Kasten gesteckt, und die Banken weigerten sich, weitere Millionen bereitzustellen. Schließlich wollte man wissen, was aus dem Wahrzeichen des Städtchens einmal werden sollte – Heimatmuseum? Hotel? Denkmal? Oder wirklich nur der Altersruhesitz zweier einsamer Männer, beide ohne Erben und ohne Aussicht auf welche?
Katalina dachte an Glogovac. Sie hatten zu viert mit zwei Ziegen, vier Schweinen und einem Pferd auf 60 Quadratmetern gehaust und sich wohlhabend gefühlt. Auf Schloss Blanckenburg im Ostharz, einst herrschaftlicher Sitz einer Familie mit Geschichte und Geschmack, einem barocken Koloss mit großzügigen Zimmerfluchten und zahllosen Dienstbotenkammern, hockten zwei Sonderlinge, die, wenn es so weiterging, im nächsten Winter das Heizöl nicht mehr bezahlen konnten: Gregor von Hartenfels, ein alter Mann, der keine Erben hinterließ, außer diesem auch nicht mehr ganz jungen Mann, Moritz von Hartenfels, den der Graf aus Dankbarkeit adoptiert hatte.
Katalina hob das Gesicht in die Morgensonne. Auch im Turmflügel des Schlosses rührte sich nichts, nur ein halbes Dutzend Pfauen ordnete sich auf der Freitreppe gelangweilt die Federn. Den alten Grafen würde man vor Mittag nicht zu sehen bekommen, er war kein Frühaufsteher.
Sie kehrte dem Schlosshof den Rücken, blickte noch einmal zum ersten Stock des Traiteurshauses hoch und ging an der Schlossmauer entlang zum Kutscherhaus im unteren Teil des Parks. Hier wohnte sie, schon seit fast drei Jahren. Eigentlich hatte das eine vorübergehende Lösung sein sollen, aber sie war noch immer hier. Das Haus hatte eine Runderneuerung so dringend nötig wie das Schloss, aber das störte sie nicht. Dann musste man auch nicht renovieren, wenn man wieder auszog, was täglich näherrückte.
Katalina holte den Hausschlüssel aus der Hosentasche und sah sich nach Zeus um. Aber der Hund war ihr nicht gefolgt, er stand wie gebannt am Wegesrand, die Rute waagerecht nach hinten gestreckt, die Ohren aufgestellt, soweit das möglich war mit diesen unmöglichen Schlappohren, die Nase witternd in der Luft, bereit zum Sprung. Gleich würde er losschnellen und die Maus zu fassen kriegen oder was immer er da belauerte.
Vor ihrem inneren Auge tauchte für einen Moment Anubis auf, der schakalköpfige Gott. Ihr war, als grinste er.
Zeus sprang nicht. Er gab einen Laut von sich, der ihr in den Magen fuhr, einen Urlaut aus Verwirrung und Schmerz. Mit gespannter Aufmerksamkeit starrte er in das Gebüsch, bis sie zurückkam und ihn am Halsband packte. Er bewegte den Schwanz, nicht freudig, eher so, als ob er ihre Anteilnahme zu schätzen wisse.
„Ruhig“, sagte sie. „Es ist nichts.“
Es ist nichts. Sieh nicht hin. Geh weiter.
Aber da war was, und sie musste hinsehen. Zeus winselte, als sie ihn zurückließ und in das Unterholz am Wegesrand vordrang. Zweige knackten unter ihren Schritten. Die Vögel waren still, und kein Blatt an den Bäumen über ihr bewegte sich.
Der Schuh. Als erstes sah sie den Schuh, einen hellbraunen Halbschuh. Der Schuh war weder elegant noch sportlich, so etwas trugen Leute, denen nicht wichtig war, was sie an den Füßen hatten. Dazu dunkelblaue Socken, so kurz, dass man das Bein sehen konnte – ein nicht sehr kräftiges Männerbein, behaart und von einer Farbe, die in diesem Sommer selten geworden war: blass. Das andere Bein war leicht angewinkelt, das Hosenbein hochgeschoben.
Katalina versuchte zu schlucken, aber die Zunge klebte ihr am Gaumen. In ihrer Magengrube krümmte sich etwas zusammen und schlug mit den Flügeln wie ein dunkler Nachtvogel.
Die Schuhe. Die Socken. Die Jeans. Der beigefarbene Blouson, unter dem man ein blaues Hemd erkennen konnte. Katalinas Blick heftete sich an den Leberfleck unterhalb des Kehlkopfs des Mannes, irgend etwas fiel ihr auf, aber sie bekam den Gedanken nicht zu fassen.
Du willst es nicht wissen, flüsterte es in ihr. Aber du weißt, was du gleich sehen wirst.
Sie ließ den Blick weiterwandern. Natürlich, sie erkannte ihn sofort. Bartlos, käsige Haut, sandiges, dünn gewordenes Haar, alles so blass wie der ganze Mann. Und blaue Augen, daran erinnerte sie sich, denn sehen konnte man die Augenfarbe nicht, obwohl das linke Auge offenstand. Auf der stumpf gewordenen Pupille hockte eine grünschillernde Fliege.
Die Fliegen. Schwärme giftig schillernder, bösartig schnarrender Fliegen. Ganze Wolken von Fliegen, die sich erhoben, wenn man näher kam, und die wie UFOs in der Luft standen, ungehalten, weil man sie hinderte, auf ihren Festplatz zurückzukehren, auf dem sie Orgien feierten, fraßen, sich begatteten, Eier legten. Und die sich herabsenkten wie ein Sargdeckel, wenn man ihnen das Feld wieder überließ.
Katalina versuchte, das bissige Tier zurückzudrängen, das ihr die Kehle hochsteigen wollte. Sie hatte viel zu oft die Maden wimmeln gesehen auf abgerissenen Gliedmaßen, zerfetzten Leibern, aufgeplatzten Schädeln, in irgendeinem Stück Fleisch, das einmal zu einem Menschen gehört hatte.
Er ist tot, er braucht keine Erste Hilfe mehr, lass ihn liegen, flüsterte die innere Stimme. Dennoch zwängte sie sich weiter vor durchs Gestrüpp. Die Fliege auf dem Auge des Mannes erhob sich, ärgerlich summend. Katalina unterdrückte einen Aufschrei. Sie streckte die Hand aus, um an der Halsschlagader nach dem Puls zu tasten. Ihr Blick wich den toten Augen aus, heftete sich wieder an das Muttermal unter dem Kehlkopf, etwas irritierte sie, der Kopf des Mannes war nach hinten gebogen, zu weit nach hinten. Aber äußere Verletzungen waren nicht zu erkennen, und tot war er ohne Zweifel. Dennoch fasste sie den leblosen Mann an den Unterkiefer. Kein Zeichen von Totenstarre. Natürlich nicht. Ihr Herzschlag stolperte. Der Mann war noch warm.
Sie wich zwei Schritte zurück, mitten in eine Brombeerhecke. Das wütende Tier in ihrer Kehle strampelte sich mit spitzen Krallen nach oben. Ihre Hand suchte Halt und fasste in die Brombeerranken. Der Schmerz lenkte sie ab von dem Wunsch, sich zu übergeben.
Alles in ihr wollte weg hier, ihr Magen, ihr Herz, das Gedärm – nicht nur aus Ekel und Angst, nein: Es war einfach nicht gut, bei einer Leiche angetroffen zu werden, das saß ganz fest und ganz tief innen drin. Sie tastete nach dem Mobiltelefon in ihrer Hosentasche. Nein, es war ebensowenig gut, die Polizei anzurufen – auch das hatte sie noch nicht verlernt, selbst nicht nach fünfzehn friedlichen Jahren. Es war am besten, nichts zu sehen, zu hören, zu wissen, zu sagen, schon gar nicht, dass sie den Mann kannte.
Er war gestern in der Praxis erschienen, hatte inmitten der Hunde-, Katzen- und Kanarienvogelbesitzer gesessen, die ihre Tiere in Käfigen und Körben auf den Knien hielten, hatte nichts im Schoß gehabt außer gefalteten Händen. Der Mann hatte abgewinkt, als sie ihn ins Sprechzimmer bitten wollte, und einem Kind mit Hamster den Vortritt gelassen. Und als er endlich an der Reihe war...
„Pferde oder Rinder?“ hatte sie gefragt, als er vor ihr saß, sehr höflich und sehr schüchtern.
„Wie bitte?“ Der Mann, der sich als Frank Beyer vorgestellt hatte, wirkte unsicher wie ein Schuljunge.
Sie hatte ihn angelächelt, um ihn zu ermutigen. „Sie kommen in meine Praxis ohne Schoßtier auf dem Arm – da stellt sich natürlich die Frage ...“
„Natürlich.“ Er zögerte. „Es geht um einen – Hund.“ Bei diesem Wort verzog sich sein Gesicht, als ob er mit der Zunge nach einem Loch im Zahn suchte.
„Und – was ist los mit dem Tier?“
Frank Beyer rutschte auf dem Stuhl nach vorn und dann wieder nach hinten. „Es handelt sich um einen Blindenhund.“
Ein Blindenhund ist kostbar. Teuer in der Ausbildung, unersetzlich für seinen Besitzer.
„Wo ist das Tier?“
„Das weiß ich nicht.“ Wenn sein Lächeln nicht so unendlich hilflos gewesen wäre, hätte sie ihn rausgeschmissen. „Ich suche ja danach – nach einem Blindenhund.“
„Da sind Sie hier falsch.“ Für so etwas war der Blindenbund zuständig, nahm sie an. Oder die Krankenkasse.
„Nein, nein.“ Er griff in die Brusttasche seines Hemdes und zog eine Karte hervor. Detektei Hermes. Darunter eine Mobiltelefonnummer. „Wenn jemand mit einem Blindenhund in Ihre Praxis kommt ... würden Sie mich bitte anrufen? Oder dieser Person meine Karte geben?“ Dann hatte er sich vorgebeugt, „es geht um Leben oder Tod“ geflüstert und die Augen weit aufgerissen.
„Natürlich“, hatte sie beruhigend gesagt. „Da machen Sie sich mal keine Sorgen.“ Hatte ihn dann höflich hinausbegleitet, er war der letzte gewesen vor der Mittagspause. Ein Spinner. „Leben oder Tod.“ Was für ein Unsinn. Aber jetzt lag er hier, und für ihn selbst hatte sich die Alternative erledigt. Und sie – sie hatte Angst.
Es ist nicht dein erster Toter, also stell dich nicht so an, sagte sie sich streng.
Natürlich nicht. Aber ...
An der Praxistür hatte er sich umgedreht und sie gefragt, woher sie stamme. „Aus Bosnien“, hatte sie gesagt.
„Natürlich!“ Er strahlte sie an, als ob er beim Preisausschreiben gewonnen hätte. Und dann hatte er etwas gesagt, das so harmlos war, dass sie ihre Erschütterung noch jetzt nicht begriff.
„Vielleicht sogar aus – Mostar?“
Aus Glogovac, wollte sie sagen. Aber sie hatte kein Wort herausbekommen.
Wie in Trance kämpfte Katalina sich durch das Brombeergestrüpp zurück. Der Mann musste etwas in ihrem Gesicht gelesen haben, jedenfalls hatte er sich entschuldigt, bevor er ging.
Mit fliegendem Atem stand sie endlich wieder auf dem Weg, die Arme blutig, an den Hosen Brombeerranken und Blätter. Zeus gab einen leisen Jammerlaut von sich, als ob er wüsste, dass es sich nicht gehört, wenn Männer tot im Gebüsch liegen. Katalina streichelte seinen Kopf und redete beruhigend auf ihn ein. Dann leinte sie ihn an auf den letzten paar Metern zum Kutscherhaus.
Die weiße Frau mit dem schwarzen Hund. Anubis, der Schakal. Der Gott der Toten. Das war ein Zeichen gewesen, ganz gewiss. Ihre vernünftige Seite protestierte, aber ihre dunkle Seite wusste es besser. Es war ein Zeichen. Der Mann von der Detektei Hermes hatte jemanden mit einem Blindenhund gesucht, und nun war er tot. Und er war noch nicht lange tot gewesen, als sie ihn fand – höchstens seit einer Viertelstunde. Ob die weiße Frau ... konnte ein blinder Mensch einen normal und gesund wirkenden Mann umbringen? Plötzlich hielt sie alles für möglich.
Und dann fiel ihr etwas ein, das sie in ihrer Panik vergessen hatte. Über dem Toten schwebte ein merkwürdiger Geruch, fast wie ein schweres Parfüm. Der Tote roch nach Frühlingsblumen.
Genauer gesagt: er roch nach Moder und Narzissen.
Ihre Hand mit dem Schlüsselbund zitterte. Sie drückte die Stirn an das kühle Holz der Tür zum Kutscherhaus und versuchte, tief und ruhig zu atmen. Zeus wartete geduldig.
Mostar, dachte sie. Verflucht sei diese Stadt.
2
Es roch anders.
Mary Nowak hob das Gesicht unter der Sonnenbrille in die Herbstsonne. Blanckenburg lag da, als ob das alles niemals passiert wäre. Nicht der Fliegerangriff der Amerikaner nur wenige Wochen vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs, nicht die deutsche Teilung und das, was sich DDR nannte, ein Gebilde, in dem die Städte ganz ohne die Nachhilfe von Bombergeschwadern zerfielen. Überholen ohne Einzuholen, dachte sie und sah das noch immer allzu vertraute Gesicht vor sich, die Halbglatze, den Ziegenbart – der Staatsratsvorsitzende Walter Ulbricht, mochte er unruhig liegen. Ruinen schaffen ohne Waffen, das war die wahre Errungenschaft des Sozialismus gewesen.
Mary packte Bügel und Hundeleine fester. Natürlich roch es anders.
Musste es ja, fünfzig Jahre später. Damals war sie zuletzt in Blanckenburg gewesen. Die Stadt hatte wie im Nebel dagelegen, ein schwerer Dunst aus Qualm und Ruß, der aus Schornsteinen und Auspuffrohren quoll und das Gemüt verdüsterte. Und beim Besuch davor ... Ihre Nase erinnerte sich an einen noch schlimmeren Gestank. In jenem Sommer, im Sommer nach dem Krieg, als sie abgerissen und halbverhungert nach fast einem halben Jahr auf der Flucht aus Ostpreußen endlich in Blanckenburg angekommen und den gepflasterten Fußweg zum Schloss hinaufgestiegen war, vorbei an Soldaten auf dem Abmarsch ...
Damals hatte es nach ausgebrannten Häusern und verkohlten Leichen gerochen.
Mary holte tief Luft und schüttelte die Erinnerung ab. Sie gingen am Kleinen Schloss vorbei in die Marktstraße. Lux verhielt sich mustergültig, setzte sich an der roten Fußgängerampel und hielt sie, als sie weitergehen wollte, zurück, bis es grün wurde. Der Hund hatte das richtige Gespür für seine Aufgabe, er verfügte über genau die Besessenheit, die ein guter Blindenführhund braucht. Es war der beste bislang, den sie erzogen hatte. Noch ein Vierteljahr, dann war die Ausbildung beendet, und er konnte seinem künftigen Besitzer übergeben werden.
Mary Nowak blieb stehen, mitten auf dem Bürgersteig. Lux drehte fragend den Kopf. Der Gedanke, das Tier abgeben zu müssen, tat weh. So sentimental war sie sonst nicht, wenn es um einen Job ging, der immerhin 25.000 Euro abwarf. Außerdem brauchte ein anderer Mensch Lux mehr als sie. Sie beugte sich herunter und strich dem schwarzen Schäferhund über das glänzende Fell. Die Leute, die an ihnen vorbeigingen, schienen zu zögern, sie spürte ihre Blicke. Gleich würden sie stehenbleiben und helfen wollen. Mary richtete sich hastig wieder auf. Dass sie plötzlich so gefühlsduselig war, musste an Blanckenburg und der Erinnerung liegen.
Es war merkwürdig, aber die Stadt sah aus wie das Blanckenburg, von dem sie jahrelang geträumt hatte. Wie es hätte aussehen können, wenn alles gutgegangen wäre. Wenn der Krieg nicht gewesen wäre. Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre. Sie blickte nach oben, dorthin, wo das Schloss in seiner alles beherrschenden Präsenz thronte.
Anyway.
Die Geschichte lässt sich nicht rückgängig machen, und nichts bleibt, wie es ist. Auch du nicht, dachte Mary Nowak, als sie am Schaufenster von Möbel-Unger vorbeiging, das von Staub und Fliegendreck blind war. Aber noch immer hingen die beiden bronzenen Tafeln rechts und links vom Backsteinportal mit der schweren Holztür. Viel mehr war nicht übriggeblieben von der einst so großartigen „Möbel-Halle“ des Hoftapezierers Friedrich Unger, deren prächtige Jugendstilfassade zum Schönsten gehörte, was die Lange Straße damals zu bieten hatte. In dem 1875 gegründeten Traditionsgeschäft gab sich jahrelang die High-Society des Städtchens die Klinke in die Hand. Heute stand der Laden leer. Wie lange wohl schon?
Sie straffte sich und warf den dicken weißen Zopf nach hinten. Die Figur ist in Ordnung, und das Gebiss hält auch noch eine Weile, dachte sie und verfluchte nicht zum ersten Mal die unumstößliche Tatsache, dass sie in einem Körper steckte, dessen Verfall unaufhaltsam war – auch die Töpfe mit den teuren Cremes vergoldeten nur die Falten. Ihr Körper hatte mehr als 80 Jahre hinter sich, von denen sie höchstens 75 zugab. Aber in ihrem Kopf war sie noch immer – nun ... Mary lächelte ihrem schmeichelhaft unscharfen Spiegelbild in der staubigen Schaufensterscheibe zu und ging weiter. In den besten Jahren eben.
Das Rathaus mit seinen gotischen Zinnen und Türmchen war beflaggt. Der Marktplatz war groß und schön und leer. Niemand saß auf den steinernen Bänken neben dem Brunnen. Warum sollte hier auch jemand flanieren, vor blinden Schaufenstern, in einer Stadt, in der es noch nicht einmal Gäste für ein Straßencafé zu geben schien, das sie plötzlich schmerzlich vermisste? Sie drehte sich um. Ein Mann stand vor dem Schaufenster des Fremdenverkehrsamts. Ob das schon die Hoffnung auf blühenden Tourismus rechtfertigte?
„Geh!“ Lux gehorchte sofort. „Rechts!“ Der Hund führte sie ein Stück die Tränkestraße hinunter und bog ab in die Marktstraße. Mary blieb stehen. Hier also waren sie, die Blanckenburger, die nicht arbeiteten oder zu Hause vor dem Fernseher saßen. Frauen begutachteten die Sonderangebote, die ein Modegeschäft vor die Ladentür gehängt hatte. Kinder zogen ihre Eltern zum italienischen Eiscafé, und vor einem Imbiss lehnten einsame Männer an Stehtischen, hätschelten ihr Vormittagsbier und ließen die Welt an sich vorüberziehen.
Lux und sie ernteten die üblichen neugierigen Blicke, weil alle glaubten, einer Blinden würde das nicht auffallen. Mittlerweile verstand sie, warum sich viele Blinde gegen einen Hund sträubten. Mit dem Tier in seinem Führgeschirr und dem Bügel war die ansonsten so diskrete Behinderung unübersehbar, und man sah die anderen zwar nicht starren, aber man hörte sie.
Es gab, gottlob, immer weniger Blinde. Mary sah sie vor sich, die gequälten Gesichter der Männer mit den schwarzgepunkteten gelben Binden, die nach dem Krieg zum Straßenbild gehörten. Geschoßsplitter, Hirnverletzungen, Nervenschäden. Heute kam so etwas selten vor und den meisten half der medizinische Fortschritt. Den anderen halfen Hunde wie Lux.
Ein hübscher schwarz-weißer Bordercollie zerrte sein Herrchen hinter sich her, um Lux von Nase zu Nase zu begrüßen. Die Hündin zeigte sich interessierter, als erlaubt war und sah vorsichtig zu Mary hoch, um zu sehen, ob sie wohl das Zeichen gab, das da hieß: Halt dich zurück. Aber Mary ließ ihr Leine und bemerkte, wie intensiv der andere Mann sie musterte. Routiniert registrierte sie seine wesentlichen Merkmale: um die vierzig. Etwa 1 Meter 85, athletisch. Dunkelbraune, mittellange Haare, hellbraune Augen. Kräftige Hände, die Handrücken behaart. Jackett mit Fischgrätenmuster und Lederflecken an den Ellbogen. Jeans. T-Shirt. An den Füßen Adidas.
„Komm, Tess“, sagte der Mann, fügte ein höfliches „Auf Wiedersehen“ hinzu und sah verlegen weg, als ihm sein Fauxpas bewusst wurde.
„Auf Wiedersehen“, antwortete Mary freundlich und drehte sich um zu Lux.
Sie standen vor einem Fachwerkhaus mit cremefarbenen geschnitzten Säulen vor Tür und Ladenfenster, hinter dessen verstaubten Scheiben ein Ficus vor sich hin kümmerte. Welches Geschäft gab es hier früher? Einen Metzger? Einen Fischladen? Haushaltswaren, Stoffe? Sie erinnerte sich vage an eine hagere Person, ein Fräulein mit spitzem Mund und klammen Fingern, das ihr ein Kleid angepasst hatte, damals, bei einem ihrer ersten Besuche in Blanckenburg.
Die Stecknadeln. Das Fräulein hatte sie im Mund und nahm eine nach der anderen heraus, um den Saum festzustecken. Mary hörte die Stimme, die leise vor sich hin summte, fühlte die kühlen Hände, mit denen das Fräulein sie hin und her schob, roch Wolle und Staub und das Öl der Nähmaschine.
Es sei der Fluch des Alterns, zu vergessen, glaubten alle. Sie sah das anders. Das Alter straft mit Erinnerung – besonders an das, was weit zurückliegt. Wie viele Jahre war es her, seit sie zum ersten Mal nach Blanckenburg gekommen war, zu der Familie von Tante Betty, der Lieblingskusine ihrer Mutter? Ein Menschenalter, wie man so sagt.
Das Glockenspiel vom Uhrturm, „Üb’ immer treu und Redlichkeit“. Die Kutsche mit den beiden braunen Wallachen, mit der die Familie Hartenfels sonntags auszufahren pflegte. Sie musste zehn gewesen sein, Gregor dreizehn und Folkert fünfzehn Jahre alt, in diesem verzauberten Jahr 1933, von dem sie nicht wussten, dass es der Anfang vom Ende sein würde. Sie sah einen Federball durch die Luft fliegen, hörte Gregor lachen, Tante Betty rufen, Folkert Klavier spielen. Hatte den Geruch der Bücher aus der Bibliothek über der Kapelle in der Nase, ihr Lieblingsbuch damals hieß „Don Quixote“. Der Park und der Teich und der Jordan, das Flüsschen, an dessen Ufer man bis nach Cattenstedt laufen konnte, zum Rittergut, um die Fohlen zu streicheln. Und eines Tages, es war ein besonders heißer Tag im Juli gewesen ...
Ellas gerötetes Gesicht. Der Duft nach schwarzen Johannisbeeren. Die Köchin hatte in der Schlossküche Marmelade eingekocht, ihr Gesicht leuchtete hinter Dampfschwaden wie ein chinesischer Lampion. An diesem Tag hatten sie das Versteck gefunden.
Die Kirche. Sie waren vor der Hitze in das kühle Gotteshaus geflüchtet, in dem selbst Gregor nur flüsterte. Hinter einer Tür am Ende des Seitenschiffs ging es eine enge Treppe hinab, immer weiter hinunter, bei Kerzenschein, den Stummel trug Folkert in der Hand, hinunter bis zu einem eisernen Tor. Dahinter lag die Krypta mit den Särgen und Sarkophagen aus Stein und Eisen.
Das Grab. Ein schlichter Steintrog mit einem Deckel, durch den ein Riss ging. Darüber das in Stein gehauene Reliefbild eines Ritters und verwitterte Buchstaben, die man nur entziffern konnte, wenn man sie mit den Fingerspitzen nachzeichnete. Gawan Graf von Hartenfels. Sie hatten ihn zu ihrem Schutzheiligen erkoren.
Graue, schwere Bodenplatten neben dem Grab. Eine war lose, man spürte, wie sie sich bewegte, wenn man drauftrat. Folkert hebelte sie mit dem Taschenmesser hoch. Darunter ein Ring und eine schwarz angelaufene Münze. Ihr Versteck. Sie verabredeten, geheime Botschaften unter der Platte zu verstecken, Fundstücke, kleine Kostbarkeiten. Und als der Krieg begann...
Das Verlobungsbild. Postkartengroß, mit gezacktem Rand. Angefertigt im Fotoatelier Jaumann, Danzig, Langer Markt. Wie ernst sie ausgesehen hatte. Sechzehn war sie gewesen, als sie sich mit Gregor verlobte, 1939, gegen den Wunsch ihrer Mutter – „Mathi, du bist doch noch viel zu jung!“ Aber sie wollte Gregor ihr Wort geben, bevor das geschah, was alle fürchteten. Der Beginn der Katastrophe.
„Nach dem Krieg in Blanckenburg“, hatten sie einander feierlich versprochen. Aber Folkert hatten sie in Plötzensee an einem Fleischerhaken gehenkt. Und Gregor...
Sie riss von der Erinnerung los, bevor sie in ihr versank. Sie war nicht hier, um sich zu erinnern. Und der leere Raum hinter der Schaufensterscheibe verbarg nichts und gab auch nichts her.
On we go.
Im Weggehen sah sie ihr Spiegelbild in der Scheibe: eine schmale Gestalt mit weißen Haaren, daneben ein schwarzer Hund und dahinter eine andere Person, die ebenso intensiv wie sie in das leere Ladengeschäft zu starren schien und jetzt hastig den Blick abwandte. Der Mann war ihr bereits vor wenigen Minuten begegnet, er war vielleicht 30, 35 Jahre alt und trug eine Art Kniebundhose. Der Tourist, der vor der Auslage des Fremdenverkehrsbüros gestanden hatte. Mary packte den Bügel und die Leine fester. Sie hätte nicht nach Blanckenburg kommen dürfen.
„Zum Hotel“, flüsterte sie Lux zu, die sie erwartungsvoll ansah und dann mit Energie lostrabte.
Der Mann hatte sie zurück in die Gegenwart geholt. Warum war sie hier? Was zum Teufel hatte sie auf diese Schnapsidee gebracht? Ein Wort. Nur ein Wort. Und jetzt war sie in Blanckenburg und versank in Erinnerungen, statt ...
Etwas zu tun, dachte sie. Aber was?
Das Hotel Viktoria Luise war das schönste der Stadt: ein Schlösschen aus rosa Backstein mit cremefarbenen Fensterstürzen, Türmen und Erkern und einem säulenumrahmten Balkon. Sie kannte die Jugendstilvilla noch als Erholungsheim für Postbeamte, was später damit geschehen war, wusste sie nicht, wahrscheinlich hatte man einen Kinderhort darin untergebracht, das machte man in der DDR gern mit den Wahrzeichen bürgerlicher Dekadenz. Heute war das Haus liebevoll renoviert, eine Suite und vierzehn Zimmer, und jedes ist anders, hatte Frau Willke gesagt und versucht, sich nichts vom Stolz auf ihr Haus anmerken zu lassen. Es lag an der Teufelsmauer, gegenüber vom Schloss, fast auf gleicher Höhe. Man schaute auf die Stadt hinunter und sah die Abendsonne hinter dem Schloss untergehen.
Heute saß nicht Frau Willke an der Rezeption, sondern ein Mann, von dem Mary zuerst nur die wenigen feinen Haare sah, die er noch auf dem Kopf hatte. Er hielt ein belegtes Brötchen in der Hand, kaute und schaute auf den Computerbildschirm. Mary hörte die Maus hektisch klicken. Das musste ja ein spannendes Spiel sein.
„Ich bin hier nur die Vertretung“, sagte er, ohne aufzublicken.
Sie nahm an, dass er keine Antwort erwartete, und lief hinter Lux her, die Treppe hoch, in den ersten Stock. Sie hatte das mittlere Zimmer namens „Schlossblick“ bezogen, das Zimmer mit dem Balkon, auf dem man im Abendlicht sitzen und die Aussicht genießen konnte.
Sie schloss die Tür auf und nahm die Sonnenbrille ab. Die hohen Wände waren türkisfarben gestrichen, der Stuck an der Decke sorgfältig wiederhergestellt. Genau das richtige für ein paar unbeschwerte Tage. Unbeschwert? Nicht hier. Nicht für sie. In Blanckenburg erwartete zuviel Geschichte und zuviel anderes, das sie unruhig machte, auch wenn sie nicht genau sagen konnte, was.
Vielleicht war es ein Fehler gewesen, überhaupt hierherzukommen. Ganz sicher war es ein Fehler gewesen, mit Lux zu üben. Es gab gewiss nicht viele Vorzüge des Alterns, aber auf einen hätte sie heute nicht verzichten dürfen: Alter macht unsichtbar. Für jüngere Menschen sehen alle alten Menschen gleich aus: farblos, faltig, gebeugt, ohne Ausstrahlung und Schönheit. Niemand nahm ältere Frauen wahr oder gar ernst. Noch nicht einmal ältere Frauen selbst.
Mit einem Blindenhund aber war man nicht mehr unsichtbar, sondern nicht zu übersehen.
Seufzend setzte sie sich aufs Bett und rief Lux herbei. Dann nahm sie ihr das lederne Leibchen ab, das gelbweiße Führgeschirr mit dem Bügel und dem Zeichen für „Blindenführhund“ auf der Schulter. Es rührte sie immer wieder, dass der Hund seine Arbeitskleidung mit sichtbarem Stolz trug.
„Ab heute sind wir in Zivil“, sagte sie zu Lux und kraulte ihr die seidenweichen Ohren. Dann schickte sie das Tier auf seine Decke.
Im Bad wusch sie sich die Hände, tupfte sich Vol de Nuit von Guerlain hinter die Ohren, sog den vertrauten, lange vermissten Duft ein und musterte sich mit zusammengekniffenen Augen. Sie hatte sich nie vor dem Älterwerden gefürchtet – was bedeuten schon Falten. Was sie zu fürchten begann, waren die kleinen Unsicherheiten, die sich zu häufen schienen. Sie stolperte zu oft, sie vergaß zu viel, sie wiederholte sich. Oder nahm sie das alles zu ernst?
Es gibt Dinge, die verlernt man nie. Und es gibt Dinge, die lernt man auch mit größter Mühe nicht. Zum Beispiel, wirklich alles mitzunehmen, was man auf Reisen braucht. Die Nagelfeile. Das Deo. Genug Socken. Das Etui mit dem Nähzeug. Und die Fellbürste für den Hund. Mary Nowak versuchte, nachsichtig mit sich zu sein. Sie hatte Frau Willke erzählt, dass sie in die Stadt gehen wollte, um einzukaufen. Und genau das hatte sie vergessen. Vor lauter Nostalgie.
Welldone.
Sie kehrte zurück in den großen, hellen Raum und öffnete die Tür zum Balkon. Auf der Anhöhe gegenüber lag das Schloss, cremeweiß auf dem Präsentierteller wie ein Baumkuchen vor dem Anschnitt. Mit den Armen auf die Brüstung gestützt starrte sie hinüber, bis ihr die Augen tränten.
Was willst du hier? Was suchst du hier nach all den Jahren?
Die Antwort hieß – Sirius.
Sirius. Hundsstern. Canicula. Hellster Stern am Nachthimmel und Hauptstern im Bild des Canis Major. Doppelt so groß wie die Sonne, heller und heißer. Einer der nächsten Sterne, den man überall auf der bewohnten Erde sehen kann.
Sirius war das Schlüsselwort. Das Geheimwort, das sie band. Sirius begleitete sie seit unendlich langer Zeit, weit weg und immer nah. Wer sie gerufen hatte, musste wissen, was das Wort für sie bedeutete.
Und dafür kam nur einer in Frage.
Mary ließ sich in den Balkonstuhl sinken. Man sah jedes Detail von hier aus. Die alte Mauer, die zum Schloss hochführte. Die Baumriesen des Parks. Die großen Fenster der gräflichen Suite. Den Uhrturm. Für einen Moment bildete sie sich ein, jemanden dort oben stehen zu sehen unter der Glocke, die für die Grafen von Hartenfels zu Blanckenburg bis 1945 geläutet hatten. Und die jetzt wieder erklang, seit Gregor von Hartenfels nach Schloss Blanckenburg zurückgekehrt war.
Sie konnte den Blick nicht von dem barocken Koloss wenden, obwohl sie spürte, wie der Anblick sie in Unruhe versetzte. Im Grunde wusste sie, was sie bewegte und wovor sie zurückschreckte. Sie hatte Angst vor der Begegnung mit dem Schloss. Sie hatte Angst vor den Erinnerungen, die es auslöste.
Sie hatte Angst vor Gregor.
Heute früh auf der Wiese, dort, wo früher die Schlosskirche gestanden hatte, war ihr alles noch ganz einfach erschienen. Sie würde hinübergehen zum Schloss und Gregor besuchen. Sie würden reden. Sie würden schweigen. Sie würden all die Jahre Revue passieren lassen, um sie dann zu vergessen.
Sie dachte an sein Lachen und fragte sich, ob es dem Alter getrotzt hatte. Ob die Falten im Gesicht ihn verändert hatten. Und ob er erschrecken würde bei ihrem Anblick.
Eine Begegnung würde, wusste sie plötzlich, das Bild zerstören, das er womöglich all die Jahre über von ihr bewahrt hatte. Wollte sie es wirklich darauf ankommen lassen?
Plötzlich fiel ihr der Mann in den Wanderhosen ein, der sie beobachtet zu haben schien. Vielleicht war es gar nicht Gregor, der nach ihr suchte. Vielleicht hatte sie jemand ganz anderes hierher gelockt. Vielleicht saß sie bereits in der Falle.
3
Nichts ging Katalina heute leicht von der Hand. Die neurotische Katze der Tochter von Zahnarzt Dr. Wenz fauchte und buckelte beim Anblick einer Spritze so lange, bis sie entwischen konnte, sprang erst aufs Fensterbrett und dann, unerreichbar, auf den Schrank. Der Nymphensittich von Opa Weber – Verdacht auf Schnabelräude – hackte nach ihr, obwohl er sie kannte, weil sie ihn ungeschickt angefasst hatte. Und dann rutschte sie auch noch aus und landete neben dem Behandlungstisch auf Bello, der sie mit einem überraschten Rülpser begrüßte.
Bello roch nach entzündetem Zahnfleisch und schlechter Verdauung, und obwohl ihre Schulter barbarisch schmerzte, begann Katalina hilflos zu kichern, während sie dem Bernhardiner in die blutunterlaufenen Augen sah. Bello hatte einen Hüftschaden und den Boden gründlich vollgesabbert, typisch für einen überzüchteten Rassehund.
„Ist was passiert?“ Edith Schmid, Bellos Frauchen, beugte sich zu ihr herunter, die kurzsichtigen Augen schwammen riesengroß hinter der dicken Brille. Die Frau sah aus, als ob sie sich nicht entscheiden konnte, um wen sie sich mehr Sorgen machen musste: um den Hund oder um Katalina.
Katalina tätschelte Bello den Kopf und stemmte sich hoch. „Alles in Ordnung. Aber was Bello betrifft: Er braucht Bewegung, so schwer ihm das auch fällt.“ Sie lächelte Edith Schmid aufmunternd zu, die tapfer nickte. Die Frau benötigte Bewegung weit dringender als der Hund, aber auf ihren Arzt würde sie nicht hören. Immer öfter hatte Katalina das Gefühl, dass ihr therapeutischer Rat eher dem Menschen als dem Tier zugute kam. Mittlerweile war sie wohl für beides zuständig.
Endlich war der letzte sieche Vierbeiner Blanckenburgs versorgt. Katalina ließ sich auf den Stuhl vor ihrem Schreibtisch sinken und starrte zum Fenster hinaus. Unter den zarten Schleiern, die über den blauen Himmel zogen, flog eine rote Sportmaschine. Die Touristen schienen sich Schloss und Stadt lieber von oben anzusehen.
Der Tote war kein Tourist gewesen und auch kein Einheimischer. Sie hatte sein Gesicht noch immer vor Augen. Vielleicht war er ja eines natürlichen Todes gestorben. Sie schüttelte den Kopf. Nein. Es hatte keinen Sinn, sich was vorzumachen. Es war mehr als unwahrscheinlich, dass sich ein Mensch nach einem Herzinfarkt oder Kreislaufkollaps noch durch eine Brombeerhecke zu einem ruhigen Plätzchen im Gebüsch schleppen konnte.
Aber wenn es kein natürlicher Tod war, wenn jemand nachgeholfen hatte, dann konnte der Täter noch nicht weit gewesen sein, als Zeus den Toten fand. Katalina fröstelte. War sie in Gefahr gewesen? Aber hätte Zeus nicht Laut gegeben, wenn jemand in der Nähe gewesen wäre?
Jemand? Der Mörder. Sag es doch, forderte sie sich auf. Der einzige Mensch, dem sie an diesem Morgen begegnet war, war die weiße Frau auf dem Kirchplatz über der Krypta gewesen. Hatte sie eine Mörderin nach der Tat beobachtet?
Sie wusste, dass sie die Polizei hätte anrufen müssen. Aber sie wusste auch, warum sie es nicht konnte.
Angst, scharf wie Sodbrennen. Das Geräusch, wenn sie gegen die Tür traten, wenn sie heraufmarschiert kamen in schweren Stiefeln, wenn sie Befehle schrien. Die Schläge, bevor sie einen mitnahmen. Die Verhöre, das viel zu helle Licht in den stinkenden Zellen.
Sie kämpfte seit Jahren gegen diese Bilder, sagte sich immer wieder, dass sie mit der Realität hier und heute nichts zu tun hatten. Aber was half schon gegen Erinnerungen.
Mechanisch begann sie, die Papiere auf dem Schreibtisch zu sortieren. Sie musste Rechnungen schreiben, sonst konnte sie auch keine bezahlen. Es mussten neue Medikamente bestellt werden. Der Fellrasierer für Hunde und Katzen war kaputt. Es gab genug zu tun, und Arbeit lenkte ab, das war sie so gewohnt. Es funktionierte immer.