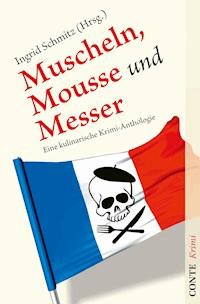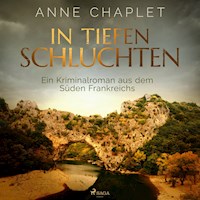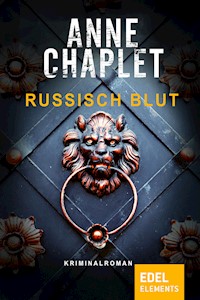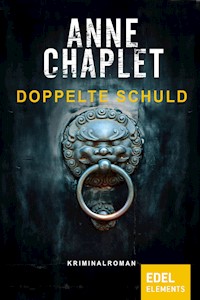4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Krimi
- Serie: Stark & Bremer
- Sprache: Deutsch
Dalia Sonnenschein arbeit in den Büros der Topmanager Frankfurts – als Putzfrau. Eines Morgens findet sie die Leiche des Bankers Marcus Saitz und putzt in Panik einfach weiter, bis es keine Spuren mehr gibt. Aber Staatsanwältin Karen Stark glaubt sowieso nicht an einen Kriminalfall. Doch dann wird auch ihr Kollege Thomas Czernowitz tot aufgefunden. Eine Mordserie? Jedenfalls gehörten die beiden Toten einem Freundeskreis einflussreicher Frankfurter an. Mussten sie deshalb sterben? Oder wegen einer dramatischen Begebenheit fünfundzwanzig Jahre zuvor?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 315
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Kurzbeschreibung: Dalia Sonnenschein arbeit in den Büros der Topmanager Frankfurts – als Putzfrau. Eines Morgens findet sie die Leiche des Bankers Marcus Saitz und putzt in Panik einfach weiter, bis es keine Spuren mehr gibt. Aber Staatsanwältin Karen Stark glaubt sowieso nicht an einen Kriminalfall. Doch dann wird auch ihr Kollege Thomas Czernowitz tot aufgefunden. Eine Mordserie? Jedenfalls gehörten die beiden Toten einem Freundeskreis einflussreicher Frankfurter an. Mussten sie deshalb sterben? Oder wegen einer dramatischen Begebenheit fünfundzwanzig Jahre zuvor?
Anne Chaplet
Sauberer Abgang
Roman
Edel Elements
Edel Elements
Ein Verlag der Edel Germany GmbH
© 2021 Edel Germany GmbH Neumühlen 17, 22763 Hamburg
www.edel.com
Copyright © 2006 by Anne Chaplet
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Michael Meller Literary Agency.
Covergestaltung: Designomicon, München.
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-96215-385-4
www.instagram.com
www.facebook.com
www.edelelements.de
Inhalt
Meine Herren, Heute Sehen Sie Mich Gläser Abwaschen
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Aber Eines Abends Wird Ein Geschrei Sein am Hafen
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Meine Herren, Da Wird Ihr Lachen Aufhoren
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Und Wenn Dann Der Kopf Fällt, Sage Ich: Hoppla!
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Heav’n has no rage, like love to hatred turn’d, Nor Hell a fury, like a woman scorn’d.
WILLIAM CONGREVE 1670-1729
DIE SEERÄUBER-JENNY
Meine Herren, heute sehen Sie mich Gläser abwaschen
Und ich mache das Bett für jeden.
Und Sie geben mir einen Penny und ich bedanke mich schnell
Und Sie sehen meine Lumpen und dies lumpige Hotel
Und Sie wissen nicht, mit wem Sie reden.
Aber eines Abends wird ein Geschrei sein am Hafen
Und man fragt: Was ist das für ein Geschrei?
Und man wird mich lächeln seh’n bei meinen Gläsern
Und man fragt: Was lächelt die dabei?
Und ein Schiff mit acht Segeln
Und mit fünfzig Kanonen
Wird liegen am Kai.
Und es werden kommen hundert gen Mittag an Land
Und werden in den Schatten treten
Und fangen einen jeglichen aus jeglicher Tür
Und legen ihn in Ketten und bringen ihn mir
Und mich fragen: Welchen sollen wir töten?
Und an diesem Mittag wird es still sein am Hafen
Wenn man fragt, wer wohl sterben muß ...
Und da werden sie mich sagen hören: Alle!
Und wenn dann der Kopf fällt, sage ich: Hoppla!
Und das Schiff mit acht Segeln
Und mit fünfzig Kanonen
Wird entschwinden mit mir.
BERTOLT BRECHT, Die Dreigroschenoper
MEINE HERREN, HEUTE SEHEN SIE MICH GLÄSER ABWASCHEN
PROLOG
1981, im Winter
Sie sitzen da wie ein Häufchen Elend. Die Versager.
»Was ist, Alter?«
Leo hebt das Bierglas zum Mund, und alle sehen, daß seine Hände zittern. Der Held. Der große Mann. Unser Anführer.
»Hat alles geklappt?«
»Natürlich. Frag nicht so blöd.« Leo stellt das Glas neben den Bierfilz, fast wäre es umgefallen.
Er lügt. Und wie er lügt.
»Und morgen ...«
»Es gibt kein Morgen.« Leo bleich. »Das Projekt ist abgeblasen. Vergeßt es.«
Leo ohne Feuer in den Augen. Steht auf, schiebt den Stuhl zurück, stößt das Glas vom Tisch, geht.
Gestern ein Held. Heute ein Feigling.
Zum Kotzen.
1
Dalia Sonnenschein lag auf den Knien und sah zu, wie eine Träne auf das Parkett fiel und zerplatzte. Nicht weinen, verdammt. Sie wischte mit dem blauen Lappen über den winzigen feuchten Fleck, als ob sie nicht nur jeden Kratzer, sondern auch noch jedes Astloch wegpolieren könnte aus dem bernsteinbraunen Holz.
Nicht weinen.
Mutter hatte auch auf den Knien gelegen, damals, und gewischt und gewienert und geweint und gesagt: »Wir müssen diesmal ganz besonders gründlich sein, Schätzchen, hörst du?«
Alles sauber kriegen. Je-den-Fleck-weg-ma-chen. Über das Linoleum schrubben, bis es quietscht. Den Scheuerlappen in den Wassereimer stecken, auswringen, daß die dunkle Brühe rausläuft, schrubben reiben wischen. Und nicht daran denken, was auf dem Küchenboden liegt, direkt neben der Tür zum Flur. Was nach Schnaps stinkt und Kotze und Pisse und sich nicht rührt. Damals hatte Dalia nicht geweint, sondern der Mutter geholfen, so gut man kann, wenn man sieben Jahre alt ist.
Sie schob die Haarsträhne hinters Ohr, die sich aus dem strengen Pferdeschwanz gelöst hatte, den sie nur während der Arbeit trug. Die feuchten rosa Gummihandschuhe rochen nach Latex und Furol. Sie sehnte sich nach zu Hause, ihrem Bademantel und einem Tropfen Parfüm.
Nicht weinen. Das alles ist ewig lange her, und dies hier ist nicht die dunkle Wohnung in Dietzenbach, sondern das gut ausgeleuchtete Zimmer des Geschäftsführers des vornehmen Bankhauses Löwe. Und nichts erinnert an damals – bis auf eines.
Ein aufgedunsener Mond war dem sanft geröteten Morgenhimmel entstiegen und bleckte durch die Fensterfront. Dalia hatte ganze Arbeit geleistet, wie immer: die benutzten Gläser in die Teeküche gebracht, gespült und poliert, den gläsernen Schreibtisch gewienert, bis davon kein Fingerabdruck mehr zu gewinnen war, die Telefonanlage gesäubert und sogar die Computertastatur gereinigt. Sie hatte den Papierkorb ausgeleert und das Leder der Sitzgarnitur in der Besucherecke abgerieben. Sie hatte alles so gemacht, wie es sich gehört im Zimmer des Geschäftsführers.
Dalia stützte sich mit der linken Hand ab und stand auf. Die Knie taten weh. Sie mußte ewig lange auf dem Parkettboden gehockt und mit dem Oberflächentuch auf ihm herum-gewienert haben, völlig ohne Sinn und Verstand, wozu gab es für die Bodenreinigung den Mop?
»Das kriegt man nur von Hand weg«, hörte sie ihre Mutter flüstern. Ihr wurde schwindelig. Nichts hatten sie weggekriegt, obwohl sie die halbe Nacht auf den Knien verbracht hatten, die Mutter und sie. Ihn hatte man nicht wegwischen können, er lag da und stank und war auch tot nicht aus der Welt zu schaffen.
Sie blickte sich um. Alles sah aus wie immer. Bis auf ... Sie zwang sich dazu, sich umzudrehen und in die linke Ecke des Raumes zu sehen, dort, wo die Besuchersessel standen. Jetzt jedenfalls standen sie wieder; der eine hatte auf der Seite gelegen, als sie das Zimmer betrat. Sie blickte auf die Uhr. Um sechs Uhr hatte sie angefangen, jetzt war es fast sieben, was sollte sie sagen, wenn man sie fragte, was sie denn gemacht habe die ganze Zeit?
Ich hab’ mir die Leiche angeschaut?
Er mußte live gar nicht übel ausgesehen haben. Für sein Alter. Mit steifen Beinen ging sie hinüber und hockte sich neben den Toten. Saitz hieß der Mann. Sie runzelte die Stirn, während sie ihn betrachtete, das blasse Gesicht, das dünne Haar, die auffallende Designerbrille ein wenig verrutscht. Er trug einen roten Rollkragenpullover, nicht sehr trendy. Kein Jackett. Ihr Blick glitt tiefer. Ehering. Armbanduhr. Die rechte Hand zu einer halboffenen Faust geballt. Es steckte etwas zwischen Zeigefinger und Daumen. Sie stupste einen latexbehandschuhten Finger hinein und schrie leise auf, als ihn etwas Spitzes traf. Sie steckte den Finger in den Mund. Er schmeckte abscheulich, nach Gummi und Seifenlauge und dem Blutstropfen, der sich an der Handschuhspitze gebildet hatte.
Der Gegenstand war eine Art Amulett, geformt wie ein Davidstern in einem Kreis, allerdings mit einem Zacken weniger. Sie konnte sich keinen Reim darauf machen und steckte ihn in die Kitteltasche. Dann stand sie auf und streckte sich. Es half alles nichts. Es wurde Zeit.
Sie warf den Staubsauger an, ließ ihn kurz aufheulen und dann fallen. Sie stolperte gezielt über den Wassereimer, dessen Inhalt sich über das Parkett ergoß, reckte die Hände in den schweinchenfarbenen Gummihandschuhen, drückte mit den Ellbogen die Tür auf und fing an zu schreien. Schreiend lief sie aus dem Zimmer, schreiend über den Flur. Sie stieß die Tür zum Lichthof auf und blieb stehen, um Luft zu holen. Dann schrie sie wieder. Wie ein Echo kam der Aufschrei der anderen zurück. Gül stürmte aus dem gegenüberliegenden Flur, Marija kam aus der Herrentoilette, das rote Tuch und den Glasreiniger in der Hand. »Dalia! Was hast du?«
»Tot! Er ist tot!« schrie Dalia.
»Wer?« Die beiden Frauen drehten die Köpfe zur gleichen Zeit in dieselbe Richtung. Dalia lief weiter, auf den Aufzug zu.
»Was ist hier los?«Johanna Maurer, die Chefin von Pollux Facility Management, stellte sich ihr in den Weg, die Lippen schmal, die Augen dunkle Schlitze. Dalia hatte gar nicht mitgekriegt, daß heute Kontrolle war. »Wo wollen Sie hin? Was schreien Sie so?«
»Da!« Dalia wies mit dem ausgestreckten Arm hinter sich. »Da liegt einer!«
Johanna Maurer faßte Dalia fest um die Schulter und marschierte mit ihr zurück in den Flur, der zum Zimmer des Geschäftsführers vom Bankhaus Löwe führte.
Dalia schluchzte jetzt hysterisch. Sicher ist sicher – in Notsituationen empfahl es sich, auf minderbemittelt zu machen. Aber seltsamerweise erleichterte sie das Theater. Die Tränen liefen ganz von alleine.
Die Maurer stieß die angelehnte Tür zu Saitz’ Büro auf, betrat das Zimmer und blieb auf der Stelle stehen. »Aha«, hörte Dalia sie sagen. »Und der ist tot?«
»Mausetot.« Dalia hätte diesen lieblosen Kommentar gerne zurückgenommen, als sie Johanna Maurers Blick bemerkte. Die Chefin guckte sie schräg von der Seite an und lächelte. Belustigt. Spöttisch. Und ein bißchen – hämisch.
Dann nahm sie Dalia wieder beim Ellenbogen und marschierte aus dem Zimmer, durch den Gang, in den Lichthof, wo die anderen warteten. »Alles mitkommen«, schnauzte die Maurer. Wie eine Schar koreanischer Touristen stolperten sie der Chefin hinterher die Treppe hinunter, zum Empfang.
»Seien Sie so gut, Milan, und rufen Sie die Polizei.«
Milan griff erschrocken zum Telefon und wählte. »Ob er was?« Er horchte, hielt dann die Hand über den Hörer und sah die Maurer an. »Ob ein Fremdverschulden vorliegt, fragen die.«
»Woher soll ich das wissen? Die sollen wen schicken«, sagte Johanna Maurer und ließ sich auf die Couch der Besuchersitzgruppe sinken, während die anderen um sie herum-standen.
»Ob wir die Polizei brauchen oder einen Notarzt?«
»Egal. Sollen schicken, wen sie haben«, antwortete die Maurer großzügig.
Zwanzig Minuten später stürmte ein junger Kerl mit zerzausten Haaren in Jeans und Lederjacke durch die Eingangstür. Er knallte zur Begrüßung seine Aktentasche auf die Empfangstheke und sagte zu Milan: »Ich habe die ganze Nacht Betrunkene und Drogenabhängige zusammengeflickt, eben reicht’s mir!« Milan zuckte mit den Schultern und deutete auf Johanna Maurer, die schon aufgestanden war und den Notarzt bittersüß anlächelte. »Siggi Leitner«, sagte der Zerzauste, lächelte gequält zurück und folgte Johanna Maurer in den ersten Stock. Nach zehn Minuten waren beide wieder unten.
»Keine Ahnung, woran der Mann gestorben ist. Also kann ich auch keinen natürlichen Tod bescheinigen.« Der Notarzt legte ein bekritzeltes Formular auf die Empfangstheke. »Rufen Sie die Polizei! Die faulen Säcke können ruhig auch mal was tun.«
Wieder hieß es warten. Es ging Dalia auf die Nerven, in der Lobby herumzustehen und den anderen Frauen beim Lamentieren zuzuhören, als ob es einen engen Angehörigen getroffen hätte. Endlich rückte die Polizei an. Ein breitschultriger blonder Stoppelkopf und eine ziemlich hübsche Frau in Grün gingen nach oben, kamen ebenfalls ziemlich schnell wieder herunter und nahmen die Personalien der Anwesenden auf.
Marija stellte sich an, als ob die beiden sie ausweisen wollten, Gül verstummte völlig,Johanna Maurer mußte einspringen.
Dabei schienen die beiden Polizisten nur an Dalia ernsthaftes Interesse zu haben. Es passierte wahrscheinlich selten, daß rund um eine Leiche herum so gründlich geputzt worden war. Dalia beschloß, einfach weiterzuweinen, was ihr überhaupt nicht schwerfiel, wenn auch aus anderen Gründen als denen, über die sie sich vor den Bullen ausbeulte: Sie hatte einen schweren Beruf. Mußte dauernd an ihre kranke Mutter denken. Kam mit dem Geld nicht zurecht. Guckte nicht richtig hin, sah immer nur das Stückchen Leben, das sie gerade putzte und wienerte. Du winselst, dachte sie irgendwann mit Befriedigung. Sie kriegen gleich Mitleid, die Bullen, und dann verlieren sie das Interesse.
»Ich will nach Hause«, sagte sie schließlich. Niemand hatte etwas dagegen.
An der frischen Luft wurde ihr schwindelig. Sie hielt sich an der Kühlerhaube eines betagten Mercedes fest und wartete, bis sich die Horrorshow in ihrem Kopf legte.
Nicht an damals denken. Nicht an Mutter denken und den stinkenden Toten. Der Mann, der neben dem umgestürzten Sessel gelegen hatte, war offenbar ganz friedlich gestorben. Sie konnte nichts dafür. Niemand konnte etwas dafür.
2
Karen Stark blinzelte hinüber zum Nachttisch, auf dem der Wecker stand. Sie war viel zu früh aufgewacht. Von einem ungewohnten Laut – einem Geräusch, das klang, als ob ein Igel durch trockenes Laub stöberte. Sie hielt den Kopf in den Luftzug, der durch die halb offenstehende Balkontür zu ihr herüberwehte, und horchte hinaus. Es raschelte wieder.
Sie schwang die Beine aus dem Bett und tastete mit den Zehen nach den Hausschuhen. Igel oder Einbrecher – beides war im vierten Stock einer Altbauwohnung im Frankfurter Westend gleichermaßen unwahrscheinlich. Der Gedanke an einen terroristischen Angriff durchzuckte sie – Attacke auf Karen Stark, die Speerspitze der Frankfurter Staatsanwaltschaft! Sie hätte fast aufgelacht. Trotzdem versuchte sie, möglichst geräuschlos aufzustehen.
Wieder raschelte es, dann fiel etwas um auf dem Balkon. Wahrscheinlich der Topf mit dem vertrockneten Weihnachtsstern, sie hätte längst mal aufräumen müssen da draußen. Schon weil es Frühling wurde und die Tauben bald brüten würden. War es vielleicht schon soweit? Im vergangenen Jahr hatten die Viecher einen Monat lang jeden Tag ein Nest in den Rosenkübel zu setzen versucht – und jeden Abend hatte sie das Gebilde aus Gras, Zeitungspapier und Resten von Plastiktüten mitsamt den frischgelegten Eiern wieder weggeräumt, bis die Nervensägen endlich aufgaben. Sie mochte keine Tauben.
Jetzt stand sie hinter der Balkontür und spähte hinaus. Ein rotes Tier mit spitzen, gefiederten Öhrchen und einem buschigen Schwanz saß auf dem Geländer und hielt etwas in der Ffote, man sah die Zehen mit den kleinen Krallen. Sein Gefährte war schwarz und nicht weniger hübsch und turnte auf der Lehne des Gartenstuhls. Jetzt sprang das rote A-Hörnchen hinüber zum schwarzen B-Hörnchen, die beiden balgten sich, bis A-Hörnchen quiekte und mit einem Satz auf das Balkongeländer sprang – und dann hinunter.
Karen hielt die Luft an. Sind Großstadteichhörnchen selbstmordgefährdet? B-Hörnchen sprang hinterher. Sie schob die Tür auf, ging hinaus auf den Balkon und blickte über die Brüstung in die Tiefe. An der Hauswand rankte sich die Glyzinie hoch, eine mächtige Kletterpflanze aus der Frühzeit des Hauses, die es in diesem Sommer wahrscheinlich ganz hinauf bis zum vierten Stock und auf ihren Balkon schaffen würde. Die beiden Kerle huschten in atemberaubendem Tempo die Schlingpflanze hinab.
Erdnüsse kaufen, dachte sie. Es mußte hübsch sein, morgens von fröhlichen Nußknackgeräuschen geweckt zu werden. Ob man den Tieren beibringen konnte, samstags und sonntags etwas später zu frühstücken?
Der blasse Himmel kriegte Farbe. Karen tappte ins Schlafzimmer zurück und schloß die Balkontür. Eine Kanne Tee, die Zeitung, und zurück ins Bett. Genau das, was einen frühen Morgen schön macht.
Sie fuhr sich mit beiden Händen durch die roten Haare und schlüpfte in den Morgenmantel. Wenn sie Glück hatte ... Sie öffnete die Wohnungstür. Da lag sie, die Zeitung.Jens aus der Dachgeschoßwohnung war noch in einem Alter, in dem man vor drei Uhr früh nicht nach Hause und ins Bett geht – und schon erwachsen genug, seiner Nachbarin aus lauter Freundlichkeit die Zeitung aus dem Briefkasten zu fischen und vor die Wohnungstür zu legen. Oder aus Rücksicht auf ihr hohes Alter? Egal – Karen schickte einen Luftkuß nach oben.
Während der Tee zog, überflog sie die Schlagzeilen. An einer Meldung ganz unten blieb ihr Blick hängen. »Ermittlungspannen im Fall Silvi«. Sie setzte sich auf den Küchenstuhl. Der Himmel draußen vor dem Fenster begann sich zu röten, aber der Tag hatte einiges von seinem Charme verloren.
Jeder Ermittlungserfolg hatte seine Kehrseite. Aber das interessierte das Publikum nicht. Seit ein paar spektakulären Fahndungserfolgen – man hatte aus Genspuren am Mordopfer die Täter ermitteln können – kursierten in der Öffentlichkeit völlig überzogene Erwartungen an die DNS-Spurenlese.
Als die Eieruhr schrillte, goß sie den Tee ab und nahm Kanne, Tasse und Zeitung hinüber ins Arbeitszimmer. Die Lust auf einen ruhigen Tagesbeginn im Bett war ihr vergangen.
Sie fuhr den PC hoch, fläzte sich in den Schreibtischsessel, legte die nackten Beine auf die Tischplatte und schlug die Zeitung auf. Die Eltern von Silvi, dem zweiten Mordopfer des geständigen Heiko H., ließen Trauer und hilflose Wut über den Tod ihres Kindes an allen aus, die sie für »zuständig« hielten – und manche Journalisten machten daraus ihr eigenes Schlachtfest. Niels Keller, der Autor des Beitrags, war ihr bekannt. Er war bei Pressekonferenzen der eifrigste und der eiferndste der Journaille. Er war, kurz gesagt, eine Pest.
»Ist Silvi gestorben, weil wir die Falschen schützen? Hat übertriebener Datenschutz dazu geführt, daß der Täter nicht schon nach dem grausamen Mord an dem kleinen Sven gefunden wurde?«
Karen nahm einen tiefen Schluck aus der Teetasse. Sie hatte das alles so oft schon richtigzustellen versucht. Aber die meisten Menschen ignorierten, was ihr Weltbild nicht vorsah. Dabei war die Sache ganz einfach: Der DNS-Vergleich funktioniert nur, wenn es auch etwas zu vergleichen gibt. An Sven, dessen kleiner Leichnam wochenlang in einem Birkenwäldchen gelegen hatte, bis ein Hund ihn aufstöberte, waren keine brauchbaren Genspuren festgestellt worden.
Karen griff zur Maus, rief ihre Mails ab und löschte alle, die ihr Viagra, Pornos oder Penisverlängerungen verkaufen wollten. Wenigstens gab es zwei E-Mails von Gunter. »Ich langweile mich zu Tode. Wo bist du?« und »Ich fliege Donnerstagabend. Essen im Suvadee?« Sie seufzte und löschte beide. Sie hatte sich schon zu oft vergebens auf ihn gefreut.
Karen legte den Kopf in den Nacken und starrte an die Decke. Es ärgerte sie mehr, als ihr lieb war, daß die Journaille immer nur die schlagzeilenträchtigen Fälle ausschlachtete. Bei toten Kindern rasteten alle aus; dabei gehörten diese Fälle, so bodenlos schlimm sie waren, zu den eher seltenen Verbrechen. Andere, weit häufigere Dramen aber interessierten die empörungsbereite Öffentlichkeit einen feuchten Kehricht. Zum Beispiel Frauenhandel. Nicht Zwangsprostitution, nein! Darüber berichtete man gern, Sex & Crime verkauften sich immer. Sondern eine viel weniger spektakuläre Sorte von moderner Sklaverei, mit der sie sich seit Wochen beschäftigte: Professionelle Menschenschlepper lockten Frauen aus der Ukraine oder aus Lettland und Litauen mit Versprechen von Reichtum und Freiheit nach Deutschland und schickten sie für einen Hungerlohn in Frankfurter Hotels putzen. Der Trick: Man meldete die Frauen als »selbständige Gewerbetreibende« an, was den unschätzbaren Vorzug besaß, daß für sie weder Sozialabgaben noch Steuern anfielen. Die Frauen, die kaum Deutsch sprachen und offenbar in vielen Fällen von ihren Schleppern sexuell genötigt oder mit Rauschgift abhängig gemacht worden waren, hatten für r 3 bis r 5 Stunden Arbeit am Tag nicht mehr als 700 Euro Lohn im Monat erhalten. Und davon wurden ihnen auch noch 200 Euro abgezogen, für miese Verpflegung und für eine Koje in schlecht geheizten Bruchbuden, wo sie zu sechst in einem Zimmer hausten. Deutsche Behörden hatten bei dem üblen Spiel mitgespielt: Ein Gewerbeamt hatte mehreren Frauen aus Litauen am selben Tag einen Gewerbeschein für »Reinigungsarbeit nach Hausfrauenart« ausgestellt, ohne Verdacht zu schöpfen oder Alarm zu schlagen. Das war ein behördlich geduldeter Skandal, nichts anderes, ganz zu schweigen vom volkswirtschaftlichen Schaden, der dadurch entstand. Und es verdarb ihr ebenso die Laune wie das ewige Warten auf Gunter.
Oder war sie ungerecht? Sie richtete sich auf, griff nach ihrem Mobiltelefon und schickte ihm eine SMS. »Gerne, chéri. Reservierst Du einen Tisch?«
Der Tee war kalt geworden. Karen durchblätterte lustlos den Lokalteil der Zeitung und schlug dann das Feuilleton auf. Die Besprechung der Theaterpremiere gestern lud nicht dazu ein, den Eigenversuch des Kritikers zu wiederholen. Schließlich raffte sie sich auf und ging ins Bad. Beim Zähneputzen erinnerte sie sich daran, daß sie Erdnüsse kaufen wollte. Und irgend etwas Blühendes für den Balkon. Und daß sie mal versuchen sollte, sich auf Gunter zu freuen.
3
Der markerschütternde Schrei erwischte ihn unvorbereitet, obwohl er damit hätte rechnen müssen. Will Bastian verdrehte die Augen. Über ihm ging ein Maschinengewehrgewitter dumpfer Einschläge los.
Dann nichts. Stille, sekundenlang.
Ein rhythmisches Geräusch, das langsam schneller wurde, ein lauter Schlag. Quietschendes Gelächter.
»Tor! Tor! Tor!« Ein Fernseher. Ein Radio? Egal – volle Pulle. Kurz vor der Schmerzgrenze etwas leiser. Dann wieder laut.
Er versuchte, ruhig weiterzuatmen. Maximilian und Julian waren aus der Schule zurück. Und – Überraschung! Sie hatten ihre Freunde mitgebracht.
Der Vormittag hatte in sahniger Stille begonnen; er hatte schon gar nicht mehr an die kleinen Pestilenzen gedacht in der Wohnung über ihm. Aber jetzt versetzte sich sein Körper wieder in den Zustand äußerster Wachsamkeit, Puls und Atmung beschleunigten: Er wappnete sich gegen die nächste Lärmattacke. Streß, dachte Will mit einem Anflug von Wehleidigkeit. Begünstigt Herzkrankheiten und frühen Tod.
Er ließ sich in den Sessel fallen, streckte die Beine von sich und ergab sich der nächsten Lärmwelle.Jemand schien direkt über seinem Kopf immer wieder hochzuspringen. Zwei balgten sich, »Du Arsch!« ächzte der eine, »Du Waschlappen!« der andere. Fast gewann er Spaß am munteren Treiben ein Stockwerk über ihm, schließlich war es das letzte Mal, daß er dessen Zeuge war. Ab morgen ging ihn das alles nichts mehr an. Und das wog sogar die Trennung von Vera auf.
Der Gedanke ernüchterte ihn. Er betrachtete das magere Häuflein Bücher, an denen ihm etwas lag, stand auf und räumte eines davon wieder zurück ins Regal. Die anderen packte er in eine Klappkiste und stellte sie vor die Tür seines Arbeitszimmers. Seines ab morgen ehemaligen Arbeitszimmers.
Oben quietschte es rhythmisch, bevor etwas so heftig auf den Boden bumste, daß die Fensterscheibe klirrte. Er blickte zur Zimmerdecke, erwartete, wie so häufig und immer vergebens, abgebröckelten Putz oder gar ein Loch zu sehen. Er war nicht oft oben gewesen, in der Wohnung der Familie Wagner, aber er glaubte sich zu erinnern, daß dem Fernseher gegenüber ein Bettsofa stand. Wahrscheinlich benutzte einer der Jungs es als Trampolin, bevor er hinuntersprang.
Zu Anfang hatte er noch protestiert. Einmal übrigens zu Unrecht, da war es die Party im Stockwerk unter seiner Wohnung gewesen, die ihn beim Arbeiten gestört hatte. Dennoch war er zu den Wagners hochgelaufen, um eine Einstellung der Kampfhandlungen zu erbitten. Er erinnerte sich lebhaft an die Gesichter der beiden Jungs, wie sie brav nebeneinander auf dem Sofa saßen, jeder einen Joystick auf dem Schoß. Mit großen Kinderaugen hatten sie anklagend zu ihm aufgesehen, zu diesem Kinderfeind, der ihnen ihre harmlosen Vergnügen nehmen wollte, vor allem jenes, jeden Tag direkt über seinem Schreibtisch mit drei anderen, ebenfalls vom Zappelphilipp-Syndrom befallenen Freunden möglichst geräuschvoll fernzusehen.
Mutter Wagner zeigte naturgemäß nicht das geringste Verständnis für seine Nöte, die im Sommer begonnen hatten, als er, vom Urlaub mit Vera zurückgekehrt, seinen ehemals so ruhigen Arbeitsplatz in ein Inferno verwandelt fand.
Auch Vera hatte das anders gesehen. »Ja wenn du Totenstille brauchst zum Arbeiten ...«
Totenstille? Er hatte auch die Jahre zuvor jedes Husten und Schnarchen gehört und jeden Anflug eines Ehestreits zwischen Thommy und Doro, den Vorgängern der Familie Wagner. Aber wenigstens waren die beiden rechtzeitig ausgezogen und hatten sich ihr familienfreundliches Reihenhäuschen gesucht, bevor die ersten Babyschreie ertönten. Das nannte man Rücksichtnahme.
Will ging hinüber ins Wohnzimmer, stellte sich vor die gemeinsame CD-Sammlung und überlegte, auf welche Scheibe er unter keinen Umständen verzichten wollte. Es gab nicht viele davon. Alles war eingetrübt durch die sechs Jahre mit Vera: Queen, »We will rock you« – das hatte er immer aufgelegt, wenn er dem Krach von oben etwas entgegensetzen wollte. Andrea Bocelli – um Himmels willen, das war nicht sein Ding, sondern Veras, aber sie hatten immer so traumhaft schön gevögelt dabei. Tom Waits – ja, das schon eher. Das war Musik, die Vera nicht mochte. Er zog die CD aus dem Regal und legte sie neben »Queen« in die Bücherkiste.
Und plötzlich war alles ganz einfach. Heute morgen noch hatte er Bilanz gezogen, hatte Vera in Gedanken vorgerechnet, was er vor sechs Jahren in ihren gemeinsamen Haushalt eingebracht hatte und worauf er deshalb einen knüppelharten Anspruch besaß. Und jetzt hätte er ihr am liebsten alles dagelassen, all den Ballast, der sich in einem Menschenleben so ansammelt. Nur der Schreibtischsessel mußte mit. Und, blöderweise, die Steuerunterlagen.
Jetzt hörte er schwere Schritte über sich. Annette Wagner hatte ihren mächtigen Körper in Bewegung gesetzt und ging durch den Flur hinüber ins Zimmer ihrer Sprößlinge. Er hörte sie keifen.
Sie wußte noch nichts von ihrem Glück: ab heute Rücksichtnahme nicht mehr nötig! Noch glaubte sie offenbar, Max und Julian alle zwei Stunden anbrüllen zu müssen, um sich nicht nachsagen zu lassen, sie sorge nicht für Zucht und Ordnung. Will schüttelte sich beim Gedanken an ihr flaches Gesicht und an ihre kleinen dicken Hände. Sie wollte einfach nicht begreifen, daß er nicht kinderfeindlich war, sondern daß sie und er gemeinsam an etwas Drittem litten: an der schlechten Bausubstanz, Annette, kapier das doch endlich!
Das Wohnhaus stammte aus den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts und hatte im Zweiten Weltkrieg eine Brandbombe abgekriegt. Die beiden obersten Stockwerke waren nach dem Krieg auf billigste Weise und mit geringerer Dekkenhöhe wiederaufgebaut worden – das Problem, das daraus folgte, war weit verbreitet und hieß Hellhörigkeit. Man hörte nicht nur jedes Wort von oben, sondern auch von unten. »Ich kann dir alle deine Telefongespräche nacherzählen«, hatte Annette gezischt. Eben! Aber Annette brachte, wie die meisten Frauen, Ursache und Wirkung durcheinander.
Wie Vera. »Erzähl mir bloß wieder, daß du kein Kinderfeind bist!« hatte sie eines Tages gesagt, als sie später als üblich aus dem Büro zurückkam und er sich bei ihr beklagte über den verdorbenen Arbeitstag. Es war in der Adventszeit gewesen, Annette hatte seit dem frühen Morgen direkt über seinem Kopf Weihnachtsmusik abgedudelt, während er an einem gefühlvollen Artikel über einen während der Nazizeit verfemten Frankfurter Architekten saß. Stille Nacht und Schneeflöckchen bis zum Abwinken. Es war grausam gewesen. Und dann kam Vera auch noch mit dem Superüberbeziehungskonflikt, von dem er gehofft hatte, er hätte sich durch Beschweigen von selbst erledigt.
Will stellte die DVD-Kassette mit »Der Herr der Ringe« wieder zurück ins Regal. Über ihm klatschte die Wagner-Brut rhythmisch in die Hände und rief etwas. Hörte sich glatt an wie »Raus raus raus aus diesem Haus«. Kinder an die Macht, dachte Will. Eine blödere Parole hatte er noch nie gehört.
Wenn er wenigstens noch festangestellt wäre. Die liebe Annette hatte den Finger gleich in die richtige Wunde gelegt: »Warum mußt du überhaupt zu Hause arbeiten? Andere Leute gehen tags doch auch ins Büro!« Na klar. Das hatte er ja getan, jahrelang. Es sei denn, es gab einen Text zu schreiben, für den man ein bißchen häusliche Ruhe brauchte. Aber mittlerweile war seine Zeitung von einem Organ der Meinungsführerschaft zu einer Art Sozialprojekt zurückgeschrumpft, in dem alle gemeinsam weniger arbeiteten und verdienten, in der Hoffnung, das würde die Geschäftsleitung von Kündigungen abhalten. Hatte es natürlich nicht. Ihm mußte man nicht groß nahelegen, was er längst ahnte. Bevor er an die Reihe gekommen wäre, ging er freiwillig.
»Aber du hättest doch Arbeitslosengeld gekriegt!« Vera wollte nicht verstehen, daß er genau das vermeiden wollte. Er war ja nicht arbeitslos. Er hatte nur – na ja: den Aggregatzustand geändert. Nannte sich eben freier Journalist jetzt, ganz einfach.
Das schlimmste war Annettes Lächeln, als er ihr mitteilte, er würde jetzt noch öfter als früher zu Hause arbeiten. Genauer gesagt: jeden Tag. Auch am Wochenende. In ihren Augen las er Verachtung für den Versager, der seine Frau arbeiten schickte und die Kinder anderer Leute terrorisierte-die Kinder, die später für seine Rente aufzukommen hatten!-sagte Annette und schürzte vorwurfsvoll die Lippen.
»Woher weißt du das?« hatte er zurückgefragt. »Kinder, die so oft fernsehen, kriegen später Sozialhilfe, für die wir zu zahlen haben.«
Sie hatte noch spitzer gelächelt, und dann ganz leise »Wo-von denn?« gesagt.
Gute Frage. Vera sah das offenbar ähnlich, jedenfalls behandelte sie ihn so, als ob er zu Hause säße, nichts Vernünftiges zu tun habe und nur darauf warte, daß sie ihm kleine Aufträge gab: Hol doch mal für mich die Bluse aus der Reinigung. Kannst du heute einkaufen? Was kochst du morgen? Er nahm Päckchen entgegen, er beantwortete Anrufe schöner als jeder Automat. Er putzte, er kochte, er machte den Hausmann. Und dann schnappte die Falle zu. »Wo du doch eh zu Hause bist, könnten wir da nicht auch ...«
Will ging hinüber in die Küche. Über ihm lachte es schrill. Die Wagner hatte Freundinnen zu Besuch, das erklärte das massenhafte Auftreten der Kids. Kaffeeklatsch mit viel Kuchen. »Aber bitte mit Sahne.« Und dann wunderte sie sich, daß ihre beiden Jungs schon jetzt so übergewichtig waren wie die Mutter. Die Damen oben lachten wieder, sehr entspannt. So ein Kaffeeklatsch konnte dauern, die Kinder waren ja vorm Fernseher geparkt. »Video killed the radio star«, dachte er und fühlte sich plötzlich steinalt.
Die Küche war sein Revier gewesen. Er hatte für scharfe Messer gesorgt, für die richtigen Öle und den besten Essig. In der neuen Wohnung würde er sich wahrscheinlich aufs Warmmachen von Seniorengerichten beschränken, den Alten wie ein Kind schon nachmittags vorm Fernseher ruhigstellen und abends zum nächstbesten Italiener gehen. Wozu also noch scharfe Messer und handgeschmiedete Eisenpfannen?
Nur den Korkenzieher, einen teuren Screwpull, würde er mitnehmen. Und die Dekantierkaraffe. Ihr lag nichts dran. Vera hatte irgendwann begonnen, das Weintrinken einzuschränken und schließlich einzustellen. Es schmecke ihr nicht besonders gut, hatte sie mit leiser, etwas wehleidiger Stimme gesagt, vor allem nicht die Weine, die er »anspruchsvoll« nannte, und außerdem mache der Alkohol womöglich unfruchtbar. Von der Theorie hatte er noch nie gehört, aber ihren Blick konnte er lesen.
Es ging seit einiger Zeit immer nur um das eine. Um das, was sie ihre »biologische Uhr« nannte, die sie angeblich »ticken« hörte. Sie wollte ein Kind. Sie wollte Kinder. Von ihm, und zwar bald. Und weil er ja nun eh zu Hause war und nichts auf einen beruflichen Höhenflug deutete, hielt sie die Zeit für reif.
Will hatte sich wie der Fuchs im Fangeisen gefühlt. Denn er hatte ihr nichts entgegenzusetzen – jedenfalls nichts, was sie verstanden hätte.
Ganz zu Anfang ihrer Beziehung hatte er mit der Lage der Welt argumentiert, die es unverantwortlich mache, ein Kind in dieselbe zu setzen, hatte auf den Krieg in Jugoslawien verwiesen, auf die Klimakatastrophe, die Staatsverschuldung. Eine Zeitlang hatte er an seine Argumente sogar geglaubt. Sie hatte irgendwann nur noch gelacht. »Und das sagst du? Der du regelmäßig gegen die Alarmisten wetterst, die alle naselang den Weltuntergang ausrufen?«
Will wickelte den Screwpull in die Zeitung von heute und legte ihn in die Bücherkiste im Flur. Er zögerte, bevor er ins Schlafzimmer ging. Es roch nach ihrem Parfum – Serge Lutens, die letzte Flasche hatte er ihr geschenkt. Das Bett war nicht gemacht, und ihr Rock und die Strumpfhosen lagen noch da, wo sie sie gestern fallen gelassen hatte. Er setzte sich auf die Bettkante und legte das Gesicht in die geöffneten Hände. Sie hatten sich mit einer Sehnsucht geliebt, daß er beim bloßen Gedanken daran weiche Knie kriegte. »Das war doch immer gut gewesen zwischen uns«, hatte sie danach geflüstert und den Kopf auf seine Brust gelegt. Und dann kamen die Tränen, leise, verzweifelt, ohne all die Wut, die er sonst von ihr kannte.
Er hätte es ihr so gerne erklärt. Er versuchte es ihr seit Jahren zu erklären, jedenfalls in Gedanken. Die Erklärung fing immer mit »Versuch mich zu verstehen, Vera« an. Versteh mich doch. Ich würde gerne bei dir bleiben. Ich drücke mich nicht vor der Verantwortung. Ich würde auch für zwei, ach was: für drei arbeiten, wenn man mich ließe. Ich will, daß du glücklich bist. Und ich habe auch nichts gegen Kinder. Höchstens – gegen die da oben über meinem Kopf.
Und gegen welche, die von mir stammen.
Will stand auf und räumte Hemden und T-Shirts aus der Kommode. Vera, hör mir zu. Der Gedanke an ein Kind, das mir gleicht, ist mir unerträglich. Ein Kind, das so unglücklich ist, wie ich es war. Gepeinigt von Albträumen und Urängsten. Geplagt von viel zu langen Gliedmaßen und abstehenden Ohren.
Höre, Vera. Und wenn ich ein Vater würde wie der, der mein Vater war? Ein autoritärer Sack, der nie zu Hause ist? Was täte das deinem Kind?
»Du wärst der liebevollste Vater der Welt«, hatte sie einmal gesagt. Vielleicht. Aber konnte man sich darauf verlassen? Die Wahrheit war – er wollte keine Selbstverewigung. Er wollte nichts weitergeben, nichts vererben.
Irgendwann war sie gestern ins Bad gegangen. Als sie wiederkam, setzte sie sich auf die Bettkante und sah ihn an, mit einem dieser tiefen Blicke, die ihn unruhig machten.
»Laß dich sterilisieren«, sagte sie schließlich. »Damit ich dir nicht in zehn Jahren begegne, mit jugendfrischer Freundin und Baby auf dem Arm.«
Sie stand auf und drehte ihm den Rücken zu. »Wenn ich alt und vertrocknet bin«, sagte sie.
Der Himmel war grau geworden, während er sein Auto bepackt und Abschied von Backenheim genommen hatte. Auf der Bockenheimer Landstraße staute sich der Verkehr, wie immer um diese Zeit. Dort, wo das erste richtige Hochhaus Frankfurts gestanden hatte, das Zürichhochhaus, gähnte noch Jahre nach dem Abriß eine Lücke, von Bauzäunen umstellt. Lieber das als ein einfallsloser Zweckbau, dachte Will. Frankfurt hatte Besseres verdient – und Schöneres als einen weiteren der vielen Architektenträume von Leuten, die sich unter einer Stadt nur Standort vorstellen konnten.
Er fuhr den Reuterweg hoch, bog in den Grüneburgweg ein und passierte die Körnerwiese. Dann stellte er das Auto in die Einfahrt des stilvoll gealterten Altbaus, Frankfurter Jahrhundertwende. Die Wohnung seines Vaters lag im vierten Stock. Schon in der dritten Etage machte sich die fehlende Kondition bemerkbar. Du wirst alt, dachte Will, stemmte die Bücherkiste die restlichen Stufen hoch und ließ sie vor der Wohnungstür fallen. Auf der Klingel stand »Marga und Karl Bastian«. Drinnen heulte etwas, es hörte sich an wie eine Motorsäge im Leerlauf. Und dazu erklang das, was man im Radio unter klassischen Hits verstand. Wieder einmal hatte Albinonis Adagio herhalten müssen. Will seufzte. Dann schloß er auf.
Karl Bastian trug eine ausgebeulte blaue Trainingshose, in deren Bund er ein Geschirrtuch geklemmt hatte, darüber ein weißes T-Shirt. Sein Vater hatte das Radio voll aufgedreht und sang mit, während er einen asthmatisch röhrenden Staubsauger über das Parkett im Flur schob. Kurz winkte er Will zu und zog mit dem antiken Gerät weiter ins Wohnzimmer.
Ein Job weniger, den ich zu übernehmen habe, dachte Will unfromm, aber eigentlich war er gerührt. Der Alte gab sich wirklich Mühe. Er trug die Kiste in das Zimmer, in dem er ab heute wohnen und arbeiten würde. In der Tür blieb er stehen. Das Zimmer wirkte hell und klar und leer, Bettsofa und Schreibtisch fielen kaum auf in dem großen Raum. Will atmete tief ein und schwor allen weiteren weltlichen Gütern ab. Dann stellte er die Kiste ab und lief die Treppenstufen wieder hinunter, um Koffer, Kleidersack und Schreibtischstuhl aus dem Auto zu holen. Auf ein neues, karges Leben. Ein Männerleben.
Will Bastian, noch nicht 48 Jahre alt, kehrt nach der Trennung von seiner Freundin zwar nicht zurück zu Mama, aber zu Papa, 82. Der ihn Willi nannte, was er haßte. Und mit dem er sich seit Jahren nichts zu sagen hatte.
Er hatte noch niemandem von seinem Entschluß erzählt, aber er wußte, was die Kumpels sagen würden. »Du tust was?« Max Winter würde sich kaputtlachen. »Die Versöh-nung der Generationen! Wie human!« könnteJulius Wechsler sagen, wenn er überhaupt etwas sagte.
Seine Antwort hatte er sich längst zurechtgelegt. »Mein Vater kommt nicht mehr alleine klar, und die Wohnung ist groß genug.«
Er mußte ja niemandem auf die Nase binden, daß Karl Bastian sich bester Gesundheit erfreute und er nur-wie sagt man? – perspektivisch das Nützliche mit dem Humanen verband. Immerhin sparte er schon jetzt an der Miete und war der erste Kandidat aufs Pflegegeld, wenn der Alte wirklich klapprig wurde, was nur eine Frage der Zeit war.
Max Winter kannte solche Probleme nicht. Max betrieb eines der besten Restaurants der Stadt. Und Julius Wechsler? Der Dicke hatte weder finanzielle Sorgen noch alte Eltern – und schon gar nicht so etwas wie ein Gemüt. Heute abend würde er es ihnen sagen müssen. Der Gedanke daran war nicht unbedingt angenehm.
»Alles klar, Willi?« Sein Vater steckte den Kopf zur Tür herein. »Bist du zum Abendbrot da? Ich habe eingekauft. Auch einen Begrüßungssekt.«
»Danke, Vater. Aber heute abend habe ich einen Termin.«
Der Alte hob die Schultern und verzog sich wieder. Wenigstens stellte er das Radio leiser.
Es geht schon los, dachte Will. Der Familienanschluß. Die alten Rituale. Das alte schlechte Gewissen.
»Sehen wir uns beim Frühstück?« Da war er wieder. »Ich hole Brötchen.«
Will nickte und lächelte und kam sich wie ein undankbares Kind vor.
4
Wotan wartete wie immer hinter der Tür, als sie den Schlüssel im Schloß umgedreht und sie aufgeschoben hatte. Dalia kniete sich vor ihn hin und drückte ihr Gesicht in sein weißes Fell. Er versuchte, ihre Nasenspitze zu küssen, als er merkte, daß sie weinte. Irgendwie konnte sie damit heute nicht mehr aufhören.
»Wir werden weiterziehen müssen, Kleiner«, flüsterte sie und stand auf. Er sprang voraus in die Küche und stellte sich erwartungsvoll an den Freßnapf. Sie gab ihm den Rest aus der gestern abend geöffneten Dose, sah ihm eine Weile beim Fressen zu und schaltete die Kaffeemaschine ein. Während der Kaffee durchlief, ging sie zum Schreibtisch, der unter dem Fenster stand, gleich gegenüber der Schlafcouch.