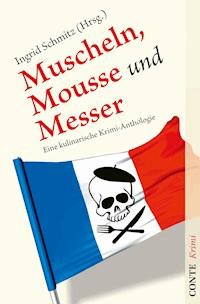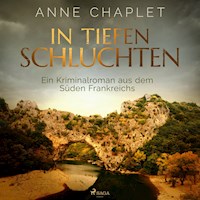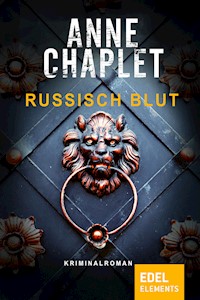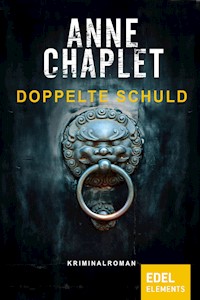4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Krimi
- Serie: Stark & Bremer
- Sprache: Deutsch
In Frankfurt hat eine Buchhändlerin Selbstmord begangen, und in Südfrankreich taucht kurz danach die Leiche einer Fotografin auf. Neben beiden Toten werden antiquarische Waffen gefunden, die aus demselben Raubzug stammen. Das ist ein Fall für Karen Stark, Staatsanwältin in Frankfurt. Aber ihre eigene Behörde schickt sie in Zwangsurlaub. Und der Verdacht erhärtet sich, dass die Lösung der beiden Fälle gezielt verhindert wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 381
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Über das Buch:
In Frankfurt hat eine Buchhändlerin Selbstmord begangen, und in Südfrankreich taucht kurz danach die Leiche einer Fotografin auf. Neben beiden Toten werden antiquarische Waffen gefunden, die aus demselben Raubzug stammen. Das ist ein Fall für Karen Stark, Staatsanwältin in Frankfurt. Aber ihre eigene Behörde schickt sie in Zwangsurlaub. Und der Verdacht erhärtet sich, dass die Lösung der beiden Fälle gezielt verhindert wird.
Anne Chaplet
Die Fotografin
Der vierte Fall für Stark & Bremer
Edel Elements
Edel Elements Ein Verlag der Edel Germany GmbH
© 2016 Edel Germany GmbH Neumühlen 17, 22763 Hamburg
www.edel.com
Copyright © 2002 by Anne Chaplet
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Michael Meller Literary Agency GmbH, München.
Covergestaltung: Anke Koopmann, Designomicon
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-95530-867-4
facebook.com/EdelElementsinstagram.com/Edel_Elementswww.edelelements.de
Inhalt
1. BILD
2. BILD
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
3. BILD
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
4. BILD
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
5. BILD
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Give me one moment in time when I’m all that I thought I could be – When all of my dreams are a heartbeat away and the answers are all up to me. Then in that one moment in time I will feel – I will feel eternity.
Song zur Olympiade 1988, gesungen von Whitney Houston
1. BILD
Wenn du nur einmal die Teetasse auf dem Küchentisch stehengelassen hättest und das Frühstücksbrettchen mit dem gebrauchten Buttermesser. Wenn du wenigstens die Wohnungstür hinter dir zugeschlagen hättest. Aber du bist gegangen wie an jedem anderen Tag: spurlos und lautlos. Voller Rücksichtnahme. Mit gebundenem Schlips, gebügelten Hosen, tadellos sitzendem Jackett, die Mütze unterm Arm. So wie immer. Nur einen Zettel hast du dagelassen auf dem Küchentisch: »Bin rechtzeitig zurück.«
Hättest du es nicht wenigstens an diesem Tag anders machen können? Dich auf die andere Seite drehen, verschlafen, dein Pflichtgefühl vergessen?
Dumme Frage. Es wäre dir nicht in den Sinn gekommen. Niemals hättest du das Auto in der Garage gelassen, den Luxusschlitten, auf den du stolzer warst, als wenn es dein eigener gewesen wäre, und dessen technische Daten du herunterbeten konntest wie die Meisterschaftssiege von Hertha BSC – der neue Mercedes 560 SEL. Cremeweiß. Acht Zylinder. 300 PS.
Was wäre schon passiert, wenn du ihn nicht vom Flughafen abgeholt hättest, den Herrn? Wenn er sich ein Taxi hätte nehmen müssen? Undenkbar? Bestimmt warst du mindestens eine Viertelstunde zu früh da. »Sicher ist sicher«, höre ich dich sagen. Und: »Wer weiß, wozu es gut ist.«
Sicher ist sicher.
Und so seid ihr ins Büro gefahren. Du hast gewartet, während er Telefongespräche erledigte und die Unterschriftenmappe durcharbeitete. Du hast ihn zur Sitzung nach Bonn gefahren und dann noch einmal zurück ins Büro. Und dann...
»Bin rechtzeitig zurück.« Ein Zettel auf dem Küchentisch. Jetzt liegt er im Fotoalbum, mehrfach zusammengeknüllt, ebensooft wieder auseinandergefaltet und glattgestrichen.
Das Fußballspiel ging übrigens 2:2 aus. Ich habe alleine vor dem Fernseher gesessen und geheult bei jedem Tor.
Du hättest es schaffen können. Es war erst 17 Uhr, als du ihn nach Hause fahren durftest. Alles hätte gutgehen können, für dich, für ihn, für Lemperle (25), Seiler (41), Brandi (32). Es war ein milder Tag im Spätsommer 1986, der Himmel leicht bewölkt, eine Ahnung von kühleren Tagen schon in der Luft, auf den Straßen sicherlich nicht mehr Verkehr als üblich. Und du kanntest die Strecke im Schlaf.
Hast du wirklich nie Angst gehabt? Bist du nie nachts aufgewacht und hast dir ausgemalt, was passieren könnte, wenn?
Wenn du wenigstens eine andere Strecke gefahren wärst als die gewohnte, die vertraute. Aber du mochtest die Merkstraße mit ihren vielen schäbigen Lädchen und dem Getümmel auf den Bürgersteigen, die Würstchenbude am Ebertplatz, an der zu jeder Tageszeit jemand mit der Bierflasche in der Hand herumsteht. Du liebtest das Blumengeschäft, vor dem im Herbst immer dicke gelbe und rote und bronzefarbene Chrysanthemen standen. Heute kann man da Brillen kaufen. Den Friseurladen, »Salon Frenzl, Damen und Herren«, gibt es noch, aber seit zwei Jahren steht über der Tür mit lila Schrift auf weißem Hintergrund »Gitti’s Langhaarkonzept«.
Es war Montag. Montags haben Friseurgeschäfte zu. Und du durftest sowieso alles nur aus den Augenwinkeln wahrnehmen, das hast du jedenfalls immer behauptet. Weil du dich konzentrieren mußtest, denn hinter dem Friseurladen wird die Straße breiter, der Verkehr dichter. Hast du wenigstens einen Blick gewagt zu den letzten Rosen in den Vorgärten vor den Gründerzeithäusern? Saßen noch Gäste an den langen Holztischen im Gärtchen vor dem Italiener, der heute ein Thailänder ist?
Immer bist du hier entlanggefahren. Ein Mann, treu wie Gold, der schon zehn Meter vor einer Ampel den Fuß vorsorglich vom Gas nahm und vor jedem Zebrastreifen bremste. Und der nie zugeben wollte, daß ihn der Job ein bißchen mürbe gemacht hat im Laufe der Jahre. Weshalb du eines Tages eine Matte aus dicken braunen Holzkugeln auf den edlen Ledersitz der Limousine geschnallt hast – »darauf schwören Taxifahrer«, hast du behauptet. Der Herr nahm es mit Humor. »Solange nicht demnächst ein gehäkelter Klorollenüberzieher auf der Hutablage liegt«, soll er gesagt haben.
Du hättest noch eine Chance gehabt. Vielleicht hättest du noch eine Chance gehabt, wenn du vorzeitig Richtung Luisenstraße abgebogen wärst, vor der großen Kreuzung, in deren Mitte heute wieder der Mozartbrunnen steht. Und dann, nur eine Seitenstraße weiter...
Aber das hättest du nur gemacht, wenn da mehr als ein vager Verdacht gewesen wäre. Ein deutlicher Hinweis. Etwas, das vermocht hätte, dich herauszureißen aus deiner geordneten Welt, in der »so was« nicht möglich war. Eigentlich nicht möglich war. Denn natürlich war sie längst in Unordnung, deine Welt, sonst wären Lemperle, Seiler und Brandi nicht hinter euch gewesen in ihrem dunkelblauen Opel, als ihr um 17.25 durch die Friedrich-List-Straße in westliche Richtung fuhrt, sonst hättest du nicht eine Walther P 1 im Handschuhfach liegen gehabt, geladen. »Da liegt sie gut«, sagtest du immer, wenn Mutter klagte, daß sie dir dort nicht weiterhelfen würde, im Falle des Falles.
Ich hätte sie zu gerne einmal in die Hand genommen. »Das ist nichts für Kinder«, hast du geantwortet. Ich war beleidigt. Ich war schon fünfzehn.
Da wart ihr nun, kurz vor dem Ziel. In die Eichendorffstraße konnte man von der Friedrich-List-Straße aus nicht einbiegen, die ist Einbahnstraße. Das ist noch heute so. Also bist du rechts ab in die Moritzstraße gefahren, dann einmal um den Block, um so in die Eichendorffstraße zu gelangen, zur Wohnung, zur Nummer 10.
Du konntest nicht anders fahren. Sie wußten, daß du nicht anders fahren konntest. Aber war damit zu rechnen, wie abrupt du bremsen würdest, als du abgebogen bist in die Moritzstraße und es liegen gesehen hast? Ein Profi guckt in den Rückspiegel, bevor er auf die Bremse tritt, hast du mir immer erklärt. Galt das nicht für dich? Hast du nicht gesehen, wie nah der dunkelblaue Opel hinter dir war? Oder – war es der Schock?
Was hast du gesehen, als du es gesehen hast, das rote Kinderfahrrad mitten auf der Fahrbahn? Ein Kind? Dein Kind?
Nach allem, was man weiß, gab es kein Kind in der Moritzstraße um 17.25. Nur ein Kinderfahrrad und einen erfahrenen, zuverlässigen, routinierten Chauffeur, der gebremst haben muß wie der Teufel. So heftig, daß das Begleitfahrzeug mit den drei Polizisten hinter ihm auffuhr.
Hast du den Schweinen die Arbeit abnehmen wollen? WARST DU LEBENSMÜDE?
Du hast gebremst. Ich höre und sehe das alles vor mir, seit sechzehn Jahren, immer wieder – als ob sie es damals live im Fernsehen übertragen hätten. Das Kreischen der Bremsen. Dann ein dumpfer Laut, Glas zerbirst, knirschend schiebt sich der dunkelblaue Opel auf den cremeweißen Mercedes (den Opel konnte man vergessen hinterher, der Mercedes hatte kaum eine Beule). Dann sekundenlange Stille. Und dann – Silvesterfeuerwerk. Getacker von zwei HK-43. Der Aufprall von 118 Kugeln auf Metall, Glas, Lederpolster, auf menschliche Körper. Splitterndes Glas, Schreie vielleicht. Dann wieder Stille. Dann Motorengeräusch, der charakteristische Sound eines älteren VW-Bus-Motors. Das Quietschen von Reifen. Und dann, schon aus der Ferne, wütendes Hupen, als das Fluchtfahrzeug bei Gegenverkehr aus beiden Richtungen über die Kreuzung fährt.
Hast du das mitgekriegt? Was hast du gehört in der plötzlichen Stille? Wie das Blut aus fünf durchlöcherten Männerkörpern auf das Pflaster tropfte?
Du hast nicht mehr nach deiner Pistole greifen können, die lag weit weg. Du hattest keine Chance. Hast du ihm wenigstens in die Augen gesehen, dem Mann, der auf die Kühlerhaube des Wagens gesprungen war und ein ganzes Magazin in dich hineinpumpte? Welche der Kugeln hat dich schließlich getötet? Eine der dreizehn, die man in Kopf und Hals gefunden hat, eine der sieben, die in deine Brust gedrungen sind, eine der fünf, die deinen Bauch getroffen haben?
Hast du geschrien? Etwas gesagt? Etwas gedacht? Etwas – getan?
Ich habe die Schußkanäle in deinen weißgebluteten Händen gesehen, später. Du mußt sie dir vors Gesicht geschlagen haben.
Schade um Lemperle, Seiler und Brandi. Aber es war ihr Job, sie wurden dafür bezahlt.
Schade um den Herrn Aufsichtsrat. Berufsrisiko.
Aber du? Wofür mußtest du bezahlen?
Und wofür ich?
2. BILD
1
Beaulieu
Wer hier nicht glücklich sein konnte, dem war nicht zu helfen.
Alexa Senger lehnte sich zurück, reckte die Arme in die Luft, legte den Kopf in den Nacken und schaute in den Morgenhimmel, an dessen rötlich schimmerndem Saum ein paar pausbäckige Wolken hingen. Auf dem Terrassenstuhl neben ihr döste die Katze, die Luft roch nach Holzfeuer und frisch geschnittenem Gras, hoch oben wiegte sich ein Mauersegler im Aufwind.
Ein silbern funkelndes Flugzeug kreuzte lautlos das Bild. Sie senkte den Blick. Über dem Kübel mit dem dunkellila blühenden Sommerflieder tanzte ein Schwarm von Schmetterlingen. Felis gähnte, machte einen Buckel und sah abwägend zu den Flattermännern hinüber.
Alexa ließ die Arme fallen. Sei glücklich, dachte sie. Hier ist schließlich das Paradies auf Erden.
Das Haus lag da, wie es sich für ein altes, aus dem 17. Jahrhundert stammendes Steinhaus am Rande eines kleinen Dorfes im Süden Frankreichs gehörte, verwachsen mit einer Landschaft, in der alles kräftiger zu sein scheint als anderswo: die Gerüche, die Luft, die Farben, die Laute. Auf der Terrasse quollen die Blumentöpfe über von dicken Büscheln Lavendel und Thymian, Rosmarin und Salbei. Alexas Blick ging über die Kübel mit den Zitronenbäumchen und Kletterrosen und Liguster hinunter ins Tal, über die Kaskaden der von Steinmauern umgrenzten Gärten hinweg, in denen Olivenbäume und Eßkastanien wuchsen. Oder, in grünen und roten und gelben Streifen, Salat und Lauch und Kohl, eingesäumt von leuchtender Tagetes. Und am Fuß des Hangs: ein Teich.
Vor ein paar Tagen hatte sie lange dort unten gestanden, den Fröschen zugehört und hochgeschaut. Von unten sah man das Haus am besten: Eine in den Fels gehauene Burg, die sich über der letzten Häuserreihe des Dorfes erhob, größer als die Gebäude links und rechts davon; eine uneinnehmbare Festung, getarnt hinter Efeu und Wein und Rosen, verwunschen, vom Wind umfächelt. Und hinter ihren Mauern dunkle Gewölbe, verstohlene Nischen, verträumte Gärtchen, kühle Zimmer und schließlich eine Terrasse so groß wie ein Ballsaal, über der die Sonne aufging und die ab dem frühen Nachmittag in wohltuendem Schatten lag. Das war ihr Haus.
Ein Dornröschenschloß.
Alexa setzte sich auf und hielt das Gesicht in den kühlen und von der Sonne noch kaum erwärmten Wind, der vom Norden kam, von den Bergen, und den die Einheimischen Sire nannten, wenn es Winter, und, freundlicher, Bonne Maman, wenn es Sommer war.
Ein Luxusgefängnis. Wie geschaffen fürs jahrelange Warten auf den Prinzen.
Sie zog das Band aus dem Haar, schüttelte die dunklen Locken und raffte sie mit beiden Händen zum Pferdeschwanz zusammen. In ihrem Fall hatte der Prinz schon mal probehalber vorbeigeschaut, sich die Sache eine Weile angesehen und war dann wieder abgereist. So wurde das natürlich nichts mit der Erweckung. Sie verzog den Mund, stand auf und ging hinein in die kühle Küche. Das Sonnenlicht, das durch die Fensterläden drang, zeichnete schmale Streifen auf den Küchenboden. Alexa nahm sich einen Pfirsich aus der Schale und ein Messer aus der Schublade. Nun durfte Dornröschen Zusehen, wie die Rosenhecke wieder zuwucherte – sofern sie sich nicht endlich entschloß, zur Baumschere zu greifen.
Abrupt blieb sie stehen. Sie lauschte in das Haus hinein, ob sich oben, im Schlafzimmer, etwas regte, ob sich unten, aus den Kellern, etwas die Treppe hoch auf den Weg zu ihr machte, lauschte auf einen Laut, einen Hauch, eine Bewegung, bis die Kühle der Steinfliesen ihr durch die Fußsohlen gedrungen war. Ihre Finger umklammerten den Pfirsich. Ihre Füße klebten am Boden. Alle Sinne konzentrierten sich auf das Hören.
Als ihr der Saft übers Handgelenk lief, erwachte sie aus der Trance. Sie trug die angematschte Frucht und das Obstmesser hinaus auf die Terrasse. Dann zerteilte sie den Pfirsich und zog ihm die samtene Haut ab. Obwohl ihr Magen sich beim bloßen Anblick verkrampfte, zwang sie sich dazu, wenigstens die Hälfte zu essen. Felis, die sich in einem der Blumentöpfe niedergelassen hatte, hob mit geschlossenen Augen den Kopf und hielt die Nase in ihre Windrichtung. Dann ließ sie sich auf das blaue Polster aus Männertreu zurücksinken. Obst war uninteressant.
Das Dorf erwachte zum Leben. Vom Tal her hörte man leises Gebimmel – die Ziegen von Madame Reynouard wurden auf die Weide getrieben. Jeden Morgen und jeden Abend klangen die Glocken an ihren Halsbändern bis hinauf ins Dorf. Dann das schrille Jammern eines Mofas, das sich immer höher schraubte, bis der Fahrer endlich den nächsten Gang einlegte. Alexa blinzelte mit halbgeschlossenen Augen in die Morgensonne. Gleich würde Monsieur Crespin auf den Balkon am Haus schräg neben dem ihren treten und die Wettervorhersage des Fernsehens nachprüfen.
Man konnte die Uhr nach dem alten Crespin stellen. Morgens, mittags und abends trat er vor die Wetterstation, die an der Schmalseite seiner verglasten Veranda hing, ein hundeknochenförmiges Gebilde aus Holz, das in der oberen Ausbuchtung ein Barometer und in der unteren ein Thermometer umfaßte. »Das Barometer fällt«, hatte er gestern abend mit gesenkter Stimme zu ihr hinübergerufen. Sie beugte sich vor. Soweit sie das von hier aus sehen konnte, stand der Zeiger des Barometers auf fünf nach zwölf, das sprach nicht gerade für ein Tief.
Jetzt schritt Monsieur heran, winkte abwesend und klopfte mit dem Fingerknöchel auf das Glas des Barometers. Der Zeiger rückte noch ein bißchen vor. Der hagere Mann schüttelte den Kopf mit dem dünnen weißen Haar, murmelte etwas, das sie nicht verstand, und ging wieder zurück ins Haus. Manchmal fragte sie sich, wie er sich dort zurechtfand. Nie war einer der grau gestrichenen Fensterläden geöffnet.
Auf Monsieurs Veranda stand eine Topfpflanze mit gefiederten Blättern, auf einer Wäscheleine hingen zwei Paar Strümpfe, ein weißes Unterhemd und eine verwaschene blaue Arbeitshose. Sie hörte ihn husten dort drinnen, dann rückte ein Stuhl, es klang, als blättere er in einer Zeitung. In einer halben Stunde würde er aufstehen und sich bereit machen für den Gang hoch ins Dorf, wo er jeden Morgen einen Milchkaffee trank und ein Croissant aß, draußen vor dem Café des Monsieur Andre schräg gegenüber der Kirche, und sich die neuesten Nachrichten zutragen ließ.
Man lebte eng zusammen hier. Trotzdem begegnete sie manchmal tagelang niemandem außer dem alten Herrn. Von Balkon zu Balkon tauschten sie die gewohnten Sätze über die üblichen Probleme: das Wetter, die Pflanzen, seinen Garten, den Hund und die Katze. Ihr war das recht so, im Unterschied zu anderen machte er keine Anspielungen und stellte auch keine unangenehmen Fragen. Wie die, die sie wochenlang beim Bäcker, beim Zeitungholen, im Supermarkt, von Bekannten und Unbekannten und oft noch vor der Begrüßung gehört hatte – »wohnt Ihr netter Freund nicht mehr bei Ihnen?«
Sieht ganz so aus, dachte sie. Seit einem schwülen Mittwochmorgen im Juli nicht mehr – es war noch gar nicht lange her, aber es fühlte sich an wie lebenslänglich.
Sie spürte, wie der vertraute Schmerz aufflatterte, und scheuchte ihn zurück. Als ob sie das Alleinsein nicht gewohnt wäre. Und außerdem hatte es so kommen müssen: Sie hatte es geahnt, schon beim ersten Gespräch, das sie beide damals mit der Maklerin führten.
»Ich möchte kein Scheidungshaus«, hörte sie sich sagen. Madame Dervalle hatte genickt und gelächelt und so getan, als ob sie verstünde. Scheißfreundlich und falsch bis auf die Knochen, dachte Alexa. Sie hatte die Frau vom ersten Moment an nicht gemocht. Dabei sah Madame gut aus und sprach sogar ein bißchen Englisch – »a liiittle«, hatte sie geflötet, den Kopf kokett zur Seite geneigt.
»Scheidungshäuser« waren wie Wanderpokale. Immer wieder hingen ihre Fotos in den Schaufenstern der Agenturen. Immer wieder ließ sich ein Paar zum Kauf überreden – angezogen von Verheißungen wie »unverbaubarer Blick« oder »herrliche Landschaft« oder »Haus mit Charakter«. Alexa wußte mittlerweile, was sich hinter diesen Zaubersprüchen verbarg. »Unverbaubar« war der Blick, den man von einem verlassenen Gehöft hoch oben in den Cevennen hatte. Dafür fror man sich schon im eisigen Herbstwind die Nase aus dem Gesicht. »Herrliche Landschaft« bedeutete etwas Ähnliches – ungestörte Bergeinsamkeit ohne Wasseranschluß mit mindestens einer Stunde Fahrtzeit zum nächsten Bäcker. Und »Haus mit Charakter« hieß entweder, daß es nur noch von Efeu und wildem Wein zusammengehalten wurde, oder daß es sich im Besitz von fünf streitlustigen Erben befand, die sich über den Verlauf der Grundstücksgrenzen nicht einigen konnten.
Irgendwann gaben die meisten Paare auf. Entweder, weil das Traumhaus sich als Geldvernichtungsmaschine entpuppte, oder, was meistens damit einherging, weil man sich in langen Monaten auf einer zugigen Baustelle heillos zerstritten hatte.
»Kein Scheidungshaus.« Sie hatte die Worte wiederholt und versucht, seinen Blick zu erwischen dabei.
Madame Dervalle lächelte und lächelte. »Ein einmaliges Angebot« – sie legte Alexa schwungvoll drei Farbfotos vor. »Sie sind die ersten, denen ich das Objekt anbieten kann. Ein Traumhaus in Toplage. Ein ausgesprochen günstiger Preis.«
Alexa runzelte die Stirn. Ein Traumhaus für wenig Geld gab es nicht.
»Die Vorbesitzer – die armen Bauers aus Deutschland – leider – aber so ist das nun mal...«
»Was war mit den Bauers?« Als ob sie es nicht geahnt hätte.
Madame Dervalle zuckte die Schultern und lächelte. Und er – er schien damit beschäftigt, die Falten aus dem Tischtuch zu streichen. »Möchtest du nicht erst einmal...«, murmelte er.
Madame fand das auch. »Sehen Sie mal, hier!«
Widerwillig hatte Alexa die Farbfotos in die Hand genommen und eines nach dem anderen angeschaut.
»Das Haus ist etwas ganz Besonderes.«
Täuschte sie sich, oder schickte Madame ihm einen verschwörerischen Blick zu? Er jedenfalls nickte zurück, mit diesem beschwichtigenden Männerlächeln, das wohl »Achten Sie nicht weiter auf meine kleine Freundin, sie ist ein bißchen abergläubisch« bedeuten sollte. Alexa erinnerte sich gut an das Gefühl, das in diesem Moment heiß in ihr hochgestiegen war. Trotz. Sie hatte das Geld.
»Was wollten Sie noch sagen über die Bauers...?«
Madame versuchte, möglichst unbeteiligt zu gucken. »Au début – die Liebe, et après, nun ja...«
Es war genau, wie sie befürchtet hatte. Sven und Felicitas Bauer hatten sich getrennt, schon kurze Zeit nachdem sie das Haus gekauft hatten. Sie war die Treppe zum Dachboden heruntergestürzt. »Was hatte sie da auch zu suchen?« kommentierte Madame mit strengem Blick, so, als ob man Frauen ›in ihrem Zustand‹ das Betreten von Dachböden regierungsamtlich verbieten müßte. Felicitas Bauer hatte das Kind verloren, mit dem sie im vierten Monat schwanger war.
»Monsieur war désolé, und sie – nun, wie das so ist...«
Wie ist das so, hatte sich Alexa gefragt? Wie ist das, wenn man ein ungeborenes Kind verliert? Schlimmer – oder weniger schlimm, als wenn ein Mensch stirbt, den man sein Leben lang kennt?
»Und die Vorbesitzer?« Alexa hielt noch immer die Bilder in der Hand. Es ging etwas Eigenartiges aus von dem Licht und den Farben des alten Hauses vor dem eisig blauen Himmel.
Madame machte mit den Händen flatternde Bewegungen, als ob sie einen kläffenden Hund beruhigen wollte. »Die armen Silbermanns...«
Die armen Silbermanns hatten vier Jahre lang die Ferien im Haus verbracht. Er war Architekt, sie Fotografin. Ein Paar aus Paris, nicht mehr ganz so jung wie die Bauers, gutsituiert und unproblematisch, wie Madame andeutete – keine Kinder, keine Hunde. Eines Tages im vergangenen Herbst war Ada Silbermann verschwunden und nie wieder zurückgekehrt. Nach kurzer Zeit verkaufte Ernest Silbermann das Haus.
»All die Erinnerungen... Der arme Mann...«
Madame war offenbar auf das Mitleid mit Männern spezialisiert.
»Und – vor den Silbermanns?« fragte Alexa schließlich, obwohl er sie wie ein Gemarterter ansah, die Augenbrauen zusammengezogen, die braunen Augen noch dunkler als sonst, den Finger auf die Narbe in der Unterlippe gelegt. Wahrscheinlich hätte er am liebsten »Jetzt entscheide dich doch endlich mal!« gesagt.
Die Dervalle entspannte sich wieder. »Madame Champetier hat hier gewohnt, mit ihrem kleinen Hündchen, bis kurz vor ihrem Tod.«
Hoffentlich ist sie an Altersschwäche gestorben, hatte Alexa noch gedacht und sich bemüht, nicht allzu interessiert auf die Fotos zu starren.
»So eine fröhliche Frau. Und das, obwohl...« Die Maklerin biß sich auf die Lippen und schaute zur Seite.
»Obwohl was?«
»Nun, es hieß, nachdem das mit ihrem Mann passiert war...«
Alexa versuchte, seinen Blick zu erhaschen. Aber er hatte die Augen geschlossen und schien den Kopf zu schütteln. Sie hätte ihn zugleich küssen und schlagen mögen. Es wird auch dein Haus sein, hätte sie am liebsten gerufen. Willst du mit Gespenstern leben?
»Was war mit dem Mann von Madame Champetier?« Sie fürchtete das Schlimmste.
»Also...«
Unter gesenkten Wimpern schielte die Dervalle zu ihm hinüber. Diesmal wich er auch dem Blick der Maklerin aus.
Madame seufzte. »Alphonse Champetier ist im Sommer 1942 ermordet worden. Man hat nie erfahren, von wem.«
Alexa spürte, wie ihr Unbehagen wieder anschwoll. 1942 – das war mitten im Zweiten Weltkrieg. Frankreich war von den Deutschen besetzt. Hatte der Tod des Alphonse damit zu tun? Spätestens jetzt hätte sie das Gespräch abbrechen, hätte sie nein sagen müssen.
Denn das kriecht einem Haus in die Poren – alles, was mit Tod, Einsamkeit, Trauer, gescheiterter Liebe zu tun hat. Das steckt drin in den Mauern, wie ein böser Geist. Und wie ein Pesthauch überfällt es das nächste Opfer, das sich nähert. Und dann... Alexa fühlte, wie ihr kalt wurde.
Andererseits – was sie auf den Fotos sah, gefiel ihr. Es gefiel ihr immer besser, nein: es entsprach ihren kühnsten Visionen. Wenigstens ansehen mußte sie sich das Haus, wenigstens einmal auf dieser Terrasse, unter diesem Torbogen stehen und dem nachspüren, was das Haus ausstrahlte.
Und, wenn man es nüchtern betrachtete: eine Serie von Schicksalsschlägen der Vorbesitzer trieb den Verkaufspreis eines alten Hauses nicht gerade in die Höhe.
»Und davor...«, fragte sie. Aber so genau wollte sie es plötzlich nicht mehr wissen. Er mußte gemerkt haben, daß sie angebissen hatte, denn plötzlich war er ruhiger geworden auf seinem Stuhl an der anderen Seite des Tisches.
»Das Haus ist mehr als 300 Jahre alt, es hat Geschichte, was wollen Sie machen.« Die Dervalle klang gleichgültig. Es schien sie wenig zu berühren, daß hinter seinen Mauern offenbar kein einziges Paar glücklich und zufrieden einem natürlichen Ende entgegengelebt hatte.
»Außerdem kaufen Sie das Haus mit allem Interieur. Das ist – comment dit-on en Allemagne? Eine Schnäppschen...«
Kurz vor dem Termin beim Notar, an dem der Kaufvertrag unterschrieben werden sollte, waren er und sie noch einmal durch das Haus gegangen, von oben, vom Dachboden, runter in die beiden Schlafzimmer, dann eine weitere steile Treppe hinunter zum Kaminzimmer, zur Bibliothek und zur Küche mit Eßzimmer. Dann wieder einen Stock tiefer, eine Freitreppe hinunter an einem schattigen Gärtchen vorbei in die Caves, in die Kellergewölbe, aus denen ihnen aufgeschreckte Vögel entgegenflatterten. Und schließlich wieder hoch, auf die Terrasse.
»Und? Glücklich?«
Sie sah ihn vor sich, wie er da stand im Abendlicht, die kurzen blonden Haare zerrauft. Sah seine zärtlichen Augen, die schiefe Nase, den weichen, geschwungenen Mund mit der feinen Kerbe in der Unterlippe. Das Gesicht einer etwas lädierten antiken Statue. Sie hatte sich wortlos an seine Brust geschmiegt. An diesem Abend begann sie an das Glück zu glauben.
Sie mußte irgendeinen Laut von sich gegeben haben, jedenfalls sprang Felis ihr mit einem leisen Schrei auf den Arm und stieß ihr die feuchte Nase ins Gesicht. Sie kuschelte sich an das warme, duftende Katzenfell und schloß die Augen.
Seit er fort war, versuchte sie, nicht mehr an ihn zu denken. Sogar seinen Namen hatte sie sich verboten.
Vom Kirchturm ertönten vier Glockenschläge, das Zeichen für die volle Stunde. Dann schlug eine etwas tiefer klingende Glocke die Stundenzahl an, mit einem blechernen Nachhall. Sie zählte bis neun. Es war Zeit.
»Lauf!« sagte Alexa und schubste Felis von ihrem Schoß. Sie stand auf, ging ins Haus zurück und die Treppe hinauf zum Schlafzimmer. Die Tür des wuchtigen Kleiderschranks knarzte beim Öffnen. Sie lauschte dem Geräusch hinterher und stellte sich all die Frauenhände vor, die in den Jahrzehnten, in denen der Schrank schon hier stand, den Schlüssel im Schloß gedreht und die Tür aufgezogen hatten. Felicitas Bauer mochte ein luftiges, weites, vielleicht geblümtes Kleid herausgeholt, es prüfend vors Licht gehalten, genickt, das Kleid aufs Bett gelegt und dann über den Kopf gezogen haben. Ada Silbermann sah sie mit einem streng geschnittenen Tweedjackett in der Hand vor dem Schrank stehen.
Madeleine Champetier nahm seit 1942 Jahr um Jahr und Tag um Tag einen schwarzen Rock und eine schwarze Bluse heraus.
Und die Frau, die noch früher dort gewohnt hatte, von der Madame zuletzt dann doch noch, wenn auch widerstrebend, erzählt hatte? Vielleicht, dachte Alexa, hat sie die Uniformröcke ihrer beiden Söhne aus dem Schrank geholt, gestärkt und gebügelt, um sie ihnen hinzulegen, bevor sie an die Front mußten, in den Ersten Weltkrieg, aus dem sie nicht zurückkehrten.
Sie fröstelte. Blind griff sie in den Schrank hinein. Ungläubig starrte sie auf das rote Kleid, mit dem ihre Hand wieder aus dem dunklen Schrank herauskam. Das sollte sie anziehen? Mit gerunzelter Stirn sah sie den Schrank an.
»Na gut«, sagte sie.
2
Frankfurt am Main
Karen Stark glaubte von sich, daß sie auf Äußerlichkeiten nichts gab. Aber bei Angelika Kämpfer war ihr jedes Detail aufgefallen. Die hellblaue Bluse mit dem garantiert knitterfreien Krägelchen. Die granitgraue Weste, die sie darübergezogen hatte, in sportlichem Strick, mit V-Ausschnitt. Der lange weiße Hals und die schmalen Ohren. Die Frisur, vor allem die Frisur: Staatsanwältin Dr. Angelika Kämpfer trug ihre mittelbraunen Haare länger als kinn-, aber kürzer als schulterlang. In der Mitte zwischen Ohrläppchen und Schultern fächerten sie sich sanft nach außen, nicht in einer satten Welle, nein, sondern so züchtig, daß es schon wieder kokett wirkte.
Zum Inbild der Mädchenhaftigkeit paßte auch, daß nicht alle Haare hinter den Ohren geblieben waren, sondern einige glänzende Haarsträhnen sich nach vorne geschmuggelt hatten, so daß die rosa Ohrmuscheln hindurchschimmerten. Und dann der brave Seitenscheitel und der kurze Pony über den in Form gezupften Augenbrauen! Die blauen Augen darunter, natürlich ungeschminkt, wirkten ungerührt, ja kühl, was daran liegen mochte, daß die eine Augenbraue etwas höher stand als die andere. Angelika Kämpfers Nase war gerade und schmal, ihre Lippen glänzten rosig auch ohne Lippenstift, und noch nicht einmal das Muttermal über der Oberlippe rechts schmälerte dieses Bild der Untadeligkeit.
Die Neue strahlte kühle Intelligenz und äußerste Zielstrebigkeit aus. Und sie machte ihrem Namen alle Ehre.
Karen versuchte, gleichmäßig zu atmen. Sie saß in einem ausgeklügelten Mechanismus aus Kunstleder und Stahl und Eisen. Ein Gewicht von 220 Pfund drückte die angezogenen Knie gegen Bauch und Brust. Langsam begann sie, ihre Beine dem Widerstand entgegenzustrecken. So würde sie der Kollegin Kämpfer künftig entgegenarbeiten müssen – mit steter Kraft und ohne außer Atem zu geraten. Jetzt waren ihre Beine fast gerade. Sie merkte, wie alle Muskelfasern zu vibrieren begannen.
Was hatte sie sich eigentlich vorgestellt, als sie von der Berufung der acht Jahre Jüngeren hörte? Frauensolidarität? Gemeinsames Menstruieren bei Mondschein? Karen atmete geräuschvoll aus, als sie ihre Beine vom Gewicht wieder zurückdrücken ließ in die Ausgangsposition. Triumph der Weiblichkeit? Sie machte eine kurze Pause, bevor sie die Beine wieder streckte. Schweißtropfen liefen ihr von der Stirn. Sie ließ das Gewicht zurücksinken, setzte ab und rollte den Sessel des Fitneßgeräts zurück. Dann wischte sie sich mit dem Handtuch über das Gesicht. Was für ein Quatsch.
Die Zeiten waren vorbei, als man sich mit den wenigen Kolleginnen zwangsweise solidarisch fühlen mußte. In Frankfurt war fast ein Drittel der Abteilungen mit Frauen besetzt. Und sogar der Vorsitz des Bundesverfassungsgerichts befand sich fest in Frauenhand. Was für ein Fortschritt!
Also keine Sentimentalitäten mehr, sagte sich Karen, während sie den Raum durchquerte. Um diese Zeit war der Kraftraum fast leer, nur eine ältere Frau saß auf der Butterfly am Fenster. Weiber sind nicht die besseren Menschen. Karen steuerte den Turm an, legte sich den breiten Gürtel um die Hüften und machte ihn mit einem Karabinerhaken an der Öse fest. Und Frauensolidarität ist ein Fossil aus dem schon ganz schön vergangenen 20. Jahrhundert. Dann stieg sie zwei Stufen des Gerüsts hoch, rutschte mit den Füßen nach hinten, bis sie nur noch mit den Fußballen auf der Treppe stand und hob sich mit geraden Beinen auf die Zehen, ihr eigenes Gewicht verstärkt durch die Eisenbarren, die sie aufgelegt hatte. Nach der zehnten Wiederholung begannen ihre Wadenmuskeln zu zittern.
Kollegin Kämpfer hatte es schon bei der Begrüßung an Deutlichkeit nicht mangeln lassen. Sie gab sich noch nicht einmal die Mühe, zu lächeln, als sie mit kaum merklicher Verzögerung Karen die kühle, schmale Hand hinhielt. Und es war auch nicht eben höflich, wie schnell sie sich wieder ab- und dem Kollegen Manfred Wenzel zuwandte. Und siehe da, sie lächelte, als sie ihm die Hand gab. Mit Genugtuung sah Karen, daß Wenzel keinen Gesichtsmuskel verzog. Soviel Zartgefühl hätte sie ihm gar nicht zugetraut.
»Kollege Wenzel und Kollegin Stark sind ein erfolgreiches Team, ein sehr erfolgreiches Team«, hatte OStA Zacharias geschwätzt, der ihnen die Kämpfer eingebrockt hatte. »Nun wird uns Dr. Wenzel leider verlassen« – wieso leider? Karen wußte, daß die beiden sich auf den Tod nicht ausstehen konnten. »Und jetzt hoffen wir auf weitere glückliche Zusammenarbeit!« Diesmal zuckte niemand der Anwesenden auch nur mit der Wimper.
Karen ließ die Szene noch einmal vor ihrem inneren Auge Revue passieren. Ihre Reflexe mußten so gelähmt gewesen sein, daß sie erst gar nicht merkte, was gespielt wurde. Zacharias hatte sich im Schreibtischsessel weit nach hinten gelehnt, mit dem teuren Montblanc gewedelt, unentwegt gelächelt und unentwegt geredet, das übliche Geschwafel, sie hörte seit Jahren nicht mehr hin. Bis der Abteilungsleiter, mit der ihm eigenen Vorliebe für verkürzte Satzbildung, sagte:
»Und solange der Kollege Wenzel noch verfügbar ist, liebe Kollegin Stark – und angesichts des Urlaubs, den Sie noch zu nehmen haben – die Frau Dr. Kämpfer wird sicherlich...«
Sie hatte erst gar nicht verstanden. Und dann war ihr heiß geworden vor Zorn. Sie sollte abgeschoben werden. Man wollte sie weghaben. Damit Kollegin – Dr.! – Kämpfer ein freies Feld hatte, um sich unentbehrlich zu machen?
»Aber ich...«
Zacharias wedelte ihr beschwichtigend zu. »Machen Sie sich keine Sorgen. Ihre Fälle sind bei Angelika... bei Frau Dr. Kämpfer in besten Händen.« Er drohte doch tatsächlich neckisch mit dem Füllfederhalter. »Auch Ihr Lieblingsfall – wie hieß sie noch? Eva Rauch...«
In den Fall Eva Rauch hatte sie tatsächlich beträchtliche Energie gesteckt – ohne sie wäre der Vorgang in der Ablage gelandet. Sie war mit der Sache so beschäftigt gewesen, daß sie dafür das eine oder andere hatte schleifen lassen. Selbst Wenzel war maßvoll ungeduldig geworden. Und nun sollten die Früchte dieser Arbeit der Neuen in den Schoß fallen. Sie war zu verblüfft, ach was: zu schockiert gewesen, um zu protestieren.
»Ob Sie mir alles Nötige bald zukommen lassen würden, Frau Kollegin?« hatte die Kämpfer gleich hinter der Tür, die der Abteilungsleiter ihr mit großer Geste aufhielt, kühl gefragt. »Eine Einweisung ist nicht vonnöten, ich werde sicherlich mit der Aktenlage auskommen. Sagen wir – bis morgen?«
Karen hatte wie betäubt genickt.
»Die Sache bleibt ja unter Frauen«, murmelte Wenzel im Vorübergehen.
»Ich glaube nicht, daß das in diesem Zusammenhang...« Karen sah mit Genugtuung, daß die Kämpfer nicht mehr ganz so gelassen guckte, grinste sie an, drehte ihr den Rücken zu und folgte Wenzel in die Kantine.
Erst auf dem Weg zurück ins Büro erreichte sie die Botschaft mit voller Wucht. Sie war vor aller Augen gedemütigt, gekränkt, beleidigt worden. Man schickte sie wie einen Pflegefall in den Urlaub. Und wenn sie zurückkäme, hätte Kollegin Kämpfer eine strategische Position nach der anderen besetzt und würde ihr das Leben versauen, bis sie endlich entnervt um Versetzung nachsuchte und in der Abteilung für Jugend- und Jugendschutzsachen landete.
In ihrem Zimmer angekommen, schlüpfte sie aus den Schuhen, ließ sich im Waschkabinett kaltes Wasser über die Handgelenke laufen, setzte sich an den Schreibtisch und legte die Beine hoch. Nach zwei Minuten hatte sich ihr Puls wieder normalisiert. Urlaub, dachte Karen Stark, ist gar keine schlechte Idee.
Und weil sie sich nicht nachsagen lassen wollte, sie sitze auf ihren Fällen wie die Fliege auf dem Handkäs’, ließ sie den Justizwachtmeister die Akten schon nach einer halben Stunde zu Angelika Kämpfer hinüberschaffen. Seitdem hatte sie die neue Kollegin nicht mehr gesehen.
In der Garderobe des Trainingsclubs schlüpfte sie aus den nassen Klamotten und stellte sich unter die Dusche. Sie war, seit sie mit dem Training wieder angefangen hatte, deutlich schlanker geworden. Mehr Muskeln, weniger Fett. Mehr Sprungkraft.
Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht, dachte sie und ballte versonnen die Faust.
Die Fingernägel müßten auch mal wieder lackiert werden.
3
Beaulieu
Alexa hatte ihre Einkäufe erledigt, gerade rechtzeitig vor dem Touristenaufmarsch. Der Markt in St. Julien galt als der schönste weit und breit, und insbesondere während der Sommersaison pulsierte er in zwei verschiedenen Rhythmen. Die einen durchquerten den Platz unter den Platanen in aller Frühe zügig und in engen Kreisen. Man wußte, was man wollte, wo es die besten Poularden und die zartesten Kaninchen und das frischeste Gemüse gab. Die anderen, meist Menschen in kurzen Hosen, ungeduldige Kinder im Schlepptau, in der Hand die Kamera, zog in weiten Bögen und gemächlich über den Markt.
Alexa war schon auf dem Weg zum Parkplatz, als sie Catherine sah. Lebhaft wie immer redete sie auf eine ältere Frau ein, die einen Einkaufskorb zwischen die Beine gestellt und die Hände in die Hüften gestemmt hatte. Alexa hoffte, sich an den beiden vorbeidrücken zu können. Nicht, daß sie Catherine nicht dankbar wäre. Sie war es gewesen, die nach dem Einzug als erste bei ihnen vorbeigekommen war, mit einer Flasche Wein und einem Brot.
»Das gehört sich doch unter Nachbarn!« hatte sie gerufen und, an Alexa vorbei, ihm zugezwinkert.
»Na wenigstens weißt du jetzt, daß er nicht hinter deinem Geld her war«, lautete ihr Kommentar, als Alexa wieder allein war. Fast war sie Catherine dankbar gewesen für ihren Zynismus.
Besser als Mitleid. Mitleid war das letzte.
Catherine gehörte das Relais des Roses, Beaulieus bestes Restaurant – »mir, nicht dem Esel Emile«, betonte sie oft. Ihr entging nichts, auch heute nicht.
»Alexa!« Alexa blieb stehen und wartete, bis Catherine sich von der anderen verabschiedet hatte, die neugierig zu ihr hinüberzusehen schien. »Komm! Heute ist der Bäcker wieder da, Pagot, der mit dem besten pain de seigle, du weißt doch, du wolltest doch immer mal...«
In kulinarischen Dingen duldete Catherine keinen Widerspruch. Obwohl Alexa ausgerechnet heute kein Brot hatte kaufen wollen, ging sie mit.
»Er bäckt noch auf die alte Art, und seine tartes...« Catherine küßte ihre Fingerspitzen.
Alexa nickte, ohne den geringsten Appetit zu verspüren.
»Du kaufst hoffentlich keine Gewürze auf dem Markt. Das ist alles viel zu teuer und zu alt und steht nur für die Touristen da.«
Alexa guckte verstohlen hinüber zu dem Stand mit den dekorativ aufgekrempelten Säckchen, aus denen die Frau mit den dunkel geschminkten Augen und dem bunten Schal um den Kopf mit einem kleinen Maßlöffel Curcuma, Anis oder Cayennepfeffer in Papiertüten füllte. Natürlich hatte sie hier gekauft – Muskatnüsse und Wacholder und dicke Zimtstangen.
Vor dem Gemüsestand blieb Catherine stehen und packte Alexas Arm. »Siehst du da vorne, die Frau mit dem großen Hut?« flüsterte sie unüberhörbar. »Sie läßt sich tatsächlich hier blicken, obwohl jeder weiß...« Als die Frau mit dem Hut in ihre Richtung guckte und winkte, ging Catherines Gesichtsausdruck geübt in Leutseligkeit über.
»Hallo, Françoise!« Catherine winkte zurück und drehte sich gleich wieder um zu Alexa. »Sieh nicht hin, sonst kommt sie womöglich noch hierher.«
»Und was kann ich heute für dich tun, Catherine?« fragte der Gemüsehändler.
»Ich nehme drei Knollen rosa Knoblauch«, rief sie über die Schulter, während ihre Augen die Menschenmenge absuchten. »Und zehn von den weißen Auberginen. Die mußt du mal probieren«, sagte sie zu Alexa, die unschlüssig neben ihr stand.
Wieder reckte sich Catherine und schwenkte den Arm. »Marcel! Tu vas bien?« Ein Mann mit gerötetem Gesicht unter der Baskenmütze winkte zurück.
»Und zwei Kilo rote Bohnen – Alexa, wenn du mal provençalisch kochst...«
Als Alexa stumm den Kopf schüttelte, seufzte Catherine auf. »Ißt du denn gar nichts? Na ja – so siehst du ja auch aus. In deinem Alter hatte ich auch nie Appetit.«
Alexa wußte erst gar nicht, wovon Catherine sprach. Gewiß, sie hatte abgenommen, seit er fort war. Alles war ein bißchen durcheinander seither. Aber seit einigen Tagen fühlte sie sich, als ob sie aufgegangen wäre wie Hefeteig. Sah man ihr das nicht an?
Die beiden Frauen hatten sich inzwischen dem Rhythmus der anderen angepaßt, die sich zwischen den Ständen drängten. Unter bunten Sonnenschirmen lagen kleine runde Ziegenkäse, in jedem Reifestadium; beim Fischhändler türmten sich die Langusten, Muscheln, Austern, und nebenan, am Stand mit den CDs und Schallplatten, wurde französische Volksmusik gespielt. Daneben Ständer mit gerüschten und geblümten alten Kleidern, Tische mit Spitzendecken und Damasttüchern, dann wieder Gemüsestände mit leuchtenden Tomaten, Auberginen, Zucchini – alles verband sich zu einem Rausch von Farben und Gerüchen.
Doch von einer Sekunde auf die andere fühlte Alexa sich in einer anderen Welt. Nebel zog über die Sonne. Die Gemüsefrau bleckte ein großes gelbes Gebiß. Der Fischhändler starrte sie mit blutunterlaufenen Augen an. Die gerupften Hähne mit den verdrehten Köpfen reckten die Klauen im Todeskampf. Über dem Ziegenkäse lag ein grünschillernder Pelz von Schmeißfliegen. Der Gestank von totem Fisch und eine Wolke schräger Klangfetzen schlugen über ihr zusammen. Sie suchte mit der Hand Halt am Tisch mit den antiquarischen Büchern. Vor ihren Augen schien ein Schwarm von Mücken zu kreisen und übel war ihr auch. Von Ferne hörte sie Catherines besorgte Stimme.
»Geht schon wieder«, flüsterte sie.
Die Übelkeit verflog, wie sie gekommen war. Alexa strich sich die Haare aus der Stirn.
Catherine blickte sie an, taxierend. »Bist du sicher...?«
Alexa hob den Kopf. Die Gemüsefrau lächelte freundlich zu ihr herüber. Die Sonne schien wieder hell. »Ganz sicher.«
Langsam gingen sie weiter. Catherine grüßte nach allen Richtungen, rief der einen ein fröhliches Ça va! zu, klopfte dem anderen auf den Rücken. Alexa ging benommen neben ihr her. Plötzlich blieb sie so abrupt stehen, daß der Mann hinter ihnen ihr das Objektiv seiner Kamera ins Kreuz rammte.
»Lavendelextrakt« stand auf dem großen silbernen Behälter, aus dem ein Mann mit gerötetem Gesicht und schrundigen Händen kleine Flaschen abfüllte. Daneben lagen Berge von Lavendelsträußen, alle mit einer blauen Kordel umwickelt. Als er sah, daß Alexa ihn anstarrte und endlich auch Catherine stehenblieb, schwenkte der Lavendelverkäufer mit einem fröhlichen »Mesdames!« eine noch nicht verkorkte Flasche in ihre Richtung. Alexa wich zurück.
Catherine winkte dem Mann zu und zog sie am Arm weiter.
»Liegt das immer noch überall herum in deinem Haus, das Gemüse?«
»In Wagenladungen«, sagte Alexa und versuchte zu lachen. Aus allen Ecken krümelten die kleinen blauen Blüten hervor.
»Ada schwor auf Lavendel. Gegen Mücken, Flöhe, Skorpione. Gegen Rheuma, Allergien und Schlaganfall. Gegen Depressionen, Katerstimmung und Liebeskummer.«
Ada Silbermann. Ihr schien das Haus in Beaulieu noch immer zu gehören.
Catherine drückte Alexas Arm. »Das scheint bei dir nichts zu nützen.«
»Und hat es vielleicht ihr geholfen?« Der Satz war ihr herausgerutscht, ohne daß sie wußte, was sie damit sagen wollte. Schließlich gab es ein paar völlig undramatische Gründe, warum eine Frau verschwand: Sie hatte ihren Ehemann satt. Sie war zu einem anderen gegangen. Sie wollte...
Catherine seufzte. »Wer weiß, warum sie ging und wo sie geblieben ist. Eines Tages war sie nicht mehr da. Anfang Oktober war das, nach dem großen Regen. Die Marktstände bogen sich vor Steinpilzen.« Sie blieb wieder stehen. »Wir waren alle völlig schockiert. Und Ernest...«
Anfang Oktober, dachte Alexa. Vor einem Jahr. Damals hat alles angefangen – an einem sonnigen Herbsttag. Wenn er nicht gewesen wäre... Vielleicht wäre ich dann heute nicht hier.
»Ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man plötzlich allein ist«, sagte sie leise. Aber Catherine war schon wieder ganz woanders.
Sie hielt sich ein Stück gelber Seife vor die Nase. »Riech mal«, sagte sie und reichte Alexa das Seifenstück. Auf dem Tisch, vor dem sie standen, lagen dicke Blöcke aus Seife, braune, blaue, gelbe oder rote, in denen wie Insekten in Bernstein Limonenscheiben eingeschlossen waren oder Rosmarinzweige oder Lavendelblüten. Die Frau am Stand verkaufte die Seife scheibenweise, in durchsichtige Folie verpackt.
Alexa schnupperte folgsam. »Und ihr habt nie wieder von ihr gehört...«
Catherine legte die Seife zurück und nickte der Frau freundlich zu, bevor sie weiterging. »Nie wieder.«
»Aber...« Irgendwie ist sie noch immer da, hätte Alexa fast gesagt.
»In alten Häusern bleibt immer etwas von all denen, die in ihnen gelebt haben. Es macht ihren Zauber aus, oder?«
Klar, dachte Alexa. Natürlich hat das Charme. Aber warum nährt sich ausgerechnet in meinem Haus der Zauber aus Menschenschicksalen, die man beim besten Willen nicht glücklich nennen kann? Zwei Söhne gefallen, ein Mann ermordet, eine Frau verschwunden, ein Kind gestorben... Und schließlich: Eine Frau, von ihrem Liebsten verlassen.
Das jedenfalls ist noch steigerungsfähig.
Felis lag schlafend auf der Terrasse, als Alexa nach Hause kam. Sie streichelte die Katze, verstaute die Einkäufe in Kühlschrank und Keller, wusch ab, putzte Küche und Bad, säuberte den Küchenschrank bis in die hinterste Ecke von vertrockneten Lavendelblüten und machte einen großen Bogen um den Raum, in dem die Bauers alle Überbleibsel der Vorbesitzer verstaut hatten, mit denen sie nichts anfangen konnten. Als er noch da war, hatte er den Raum inspiziert und etwas von kaputten Stühlen, einem Bettgestell und vielen Koffern gesagt. Irgendwann würde sie dort aufräumen müssen. Aber nicht jetzt. Nicht heute.
Vom Kirchturm her schlug es vier Uhr. Sie legte sich in den Liegestuhl auf die jetzt schattige Terrasse und machte es wie die immer noch schlafende Felis: Sie schloß die Augen.
Wovon sie aufgewacht war, wußte sie nicht mehr. Ihr Herz raste wie nach einer mit knapper Not überstandenen Gefahr. Sie setzte sich auf und massierte sich das schmerzende Kreuz. Wie konnte man nur so lange schlafen. Sie blickte in den Himmel. Dort waren Gewitterwolken aufgezogen. Im nächsten Augenblick zog eine Windbö eine Schleppe aus feinem Staub über die Terrasse.
Alexa spürte, wie sie eine Gänsehaut bekam. Diesmal hörte sie keine verdächtigen Geräusche, hatte sie keine Erscheinungen, sah sie keine Gespenster. Etwas anderes machte ihr angst. Es war das vertraute Gefühl – das Gefühl, daß sie allein war.
»Felis?« rief sie leise, stand auf und suchte mit den Augen die Lieblingsplätze der Katze ab. Sie lag nicht auf dem Stuhl, nicht unter dem Tisch, nicht im Topf mit dem Sommerflieder. Alexa zwang sich zur Ruhe gegen die aufkommende Panik, angelte mit den Zehen nach ihren Sandalen und ging ins Haus.
»Felis! Komm her! Komm zu mir!«
Die Katze kam immer, wenn sie nach ihr rief, redete sie sich ein. Nur einmal, das war ein paar Wochen her, hatte Felis sich fast drei Tage nicht blicken lassen. Todesängste hatte sie ausgestanden – bis sie endlich das Jammern einer Katze hörte und hinunter zum Tor lief. Felis stand davor, zerzaust und abgemagert. Sie wußte bis heute nicht, wie das Tier aus dem Haus herausgekommen war.
Alexa lehnte sich gegen die kühle Küchenwand und versuchte, ruhig zu atmen.
Das Kind hatte keine Worte für das Unglück. Es fühlte nur einen unbarmherzigen Schmerz, einen nie gefühlten und doch schrecklich vertrauten Schmerz. Es weinte bis zur Erschöpfung.
»Vielleicht ist er morgen wieder da«, sagte Vater irgendwann, aber das Kind sah in seinem Gesicht, daß er nicht daran glaubte.
»Du kommst darüber hinweg«, sagte Mutter und das Kind haßte sie dafür.
Aber am meisten haßte es sich selbst. Es hatte seine gerechte Strafe bekommen. Es hatte diese Strafe verdient.
Sie waren übers Wochenende zur Großmutter gefahren, das Kind und die Mutter. »Großmutter stirbt«, hatte Mutter gesagt. »Sie will dich noch einmal sehen. Sei lieb zu ihr.« Großmutter lag im Bett, sie hatte kalte Hände und roch nicht gut. Das Kind mochte nicht von ihr geküßt werden. Die alte Frau tätschelte ihm die Wange. Es drehte den Kopf weg. »Benimm dich! Vielleicht siehst du sie zum letzten Mal!« zischte Mutter. Das Kind quengelte. »Aber ich tu dir doch nichts, Püppchen!« flüsterte Großmutter. Das Kind wandte ihr den Rücken zu.
Mutter schwieg die ganze lange Fahrt über, aber das Kind war froh, daß es wieder nach Hause ging. Vater war da, er hatte von seinem letzten Flug ein Geschenk mitgebracht – ein buntes Halstuch. Das Kind fiel ihm um den Hals und bettelte dann so lange, bis er ihm eine Geschichte erzählte. Erst nach einer schrecklich langen Zeit merkte das Kind, daß etwas fehlte. Daß es etwas vermißte.
»Wo ist Jonny?« Der Vater sah verlegen aus, so, wie Erwachsene aussehen, wenn sie etwas verbergen wollen. »Wo ist er? Wo? Wo?« Es mußte etwas passiert sein. Etwas Schreckliches.
Jonny. Vater hatte ihn vorigen Winter vor der Haustür gefunden, ein schwarzes Hundebaby mit weißem Brustlatz und Seidenöhrchen und dicken Pfoten. »Man hat ihn ausgesetzt«, hatte er gesagt, als er das zitternde kleine Fellbündel ins Wohnzimmer brachte.
Ausgesetzt. Was für ein schreckliches Wort.