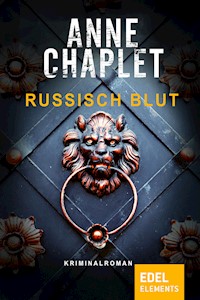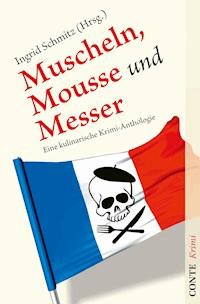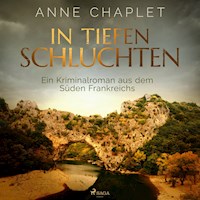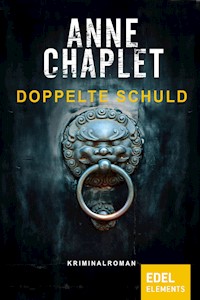1
Flucht aus Ostpreußen, Winter 1945
Es war ein düsterer Tag gewesen. Jetzt stand vor den Fenstern die schwarze Nacht. Mathilde zögerte. Im Esszimmer lag alles noch auf dem Tisch, die Terrinen, die Platten, die Teller und das Besteck. Ihr Vater hatte es so gewollt. Und die Köksch hatte voller Verachtung gesagt: „Du schließt nicht ab! Dann müssen sie nicht erst die Tür eintreten, bevor sie sich bedienen.“ Sie ging noch einmal zurück, nahm das Besteck und den Serviettenring mit ihren Initialen sowie die silberne Schöpfkelle und wickelte alles in eine Schürze.
Der Treck war fort. Sie war die letzte.
Marie Mathilde von Bergen ließ alle Türen offenstehen, nahm die Jacke vom Haken, schlüpfte in die Gurte des gepackten Rucksacks, steckte das Bündel mit dem Tafelsilber in die Satteltasche und ging über den Hof zum Stall. Es war eisig kalt, bestimmt längst unter zwanzig Grad Minus. Der Wind pfiff über die Dächer, aber es schneite wenigstens nicht.
Im Stall scharrte Falla unruhig im Stroh. Die meisten Tiere waren fort und die übriggebliebenen schienen die Veränderung zu spüren. Vielleicht vermisste die Stute den Hund? Papa hatte Wotan erschossen, bevor er ging. Er hatte mit Tränen in den Augen die Kühe losgebunden und die Türen zum Schafstall aufgelassen.
Sie nahm Sattel und Halfter von der Wand. Falla reckte ihr den braunen Kopf mit der weißen Blesse entgegen. Sie öffnete den Verschlag, tätschelte der Trakehnerstute den Hals und ließ sie ein Bein nach dem anderen heben, um ihr die scharfen Stolleneisen unter die Hufe zu schrauben. Hoffentlich half das auf den vereisten Straßen. Dann sattelte sie das Tier, führte es aus dem Stall, sah ein letztes Mal hinauf zum ersten Stock von Gut Jechow, in dem ihr Zimmer lag, stieg auf und ritt zum Tor hinaus.
In keinem der umliegenden Gehöfte und Katen brannte noch Licht. Das Grollen hinterm Horizont war jetzt ganz nah. Falla hob den Kopf und spitzte die Ohren. Mathilde spürte die Unruhe des Pferdes wie ein Echo der eigenen Angst vor dem unbekannten Verhängnis.
„Wir kommen zurück“, hatte Mama beim Abschied geflüstert. Nein, dachte Mathilde. Der Osten ist verloren.
Kilometer für Kilometer rückte die vertraute Landschaft in die Ferne. Sie versuchte, sich alles noch einmal einzuprägen in den Farben der Jahreszeiten. Aber sie sah nur Weiß und Schwarz und Grau. Wie auf einer Fotografie, die man Jahre später in der Hand halten würde, um „damals“ zu seufzen.
Als es auf die Straße zuging, wurde Falla immer langsamer und blieb schließlich schnaubend stehen. Ein schwarzer Lindwurm kroch dort vorne, ein schweigendes Ungeheuer aus tief vermummten Menschen, die im Schritttempo den Pferdekarren hinterherstapften oder Handwagen zogen, Schlitten, vollgestopfte Kinderwagen. Es gab kein Schluchzen, es fiel kein Wort – man hörte nur das Rascheln von Kleidern und das Knirschen des Schnees und das Schnauben der Pferde, die so müde aussahen wie die Menschen. Noch nicht einmal die Kinder schrien.
Mathilde flüsterte Falla beruhigende Worte ins Ohr und lenkte sie sanft an den Rand der endlosen Schlange geduckter Menschen. Der Treck kroch gen Westen, bis es licht wurde am Horizont. Bald darauf kamen den Flüchtenden Kübelwagen mit Soldaten und Geschütze auf Lafetten entgegen. Und dann rollten Panzer heran, geradewegs zu auf die Menschenmassen, die eingekeilt waren zwischen den schweren Wagen und nicht ausweichen konnten. Mathilde versuchte, ihre Tränen mit der behandschuhten Hand wegzuwischen, bevor sie ihr auf den Wangen gefroren. Am Wegesrand und im Straßengraben lagen armseliger Hausrat, gestrandete Karren und verendete Pferde. Und kleine Leichen.
Hinter Altfelde musste sie absteigen, um sich neben Falla warmzulaufen. Steif vor Kälte stolperte sie über den verharschten Schnee, als sie ein Puppengesicht im schneeverwehten Graben sah, eine winzige Gestalt in einem weißen Tuch, das der Wind oder ein Tier weggezupft hatte. Von nun an achtete sie nicht mehr auf das, was neben ihrem Weg lag.
Die Gegenwart war der nächste Schritt, die Zukunft der nächste Tag.
Alles andere versuchte sie zu vergessen: die Wagen, mit denen schon vor Monaten Jechows Gemälde und Möbel, die Porzellansammlung und die kostbarsten Bände aus der Bibliothek abtransportiert worden waren. Mamas Augen beim Abschied. Papas Bitte, sie möge sich ihren Weg nach Westen abseits vom Treck suchen. Sie wusste, was er dachte und nicht gesagt hatte: Es erhöhte die Chance, dass einer der Jechows überlebte.
Manchmal dachte sie zaghaft an Gregor. Und manchmal schwebte ihr Blanckenburg vor Augen, wie ein Luftschloss, heiter und hell.
Erst nach mehr als zwölf Stunden machte sie Pause. In dem verlassenen Hof hatten Soldaten Quartier gemacht. Es gab Futter und Wasser für Falla, dünnen Kaffee, Brot und ein Lager im Stroh. Sie war kaum eingeschlafen, als sie wieder hochschreckte. „Weg!“ brüllte ein junger Soldat in den Stall hinein. Im Schein der Laterne leuchtete sein Gesicht, die Wangen gerötet, die Augen weit aufgerissen. Er war so jung. Jünger als sie, jünger als Gregor. „Wir sprengen die Brücke über die Nogat!“ Wieder zog sie auf Falla neben dem Flüchtlingsstrom her, voller Hoffnung und voller Angst, dem Treck der Eigenen zu begegnen.
Hinter Dirschau verließ sie den Treck und schlug den Weg nach Schöneck ein. Ein ausgemergelter Jagdhund lief eine Weile hinter ihr her, ohne einen Laut von sich zu geben. In Gladau schlossen sich ihr zwei vermummte Gestalten auf erschöpften Pferden an. Man nickte einander zu. Sie sah müde Augen unter schneeverkrusteten Brauen.
Mathilde fühlte sich wie ausgeschnitten aus der Welt, die sie gekannt hatte. Die Stimmen, Gerüche und Farben waren immer flüchtiger geworden und hatten sich irgendwo auf der Strecke aus ihrem Gedächtnis gelöst. Ihr Kopf war leer. Manchmal spielte die Erinnerung ihr Gedichtzeilen zu, „Er stand auf seines Daches Zinnen“ oder „Die Kraniche des Ibikus.“ Alberne Abzählreime. Kinderlieder. Eine Zeile schwebte immer wieder an und begann sich schließlich einzunisten: „Aber weiter und weiter schlepp ich mich fort, von Tag zu Tag, von Mond zu Mond, von Jahr zu Jahr...“
Im Forsthaus von Ribaken machten sie Rast. Mathilde nahm ihre Umgebung erst wieder wahr, als jemand Brot und heiße Suppe vor sie stellte. Und jetzt erst spürte sie den Hunger. Sie begann gierig zu löffeln.
Die Gaststube des Forsthauses war überfüllt; kein Gesicht sah vertraut aus. Die Wärme und das Essen und die vielen menschlichen Stimmen lullten sie ein, sie wäre auf der Stelle eingeschlafen, wenn nicht die Schmerzen in ihren halberfrorenen Händen gewesen wären. Und die neuesten Nachrichten: Elbing war bereits am 23. Januar von den Russen eingenommen worden. Seither war das nördliche Ostpreußen vom Westen abgeschlossen. Sie war den Eroberern nur wenige Stunden voraus. „Sie kreisen uns ein. Sie sind hinter uns. Sie kommen von der Seite“, sagte ein älterer Mann mit bebender Stimme.
Noch in der Nacht brach sie wieder auf. Einer ihrer stummen Begleiter half beim Nachschärfen der Stolleneisen für Falla. Der Mann hatte die Abzeichen von seiner Wehrmachtsuniform gerissen. Als er ihren Blick sah, sagte er: „Der Krieg ist schon seit letztem Sommer aus. In Berlin hat das nur noch niemand mitgekriegt.“ Sie zog die Sattelgurte fest. „Wehe den Besiegten“, murmelte der Mann.
Wenn es Folkert und seinen Freunden gelungen wäre, den Größten Feldherrn aller Zeiten umzubringen, letztes Jahr, im Sommer – wäre sie dann auch hier, in dieser eisigen Nacht?
Falla wirkte zum ersten Mal müde. Sie schien das rechte Vorderbein zu schonen. Mathilde murmelte Liebkosungen und kämpfte gegen die Angst an, die ihr in die Kehle stieg. Wer beten könnte.
Sie erreichten Gut Jannewitz in der Dämmerung. Man hatte die letzten Schweine geschlachtet, die ausgeweideten Kadaver hingen an einem Balken im Hof. In der Wohnstube stand die Luft, es roch nach ungewaschenen Menschen und feuchten Kleidern. Ein ganzer Treck war hier gestrandet – Soldaten hatten Straßensperren errichtet, um Truppen der Wehrmacht ungehindert durchleiten zu können.
Alles in Mathilde wollte weiter. Aber das Pferd brauchte eine Pause – und sie auch. Nur langsam drangen Menschen und Stimmen und Gerüche zu ihr durch: Die alte Dame, die ihr einen zweiten Teller Suppe gebracht hatte und jetzt auf dem Sofa saß und Strümpfe strickte, neben einem müden Mann im Wehrmachtsmantel, der den rechten Arm in der Schlinge trug. Das Mädchen mit den viel zu großen Augen. Das Kind, das den Suppenlöffel nicht halten konnte. Mathilde schob den Teller von sich, wollte aufstehen. Sie musste schluchzend zusammengebrochen sein. Es war ihr peinlich, als sie merkte, dass ihr Kopf an der Brust ihres Nachbarn lag.
Als die Sperre aufgehoben wurde, brach Mathilde mit den anderen auf. Es hatte in der Nacht geregnet auf den gefrorenen Boden, Straßen und Wege waren spiegelglatt. Sie sah fassungslos zu, wie einer der eisenbereiften Wagen vor ihr im Zeitlupentempo von der Straße rutschte und im Straßengraben landete. Pferde strauchelten und stürzten, Menschen schrien und weinten. Die Welt war verrückt geworden
Ob noch Brücken über die Oder führten? Ob Schloss Blanckenburg noch stand? Ob Gregor an sie dachte?
Sie hatten es sich versprochen, damals, als man die Zeichen schon lesen konnte: sie und die beiden Brüder Hartenfels, Folkert und Gregor, Söhne von Tante Betty, der
Lieblingskusine ihrer Mutter. Es war wie ein feierlicher Schwur gewesen: Was immer passiert – wir sehen uns wieder in Blanckenburg. Aber Folkert war tot. Und Gregor? Zum ersten Mal, seit sie sich von Jechow verabschiedet hatte, verließ sie der Mut. Sie glaubte nicht mehr daran, dass sie ankommen würde. Dass der Winter je zu Ende ginge, dass der Kanonendonner einmal aufhören würde, dass sich die Kälte wieder zurückziehen könnte aus den Knochen, aus den Muskeln, aus dem Gedärm. Aus der Seele.
In Bassenthin erzählte man, dass die Russen auf Köslin und Schlawe vorrückten; das lag nicht weit hinter ihr. In Pommern flüchtete noch niemand, es sei verboten, sagte eine Frau und lachte verächtlich. Mathilde zog mit den anderen Richtung Oder, zur Autobahnbrücke.
Die Straße war überfüllt und spiegelglatt. Mathilde musste immer wieder absteigen, weil sie so müde war, dass sie befürchtete, aus dem Sattel zu rutschen – und um Falla zu schonen. Die Nacht schien kein Ende zu nehmen.
Weit vor der Brücke begann das Chaos. Soldaten versuchten, den Verkehr zu regeln, um die Flüchtlinge schneller überholen zu können. Mal sollten die Trecks rechts, mal links, mal in der Mitte fahren. Als vier andere Reiter umdrehten und ihr zuriefen, sie wollten zur nächsten Oderbrücke weiter südlich reiten, schloss Mathilde sich an. Eine Weile hielt sie das Tempo der anderen durch. Dann fiel sie zurück.
2
Ankunft in Blanckenburg, fast sechzig Jahre später
Ein Bahnhof war wie der andere.
Katalina Cavic setzte Koffer und Taschen ab und zog sich den Kragen ihrer gefütterten Lederjacke enger um den Hals. Über den Platz vor Blanckenburg-Bahnhof strich ein eisiger Luftzug. Die wenigen Menschen, die an diesem frischen Apriltag zu sehen waren, hatten den Kopf gesenkt und stemmten sich gegen den Wind.
Es war ihr mittlerweile egal, wo sie ankam – und was sie hinterließ, wenn sie wieder ging: Eine heruntergewirtschaftete Wohnung, ein paar Bücherkisten, ein altes Auto. Manchmal auch einen Mann. Warum Blanckenburg? Warum nicht. Das letzte Mal war es Kerken gewesen und davor Bramsche und davor ...
Sie schob die Hände in die Jackentaschen und zog die Schultern hoch. Irgendwann kam die Zeit, da würde sie auch Blanckenburg wieder den Rücken kehren. Heimat ist, wo es Arbeit gibt. Der Rest ist Erinnerung.
Sie blickte auf die Uhr. Er kam zu spät.
Als sie wieder aufsah, glaubte sie sich in einer anderen Welt.
Zwei schwarze Pferde vor einer offenen Kutsche galoppierten mit wehenden Mähnen auf den Platz. Das passte weder zum Wetter noch zu diesem trübsinnigen Vorort. Das Friesengespann stob an ihr vorbei, trommelnde Hufe, geblähte Nüstern, rollende Augen. Der Mann auf dem Kutschbock hatte sich halb aufgerichtet, rief den Pferden etwas zu und zerrte an den Zügeln. Vergeblich.
Katalina hielt ihr Gesicht in den Wind und hätte fast gelacht. Ja, es gab zu tun. Blanckenburg hatte eine Verabredung mit ihr. Sie würde das Städtchen schneller kennenlernen, als seine Einwohner ahnten und es ihr lieb war: den Mann, der seine Pferde nicht im Griff hatte. Und all die anderen, deren Hunde und Meerschweinchen,
Katzen und Zierfische Koliken oder Flöhe hatten. Das war der Gang der Dinge. Ein Beichtvater war nichts gegen einen Tierarzt, diese natürliche Vertrauensperson aller Menschen mit Tieren, insbesondere der älteren und einsamen. Und ein Tierarzt war nichts gegen eine Tierärztin.
Manchmal machte sie das traurig. Manchmal brachte es sie zum Lachen. Und manchmal sorgte es dafür, dass sie wieder ging.
Immer auf der Flucht, dachte Katalina.
Das Friesengespann hatte eine Runde um den Platz gedreht und kam jetzt zurück. Das Fell der Pferde glänzte, der Kötenbehang, die Fellstulpen um die Fesseln, und die unbeschnittenen Mähnen waren sauber gekämmt. Rotes Ledergeschirr, schwarze Kutsche – man hatte offenbar Geld und Geschmack. Als das Gespann vor ihr zu stehen kam, griff Katalina dem nervöseren der beiden Tiere ins Zaumzeug und murmelte „Polako, Polako.“ Der Gaul reagierte, als ob er flüssig im Bosnischen wäre.
„Ich weiß nicht, was mit ihr los ist“, sagte der Mann in Reitstiefeln und grüner Cordhose, der von der Kutsche sprang und ihr mit ausgestreckter Hand entgegenging. „Alex Kemper. Sind Sie – ?“
Das also war der Mann, der ihr beim letzten Telefongespräch versprochen hatte, sie abzuholen. Er schaute fragend. Was hatte er erwartet? Eine blonde Fee? Sie ließ die Hand in der Jackentasche.
Verlegen lächelte er. „Sie müssen Katalina Cavic sein.“
„Und Sie sind der Herr von Schloss Blanckenburg?“ Ihre Handbewegung umfasste Wagen und Gespann.
Kemper verzog den Mund und lachte dann doch. „Ein Herr, der noch nicht einmal seine Pferde im Griff hat?“ Er tätschelte den Hals des Wallachs, der ruhig dastand, während die Stute noch immer dampfend atmete. „Das hier ist Woodstock und die nervöse Dame heißt Daphne.“
Kemper verstaute das Gepäck und half Katalina mit übertriebener Galanterie in den Wagen. Kaum saß er selbst, gingen die Pferde los, als stünde der Große Preis von Niedersachen auf dem Spiel. Die wenigen Zuschauer tuschelten und grinsten.
„Langsam!“ Der Mann hielt die Zügel viel zu kurz. Sie hätte sie ihm am liebsten aus der Hand genommen. Aber nach einer Weile fielen die Tiere von selbst in einen lockeren Trab und nach wenigen Minuten hatten sie den tristen Vorort mit dem Bahnhof verlassen. Katalina lehnte sich aufatmend zurück und ließ den Blick über die Landschaft gleiten. Rostrote aufgebrochene Erde auf den Äckern. Dazwischen graugrüne Wiesen und verkrautetes Brachland, ein Tannenwäldchen in der Ferne, am Bachlauf verwehtes Gehölz.
Kemper entspannte sich langsam. „Eigentlich wollte ich bei Ihnen Eindruck schinden“, sagte er. „Aber Friesen können zickig sein.“
Das Ende der Verbindungsstraße kam in Sicht. Vor ihnen lag Blanckenburg-Stadt, genau da, wo das flache Land sich zu erheben begann und gemächlich dem höchsten Punkt des tannendunklen Gebirges zustrebte. Über dem Städtchen sah man das Schloss thronen. Blanckenburg schien sich zu ducken unter seinem gewaltigen Wahrzeichen. „Renaissance-Schloss seit dem 16. Jahrhundert, ab 1705 barock umgebaut. Die Burganlage selbst stammt aus dem 12. Jahrhundert“, sagte Kemper.
Autos und Menschen strömten ihnen entgegen, während die Pferde die Hauptstraße entlang zogen. Die Stute ging im Gleichklang mit dem Wallach, ihre prächtigen Hinterteile wogten, die Köpfe mit den spitzen Ohren nickten, ab und an schnaufte eines der beiden Tiere. Nur Kemper wirkte verkrampft, er grüßte niemanden, obwohl man ihm zuwinkte und ihnen hinterhersah.
Dafür lächelte Katalina in die Menschenmenge, als ob sie ihre Untertanen segnete. Es waren ihre künftigen Kunden, die Frau im Regenmantel, deren geschorener Pudel ein bunt gemustertes Deckchen trug, der Jugendliche in Schlabberhosen, der sich von einem
energiegeladenen Malamud über die Straße ziehen ließ – und die Frau vor dem Schaufester einer Buchhandlung. Zum vornehmen Grau des edlen Weimaraners, der neben ihr stand, trug sie ein bodenlanges dunkelrotes Gewand und einen auffallend breitkrempigen Hut.
In diesem Moment stieß Daphne ein markerschütterndes Wiehern aus und sprang vorwärts. Woodstock, überrumpelt, hielt nicht lange dagegen und schloss sich dem wilden Galopp an. Die Kutsche schlingerte über die Straße, fast wäre das Gespann mit einem entgegenkommenden Kleintransporter zusammengeprallt.
Alex Kemper brüllte und zerrte an den Zügeln. Diesmal nahm Katalina sie ihm aus der Hand. Sie spürte fast im selben Moment, wie sie Kontakt aufnahm mit den beiden kraftvollen Kreaturen vor ihr, wie über eine Nabelschnur. Daphne schüttelte noch einmal schnaubend den Kopf, Schaumfetzen flogen nach rechts und nach links. Dann wurde sie ruhiger und schließlich fielen beide Pferde wieder ins Schrittempo.
Katalina atmete tief auf. „Was um Himmelswillen ist los mit den Gäulen?“ „Ich hatte gehofft, Sie könnten mir das erklären.“ Kemper klang resigniert. „Es kommt aus heiterem Himmel.“
Sie bogen von der Hauptstraße ab, in eine kopfsteingepflasterte Gasse. Es ging bergauf. Über ihnen hing das Schloss wie ein graues Felsennest. Das Gespann zog einen weiten Bogen um den Schlossberg, bis sie durch einen steinernen Torbogen in den Innenhof einfuhren.
Das Geräusch der Pferdehufe hallte von den beiden langgestreckten Seitentrakten des Gebäudes wieder. Sie musste die Zügel unwillkürlich angezogen haben, denn die Pferde schritten wie in einem Trauerzug auf die Schlossruine zu.
Das von Ferne so imposante Gebäude sah aus der Nähe wenig einladend aus. Die Uhr am Turm des Schlosses schien schon lange auf halb sechs zu stehen. Die steinernen
Figuren auf den Simsen rechts und links davon wirkten grau und gebrechlich. Türen hingen schief in den Angeln oder waren mit roten Klinkern zugemauert.
„Der alte Kasten ist nicht bewohnbar.“ Besitzerstolz merkte man Kemper nicht an. „Wir wohnen standesgemäß nebenan, im Traiteurshaus, da hauste früher der Koch.“ Er half ihr vom Bock. „Sehen Sie sich ruhig um. Aber Sie sollten nicht allein hineingehen. In den oberen Stockwerken kann man für nichts mehr garantieren.“
Der einstmals ockerfarbene Putz hatte sich in dicken Placken von der Fassade des vierflügligen Baus gelöst. In den Regenrinnen wuchs Unkraut. Einige Scheiben der tiefgezogenen Fenster waren zerschlagen, andere mit Pappe zugeklebt. Katalina versuchte einen Blick durchs Fenster. Hier musste eine Kapelle gewesen sein. Die Stuckverzierungen an der Decke des Kreuzgewölbes waren größtenteils abgefallen und lagen in weißen Brocken auf dem Boden.
Durch die Fenster zum nächsten Saal konnte man noch Reste von prächtigen Deckengemälden und Wandmalereien erkennen. Die Kachelöfen, das Parkett, die Wände schienen Opfer von jugendlichen Vandalen, Hausschwamm und kaputten Regenrinnen geworden zu sein. Katalina zog fröstelnd die Schultern hoch.
Der durchdringende Schrei hinter ihr ließ sie zusammenzucken. Die erbitterte Klage eines frustrierten Schlossgeistes? Katalina drehte sich um. Ein Pfauenpärchen schritt heran. Es passte zu der verkommenen Pracht mindestens so gut wie das Pferdegespann mit den schwarzen Friesen.
Sie atmete tief durch. Der Turmflügel wirkte nicht ganz so verwahrlost wie die beiden Seitenflügel. Im ersten Stock waren die Fenster noch intakt, im zweiten mit Holzplanken vernagelt oder mit Plastikfolie geflickt. Der Anblick des Verfalls löste ein Gefühl in ihr aus, das sie nicht gleich entschlüsseln konnte. Sie legte den Kopf in den Nacken und sah hinauf zum Turm, um den ein Schwarm Krähen kreiste. Genau. Das alles war ihr vertraut. Es erinnerte sie. An Kälte, Feuchtigkeit, Hunger, Verfall. An das
graue Bauernhaus, durch dessen Fenster und Türen der Wind blies. An das blakende Herdfeuer in der Küche. An die Großeltern. An Gavro.
Es erinnerte an zu Hause.
Zu Hause ist da, wo es Arbeit gibt, wies eine strenge innere Stimme sie zurecht, die wie Großmutter klang, wenn sie zu lange in der Bibel gelesen hatte. Nun, an Arbeit mangelte es in Blanckenburg sicher nicht: Sie hatte die örtliche Tierarztpraxis übernommen, in einem Fachwerkhaus in der Altstadt, das renoviert werden musste. Bis alles fertig war, durfte sie im Kutscherhaus des Schlosses wohnen, das hoffentlich in nicht ganz so trostlosem Zustand war wie das herrschaftliche Anwesen selbst. Sie musste möglichst bald verlässliche Handwerker auftreiben und sich um ein neues Auto kümmern. Schließlich wollte sie nicht auch noch ihre Freizeit in diesem Ruinenstilleben verbringen.
Katalina schlenderte zurück zum Traiteurshaus, einem kompakten Bau, der vor der Schlossmauer lag und bewohnbar wirkte. Eine schrille Stimme schallte ihr entgegen. Sie schaute hinauf zum ersten Stock. Eine Frau mit einem dunklen, strengen Pagenschnitt um das runde Gesicht lehnte aus einem der Fenster und rief wieder etwas, das Katalina nicht verstand. Es klang wie ein empörtes „Nein“ auf bayrisch.
„Ich suche Noa, meine nichtsnutzige Tochter“, sagte die Frau, als sie schließlich hinunterblickte und Katalina sah. „Sie sind die neue Tierärztin, stimmt’s?“
Katalina nickte.
„Hat Alex Sie hier stehengelassen? Wo ist Ihr Gepäck? Wie war die Fahrt? Sprechen Sie überhaupt deutsch? Frieren Sie nicht?“
Katalina musste nicht antworten, denn die Frau hatte ihren Kopf noch vor dem letzten Fragezeichen zurückgezogen. Minuten später öffnete sich die Haustür.
Katalina würde sich immer an diesen Augenblick erinnern, in dem sie Alma Franken zum ersten Mal begegnete: Alma sah aus wie eine russische Mamotschka, es fehlte nur
das Kopftuch. Sie war klein, rund wie ein Kegel und trug einen bodenlangen, schweren Faltenrock, ähnlich solchen, die alte Frauen in jenen Gegenden tragen, in denen man an Kirchweih noch Tracht anlegt. Das stark geschminkte Gesicht und die auffälligen Schmuckstücke um Hals und Handgelenke passten nicht zu dem biederen Gewand. „Kommen Sie rein in unsere malerische Residenz.“
In Flur war es düster; es roch nach Essen. Alma öffnete die Tür zu einer Art Wohnküche. Der Raum war überheizt, im Backofen brutzelte irgend etwas und unter dem Fenster bullerte ein schwarzer Kanonenofen. Eine Frau saß auf einem durchgesessenen Sofa und starrte konzentriert auf einen Laptop. Zu ihren Füßen räkelte sich eine riesige schwarze Dogge. Das Tier hob den Kopf, schien sich nicht entscheiden zu können, ob es gähnen oder knurren sollte, und ließ ihn wieder fallen.
„Das ist Frau Dr. – “
„Cavic“, sagte Katalina. „Praktische Tierärztin. Ohne Doktor.“
„Also die neue Veterinärin“, sagte der hagere Mann, der beim Herd gestanden hatte und sich nun neben die Frau auf dem Sofa setzte. „Willkommen auf Schloss Blanckenburg.“ „Die unhöflichen Herrschaften auf dem Sofa sind übrigens Sophie Franken und Peer Gundson“, sagte Alma und wandte den beiden den Rücken zu. „Meine jüngste Schwester und ihr – Lebensgefährte.“ Die Frau mit dem Laptop hob den Kopf, sah blicklos in Katalinas Richtung, nickte und senkte den Kopf wieder. Peer Gundson hob eine Hand und winkte matt.
„Es fehlt noch Erin, das ist die mittlere von uns dreien. Verheiratet mit Alex.“
Nanu, dachte Katalina. Kemper sah nicht nach Ehemann aus.
„Und meine Tochter Noa. Wo ist der Satansbraten?“
Alle guckten zur Tür. Aber es war Alex Kemper, der einen Schwall kühler Luft, ihre Arzttasche und einen mürrischen Gesichtsausdruck in die stickige Küche brachte.
„Es stinkt“, sagte er. „Kann es bei uns nicht dieses eine Mal, wenn wir schon mal einen Gast haben, etwas kultivierter zugehen?“ Er ließ die Tasche fallen.
Die Frau mit dem Laptop klappte ihr Gerät zu und blickte kurzsichtig in die Runde. Alma begann geräuschvoll den Tisch zu decken. Und Katalina wünschte sich weit fort. Dennoch folgte sie der unausgesprochenen Einladung, sie hatte Hunger. Alle setzten sich – bis auf Sophie Franken, die nervös abwinkte. Kemper schob seinen Teller schon nach den ersten Bissen von sich.
„Geht’s uns so schlecht, liebe Alma, dass wir diesen Schweinefraß hier essen müssen?“ „Du weißt, wie es uns geht“, sagte Alma mit leidender Miene. „Gut, dass uns Frau Cavic demnächst allmonatlich ihre Miete vorbeibringen wird. Dann können wir uns deinen vorzüglichen Geschmack vielleicht wieder leisten.“
Peer Gundson, der bei Kempers Bemerkung aufgestanden und hinausgegangen war, kam zurück mit einer Flasche in der Hand. Verlegen lächelnd sah er Katalina an und goss ihr, als sie nickte, ein.
Alex prostete ihr zu. Im Unterschied zu den anderen hatte sie mit Appetit gegessen. „Als Tierärztin scheint man einen guten Stoffwechsel zu haben“, sagte er mit Blick auf ihren Teller. Sie sah auf. Alle schienen auf ihren Teller zu starren. Katalina starrte zurück. Ich weiß, was Hunger ist, dachte sie und hob das Glas.
Der Rotwein schmeckte schwer und würzig und ließ sie an gefüllte Heuschober und an ihre Großmutter denken, wie sie mitten im heißesten Sommer in der Küche stand und Marmelade aus schwarzen Johannisbeeren einkochte.
„Solange wir noch was im Keller haben“, sagte Alex und prostete in die Runde. „Und wer weiß – vielleicht werden ja doch noch alle Wünsche wahr.“
Alma nahm einen Schluck und stellte das Glas dann wieder ab. Sie hatte die schwarzen Augenbrauen zusammengezogen und blickte in die Runde. „Sollten wir nicht doch –
nach anderen Möglichkeiten Ausschau halten? Ich meine – das Projekt mit dem Golfhotel war vielleicht übertrieben, aber – “
„Es ist vor allem gescheitert, liebe Alma“, sagte Peer Gundson.
„Ich finde, wir sollten Geduld haben“, sagte Sophie, die noch immer neben dem leise schnarchenden Hund saß. Ihre Stimme zitterte vor Nervosität.
„Aber das eine schließt doch das andere nicht aus! Ich meine, bevor wir das Schloss weiter verfallen lassen müssen... Viel Zeit ist nicht mehr!“
„Diesen Sommer hält es noch durch!“ Alex Kemper klang bestimmt, aber Katalina war der kurze Seitenblick hin zu ihr nicht entgangen.
„Ich habe darüber nachgedacht, ob wir nicht besser – “
„Heute nicht, Alma. Unser Gast interessiert sich nicht für unsere Sorgen.“
Katalina senkte den Kopf, damit niemand sie lächeln sah. Familie ist doch was Schönes, vor allem, wenn man sie nicht hat, dachte sie.
Ein kluger Gedanke – nur schade, dass er wehtat.
Nach einer Weile löste der Wein die Anspannung, unter der die Schlossbewohner zu stehen schienen. Schlossbewohner? Das Schloss war eine Ruine, seine Besitzer wohnten im Dienstbotenhaus und schienen auch noch auf das bisschen Miete angewiesen zu sein, die sie ihnen zahlte. Zugleich hielt man sich ein kostspieliges Pferdegespann. Seltsam. „Lachen Sie nur über uns.“ Alma lehnte sich zu ihr hinüber, die Stimme verschwörerisch gesenkt. „So ist das in Familien. Abgesehen davon, dass es bei uns nicht die drei Schwestern sind, die sich zanken, sondern unsere Männer.“
„Aber was denn! Peer ist die Bescheidenheit und Zurückhaltung in Person.“ Alex grinste spöttisch. „Und im übrigen bin ich sicher, dass Katalina das alles brennend interessiert.“
Ersatzweise begannen nun alle, sie auszufragen. Verheiratet? Nein. Kinder? Keine. Haustiere? Nicht mehr. Noch nicht. Als irgendwann die Küchentür aufging, schaute
keiner hin. Eine zarte, unauffällige Person, die vom Alter her nur Erin sein konnte, schlüpfte auf den freien Stuhl neben Gundson. Alma bemerkte sie als erste und schien sie fragend anzusehen. Erin hob die Schultern und ließ sie wieder fallen und schüttelte dann leicht den Kopf. Alma seufzte, räumte die Teller zusammen und stand auf.
Katalina verabschiedete sich, sobald es die Höflichkeit zuließ. Als sie, von Alex begleitet, hinausging, hob die Dogge den Kopf. Was für ein schönes Tier, dachte sie noch und sah erstaunt, wie sich der Blick des großen Hundes verschleierte und ihm der Kopf wieder auf die Pfoten sank.
Kemper trug ihr das Gepäck zum Kutscherhaus. Er atmete wie sie tief durch, als sie durch die kühle Nachtluft gingen. „Wir sind – eigentlich ganz normal, Katalina“, sagte er nach einer Weile.
Erwartete er eine Antwort?