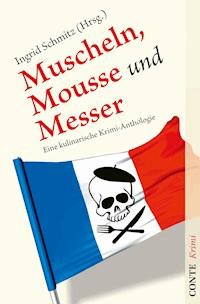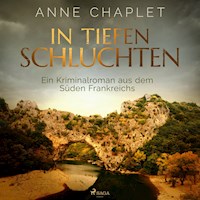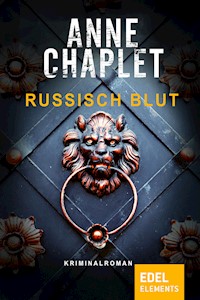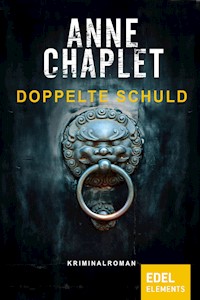4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Krimi
- Serie: Stark & Bremer
- Sprache: Deutsch
Der dritte Fall für Stark und Bremer: "Das ist hohe Krimikunst, und nur wenige beherrschen sie hierzulande so gut wie Anne Chaplet." (Tagesspiegel) Ein Bundestagsabgeordneter stürzt unter mysteriösen Umständen von einem Frankfurter Kirchturm. Staatsanwältin Karen Stark glaubt nicht an Selbstmord und beginnt zu ermitteln. Biobäuerin Anne Burau rückt als Abgeordnete im Parlament nach. Auch sie findet Hinweise darauf, dass ihr Vorgänger zu Lebzeiten bestimmten Wahrheiten zu nahe kam – ebenso wie ein spurlos verschwundener Journalist... "Anne Chaplet schreibt virtuos: dicht, mit ironischen Wendungen und einem unerbittlichen Scharfblick für Milieus ... Ein Glücksfall für die deutsche Kriminalliteratur." (SPIEGEL)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 420
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
"Das ist hohe Krimikunst, und nur wenige beherrschen sie hierzulande so gut wie Anne Chaplet." (Tagesspiegel)
Ein Bundestagsabgeordneter stürzt unter mysteriösen Umständen von einem Frankfurter Kirchturm. Staatsanwältin Karen Stark glaubt nicht an Selbstmord und beginnt zu ermitteln. Biobäuerin Anne Burau rückt als Abgeordnete im Parlament nach. Auch sie findet Hinweise darauf, dass ihr Vorgänger zu Lebzeiten bestimmten Wahrheiten zu nahe kam – ebenso wie ein spurlos verschwundener Journalist...
"Anne Chaplet schreibt virtuos: dicht, mit ironischen Wendungen und einem unerbittlichen Scharfblick für Milieus ... Ein Glücksfall für die deutsche Kriminalliteratur." (SPIEGEL)
Anne Chaplet
Nichts als die Wahrheit
Der dritte Fall für Stark & Bremer
Edel Elements
Edel Elements Ein Verlag der Edel Germany GmbH
© 2015 Edel Germany GmbH Neumühlen 17, 22763 Hamburg
www.edel.com
Copyright © 2000 by Anne Chaplet
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Michael Meller Literary Agency GmbH, München.
Covergestaltung: Anke Koopmann, Designomicon
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-95530-672-4
www.instagram.com
www.facebook.com
www.edelelements.de
Trauriger Sonntag, dein Abend ist nicht mehr weit
Mit schwarzen Schatten teil ich meine Einsamkeit.
Er liebte die Wahrheit mehr als das Leben.
Das Leben hatte ein Einsehen.
Das Wahrscheinliche muß nicht wahr,
das Wahre nicht wahrscheinlich sein.
Inhalt
Erster Fall
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Zweiter Fall
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Dritter Fall
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Vierter Fall
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Dank
ERSTER FALL
1
Frankfurt am Main, 13. August
Sie nahmen zu fünft Kurs auf ihn. Er spürte den Lufthauch an seiner Wange, als die Bande von Mauerseglern an ihm vorbeipfiff. Man hätte meinen können, die kleinen Viecher veranstalteten eine Mutprobe.
Tom Berger schüttelte den Kopf und lief weiter, ohne sich aus dem Tritt bringen zu lassen. Die Vögel spielten verrückt heute morgen – alle Vögel. Völlig ohne den üblichen Lärm, fast geräuschlos hatte sich vorhin ein ganzer Schwarm von Spatzen aus dem Gebüsch in der Parkanlage erhoben und war wie eine Rauchwolke vor die Morgenröte gestiegen. Am Mainufer hatten ihn zwei Amseln begleitet – sie waren neben ihm hergeflogen, hockten sich auf die Lehne einer Bank oder auf den Papierkorbhalter, warteten, bis er nachkam, und flogen ihm wieder voran. Als er auf den Holbeinsteg zutrabte, erhoben sich mit lautem Flügelschlagen drei Schwäne aus dem Main, kreisten einmal über seinem Kopf und flogen dann fort Richtung Süden. Berger blinzelte in den Himmel und wischte sich mit dem Handrücken den Schweiß von der Stirn.
Er las die Zeichen.
Alles war Zeichen. Die Vögel. Die Schatten der Platanen. Das halbe Fragezeichen, das ein Kondensstreifen am blaßblauen Himmel beschrieb. Die Krümmung des Stegs über den Main. Die Spuren im frisch geharkten Uferweg. Er lächelte, während er die Treppenstufen hinauflief. Auf dem Steg blies ihm der Morgenwind entgegen. Leichtfüßig wich er der Plastiktüte aus, die der Wind über die Brücke trieb.
Auch auf der anderen Uferseite sah man keine Menschenseele. Es war noch immer früh, kaum jemand war unterwegs. Vorhin hatte er eine Stadtstreicherin mit Hund in einem Papierkorb wühlen sehen – und vom gegenüberliegenden Ufer her hatte ein anderer einsamer Jogger zu ihm herübergewunken. Der Augustmorgen war frisch und unverbraucht, erst in zwei Stunden würden Sommerhitze und Auspuffgase die Luft dick und das Atmen schwer machen.
Wieder schrillte ein Geschwader von Mauerseglern an ihm vorbei. Alles ist Zeichen, dachte Tom. Die Welt sprach zu ihm, und das Schöne daran war: Er konnte sich aussuchen, was sie ihm jeweils sagen wollte. Tief fliegende Mauersegler bedeuteten gute Nachrichten. Vielleicht stieg der Dax. Vielleicht überlegte Sibylle es sich doch noch anders. Als er den Eisernen Steg erreichte, die zweite Fußgängerbrücke über den Main, beschloß er, den Börsenindex heute mit sechzig Zählern im Plus schließen zu lassen.
Ein Morgen voller Bedeutung. Er sah auf die Uhr, während er vom Mainkai aus den Weg zum Römerberg nahm. Seine Schritte hallten durch die Fahrtorgasse. Der Himmel war voller Zeichen. Man mußte sie nur lesen können.
Er hatte den großen Platz – rechts die Fachwerkhäuser, dahinter der Dom, vorn die Justitia am Gerechtigkeitsbrunnen – bereits überquert, als er das Kreischen hinter sich hörte. Elstern, dachte er. Die Vögel spielten wirklich verrückt heute. Ihre häßlichen Stimmen schimpften im Chor, sie wollten gar nicht aufhören, sich zu beschweren. Während er schon über die Braubachstraße lief, drehte er sich um und blickte zurück. Die schwarzweißen Vögel kreisten um den Glockenturm der Alten Nikolaikirche, stiegen auf, flatterten herab und schienen sich maßlos aufzuregen über irgend etwas. Tom Berger glaubte einen Schatten zu sehen oben im Turm, hinter der Brüstung, dort, wo der Laufgang sein mußte, auf dem zur Weihnachtszeit die Turmbläser standen.
Der Schatten wurde größer. Berger blieb stehen. Der Schatten füllte den Raum aus da oben, zwischen den zwei Pfeilern. Die Elstern schrien. Der Schatten schien sich zu heben, sich von seinem Hintergrund zu lösen, stand einen Moment lang vor dem blauen Himmel und schwebte, nein, fiel im Sturzflug nach unten. Das Klingeln der Straßenbahn holte Berger zurück in die Realität: Er stand mitten auf dem Zebrastreifen. Ohne zu zögern lief er zurück, dorthin, wo der Schatten aufgekommen sein mußte. Die Elstern zeterten noch immer über seinem Kopf.
Der Mann lag auf dem Pflaster, auf dem Rücken; das linke Bein in einem unnatürlichen Winkel unter dem rechten, die Arme ausgebreitet. Berger registrierte den eleganten schiefergrauen Anzug mit Weste, die anthrazitfarbenen Wildlederschuhe, den gepflegten graumelierten Bart und die halbgeöffneten Augen. Tot. Der Mann ist tot, dachte er, kniete sich neben ihn und fühlte ihm den Puls. Plötzlich war ihm kalt in seinem naßgeschwitzten Trikot. Nichts, kein Flattern, kein Lebenszeichen. Er tastete nach der Halsschlagader, legte sein Ohr an den Brustkorb des Mannes. Tot, dachte er. Mausetot.
Tom Berger ging in die Hocke. Was machte man in einem solchen Fall? Beten? »Ruhe in Frieden«, murmelte er. Mehr fiel ihm nicht ein. Sollte er ihm nicht wenigstens die Augen schließen? Er zögerte. Der Tote sah entspannt, ja friedlich aus. Berger legte ihm die Zeigefinger auf die Augenlider und zog sie mit sanftem Druck zu. Je länger er den Mann betrachtete, desto bekannter kam er ihm vor.
Die Elstern über ihm kreischten. Er blickte zu ihnen hoch. Dann fiel es ihm wieder ein. Er hatte das Gesicht auf Parteiplakaten gesehen. Und nach gewonnener Wahl im Fernsehen, entspannt und strahlend über den Erfolg. Der Mann war Politiker, Bundestagsabgeordneter. Warum sprang so einer vom Kirchturm? Aus den üblichen Gründen?
Tom Berger klopfte die Seitentaschen seiner Jogginghose ab, auf der Suche nach dem Telefon. Er las schon seit Jahren keine Zeitung mehr – höchstens das »Handelsblatt« und immer nur den Wirtschaftsteil. Politik war kein gutes Omen. Gab es womöglich einen neuen Skandal, von dem er noch gar nichts mitbekommen hatte?
Dabei lag der Mann ganz harmlos da – wenn man von der Blutlache unter seinem Kopf absah, die langsam größer wurde. Berger wählte die 110. Vielleicht hatte er sich aus Liebe hinabgestürzt? Tom spürte, wie die Sehnsucht nach Sibylle kleine scharfe Krallen nach ihm ausstreckte. Liebe tut weh, dachte er. Liebe kann einem das Herz zerreißen.
In der Ferne erklang ein Martinshorn.
Später fragte ihn der Mann von der Polizei, ob er etwas gehört hätte – einen Schrei, einen Hilferuf – oder etwas gesehen. Berger schüttelte den Kopf. Er hatte keinen Schrei gehört – nur das Kreischen der Elstern. Das war ein Zeichen gewesen, ganz ohne Zweifel. Ein Zeichen von großer Bedeutung.
2
Rhön, Weiherhof, einen Monat später
»Politiker lügen immer!«
Die schärfsten Kritiker der Elche, ersatzweise ihre Ehefrauen... Anne Burau lächelte gefaßt zur Schmalseite des Nebentischs hinüber, wo Monika Seidlitz saß und auf den alten Hubert einredete. Die Frau des Ortsvorstehers hielt ihre schmalen Schultern im hellblauen Pullover so, daß niemandem entgehen konnte, wen sie meinte – niemandem außer dem schwerhörigen alten Mann, der milde lächelte und mit dem Kopf wackelte. Das tat er immer, wenn er gar nichts verstand.
Sicher hoffte die Seidlitz darauf, daß Anne ihr empört widersprach. Keine Chance, dachte Anne, drehte ihr den Rücken zu und versuchte alles auszublenden, außer den melancholischen Klängen, in die das Trio Woronetz russische Volkslieder verwandelte. Der rotwangige Bassist mit dem blonden Stoppelhaar lächelte zu ihr hinüber und flocht ein paar jazzige Arabesken unter die traurige Weise. Anne neigte den Kopf und lächelte zurück. Als sich die Stimme der Geige im Schlußakkord jubelnd über das Akkordeon und den Zupfbaß erhob, heulte der Terrier von Meiers leidenschaftlich mit. Guter Hund.
Es roch nach Holzfeuer und gegrilltem Lammfleisch. Plötzlich rückte das Stimmengewirr um sie herum in die Ferne, als ob jemand am Lautstärkeregler gedreht hätte. Und dann fühlte sie sich schweben: Über ihren Nachbarn, über dem Weiherhof, über dem Abschiedsfest, das man ihr gab, so, als ob sie nach Australien auswanderte und nicht bloß nach Berlin ginge. Von hier oben sah ihr bisheriges Leben, sahen die Menschen, die es bevölkerten, wie Miniaturen aus – hübsch, farbenfroh, friedlich, harmlos. So unwirklich wie Paul Bremers leuchtend weiße Haare und die roten Wangen des Bassisten. So bilderbuchgemäß wie die geblümte Kittelschürze, die heranschwebte, innehielt, zurückschwebte und haltmachte. Dann senkte sich das Gesicht der Metzgersfrau aus Ebersgrund vor Annes Gesichtsfeld und füllte es aus, so groß und so nah, daß sie die Sommersprossen darin hätte zählen können.
»Gell, du freust dich?« fragte Herta. Das hatte sie in der letzten halben Stunde schon dreimal gefragt, nicht gezählt die Male, in denen Anne nicht zugehört hatte. Eine Antwort erwartete sie auch diesmal nicht, denn es gab nur eine – glaubte Herta.
Anne setzte sich auf. Im Moment empfand sie gar nichts – weder Freude noch ihr Gegenteil. Sie blinzelte in den Himmel, der blaßblau über der Krone der alten Kastanie stand, öffnete die Jacke und fuhr sich mit den Fingern durch die Haare. Sie hatte nicht gemerkt, daß der Wind die Wolkendecke zerstreut hatte. Sie hatte den Kuckuck nicht wahrgenommen, der schon seit einer Weile zu rufen schien. Wie lange schon? Und wie oft? Früher hatte davon das Leben abgehangen. Früher verriet der Kuckuck seinen Zuhörern, wie viele Jahre ihnen noch blieben oder wie bald man dem Märchenprinzen begegnete. Als Kind und später als junges Mädchen war sie bei jedem Kuckucksschrei stehengeblieben und hatte gezählt und sich vorsichtshalber schon mal eine Ausrede zurechtgelegt für den Fall, daß er nur zwei- oder dreimal schlug, was fürs Leben zuwenig und für die Ankunft des Märchenprinzen zuviel gewesen wäre. Damals hatte sie aufs ewige Leben und auf die große Liebe gesetzt. Anne seufzte. Der Abschied von solchen Illusionen lag schon eine Weile zurück.
»Iß! Damit du was auf die Rippen kriegst!« Herta hielt ihr einen bis zum Rand gefüllten Teller vor die Nase. Anne blickte auf. Wie eine Mutter lächelte die Ältere zu ihr hinunter. »Oder willst du die einzige sein, die bei so einem schönen Fest leer ausgeht?«
Herta meinte es gut, wie immer. Anne grinste zurück. Mit einem Mal fühlte sie sich nicht mehr wie im Kino, als unbeteiligte Zuschauerin, sondern war mitten drin im Film, alles in Farbe, volle Lautstärke. Um sie herum klapperten Messer und Gabeln, redeten Männer und Frauen aufeinander ein, wurden große Krüge über den Tisch gereicht, tobten Kinder, drehten dienstbare Geister die Grill-spieße, heulte der Hund, jubelte die Geige, begleitet vom aufgeregten Geschnatter und Trompeten der Enten und Gänse, die, ein paar Schritte vom Hof entfernt, auf der Wiese am Löschteich grasten. Und das alles sollte sie verlassen? Anne kam sich plötzlich zugleich fahnenflüchtig und unentbehrlich vor. Was war, wenn Rena...? Und hatte sie ihr eigentlich schon gesagt...? Und würde ihre Tochter von allein daran denken...?
Sie schlug sich die Hand vor den Mund und guckte zu Rena hinüber, die mit erhobenen Händen auf den Tierarzt einredete. Otto Grün hielt den Kopf gesenkt und schüttelte ihn ab und an bedächtig. Anne konnte sich denken, worum es ging. Der Veterinär hatte schon vor drei Wochen gesagt, daß der alte Pjotr es nicht mehr lange machen würde. Es wäre besser, man erlöste ihn von seinen Qualen. »Aber er quält sich doch gar nicht!« hatte Rena damals mit Tränen in den Augen gesagt – sie war mit dem gescheckten Wallach aufgewachsen. »Weiß man’s?« hatte Otto erwidert.
Rena hat den Hof fest im Griff, redete Anne Burau sich ein, auch wenn sie erst achtzehn ist. Außerdem war sie nicht allein. Da war Krysztof. Und Ivanka. Und Otto Grün, für den Notfall. Anne wurde nicht mehr gebraucht. »Wir haben schließlich schon öfter auf dich verzichtet!« hatte Rena gestern wegwerfend gesagt – mit jener Herzlosigkeit, die bei Menschen ihres Alters als guter Ton galt.
Der kräftige Schlag auf die Schulter traf sie unerwartet. Sie schrie leise auf. »Na? Kannst’ schon jetzt nichts mehr vertragen, du Strich in der Landschaft?« dröhnte Martins Stimme zu ihr herunter. »In drei Monaten kriegst’ wahrscheinlich keine halbe Sau mehr gehoben! Und wennst’ nix ißt...« Seine Hände zeichneten eine übertrieben schlanke Silhouette in die Luft. Alle an ihrem Tisch lachten.
»Aktenstemmen als Ausgleichssport!« rief einer am Nebentisch.
»Hammelsprung! Damit verschaffen sich deutsche Abgeordnete Bewegung!«
Anne lächelte matt. Wie sich Politikerwitze doch gleichen. Unwillkürlich inspizierte sie ihre Hände. Wahrscheinlich hatte Martin recht. Schon bald würde ihnen niemand mehr ansehen, daß sie einer Bäuerin gehörten. In kürzester Frist würden sich ihre Beine wieder an höhere Absätze gewöhnt haben. Und mit der Zeit...
Sie atmete tief durch. Bei aller Wehmut über den Abschied – plötzlich schien es ihr nicht mehr unmöglich, das neue Leben zu genießen. Ein Leben ohne Gummistiefel und Stallgeruch und ohne das ewige Dilemma der Landfrau – nämlich, daß es sich eigentlich nicht lohnte, was Schönes anzuziehen, weil man sich sowieso gleich wieder einsaute. Ein Leben, in dem Kostüm und kurzer Rock, Strumpfhosen und Make-up und Parfüm, nicht zu vergessen die Aktentasche, so lebenswichtige Requisiten waren wie hier die Leggins, die Birkenstocksandalen und das Gummiband für die Haare.
»Und? Bist du noch hier oder schon dort?« Paul Bremer stand neben ihr, mit einer steilen Falte über der Nase. Sie rutschte auf der harten Bank ein Stück zur Seite, um ihm Platz zu machen.
»Du weißt doch, Paul – ich bin immer an zwei Stellen gleichzeitig.« Sie versuchte es mit einem unbefangenen Lächeln. »Mindestens.« Er setzte sich nicht. Die alte Leichtigkeit zwischen ihnen schien verflogen.
Trotzig sagte sie sich, daß es ihr egal sein konnte, was Paul Bremer davon hielt, daß sie es noch einmal versuchen wollte mit der politischen Karriere. Und daß es ihr wurscht war, daß er ihre Entscheidung als Flucht auffaßte. Passenderweise drehte er ihr in diesem Moment den Rücken zu, um Marianne zu begrüßen, die ihm wie zufällig den Ellenbogen in die Seite gestoßen hatte und jetzt irgend etwas von ihm wollte. Wenigstens mußte Marianne jetzt nicht mehr eifersüchtig sein.
Anne drehte sich wieder zum Tisch hin und gabelte ohne großen Appetit ein Stück Fleisch vom Teller. »Warum?« hatte Paul sie damals gefragt, mit einer Enttäuschung in der Stimme, die ihr kindisch vorgekommen war. Wohl deshalb hatte sie heftiger reagiert, als nötig gewesen wäre.
»Weil ich nicht völlig verbauern will, verdammt!«
»So wie ich, meinst du? »
Sie hätte es wissen müssen, daß er sich stellvertretend für alle landflüchtigen Städter angegriffen fühlen würde. Sie hatte einzulenken versucht. »Ich will mir später nicht den Vorwurf machen müssen, Herausforderungen aus dem Weg gegangen zu sein.«
Sein Blick sprach Bände. »Herausforderungen, aha. Ich empfehle diesbezüglich auch Verlautbarung oder Beschlußfassung oder Zielführung. Und ›Ich würde meinen‹ oder ›Ich gehe davon aus‹.«
»Ach komm, Paul. So schlimm ist es nun auch wieder nicht.« Sie hatte ihn beschwichtigen wollen – es war ihr wichtig erschienen, daß er verstand. »Und außerdem ist Politik mein alter Beruf.«
»Aber du lebst seit acht Jahren hier. In der Rhön. Auf dem Weiherhof.« Er klang, als ob das gefälligst auch so zu bleiben hätte.
»Du verstehst nicht, Paul. Ich habe mir dieses Leben hier nicht ausgesucht...« Dieses Leben hier: als Biobäuerin in der tiefsten Rhön. Davon hatte sie in ihrem früheren Leben noch nicht einmal geträumt. Sie hatte sich als künftige Staatssekretärin gesehen, auf Landesebene – als Ministerin gar, wenn sie sich mal ganz vermessen fühlte. Politik – das war ihr Leben gewesen. Bis – die Erinnerung daran löste noch heute das altbekannte Ziehen in der Magengrube aus. Anne legte die Gabel zurück auf den Teller.
Von Paul hatte sie mehr Verständnis erwartet. »Wenn mein Mann mich nicht verraten und verkauft hätte, wäre ich nie auf dem Weiherhof gelandet. Das weißt du, Paul.« Und du weißt auch, wie ungeheuer weh die Entdeckung getan hat, daß Leo ein verdienter IM bei der Stasi war, hatte sie in Gedanken hinzugefügt.
Sie hatten sich seither weniger häufig gesehen – im aufreibenden Wahlkampf war dafür auch kein Platz gewesen. Und womöglich hätte ihm gar nicht gefallen, was ihr, wie alle bestätigten, anzusehen war: Sie hatte jeden Tag der Kampagne schamlos genossen, als ob es die vergangenen acht Jahre nicht gegeben hätte. Erst am Tag der Wahl hatte sie die Ahnung zugelassen, daß es mit der Rückkehr in ihre alte Welt doch nicht so einfach werden könnte. Als die ersten Hochrechnungen auf die Bildschirme kamen, war sie deshalb nicht weiter überrascht gewesen.
Sie sah sich an der Säule am Rande des großen Saals in Bonn stehen, allein. Menschenmassen drängten sich um sie herum und an ihr vorbei. Die Luft war zum Schneiden, erhitzt von der Wärme all der Leiber und von den Lampen, die die Szene taghell erleuchteten. Es roch nach Männerparfüm und dem, was heiße Scheinwerfer aus Luft machen, wenn sie sie lange genug erhitzt haben. Die Masse der Bildjournalisten war mit klackenden Verschlüssen und leisem Surren der hochgerüsteten Nikons und Leicas dem Kandidaten hinterhergehechelt, der, wie die ersten Hochrechnungen nahelegten, wohl der künftige Vizekanzler sein würde. Für Annes Rang auf der Landesliste hatte das Ergebnis nicht ausgereicht. Sie erinnerte sich noch gut an ihre gemischten Gefühle damals. War sie nicht eigentlich sogar mehr erleichtert als enttäuscht gewesen?
Anne schob die Schultern nach vorn und zog sich die Jacke enger um den Körper. Die Sonne war wieder hinter einer Wolke verschwunden. Ihre Augen suchten Paul Bremer, der die Linke in die Hosentasche gesteckt hatte, nervös auf den Zehenspitzen wippte und sich mit der Hand durch das kurze weiße Haar fuhr, während Marianne auf ihn einredete. Manchmal verstand sie wirklich nicht, warum sie hier weg wollte. Und warum sie sich nicht in vernünftige Männer verliebte. In so einen wie ihn. In einen gutaussehenden, intelligenten, verläßlichen Mann.
Andererseits – konnte man Paul wirklich vernünftig nennen? Anne verzog das Gesicht. Verglichen mit Peter Zettel – vielleicht. Peter. Einer der Fehlgriffe ihres Lebens.
Am Abend der Bundestagswahl war sie ihm zum ersten Mal begegnet. Sie hatte damals unwillig weggeguckt, als sie merkte, daß er sie beobachtete. Immerhin hatte sie noch gesehen, daß er einen dieser kleinen Spiralblöcke in der Hand hielt, die Journalisten in Bonn benutzten, die auf sich hielten. Anne mochte Journalisten nicht sonderlich. Jedenfalls nicht die von der hungrigen Sorte, die vom Aufdecken ungeheuerlicher Skandale träumten und vom Pulitzerpreis — oder von seinem deutschen Gegenstück, wie immer das hieß.
Erregte Männerstimmen rissen sie aus ihren Gedanken. Anne war plötzlich hellwach. Vor der Scheune standen sich zwei Männer wie wütende Bullen gegenüber, die Fäuste geballt.
»Krysztof!« Daß es ihre Aufgabe war, für Ruhe und Frieden zu sorgen, war eine Gewohnheit, die sich nicht so schnell abstellen ließ, wie ihre Tochter vielleicht wünschte. Und den Streit, den sie dort drüben kommen sah, wollte sie um fast jeden Preis vermeiden.
Der polnische Feldarbeiter hatte sich breitbeinig und mit gesenktem Kopf vor Sergej aufgebaut, dem Bruder von Ivanka, einem jungen Russen aus der Siedlung. Es war nicht das erste Mal, daß die beiden sich stritten. Über Politik, worüber sonst. Über die Vergangenheit und den Kommunismus und die NATO und die Zukunft. Als ob es nichts Näherliegendes gäbe, worüber sich zwei ehemalige Bewohner des untergegangenen Ostblocks nach dem Ende von über vierzig Jahren erzwungener Völkerfreundschaft zu streiten hätten...
»Laß mal, Mama!« Rena hielt ihr abwehrend die erhobene Hand entgegen und ging mit geradem Rücken auf die Streithähne zu. Anne ließ sich wieder sinken. Sie hatte hier nichts mehr zu sagen. Daran mußte sie sich langsam gewöhnen.
Sie hatte eine andere Zukunft. Und daß der Gedanke daran sie nicht so fröhlich stimmte, wie sie gern wäre, hing nicht eben wenig mit Peter Zettel zusammen. Irgendwann hatte er damals neben ihr gestanden, sich wie sie mit einer Schulter an die Säule gelehnt und in die Menge gesehen. Die Fraktionssprecherin gab einem glatzköpfigen TV-Gesicht ein Interview und hatte ihre übliche professionelle Kühle gegen eine fast kindliche Freude ausgetauscht – jedenfalls schien sie auf den Fußspitzen zu federn und wischte sich alle naselang imaginäre Haarsträhnen aus dem Gesicht. Für viele ihrer Parteifreunde gingen heute abend Lebensträume in Erfüllung. Für Anne nicht – was eigentlich, bildete sie sich heute wie damals ein, fast gar nichts machte. Sie hatte frühzeitig darauf geachtet, daß die Träume, die sie sich erlaubte, nicht zu viel Platz einnahmen.
»Enttäuscht?« Sie hatte geglaubt, ein kleines ironisches Lächeln in seiner Stimme zu hören, und sich unwirsch zu ihm hingedreht, um ein paar Dinge klarzustellen.
»Ich meine – Sie haben verdammt hart gearbeitet dafür, oder?«
Nicht mehr, als sich gehört, hatte sie antworten wollen. Und daß die bisherigen Hochrechnungen auf ein recht ordentliches Ergebnis schließen ließen. Und daß das amtliche Endergebnis schließlich noch nicht feststehe. Und daß, im großen und ganzen gesehen, der Weg das Ziel sei – oder so ähnlich. Aber sie hatte nur mit den Schultern gezuckt. Was ging ihn das an?
»Ein paar tausend Stimmen mehr, und Sie wären drin gewesen.« Er ließ die Augen dem Pulk der Kameraleute und Pressefotografen folgen, die wieder hinter dem Kandidaten her waren, diesmal in die entgegengesetzte Richtung, zu einem weiteren der vielen improvisierten Fernsehstudios im Wandelgang außerhalb des Saals. Aber seine rechte Schulter berührte ihre linke. Und sie hatte es zugelassen.
»Sie hätten es verdient gehabt. Nach allem, was passiert ist.«
Was meinte er? Was wußte er? Sie erinnerte sich an das helle Mißtrauen, das damals in ihr emporgeflackert war.
»Die Partei hätte Ihnen einen besseren Listenplatz geben sollen.« Der Kerl ließ sich von seinem Thema nicht abbringen, obwohl ihm aufgefallen sein mußte, daß sie von ihm abgerückt war.
»Die Basis hat anders entschieden«, hatte sie sich kühl sagen hören.
»Die Basis?« Er hatte verächtlich geschnaubt.
»Und außerdem bin ich darüber gar nicht so unglücklich.« Warum glaubte sie eigentlich, sich dem Kerl gegenüber erklären zu müssen?
»Weil sonst womöglich alles wieder hochgekocht wäre? Die Vergangenheit? Der Verrat? Der Tod Ihres Mannes?«
Es hatte sich also herumgesprochen. »Und warum bohren Sie in alten Wunden? Journalistenneugier?« Sie mußte, trotz aller Wut, verletzt geklungen haben.
Er hatte erschrocken gewirkt, »Das wollte ich nicht!« gesagt und ihr die Hand auf den Unterarm gelegt, mit dieser intimen Geste, die gerade Mode war. Ihr war aufgefallen, wie lang und schmal seine Hand wirkte, Musikerfinger, hatte sie gedacht und ihm in die Augen gesehen. Braune Augen. Viel zu braune Augen.
»Ich hätte Sie gern erlebt im Bundestag.« Er guckte so treuherzig, daß sie ihm das fast geglaubt hätte. »Ich kenne den einen oder anderen in Ihrer Fraktion, auf den – oder die – ich gut verzichten könnte.« Die kannte sie auch. »Nur einer weniger, und Sie könnten nachrücken!« Sie mußte gegen ihren Willen lachen. Aus irgendeinem Grund gefiel er ihr plötzlich, der Schnösel mit den schönen Händen.
Und dann hatten sie das Für und Wider der anderen Kandidaten diskutiert. Ihr Protest war halbherzig gewesen, als er »Die kann weg!« rief, just in dem Moment, in dem Eva Seng mit hoch erhobenem Haupt vorbeischritt. Dabei hatte sie die Seng schon immer für eine hohle Semmel gehalten. Aber die Abgeordnete aus Fulda konnte auf Knopfdruck Gefühle zeigen – und das mochte die Basis. Annes Stärke war das nicht.
»Der kann weg!« hatte Peter Zettel auch noch bei zwei anderen künftigen Mandatsträgern aus Hessen gerufen. Von Alexander Bunge war, soweit sie sich erinnerte, nicht die Rede gewesen.
Als das letzte Kamerateam, der letzte Bildfotograf abgezogen und nur noch zwei ältere Herren übriggeblieben waren, die nicht mehr ganz nüchtern auf das jüngste und sehr weibliche Mitglied der künftigen Bundestagsfraktion ihrer Partei einredeten, hatte sie sich von ihm am Arm nehmen, aus dem Saal steuern und ein Taxi herbeiwinken lassen. Sie hatte noch heute sein Gesicht vor Augen, sein ernstes, plötzlich ungeheuer jung wirkendes Gesicht, wie er sich zu ihr hinunterbeugte und sie durch die offene Wagentür hindurch fragend ansah. Sie hatte weder gelächelt noch irgend etwas gesagt, nur die Spannung gespürt bis in die Zehenspitzen. Dann war die Wagentür zugefallen. Sie war aufatmend ins Polster gesunken, hatte den Kopf an die Kopfstütze gelehnt und die winzige Spur von Enttäuschung weggewischt. Erst als die Tür auf der anderen Seite des Wagens aufging und er sich neben sie gleiten ließ, gestand sie sich ein, daß es das war, was sie wollte.
Einen Mann – ganz einfach.
Alles war ihr wie selbstverständlich erschienen – daß er ihre Hand nahm und dem Taxifahrer eine Adresse im Süden Bonns nannte. Die ganze Fahrt über hatten sich ihre Hände und Finger berührt, gestreichelt, erregt. Erst in seinem Appartement hatten sie sich geküßt, gleich hinter der Wohnungstür, noch bevor sie zugefallen war.
Erschrocken legte Anne sich die Hand auf die Wange. Ihr war heiß geworden. Verlegen blickte sie auf. Linde Steinhauer stand vor ihr, hatte die muskulösen Arme in die Seite gestemmt und guckte sie herausfordernd an. »Frau Abgeordnete wirken aber sehr weit weg!«
»Mach dir keine Sorgen, ich hebe schon nicht ab!« Anne versuchte, der Parteifreundin zuzublinzeln, aber Linde dachte nicht daran zurückzulächeln. Was vielleicht verzeihlich war – sie war damals die Unterlegene gewesen beim Kampf um einen noch halbwegs aussichtsreichen Listenplatz. Warum Anne bei der entscheidenden Abstimmung mit einer knappen Mehrheit gesiegt hatte, war ihr bis heute ein Rätsel. Schließlich war niemand im Kreisverband begeistert gewesen über den Wunsch des Parteivorstands, einer ehemaligen Politikerin Asyl zu gewähren, die vor Jahren und auch noch in einem Bundesland im hohen Norden von einem Tag auf den anderen den ganzen Bettel hingeschmissen hatte und nun wieder einsteigen wollte. Hier, in der Rhön. In einem Landstrich, in dem man erst nach mindestens dreißig Jahren Anwesenheit die bloße Anwartschaft auf Dazugehörigkeit erwarb.
Anne rutschte auf der Bank in eine etwas bequemere Position und nahm einen tiefen Schluck direkt aus der Bierflasche. Diesen guten alten Brauch mußte sie sich wahrscheinlich auch abgewöhnen, in Berlin. In den besseren Kreisen, zu denen Volksvertreter aus irgendeinem Grund zählten. Wieder strich sie sich die Haare hinter das Ohr. Viel zu dünn, dachte sie – zu glatt, zu blond, zu schlicht für die Politszene in Berlin, für die Objektive der Foto- und Fernsehkameras und die kritischen Augen der Kolleginnen. Und eine modischere Brille könnte sie sich auch mal wieder leisten.
Der Wind hatte nachgelassen, die Fetzen blauen Himmels über der Kastanie schienen größer geworden zu sein. Plötzlich wünschte sie sich mit einem ziehenden Schmerz irgendwo da, wo sie das Herz vermutete, hierbleiben zu dürfen und sich nicht aussetzen zu müssen – dem Neuen und dem Alten... Der Vergangenheit und der Erinnerung an eine Szene, die sie am liebsten vergessen hätte – wenn ihr das nur gelingen würde.
Sie hatte sich damals spät in der Nacht – eigentlich war es schon früher Morgen gewesen – vor Peter Zettels Wohnungstür wiedergefunden, draußen, im dunklen Treppenhaus, die Schuhe in der Hand, der Rock verrutscht, mit von seinen Küssen schmerzenden Lippen. Auf der Flucht.
Sie hatte zehn Minuten laufen müssen, bis sie ein Taxi fand, das sie zu ihrem Hotel brachte. Bonn machte auch im fahlen Morgenlicht keinen besonders einladenden Eindruck. Und plötzlich hatte sie das Gefühl angefallen, nicht nur ihre Partei und die Wähler, sondern auch die Stadt hätten sie als unwürdig abgewiesen. »Wir brauchen dich hier nicht« las sie auf den abweisenden Fassaden des Hauses der Geschichte, in den dunklen Fenstern vom Museum König. Niemand brauchte, keiner wollte sie – auch nicht der Mann, vor dem sie soeben geflohen war.
Am nächsten Morgen starrte sie im Frühstücksraum des Hotels, in dem es nach gekochten Eiern und abgestandenem Zigarettenrauch roch, so lange in ihren Kaffee, bis er kalt geworden war und ölige Schlieren zog. Als Rena sie Stunden später im Bahnhof von Haslingen abholte, hätte sie vor Erleichterung fast geweint.
Sie hatte wochenlang damit zugebracht, sich den Film immer wieder vorzuspielen, um endlich zu begreifen, was geschehen war. Rena war erst verständnisvoll gewesen und dann immer ungeduldiger geworden, wenn Anne wieder einmal mitten in der Arbeit innehielt und in die Luft starrte. Einmal hätte sie sich fast den halben Daumen abgesäbelt, als sie beim Schneiden von Lammkoteletts mit der Knochensäge ins Tagträumen geraten war.
»Du bist Landwirtin, nicht Bundestagsabgeordnete!« Rena hatte hilflos und frustriert ausgesehen, die dunklen Augenbrauen zusammengezogen, der Mund ein schmaler Strich. »Dir gehört der Weiherhof, du bist Mitglied bei ›Bioland‹, deine Kälber und Schweine, deine Lämmer, Enten und Gänse sind gesund und glücklich, du hast eine Tochter, die dir den Reitstall führt, und wir verdienen genug für vier – solange du anpackst, statt verlorenen Chancen hinterher-zujammern!« Sie mußte ihre Tochter völlig fassungslos angesehen haben. Rena war nach einer Weile mit gesenktem Kopf auf sie zugekommen, hatte sie ungelenk umarmt und »Geh doch einfach mal wieder Reiten!« gesagt.
Ihre Tochter hatte geglaubt, sie trauere dem verpaßten Mandat hinterher. Anne schüttelte den Kopf. Rena wäre wahrscheinlich nicht für fünf Minuten auf die Idee gekommen, der sonst so kühlen Mutter gehe die Geschichte mit einem Mann nicht aus dem Kopf —besser gesagt: die Kränkung, die er ihr zugefügt hatte. Und die ewige Frage: Warum? Am Ende blieb ihr nur eine Erklärung – die aller-kränkendste von allen. Der Gedanke daran drückte ihr auch heute noch auf den Magen. War sie schon zu alt?
Als sie aufblickte, sah sie in die Augen Paul Bremers, der wieder diese steile Furche zwischen den Augenbrauen hatte. Wie lange er ihr wohl schon zusah? Und was hatte er gelesen in ihrem Gesicht?
»Komm, Paul, bitte! Du guckst mich an, als ob du um meine geistige Gesundheit fürchtest!« Sie griff in ihrer Verlegenheit wieder zur Bierflasche.
»Wenn du’s nicht selber gesagt hättest....«
»Danke der Nachfrage! Mir geht’s prima!«
Bremer ließ sich neben sie gleiten und zeichnete mit dem Finger Muster in die nassen Ringe, die Gläser und Krüge auf dem Tisch hinterlassen hatten.
»Es geht dir wohl sehr nahe, oder?«
Was zum Teufel meinte er?
»Ich meine: Schön, daß du jetzt doch noch in den Bundestag kommst. Mehr oder weniger jedenfalls. Aber daß dafür einer abtreten mußte...«
Sie mußte ihn für einen Moment ratlos angesehen haben. Dann hatte sie sich gefangen und nickte. Bremer dachte, im Unterschied zu ihr, ans Naheliegende.
»Und dann auch noch – so dramatisch...« Er guckte sie noch immer an. Sag doch was, Anne, dachte sie. Etwas Pietätvolles. Und möglichst nicht die kleine, schmutzige Wahrheit, daß du nicht an den armen Verblichenen, sondern an einen Mann gedacht hast, den du noch nicht einmal einen ehemaligen Liebhaber nennen darfst, denn bevor es dazu kommen konnte, hast du die Flucht ergriffen .. .
»Über die Motive gibt es wohl noch immer keine Klarheit.« Jetzt guckte Bremer so, als ob er sich wirklich Sorgen um ihren Geisteszustand machte.
Sie riß sich zusammen und nickte. »Es kommt selten vor, daß man ein Mandat antritt, weil einer gestorben ist. Normalerweise liegt die Lebenserwartung eines Abgeordneten gut über dem Landesdurchschnitt.«
»Wie hast du davon erfahren?«
»Per Telefon. Morgens um halb acht.« Ihr stand vor Augen, wie sie ausgesehen haben mußte, als das Telefon klingelte. Sie war aus dem Kühlhaus gekommen, ungeschminkt, in nicht mehr ganz sauberen Leggins und einem karierten Flanellhemd, die Haare im Nacken wie üblich zusammengezwirbelt, das Geschirrtuch in der Hand, mit dem sie sich die Hände abwischte, bevor sie den Hörer aufnahm. So stellte man sich ein potentielles Mitglied des Bundestags gemeinhin nicht vor.
»Der Mann hat sich einen Spaß draus gemacht. Erst höre ich ihn sagen: ›Sie sind Abgeordnete des Deutschen Bundestags‹.« Sie versuchte, die betuliche, sonore Stimme nachzuahmen. »Und dann: ›Hier ist der Bundeswahlleiter. Nehmen Sie die Wahl an?‹« Sie hatte »Wieso?« und »Warum?« gestottert. »›Der Abgeordnete einen Platz vor Ihnen auf der Landesliste ist unerwartet abgelebt ... ‹ – du hättest deine Freude an diesem feinsinnigen Sprachgebrauch gehabt.«
»Mehr nicht?«
»Mehr nicht.« Die Details hatte sie erst aus der Zeitung erfahren. Alexander Bunge war in Frankfurt vom Kirchturm gefallen – ob unbeabsichtigt oder freiwillig, wußte niemand, über letzte Worte oder einen Abschiedsbrief war nichts bekannt. Dennoch deutete alles auf Selbstmord hin. Das passende Motiv dafür lieferte die Geschichte, die eine Woche zuvor im »Journal« erschienen war, in der Zeitung, für die Peter Zettel arbeitete, der mit dem Bundestag von Bonn nach Berlin umgezogen war.
»Er soll sich Kinderpornographie reingezogen haben. Aus dem Internet.« Man sah Paul an, wie befremdlich er auch nur den Gedanken daran fand.
Anne nickte. So hatte es in der Zeitung gestanden – schwer vorstellbar, eigentlich. Der bärtige, drahtige Bunge mit dem Flair einer mittleren deutschen Führungskraft war ihr gar nicht als der Typ für so was erschienen. Aber was sah man Leuten schon an?
Anne öffnete die Jacke, unter der ihr warm geworden war, und streckte die Beine aus. »Ganz so hatte ich mir meinen Einzug in den Bundestag nicht vorgestellt. Außerdem« – sie beschrieb mit der Linken einen Bogen, der den Hof und ihre Nachbarn, der sogar Paul Bremer umfaßte. »Außerdem werde ich das alles hier vermissen.« Sie fürchtete einen Moment lang, daß er »Mich auch?« fragen würde. Statt dessen starrte er sie lange an, sagte »Trotzdem viel Glück«, stand auf und ging zum Nebentisch.
Anne ließ sich auf der Bank zusammensinken, so als ob sie sich unsichtbar machen wollte in der Menschenmenge um sie herum. Alexander Bunge war in den Parlamentsferien gestorben. Sie hatte deshalb zunächst niemanden erreicht, der ihr sagte, was sie zu tun hatte. Alle waren im Urlaub gewesen – in Umbrien. Oder in der Toskana. Oder in der Provence – was eben so angesagt war in ihrer Partei. Schließlich war sie allein nach Berlin gefahren, um ihren Bundestagsausweis abzuholen und sich für das Parlamentshandbuch fotografieren zu lassen. Die neuen Privilegien, samt Jahresnetzkarte für die Deutsche Bahn, wurden ihr wie ein Päckchen Kaugummi überreicht. Damals hatte sie kurz daran gedacht, den Versuch, in die Politik zurückzukehren, zum Irrtum zu erklären. Verunsichert und unzufrieden war sie wieder zurückgefahren, ohne sich mit einem ihrer alten Freunde und Bekannten in der Hauptstadt zu verabreden. Auch nicht mit Peter Zettel, obwohl sie kurz daran gedacht hatte.
Seit einigen Wochen telefonierten sie wieder miteinander. Erst war sie abweisend gewesen, und dann hatte sie unverbindlich-freundlich getan. Er sollte schließlich nicht glauben, daß er sie verletzt hatte – daß sie noch immer verletzt war. Er hingegen hatte sich fast überschlagen vor Herzlichkeit. »Wir werden uns bald wiedersehen, Anne« – Absenken der Stimme. Und dann, bedeutungsvoll: »Hier – in Berlin.« Bei ihrem letzten Telefongespräch hatte er sich angehört, als hätte er Bunge höchstpersönlich vom Kirchturm gestürzt, nur um ihr einen Gefallen zu tun und recht behalten zu haben. »Hab ich’s dir nicht gesagt?« Erschüttert hatte ihn das Schicksal Bunges jedenfalls nicht. »Wir sehen uns wieder!«
Sie hatte ihn längst wiedergesehen, Monate vorher, allerdings ohne daß er davon Kenntnis genommen hätte – zur ersten Sitzung des Bundestags im frisch renovierten alten Reichstag, in diesem von der Geschichte gebeutelten Gebäude, einst Symbol für das Scheitern der deutschen Demokratie.
Anne kannte das Gebäude noch als halbe Ruine, als schwärzlicher, nur notdürftig erhaltener Klotz nördlich vom Brandenburger Tor, jenem Tor, das in den langen Jahren des kalten Kriegs zum Symbol der deutschen Teilung geworden war. Seit sich der Bundestag nach der deutschen Wiedervereinigung für Berlin als Hauptstadt entschieden hatte, war der Reichstag aufwendig umgebaut und mit einer neuen Kuppel versehen worden.
Sie hatte sich auf eine Enttäuschung gefaßt gemacht. Wahrscheinlich war von dem alten Symbol nichts übriggeblieben unter all dem Beton und der neuen Funktionalität. Aber als sie vor der sauber gebürsteten Fassade stand, vor dem Schriftzug »Dem deutschen Volke«, war ihr seltsam feierlich zumute gewesen – und als dem Bundestagspräsidenten der Schlüssel übergeben wurde, hatte sie einen Kloß im Hals gehabt. So sentimental kannte sie sich gar nicht.
Auch innen begegnete das Neue dem Alten. Sie glaubte, unter all dem großzügig verarbeiteten Beton die Verletzungen noch sehen und spüren zu können, die dem Gebäude in seiner Geschichte zugefügt worden waren – und all den Menschen, die Teil der besseren deutschen Geschichte sind. Die Abgeordneten des Kaiserreichs, allen voran die der größten Oppositionspartei, der Sozialdemokratie. Die Abgeordneten der Weimarer Republik, von denen viel zu viele nicht begriffen hatten, welch fragiles Glück eine parlamentarische Demokratie war. Als Soldaten der Roten Armee nach dem Sieg 1945 triumphierend ihre Fahne auf das Dach des zerstörten Gebäudes setzten, das sie für ein Symbol Nazideutschlands hielten, waren sie einem Irrtum aufgesessen. Unter den Nazis tagte man hier nicht mehr.
Plötzlich war in ihr ein verwirrendes Glücksgefühl emporgestiegen: Die rührende Vorstellung, daß es doch noch gut werden könnte für und mit Deutschland, ja, daß womöglich gerade dieses gezeichnete Haus Versöhnung zustandebringen könnte – der erfolgreichen deutschen Nachkriegsdemokratie mit der düsteren Geschichte des Landes. Sie hatte sich von ihrer eigenen Sentimentalität überwältigen lassen. Das mußte sie durchlässig gemacht haben für andere Gefühle – und damit verletzlich für die Begegnung, mit der sie doch eigentlich hatte rechnen müssen.
»Schade, daß du nicht dabei bist«, hatte Emre Özbay gerade zu ihr gesagt, der Liebling der meisten Frauen und einiger Männer im Bundestag. Der Sohn türkischer Eltern aus Melle hatte in jenem Fragebogen, den nur Prominente zur Beantwortung vorgelegt bekommen, auf die Frage: »Wer oder was möchten Sie am liebsten sein?« mit dem politisch überaus unkorrekten Satz »Das Badewasser einer schönen Frau« geantwortet.
»Es gäbe da die eine oder andere der lieben Kolleginnen, auf die ich zu deinen Gunsten gern verzichtet hätte.« Emre hatte sie freundschaftlich um die Schulter gefaßt. Fast wäre sie ihm um den Hals gefallen.
Das wäre unzweifelhaft das beste gewesen, dachte Anne und hielt ihr Gesicht in den Sonnenstrahl, der durch die Krone der Kastanie zu ihr nach unten fiel. Dann hätte sie ihn nicht gesehen, wie er da stand, tief ins Gespräch vertieft. Sie mußte ihn angeglotzt haben wie ein frisch geborenes Kalb – und wäre fast mit der blöden Seng zusammengeprallt, so abrupt war sie stehengeblieben.
Anne schnaubte. Was hatte sie bloß hysterisch reagiert – auf einen völlig unwichtigen Kerl, der sie im übrigen gar nicht wahrnahm, so intensiv redete er auf seine Begleiterin ein, eine dunkeläugige, dunkelhaarige, sportlich wirkende Frau, an der alles ausladend war – der Mund und die Nase und die Tasche, die sie unter den Arm geklemmt trug. Nur ihre Brille war unproportioniert schmal. Oder war das gerade Mode in Berlin? Emre war ihren Blicken gefolgt.
»Kennst du Zettel, das Investigationsgenie vom ›Journal‹?« Sie hatte stumm genickt. »Die mit dem großen Mund neben ihm haben sie vom ›Magazin‹ abgeworben – für ein Spitzengehalt.« Emre streckte ihr die gespreizte rechte Hand und den Daumen der linken Hand entgegen und bewegte sie zweimal vor und zurück. Für eine sechsstellige Summe also, mit einer Zwei vorne dran. »Isolde Menzi. Das Sturmgewehr von Seite 3.« Das paßt ja wie die Faust aufs Auge, hatte Anne gedacht und sich weggedreht von den beiden.
Sie hätte sich die Mühe nicht machen brauchen. Sie war Luft gewesen für ihn. Auch beim Sektempfang nach der Eröffnungsveranstaltung sah er nicht ein einziges Mal zu ihr hin. Wenigstens einige der Journalisten und Politiker erkannten sie wieder – sie war noch nicht so vergessen, wie sie geglaubt hatte.
Nach zwei Gläsern Sekt und nachdem sie lange genug zugehört hatte, wie Emre und ein paar seiner Kollegen über ein Abstimmungsproblem verhandelten, das sie nicht verstand, löste sie sich aus der Versammlung und machte sich allein auf den Weg durch das Haus. Erst als sie oben auf der Terrasse stand, über der sich die neue Reichstagkuppel wölbte, konnte sie wieder durchatmen. Den Ausblick hatte sie noch heute vor Augen. Hinter dem Panorama von Kränen leuchteten Türme und Kuppeln in der Aprilsonne, über die ab und an dicke weiße Wolken segelten. Wie im Rausch hatte sie jedes Detail in sich aufgesogen – wie ein trockener Schwamm. Die Landfrau war eben doch noch immer ein Stadtmensch.
Erst nach und nach hatte sie wahrgenommen, daß neben und hinter ihr eine Gruppe von Männern stand, die einem weißhaarigen älteren Herrn zuhörten, der ihr bekannt vorkam.
»Sie sind wohl mit allen Baustellen der Berliner Republik vertraut!« sagte einer der Zuhörer. Die anderen lachten. Alle Baustellen? hatte sich Anne gefragt. Die neue alte Hauptstadt schien daraus zu bestehen – aus Baggergruben, Bauskeletten und entkernten Altbauten.
»Mit den meisten«, sagte der alte Herr und räusperte sich. »Und mit ihrer Vorgeschichte.«
Anne hatte die Ellenbogen auf die Balustrade gelegt und versucht, dem Blickwinkel zu folgen, den der ausgestreckte Arm des Mannes wies.
»Schauen Sie – wie klein das Brandenburger Tor von hier aus wirkt!« Wie Spielzeug leuchteten die Viktoria und der Streitwagen mit den vier Pferden, auf dem sie stand, zu ihnen herüber.
»Dahinter: der Pariser Platz. Und südlich davon – sehen Sie die lang geschwungene Reihe von Plattenbauten? Das ist die Wilhelmstraße.«
»Da hat der Teufel gewohnt«, sagte eine Stimme hinter Anne. Die Stimme ließ sie frösteln. Sie drehte sich nicht um.
Der Weißhaarige machte eine Pause. »Dort stand früher die alte Reichskanzlei.« Alle nickten. »Und im rechten Winkel dazu wurde die neue Reichskanzlei gebaut. Sehen Sie?« Anne sah nur Baukräne. »Von uns aus gesehen rechts davon lagen früher die sogenannten Ministergärten.« Wieder nickten alle. »Auf dem umzäunten Gelände vorn entsteht das Mahnmal für die ermordeten Juden Europas.«
»Und was erinnert an die Täter?« brummte der Mann hinter Anne halblaut.
»Und dahinter? Was war da?« Anne konnte von hier oben aus nicht erkennen, welches Areal die junge Frau meinte.
»Zu DDR-Zeiten stand dort die Mauer. Und der Todesstreifen.« »Und davor?«
Der alte Herr war erstarrt. Täuschte sich Anne? Oder hatte sich der Mann sogar bekreuzigt?
»Dort endete das ›Dritte Reich‹ in Blut und Flammen«, sagte die Stimme hinter ihr, fast tonlos jetzt.
Anne erinnerte sich an das Stimmengewirr um sie herum und daran, daß sie sich erst später zusammengereimt hatte, was der Mann hinter ihr gemeint haben könnte. Dort, in direkter Nachbarschaft zum künftigen Mahnmal, mußte der Garten der Reichskanzlei gewesen sein, in dem Soldaten der Roten Armee die halb verkohlten Leichen gefunden hatten – von Adolf Hitler und Eva Braun, die im Führerbunker nebenan Selbstmord begangen hatten.
Der Gedanke daran ließ sie schaudern. Sie wickelte sich fester in ihre Jacke. Die Bilder vom zertrümmerten Berlin, der Gedanke an den Schuß, mit dem der Verbrecher sein Leben beendet hatte – das alles stand ihr so lebhaft vor Augen, daß sie erschrocken aufschrie, als etwas auf ihrer rechten Schulter aufprallte, direkt neben dem Kragen ihrer Jacke. Ein Schuß? Ihre Hand faßte in etwas Warmes, Feuchtes. Dann verbreitete sich bestialischer Gestank – ein scharfer, beißender Geruch nach Ammoniak und etwas anderem, etwas Undefinierbarem und zugleich Vertrautem. Hastig sprang sie auf.
»Was ist los?« fragte erschrocken ihre Tischnachbarin. »Was...« Und dann begann Herta zu lachen.
Anne ignorierte Hertas Heiterkeitsanfall und schlüpfte mit zitternden Händen aus der Jacke. Über ihr rauschte es in der Kastanie. Dann flatterte eine große Elster davon, mit einem schlechtgelaunten »Krah!«.
Anne ließ sich auf die Bank zurücksinken und nahm die Serviette, die Paul Bremer ihr entgegenstreckte, um sich die Finger zu säubern und den restlichen Elsterschiß notdürftig von ihrer Jacke zu entfernen.
»Sei froh, daß du nach Berlin gehst«, sagte Monika Seidlitz mit gespieltem Mitleid.
»Dort scheißen dir höchstens die Tauben auf den Kopf«, fügte Paul hinzu. »Die sind kleiner.«
Gut, dachte Anne, wenn man Nachbarn hat.
3
Berlin
Becker klopfte mit dem Bleistift auf den Block, der vor ihm auf dem Konferenztisch lag. Er haßte die morgendlichen Sitzungen, zu denen alle zu spät kamen – außer ihm. »Des Rätsels Lösung ist: Du kommst einfach zu früh, Hansi«, hatte Jo Eyring kürzlich behauptet, ihm betont sanft die Hand auf die Schulter gelegt und unverschämt gegrinst dabei. So konnte man es auch sehen, wenn man unbedingt wollte.
Durch die geöffnete Tür hörte er Isolde reden. Sie telefonierte immer noch so, als ob die Segnungen der digitalen Revolution nicht existierten und sie Entfernung mit Lautstärke ausgleichen müsse. »Das kann jeder passieren«, trompetete sie gerade. »Das haben wir alle mal gemacht. Eine Abtreibung...« Die Person am anderen Ende der Verbindung schien einen Einspruch zu wagen. »Ach was! Du nimmst ein Taxi, Annalena, und nach einer halben Stunde ist alles vorbei!«
Becker krümmte sich auf seinem Stuhl, stellvertretend für Annalena, die offenbar noch immer nicht begriffen hatte, daß ihr Schicksal zum Fortsetzungsroman für die gesamte Redaktion geworden war. Das hatte vor etwa drei Monaten damit angefangen, daß Annalena über den lustlosen Sex mit ihrem Angetrauten geklagt haben mußte. »Probier’s mal mit einem anderen!« hatte Isolde ihr lautstark empfohlen. Daran mußte sich Annalena gehalten haben, denn in den Wochen danach nahm die halbe Redaktion am Liebestaumel der angeblich besten Freundin der angeblich besten Journalistin des Hauptstadtbüros teil.
Hans Becker verzog das Gesicht. Er für seinen Teil hätte auf eine solche Freundschaft längst verzichtet. Isolde Menzi schonte nichts und niemanden, zugegebenermaßen auch sich selbst nicht, aber meistens waren die anderen das Opfer. Wie die unglückselige Annalena, deren neue Liebschaft nicht ohne Folgen blieb. Sie war nach kürzester Zeit schwanger und ihren Ehemann los. »Heiratet er dich wenigstens?« hatte Isolde in scharfem Ton gefragt. Gemeint war der neue Liebhaber. Dem »Ach so!« und »Hmmmh!« und dem etwas tiefer intonierten »Also so ein Schwein!« hatten Becker und alle anderen entnehmen können, daß nein. Und nun mußte also auch die Leibesfrucht dran glauben.
Becker sah auf die Uhr und ließ den gelbschwarzen Faber Castell sanft und rhythmisch gegen das Wasserglas prallen. Isolde war erst seit kurzem beim »Journal« – eingekauft als knallharte Analytikerin und als beißwütiger Terrier, der keinen Fall losließ, den er mal gepackt hatte. Beides traf zu, das mußte er neidlos zugeben. Er nickte dem Kollegen Schiffer zu, der mit gerunzelter Stirn ebenfalls auf seine Uhr sah, bevor er sich an der gegenüberliegenden Seite des runden Tischs niederließ und in dem Packen von Bundestagsdrucksachen zu blättern begann, den er mitgebracht hatte. Isolde ließ sich von nichts und niemandem beeindrucken, roch jeden Skandal, kannte keine Rücksichten, war immer an vorderster Front.
Schade, daß wir gerade keine Front haben, dachte Becker. Denn in der Redaktion war sie eine ziemliche Nervensäge, die Kette rauchte, unermüdlich Kaffee kochte und andauernd telefonierte, mit einer Lautstärke, der man sich auch bei geschlossenen Türen nicht entziehen konnte. Ihre Neugier war unerschöpflich, ihre Präsenz übermächtig. Becker versuchte stets, den Abstand zu ihr möglichst groß zu halten. Ihm blieb die Spucke weg in ihrer Nähe. Alles an ihr war zu laut: Ihre Stimme. Ihre Kleidung. Ihr Lippenstift. Sie nahm ihm den Atem.
Er krauste die Nase in Erinnerung an ihren Geruch. Besonders schlimm war es, wenn sie frisch geduscht von ihrer täglichen Aerobicstunde kam, geradezu dampfend noch von der körperlichen Anstrengung. Einmal war sie strahlend und dynamisch ins Büro gekommen, hatte ihre Sporttasche fallen lassen und sich über den Schreibtisch gelehnt, ihm entgegen, wahrscheinlich nur, um ihm etwas zuzuflüstern. Es hatte ihm die Brillengläser beschlagen. In Panik hatte er seinen Stuhl nach hinten rollen lassen, »’tschuldigung« gemurmelt und war auf die Toilette geflohen. Ihr Parfüm – es mußte ihr Parfüm gewesen sein. Es hatte ihn plötzlich an das Mückenspray erinnert, mit dem seine Oma immer das Kinderschlafzimmer eingenebelt hatte – bevor alle Welt wußte, wie gefährlich das war.
Vielleicht war es auch... Hans strich mit der Fingerspitze über die lange weiße Narbe an seiner Schläfe und streckte die Beine von sich. Vor ein paar Wochen, als er wieder einmal versucht hatte, sich dünne zu machen in ihrer Gegenwart, hatte sie sich zu ihm umgedreht, ihm ins Gesicht geguckt und dann, ausnahmsweise einmal leise, gesagt: »Du hast Angst vor mir, Hansi.« Er hatte wie das Kaninchen im Angesicht der Schlange zurückgeguckt. Fast hätte er ergeben genickt. Aber dann hatte Gott sei Dank der Alte nach ihr gerufen.
»MENZI!« Becker zuckte zusammen. Sonnemann war ins Zimmer gekommen, schlechtester Laune, wenn man nach dem Klang seiner Stimme ging und der robusten Zielstrebigkeit, mit der er zu seinem Sessel ging. »Verdammtes Weib!« murmelte der Redaktionsleiter, ließ sich in den Sitz fallen und knallte den Stenoblock auf die Tischplatte.
»Wo ist Zettel?« Keiner sagte was. »Wieder nicht da. Bin ich denn hier unter lauter Idioten?« Auch das mußte man nicht kommentieren. Es gehörte zum morgendlichen Ritual. Ebenso wie der kalte Luftzug, der Isoldes Auftritt begleitete, denn sie pflegte im Vorübergehen stets demonstrativ ein Fenster aufzureißen – als rituellen Protest gegen das Rauchverbot während der Konferenzen. Heute trug sie zum eisblauen Blazer ein knallrotes Tuch, registrierte Hans, als Isolde mit dem gewohnten »Ratsch!« das Fenster hinter seinem Rücken öffnete.
»Guten Morgen!« sagte sie und zeigte die Zähne.
»Wird auch Zeit!« Sonnemann ließ sich zu keinen Höflichkeiten hinreißen. »Wo ist Zettel?«
Isolde guckte, als ob ihr das passende biblische Zitat vorübergehend entfallen wäre. »Soll ich meines Bruders Hüter sein?« murmelte Becker.
»Was?« brüllte Sonnemann.
Das heißt »Wie bitte«, dachte Becker und ließ sich noch ein paar Zentimeter tiefer in den Sessel sinken. Er hatte sich noch immer nicht an den Ton gewöhnt, der in das früher so beschauliche Berliner Büro eingezogen war, seit Sonnemann die Geschäfte führte. Sonnemann mit dem kahlen Schädel und dem Stiernacken und dem breiten Kreuz. Sonnemann, das Tier. Sonnemann, der Vater der Kompanie. Trotz seines rauhen Tons wußten in der Redaktion alle, was sie an ihm hatten. Im Ernstfall stand er eisern hinter ihnen – vor allem gegen »die da oben«, gegen die Chefredaktion im hohen Norden. Wirklich gefährlich wurde er erst, wenn er leise oder gar höflich wurde.
Hinter ihm ging die Tür auf. »Herr Sonnemann?« Die Sekretärin, Frau Novak, war die einzige hier, die der Büroleiter zu respektieren schien. Ihre kurzen schwarzen Haare waren graumeliert, und sie wirkte in ihrer dunkelgrauen Bügelfaltenhose mit der weißen Bluse und der gestreiften Weste »tipptopp«, wie Beckers Mutter sagen würde. Unwillkürlich mußte er beim Gedanken an den spitzen Mund grinsen, den seine Mutter immer gemacht hatte, wenn sie »tipptopp« oder »1a« oder »einwandfrei« sagte.