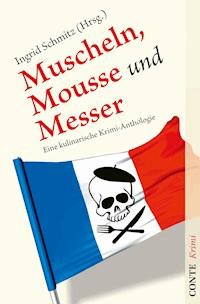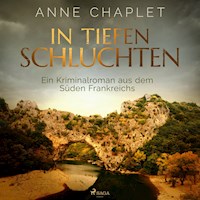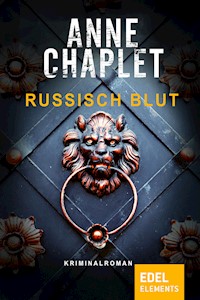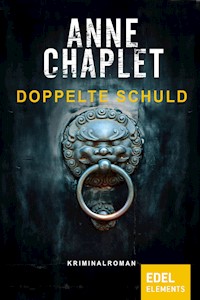8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Hauptkommissar Giorgio DeLange reist aus beruflichen Gründen nach Peru. Zurück in Frankfurt, wird er von Schlägern angegriffen. Drogen werden bei ihm gefunden.Seine Beförderung wird ausgesetzt. Dann wird seine Lebensgefährtin bedroht, Staatsanwältin Karen Stark. Wer will sein Leben zerstören? Und vor allem, warum? DeLange nimmt die Kampfansage an. Da stößt die Staatsanwältin auf eine Verbindung zwischen einer Mordserie in einem hessischen Dorf und der peruanischen Guerillabewegung Leuchtender Pfad. Und der Fall bekommt plötzlich eine ganz neue Wendung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Anne Chaplet
Kriminalroman
List
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden
List ist ein Verlagder Ullstein Buchverlage GmbH
ISBN: 978-3-8437-0203-4
© 2012 by Ullstein Buchverlage GmbH, BerlinAlle Rechte vorbehaltenS. 5: Roter Sand, Musik & Text: Richard Z. Kruspe, Paul Landers, Till Lindemann, Doktor Christian Lorenz, Oliver Riedel, Christoph Doom Schneider. Mit freundlicher Genehmigung.© Musik Edition Discoton GmbH (Universal Music Publishing Group)Satz und eBook: Pinkuin Satz und Datentechnik, Berlin
Roter Sand
Eine Liebe zwei Pistolen
Eine zielt mir ins Gesicht
Er sagt ich hätte dich gestohlen
Dass du mich liebst weiß er nicht
Roter Sand und zwei Pistolen
Eine stirbt im Pulverkuss
Die zweite soll ihr Ziel nicht schonen
Steckt jetzt tief in meiner Brust
Rammstein
PROLOG
KAPITEL 1
Peru, im Herbst
»Atahualpa ließ seinen Bruder Huáscar hinrichten und trank Blut aus seiner Hirnschale.« Die Fremdenführerin lächelte. Im gleichen Plauderton hatte sie über die Kunstfertigkeit der Inka beim Pfählen, Steinigen und Vierteilen berichtet, während ein scharfer Fallwind ihr einen weißen Herrenhut mit rotem Band vom Kopf zu blasen versuchte.
War das der sprichwörtliche Gleichmut der Inka, der aus ihr sprach? Oder waren ihr die eigenen Gruselgeschichten gleichgültig geworden? Giorgio DeLange fand, dass das irgendwie nicht passte zu der netten jungen Frau im bunten Rock der Peruanerinnen. Aber es passte zu den grauen Mauern von Machu Picchu, über denen der umwölkte Zuckerhut des Huayna Picchu thronte.
»Ja, wir sind besessen von Blut«, flüsterte eine Stimme hinter ihm.
DeLange drehte sich um.
»Nos bañamos en la sangre.« Das breite Gesicht mit der flachen Nase und den schwarzen Augen sah aus wie eine düstere Maske. »Wir baden in Blut.«
»Was ist los, amigo?«, fragte DeLange.
Tomás Rivas, sein peruanischer Kollege von der Policía de Investigaciones in Lima, schüttelte den Kopf, drehte sich um und stapfte davon. DeLange folgte. Die Fremdenführerin zählte mittlerweile gutgelaunt die Greueltaten der spanischen Eroberer auf, die sich den lokalen Gebräuchen gewachsen zeigten. Als sie bei ihrem Reisebus angelangt waren, griff Tomás in den Rucksack, den er neben dem Fahrersitz verstaut hatte, holte eine Flasche hervor und nahm einen tiefen Zug Pisco. Dann reichte er sie weiter an DeLange, der nicht ablehnen mochte. Vorsichtshalber trank er nur einen kleinen Schluck.
»Wir ersaufen in Blut.« Tomás forderte die Flasche mit herrischer Handbewegung zurück. »Weißt du, wie wir unsere Feste feiern?«
DeLange schüttelte den Kopf.
»So zum Beispiel: Man fängt einen Kondor und bindet ihn auf den Rücken eines Stieres. Wenn der Kondor den Stier zerfetzt, wird alles gut.«
DeLange hätte zu gern gewusst, wie die Indios es anstellten, einen Kondor zu fangen. Der Vogel hatte eine Spannweite von bis zu drei Metern.
»Und was macht ein Peruaner zum Fruchtbarkeitsfest? Liebe?« Tomás lachte verächtlich. »Wir schlagen uns gegenseitig ins Gesicht, bis es blutet. Und weißt du, warum?«
Diesmal vermied es DeLange, den Kopf zu schütteln. Es war entschieden zu früh am Tag für einen Pisco.
»Blut nährt die Erde. Glauben wir.« Tomás verzog das Gesicht. »Darum lassen wir es fließen. Zur Wintersonnenwende haben unsere Vorfahren Tausende von Lamas geschlachtet und ihr Blut auf den Felsen verteilt. Und als Höhepunkt Kinder geopfert.«
»Wie beruhigend, dass die Aufklärung mittlerweile auch in Peru gesiegt hat«, meinte DeLange trocken.
Tomás Rivas war etwa zwei Kopf kleiner als DeLange, aber sein Zorn machte ihn drei Kopf größer. »Glaubst du das, Jo? Glaubst du das wirklich?«
Der zuckte mit den Schultern.
»Und ich sage dir: Die apokalyptischen Reiter sind unterwegs«, zischte Tomás. »Aber diesmal zu Fuß.«
Nach und nach trudelte der Rest der Reisegruppe ein, und die Fahrt nach Ayacucho konnte weitergehen. Die meisten Passagiere waren Indios, die man allerdings nicht so nennen durfte, sonst verdarb man es sich mit Tomás, der Quechua war. »Und stolz darauf.« Die paar Touristen kamen aus den Niederlanden oder Deutschland. Zu DeLanges Trupp gehörten, neben Tomás Rivas, eine Frau und zwei Männer, Kollegen aus der Abteilung für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Polizeipräsidium Frankfurt, alle bester Laune. Und alle innerhalb weniger Stunden still und leidend. Doch keiner war so sterbenskrank wie Kriminalhauptkommissar Giorgio DeLange, der schon nach wenigen Stunden glaubte, diesen Höllentrip nie und nimmer zu überleben.
Der Fahrer und die Einheimischen aber waren in bester Verfassung. Die – und die Reiseführerin.
»Unsere nächste Station ist die alte Inkahauptstadt Cusco. Cusco liegt 1000 Meter höher als Machu Picchu, also auf 3400 Metern«, flötete sie. »Auf dem Weg dahin erreichen wir eine Passhöhe von 4200 Metern.«
Der Busfahrer nahm sich die Botschaft zu Herzen und gab Stoff. Auf schmalen Sandpisten arbeitete sich der Bus hinauf und schrubbte mit kreischenden Bremsen wieder hinab. Rechts hätte man schrundigen Felsen berühren können, und was auf der linken Seite wartete, versuchte DeLange zu verdrängen. Der Abgrund. Die Hölle.
Im Reiseführer stand etwas von einer atemberaubenden Fahrt durch atemberaubende Landschaft, von grüner Weite ohne Baum oder Ansiedlung, von schroffen Felswänden, von schneebedeckten Gipfeln in der Ferne. Großartig und ergreifend und unvergesslich und so weiter.
DeLange hatte keinen Blick dafür. Sein Kopf war eine Baustelle, auf der Tausende kleiner Zwerge hämmerten, bohrten und sprengten. Den Frankfurter Kollegen schien es nicht besser zu gehen. Niemand sprach. Niemand lachte. Wohltuende Stille. Wenn sie nicht gewesen wäre, seine Sitznachbarin. Die Reiseführerin.
Die Frau mit dem glänzenden schwarzen Zopf unter dem weißen Hut hieß Shidy. Ihr schien das Geruckel und Gezuckel nichts auszumachen. Auch DeLanges angestrengtes Schweigen störte sie nicht.
»Wissen Sie, was Shidy heißt?« Sie kicherte. »Das ist Quechua und bedeutet Prinzessin.«
Darauf musste man erfreulicherweise nicht antworten. Aber Shidy bestand darauf, ihr Deutsch an ihm auszuprobieren. DeLange litt Höllenqualen. War der Trip dran schuld oder die Tatsache, dass Shidy nuschelte wie eine Berliner Kiezbraut? Weil sie ein Fan von Lola rennt war, behauptete sie. Der Film, si?
»Habe ich mindestens zwanzig Mal gesehen. Um mein Deutsch zu verbessern.« Sie sah ihn erwartungsvoll an.
»Super«, murmelte DeLange, obwohl er das erstaunlich fand. Soweit er sich erinnerte, kamen in dem Film kaum zwei ganze Sätze vor.
»Und ich liebe Rammstein.«
Verstehe, dachte DeLange. Es rammt in meinem Kopf. Jemand schmeißt mit Steinen. Und nur Inkaprinzessinnen bringen es fertig, so was zu lieben.
Shidy redete ununterbrochen und legte erst eine Pause ein, als sie haltmachten. Alles stöhnte und reckte sich. Doro, die taffe blonde Kollegin, als Hauptkommissarin Ansprechpartnerin für die Opfer antischwuler Gewalt, hielt Sport für ein Allheilmittel und lief todesmutig zum Ausstieg, um sich mit dem großartig ergreifend Erhabenen da draußen zu konfrontieren. Wahrscheinlich versuchte sie, mit zwanzig Liegestütz gegen die Übelkeit anzugehen. DeLange hingegen dachte nicht ans Aussteigen. In Deckung gehen und Stellung halten war das Einzige, was ihm sinnvoll erschien.
Doch das Grauen blieb nicht draußen, da, wo es hingehörte. Es kam näher. In einer Wolke übelkeiterregender Gerüche. In Gestalt einer Bauersfrau in dicken Röcken und bunten Tüchern, die den Bus ins Schwanken brachte, als sie einstieg. Sie schleppte einen Korb mit sich, die Quelle des Geruchs, der DeLange präventiv zur Spucktüte greifen ließ.
Doch Shidy, mit der Grausamkeit der Nichtbetroffenen, winkte die Bauersfrau heran und unterhielt sich mit ihr angeregt über den Inhalt des Korbs, bevor sie ihre Wahl traf.
»Willst du? Rocoto relleno.« Sie hielt DeLange etwas hin, das wie eine gefüllte Paprika aussah. Er schüttelte den Kopf und versuchte, ihr nicht zuzusehen, während sie aß. Sie hatte Hunger. Unfassbar. DeLange hatte noch nicht mal Appetit. Vor allem nicht auf das weißliche Stück Fleisch in der dicken Panade, das sie sich jetzt in den Mund schob.
»Cui«, sagte sie kauend. »Meerschweinchen.«
DeLange schwindelte es. Seine Hand krampfte sich um die Spucktüte. Er schloss die Augen und versuchte, an etwas zu denken, das weder roch noch sprach noch ein Fell trug oder erhaben und ergreifend war.
Shidy neben ihm kaute und schluckte und schluckte und kaute.
Irgendwann spürte er ihre tröstende kleine Hand auf seinem Arm. »Soroche«, sagte sie.
Soroche. Irgendwie beruhigte ihn das Wort. Sein Zustand hatte einen Namen. Es war nichts so Banales wie ein von einem Messerstich traumatisierter Gesichtsnerv, sein Hausgenosse seit vielen Jahren, sondern etwas Romantisches. Großes. So etwas wie Saudade, vielleicht. Sehnsucht. Wehmut. Ja, das passte.
Shidy murmelte: »Wie sagt man? Maladie der Berge?«
Melodie der Berge. Fast hätte DeLange gelacht. Das wurde ja immer schöner.
»Höhenkrankheit«, sagte sie.
Wie enttäuschend.
Die Bauersfrau war längst gegangen, Doro wieder in den Bus gestiegen, mit bleichem Gesicht, aber gefasst. Und weiter ging es. Weiter – und höher. Irgendwann verwandelte sich DeLanges Körper in reinen Schmerz. Er musste gestöhnt haben, denn Shidy ergriff seine Hand und schloss seine Finger um einen Becher.
»Trinken«, sagte sie. »Hilft.«
»Was ist das?« Er öffnete vorsichtig die schmerzenden Lider und roch an der Brühe. Undefinierbar, aber erträglich. Und die Farbe: irgendetwas zwischen grasig und rostig. Er nahm einen Schluck.
»Coca-Tee«, sagte sie. »Gut für dich.«
Coca? Kokain? Also Rauschgift? Was soll’s, dachte er, passt. Er trank den Becher aus und bildete sich ein, es ginge ihm schon besser. Dennoch hielt er die Augen fest geschlossen und versuchte, nicht an den Abgrund neben der Straße zu denken. Schöne Landschaft? Nein danke. Als er versuchsweise die Augen öffnete, sah er hinaus in dichten Nebel. Ausgezeichnet. Ihm entging also nichts.
Wieder machte der Bus halt. Seinen Kopfschmerzen nach zu urteilen, waren sie entsetzlich hoch. »4200 Meter. Passhöhe«, flüsterte Shidy neben ihm. Sie klang ausnahmsweise respektvoll. Der Fahrer würgte den Motor ab. Tiglet stand auf, auch »The wondrous cat of the day« genannt, was immerhin freundlicher klang als »Sautitte«. Er hatte es längst aufgegeben, ihnen zu erklären, dass er nach seinem aramäischen Großvater hieß und nicht nach einer Katze oder dem Gesäuge einer Muttersau. Tiglet sollte demnächst als deutscher Kontaktmann zu Europol wechseln, aber jetzt stolperte er wie ein alter Mann durch den Gang nach vorne. Wahrscheinlich musste er mal. Aber der Fahrer schüttelte den Kopf, als Tiglet ihm auf die Schulter tippte, und ließ die Türen geschlossen. Nur das Fenster hatte er heruntergelassen, durch das er mit jemandem sprach, erst ungeduldig, dann ärgerlich, dann mit Angst in der Stimme. In kehligem Spanisch bellte jemand Befehle.
»No, en absoluto«, antwortete der Fahrer. »No, yo no sé nada, absolutamente nada.«
Im Bus war es totenstill geworden. Die Leute schienen kaum zu atmen. Wovor fürchteten sie sich? Selbst Shidy sagte kein Wort, aber sie griff nach seiner Hand. War das da draußen die Polizei? DeLange suchte Blickkontakt zu Tomás Rivas, aber der saß drei Reihen vor ihm und rührte sich nicht. Terroristen? Die Sekunden fühlten sich wie Minuten an.
»Está bien. Continuar, pero rápidamente«, schnarrte die befehlsgewohnte Stimme.
Der Fahrer ließ den Motor anspringen. Jetzt sprachen alle auf einmal, einige Fahrgäste stürzten vor, redeten auf den Mann ein. Doro drehte sich nach DeLange um, mit fragend hochgezogenen Augenbrauen. Tiglet war ebenfalls aufgestanden, starrte halb gebückt durchs Fenster und versuchte, im Nebel etwas zu erkennen. Der Fahrer legte den Gang ein und gab Gas.
DeLange ließ sich in seinen Sessel zurücksinken. Er begriff nichts. Gar nichts. Nur eines registrierte sein gequälter Kopf: Es ging wieder bergab.
»Sie sind alle gleich schlimm. Entweder sind es die Terroristen oder es ist das Militär. Sie lassen die Menschen herauskommen, man muss in der Kälte stehen, sie nehmen einem die Pässe weg«, flüsterte Shidy.
»Wer?«, murmelte DeLange ohne großes Interesse. »Ich dachte, die Terroristen …«
»Schhhh.« Sie legte sich den Finger auf die Lippen. »Nicht beschreien. Sie sind noch immer da. Oder ihre Geister.« Und dann sang sie ihm leise ins Ohr: »Stein um Stein mauer ich dich ein/Stein um Stein/Ich werde immer bei dir sein.«
Langsam begriff er, was sie an Rammstein fand und warum sie die deutsche Gruppe liiiiebte. Die Texte waren schon was Besonderes.
Der Druck auf DeLanges Kopf ließ nach. Er wachte erst auf, als Shidy neben ihm »Wir sind daha« sang.
Tatsächlich. Eine Straße. Häuser.
»Ayacucho liegt auf 2700 Metern Höhe«, verkündete Shidy im geschäftsmäßigen Singsang. »Es gibt 33 Kirchen, einen Triumphbogen und eine Universität, San Cristobál, gegründet 1677.«
Alle klebten jetzt an den Fenstern. Spanischer Kolonialstil aus grauem Stein. DeLange sah vor allem Kirchen. Es waren erstaunlich wenig Autos auf den Straßen und kaum Touristen unterwegs.
Er streckte die Glieder. Seine Lippen waren trocken, wahrscheinlich hatte er Mundgeruch und sollte dringend duschen. Um ihn herum brach hektische Aktivität aus, Doro stand im Mittelgang und machte gymnastische Übungen, Ben und Tiglet hatten sich erhoben und holten ihre Taschen aus der Gepäckablage. Der Bus schaukelte durch enge Straßen und hielt auf einem großen Platz neben anderen Reisebussen.
Es dauerte ewig, bis alle Fahrgäste ihren Krempel beisammenhatten und er endlich aussteigen konnte. Shidy hatte ihren Rucksack bereits über den Schultern und umarmte ihn zum Abschied. »Ayacucho heißt ›Winkel der Toten‹«, flüsterte sie ihm ins Ohr, bevor die Inkaprinzessin in der Menge verschwand. Gut zu wissen, dachte DeLange.
Tomás hatte seinen vier Kollegen vom Frankfurter Polizeipräsidium Zimmer organisiert, in einer kleinen und ziemlich spartanischen Herberge. DeLange widerstand der Versuchung, sich auf das schmale Bett zu legen und die Augen zu schließen, packte seine Reisetasche aus, putzte sich flüchtig die Zähne und ging wieder hinaus, um mit den anderen Männern auf Doro zu warten.
Tomás hatte einen Tisch in einem Restaurant namens Wallpa Sua reserviert und ihnen »Hühner, so groß wie Enten« versprochen. Auf dem Weg dahin erklärte er ihnen, warum das Restaurant »Hühnerdieb« hieß: »So haben Leute aus Huanta ihre Nachbarn aus Huamanga beschimpft.« Er lachte, als ob das in Wirklichkeit eine Liebeserklärung gewesen sei.
Schon auf der Straße quoll ihnen der Duft von Holzfeuer, Knoblauch und Kräutern entgegen. Drinnen saß man dichtgedrängt an langen Tischen, umgeben von Möbeln mit Flohmarktcharme. Es war warm und laut und in kürzester Zeit waren sie wieder bester Stimmung.
Es war der vorletzte Tag ihrer Reise, und DeLange war mittlerweile davon überzeugt, dass die Peruaner weitaus gastfreundlicher waren als ihre deutschen Kollegen. Vor einem Jahr war eine Delegation peruanischer Polizisten in Frankfurt gewesen, alles Mitglieder der IPA, der International Police Association. Ausschließlich Männer, bei der peruanischen Polizei schien es keine Frauen zu geben. Sie waren ein lustiger Haufen gewesen, trinkfest und belastbar. Mit Waffen kannten sie sich bestens aus, aber es haperte an allen zivileren Techniken. Alles, was der Verkehrskontrolle diente, erregte ihr größtes Interesse. Vor allem der Gedanke, dass man damit Geld verdienen konnte.
Noch nicht einmal in Lima gab es Radarkontrollen, und die Ahndung von Parkverstößen war den Kollegen unbekannt, es gab schließlich keine Parkordnung. DeLanges Kollege Ben, der Mann, der die interne Kommunikation und nebenbei auch die Website des PP organisierte, erklärte Peru zum gelobten Land der Autofahrer. Damals ahnten sie noch nicht, wie groß das Verkehrschaos in der Millionenstadt war und wie miserabel der Straßenzustand außerhalb.
Die IPA war eine großartige Sache. Ein weltweites Netzwerk der Polizei, immer nützlich, wenn man mal am Dienstweg vorbei eine Info brauchte. Ihr Motto: »Servo Per Amikeco«. Das war Esperanto, was heute niemand mehr sprach. Die meisten Kollegen konnten immerhin Englisch, bis auf die französischen, die beherrschten nur die Muttersprache und wunderten sich, dass niemand sie verstand.
Tomás hatte sogar ein paar Brocken Deutsch gesprochen. Und er war nicht ganz so waffenbesessen gewesen wie die anderen. Nach der Besichtigung des Museums im Keller des Polizeipräsidiums hatte die Presseabteilung die Besucher in die Kantine eingeladen, es gab wie immer bei solchen Anlässen Salat und halbe Brathähnchen mit Pommes frites. Das, glaubte man, sei international unverfänglich. Als Tomás vor der Essensausgabe stand, deutete er mit strahlendem Lächeln auf die fettigen Teile und orderte »Goldhamster«. Die Deutschen hinter und vor der Theke lachten sich krumm, aber DeLange hatte den Mann umarmt und ihm ein Bier ausgegeben. Und sich gefragt, welcher Komiker von Tourist ihm das Wort wohl beigebracht haben mochte.
Eine halbe Stunde später wusste DeLange alles über Tomás’ Frau, seine Kinder und deren Kinder, die Mutter und die Tante, die Großeltern seiner Frau und die halbe Nachbarschaft des Viertels von Lima, in dem Tomás wohnte. Er hatte viele Fotos betrachtet, Tomás’ Frau bewundert und die Kinder gelungen gefunden.
Dann war er dran gewesen. Die Bilder von Flo und Caro erfuhren andächtige Würdigung. Dass die Mutter dieser beiden schönen Töchter tot war, erschütterte Tomás. Dass DeLange eine neue Beziehung hatte, wurde mit einem gewaltigen Schlag auf die Schulter kommentiert. So begann eine wunderbare Freundschaft, die sie in den Tagen danach mit viel Bier und Schnaps besiegelt hatten.
Die Stimmung an ihrem Tisch im Wallpa Sua stieg mit jedem Glas Chicha, einem Bier aus Mais, und uferte aus, als zwei mandeläugige Mädchen den Hauptgang servierten: gebräunte, fettglänzende Hühner, groß wie Kapaune, dazu Krüge mit Saucen und Berge von Pommes frites. Tomás hatte nicht zu viel versprochen. DeLanges Appetit war wieder erwacht, und er konzentrierte sich auf ein saftiges Hühnerbein. Für eine Weile herrschte gefräßige Stille, bis alle satt waren. Außer Ben, der konnte immer essen. Nachdem sie den Tisch abgeräumt hatten, servierten die Mädchen Pisco sour.
DeLange hatte dem Zeug zu Beginn der Reise wenig abgewinnen können: Eine Mischung aus Weinbrand, Zucker, Zitrone und Eischaum klang nicht gerade einladend. Aber es schmeckte großartig, und er hatte heute nicht die Absicht, auf seinen Kopf Rücksicht zu nehmen. Wozu gab es Tramal.
Nach der dritten Runde fühlte DeLange sich leicht und abenteuerlustig. Den morgigen Tag konnte jeder nutzen, wie er wollte. Tomás hatte einen Ausflug nach Piquimachay vorgeschlagen, eine Höhle, in der man die ältesten Steinwerkzeuge Perus gefunden hatte. Oder nach Baños Intihuatana, wo es interessante Inkaruinen an einer Lagune zu besichtigen gab. Ben wollte hierbleiben, angeblich, um alle 33 Kirchen Ayacuchos zu besichtigen, was ihm keiner glaubte. DeLange aber war nach einem Ausflug in die Vergangenheit. Zumindest räumlich war das Ziel nicht weit, es lag vielleicht 70 Kilometer nordöstlich von Ayacucho. Unklar nur, ob nach all den Jahren dort noch etwas zu finden war.
»Ich fahre nach Ayla. Vielleicht kannst du mir ein Auto organisieren?«
Tomás reagierte wie angestochen. »Caracho! Was willst du da?« Die Augen in dem dunklen Gesicht wurden schmal.
»Was ich da will? Nichts Besonderes. Warum fragst du?«
»Darum.« Tomás leerte sein Glas und winkte nach der Kellnerin. »Pisco para todos!«
Noch eine Runde? DeLange war schon leicht angeschlagen. Niemand aus seiner kleinen Reisegruppe wirkte noch nüchtern, und das, obwohl auch Mitarbeiter der Abteilung für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Polizeipräsidium Frankfurt, von Kollegen gerne als »Sesselfurzer« belächelt, einiges vertragen können. Aber das war offenkundig nichts im Vergleich mit peruanischen Polizisten, vor allem, wenn sie mehr Indio als Spanier waren.
Die Mädchen verteilten die Gläser, Tomás hob das seine, prostete in die Runde, und ließ es halb geleert auf die Tischplatte knallen.
Nach einer Weile wiederholte DeLange seine Frage. »Was spricht gegen einen Abstecher nach Ayla? Ich miete mir einen Landrover und …«
Tomás drehte sich langsam zu ihm um. »Mi amigo«, sagte er leise. »Was zum Teufel willst du da?«
»Also wirklich!« DeLange hob entnervt die Hände. »Ich will einen Ausflug machen. Morgen! An unserem freien Tag! Wo ist das Problem?«
»Warum Ayla? Warum ausgerechnet Ayla? Warum nicht …« Tomás fuhr mit dem Arm durch die Luft. »Zur Höhle von Piquimachay? Wie die anderen?«
Ja, doch. Die Frage war berechtigt. Höhlen oder Inkaruinen waren gewiss spannender als ein Andendörfchen, das für keine touristischen Sensationen bekannt war. Trotzdem. DeLange wusste, was er dort wollte. Aber Tomás würde ihn für völlig irre halten, wenn er es zugab.
Er wollte die Grundschule besuchen.
»He, Tomás! Jo! Was ist los mit euch?« Ben prostete ihnen zu. Ein lieber Kerl. Er hatte bereits seinen nächsten Urlaub geplant – er würde, natürlich, zu den Kollegen nach Lima fliegen und Entwicklungshilfe leisten. »Kein Wunder, dass die ihren Laden nicht im Griff haben«, hatte er erklärt, als ihnen klargeworden war, dass die peruanische Polizei sich elektronisch auf Steinzeitniveau befand. »Die überführen keine Täter. Die schießen auf Verdacht, damit die Erfolgsbilanz stimmt.«
Tatsächlich hatte der Präsident des Landes beschlossen, zwecks Kriminalitätsbekämpfung die Todesstrafe wiedereinzuführen.
»Wisst ihr, was man der Regierung hier beibringen muss?« Die anderen lachten. Sie kannten offenbar Bens Pointe schon. »Dass Tote keine Knöllchen zahlen!«
Ben war bekannt für seine »Kurze Einführung in die politische Ökonomie des Verbrechens«.
»Einmal auf die Straße spucken, 50 Euro – und schon gewöhnt sich der Peruaner an die Zivilisation! Auf dem Weg dahin hat der Staat genug eingenommen, um ganz Lima mit Radarfallen zuzupflastern. So macht man das.«
»Hast du nicht behauptet, Peru sei ein Paradies für Autofahrer, weil es hier keine Radarfallen gibt?« Doro. Humor war nicht ihre Stärke.
»Ach, das sind individuelle Schicksale, darauf kann der Gang der Geschichte keine Rücksicht nehmen. Jedenfalls kann ein Staat mit Geld bessere Straßen bauen. Auf denen man schneller fahren kann. Und dann …«
»Brauchen sie mehr Krankenhäuser.« Tiglet klatschte in die Hände. »Mit deutscher Technologie.«
»Seht ihr? Das ist Entwicklungshilfe mit menschlichem Antlitz!« Ben feixte in die Runde.
Irgendwie hatte das was, ein Bulle mit DDR-Vergangenheit und gründlicher Schulung in Dialektik.
»Also was ist? Könnt ihr noch einen vertragen?«
»Ya!«, sagte DeLange und winkte der Kellnerin.
»Also?«, fragte Tomás misstrauisch, als die Kollegen wieder mit sich selbst beschäftigt waren.
»Ein Bekannter hat da mal gearbeitet«, sagte DeLange lahm.
»In Ayla? Wann war das?«
»Ist ewig her.« DeLange tat, als ob das nicht weiter wichtig wäre.
»Du weißt, wie weit das ist?«
»64 Kilometer, ich hab nachgeschaut – komm, das ist doch nichts!«
Sie hatten schon ganz andere Distanzen durchmessen auf ihrem Trip. Von Lima aus in den Regenwald. Zum Titicacasee. Nach Arequipa. Zu den Nazca-Linien. Auf dem Weg dahin waren sie in einen Streik der Campesinos geraten und stundenlang aufgehalten worden. Und das Ganze in klapprigen Bussen, mit einer Schmalspurbahn, in einem Boot mit stottern-dem Motor und in klappernden Kleinflugzeugen. Was konnte ihn da noch schrecken?
»Er hat in Ayla eine Grundschule gegründet, vor vielen Jahren, und ich dachte …«
»Eine Grundschule? Ein Deutscher?« Tomás, wie aus der Pistole geschossen.
Seine heftige Reaktion gefiel DeLange. Da war also was gewesen, vor all den Jahren. Der gute alte Charly hatte Spuren hinterlassen.
Charly. Heute Dr. Karl-Heinz Neumann-v. Braun. Ein bügelfaltenschnittiger Besserwisser. DeLange hatte Gründe, ihn nicht zu mögen. Als der Mann noch Politiker war, machte er jede Pressekonferenz im Polizeipräsidium zur eigenen Show, das war penetrant genug. Aber seit dem Fall Alexandra Raabe hatte DeLange weit bessere Gründe, den Kerl verdächtig zu finden. Und als er bei seinen Recherchen zu Peru über ein Interview gestolpert war, das Neumann einer Schülerzeitung gegeben hatte, war seine Neugier geweckt. Der gute Charly hatte einst in Peru eine Schule mitgegründet. Um Indiokinder zu fördern – vornehmer gesagt: die indigene Andenbevölkerung. In Ayla, einem Dorf in der Region Ayacucho.
»Was weißt du über Ayla?«, fragte Tomás, kaum zu verstehen im Kneipenlärm.
»Nichts.«
Tomás seufzte und griff nach seinem Tabakpäckchen. Er rauchte Selbstgedrehte, und zwar eine nach der anderen. Wie schnell man sich an so was wie ein Rauchverbot gewöhnt, dachte DeLange, als der Kollege sich die Zigarette anzündete und den Rauch in seine Richtung blies. Die Luft war jetzt schon zum Schneiden.
»Gehen wir raus? Ins Freie?«
Tomás nickte und folgte DeLange in den Patio. Dort standen Tische und Stühle um ein Fass herum, in dem ein Feuer brannte. In Deutschland war Herbst mit Schmuddelwetter, hier herrschte Frühsommer mit angenehmen Temperaturen. Nachts war es ziemlich kalt, doch nach der Hitze im »Hühnerdieb« tat die kühle Luft gut. Über ihnen hing ein rabenschwarzer Himmel, auf dem die Sterne glitzerten. Noch nie war DeLange das Kreuz des Südens so nah erschienen.
»Skorpion«, sagte Tomás und deutete nach oben. »Hydra.«
DeLange starrte in den Himmel, bis ihm der Nacken weh tat, während Tomás schweigend rauchte. Endlich nahm der Freund einen letzten tiefen Zug, warf die Kippe auf den Boden und trat sie in den Staub.
»Jo.« Tomás’ Stimme klang rau. »Ayla ist die Wiege des Bösen. Dort hat alles angefangen.«
Also doch. DeLange spürte, wie sich sein Pulsschlag beschleunigte.
»Es stimmt, sie haben Schulen gegründet. Damals.« Tomás klang bitter. »Sie wollten Gutes tun. Ich habe sie erlebt.«
»Wen? Und was hast du erlebt?«
Tomás hob beide Hände. »Na, was schon? Ich war auch auf so einer Schule. Ich habe Lesen und Schreiben gelernt. Und ich kann singen.« Tomás zog den Bauch ein und streckte die Brust raus. Er hatte einen angenehmen Tenor und die Melodie klang ein wenig wie El condor pasa, nur die Worte verstand DeLange nicht.
Tomás brach ab. »Platz eins beim Liedwettbewerb in Victor Fajardo.« Er klang plötzlich sehnsüchtig.
»Und was war böse an alledem?«, fragte DeLange behutsam.
Tomás hatte schon wieder das Tabakpäckchen in der Hand. »Nichts. Ohne sie wäre ich nicht das, was ich heute bin. Ohne sie wäre ich nie Polizist geworden.« Er rollte Tabak in das weiße Papier und leckte es an. »Auch wenn das vielleicht nicht ihre Absicht war.«
»Und wer genau waren ›sie‹?« DeLange versuchte, seine Ungeduld zu zügeln.
»Sie kamen aus Ayacucho, von San Cristobál. Aber auch aus Italien. Aus Frankreich. Und aus Deutschland. Unsere Lehrer.«
Tomás nahm ein Streichholz aus der Schachtel. »Die Ehrlichen blieben nicht lange. Und die anderen …«
DeLange konnte den Gesichtsausdruck des Freundes kaum erkennen. Aber er hörte die tiefe Traurigkeit in seiner Stimme.
»Sie haben mein Land zerstört.« Endlich brannte das Streichholz. Tomás zündete sich die Zigarette an und nahm einen tiefen Zug. »Und das alles begann mit einer Grundschule in Ayla.«
»Ich kapier nichts«, sagte DeLange, obwohl ihm etwas dämmerte.
Tomás lachte leise. »Was weißt du über Peru, Giorgio?«
Nichts. Ein bisschen was. Zu wenig.
»Die meisten Touristen kommen hierher, um Machu Picchu zu sehen. Oder die Nazca-Linien. Sie wollen Geschichten hören über die Inka, ihren Reichtum, ihre Grausamkeiten. Sie bewundern die Landschaft, trinken Pisco, kauen Coca. So wie ihr.«
Ihr. »Ich weiß«, sagte DeLange. Sollte er sich jetzt schuldig fühlen?
»Aber sie wissen nichts über mein Land. Gar nichts. Wir sind todkrank. Wir leben Gewalt. Wir tränken den Boden mit Blut.«
Seine Hand zitterte, als er an der Zigarette zog. »Und diese Schulprojekte …« Er machte eine wegwerfende Handbewegung. »Damit fing es an. Das war der Beginn des Leuchtenden Pfades.«
Der Leuchtende Pfad. Sendero Luminoso. Eine völlig durchgeknallte Terroristentruppe. Die kannte DeLange.
»Es begann in den siebziger Jahren. Damals lehrte ein Philosophieprofessor namens Abimael Guzmán an der Universität in Ayacucho. Er las mit seinen Studenten Marx und Mao und schickte sie dann als Lehrer aufs Land.«
Neumann ein Senderista? Hammer.
»Sie wollten die Indios befreien und die Fackel der Revolution entzünden und über den ganzen Kontinent tragen. Du kennst die Sprüche.« Er hob die Schultern und ließ sie wieder fallen. »Es waren gute Leute dabei. Aber auch Verrückte. Weltverbesserer. Und brutale Verbrecher.« Tomás atmete tief ein. »Die Verbrecher sind übrig geblieben. Wir haben nur die Verrückten erwischt.«
DeLange wollte etwas sagen, aber Tomás ließ sich nicht unterbrechen.
»Ich hatte einen kleinen Bruder. Einen Onkel. Eine Mutter. Weißt du, was sie mit ihnen gemacht haben im April 1983?«
DeLange schüttelte den Kopf. Aber er ahnte es.
»69 weiße Särge haben wir herausgetragen aus Lucanamarca. Achtzehn Kinder, elf Frauen, viele davon schwanger. Alte Männer. Erschlagen, zerhackt, erschossen.« Tomás’ Stimme klang gepresst.
1983. Da war Neumann längst wieder in Deutschland. Ein Massaker kann man ihm also nicht anhängen, dachte DeLange.
Tomás räusperte sich. »Du hast nach einem Deutschen gefragt, der nach Ayla gekommen ist, viele Jahre vor dem Massaker.«
»Ja«, sagte DeLange vorsichtig. »Hast du ihn gekannt?«
Tomás spuckte aus. »Es waren zwei. Ihn habe ich nicht gesehen. Aber die Frau. Bevor sie meine Mutter tötete.«
Die Tür zum Restaurant öffnete sich. Ein Schwall verbrauchter Luft und die Stimmen angeheiterter Gäste drangen heraus. Ein Mann ging hinüber zur Baumgruppe neben dem Parkplatz. Sie hörten, wie er sich erleichterte.
»Sie war sehr schön, die Deutsche. Sie hat die Erde Perus gedüngt.« Tomás’ Stimme zitterte. »Und sie war gründlich. Sie hat Ströme von Blut vergossen.«
Was ist mit Neumann, wollte DeLange fragen.
»Sie war der Teufel. Aber einige verehren sie noch immer wie eine Heilige. Sie nennen sie Chhanka.«
»Und der Mann …« Die Vorstellung, dass der staatstragende Neumann einer Bande blutrünstiger Massenmörder angehört haben könnte, erregte ihn.
»Chhanka lebt, sagen sie.«
Am nächsten Tag brachen die anderen zur Höhle von Piquimachay auf. Tomás begleitete DeLange auf seiner Fahrt in die Pampa. Je weiter sie kamen, desto karger wurde die Landschaft. Tomás deutete auf Steinhaufen am Wegesrand. Die Überreste verlassener Dörfer. Nach drei Stunden erreichten sie eine Weggabelung. Tomás bog links ab und hielt nach einem guten Kilometer.
»Hier«, sagte er und beschrieb mit dem Arm einen Bogen. »Hier war Ayla.«
Der Wind wirbelte den Staub über die Piste, und am dunstigen Himmel kreiste ein großer Vogel. DeLange blickte auf die Ruine eines Hauses. Nur eine Wand stand noch, der Putz bräunlich verfärbt.
Tomás stieg aus, eine Zigarette zwischen den Lippen. DeLange folgte. Als sie näher kamen, erblickte DeLange die ungelenke Zeichnung von Hammer und Sichel, darunter stand »PCP«. Und daneben …
»Viva los comtés populares«, sagte Tomás. »›Hoch die Volkskomitees‹. Mit Blut geschrieben.« Er spuckte aus.
Was hatte Shidy gesagt? »Sie sind noch immer da. Oder ihre Geister.«
Frankfurt am Main, im Winter
Es war ein lausig kalter Abend nach einem lausig kalten Tag in einem schon viel zu langen, lausig kalten Winter. Ein Winter, in dem sogar DeLange es vertretbar fand, wenn Hunde Pullover trugen.
Nur die besserbetuchten Damen Frankfurts, die am Stoff nicht sparen mussten, taten so, als ob ihnen die Kälte nichts anhaben konnte. In hauchdünnen Gewändern flanierten sie über den Platz vor der Alten Oper, höchstens eine Stola oder ein Stück Pelz um die nackten Schultern.
DeLange stand unter einer Laterne und schaute zu, wie sie stöckelten und lachten und sich von ihren schweigsamen Begleitern stützen ließen, wenn sie auf dem Pflaster zu stolpern drohten. Die trugen ihre Highheels wohl sonst nur im Bett.
Die Menge ballte sich vor der Treppe, die sich zu einem säulenbestandenen Entree emporschwang. Die Fassade von Frankfurts Bürgertempel war sanft beleuchtet, durch die Fenster drang mildes Licht, und DeLange glaubte, ein festliches Summen zu hören. Am Seiteneingang fuhr unter Blitzlichtgewitter irgendeine Prominenz vor, Chauffeure rissen den Schlag dunkler Limousinen auf – für Herren, die sich ihre Anzüge und ihre Frauen maßschneidern ließen. Und für Damen in Begleitung von Männern, die nach ihrem Personal Trainer aussahen. Zwischen all den Glatzen und Frisuren leuchtete der blonde Schopf der Oberbürgermeisterin.
Der »Maskenball« in der Alten Oper war eins der Ereignisse, von denen die Klatschpresse lebte. Tout Francfort wurde erwartet, das gehörte sich so, denn ein Teil des Erlöses diente einem guten Zweck. Welchem, hatte DeLange vergessen. Man konnte es sich jedenfalls heutzutage nicht mehr leisten, einfach nur so herumzufeiern. Charity verklärte jeden Event zur moralischen Mission.