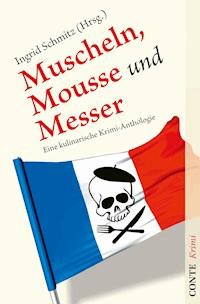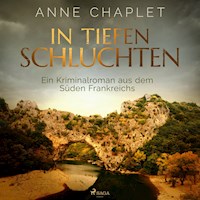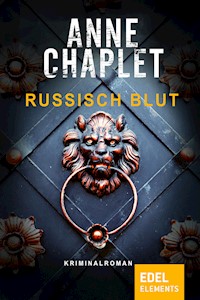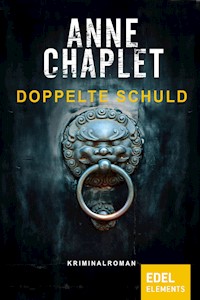9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Tori Godon ermittelt
- Sprache: Deutsch
Aufruhr in den Cevennen: Tori Godon ermittelt weiter. Der Himmel über dem kleinen Ort Belleville am Fuße der Cevennen leuchtet in schmutzigem Rot, als die ehemalige Anwältin Tori Godon mitten in der Nacht aus dem Schlaf gerissen wird. Feuer – seit Jahrhunderten prägt es die wilde Landschaft und die Menschen des Vivarais. Dort, wo einst zur goldenen Zeit der Seidenraupenzucht unzählige Maulbeerbäume standen, jagt der Wind die Flammen über Berge und Ebenen. Neben den verkohlten Überresten eines Wohnwagens auf einer Hochebene findet Tori die Leiche eines Hundes. Sein Besitzer, der Schweizer Franco Jeger, ist spurlos verschwunden. Tori begibt sich auf die Suche. An ihrer Seite: der ehemalige Drogenfahnder Nico und ihr Hund July. Als sie einen anonymen Drohbrief erhält, auf sie geschossen wird und ein weiteres Feuer Todesopfer fordert, ahnt Tori: Das Paradies ist eingestürzt. Eine erschütternde Tragödie in einem geschichtsträchtigen Landstrich, atmosphärisch dicht und mitreißend erzählt – eine starke Fortsetzung der Reihe!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 348
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Anne Chaplet
Brennende Cevennen
Ein Kriminalroman aus dem Süden Frankreichs
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Anne Chaplet
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Anne Chaplet
Anne Chaplet ist das Pseudonym von Cora Stephan, unter dem sie ihre mehrfach preisgekrönten Kriminalromane veröffentlicht hat. Cora Stephan ist Publizistin und Schriftstellerin, ihr Roman »Ab heute heiße ich Margo« erschien 2016 bei Kiepenheuer & Witsch. »Brennende Cevennen« ist nach »In tiefen Schluchten« (2017) der zweite Band der Krimireihe um die ehemalige Anwältin Tori Godon.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
In dem kleinen Ort Belleville am Fuße der Cevennen herrscht seit Wochen brütende Hitze. Mitten in der Nacht wird die ehemalige Anwältin Tori Godon aus dem Schlaf gerissen. Der Himmel leuchtet in schmutzigem Rot. Dort, wo einst zur goldenen Zeit der Seidenraupenzucht unzählige Maulbeerbäume standen, jagt der Wind die Flammen über Berge und Ebenen. Seit Jahrtausenden prägt Feuer die wilde Landschaft und die Menschen des Vivarais. »Die Cevennen müssen brennen«, so lautete der Schlachtruf des königlichen Heeres im Kampf gegen die rebellischen Protestanten.
Als Tori am nächsten Morgen auf einer nahe gelegenen Hochebene wandern geht, findet sie neben den verkohlten Überresten eines Wohnwagens die Leiche eines Hundes. Sein Besitzer, der Schweizer Franco Jeger, ist spurlos verschwunden. Tori ist sicher: Nie hätte er seinen Hund freiwillig zurückgelassen. Sie begibt sich auf die Suche nach ihm. An ihrer Seite: der ehemalige Drogenfahnder Nico und ihr Hund July. Als sie einen anonymen Drohbrief erhält, auf sie geschossen wird und ein weiteres Feuer Todesopfer fordert, ahnt Tori: Das Paradies ist eingestürzt.
Hinweis für E-Reader-Leserinnen und Leser
Wenn Sie sich die Karte in Farbe und zoombar ansehen möchten, dann geben Sie bitte die folgende Internetadresse im Browser Ihres Computers oder Smartphones ein:
www.kiwi-verlag.de/buecher/specials/karten-brennende-cevennen.html
Hinweis für Leserinnen und Leser auf dem Smartphone/Tablet oder am Computer
Sie möchten sich die Karte zoombar anschauen? Dann tippen bzw. klicken Sie bitte auf die Abbildung. Es öffnet sich ein neues Fenster mit der entsprechenden Website-Ansicht.
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Motto
Kapitel I
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
Kapitel II
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
Kapitel III
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
Kapitel IV
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
Dank
Adressen
Zitatnachweise
Für Pascal und Aline, Malte, Florian und Marco.
In memoriam Holger Stephan
On a vu souvent
Rejaillir le feu
De l’ancien volcan
Qu’on croyait trop vieux
Il est paraît-il
Des terres brûlées
Donnant plus de blé
Qu’un meilleur avril
Et quand vient le soir
Pour qu’un ciel flamboie
Le rouge et le noir
Ne s’épousent-ils pas.
Ne me quitte pas.
Jacques Brel
Kapitel I
Belleville, im Sommer
1
In dieser Nacht blieb der Hund still. Nur Tori wurde wach. Hellwach.
Es war seit Tagen brütend heiß, die Nächte brachten keine Abkühlung, selbst der Deckenventilator, der über ihrem Bett kreiste, vermochte die Hitze nicht zu vertreiben. Doch das war es nicht, was Tori hochschrecken ließ. Auch das Glockengeläut vom Kirchturm war sie gewohnt, das Eselsgeschrei, den krähenden Hahn vom Stall gegenüber. Nichts davon konnte sie um ihren Schlaf bringen. Es war der Geruch, der bekannte, beängstigende Geruch nach alles verzehrendem Feuer, der ihren Puls beschleunigte, während sie sich aufsetzte und zu orientieren versuchte.
Feuer. Der Feind war wieder da, brach ein in ihr Leben, mitsamt den Schrecken der Vergangenheit und der Erinnerung. Oder bildete sie sich den Geruch bloß ein, wie so oft, wenn sie etwas roch, was nicht da war?
Nein. Es brannte. Aber wo? Im Haus? Ihre Zehen suchten nach den Sandalen. Jetzt wurde auch July wach. Tori streckte die Hand nach der Hündin aus, die ihren Kopf hineinschmiegte. Im Haus brannte es nicht, dann hätte July längst Alarm geschlagen. Sie ging zum Fenster und blickte über die Dächer der Häuserreihe unterhalb ihres Hauses auf die Straße. Die Straßenlampen brannten noch, obwohl es bereits zu dämmern schien. Doch weshalb war im Dorf noch niemand auf den Beinen?
Ein Windstoß wehte ihr ins Gesicht, heißer Wüstenatem, der ihren Blick auf den Berghang lenkte, der sich hinter dem Dorf erstreckte und den nördlichen Horizont markierte. Der Himmel über dem Bergrücken war wie mit Blut getränkt, ein dunstiges Rot, das Form und Farbe wechselte, sich aufblähte und wieder abschwoll. Dort, auf einem Kalksteinplateau, lag eine bei Wanderern beliebte Hochebene, genannt Les Gras, auf der die typischen Pflanzen der Garrigue wuchsen: Wacholder und Buchs, Zistrosen und Wermut, Rosmarin und Thymian, dazwischen die eine oder andere grüne Eiche.
Offenbar brannte es auf den Gras.
Wie gebannt starrte Tori in das infernalische Leuchten. Inzwischen war das Licht in einigen Häusern von Belleville angegangen. July sprang neben ihr auf das Fensterbrett. Sie legte den Arm um die Hündin. Wie schlimm war es? Waren Menschen in Gefahr? Mit jeder Bö wurde der Wind stärker. Tori spürte seine sengende Hitze auf ihrer Haut. Was, wenn der Wind das Feuer weiter in ihre Richtung lenkte? In Gedanken spielte sie ihren fluchtartigen Aufbruch durch und drückte den Hund noch etwas fester an sich. Doch der Pitbull war die Ruhe selbst. Also gab es nichts, wovor man sich fürchten musste, jedenfalls noch nicht.
Doch an Schlaf war nicht mehr zu denken.
2
Auf den Gras, ein paar Stunden früher
Pierre Chalard liebte es, die Nacht bei den Schafen zu verbringen. Er hatte sie mit den beiden Hunden auf seine Lieblingsweide getrieben, oben auf die Gras, unweit von Chapias. Beim Schafehüten ließ es sich ausgezeichnet philosophieren, fand er, schon die alten Griechen empfahlen das, auch deshalb ging er gern mit der Herde seiner Familie hinaus, wenn er in den Semesterferien zu Hause war.
Sein Vater Charles war stolz auf die kleine Schar, die aus zwei Böcken, einundzwanzig Mutterschafen und zwölf Lämmern bestand. Es waren kompakte Tiere, lebendig und mit gutem Fleisch, aus einer alten französischen Rasse namens »Raïole«, ein Name, der aus dem Okzitanischen stammte und so viel hieß wie ›royal‹. Nun, königlich fand Pierre die Tiere nicht, trotz der fein gebogenen Hörner, aber sie waren perfekt an die Garrigue angepasst, bevorzugten Kräuter und Kastanien und die Eicheln der Grüneiche. Außerdem gab es Geld von der EU dafür, dass die Familie Chalard eine alte Haustierrasse züchtete und vor dem Aussterben bewahrte.
Die Herde hatte den ganzen Tag gegrast, auf dem schönsten Platz, den er auf der Hochebene kannte: sattes samtiges Grün zwischen weißen Steinmauern, an der Schmalseite eine Gruppe schattenspendender Bäume. Nichts stimmte seliger als das Malmen und Rülpsen grasender Schafe, begleitet vom Summen der Bienen und dem zufriedenen Seufzen der dösenden Hunde. Bruno, der grauhaarige Herdenschutzhund, lag wie immer bei seinen Schafen. Mystère, Pierres junger Berger Picard, ein weißblonder Zottel, dessen rechtes Ohr stets müde herabhing, egal, wie aufgeweckt der Hund sich gab, ruhte neben seinem Herrchen. Das holte, nach ausgiebiger Lektüre im Epikur und nach einem Nachtmahl aus Rotwein, Wurst, Brot und Tomaten, ein Päckchen Tabak aus seinem Rucksack und einen in Alufolie gewickelten Brocken. Es war ein Stück vom Haschisch, das er heute Morgen in seinem Zimmer unter der Matratze gefunden hatte, wo er es vor Jahren versteckt hatte. Ob der Stoff noch wirkte? Er drehte sich einen Joint und rauchte bedächtig, jedem Zug nachspürend. Dann ließ er, auf der Decke liegend, die Gedanken fliegen. Was war Glück? Wenn der Körper frei von Schmerzen war und die Seele gleichmütig und friedlich? Epikur zufolge war er also glücklich.
Der würzige Duft der Garrigue mischte sich mit dem Geruch der wiederkäuenden Schafe und dem süßen Haschischrauch. Die Vögel verstummten, die Zikaden sägten lauter, die Sterne rückten näher. Wind kam auf, heißer Wind, der keine Abkühlung schenkte, er wehte schon seit Tagen aus dem Süden und brachte roten Wüstensand mit. In der Ferne grummelte Donner. Ein Gewitter? Das wäre an der Zeit, alles lechzte nach Regen. Er würde nass werden, sicher, dachte Pierre. Aber das störte ihn nicht.
Die Unendlichkeit des Universums stimmte ihn demütig. Pierre stellte sich vor, wie er eines Tages mit Mystère von den Cevennen bis in die Pyrenäen wandern würde, die alten Schaftriften entlang, die zugleich Pilgerwege waren. Obwohl er nicht religiös war, faszinierte ihn die Verbindung des Schafs mit dem Heiligen, wie es sich im Wort vom ›Lamm Gottes‹ manifestierte. Mit solchen Gedanken und einer sanften Haschischdröhnung schlief er ein.
Ein tiefes Knurren weckte ihn. Pierre schrak hoch. Bruno. Irgendetwas beunruhigte den Hund.
Bruno war ein Veteran, ein mittlerweile ziemlich struppiger Berger Pyrenée, Vaters Hund, der als Herdenschutzhund bei den Schafen lebte, seit er ein Welpe war. Ganz so wie alle Hunde, die ihre Herde verteidigen sollten, wenn jemand sie angriff – Wolf oder Mensch. Dass Bruno einem Wolf standhalten konnte, bezweifelte Pierre allerdings. Dafür brauchte es einen echten Kampfhund, einen Kangal oder einen Molosser. Bruno aber war viel zu verzogen, um Tier oder Mensch ernsthaft gefährlich zu werden.
Bruno stand am Eingang zur Weide, einer Öffnung zwischen den hüfthohen Mauern, die von einem einfachen Gatter aus Holz verschlossen war. Pierre, der unter den Bäumen am gegenüberliegenden Ende der Weide geschlafen hatte, lief an der unruhigen Herde vorbei zu ihm, gefolgt von Mystère. »Was ist los, Bruno?«, flüsterte er. Im Licht der Sterne sah er, dass sich Brunos Nackenhaare sträubten. Doch der Hund knurrte nicht mehr. Er begann sogar, ganz sachte mit dem Schwanz zu wedeln. Pierre starrte ins Halbdunkel. Er hörte nichts. Er sah nichts. Und doch: da war etwas.
»Hallo?«, rief er in die Dunkelheit.
Schritte auf dem Schotter des Feldwegs. Etwas lief über den Feldweg Richtung Chapias. Das war kein Tier. Ein Mensch? Niemand, den er kannte, würde morgens um drei Uhr über die Gras wandern. Selbst Touristen schliefen nachts.
Pierre tätschelte Bruno, der dem Schemen hinterherblickte, aber sich beruhigt hatte. Auch die Herde wurde langsam wieder still. Bruno und Mystère legten sich zu den Schafen und Pierre kehrte zu seiner Decke unter den Bäumen zurück.
Er konnte noch nicht lange geschlafen haben, als er vom Blöken der Mutterschafe aufwachte. Sie riefen nach den kläglich bähenden Lämmern. Die Hunde standen mit gespitzten Ohren und bebender Rute bei der Herde und nahmen Witterung auf.
Pierre roch es jetzt ebenfalls. Brandgeruch. Das war kein Kaminfeuer. Und auch kein Lagerfeuer. Er blickte auf. Das hier war größer: Der Himmel leuchtete rot, dort, wo die Felsnase aufragte, die man hier Crag du Diable nannte.
»Bruno! Mystère! Nach Hause!« Die Hunde reagierten sofort und zogen einen Halbkreis um ihre Schützlinge. Die Schafe schmiegten sich eng aneinander, das furchtsame Blöken wurde immer lauter. Pierre ging voraus und öffnete das Gatter zwischen den Steinmauern. Schon strömte die Herde durch den engen Durchlass und begann panisch den Weg hinunter zur Straße zu galoppieren. »Aufpassen«, zischte Pierre. Die Hunde schnellten vor, setzten sich an die Spitze der Stampede, bis die Tiere ruhiger liefen, und lenkten sie dann beim steinernen Wegkreuz von der Straße ab auf einen schmalen Pfad, der von den Gras hinunter Richtung Labeaume führte. Als ein Schaf ausbrechen und über das Geröll am Wegesrand klettern wollte, war Mystère sofort zur Stelle und brachte das Tier mit einem Kniff ins Hinterbein zurück in die Herde. Pierre atmete tief ein. Seinem Vater dürfte er mit einem verletzten Schaf nicht kommen, das gäbe Ärger. Aber Mystère hatte sich bewährt, obwohl er noch so wenig Erfahrung hatte, und das machte ihn stolz.
Sein Rucksack. Er blieb stehen. Er musste ihn auf der Weide vergessen haben. Glücklicherweise steckte sein Mobiltelefon in der Hosentasche. Pierre rief die 18 an und meldete den Brand, im Laufschritt hinter den Schafen her, die den steilen Pfad hinunter zum Hof der Familie Chalard liefen, ruhiger jetzt, die Gefahr war weit genug weg.
Pierre drehte sich um. Am Himmel stand der schmutzigrote Widerschein des Feuers. Der aufkommende Wind würde die Flammen über das Plateau jagen. Zwischen dem Hof und der Feuersbrunst lag nur die Straße nach Chapias als Feuerschneise.
Von Rosières her hörte man die Alarmsirene der Feuerwache. Wird schon gut gehen, dachte Pierre.
3
Belleville rühmte sich einer Grande Rue, obwohl es nur ein Dorf mit weniger als tausend Einwohnern war, mit verwinkelten Steinhäusern und krummen Gässchen. Auf dieser Hauptstraße gab es einen Bäcker, einen Metzger, eine Apotheke, das Maison de la Presse und das Café von Francine. Sie zerschnitt das Dorf in eine Hälfte oberhalb und eine Hälfte unterhalb der Kirche. Tori wohnte unterhalb, im »Externat«, mit Blick auf einen bewaldeten, zum Teil parkähnlichen Hang. Hinter ihrem Haus führte eine steile Treppe auf einen schmalen Gang, der vor dem Haus des Metzgers mündete. Dort und beim Bäcker gleich nebenan fand der Dorfklatsch statt, wenn es denn etwas zu beklatschen gab.
Tori hatte ihren Einkaufskorb vom Haken genommen und die protestierende July zu Hause gelassen, eigentlich wollte sie nur Brot kaufen und ein paar Fleischreste für den Hund. Doch vor Metzger und Bäcker hatten sich alle versammelt, die ein dringendes Bedürfnis verspürten, sich über vergangene und künftige Schrecken auszutauschen, heute ging es – worum sonst? – um das Feuer auf den Gras.
In der Schlange vor dem Metzger stand Karim, mit rollenden Augen und zerrauften dunklen Locken, ein bulliger Kerl, der dem mutmaßlichen Brandstifter Fürchterliches anzutun drohte, weshalb sie schnell weiterging zum Bäcker. Sie mochte Karim nicht sonderlich, und das hatte mehrere Gründe. Zum einen störte es sie, dass er auf der Straße unterhalb ihres Maison Sarrasine unter deftigen Flüchen an den maroden Autos seiner Kumpels herumschraubte und dabei seine Umgebung mit einer Art arabischem Hip-Hop zudröhnte. Vor allem aber verzieh sie ihm nicht, dass er July misshandelt hatte. Er hatte das Tier von einem verunglückten Kumpel übernommen und geglaubt, sich einen menschenbissigen Kampfhund ins Haus geholt zu haben. Doch July war alles andere als das, und dafür war sie bestraft worden. Tori hatte das halbverhungerte Tier gerettet, das ihr seither täglich seine Dankbarkeit bewies. Sicher, Karim hatte sich später für seine Brutalität entschuldigt. Dennoch.
Am Ende der Schlange vor dem Bäcker stand Hugo, Toris Nachbar, ein Rentner, der jeden Morgen um Punkt sieben Uhr das Brennholz für den Küchenherd seiner Frau hackte, bevor er mit seinem betagten Moped auf einen kleinen Schwarzen mit Schuss ins Café de la Beaume nach Rosières knatterte. »Das war kein Gewitter. Das war Brandstiftung«, sagte er zu jemandem vor ihm. »Irgendein wilder Camper hat sich ein Feuerchen gegönnt. Touristen eben. Landplage.«
Tori hörte dem Gemurmel um sie herum nur mit halbem Ohr zu, während sie sich langsam mit den anderen vorschob. Egal, ob es ein Gewitter gewesen war oder Zündelei: Feuer prägte die Landschaft des Vivarais.
»Die Cevennen müssen brennen.« Für einen Moment spürte sie einen eisig kalten Luftzug, der die morgendliche Hitze durchschnitt. Das war der Schlachtruf im königlichen Heer gewesen, das ausgezogen war, um die rebellischen Protestanten des Vivarais zur Raison zu bringen. Jahrelang hatten sich die Hugenotten gegen ihre Verfolgung zur Wehr gesetzt. Erst 1710 war der letzte Aufstand niedergeschlagen worden. Man fürchtete hier das Feuer nicht nur aus naheliegenden Gründen: Die Erinnerung an das Schicksal der Vorfahren saß den Menschen im Dorf in den Knochen und im Gemüt.
»Madame?« Melanie Crespin, die Bäckersfrau, deren schwarzgefärbtes Haar einen grauen Scheitel hatte, klang ungeduldig. Tori war entgangen, dass sie längst an der Spitze der Schlange angelangt war. Sie kaufte ein Baguette und ein Croissant, zahlte, grüßte nach rechts und nach links, während sie sich an den Wartenden vorbeiquetschte, und lief wieder hinunter ins Externat und zu July, die bereits ungeduldig auf sie wartete.
Es gab ein festes Frühstücksritual im Maison Sarrasine, das je nach Jahreszeit draußen oder drinnen stattfand. Bei vorsommerlichen Temperaturen saß man auf der großen Terrasse, über der die Sonne aufging, im Hochsommer auf der überdachten und schattigen Veranda vor dem Eingang, und im Winter stand man entweder in der kleinen Küche oder saß im großen Esszimmer. Über die Reihenfolge war nicht zu diskutieren. Erst bekam July ihre Mahlzeit, schon, damit das Tier Ruhe gab und nicht dauernd neben Tori stand, mit herzzerreißend bittendem Hundeblick. Dann erst kamen die Menschen.
Während July schmatzend über ihrem Napf hockte, ließ Tori Kaffee aus der Maschine erst in einen Becher für sich selbst und dann in einen zweiten laufen. Sie stellte Butter, Brot und Käse auf ein Tablett neben die zwei Becher und trug es auf die Veranda, wo es eine Bank, einen großen Tisch und ein paar Korbsessel gab. Hier saß sie besonders gern, man blickte auf die Dächer der Nachbarhäuser, auf die Treppe und das Eingangstor und auf die alte Kletterrose, die unten im Hof wuchs und deren Triebe sich die Treppe entlang bis hoch zur Veranda gerankt hatten. Die Rose blühte nur einmal, im Mai, mit gefüllten Blüten, porzellanrosa und duftend. Carl hatte sie geliebt.
Sie stellte den zweiten Becher Kaffee dorthin, wo früher Carl gesessen hatte. »Ich denke an dich«, sagte sie leise.
Sie vermisste ihn noch immer, obwohl der Schmerz langsam nachließ. Ihre Liebe hatte gerade einmal drei Jahre Zeit gehabt, bevor Carl in ihren Armen gestorben war. Oben, in einem der Schlafzimmer, das sie die Kapelle nannte, im ältesten Teil ihres Hauses, über dem der Cheminée Sarrasine stand, der Sarazenerschornstein, der dem Haus seinen Namen gab. Das Haus hatten sie und Carl noch gemeinsam gekauft. Erst seit Kurzem wusste sie, wie alt es wirklich war und welche Geheimnisse sich hinter seinen Mauern verbargen.
Natürlich war das albern, so ein Ritual, aber sie brauchte das. Manchmal stellte sie sogar noch einen dritten Becher auf den Tisch – für Jan. Jan Fessmann, der die Wandgemälde der Kirche von Belleville restaurierte, wenn er nicht, wie schon seit Wochen, in Spanien war, um irgendeinen anderen komplizierten Fall zu begutachten. Jan, der einzige Mann, der ihr seit Carl wenigstens ein bisschen nahegekommen war.
Sie trank erst ihren und dann Carls Becher aus, stand auf und nahm die Hundeleine vom Haken, was July in einen Kreisel der Begeisterung versetzte. Eigentlich brauchte die Hündin keine Leine, aber es war besser, sie dabeizuhaben, manche Leute hatten Angst vor Hunden.
Sie nahmen den Weg den Hang hinauf, an dem sich das Unterdorf von Belleville erstreckte. Hier wuchsen Grüneichen, Kastanien, Lorbeerbäume. Tori mochte sich nicht ausdenken, was geschehen würde, bräche hier ein Feuer aus. Aber Feuer brachen nicht einfach so aus. Die meisten, das wusste sie mittlerweile, wurden von Menschen verursacht – durch weggeworfene Zigarettenkippen, nachlässig gelöschte Campingfeuer, heißgelaufene Autos oder auch Brandstiftung. Man konnte im Grunde nur hoffen, dass es ein verirrter Blitz war, der gestern die Gras in Brand gesetzt hatte. Ein Feuerteufel, der im heißen Hochsommer durch die Kiefernwälder streifte, konnte unfassbares Unheil anrichten.
July tobte durch das trockene Gras, sprang auf halbverfallene Mauern, jagte einem Vogel hinterher und tat so, als ob sie ein verspieltes Hündchen wäre. Dabei war sie ein perfekt ausgebildeter Therapiehund und normalerweise sehr erwachsen.
Nach einer Runde über steile Pfade und überwucherte Feldwege rief Tori nach dem Hund, der folgsam angerast kam und sich an ihr Bein schmiegte. »Wir müssen zur Arbeit gehen, meine Kleine«, murmelte Tori. Als ob sie verstanden hätte, trottete July brav neben ihr her auf dem Weg zurück ins Dorf.
Es war angenehm kühl in der Bibliothek von Belleville, das war das Gute an alten Steinhäusern mit meterdicken Wänden. Doch so alt das riesige Haus auch war, so wenig sah man davon, wenn man hineingegangen war. Hinter der schweren Eichentür öffnete sich eine weitere Tür, aus Glas, die in einen unromantisch funktionellen Raum führte. Ein offener Kubus mit geraden weißen Wänden, der wie eine Puppe in der Puppe in seiner steinernen Hülle saß. An den Wänden standen Bücherregale, zwei Regale dienten als Raumteiler, um die Lesetische ein wenig vom Rest des Saals abzugrenzen.
An einem Tisch am Fenster saß Monique Bonnet, die Bibliotheksleiterin, kaum wahrzunehmen hinter ihrem Computerbildschirm. Sie war seit gestern damit beschäftigt, die neu angeschafften Bücher für den Katalog zu erfassen. Monique winkte ihr zu, als Tori durch den Saal nach hinten ging, an ihren Tisch, auf dem die drei Bände der »Geschichte der Kamisardenkriege« lagen, die sie mit ihrem noch immer schwächelnden Französisch zu lesen versuchte.
Monique war eine kleine, zarte Person mit jenem Stilgefühl, das man französischen Frauen ganz allgemein nachsagte, doch gemeint waren wahrscheinlich die Pariserinnen. In Belleville jedenfalls war Monique ein bunter Vogel, hier trugen die Frauen normalerweise Jeans und T-Shirts und weder Seidenstrümpfe noch Pumps oder Etuikleider wie das, was Monique heute trug: ein ärmelloses Kleid aus lichtblauem Stoff, das passte nur zu Frauen mit einer untadeligen Figur.
Während Tori seit dem Frühjahr ein paar Kilo zugenommen hatte, was sie beruhigte – sie fühlte sich bei ihrer Größe von eins einundachtzig sonst wie ein Kleiderständer –, hatte Monique abgenommen, unter ihrem schmalen Kleid zeichneten sich die Hüftknochen ab. Auch ihre Heiterkeit hatte sie seit dem Drama eingebüßt.
Natürlich waren alle erschüttert gewesen, als man im vergangenen Jahr Paulette Theissier in der Kirche von Belleville gefunden hatte, wo sich die Dorfapothekerin erhängt hatte. Monique aber war völlig zusammengebrochen und musste ins Krankenhaus gebracht werden, zwischen den beiden Frauen hatte es wohl ein starkes Band gegeben.
Doch waren wirklich alle im Dorf gleichermaßen erschüttert gewesen? Manch einer, so kam es ihr vor, hatte Paulettes Selbstmord als angemessenes Selbstopfer empfunden, als Sühne für das, was ihre Familie in der Vergangenheit anderen angetan hatte. Und womöglich auch als Schuldanerkenntnis. War Selbstmord nicht gleichbedeutend damit? Nach ihrem Tod jedenfalls wurden alle Ermittlungen im Fall des Todes eines alten Dorfbewohners eingestellt. Man hatte ja jetzt seinen Sündenbock – und das Dorf behielt, von jeglichem Verdacht befreit, seine Ruhe.
Nur Tori fürchtete manchmal, in einem Dorf von Mördern zu leben. Freundliche, zugängliche Mörder, gewiss. Aber das war eher noch beunruhigender.
Monique erholte sich von ihrem Zusammenbruch nur langsam, deshalb hatte Tori angeboten, ihr in der Bibliothek auszuhelfen. Es gab nicht viel zu tun dort, sie konnte das bestens mit Recherchen zur Geschichte ihres Hauses verbinden. Nach allem, was sie bislang wusste, war das Maison Sarrasine eines der ältesten Häuser im Dorf, womöglich stammten Teile des Hauses aus dem zwölften oder dreizehnten Jahrhundert. Einer seiner früheren Besitzer war Henri Balazuc gewesen, ein noch heute als Held verehrter Anführer der Kamisarden. Das war einer der Gründe, warum sie sich in die Geschichte des alten Vivarais vertiefte, das Land der Abtrünnigen und Rebellen. Der andere Grund hieß Carl Godon, dessen hugenottische Vorfahren aus dem Vivarais stammten. Sie hatten gemeinsam nach der Geschichte seiner Ahnen forschen wollen – aber dazu war es nicht mehr gekommen. Sein Tod hatte so viele Pläne zunichtegemacht.
Doch es gab noch einen weiteren Grund, sich in die Geschichte zu vertiefen. Die Bibliothek sammelte Fundstücke für eine Ausstellung zu »Tausend Jahre Belleville«, viele machten dabei mit: Es kamen die Alten, die sich von irgendeinem Familienerbstück trennten, oder junge Leute, die ein altes Haus ausgeräumt hatten. Den spektakulärsten Fund bislang hatte Tori selbst beigesteuert: eine Bibel, die Henri Balazuc gehört haben dürfte, und ein Psalmbüchlein, das man im Kopftuch oder im Haarknoten verstecken konnte, wenn Soldaten anklopften, um die Reformierten bei der Ausübung ihrer verbotenen Religion zu erwischen.
Seit der Mittagspause hatte sie noch niemand gestört. Die Stammkunden kamen morgens. Simone, ein dürres altes Weib mit krummem Rücken und scharfer Zunge, las täglich Zeitung und lieh sich ab und an die neueste Literatur aus. Sie war Lehrerin gewesen. »Was man weiß, kann einem niemand nehmen«, pflegte sie zu sagen. Sie bewegte die Lippen beim Lesen, manchmal las sie laut mit oder schimpfte, wenn ihr etwas missfiel, eine Meinung oder ein Politiker. Oft gab es Streit, wenn Louis vor ihr da war und bereits über Le Monde saß. Tori war sich nicht sicher, ob der kurzsichtige alte Mann die Zeitung wirklich las, oder ob er nur ein tägliches Ritual genoss, wie es sich für einen kultivierten Herrn gehörte.
Nachmittags kam das eine oder andere Kind, das sich ein Buch auslieh, und, seit den Semesterferien, ein junger Schlaks mit dunklen Locken, Pierre Chalard, ein Philosophiestudent aus Montpellier, für den Monique extra Les Temps Moderne abonniert hatte. Er fragte nach Büchern, für die sich sonst niemand interessierte. Im 21. Jahrhundert war es exotisch geworden, die alten Griechen zu studieren.
Die Zeit verging in tiefer Ruhe, anders als im Buch, das sie las. Die Kamisarden, wie die radikalen Protestanten der Cevennen genannt wurden, und die Soldaten des Königs schenkten einander nichts, das Buch war voll exquisiter Grausamkeiten. Tori hatte das Gefühl, dass sich sein Autor geradezu berauschte am Meucheln von katholischen Priestern und Staatsbeamten auf der einen und am Rädern, Verbrennen, Erhängen, Vergewaltigen auf der anderen Seite. Zwei Jahre lang hatten die Kamisarden standgehalten, einer der besten europäischen Armeen war es nicht gelungen, sie zu bezwingen. Der Preis war hoch; 446 Dörfer, schätzte man, waren von den Soldaten des Königs niedergebrannt worden. Tausenden der »Kinder Gottes«, wie die Kamisarden selbst sich nannten, gelang die Flucht in die Schweiz oder nach Deutschland, die Bevölkerungszahl des Vivarais sank, die Dörfer verödeten. Verwilderte Gärten, geschwärzte Steinwände, abgedeckte Dächer, leere Fensterhöhlen, durch die sich Gestrüpp zwängte: Tori sah das alles vor sich und spürte den kalten Wind, der aus der Vergangenheit ins Heute blies.
Dass Feierabend war, merkte sie erst, als Monique »es ist gleich achtzehn Uhr« rief, ihren Computer ausschaltete und aufstand. »Lass uns Schluss machen, heute kommt niemand mehr.«
Tori klappte das Buch zu, packte ihre Notizen ein und erhob sich ebenfalls. July, die stundenlang geduldig unter dem Tisch gelegen hatte, streckte sich, gähnte ausgiebig und ging mit wehendem Schwanz voraus zur Tür.
Ihr Abendbrot nahm Tori auf der Veranda ein, gemeinsam mit July, beide aßen den Rest vom Baguette, Tori mit Käse, der Hund mit Wurst. Nach der schlichten Mahlzeit lehnte sie sich zurück, zählte die am Himmel kreisenden Mauersegler und versuchte, die Bilder von brennenden Dörfern und brennenden Menschen anzuhalten, die vor ihrem inneren Auge vorbeizogen. »Die Cevennen müssen brennen.« Das prägt nicht nur eine Landschaft, das prägt auch die Menschen, noch nach Jahrhunderten.
Ich muss hier raus, dachte sie. Sie streichelte July, die sich auf ihrem Platz zusammengerollt hatte. »Ich lass dich für ein paar Stunden allein, Kleine, ja?« Sie tat das ungern. Doch es gab nur einen Ort, der sich für eine kleine Flucht eignete, und der war selbst für Hunde, die Schlimmeres gewohnt waren, nicht geeignet.
Sie nahm das Fahrrad. Es war nicht weit von Belleville nach Joyeuse, man fuhr die Landstraße hinunter über Blajoux, durch Rosières hindurch und dann über die Brücke, die über die Beaume führte. Im Dorf roch es nach Kanalisation. Tori trat kräftig in die Pedale, solange es aufwärtsging, und ließ sich dann die Landstraße hinabrollen. Sobald sie Belleville hinter sich gelassen hatte, empfing sie der Duft von dürrem Gras und heißer Erde. Im Juli und im August herrschte hier am Rande der Cevennen Gluthitze, in diesen Wochen hielt man sich am liebsten drinnen im kühlen Haus auf. In diesem Sommer war überdies jede vorübergehende Abkühlung durch ein paar kräftige Gewitterregen ausgeblieben.
Die Beaume führte kaum noch Wasser. Als Tori über die Brücke fuhr, stieg ihr fauliger Gestank in die Nase. Wahrscheinlich musste man sich langsam um die Fische Sorgen machen. In Joyeuse, einem mittelalterlichen Städtchen, das sich auf einer Anhöhe über der Beaume erhob, bog sie ab ans Flussufer und fuhr vor bis zur Place de la Grand Font.
Die Bar »Chez Marie-Theres« war Wohnzimmerersatz und Klatschbasar vorwiegend für die Männer aus den Nachbardörfern, ein einzigartiges Kuriosum, ein Platz wie aus einer anderen Welt und einer anderen Zeit. Nirgendwo in Deutschland hätte eine Kaschemme wie diese einen Besuch von der Gewerbeaufsicht oder dem Gesundheitsamt überlebt. Die Fliegen, die in den Schankraum gelangten, nachdem sie sich auf dem stinkenden Abtritt im Hof gelabt hatten, erfreuten sich zwar nicht lange ihres Lebens – über der Theke hing eine Apparatur, die bläulich leuchtete und bösartig blitzte, wenn sie eines der Viecher erwischt hatte –, die elektrokutierten Leichen aber fielen, wenn man nicht aufpasste, in die Biergläser oder Erdnussschälchen, die auf der Theke standen.
Auch bei diesem Wetter galt die althergebrachte Aufteilung: die Touristen ließ man draußen sitzen, sie wollten es ja nicht anders. Die Einheimischen aber versammelten sich im Gastraum, in dem sich die Gerüche mischten – Achselschweiß und Zigarrenrauch, Fusel und aufdringliche Deos. Tori blieb in der Tür stehen und ließ sich von der Geräuschkulisse aus Stimmengewirr, Gelächter und Gläserklirren umspülen, bis sie Worte und Sätze heraushören konnte. Sie hatte eine empfindliche Nase und die dicke Luft bei Marie-Theres bekam ihr nicht, doch was blieb ihr schon übrig, wenn sie nicht allein sein wollte?
Mit Erleichterung sah sie Nico an der Theke sitzen. Sein Gesicht unter den kurzen grauen Haaren war gebräunt, was die weiße Narbe auf der linken Wange hervorstechen ließ, die vom Mundwinkel bis zum Jochbein verlief. Neben ihm stand Eric Crespin, der Bäcker, bleich wie Mehl, so sah er auch im Sommer aus. Jérôme, verantwortlich für die Müllabfuhr, redete mit vom Wein gerötetem Gesicht auf ihn ein. Als Nico Tori erblickte, ging ein Strahlen über sein Gesicht. »Na endlich«, sagte er und umarmte sie zur landesüblichen Begrüßung: Wangenkuss links, rechts und wieder links.
Nico Martens war der Mann für alles Praktische, sie hatten sich passenderweise im Baumarkt kennengelernt. Daraus war eine tiefe Freundschaft geworden. Ohne ihn wäre Tori an ihrer Trauer um Carl erstickt. In einem früheren Leben war Nico bei der deutschen Polizei gewesen, als verdeckter Ermittler im internationalen Drogenmilieu. Das Misstrauen und die inquisitorische Neigung, dachte Tori oft, waren ihm geblieben.
Hinten in der Ecke saßen ein paar Männer, die Bier tranken und lautstark aufeinander einredeten. »Du wirst es nicht glauben«, tönte ein bulliger Typ mit einer Art Wildschweinborste auf dem runden Kopf. »Der Typ wankt auf uns zu, die Haut hängt ihm in Fetzen herunter, aber er läuft noch immer.«
»Furchtbarer Anblick, ich weiß. Die wissen meist noch gar nicht, dass sie im Grunde schon tot sind.« Ein junger Mann mit einem Restbestand von Mitleid.
»Der hat zwei Tage lang durchgehalten, bis er gestorben ist. Vorher hat er noch zugegeben, mit Benzin auf dem Grundstück seines Nachbarn hantiert zu haben. Manche sind sogar für ein bisschen Brandstiftung zu blöd.«
»Kann dir nicht passieren, Robert, oder?«, lachte ein schmaler Kerl, dunkler Haarschopf über den glänzenden dunklen Augen.
Der, den er Robert genannt hatte, lachte nicht zurück.
»Das Schlimmste war der Brand im Pferdehof bei Les Deux Aygues. Zwei der Pferde kamen nicht rechtzeitig aus dem Stall. Hast du schon mal einen riesigen aufgeplatzten Fleischhaufen mit dampfenden Gedärmen gesehen? Und gerochen? Vor allem die Schreie vorher. Ich halt das ja schlecht aus, wenn Tiere leiden.« Der empfindsame junge Mann lächelte verlegen.
»Es würde schon helfen, wenn man den Leuten hier bereits in der Schule beibrächte, wie man sich und sein Haus schützt, wenn es wieder mal brennt«, grummelte der Mann namens Robert. »Ist doch gar nicht so schwer: keine Bäume oder Sträucher am Haus. Regelmäßig die Regenrinnen säubern. Bei Gefahr Fensterläden abnehmen, nasse Laken vor die Fenster hängen und vor allem den Schornstein verstopfen.« Er winkte nach Marie-Theres, die mit schwingenden Hüften herbeieilte.
»Unsere Besten«, sagte Nico und grinste Tori an. »Von der freiwilligen Feuerwehr.«
»Recht hat der Mann. Außerdem mag ich handfeste Kerle.« Tori meinte das durchaus ernst, auch wenn es nur zum Teil stimmte. Carl war eher ein Feinsinniger gewesen, ein Bücherfreund und ein großartiger Anwalt, aber in praktischen Dingen des Lebens völlig unerfahren. Ganz anders als Nico, der den Arm um sie legte und »Dann bin ich ja beruhigt« murmelte.
»Stör ich?«
Tori roch den Mann, noch bevor sie sich zu ihm umdrehen konnte.
»Ah, der Meister aller Handfesten, unser Commandant de Police.« Nico neigte übertrieben höflich den Kopf und grinste seinen alten Freund und Sparringspartner an. Serge Masson gehörte zum Kommissariat in Privas, das etwa fünfzig Kilometer entfernt lag, aber sein Haus lag in der Nähe, oberhalb der Beaume, und er kam nach Feierabend oft vorbei auf ein Glas bei Marie-Theres. Er war einer der wenigen Männer, zu denen Tori aufsehen musste, ein schlanker, gerader, strenger Typ, der selten lachte und jede Gelegenheit nutzte, zu rauchen, Gitanes, selbstgedreht, allerdings nur dort, wo es nicht verboten war. Deshalb war er der Einzige, der sich im Schankraum von Marie-Theres das Rauchen verkniff.
»Also?«, fragte Masson und nahm das Glas entgegen, das die Wirtin bis zum Rand mit Rosé gefüllt hatte. Das tranken alle hier, der Wein galt als mehr oder weniger unbedenklich, auch wenn die große Flasche, aus der Marie-Theres ihn ausschenkte, kein Etikett aufwies, das erkennen ließ, woher der Wein stammte und ob es überhaupt einer war. »Was sagt ihr? Brandstiftung oder Blitzschlag?«
»Brandstiftung!« Jérôme, der Mann von der Müllabfuhr.
»Blitzschlag«, hielt der Bäcker dagegen.
»Also ich habe von einem Gewitter nichts mitbekommen.« Tori war sich unsicher, ob sie sich einmischen sollte, schließlich war sie jemand, der nicht dazugehörte. »Und geregnet hat es auch nicht.«
»Es gibt auch Gewitter ohne Regen. Das sind die gefährlichsten. Was soll es sonst gewesen sein?«
»Sag ich doch! Brandstiftung!« Jérôme. »Die Welt ist voll von Verrückten, die nichts geiler finden als ein schönes großes Feuer.«
»Stimmt soweit. In neunzig Prozent der Fälle ist der Mensch die Ursache eines Brandes.« Leon, ein blonder Hüne mit Pferdeschwanz, der sein olivgrünes T-Shirt über der Hose trug, war hereingekommen, ließ sich ein Glas aus der großen Flasche einschenken und steckte sich eine Zigarette an.
»Ja.« Serge Masson fingerte eine zerknautschte Packung Tabak aus seiner Hosentasche und begann, sich eine Zigarette zu drehen.
»Ja was? In ganzen Sätzen, bitte!« Nico trank den Rest seines Rosés und gab Marie-Theres einen Wink.
»In neunzig Prozent der Fälle.« Masson rollte in aller Ruhe eine perfekte, aber ziemlich dünne Zigarette und steckte das Tabakpäckchen wieder ein.
»Hab ich’s nicht gesagt?« Jérôme stellte sein leeres Glas mit Nachdruck auf die Theke und ließ sich von Marie-Theres nachfüllen. »Wir haben wieder einen Verrückten in der Gegend.«
»Oder einen besonders idiotischen Touristen, der sich mitten in der Garrigue eine Dose Ravioli heißgemacht hat«, murmelte Tori.
»Also was denn nun, Serge? Muss man dir eigentlich jede kleine Information aus der Nase ziehen?« Nico zappelte vor Ungeduld. Das war das Problem bei ehemaligen Polizisten: Sie mussten sich dauernd einmischen und wussten alles besser. Tori kannte das schon: Serge und Nico stritten sich eigentlich immer, wenn sie einander begegneten.
»Ich geh dann mal eine rauchen«, murmelte Serge und lächelte Nico an. Weg war er.
»Meine Güte! Muss der Kerl immer so geheimnisvoll tun?« Nico hob die Hände.
»Er geht von Brandstiftung aus. Das ist doch wohl ziemlich deutlich gewesen, oder?«, sagte Tori.
»Neunzig Prozent«, wiederholte Leon bedeutungsvoll.
»Prima. Wir brauchen allerdings zu hundert Prozent einen Verursacher«, knurrte Nico.
»Kennt jemand Pierre Chalard?« Masson war zurück, umweht vom typischen Geruch seines Tabaks. Daran erkannte Tori ihn blind.
»Du meinst unseren Studenten?« Jérôme lachte abfällig.
»Im Unterschied zu dir riecht Pierre nicht verschwitzt und ungewaschen.« Marie-Theres hatte die Fäuste in die Seiten gestemmt. Sie mischte sich selten in die Gespräche ihrer Gäste ein, nur, wenn es ihr dringend erforderlich zu sein schien. Oder wenn jemand sich zu lange an seinem Glas festhielt.
»Er tut ja auch nichts Handfestes außer lesen!«, verteidigte sich Jérôme.
Nico legte ihm die Hand auf den Arm. »Warte mal, Jérôme. Serge hier will uns wohl etwas damit sagen.«
»Dass unser Intellektueller den Brand gelegt hat?«
Serge verzog keine Miene. »Das habe ich nicht gesagt.«
»Und warum fragst du dann?«
»Pierre war in der Nacht bei seiner Herde auf den Gras. Er hat die Feuerwehr gerufen. Und –«
Serge Masson blickte in die Runde. Er schien es zu genießen, dass alle den Atem anhielten. »Er hat jemanden gesehen.«
4
Pierre hatte mittlerweile seine Zweifel, ob er in der vorletzten Nacht auf den Gras wirklich eine Gestalt gesehen hatte. Mit seinem Vater konnte er darüber nicht reden, »Pierre hat Visionen«, würde es sonst wieder heißen. Visionen im Rausch! Stimmt, ja, er hatte was durchgezogen, nach langer Zeit wieder einmal. Das war ein weiterer Grund, seinem Vater nichts von der nächtlichen Begegnung zu erzählen. Der Alte reagierte auf Dope allergisch, für den war nur Alkohol eine saubere Droge. Hoffentlich hatte er das in Aluminiumpapier eingewickelte Piece Haschisch nicht entdeckt, das er aus Versehen auf seinem Nachttisch liegengelassen hatte.
Sein Vater war schon wach gewesen, früher als sonst, noch vor Sonnenaufgang, als sie mit der Herde von den Gras heruntergekommen waren. Mürrisch wie immer half er, die Tiere auf eine Koppel in der Nähe des Hofs zu treiben. Als Pierre danach geduscht hatte und zum Frühstück in die Küche kam, hatte Robert von der freiwilligen Feuerwehr am Küchentisch gesessen, verschwitzt und verdreckt in seiner Schutzkleidung mit den silbernen Streifen, und sich von Pierres Mutter Kaffee und Rührei servieren lassen.
»Das war vielleicht ein Feuerchen«, knurrte er, während er kaute, »wir hatten alle Hände voll zu tun. Hoffentlich haben wir sämtliche Brandnester erwischt.«
»Hast du eine Vorstellung, wie viele Hektar abgefackelt sind?«
»Vielleicht vierzig oder fünfzig.« Robert schlürfte seinen Kaffee. »Das geht noch, im Vergleich zu anderen Bränden. Wir haben hier oben überwiegend Buschwerk, das brennt nicht lange. An einen Brand in den Kiefernwäldern will ich gar nicht erst denken.«
Pierres Vater nickte. »In der Garrigue brennt es seit Jahrtausenden, die Pflanzen haben sich dran gewöhnt. Gut, dass das dürre Unterholz weg ist mitsamt der ganzen Insektenbrut. Das gibt Platz für junge Bäume und Sträucher. Und Asche ist noch immer der beste Dünger.«
»Ohne Regen wird das Gras noch eine Weile brauchen, bis die Schafe wieder dort weiden können«, hatte Pierre gesagt und war vom Frühstückstisch aufgestanden, um nach den Tieren zu sehen. Wahrscheinlich hatte sein Vater recht. Auf den Gras brannte es immer wieder, seit Menschengedenken. Das war der Gang der Dinge.
Heute früh beschloss er, zusammen mit Mystère nach seinem Rucksack zu suchen und den Schaden zu besichtigen.
Sie gingen den Weg hoch, den die Schafe vorgestern hinabgelaufen waren. Nach kurzem Anstieg gelangten sie ans Wegkreuz, wo sie auf die Straße nach Chapias einbogen. Die Feuerschneise hatte gewirkt, das Feuer war nur bis zur Straße gekommen. Doch jenseits davon war alles Grün verdorrt. Auch die Weide hatte es erwischt, auf der sie in der Brandnacht gelagert hatten. Pierre stiefelte durch die Asche zu seinem Lagerplatz. Von seinem Rucksack waren nur das Gestänge und verschmorte Plastikfetzen geblieben. Das Bändchen Epikur war Asche. Das würde er in der Bibliothek erklären müssen.
Von der Weide aus folgten sie dem Feldweg in die Richtung, aus der das Feuer herangerast war. Überall verbrannte Erde, Bäume, die ihre verkohlten Äste wie um Erbarmen bittend in den gleißend blauen Himmel reckten. Der Weg ging auf eine Felsnase zu, den Crag du Diable, eine gut zehn Meter hohe Felsformation, wie sie typisch war für die Kalksteinlandschaft der Ardèche. Nur in den Nischen des sonst nackten Felsens wuchsen ein paar genügsame Sträucher, darunter der phönizische Wacholder, ein extrem langsam wachsender Busch, der uralt werden konnte und den es nur hier in der Gegend gab. Pierre blinzelte nach oben. Es sah ganz danach aus, als ob das Feuer den Felsen verschont hätte. Dann galt das hoffentlich auch für das, was in einer Nische hinter dem Felsen lag: Francos Refugium.
Wie lange war er nicht mehr dort gewesen? Zwei Jahre? Drei?
Pierre erinnerte sich nicht genau, aber ganz gewiss hatte er seit dem Beginn seines Studiums in Montpellier Franco nicht mehr besucht. Fast hatte er ein schlechtes Gewissen deswegen.
Erst nach einer Weile fiel ihm auf, dass Mystère nicht zu sehen war. Pierre pfiff nach ihm. Das Tier war jung und hatte noch viel zu lernen, aber normalerweise blieb es in der Nähe. Wahrscheinlich hatte Mystère ein Karnickel entdeckt, das den Brand überlebt hatte. Er pfiff wieder. Ein seltsamer Laut antwortete ihm, wie ein langgezogenes Heulen. Pierre lief mit klopfendem Herzen den schmalen Trampelpfad zwischen verbranntem Ginster und Wacholder entlang, dem Laut entgegen.
Wie gut er den Weg kannte. Wie oft er hier entlanggegangen war, im Sommer wie im Winter. Was hatte den Hund erschreckt?
Auf halber Höhe öffnete sich der Pfad auf eine natürliche Terrasse unterhalb der Felsnase. Wie oft hatten sie hier gesessen! Doch das Feuer hatte den Platz nicht verschont. Pierre spürte, wie sein Herz schneller pochte. Er brauchte eine Weile, bis er das Ausmaß der Zerstörung erfasste. Francos Wohnwagen war ausgebrannt. Der einst weiße Lack hatte Blasen geschlagen und sich verfärbt, die Räder waren eine einzige geschmolzene schwarze Masse am Fuß der Felgen. Die Fensterscheiben waren zersprungen, vom Vordach und den Campingstühlen war nur das Gestänge übrig geblieben. Es roch nach verbranntem Plastik und nach etwas anderem, etwas, das einen Reflex auslöste, dem er nur schwer widerstehen konnte: Würgereiz.
Er musste sich setzen, ihm wurde schlecht. Er starrte hinüber zum Wohnwagen, aber er wollte, er konnte nicht hineinsehen. Das schwarze Gerippe des Papageienkäfigs bewegte sich in der leichten Brise, mit einem leisen Quietschen schwang die Tür zum Käfig auf und wieder zu. Pierre ließ das Bild Francos in sich aufsteigen, er sah den kleinen, rundlichen Mann mit dem kahlen Kopf und dem schwarzen Bart in roten Pluderhosen vor dem Campingwagen sitzen, im Schneidersitz, die geöffneten Hände auf die Knie gelegt. Franco war ihnen damals schrecklich alt vorgekommen, aber wahrscheinlich war er nicht viel älter als vierzig gewesen.
Wieder hörte er ein leises Wimmern. Er rappelte sich hoch und blickte sich um. Mystère hockte am anderen Ende der Terrasse vor einem Haufen verkohlter Bretter und ließ den Kopf hängen. Dort, genau dort hatte die Hütte von Francos Hund gestanden, ein schwarzgoldener Beauceron, ein ruhiges, freundliches und zugleich furchtloses Tier. Pierre ging hinüber zu seinem Hund, der einen langgezogenen Klagelaut ausstieß. Der Geruch war jetzt