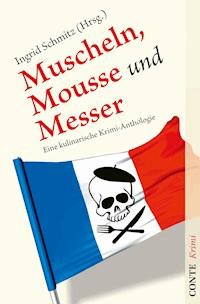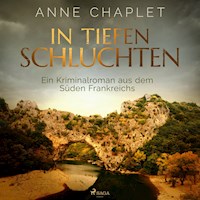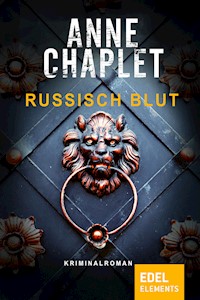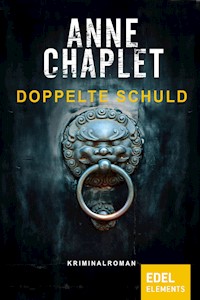4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Krimi
- Serie: Stark & Bremer
- Sprache: Deutsch
Einen Winter, in dem so viel Schnee gefallen ist, hat man in Klein-Roda lange nicht erlebt. Als es endlich taut, kommt manches ans Tageslicht, was er verborgen hatte – auch die Leiche von Michael Hansen, dem bekannten Kriegsreporter. Für die Frankfurter Staatsanwältin Karen Stark scheint der Fall klar zu sein, denn es gibt ein Geständnis: Krista Regler, Wochenendhausbesitzerin in Klein-Roda, gibt zu, den Mann überfahren zu haben. Aber in der Hauptverhandlung kommen Zweifel an Krista Reglers Tatbeschreibung auf – und plötzlich ist ihr Mann verdächtig … Ausgezeichnet mit dem deutschen Krimipreis "Das ist hohe Krimikunst. Anne Chaplet ist ein Roman gelungen, wie man ihn sich für das Genre wünscht. Von der ersten Zeile an mag man ihn lesen und nicht aufhören." Tagesspiegel
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 381
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Über das Buch:
Einen Winter, in dem so viel Schnee gefallen ist, hat man in Klein-Roda lange nicht erlebt. Als es endlich taut, kommt manches ans Tageslicht, was er verborgen hatte – auch die Leiche von Michael Hansen, dem bekannten Kriegsreporter. Für die Frankfurter Staatsanwältin Karen Stark scheint der Fall klar zu sein, denn es gibt ein Geständnis: Krista Regler, Wochenendhausbesitzerin in Klein-Roda, gibt zu, den Mann überfahren zu haben. Aber in der Hauptverhandlung kommen Zweifel an Krista Reglers Tatbeschreibung auf – und plötzlich ist ihr Mann verdächtig …
Ausgezeichnet mit dem deutschen Krimipreis
"Das ist hohe Krimikunst. Anne Chaplet ist ein Roman gelungen, wie man ihn sich für das Genre wünscht. Von der ersten Zeile an mag man ihn lesen und nicht aufhören." Tagesspiegel
Anne Chaplet
Schneesterben
Der fünfte Fall für Stark & Bremer
Edel Elements
Edel Elements Ein Verlag der Edel Germany GmbH
© 2016 Edel Germany GmbH Neumühlen 17, 22763 Hamburg
www.edel.com
Copyright © 2003 by Anne Chaplet
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Michael Meller Literary Agency GmbH, München.
Covergestaltung: Designomicon
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-95530-863-6
facebook.com/EdelElementsinstagram.com/Edel_Elementswww.edelelements.de
I may not always love you
But long as there are stars above you
You never need to doubt it
I’ll make you so sure about it
God only knows what I’d be without you
If you should ever leave me
Though life would still go on believe me
The world could show nothing to me
So what good would living do me
God only knows what I’d be without you
BRIAN WILSON, Pet Sounds, 1966
Inhalt
KAPITEL 1
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
KAPITEL 2
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
KAPITEL 3
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
KAPITEL 4
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Nur erfunden!
KAPITEL 1
1
Klein-Roda, im Herbst
Diese Blicke. Paul Bremer kam sich vor wie ein Kind mit Eimerchen und Schäufelchen, das sich beim Betreten eines fremden Spielplatzes unter den mißtrauischen Augen der anderen Kinder duckt. Gunda und Wally standen bei der Wassertonne, die grünen Gießkannen in der Hand, und reckten die Hälse. Ihre Gesichter ließen erkennen, daß sie nichts davon hielten, wenn ein junger Kerl wie er in den geheiligten Bezirk eindrang. Der Friedhof gehörte den Witwen. Auch in Klein-Roda sterben die Männer vor den Frauen.
Ein kühler Lufthauch wehte den Duft welkender Blumen zu ihm herüber. Nach einer Weile nickten die beiden alten Tanten und setzten ihr Gespräch fort. Nach frommem Gedenken an die lieben Dahingegangenen sah das nicht aus. Bremer schlug den kiesbestreuten Weg nach links ein, den Eimer mit dem Rosenstock in der einen Hand, in der anderen den Spaten. Auf dem Friedhof tratschte man über die Lebenden, über nichtsnutzige Enkel und eitle Enkelinnen, über verschwenderische Schwestern und undankbare Neffen. Er hatte weder den einen noch die andere und schon deshalb hier nichts zu suchen.
Von der Friedhofskapelle löste sich herbstrot leuchtendes Weinlaub. Das Grab lag zwischen der Ruhestätte des vorvorigen Ortsvorstehers – künstlerisch wertvoller Gedenkstein, der Bremer an eine Art geborstenen Bypass erinnerte – und der barock bröckelnden Familiengruft derer von Solms. Bis vor zwei Jahren war es das Grab einer Frau gewesen, über deren Unglück die Älteren im Dorf noch immer bewegt erzählen konnten. Sie hatte sich einst im Löschteich ertränkt, nachdem ihr kleiner Sohn tödlich verunglückt war. Ihr Grab verkam im Laufe der Zeit und wurde zum öffentlichen Ärgernis, vor allem bei den Familien, die ihre Gräber links und rechts vorbildlich in Schuß hielten. Dann wurde es geräumt. Und nun ruhte da wieder jemand, dessen Unglück überlieferungswürdig war.
Paul schob mit der Schuhspitze ein vertrocknetes Gebinde beiseite, das der Wind von einem nicht mehr ganz frischen Grab herübergeweht hatte. Er fühlte sich auch ohne die Blicke von Wally und Gunda fehl am Platz.
»Man möchte meinen, du hättest was geerbt, so wie du dich aufführst«, hatte Marianne gestern gespottet, als er ihr die Rose zeigte, die er fürs Grab gekauft hatte.
»Einer muß sich ja kümmern.« Als ob er sich entschuldigen müßte.
Marianne schwieg ausnahmsweise. Aber er konnte sich denken, was sie dachte. Daß so jemand früher außerhalb der Mauern des Friedhofs verscharrt worden wäre. Und schon gar nicht eine Rose – ausgerechnet eine Rose! – aufs Grab verdient hatte.
Er lockerte den Boden mit der Hacke, entfernte die angegilbte Thuja und die Reste zweier Begonien. Dann setzte er den Spaten an, vorsichtig, so als ob er zu tief geraten und das da unten stören könnte. Das, was in der schlichten Kiste lag, die man an einem bleischweren Spätsommertag in die Tiefe hinabgelassen hatte – in das Loch inmitten der Matten aus künstlichem Gras, die den Anblick mildern und dafür sorgen sollten, daß niemand im Schlamm steht, falls es regnet. Der Pfarrer war da. Die alte Hilde, die kam zu jeder Beerdigung.
Und er.
Zwei Zeilen oberhalb des Grabes fuhr eine Maschine an. Willi hob das Loch für den alten Johann aus, der war vorgestern hinübergegangen, ganz wie es sich gehörte. Er war im Schlaf gestorben, lebenssatt, mit 92 Jahren. So, wie wir alle sterben wollen, wenn es denn sein muß, dachte Bremer und setzte den Spaten ein weiteres Mal an. Dann nahm er den Rosenstock aus dem Eimer und stellte ihn in die Grube, krümelte Erde zwischen die feinen Wurzeln und goß an, bis alles vom Schlamm umhüllt war. Er wartete eine Weile, bevor er das Loch mit der restlichen Erde auffüllte.
Hätte man die Katastrophe verhindern können? Wäre das alles nicht geschehen, wenn ... Es waren müßige Fragen. Unwillkürlich verkrampften sich Bremers Hände um den Spatenstiel. Nichts hätte man verhindern können.
»Eine Rose«, sagte eine Stimme neben ihm. Willi hatte eine unangezündete Kippe im Mundwinkel, kratzte sich die dunklen Locken unter dem lappigen Anglerhut und schüttelte den Kopf. »Also wenn du mich fragst...«
Bremer lockerte den Griff um den Spatenstiel. »Blüht wie von selbst, macht keine Arbeit, sieht immer nach was aus«, sagte er schließlich.
»Verstehe«, sagte Willi, ein Mann mit Sinn für Ökonomie. Und, nach einer Weile: »Denk’ nicht mehr dran. Was hättest du schon tun sollen. Bei so was kann man gar nichts machen.«
Bremer faßte den Spaten wieder fester. Dann nickte er.
Das Drama hatte im Winter seinen Anfang genommen, vor acht Monaten, um genau zu sein. Und ebenso genau erinnerte sich Paul Bremer an den Tag, an dem alles begann. An einen Traum und ein Geräusch. Und an ein Gefühl.
2
Klein-Roda, im Winter
Er fühlte, wie ihm die Brust eng und das Atmen schwer wurde. Das Bild aus dem Traum, der ihn hatte aufschrecken lassen, war noch nicht verblaßt. Ein Zug Gefangener, graue, müde Gestalten, er mittendrin. Und dann das Geräusch – wie sie vorwärtsschlurften, im gleichen langsamen Takt. Jeder Schritt eine Qual.
Er öffnete die Augen. Ein milchiges Licht drang durch den Spalt zwischen den Vorhängen. Wieder erklang das schlurfende Geräusch. Ein Hund bellte. Das Leben nahm Umrisse an: Die Kommode, der Stuhl, der Schrank. Und dann sah er, daß Nemax es sich bequem gemacht hatte auf seinem Brustkorb und sich putzte, die Hinterpfote mit den gespreizten Zehen elegant gen Himmel gereckt.
Er streckte sich, nahm das Katerchen in den Arm und setzte sich auf. Das schlurfende Geräusch, eigentlich mehr ein Schaben und Scharren, kam, wenn ihn nicht alles täuschte, von mindestens drei Seiten. Und ebenso wahrscheinlich wurde es von Marianne, Gottfried und Erwin verursacht, die den Schnee von der Straße schoben und zu Wällen rechts und links davon auftürmten, wie sie es seit dem Kälteeinbruch vor einer Woche jeden Morgen machten, egal, ob es nachts 50 Millimeter oder einen halben Meter geschneit hatte.
Bremer ließ das schnurrende Tier auf seiner Schulter balancieren und ging zum Fenster. Heute waren eindeutig mehr als 50 Millimeter gefallen, die Rosenbüsche glitzerten im weißen Pelz und die Schneedecke zwischen Haustür und Gartentor lag unberührt, noch nicht einmal eine Katzenspur oder das Muster von Amselkrallen war zu sehen.
Er kniff die Augen geblendet zusammen.
»Paul, tu was«, hatte Marianne gestern gesagt, die kräftigen Hände um den Stiel des Schneeschiebers gelegt. »Bei dir ist kein Durchkommen.«
Bremer hatte die Schultern gezuckt. Er weigerte sich, Furchen und Bahnen und Pisten in den frischen weißen Schnee zu ziehen.
»Aber der Gehweg!« Die blonden Locken fielen ihr ins gerötete Gesicht, ihre Augen glänzten. Sie sah aus wie eine nordische Gottheit.
»Wer bei Verstand ist, geht auf der Straße.«
Sie stritten sich bei jedem Wintereinbruch über den richtigen Umgang mit den Naturgewalten. Sie hatte alles gern so, wie es sich gehörte. Und er haßte die schmutziggrauen Eiswälle, die zwischen Grundstücksgrenze und Bordsteinkante gerade mal schmale Pfade frei ließen, meistens eisglatt. Ihm persönlich war es egal, ob der Postbote oder der Bäcker oder der Gaslieferant auf frischgeräumten Straßen einfahren konnten. Und denen im Zweifelsfall auch.
Nemax, der mit halb ausgefahrenen Krallen Pauls nackte Schulter knetete, sprang aufs Fensterbrett und blickte konzentriert einer Meise hinterher. Bremer zog Jeans und Pullover über und ging die Treppe hinunter, um die Zeitung zu holen.
Als er den Riegel zurückgeschoben hatte und die Tür aufzog, mußte er die Hand vor die Augen legen. Die kräftige Februarsonne war über Willis Scheune gekrochen und zündete Lichterketten auf der weißen Fläche. Während er in die Gummistiefel stieg, setzte Nemax vorsichtig eine Pfote auf die glitzernden Kristalle und sah mit gespitzten Ohren zu, wie sie tief einsank und weißbepudert wieder auftauchte. Dann hüpfte er in Bocksprüngen über die Schneedecke und war mit einem Satz auf dem Pfosten am Gartentor, wo er ein Bein nach dem anderen streckte und sorgfältig ausschüttelte.
Bevor Bremer am Gartentor angelangt war, verstummte das Geräusch der Schneeschieber. Auf der Kreuzung vor ihm, dort, wo der Friedhofsweg von der Hauptstraße abzweigte und leicht anstieg, standen Marianne, Gottfried und Erwin, die eine links, der andere geradeaus, der dritte rechts, alle drei das Kinn auf die Hände gestützt, die sie um den Stiel der Schneeschippe gelegt hatten. Wie die Hüter des Schatzes, dachte Bremer.
Im Blickfeld der drei regungslosen Figuren, mitten auf der Kreuzung, stand der Stolz des Dorfes: seine fruchtbaren Frauen und ihr Nachwuchs, letzterer in einem Fuhrpark, der vom antiken Korbwägelchen bis zum neuesten Leichtmetallgefährt alle Kinderwagenmodelle versammelte, die gut und teuer oder gerade angesagt waren.
»Das darf doch wohl nicht wahr sein!« sagte Christine laut. Ihre Augen blitzten, die Wangen unter der Kapuze waren gerötet. Sie war das selbsternannte Alarmsystem des Dorfes, diejenige, die als erste wußte, welche Lebensgewohnheiten und welcher Umweltskandal die Gesundheit aller, vor allem die der Kinder, bedrohten.
Eine stämmige Brünette schob die schicke schmale Sportkarre, mit der man beim Kinderlüften joggen konnte, gemächlich um die Ecke. »Die und laufen! Der kann man beim Gehen einen Knopf annähen!« hatte Marianne kürzlich gesagt – mit aller Verachtung einer Bäuerin, die morgens nach dem Schweinefüttern ihre sechs Kilometer lief und abends noch Fahrrad fuhr, wenn nicht gerade überall Schnee lag.
Bremer holte die Zeitung aus dem Briefkasten, verbeugte sich in Gedanken vor dem alten Herrn, der sie auch heute wieder pünktlich ausgeliefert hatte und lehnte sich ans Gartentor. Die Mütter standen sichtlich erregt im Schnee, neben, vor und hinter ihnen, im Kinderwagen oder Oililly-Jäckchen, nuckelnd, nölend oder am Daumen lutschend, neun rotbackige Kleinkinder. Gemessen an der Einwohnerzahl, hatte Gottfried auf dem Weihnachtsfest im Dorfgemeinschaftshaus vorgerechnet, war Klein-Roda das Dorf mit der stärksten Geburtenrate weit und breit. Gottfried, Züchter preisgekrönter Zwergwyandottenhühner und Edelkaninchen, kannte sich aus mit erfolgreicher Fortpflanzung. »Noch nicht einmal die Italiener machen mehr Bambini!« Der Nachbar hatte stolz das Kinn gereckt und dann Klein-Roda zum Vorbild für ganz Europa erklärt.
Paul winkte zu Marianne und Gottfried hinüber – Erwin wirkte betäubt, wahrscheinlich vom gestrigen Vollrausch – und studierte den ungewohnten Menschenauflauf. Seine Nachbarin hatte ihm an vielen Vormittagen beizubringen versucht, welches Kind zu welcher Mutter und welcher Mann zu welcher Frau gehörte. Christine zu Sascha und Maxima? Oder zu Marcus und Laura? Oder...
Die ganz vorne kannte er gut: Kathrinchen. Sie hatte die Unterlippe zwischen die Zähne genommen, die dunklen Brauen zusammengezogen und die Hand auf den Buggy gelegt, in dem die kleine Nicole schlief. Rechts davon, die Frau, die den Tränen nahe schien, mußte Annamaria sein. Sie nickte im gleichen Rhythmus mit dem Kopf, mit dem sie den Kinderwagen schaukelte, in dem ein pummeliger Blondschopf Anzeichen für einen Wutausbruch erkennen ließ. Supermutter Christine hielt ihr Töchterchen an der Hand, das, unbemerkt von der auf die Versammlung einredenden Mutter, nach der Mütze ihres kleinen Bruders griff, der mit hochrotem Kopf halb aus dem Kinderwagen hing. Und dann sagte Sabine (ein Dreijähriger, ein Zwillingspärchen, ein Jahr alt): »David hätte noch leben können, wenn dieser Arzt nicht gewesen wäre.«
Alle nickten.
»Und dann möchte ich endlich wissen, warum Carmen noch immer im Krankenhaus liegt – ausgerechnet in der Abteilung von diesem Kerl!«
Christine machte hinter das letzte Worte drei Ausrufezeichen. Die anderen jungen Frauen schaukelten die Kinder heftiger.
»Und was ist los mit dem kleinen Ssssien?« Das junge Mädchen, das sich nicht zwischen Sorge und Neugier entscheiden konnte, mußte Katja sein.
»Schoooon!« riefen Sabine und Annamaria.
Seit Tagen schon hing vor dem Haus der Beckers eine Wäscheleine mit Strampelhöschen und Sabberlätzchen, darüber ein Bettlaken, auf dem »Willkommen Sean!« stand. Und seit Tagen war das Dorf in zwei Lager zerfallen – die einen sagten locker »Sssien«, die anderen rollten die Augen gen Himmel und bestanden auf »Schooon«.
»Siehste, das kommt davon, wenn man den Kindern keine vernünftigen Namen gibt!« kommentierte Gottfried diese Debatten mit selbstzufriedenem Lächeln, bis Carmens Mann Zafer protestierte.
»Ist mein Name vielleicht nicht vernünftig?«
»Naja.« Gottfried guckte listig. »Bestimmt. Im wilden Kurdistan.«
»Du kannst doch Anatolien nicht von Australien unterscheiden, du altes Schlitzohr«, hatte Zafer beinahe zärtlich gesagt und dem Alten auf die Schulter geklopft.
Jetzt redeten alle durcheinander. Fasziniert beobachtete Bremer, wie sich der Rhythmus anglich, in dem die Frauen die Kinderwagen in Schwingungen versetzten; immer schneller wurden die Kleinen geschaukelt, von denen einige Anstalten machten, sich darüber zu beklagen. Noch nicht einmal Annamaria kümmerte sich um ihren Sohn, der tief Luft zu holen schien.
Aber es war Kathrinchen, die plötzlich laut wurde. Kathrinchen, die bis heute kein Wort darüber verloren hatte, wer der Vater der kleinen Nicole war, mit der sie schwanger wurde, als sie vierzehn war. Und die im Frühjahr heiraten würde – den Vater ihres ungeborenen zweiten Kindes, Wolle. Ein braver Junge, wie alle sagten. Aus dem Nachbarort. Aber vor allem hatte er einen Arbeitsplatz.
Auch Kathrinchen packte den Griff des Kinderwagens fester. Aber sie stand stockstill, während die anderen immer erregter wippten. Bremer sah, wie sie den Kopf hob, den dunklen Haarschopf nach hinten schüttelte, einen verächtlichen Blick in die Runde warf und hoheitsvoll: »Ihr spinnt doch« sagte. »Ihr tickt nicht mehr richtig. Ihr habt ja alle ’ne Meise.« Dann schritt sie davon.
Niemand sah ihr hinterher. Die Kinder hatten endlich die Aufmerksamkeit der Mütter erzwungen, die einen schimpften, die anderen umgurrten sie. Und schließlich verließen alle die Bühne, die einen gingen nach links, die anderen nach rechts, und die drei stummen Gestalten mit den Schneeschiebern bewegten sich wieder, als ob jemand eine Spieluhr in Gang gesetzt hätte.
Er winkte noch einmal zu den Nachbarn hinüber und ging ins Haus. Als er sich einen Tee gekocht und die Zeitung aufgeschlagen hatte, war ihm klar, warum die Jungmütter heute so aufgeregt waren. Der Fall David Ferber hatte es auf die erste Seite des Lokalteils gebracht.
Bremer wußte nicht, was er von der Sache halten sollte. Der Junge war während einer Operation im Kreiskrankenhaus Feldern gestorben, die als Routine galt, weshalb man auf Betreiben der Eltern eine Untersuchung angeordnet hatte. Die Felderner Allgemeine, deren Mitarbeiter verständlicherweise nicht immer nur über die Bullenschau mit Preiskrönung oder den in Ehren ergrauten Jubilar berichten wollten, hatte den tragischen, aber an sich nicht skandalösen Vorgang in eine Schlagzeile gefaßt, der den Verdacht, den auch die Mütter von Klein-Roda hegten, auf den Punkt brachte: »War es Pfusch?« Was die Untersuchung erst erweisen sollte, ahnte das Käseblättchen und wußten die besorgten Frauen schon jetzt: Da mußte etwas nicht mit rechten Dingen zugegangen sein. Der verantwortliche Arzt hieß Dr. Thomas Regler. Regler, der zurückhaltende, ruhige Typ, dessen Frau ein paarmal im Monat in ihrem kleinen Wochenendhaus in Klein-Roda auftauchte.
Bremer räumte den Frühstückstisch ab und wischte Nemax hinterher, der in das Schälchen mit Katzenmilch getreten war. Früher, ach was: noch vor hundert Jahren, nahm man schicksalergeben hin, daß ein Kind den unzähligen Gefahren des Lebens, den Seuchen und Krankheiten, den Unfällen, dem Hunger, den Men sehen und den wilden Tieren, dem Leben eben, erlag. Heute ist das unvorstellbar geworden – wo doch alle ärztliche Kunst der Welt zu haben ist. Wo alles als möglich gilt. Und wo man gelernt hat, daß das Schicksal besiegt werden kann. Auch bei einem Kind. Vor allem bei einem Kind.
Bremer nahm die zweite Kanne Tee mit nach oben und setzte sich an den Schreibtisch. Sollte er neidisch sein? Er hatte nicht zu den überbehüteten Kindern gehört. Eine Zeitlang hatte er geglaubt, niemand würde sich grämen, wenn er eines Morgens tot im Bett liegen würde. Vielleicht war er ein Findling? Mit dem zarten Körperbau und den bernsteinbraunen Augen sah er ganz anders aus als Vater. Das sagten alle. Und heute fand er das auch. Fotos zeigten Vater als breitschultrigen grimmigen Riesen mit kurzgeschorenen blonden Haaren und blassen Augen. Bremer war noch immer schmal und nicht sehr groß, und bevor seine Haare vorzeitig weiß wurden, waren sie dunkelbraun, fast schwarz gewesen.
Manchmal fragte er sich, ob er jemals Eltern gehabt hatte. An das erste Kinderheim von vielen erinnerte er sich nicht. An das letzte schon. An das dunkle Haus mit den Schlafsälen, in denen sich jede Nacht ein anderer Horror abspielte. Henry war der schlimmste gewesen. Wer da nicht mithalten konnte oder gar weinte, hatte keinen friedlichen Moment mehr. Bremer schüttelte die Erinnerung ab. Großonkel Wallenstein hatte ihn herausgeholt, als er schon glaubte, die Anstalt für ungeliebte Kinder nicht mehr lebend zu verlassen. Er hatte mehr Glück gehabt als andere.
Als unten die Glocke anschlug, war es bereits früher Nachmittag. Er hatte wundersamerweise Seite um Seite heruntergeschrieben, ohne die Überredungsrituale, mit denen er sich sonst jeden Satz abrang. Als er noch der Werbeindustrie diente, hatte er das nicht gekannt – Schreibhemmung. Damals war jedes Wort ein Schuß. Aber mit jedem Buch schien die Schwelle höher zu liegen.
Vor der Tür stand Kathrinchen. Ihr Besuch überraschte ihn nicht. Er war in den letzten Jahren vom Stadtflüchtling, den man mit leisem Argwohn betrachtete, zum guten Onkel des Dorfes geworden; der, den man fragt, wenn man die Antwort der anderen fürchtet. Als sie ihren schon sanft gerundeten Bauch durch die Tür geschoben hatte, sah er hinter ihr Nicole, Daumen im Mund, die nach Nemax Ausschau hielt.
Kathrinchen brauchte einen großen Milchkaffee, einen Lebkuchen und drei Anläufe, bis sie endlich mit dem rausrückte, was sie beschäftigte.
»Die spinnen alle. Die spinnen.«
Paul goß Kaffee nach.
»Die sind nicht ganz dicht.«
Kathrinchen schüttete Milch in den Kaffee und schaufelte zwei Löffel Zucker hinein. »Die kennen ihn doch gar nicht. Keine Ahnung haben sie! Mir hat Dr. Regler damals geholfen. Er würde niemals zulassen...« Sie schüttelte den Kopf.
Paul Bremer griff nach Nemax, der vor der zupackenden Zärtlichkeit des Kindes aufs Küchenbüfett geflüchtet war. Er erinnerte sich, daß Kathrinchen damals zur Entbindung ins eine gute Stunde entfernte Krankenhaus von Feldern geschickt worden war, nachdem der Feldwaldundwiesenarzt aus Bad Moosbach ihr eine Abtreibung nahegelegt hatte.
Sie wußte nicht, was sie glauben sollte. Er auch nicht. Er kannte Thomas Regler nur flüchtig, meist kam dessen Frau allein zu dem kleinen Haus hinter dem Friedhof, das sie sich liebevoll ausgebaut hatte. Krista war eine handfeste, kluge, lebendige Frau ohne Allüren. Und ihr Mann – er erinnerte sich an ein melancholisches Gesicht, an tiefblaue Augen und einen unordentlichen Schopf dunkler Haare – wirkte ebensowenig wie ein arroganter Halbgott in Weiß.
»Kathrinchen – wir wissen nicht, was passiert ist. Das muß alles gründlich untersucht werden. Und man kann es doch verstehen, wenn Eltern in ihrem Schmerz...« Seelendoktor Bremers heile Welt, dachte er und fand sich schrecklich altväterlich.
»Aber das ist es ja! Ausgerechnet Sonja Ferber! Die hat das Kind doch beim kleinsten Mucks angeschrien! Oder geschlagen!« Kathrinchen war den Tränen nah. Bremer betrachtete sie liebevoll. Aus dem Mädchen mit den großen dunklen Augen würde noch lange nicht Kathrin werden. Irgendwie war das tröstlich.
»Es wird eine Untersuchung geben, und dann wird man der Wahrheit schon näherkommen.« Vielleicht. Vielleicht auch nicht.
»Und bis dahin machen sie ihn fertig! Die dummen Gänse sagen, man soll nicht mehr hingehen zu Dr. Regler! Die Kinder wären bei so einem nicht sicher!«
Bremer seufzte. Was immer die Mütter für Probleme mit dem Arzt haben mochten – für Kinder war er der richtige. Er erinnerte sich gut an die Sache mit dem kleinen Mädchen. Die Kleine – wie hieß sie noch? – hatte sich von ihrer Mutter losgerissen und war fröhlich quietschend auf Gottfrieds Hund zugelaufen, als ein Mountainbiker in voller Montur und mit beeindruckender Geschwindigkeit um die Ecke rauschte. Das Kind hatte die Gefahr wahrscheinlich gar nicht wahrgenommen, wohl aber die entsetzten Schreie der Umstehenden. Jedenfalls war die Kleine hingefallen und hatte angefangen, entsetzlich zu brüllen. Der Regler, der das weinende Kind auf den Arm nahm und tröstete, war wie verwandelt. Das melancholische Gesicht sah plötzlich unbeschwert und fröhlich aus, und er flüsterte so lange auf die Kleine ein, bis sie zu lächeln begann und ihm an die Nase faßte.
Offenbar mochte der Mann Kinder, vielleicht sogar mehr, als für einen Kinderarzt selbstverständlich war. Für so jemanden wäre es eine Katastrophe, wenn wirklich ein Behandlungsfehler zum Tod des Kindes geführt hätte.
»Er hat Nicole zur Welt gebracht und jetzt... Ich sehe gar nicht ein ...«
Kathrinchen hatte die Hände um den Leib gelegt. Bremer lächelte erst sie an und dann ihren Bauch.
»Die anderen haben gesagt, das sei verantwortungslos gegenüber dem Kind, wenn ich wieder zu ihm gehe!«
Die Übermütter des Dorfes. Bremer schüttelte den Kopf und nahm Nicole auf den Schoß, damit sie Bleibeverhandlungen mit Nemax aufnehmen konnte.
Kathrinchen rührte im Kaffee, ohne einen Schluck zu nehmen. »Ich meine – man kann doch nicht jemanden verurteilen, wenn man noch gar nicht genau weiß, was wirklich passiert ist.«
»Traust du ihm?« Es war die einfachste Frage, die ihm einfiel.
Sie zögerte. Dann nickte sie.
Als Kathrinchen endlich Nicole auf den Arm nahm und ging, war es drei Uhr vorbei. Bremer aß den übriggebliebenen Lebkuchen und ging wieder an den Schreibtisch.
Er hatte eben den roten Faden wiedergefunden, als es erneut unten läutete. Auf Strümpfen lief er die Treppe hinunter und hätte beim Anblick von Gottfried fast schallend gelacht. Der Nachbar hielt in jeder Hand ein gerupftes und im Licht der Flurlampe schwindsüchtig aussehendes Suppenhuhn. Milde Gaben für das örtliche Orakel, dachte Bremer und nahm ihm die Kadaver ab. Gottfried folgte in die Küche. Nemax, der auf der Küchenbank geschlafen hatte, stellte die Ohren auf und hielt die Nase in die Luft.
»Und?« Bremer rückte dem Nachbarn einen Stuhl zurecht und zeigte fragend auf die Flasche mit dem Obstler.
»Aber nur...«
»Einen winzigen Schluck, wie immer.« Bremer goß das Wasserglas halb voll.
»Hast ja mitgekriegt«, sagte Gottfried nach einer Weile, in der er ausgiebig geseufzt und sich den Nacken massiert hatte.
»Hm.« Paul goß sich auch einen ein. An Arbeiten war eh nicht mehr zu denken.
Gottfried hob mit abwesender Miene das Glas. »Die Ferbers sind völlig aus dem Häuschen. Sie haben sich einen Anwalt aus der Stadt geholt.«
Aus der Stadt. Womöglich noch aus Frankfurt. Das bedeutete nichts Gutes.
»Sie verbreiten überall, der Regler hätte – naja – halt nicht alles so gemacht, wie es sich gehört. Und jetzt wird es eine Untersuchung geben.«
»In der Zeitung steht, daß David an einer allergischen Reaktion gestorben ist. Das hätte bei jedem Arzt passieren können.«
»Sicher«, sagte Gottfried und wiegte unschlüssig das Haupt.
Bremer fragte sich mittlerweile, ob man Thomas Regler eine Chance lassen würde – ihm und seiner Frau. Beide Mitte Dreißig. Keine Kinder.
»Was weiß man schon«, sagte Gottfried, kippte den Schnaps und erhob sich.
Keine halbe Stunde später war Marianne an der Tür. Das runde Bauernbrot, das sie ihm in die Hand drückte, war noch ganz warm. Sie hatte das Backhaus angeheizt – und das bei diesem Wetter. »Ach Marianne«, sagte er und küßte sie auf die Wange. Dann zog er sie in die Küche.
»Aber ich hab’ doch Gummistiefel an. Ich muß gleich noch in den Stall. Ich mach’ dir alles dreckig!«
Bremer guckte sie liebevoll an. Sie putzte jeden Tag. Er nicht.
»Und du kehrst ja nicht vor deinem Haus!« Marianne guckte an sich herunter. Die Gummistiefel trugen einen weißen Schneekragen.
»Na und? Es ist doch längst wieder zugeschneit.« Wenn das so weiterging, brauchten die Nachbarn gar nicht mehr aufzuhören mit dem Schneeschippen. Besser noch, sie fingen erst gar nicht damit an. Mit keimender Anteilnahme fragte er sich, wie hoch der Schnee draußen wohl schon lag und ob er noch trockenen Fußes zum Briefkasten gehen konnte, morgen früh. Und ob es dann überhaupt eine Zeitung geben würde.
Bremer goß ihr einen Schnaps ins Glas, ohne groß zu fragen. Klarer galt in Klein-Roda nicht als Alkohol, sondern als therapeutische Maßnahme oder soziales Gleitmittel. Er war froh, daß die Flasche fast leer war und er eine Entschuldigung hatte, wenn er nichts trank.
»Die Ferbers drehen durch.« Marianne prostete ihm zu und leerte das Glas in einem Zug. Sie klang, als habe sich Sonja Ferber über eine Fehllieferung vom Ottoversand beschwert.
Bremer erschreckte diese ungewohnte Kälte. »Und wenn es dein Kind gewesen wäre, das da auf dem Operationstisch gestorben ist?«
»Dann würde ich weinen um mein Kind, statt auf Schadensersatz zu klagen!«
»Aber wenn im Krankenhaus gepfuscht worden ist und wenn Thomas Regler ...«
Marianne schob ihm das leere Schnapsglas hin. »Thomas Regler ist in Ordnung. Der bringt sich ja halb um bei jedem Kind, das zu ihm kommt. Ärzte sind auch nur Menschen. Und manchmal will es das Schicksal eben nicht anders.«
Bremer starrte sie an. Die schöne Nachbarin schien die einzige zu sein, die nicht an die vollkommene Beherrschung des Lebens glaubte. Alle anderen taten so, als ob das Wort Schicksal ihnen nicht mehr geläufig wäre – oder gar so etwas wie Gottes Wille. Heutzutage hatte man kein Unglück, sondern einen Versicherungsschaden.
»Fragt sich nur, warum er selbst keine Kinder hat. Seine Frau hat doch sonst nichts zu tun.«
Das war nun wieder Marianne, wie er sie kannte. Nie um eine boshafte Bemerkung verlegen – vor allem, wenn es andere Frauen betraf.
Die Nachbarin hinterließ feuchte Spuren auf dem Fußboden und einen kühlen Lufthauch. Als er die Gläser ins Spülbecken gestellt hatte, ging das Licht aus. Der Kühlschrank röchelte noch einmal auf. Die Uhr am elektrischen Backofen erlosch, langsam, als ob sie sich wundere. Bremer sah aus dem Fenster. Auch die Straßenlampen waren aus. Zu seiner Verblüffung verspürte er eine kindliche Freude über die ungewohnte Dunkelheit. Lange würde er sie nicht genießen können, das Licht mußte jede Minute wieder angehen.
Aber es tat sich nichts. Schließlich griff er zu den Streichhölzern neben der Kerze auf dem Küchentisch und zündete sie an. Und als ob er, je länger der Ausnahmezustand anhielt, desto kindischer würde, bekam er eine Gänsehaut, als es unter dem Küchentisch grollte.
Dabei kannte er das Geräusch, obzwar er noch vor Monaten keiner Katze von der Statur des Katers Nemax einen solchen tiefen, markerschütternden Laut zugetraut hätte. Er hob die Kerze. Nemax trabte herbei, mit erhobenem Haupt und gestrecktem Schweif, im Maul ein dunkles Etwas.
Ihm ging der Anblick ans Herz. Das Raubtier mußte Giordano, die Hausmaus, erwischt haben. Die anderen Mäuse waren sicher, sie lebten draußen, tief unter dem Schnee versteckt. Nur Giordano hatte sich für den Winter etwas besonders Cleveres ausgedacht. Er hauste in der Küche, hinter dem Kühlschrank. Und nun hatte der dumme Kerl sich herausgetraut, hatte sich womöglich am Katzenfutter vergriffen, hatte den Mörder mit den Samtpfoten nicht kommen gehört.
Nemax ließ das Fellbündel fallen und schob es mit der Pfote hin und her. Giordano blieb still. Gut so, Kleiner, dachte Bremer. Aber dann vergaß die Maus alle Umsicht und lief hakenschlagend Richtung Haustür. Nemax hatte sie in Sekundenschnelle wieder am Genick – und knurrte wie ein Kettenhund.
Das Spiel begann von neuem. Mach ein Ende, du kleines Raubtier, dachte Bremer und versuchte, das Knurren der Katze und das Quieken der Maus zu ignorieren. Bis er es nicht mehr aushielt. Nemax protestierte, fauchte sogar, als Bremer nach der Maus griff, aber er mußte sie gehen lassen. Der kleine pelzige Körper wand sich in Bremers Händen, während er hinaus und zum Schuppen lief. Dort ließ er das Tierchen frei.
Als er zurückkam ins Haus und seine nassen Socken auszog, spürte er einen Schmerz am Daumenballen. Giordano der Kämpfer hatte ihn gebissen. Seinen Retter. Bremer goß sich den mickrigen Rest aus der Schnapsflasche ins Glas, desinfizierte die Stelle und war fünf Minuten lang gründlich gerührt.
Vielleicht war das der Grund, warum er das Geräusch nicht hörte. Erst, als etwas gegen die Eingangstür polterte, sprang er auf.
Er kam sich vor wie der mißtrauische Wirt im mittelalterlichen Gasthof zum Alten Bock, als er mit hocherhobenem Kerzenleuchter die Tür öffnete. Draußen stand Thomas Regler, das melancholische Gesicht unter dem dunklen Haarschopf weiß, die beiden Hände hochgehalten, als wolle er sich der bewaffneten Übermacht ergeben.
»Ich schieße nicht«, sagte Bremer vorsichtshalber.
Regler lächelte nicht. »Ich brauche Hilfe«, sagte er. Das war nicht zu übersehen. Die rechte Hand war verbunden, weiß konnte man den Verband nicht mehr nennen. Und die linke Hand – Bremer schluckte. Das sah übel aus. Er hielt die Tür auf.
Bremer hatte Thomas Regler noch nie so gesehen. Der Arzt sah völlig entgeistert aus. Wie ein Kind saß er in Bremers Küche und hielt ihm die Hand hin. Gottlob war in der Hausapotheke noch alles Nötige vorhanden für einen provisorischen Verband.
»Sie sollten zum Arzt gehen.«
Regler schaute ihn traumverloren an.
»Ins Krankenhaus.«
Regler drehte den Kopf zum Fenster. Es schneite. Es schneite in dicken Flocken und ohne Pause. »Ein Gutes hat das alles«, sagte er schließlich. Er klang wie einer, der sich wundert über das Leben und seine Schachzüge. »Ich werde so bald nicht mehr operieren können. Kein Grund mehr zu Panik.« Und dann lachte er. »Wie hat mein Pathologieprofessor immer gesagt? ›Und wenn du noch soviel chirurgst, es kommt der Tag, an dem du murkst.‹«
Haben Sie denn gemurkst, wollte Bremer fragen. Was ist geschehen, während der kleine David auf dem Operationstisch lag? Aber Regler war schon aufgestanden. Er brachte ihn zur Haustür.
»Sie werden doch nicht mehr fahren?« Natürlich nicht. Er würde zum Haus gehen, dem kleinen Haus hinter dem Friedhof, dem Haus seiner Frau.
»Können Sie heizen? Haben Sie etwas zu essen?«
Regler hob die Schultern und ließ sie wieder fallen.
»Ist Krista da? Kann sie nicht...«
Regler drehte sich um. Seine Augen schienen noch dunkler geworden zu sein, er preßte die Lippen zusammen. »Krista?« flüsterte er. »Krista?«
Bremer starrte ihm hinterher, bis der Mann in der Dunkelheit verschwunden war. Er horchte in die Nacht. Man hörte nichts, keines der üblichen Geräusche wie das leise Gebrabbel von Erwins Großfernseher oder das ferne Rauschen von der Bundesstraße. Kurz riß die Wolkendecke auf, und im Licht des Mondes lagen lange Schatten auf dem Schnee.
Bremer machte sich eine Flasche von seinem besten Roten auf. Als er endlich zu Bett ging, hüllte ihn die schwarze Melancholie ein. Anne würde nicht wiederkommen. Er würde bis ans Ende seiner Tage alleinbleiben.
Aber vielleicht hatte er auch nur ein Glas zuviel getrunken.
3
Am nächsten Morgen blinkte die Uhr am elektrischen Backofen, und die Heizung war wieder angesprungen. Es schneite ausnahmsweise nicht. Die Nachbarn hatten sich in ihre Festungen zurückgezogen, aus denen Rauchzeichen in den blaßblauen Himmel aufstiegen. Die Meisen hingen an den Futterringen und ignorierten Nemax, der sich auf dem Pfosten neben dem Gartentor postiert hatte und so aussah, als stehe er kurz vor dem ersten Flugversuch. Bremer ging ins Haus, warf den Computer an, erledigte alle E-Mails, studierte ratlos die Kontoauszüge und machte sich an die Arbeit. Irgendwann hatte er keine Lust mehr, zog sich warm an und ging hinaus.
Noch war es hell. Unter den Stiefeln knirschte der Schnee. Die Kälte stieg ihm in die Nase, als er den Weg hoch zum Wäldchen ging. In der Ferne standen Windräder unbewegt vor dem blassen Himmel. Auf dem Schnee sah man die Spuren von Hasen, Rehen und Krähen, aber noch immer wirkte die Landschaft wie in Unschuld gekleidet. Der Schnee deckte alles zu.
Was man wohl finden würde, wenn es taute? Das Übliche – Bierdosen, Tempotaschentücher, Kondome, die Reste von Silvesterraketen, Kinderspielzeug, verlorene Handschuhe. Als er aus dem Wäldchen auf die Anhöhe hinaustrat, breitete sich vor ihm ein blendendweißes Tuch über die Landschaft, bis zum Horizont. Auf der anderen Seite des Tales stand ein Rehbock und schien zu ihm herüberzusehen. Zwei Krähen flatterten einem Greifvogel hinterher, noch ohne die im Frühjahr wachsende Angriffslust. Und auf der Koppel vor ihm hatten sich Maulwürfe durch die Schneedecke gewühlt und dunkle Erdhaufen ins Weiß geschaufelt.
Es war noch immer beängstigend ruhig. Kein Hund bellte, keine Kirchenglocke läutete, kein Auto kam vorbei. Über den Häusern von Groß-Roda standen die dünnen weißen Rauchsäulen fast senkrecht. Kein Traktor heulte, kein Kind schrie. Selbst die Meisen, die in der Hecke mit den Schlehen und Wildrosen hausten und lärmend aufstiegen, wenn man sich näherte, schienen eine Schweigeminute eingelegt zu haben. Und dann erklang die Feuerwehrsirene von Klein-Roda. Es war ein ferner, fast sehnsuchtsvoller Ton, in den sich die Sirene von Heckbach hineinschmiegte. Und jetzt schloß sich die von Ottersbrunn an. Bremer zählte mit. Nein, es wurde weder zur Übung gerufen noch zum gemeinsamen Besäufnis. Es war ernst.
Er kehrte um. Vielleicht brannte es – womöglich gar in Klein-Roda. Erwins Bruchbude stand auf der Liste der gefährdeten Bauwerke ganz oben. Oder es hatte einen Unfall gegeben. Er ging schneller.
Als er in den Feldweg nach Klein-Roda einbog, sah er sie auf der Straße stehen, die Nachbarn. Die Männer in leuchtend orangefarbenen Jacken wirkten verlegen, jeder hatte eine junge Frau neben sich, die auf ihn einredete. Nur Jens stand allein, etwas abseits. Der Briefträger schien immer dazusein, wenn was los war, als ob er eine Antenne dafür hätte.
Marianne winkte Bremer an ihre Seite. »Tamara«, flüsterte sie. »Sie ist seit gestern abend nicht zu Hause gewesen.«
Bremer kannte Tamara. Alle kannten Tamara, ein verzogenes Balg aus dem Nachbarort, die Tochter einer Cousine von Marianne. Tamara war oft bei ihr zu Besuch, wenn die Eltern gerade etwas anderes vorhatten. Tamara mit den langen seidigen Haaren, die sie mit gekonntem Kopfschwung hinter sich warf, wenn sie auf der Dorfstraße aufreizend langsam hin- und herschlenderte. Selbst Gottfried ließ sich noch in Verlegenheit bringen von so viel zur Schau gestellter Jungmädchenschönheit.
»Sie ist doch erst dreizehn«, hatte Marianne im letzten Herbst gesagt, als Christine mit hektischen roten Flecken im Gesicht angekommen war und die Kleine beschuldigte, hinter ihrem Mann herzusein.
»Aber frühreif wie sechzehn«, hatte Gottfried gebrummelt.
Marianne verteidigte Tamara wie eine Mutterhenne. Nur, daß die Kleine kaum etwas von dem anrührte, was sie morgens, mittags und abends auf den Tisch brachte, das gefiel ihr nicht.
»Dann verhungert sie eben!« sagte Bremer, wenn Marianne sich wieder einmal darüber beschwerte, daß Tamara nichts aß, keine Frikadellen, keine Schweinekoteletts, keinen Rosenkohl und keine Torte. Tamara war, natürlich, dünn wie ein Bleistift und wollte Model werden. Was sonst.
»Und sie hat auch nicht angerufen.« Marianne sah aus, als ob das besonders besorgniserregend wäre.
»Seit gestern abend? Und da regt ihr euch schon auf?« flüsterte Bremer zurück. Tamara tat, was sie wollte. Wahrscheinlich hockte sie bei irgendeiner Freundin und probierte die Lippenstifte aus der Kosmetiktasche der Mutter aus.
»Und die Polizei tut nichts!« Marianne machte große, vorwurfsvolle Augen. »Es ist noch zu früh, hat Walter gesagt!«
Bremer gab dem Revierleiter von Bad Moosbach recht.
»Aber unsere Männer gehen jetzt raus! Alles wird durchgekämmt !«
»Unsere Männer« wirkten keineswegs überzeugt vom Sinn des Ganzen. Doch wenn die Heldinnen von Klein-Roda, seine Mütter, etwas wollten, dann parierte man. Und wenn es um Kinder ging...
Werner ergriff das Wort, der Fähnleinführer der Freiwilligen Feuerwehr von Groß-Roda, ein Mann mit tiefer Stimme und nicht dazu passendem Ziegenbärtchen. »Wir gehen durch den Wald hinter Klein-Roda über die Eulenhof-Wiese bis hinunter zur Flußaue und dann wieder hoch nach Groß-Roda!«
Bremer blinzelte in den Himmel. Es sah aus, als würde es gleich wieder schneien. Die jungen Männer traten unruhig von einem Fuß auf den anderen, der Mann von Katja – oder war es der von Annamaria? – schlug die Hände in den dicken Handschuhen gegeneinander, Christines Jan machte Lockerungsübungen.
»Das bringt doch nix!« Gottfried hatte sich neben Bremer eingefunden und schüttelte den Kopf. »Nachts hat es geschneit. Wenn ihr gestern abend etwas passiert ist, dann wird man keine Spuren mehr finden.«
»Und wenn ihr heute jemand etwas getan hätte, dann wäre er schön dumm, wenn er uns eine Fährte durch den Schnee gelegt hätte.«
Gottfried nickte. »Wenn überhaupt, dann muß man beim Loch suchen. Oder – im Tunnel.«
Das »Loch« war ein stacheldrahtumzäuntes Grundstück jenseits der Landstraße, in der Mitte ein Tümpel, umgeben von Tannen und anderen Nadelbäumen. Nur im Winter konnte man die Hütte erkennen und den großen Holzstapel davor und die Solarzelle auf dem Dach. Manchmal stieg Rauch auf aus dem Schornstein. Aber nie sah man jemanden. Ein Jäger aus Recklinghausen übernachte hier ab und an, hatte Wilhelm, der Ortsvorsteher, mal behauptet. Marianne bezweifelte das. Und was Marianne nicht wußte, das wußte auch kein anderer, vor allem nicht besser. Und der Tunnel...
Gottfried stieß ihm den Ellenbogen in die Seite und hob die Augenbrauen. Bremer sah ihm an, daß er die ganze Aktion für idiotisch hielt. Aber wenn es die Weiber beruhigte! »Besser, wir lassen die grünen Jungs nicht allein«, flüsterte er. Der Nachbar sah wetterfest aus, hatte den Hund bei Fuß und schien zu allem entschlossen. Bremer lief ins Haus und holte Fellmütze und Taschenlampe. Dann ging es los.
Mit fast militärischer Präzision bildeten die Männer eine lange Linie, die über die Anhöhe hinter Klein-Roda durchs Wäldchen schwenkte. Eine Weile hörte man nur das Knirschen schwerer Stiefel auf dem Schnee, das Knistern der Regenjacken, Atmen, Husten, Schneuzen. Einer murmelte etwas vor sich hin, das wie »Schwachsinn!« und »Weiber!« klang.
»Rechtzeitig eine hinter die Ohren, das hätte geholfen«, sagte Gottfried neben ihm. Bremer sah ihn von der Seite an. Der alte Herr würde dem kleinen Biest Tammy noch nicht einmal ein Härchen krümmen.
»Und wo ist die Olle von der Tammy?« rief Zafer halblaut.
»Beim Shoppen!« tönte es zurück.
»Stimmt nicht«, flüsterte Gottfried. »Sie war bei Marianne. Und die hat es der Frau von Werner erzählt. Und die...« Hatte bei ihrem Mann auf die Tränendrüse gedrückt. Und der erinnerte die Jungmänner des Dorfes an ihre Beschützerrolle. Und jetzt...
Wahrscheinlich war Tamara längst zu Hause. Und wenn ihr wirklich etwas passiert war? Bremer dachte an den Fall Vanessa. An die Entführung und Ermordung der kleinen Manuela. Fälle, die den Landkreis monatelang beschäftigt hatten, Fälle, die allen Eltern hier ins Gedächtnis gegraben waren.
»Alle kastrieren«, sagte eine Stimme neben ihm. »Die Schweine. Und dann lebenslänglich. Wegschließen, für immer.« Jens sprach mit einer Wut, die Bremer voreilig schien. Man wußte doch noch gar nicht, ob Tamara wirklich etwas passiert war. Und wenn, dann war unklar, was.
»Kleine Kinder umbringen. Erschlagen. Steinigen. Und dafür kassieren die ein paar mickrige Jahre Knast. Und dann werden sie wieder auf die Menschheit losgelassen. Die Schweine.«
Tamara war kein kleines Kind, sie war ein junges Mädchen, fast schon eine junge Frau. Bremer guckte zur Seite.
»Laß man«, flüsterte Gottfried neben ihm. »Der Jens hat so seine Geschichte.«
Die Männer stapften vorwärts. Sie taten es für ihre Frauen. Im tiefen Schnee für sie frieren war das mindeste, was sich gehörte. Bremer sandte einen zarten Gedanken an Anne. Männer, dachte er mit einem Anflug von Rührung. Männer sind so.
Nach Stunden kehrten sie zurück. Bremer war durchnäßt und verfroren und müde und unendlich dankbar für das bißchen Glut im Kamin. Als das Feuer wieder brannte, lehnte er sich in die Sofakissen und starrte in die Flammen.
Natürlich hatten sie Tamara nicht gefunden.
4
Bremer hatte ruhig und traumlos geschlafen und wurde erst von der Sonne geweckt, die durch die dünnen Gardinen vor dem Schlafzimmerfenster drang. Er räkelte sich noch eine Weile im Bett, bevor er aufstand, um zum Briefkasten zu gehen. Katzenfährten durchkreuzten die Schneedecke im Garten, und unter den Meisenringen lagen Körnerreste. Auf der Kreuzung vor Bremers Haus war das halbe Dorf versammelt. Überwiegend die männliche Hälfte, besser gesagt.
Er sah den Friedhofsweg hoch, dorthin, wo das Haus der Reglers lag. Keine Rauchfahne über dem Haus. Wahrscheinlich war Regler wieder nach Hause gefahren. Oder endlich zum Arzt gegangen.
Bremer holte die Zeitung aus dem Briefkasten und lehnte sich ans Gartentor.
»Sie ist doch noch ein Kind!« Mariannes Stimme klang abwehrend. Irgend jemand antwortete ihr, ein Mann, er konnte die Stimme nicht mit einer Person verbinden. Marianne hatte die Fäuste in die Seiten gestemmt, die blonden Locken sträubten sich auf ihrem Kopf. Unsere kampfbereite Löwin, dachte Paul. Ausgerechnet der sonst so schüchterne und seiner Sabine und den drei Kindern völlig ergebene Alexander wagte ihr jetzt zu widersprechen, leicht nach vorn gebeugt, die Hände in der Jackentasche versenkt, eine Mütze mit heruntergeklapptem Ohrenschutz auf dem Kopf.
»Sie ist ein frühreifes, verwöhntes Balg! Und die Eltern sind nicht besser!«
»Die Weiber rechnen immer mit dem Schlimmsten. Dabei weiß man doch, daß das Mädchen eine Herumtreiberin ist!« Und das mußte Sascha mit der Dieter-Bohlen-Welle sagen, der auch nicht gerade als Chorknabe galt.
Marianne sah von einem zum anderen. »Und was war mit Vanessa? Was mit Manuela?« Das waren die Trümpfe. Die beiden Mädchen waren keine koketten Herumtreiberinnen gewesen. Aber jemand hatte sie aufgelesen, verschleppt, vergewaltigt, ermordet.
»Das ist etwas anderes!« Alexander schien wieder geschrumpft zu sein.
»Wie auch immer: Ich jedenfalls kann nicht bei jedem Scheiß nachts durch den Schnee waten, danach alle halbe Stunde von Sohnemann aufgeweckt werden und pünktlich um 5 Uhr ins Auto nach Frankfurt steigen! Ich mach den Zirkus nicht mehr mit!« Sogar Christines Mann Jan wagte die offene Rebellion.
»Annamaria will, daß wir nach Frankfurt fahren, wenn mal was ist mit den Blagen – nur wegen der Zeitungsberichte über diesen Dr. Regler. Dabei ist dem Mann doch gar nichts nachzuweisen!« Annamarias Gatte wurde rot im Gesicht, während er sprach. Er redete selten.
»Willst du künftig jeden Sonntag auf den Friedhof gehen, um deinen Sohn besuchen zu können?« fragte plötzlich eine Stimme, mit der man Tischtücher zerschneiden konnte. Christine stand hinter Jan und funkelte ihn vorwurfsvoll an.
Keiner wagte mehr etwas zu sagen.
»Tamara ist wieder da«, sagte Gottfried schließlich, »ihre Mutter ist beruhigt, und euch allen hat der Marsch durch die frische Luft nicht geschadet. Lieber einmal zuviel als einmal zuwenig.«
»Wir hätten uns bis ans Ende aller Tage Vorwürfe gemacht, wenn wirklich etwas passiert wäre«, murmelte Zafer. Dazu fiel niemandem mehr etwas ein.
Die nächsten Tage verliefen ereignislos. Tamara ließ sich vorsichtshalber nicht blicken im Dorf. Die drei Hüter der freien Straße kehrten weiterhin jeden Tag, egal, ob es schneite oder nur rieselte. Eines Tages lag eine Ansichtskarte aus Kuala Lumpur in Bremers Briefkasten. Von Anne. Von irgendeinem Weltkongreß für Weltverbesserung. Die Arbeit am Buch näherte sich ihrem Ende. Nemax hatte eine Vorliebe für Spaghetti mit Parmesankäse entwickelt. Der Deutsche Aktienindex legte zu und drehte wieder ins Minus. Carmen wurde aus dem Krankenhaus entlassen, ließ das Kind bestaunen und sagte: »Klar heißt du Schooon, gell, Möpselchen?«
Und eines Abends...
Nemax war schon seit Stunden unruhig. Alle naselang wanderte das Tier zum Fenster, lief unschlüssig zur Katzenklappe und wieder zurück oder schnüffelte an der Haustür. Schließlich hatte Bremer ein Einsehen und ging mit dem Kater vor dem Schlafengehen noch einmal hinaus. Nemax trat von einem Bein aufs andere, tupfte die Vorderpfote in den nicht mehr ganz so frisch aussehenden Schnee, stieß ein ungeduldiges Quarren aus und streckte das Näschen in die Luft. Eine Windbö fegte über das Gemüsebeet. Bremer bückte sich und griff in den Schnee. Er war schwer und naß. Am Himmel rasten die Wolken vor einem blendenden Mond.
Bremer grüßte hinauf und ging wieder ins Haus. Er lauschte auf das Knacken der alten Balken und Dielen des Hauses, dachte an Anne, fragte sich, was Thomas Regler machte und wieso dessen Frau sich nicht mehr blicken ließ und ging ins Bett.
Er schlief unruhig. Der Sturm wiegte das Haus, und irgendwann begann es zu regnen. Als er am nächsten Morgen die Haustür öffnete, stand das Wasser auf der Straße und die Meisen schimpften im Apfelbaum. Der Schnee auf dem Gemüsebeet war zu schmutziggrauen Flecken zusammengeschnurrt, die Schneewälle am Straßenrand eingefallen. Er sah zu, wie braunes Wasser in den Gully stürzte, vor dem sich eine zerquetschte Coladose, ein Kinderstrumpf, die Reste einer toten Ratte und mehrere Zellophanhüllen von Zigarettenschachteln angesammelt hatten.
Am Nachmittag fuhr Ortsvorsteher Wilhelm mit der Kehrmaschine durchs Dorf.
Am Tag darauf fiel ein Kind unter großem Geschrei aus dem Kinderwagen, während sein pflichtvergessener Vater auf der Straße stand und mit den Nachbarn die kommende Fußballsaison diskutierte.
Am Abend hörte Bremer von Gottfried, daß Krista Regler schon seit einer Woche im Krankenhaus lag. Die Bekannte des Neffen eines befreundeten Züchters war Aushilfsschwester dort. Man hatte Krista im Wald gefunden, im Auto sitzend, fast erfroren. Niemand durfte sie besuchen, auch nicht ihr Mann.
Und am Tag darauf kam die Polizei.
5
Feldern
Es nahm ihm die Luft. Man hielt ihn für ein Monster.