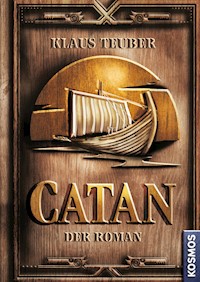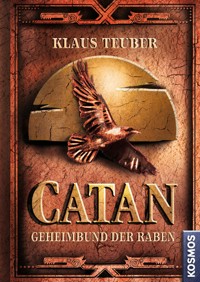
20,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Franckh-Kosmos Verlags-Gmbh & Co. KG
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Achtzehn Jahre sind vergangen, seit die Siedler auf Catan angekommen sind, und Fürst Thorolf herrscht mit harter Hand über Waldhafen. Einige Unfreie, die unter der zunehmenden Willkür ihrer Herren leiden, schließen den Geheimbund der Raben – so wie die Vögel frei durch die Lüfte gleiten, wollen auch sie selbst über ihr Schicksal bestimmen und der Gemeinschaft entfliehen. Als sich Thorolfs Tochter Jora mit den Unfreien verbündet, wird der Fürst vor die schwere Entscheidung zwischen dem Erhalt seiner Macht und dem Leben seiner Familie gestellt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 677
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Titel
CATAN - Geheimbund der Raben
Klaus Teuber
KOSMOS
Impressum
Alle Angaben in diesem Buch erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Sorgfalt bei der Umsetzung ist indes dennoch geboten. Verlag und Autoren übernehmen keinerlei Haftung für Personen-, Sach- oder Vermögensschäden, die aus der Anwendung der vorgestellten Materialien und Methoden entstehen könnten. Dabei müssen geltende rechtliche Bestimmungen und Vorschriften berücksichtigt und eingehalten werden.
Distanzierungserklärung
Mit dem Urteil vom 12.05.1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden, dass man durch die Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite gegebenenfalls mit zu verantworten hat. Dies kann, so das Landgericht, nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Wir haben in diesem E-Book Links zu anderen Seiten im World Wide Web gelegt. Für alle diese Links gilt: Wir erklären ausdrücklich, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten haben. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten in diesem E-Book und machen uns diese Inhalte nicht zu Eigen. Diese Erklärung gilt für alle in diesem E-Book angezeigten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen Links führen.
Wir behalten uns die Nutzung von uns veröffentlichter Werke für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.
Unser gesamtes Programm finden Sie unter kosmos.de.
Über Neuigkeiten informieren Sie regelmäßig unsere Newsletter kosmos.de/newsletter.
Umschlaggestaltung: www.buerosued.de
© 2023, Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. KG
Pfizerstraße 5–7, 70184 Stuttgart
Alle Rechte vorbehalten
ISBN 978-3-440-50805-3
E-Book-Konvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Prolog
Beinahe ein Jahr lang habe ich keine Zeile geschrieben. In den drei Jahren zuvor war ich, Björn Einarson, gut vorangekommen und neben mir liegt ein dicker Stapel Pergament: der erste Teil der Geschichte meines Großonkels Yngvi, der zu den ersten Siedlern gehörte, die vor fast achtzig Jahren mit ihren Schiffen an der Küste Catans gelandet sind.
Dass ich damals die Zeit zum Schreiben fand, verdanke ich meinen beiden Söhnen, die mich und meine Frau tatkräftig bei der Bewirtschaftung unseres Hofes unterstützten. Doch vor einem Jahr hat uns unser jüngerer Sohn Sverrir verlassen und sich einer Gruppe junger Siedler angeschlossen, allesamt nachgeborene Söhne von Bauern und Fischern hier aus Waldhafen. An der Küste, auf halbem Wege nach Ryansdorf, haben sie einen geeigneten Siedlungsplatz gefunden, an dem sie sich eine Existenz aufbauen. Ich kann Sverrir gut verstehen: Unseren Hof wird mein ältester Sohn Hakon erben und Sverrir muss sehen, wo er bleibt.
Aber ich ließ mich nicht lumpen und überließ ihm ein paar Tiere sowie einen kleinen Beutel Silber, mit dem er die zweitägige Überfahrt zum neuen Siedlungsplatz bezahlen konnte.
Als Sverrir auf der Knorr eines Händlers den Hafen verließ und uns zuwinkte, waren wir nicht traurig. Wir wussten, wir würden unseren Jüngsten wiedersehen, spätestens dann, wenn er Haus und Hof haben und in Waldhafen Ausschau nach einer passenden Braut halten würde.
Doch Sverrirs Arbeitskraft fehlte uns an allen Ecken und Enden, und ich war gezwungen, einen Großteil seiner bisherigen Aufgaben zu übernehmen. Vor zwei Wochen dann klopfte Gunnar an unserer Tür, einer der zahlreichen Söhne eines benachbarten Bauern: Er wollte sich bei mir als Knecht verdingen. Er sagte, auf dem Gehöft seines Vaters gebe es nicht für jeden Arbeit und er wolle sich genügend Silber verdienen, um sich später etwas Eigenes aufzubauen. Als ich ihm den Lohn nannte, den ich bereit war zu zahlen, lächelte er und schlug ein.
Gunnar hat sich als echter Glücksfall erwiesen: Er kann ordentlich zupacken und gibt mir nur selten Anlass für eine Rüge.
Letzte Woche konnte ich also endlich wieder die Pergamente aus meiner Truhe holen und mich meiner großen Leidenschaft widmen. Wo war ich stehen geblieben? Richtig: Yngvi hatte sich mit seinem Bruder Thorolf überworfen und Waldhafen zusammen mit seiner Frau Carla verlassen. In Ryansdorf hatten die beiden neu beginnen wollen.
Ich suchte in meinen alten Aufzeichnungen nach Ereignissen aus den Jahren danach – fand aber so gut wie keine. Ein paar Geburts- und Todesdaten und eher knappe Notizen zu einigen Vorfällen in Waldhafen und Ryansdorf sind alles, was ich gefunden habe.
Ich erinnere mich, dass ich Yngvi nur wenige Tage vor seinem Tod gezielt nach den Ereignissen in der Zeit nach seiner Ankunft in Ryansdorf befragte. Warum hatte er mir so gut wie nichts aus diesen Jahren erzählt?
Mein Großonkel hatte einen Moment überlegt und dann lediglich gesagt, da gebe es nicht viel zu erzählen. Carla und er seien von Ryan herzlich empfangen worden und nach einigen Anfangsschwierigkeiten hätten sie sich im Dorf der ehemaligen Sklaven gut eingelebt. Aus Waldhafen habe er gehört, dass Thorolf mit harter Hand herrschte, was dort nicht jedem gefallen habe. Erst viele Jahre nach seinem Abschied aus Waldhafen habe die Geschichte der Siedler eine dramatische Wendung genommen, die wirklich erzählenswert sei …
Und damit war er wieder einmal auf jene Ereignisse zu sprechen gekommen, über die ich eine Vielzahl von Notizen habe und die schon damals, vor fast dreißig Jahren, meine Fantasie beflügelten.
Will ich also die Geschichte der ersten Siedler weitererzählen, bleibt mir nichts anderes übrig, als siebzehn Jahre zu überspringen.
Ich sitze am Tisch vor meinem Haus, tauche meine Feder seit langer Zeit wieder in das Fässchen mit frisch hergestellter Rußtinte und beginne voller Freude, jene Geschichte aufzuschreiben, in deren Mittelpunkt Aslas und Thorolfs Tochter Jora und die Männer und Frauen des Geheimbundes der Raben stehen …
TEIL 1:
Sommer 878 n. Chr.
KAPITEL 1
Thorolf
Missmutig saß Thorolf an dem langen Tisch in seiner Halle und löffelte gesalzenen Haferbrei. Hinter dem gemauerten Herd reinigten seine Magd Ilka und deren Tochter Mara Töpfe und Schüsseln im Wasser eines großen Holzbottichs. Das Klappern des Geschirrs zerrte an seinen Nerven.
„Ruhe!“, brüllte er.
Augenblicklich verstummten die störenden Geräusche.
Thorolf war sich seiner schlechten Laune bewusst. Diese rührte sowohl von seinem Schädelbrummen, das ihn gnadenlos an das Saufgelage am Vorabend erinnerte, als auch von dem beständigen Schmerzen eines Backenzahns, der seit ein paar Tagen unbarmherzig in seinem Kiefer pochte. Aber nicht nur das. Auch das belanglose Einerlei, das ihn erwartete, verursachte an Tagen wie diesem ein unzufriedenes Grummeln in seiner Brust. Dann gierte er nach Herausforderungen, die sein Blut in Wallung brächten, und sehnte sich nach dem Reiz von Abenteuern, wie er sie als junger Mann in seiner nordischen Heimat erlebt hatte. Damals hatte er mit seinem Handelsschiff fast alle Küsten der bekannten Welt bereist und innerhalb nur weniger Jahre ein beträchtliches Vermögen angehäuft.
Doch dann hatte er Asla, der schönen Tochter eines nordischen Königs, zur Flucht vor einer Ehe mit einem widerlichen Tyrannen verholfen. Für diese Liebestat, die fast einen Krieg heraufbeschworen hätte, war er zusammen mit seinen Brüdern Yngvi und Digur, die ihn unterstützt hatten, für die Dauer von sieben Jahren aus der Heimat verbannt worden.
Gemeinsam mit einigen Familien, die in der Auseinandersetzung mit Aslas rachsüchtigem Vater ihr Hab und Gut verloren hatten, waren sie auf ihren Schiffen zu einer Insel tief im Süden aufgebrochen, von deren freundlichen Bewohnern und fruchtbarem Boden ihnen ein weit gereister Händler berichtet hatte. Doch eine feindliche Flotte und heftige Stürme trieben sie weitab von ihrem eigentlichen Kurs auf den Ozean hinaus. Erst nach einer langen und bedrohlichen Irrfahrt erreichten sie die Küste einer anderen Insel. Dankbar hatten sie das große, unbewohnte Eiland Catan getauft, was in der Sprache des Volkes, zu dessen Insel sie ursprünglich hatten segeln wollen, „Land der Sonne“ hieß.
Achtzehn Jahre war das her und so schön und fruchtbar Catan auch war, wurde die Insel Thorolf oft zu eng. Doch zu weit lag sie von seiner alten Heimat entfernt, zu gefährlich war die lange Reise über die tückische See, um von hier aus seine Handelsfahrten wieder aufzunehmen.
An weinseligen Abenden wie dem am Vortag verstummte bisweilen die Vernunft und er gab sich der verführerischen Vorstellung hin, am nächsten Morgen seine Knorr zu besteigen und mit ihr nach Osten zu segeln. Es war nur die Schläfrigkeit nach den vielen Bechern Wein gewesen, die ihn schließlich davon abgehalten hatte, noch in der Nacht ein paar seeerfahrene Männer aus ihren Betten zu holen und mit ihnen die lange Fahrt vorzubereiten. Vielleicht war es auch der Gedanke an seine erste Frau Asla gewesen, die er förmlich hören konnte, wie sie beharrlich an seinen Verstand appellierte und ihn schalt: „Schäm dich, Thorolf Ulrikson, du beleidigst die Götter, die uns in diese wundervolle neue Heimat geführt haben. Du bist Fürst über Waldhafen und dessen Einwohner achten dich. Das wolltest du doch immer. Was willst du mehr?“
Trotz seiner üblen Laune musste Thorolf schmunzeln. Asla sagte ihm oft schonungslos die Meinung, wenn sie eine seiner Handlungen missbilligte, nicht selten spitz und scharf. Bei einigen Themen – wie der Stärkung der Rechte von Frauen – war sie genauso unnachgiebig und stur wie er geblieben. Nach einem Vorfall, an den Thorolf sich nicht gern erinnerte, hatte Asla die Scheidung von ihm verlangt. Seitdem fehlte ihm etwas, das ihm seine zweite Frau Vildis nicht gab. Vielleicht lag darin eine weitere Ursache für seine anhaltende Unzufriedenheit.
Ein Jahr nach seiner Trennung von Asla hatte Thorolf eine der Töchter des Bauern Sören geheiratet. Vildis war ein hübsches, wenn auch für seinen Geschmack zu mageres Mädchen von fünfzehn Wintern gewesen, das ihm in der Hochzeitsnacht ebenso widerwillig wie ängstlich ins Ehebett gefolgt war. Tapfer, mit zusammengebissenen Zähnen hatte Vildis den Vollzug der Ehe ertragen. Später biss sie zwar nicht mehr die Zähne zusammen, wenn er in sie eindrang, blieb aber stets teilnahmslos und erwiderte weder seine Küsse noch die Liebkosungen seiner Hände. Wie er sich auch mühte, es gelang ihm nicht, Vildis’ Inneres zu berühren und Gefühle in ihr zu wecken. Nach jedem Akt war ihr die Erleichterung anzusehen, es hinter sich gebracht zu haben.
Lange hatte Thorolf ihr Verhalten nicht verstanden. Er war Anfang vierzig, ein großer, ansehnlicher Mann mit noch immer dichtem schwarzem Haar und zudem ein Fürst, der über rund achthundert Menschen in der Gegend um Waldhafen herrschte. Er hatte immer geglaubt, jede Frau würde ihm zu Füßen liegen und ihn innig lieben – wenn nicht gleich, dann zumindest im Laufe der Zeit.
Als er Vildis nach Jahren mürrisch danach gefragt hatte, warum sie sich nichts aus ihm mache, hatte sie ihn verständnislos angeblickt und ihm mit unüberhörbarem Vorwurf in der Stimme entgegnet: „Ich bin als junges Mädchen in die Ehe mit dir genötigt worden. Du hast mich nicht gefragt, ob ich dich liebe, bevor du mich zur Frau genommen hast. Weder meinem Vater noch dir war das wichtig. Warum störst du dich jetzt an meinen mangelnden Gefühlen? Bin ich dir nicht eine gute Frau? Wann immer du es willst, spreize ich meine Beine für dich. Ich gebäre dir Kinder und sicher wirst du dich nicht über die Führung des Haushalts beklagen.“ Widerwillig hatte er ihr zugestehen müssen, dass sie ihm eine gute Frau war, und es dabei bewenden lassen. Vildis hatte ihre Pflicht erfüllt und ihm im Lauf der Jahre sechs Kinder geboren – nur zwei davon hatten das Säuglingsalter nicht überlebt. Was das anging, hatte er wenig Grund zu klagen.
Jetzt hörte Thorolf das dunkle, glucksende Lachen seiner Frau. Er ging nach draußen auf den Hof. Das helle Morgenlicht eines späten, warmen Sommermorgens ließ ihn die Augen zusammenkneifen. Vildis spielte Fangen mit Njala und Valny, ihren sechs und fünf Jahre alten Töchtern. Vildis war in den vergangenen Jahren fülliger geworden und trug ihre blonden Haare zusammengesteckt. Mit geröteten Wangen lief sie Njala hinterher, streckte einen Arm aus und grapschte vergeblich nach dem Hemd ihrer Tochter.
Vor Vergnügen kreischend schlug das Mädchen einen Haken und rannte auf eine Schar Hühner zu, die entrüstet gackernd in alle Richtungen davonstoben. Plötzlich stolperte Njala über einen Stein und stürzte. Nach einem kurzen Schreckmoment begann sie zu weinen. Besorgt eilte Vildis zu ihr, besah das aufgeschlagene Knie und hauchte einen Kuss auf die Schramme. Sie nahm Njala in den Arm und herzte und küsste sie, bis diese nur noch kleine Schluchzer von sich gab. Als Vildis zu Thorolf sah, stand Liebe in ihrem Blick. Aber die galt nicht ihm.
Thorolf ging über den Hof und pfiff nach einem Knecht, der Heu von der Scheune zum gegenüberliegenden Stall karrte. „Sattle mein Pferd!“, wies er ihn an. Kurz sah er dem Mann nach, der beflissen zum Stall eilte, dann öffnete er das Tor seines Anwesens. Von hier aus hatte er einen weiten Blick auf den See und die Häuser Waldhafens. Vom Ufer des Gewässers zogen sich die reetgedeckten Dächer den sanft ansteigenden Hang bis zu seinem Fürstensitz hinauf.
Als sie damals Catan erreichten, hatte noch dichter, unwegsamer Wald das ganze Gebiet um den See bedeckt. Mühevoll hatten die Siedler mit ihren Knechten unzählige Bäume geschlagen und so Jahr für Jahr mehr Land für ihre Felder und Wiesen gewonnen. Inzwischen war der Saum des Waldes in weite Ferne gerückt.
Dorthin wollte er jetzt, um den Baufortschritt am neuen Weg zu begutachten. Auf die Begleitung seiner Gefolgsleute würde er verzichten – schließlich hatte er nicht vor, einen aufmüpfigen Bauern, der seine Abgaben nicht zahlen wollte, zurechtzuweisen und ihm seine Macht zu demonstrieren.
Der Knecht brachte ihm seinen Schimmel. Die temperamentvolle Stute tänzelte unruhig und schnaubte, als sich Thorolf in den Sattel hievte. Offenbar war das Pferd das Stehen im Stall leid und konnte es kaum erwarten, mit seinen Hufen auszugreifen. Mit einem freudigen Wiehern reagierte es auf seinen sanften Schenkeldruck und trabte los.
Thorolf folgte dem alten Weg nach Südosten. Felder mit heranreifendem Roggen und fast erntereifer Gerste wechselten sich mit blühenden Wiesen ab. Er ritt an einer Gruppe von Rindern vorbei, die bedächtig Büschel saftigen Grases malmten und ihm neugierig hinterherglotzten. Auf einer Wiese zu seiner Linken ragten verkohlte Pfosten in den Himmel – die Überreste der ersten Köhlerei, die sie bald nach ihrer Ankunft, damals noch tief im Wald, errichtet hatten.
Wenig später passierte er ein halb fertiges Gehöft. Ein junger Bauer deckte mit der Hilfe eines Knechts den Dachstuhl eines Nebengebäudes mit Schilfrohr ein. Als der Bauer seinen Fürsten erblickte, hob er die Hand und nickte ihm respektvoll zu. Wohlwollend erwiderte Thorolf den Gruß.
Sigurd war einer der vielen nachgeborenen Bauernsöhne Waldhafens, die nicht das Land ihres Vaters erben würden, und der Knecht hieß Beli. Thorolf hatte den ehemaligen Freien erst vor ein paar Wochen auspeitschen lassen und zu zwölf Jahren Knechtschaft verurteilt. Manche hatten gemurrt und moniert, das Urteil sei zu hart, aber der Hitzkopf hatte im Streit einen Mann getötet, und um die Familie des Opfers zufriedenzustellen, hatte Thorolf ihn streng bestrafen müssen. Doch wenn Beli sich gut führte, würde er ihm zwei Jahre der Strafe erlassen.
Thorolf zügelte sein Pferd und sah Sigurd und Beli eine Weile bei der Arbeit zu. Anders als im kargen Nordland, der alten Heimat der Siedler, gab es auf Catan genügend fruchtbare Erde für alle, die bereit waren, hart dafür zu arbeiten. Junge freie Männer wie Sigurd rückten mit der Axt in der Hand beherzt dem dichten, grünen Wald zu Leibe und entrissen ihm die Herrschaft über das Land. So erschlossen sie sich ihren ersten Acker und bauten sich später ein Haus. Wenn ein Vater großzügig war, schenkte er seinem Sohn Werkzeuge, Saatgut und lieh ihm vielleicht einen Ochsen und ein oder zwei seiner Knechte. War er vermögend und sehr großzügig, schenkte er ihm den Ochsen und dazu eine junge Magd und einen jungen Knecht – nicht selten die Halbgeschwister seines Sohnes.
In leichtem Trab folgte Thorolf schließlich dem neu angelegten Weg in den Wald. Nachts hatte es heftig geregnet und der herbe, leicht modrige Geruch nach feuchten Moosen, Farnen und dem Blattgrün der krummen, wild durcheinander wachsenden Bäume stieg ihm angenehm in die Nase. Seine Kopfschmerzen hatten nachgelassen, aber der Quälgeist in seinem Kiefer gönnte ihm keine Ruhe. Er seufzte. Gegen Abend würde er wohl seine erste Frau aufsuchen müssen. Asla war neben ihrer Schwester Stina die fähigste Heilerin in Waldhafen und würde ihn schnell und gekonnt von seiner Qual befreien.
Die Hufe des Schimmels hinterließen nur schwache Abdrücke auf dem festen, zu beiden Seiten hin leicht abfallenden Weg. Statt sich in Pfützen zu sammeln, war der Regen der Nacht abgeflossen und im lockeren Waldboden am Wegrand versickert. Der Bautrupp hatte gute Arbeit geleistet.
Im Nordland hatte sich niemand die Mühe gemacht, Wege anzulegen. Die Menschen nutzten ausgetretene Pfade, um ins Landesinnere vorzudringen und die dort versprengt liegenden Höfe zu erreichen. Im Frühjahr und Herbst mussten sich Reisende oft über aufgeweichte, matschige Erde quälen, die eher zu einem Sumpf denn zu einem Weg zu gehören schien.
Auch auf Catan gab es Regenzeiten, die die Pfade fast unpassierbar machten und den Transport von Baumstämmen, Kohle und anderen wichtigen Gütern mit Wagen und Pferd schwierig gestalteten oder tagelang ganz vereitelten. Es war Gregor gewesen, der vorgeschlagen hatte, die Pfade, die sich wie ein Spinnennetz im Osten der Siedlung durch die Felder zum Wald zogen, zu festen, breiten Wegen auszubauen – zumindest die wichtigsten. Thorolf mochte den Priester der christlichen Gemeinde nicht, dessen Glaube Unruhe in die Gemeinschaft brachte, doch er schätzte die Ideen des gelehrten Geistlichen und hatte ihn reden lassen. Mit lebhaften Gesten hatte der kleine, untersetzte Mann der Versammlung der Familienoberhäupter die befestigten Straßen seiner Heimatstadt Rom beschrieben und deren Aufbau erklärt.
Der Bau gepflasterter Straßen, die nach Gregors Bekunden eine halbe Ewigkeit halten würden, war Thorolf zu aufwendig erschienen. Letztlich war er es, der den Familien, die Knechte an den Bautrupp ausliehen, Gold für den Ausfall von deren Arbeitskraft zahlen musste, und die Abgaben zu erhöhen, kam momentan nicht infrage.
Schließlich hatte er sich für eine Form des einfacheren Wegebaus entschieden. Diese Wege mussten zwar öfter erneuert und ausgebessert werden werden, aber der Aufwand war vertretbar. In ein paar Jahren würde er die Strecke zwischen Waldhafen und der neuen Siedlung vielleicht pflastern lassen und in eine haltbarere Straße verwandeln.
Die Sonne war bereits ein gutes Stück weitergewandert, als Thorolf den Bautrupp erreichte. Einige Unfreie hüpften auf breiten Brettern, um so die schwere, lehmhaltige Erde einzuebnen und zu verdichten. Thorolf verkniff sich ein Grinsen. Die Hopser, die bei Kindern leicht und natürlich angemutet hätten, wirkten bei den Männern, die sich an den Schultern fassten und auf Kommando gleichzeitig in die Höhe sprangen, unbeholfen und komisch.
Als die Knechte Thorolf bemerkten, hielten sie inne und senkten die Köpfe. Mit einer knappen Geste gab Thorolf ihnen zu verstehen, dass sie ihre Arbeit fortsetzen sollten.
Er ritt an ihnen vorbei und überquerte die Brücke. Fünf dicke Baumstämme lagen über dem Bett des munter gurgelnden Bachs. Stabile Holzbretter waren Kante an Kante quer mit den Stämmen vernagelt. Thorolf nickte zufrieden. Sven hatte gute Arbeit geleistet. Die Holzkonstruktion des tüchtigen Sohns von Högni, dem Schiffsbauer, wirkte sehr solide und war breit genug für die Karren der jungen Familien, die in ein paar Wochen zu der Lichtung aufbrechen würden, die sie Grünheim getauft hatten. Dort wollten sie Häuser und Gehöfte bauen und weiteren Wald roden.
Hinter der Brücke zog sich eine schmale, von Holzfällern geschlagene Schneise durch den Wald. Einige Knechte zogen mithilfe zweier Ochsen Baumstümpfe und Sträucher aus dem Boden, andere schaufelten Erde und glichen Unebenheiten aus. Hier und da war dem neuen Weg schon seine leicht gewölbte Form anzusehen.
Die Peitsche eines Aufsehers klatschte auf das Kreuz eines Ochsen, was dem Tier ein unwilliges Brüllen entlockte. Die Knechte schufteten mit bloßem Oberkörper und stöhnten und ächzten unter der schweren Arbeit. Die stehende, warme Luft war von ihrem strengen Schweißgeruch geschwängert. Die Furcht, selbst schmerzende Hiebe auf ihren nackten Rücken zu erhalten, trieb die Unfreien zu Höchstleistungen an.
Der Wegebau schritt wirklich zügig voran. Thorolf stieg vom Pferd, um ein paar Worte mit dem Aufseher zu wechseln, als ihn ein schriller Schmerzensschrei innehalten ließ. Nichts Ungewöhnliches, mutmaßte Thorolf zunächst, Verletzungen waren an der Tagesordnung. Doch als der Schrei ein zweites Mal ertönte, drang Thorolf in den Wald ein und kämpfte sich durch das unwegsame Unterholz in die Richtung, aus der die Schreie gekommen waren. Bald hörte er einen Mann derb fluchen und dann sah er ihn auch. Es war Runar, der älteste Sohn Haralds. Der breitschultrige Schmied, dem er die Leitung des Bautrupps übertragen hatte, stand mit dem Rücken zu ihm, schwang die Peitsche und schlug auf einen halb hinter Gestrüpp verborgenen Menschen ein. Dessen erneuter schmerzerfüllter Schrei gellte in Thorolfs Ohren.
„Was geht hier vor?!“, rief Thorolf.
Runar drehte sich um. Die Überraschung, seinen Fürsten zu sehen, überdeckte nicht den lustvollen Zug um seinen Mund und das erregte Funkeln in seinen Augen. „Der wollte sich drücken und hat sich im Wald versteckt. Das wird er nicht noch mal wagen“, sagte Runar selbstgefällig und wechselte lässig den Peitschengriff von einer Hand in die andere.
Thorolf schob ein paar Farnwedel beiseite. Ein schmaler junger Mann lag bäuchlings auf dem Boden. Um Gnade flehend hielt der Unfreie schützend seinen Hinterkopf umfasst. Sein Hinterteil war entblößt und blutige Peitschenmale zeichneten sich auf der blassen Haut seines Gesäßes und Rückens ab. Thorolf befahl dem Knecht, sich umzudrehen. Schwerfällig und an allen Gliedern zitternd gehorchte dieser. Thorolf erkannte seinen eigenen Knecht Alf, den er dem Bautrupp zugeteilt hatte. Der Junge war der Sohn einer Magd, bei der er gelegen hatte, als er noch mit Asla verheiratet gewesen war. Möglicherweise war Alf sein Bastard, zumindest sprachen das kräftige Kinn mit dem markanten Grübchen und das Alter des Jungen dafür. Mehr als sechzehn Winter hatte der dunkelhaarige Bursche noch nicht erlebt.
Alf richtete sich auf und sah Thorolf mit glasigen Augen an. Seine Zähne klapperten und Erbrochenes klebte an einem Mundwinkel. Er stammelte ein paar zusammenhanglose Worte. Thorolf legte ihm eine Hand auf die Stirn. Sie glühte. Der Junge hatte hohes Fieber.
„Bleib hier sitzen, bis ich dich holen komme“, wies Thorolf ihn an und gab Runar ein Zeichen, ihm zu folgen.
Erst als er sich außer Hörweite des Knechts wähnte, fuhr er den Schmied an: „Der Junge ist krank. Ist dir das nicht aufgefallen?“
„Der tut nur so, um sich vor der Arbeit zu drücken“, entgegnete Runar gleichmütig und sagte dann lachend: „Du wirst sehen: Ein paar Peitschenhiebe werden ihn schon heilen.“
Thorolf schüttelte ungläubig den Kopf. „Der Junge wird sterben, wenn er nicht unverzüglich zur Heilerin gebracht wird – wenn nicht an seinem Fieber, dann an den Wunden auf seinem Rücken.“ Thorolf kniff die Augen zusammen und seine Stimme nahm einen gefährlichen Klang an, als er sagte: „Sollte er nicht überleben, dann erwarte ich von dir einen faustgroßen Beutel Gold. Denn so viel ist Alfs Arbeitskraft über die Jahre wert. Solltest du nicht zahlen können, nimmst du seinen Platz ein und wirst mir drei Jahre lang als Schuldknecht dienen.“
Runar wurde bleich und sein selbstgefälliges Grinsen erstarb.
Doch Thorolf war noch nicht fertig. „Du schnappst dir jetzt den Burschen und reitest mit ihm zur Heilerin“, wies er den Schmied an. „Und vergiss nicht, was dir blüht, wenn Alf sterben sollte!“
KAPITEL 2
Jora
Jora tanzte mit Sven. Nicht nach dem Rhythmus einer Trommel oder der Melodie einer Flöte, ihre Schritte und die Bewegung ihres Schwertarms folgten dem Takt der sich ändernden Wahrnehmungen von Augen und Gehör. Blitzschnell registrierte sie kleinste Wandlungen im Blick ihres Gegners, in seiner Atemfrequenz und seinem Bewegungsablauf. Sie brauchte nicht zu überlegen. Ihr durch unzählige Übungskämpfe trainierter Instinkt wusste sofort, was zu tun war, und ihr Körper reagierte unmittelbar.
So auch jetzt, als Sven seine Waffe hob, um eine Parade von ihr zu erzwingen. Im letzten Moment würde er versuchen, ihr blockendes Schwert zu unterlaufen und ihr einen Stoß in den Bauch zu versetzen. Jora hob ihren Schwertarm, als wollte sie zur Abwehr seines Schlags ansetzen, schwang ihn dann aber zusammen mit ihrem freien Arm rasch in die Höhe. Kraftvoll stieß sie sich vom Boden ab. Bevor sie ihre Beine anzog, um sich in der Luft rückwärts zu drehen, traf sie mit einem Stiefel Svens Schwerthand. Sie hörte die Waffe zu Boden fallen und ihren Kampfpartner seinen Schmerz hinausfluchen. Den Bruchteil eines Augenblicks später landete sie sicher auf dem Boden, nutzte den Schwung ihres Schwertarms und streifte mit dem stumpfen Ende ihrer Waffe Svens durch dickes Leder geschützten Bauch.
Es war warm. Jora strich sich über die schweißnasse Stirn und grinste. Sven war vierundzwanzig und damit fast sechs Jahre älter als sie, und bisher war es ihr nur wenige Male gelungen, den großen, athletischen Mann zu bezwingen.
„Hätten wir mit echten und nicht mit Holzschwertern gekämpft“, sagte sie triumphierend, „müsstest du jetzt deine Eingeweide einsammeln.“
Sven rieb sich die schmerzende Schwerthand. Er konnte mit Niederlagen umgehen und lächelte verschmitzt zurück. „Noch mal falle ich auf diesen Trick nicht herein!“
Jora sah sich um. Junge Burschen zwischen zwölf und fünfzehn Jahren starrten sie erstaunt an. Sie verehrten Sven und bewunderten seine Schwertkunst, in der er sie auf Geheiß Thorolfs unterrichtete. Umso mehr mochte es ihnen als Hexenwerk erscheinen, dass ihr Lehrmeister von ihr, einer jungen Frau, besiegt worden war. Die Alten erzählten zwar Geschichten von nordischen Frauen, die Männern im Umgang mit Schwert, Speer und Bogen ebenbürtig oder gar überlegen waren, aber von solchen Kriegerinnen erzählt zu bekommen, war dann doch etwas anderes, als eine junge Frau leibhaftig das Schwert schwingen zu sehen. Und das auf meisterliche Weise, wie sich Jora inzwischen selbst zugestand.
Sie blickte zu Digur, der hinter den Jungen stand. Der hünenhafte Mann war Svens wesentlich älterer Halbbruder. Beider Mutter Diara war als Kind versklavt und in den Norden verschleppt worden. Digur war einer Liebschaft Diaras mit Thorolfs Vater entsprungen. Nach seiner Geburt war Diara freigelassen worden und der Schiffsbauer Högni hatte die schöne junge Frau aus dem heißen Süden geheiratet und weitere Kinder mit ihr gezeugt. Unerwartet und zum großen Leidwesen nicht nur ihrer Familie war Diara zu Beginn des Jahres verstorben, doch lebte sie im Aussehen ihrer Kinder weiter: Fast allen, angeblich auch ihren und Högnis älteren Söhnen, die in der alten Heimat geblieben waren und die Bootswerft ihres Vaters hatten weiterführen wollen, hatte Diara ihre dunkle Haut und ihr schwarzes Kraushaar vererbt.
Digur nickte Jora anerkennend zu. In der alten nordischen Heimat, so erzählte man sich, sei er wegen seiner überragenden Kampfkunst ein gefürchteter Gegner gewesen. Nicht selten habe allein seine Anwesenheit im Heer des nordischen Königs den Sieg herbeigeführt. Die Anerkennung des großen Kriegers bedeutete Jora viel.
Sie dachte an den Tag zurück, an dem sie Digur mit einem besonderen Anliegen besucht hatte: Ihr kleines Kinderschwert fest umklammernd hatte sie ihren Onkel gebeten, ihr den Kampf mit dem Schwert beizubringen, nachdem Thorolf ihren Wunsch zuvor mit schroffen Worten abgelehnt hatte. Sie sei nur ein Mädchen, hörte sie ihren Vater noch heute sagen, und solle lieber spinnen und weben, als sich mit Männerdingen zu beschäftigen. Auch Digur war zunächst nicht auf ihre Bitte eingegangen. Ihr wortkarger Onkel hatte nur den Kopf geschüttelt und sie vor die Tür gesetzt. Doch schon als Neunjährige hatte sie nicht so schnell aufgegeben.
Digurs ältester Sohn Ulrik besaß ebenfalls ein Holzschwert. Also freundete sie sich mit dem nur wenig jüngeren, fröhlichen Jungen an und verbrachte einige Zeit mit ihm. Sie freute sich, wenn Digur nach Hause kam und ihnen eine Weile dabei zusah, wie sie sich unter lebhaftem Geschrei mit ihren Kinderschwertern duellierten. Wenn Digurs Frau Stina dann die Familie zum Abendessen rief, lud sie jedes Mal auch Jora ein, sich zu ihnen zu setzen. Jora schüttelte zwar stets den Kopf, blieb aber noch eine Weile wortlos, das Holzschwert in der Hand, an der Tür stehen und schaute dabei zu Digur – mit der einen Bitte in ihrem Blick.
Irgendwann hatte er nachgegeben. Dies war zum einen der Fürsprache seiner Frau zu verdanken, die gemeint hatte, er werde Ulrik doch ohnehin bald im Schwertkampf unterrichten, da könne er seine Nichte doch gleich mit ausbilden. Zum anderen, so erzählte es Digur Jora später, habe er bereits in ihren kindlichen Bewegungen das Talent entdeckt, das sie heute auszeichnete, und sei beeindruckt von ihrer Zähigkeit gewesen, als Ulrik sie mit seinem Schwert unglücklich an der Stirn getroffen und sie unverdrossen weitergekämpft habe, obwohl ihr das Blut über das Gesicht gelaufen sei.
So war Digur ihr Lehrmeister geworden. Mit seinem Holzbein konnte er manche Bewegungsabläufe nicht vorführen, aber seine kurzen, schnörkellosen Erklärungen hatten Jora genügt, um seine Anweisungen umzusetzen und im Laufe der Jahre den Tanz mit dem Schwert zu erlernen.
Sven riss Jora aus ihren Gedanken, als er den Jungen laut zurief: „So, jetzt seid ihr dran! Bevor ihr gegeneinander antretet und Jora und ich euch das Unterlaufen eines Angriffs zeigen, rennt ihr zum Aufwärmen zehnmal um den Platz!“
In diesem Augenblick entdeckte sie Thorolf. Ihr Vater musste schon eine ganze Weile im Schatten des Baumes gestanden und ihren Übungskampf mit Sven beobachtet haben. Seine Miene mochte Unbeteiligten ausdruckslos erscheinen, doch sie glaubte, in dem leichten Anheben seiner Mundwinkel und dem warmen Glanz in seinen Augen eine gewisse Würdigung ihres Könnens zu erkennen. Jora lief ein leichter Schauer über den Rücken. All ihre Mühen hatten sich gelohnt, mehr Lob würde sie von ihrem Vater nicht erhalten. Aber das wenige an Wertschätzung, das er ihr zukommen ließ, würde sie weiter an ihrem Können feilen lassen. Nur so konnte sie in seiner Achtung steigen.
Ihretwegen, das wusste sie, war Thorolf nicht gekommen. Er wollte sich ein Bild von den Fortschritten seines ältesten Sohns Leif machen. Der Fünfzehnjährige bemerkte seinen Vater erst, als die Kampfübungen begannen. Jora sah ihrem rundlichen Halbbruder an, wie sehr er sich mühte, es Thorolf recht zu machen, doch Leif besaß keinerlei Talent für den Umgang mit dem Schwert: Seine Bewegungen wirkten plump, seine Reaktionen waren zu langsam und am Ende der Übungen war er es, der sich die meisten Blessuren eingefangen hatte. Sichtlich enttäuscht verließ Thorolf den Übungsplatz.
Leif war fünf gewesen, als er sein erstes Holzschwert von Thorolf geschenkt bekommen hatte. Er hatte leidenschaftslos ein paarmal damit herumgefuchtelt, es danach aber nicht mehr angefasst. Sehr zum Verdruss seines Vaters stürmte er nicht durch die Gassen Waldhafens, um den anderen Jungen stolz sein Holzschwert zu präsentieren und sich Kämpfe mit ihnen zu liefern. Lieber spielte er mit Murmeln aus gebranntem Ton.
Diese Vorliebe ihres Halbbruders hatte Jora sich zunutze gemacht und ihm für das Kinderschwert eine Handvoll ihrer eigenen Murmeln angeboten. Glücklich hatte Leif aus einer Ecke das verstaubte Schwert geholt, zwischen dessen Parierstange und Blatt sich eine Spinne ein Netz gesponnen hatte, und die heiß begehrten Murmeln in Empfang genommen.
Das Glück ihres Halbbruders hatte jedoch nur bis zum Abend gewährt. Schluchzend erzählte er Jora später, dass Thorolf, als er von dem Handel erfahren habe, sehr wütend geworden sei. Er habe ihm alle seine Murmeln abgenommen und sie mit den Worten: „Das Letzte, was ein Mann aus der Hand gibt, ist sein Schwert“, in die Glut des Herdes geworfen. Jora hatte eine Weile befürchtet, ihr Vater würde das Kinderschwert von ihr zurückverlangen, doch das tat er nicht. Er gab Leif ein neues Holzschwert, das dieser von da an zwar wie seinen Augapfel hütete, mit dem er aber weiterhin nicht wirklich etwas anfangen konnte.
***
Mit hängendem Kopf und eingezogenen Schultern tappte Leif vom Übungsplatz. Wieder hatte er kläglich versagt. Wie so oft – und er würde seinen Vater auch zukünftig enttäuschen. Er hasste den Schwertkampf und würde sich nie mit ihm anfreunden. Nur vor den Nachmittagen, an denen Sven und Jora ihm und den anderen Jungen den Umgang mit dem Speer beibrachten, fürchtete er sich noch mehr. Immerhin hatte er gelernt, sich nicht über das Brennen, Ziehen und Stechen an den vielen Stellen seines Körpers zu beklagen, über die Schmerzen, die ihm mittlerweile zu vertrauten Begleitern geworden waren. Zumindest das hatte ihm ein wenig Achtung von den anderen Jungen eingebracht.
Fast magisch zog es ihn zu Aslas Haus. Hier fand er das, wonach er sich sehnte. Als er eintrat, begrüßte ihn die frühere Frau seines Vaters mit einem warmen Lächeln. Ihre langen blonden Haare trug sie zu einem praktischen Pferdeschwanz gebunden.
Sanft strich sie über die rötlich verfärbte Schwellung unterhalb seines linken Auges und sagte besorgt: „So, wie du ausschaust, kommst du gerade vom Schwertkampf.“
Leif nickte verdrossen und blickte ihr in die braun-grün gesprenkelten Augen. Ihm wurde warm ums Herz. Er liebte Asla. Nicht, weil sie eine schöne Frau war – sie war schon über dreißig –, sondern für den Respekt, den sie ihm entgegenbrachte. Anders als sein Vater und die meisten anderen Erwachsenen behandelte sie ihn nicht wie einen dummen, nichtswürdigen Jungen, sie gab ihm das Gefühl, etwas wert zu sein. Und er liebte ihr Haus. Im Eingangsbereich der kleinen, gemütlichen Halle stand ein großer Tisch mit einem Mörser, einer Waage, einem kleinen Kasten mit Gewichten, kleineren und größeren Krügen und mehreren Löffeln in verschiedenen Größen. Gerätschaften, die vom Handwerk einer Heilerin zeugten. An der Wand hinter dem Tisch reihten sich auf einfachen Holzbrettern irdene Töpfe und Krüge mit heilenden Salben und diversen Flüssigkeiten. Zwischen der Stirn- und der Seitenwand hatte Asla Stricke gespannt, an denen Kräuter zum Trocknen hingen. Leif mochte die unverwechselbare, faszinierende Mischung von Düften, die die Pflanzen verströmten.
Hoffnungsvoll fragte er: „Kann ich dir helfen?“
„Ja, das kannst du“, sagte Asla und drückte ihm umstandslos einen geflochtenen Korb in die Hände. „Geh in den Garten und füll ihn etwa zur Hälfte mit Ringelblumenblüten. Danach kannst du eine Wundsalbe daraus bereiten. Du hast mir ja oft genug dabei zugeschaut und solltest wissen, wie das geht.“
Leif nickte aufgeregt und er spürte, wie sich sein Gesicht vor Aufregung rötete. Er durfte seine erste Salbe herstellen! Beschwingt stürmte er zu dem neben dem Haus gelegenen Kräutergarten. Dort ging er langsam umher, strich mit einem Finger über die Blüten und Blätter der verschiedenen Heilpflanzen, roch an ihnen und flüsterte ihre Namen: „Löwenzahn, Schafgarbe, Kamille, Beifuß, Schöllkraut, Spitzwegerich, Ringelblume, Schlafmohn.“ Leif konnte nicht nur jede Pflanze benennen, er wusste auch, gegen welche Leiden Asla sie einsetzte. Er kniete sich vor die Ringelblumen und pflückte behutsam die großen gelborangen Blüten. Dabei entsann er sich des Tages, an dem er einen Fischer bei einer Fahrt in küstennahen Gewässern begleitet hatte. Gegen Abend prangte eine mächtige dunkelgelbe Sonne am glutroten Himmel. Majestätisch ergab sie sich ihrem täglichen Schicksal und versank langsam im Meer. Unvergesslich war ihm das beeindruckende Farbenspiel geblieben, an das ihn die Blüten der heilsamen Pflanze jetzt erinnert hatten.
Leif hatte seinen Korb knapp zur Hälfte gefüllt, als er den Hufschlag eines Pferdes hörte und den lauten Ruf eines Mannes: „Heilerin, komm raus! Ich habe einen Kranken.“
Neugierig lugte Leif um die Hausecke. Es war Runar, hoch zu Ross; vor ihm lag ein junger Mann mit nacktem Oberkörper über dem Widerrist des Pferdes, offensichtlich bewusstlos. Das war Alf, ein Knecht seines Vaters. Schenkte man dem Gerede der Leute Glauben, dann war Alf sein Halbbruder.
Asla kam aus dem Haus gelaufen und deutete auf Alf. „Was ist mit ihm?“
„Der Fürst behauptet, er sei krank. Du sollst dich um ihn kümmern“, sagte Runar kurz angebunden, der sich trotz Thorolfs Aufforderung Zeit gelassen hatte, Alf zur Heilerin zu bringen.
Asla legte eine Hand auf Alfs Stirn. „Er hat hohes Fieber“, stellte sie fest. Dann deutete sie auf die blutigen Striemen auf dem Rücken des Bewusstlosen. „Warst du das?“
„Ja. Es ist meine Pflicht als Aufseher, das faule Pack anzutreiben“, antwortete der junge Schmied mürrisch.
„Gut. Dann hilf mir, ihn reinzutragen.“
Runar runzelte die Stirn und blaffte: „Ich lass mir nichts befehlen. Schon gar nicht von einer Frau. Hier, nimm ihn und sieh zu, wie du mit ihm fertigwirst.“
Runar stieß den leblosen Körper vom Pferd. Asla bekam Alf gerade noch an einem Arm zu fassen, bevor dessen Kopf auf dem Boden aufschlug. Der Schmied wendete sein Pferd und ritt davon, ohne sich noch einmal umzusehen.
Leif stellte den Korb auf dem Boden ab und eilte zu Asla, die Runar mit ungläubigem Blick nachstarrte. Gemeinsam trugen sie Alf ins Haus. Dort stand, hinter dem gemauerten Herd mitten im Raum, ein sechs Fuß langer, grob gezimmerter Tisch, den Asla ihren Behandlungstisch nannte. Mit vereinten Kräften hievten sie den Kranken bäuchlings auf die Bretter.
Asla schnaufte vor Anstrengung und atmete zweimal tief durch. „Gut, dass du da bist, Leif. Bitte leg Holz nach und koch Wasser auf. Wenn es sprudelt, gib Kamille und ein paar Lappen hinein. Ich muss seinen Rücken säubern.“
Das ließ sich Leif nicht zweimal sagen. Er war glücklich, Asla unterstützen zu können. An manchen Tagen gingen ihr Thorolfs Magd Ilka oder deren Tochter Mara zur Hand, heute aber wurden beide Frauen im Haushalt des Fürsten gebraucht.
Nachdem er den Kessel mit Wasser gefüllt und über die Herdstelle gehängt hatte, gesellte Leif sich zu Asla, die dem jungen Knecht nasse, kühlende Tücher um die Beine wickelte und beruhigend auf ihn einredete. Doch Alf reagierte nicht auf ihre Worte, stöhnte nur hin und wieder und murmelte zusammenhanglose Worte. Sein Atem ging flach und schnell.
„Was hat er?“
„Ich weiß es nicht“, antwortete Asla besorgt und deutete auf die Innenseite von Alfs rechtem Unterarm. „Siehst du die vielen kleinen roten Flecken?“
Leif nickte. An einer Stelle waren die Flecken miteinander verschmolzen und bildeten eine größere dunkelrote Fläche. „Das sieht komisch aus. Wahrscheinlich hat Runar ihn zu hart angefasst.“
„Nein“, meinte Asla bestimmt, „die Flecken kommen von innen. Irgendetwas stimmt mit Alfs Säften nicht.“
Nachdem das Kamillenwasser im Kessel abgekühlt war, säuberte Asla die Wunden auf dem Rücken des jungen Knechts. Gemeinsam drehten sie ihn anschließend auf die Seite, und während Leif Alfs Kopf hielt, setzte Asla ihm einen Becher mit einem Kräutersud an die Lippen.
„Wach auf und trink“, beschwor sie ihn, „du musst unbedingt etwas trinken.“
Doch Alf reagierte nicht. Seine Gesichtszüge wirkten seltsam entspannt, als träumte er von einer besseren Welt, und nur ein gelegentliches Zucken der Lider zeugte davon, dass noch Leben in ihm war. Schließlich gab Asla ihr Vorhaben auf, dem Bewusstlosen Flüssigkeit einzuflößen.
Seufzend ließ sie sich auf einem Schemel nieder und faltete die Hände in ihrem Schoß. „Mehr kann ich nicht tun“, sagte sie. „Sein Leben liegt nun in Gottes Hand.“
Nach einer Weile, in der sie schweigend auf den geschundenen Körper des Kranken gestarrt hatten, prüfte Asla dessen Puls und Atmung. Traurig blickte sie zu Leif und schüttelte den Kopf.
Leif war erschüttert. Natürlich wusste er, dass Menschen starben. Aber er war noch nie dabei gewesen.
***
Jora verabschiedete sich von Digur und Sven. Laut pfiff sie nach Grimm. Der riesige Wolfshund hatte ihr gehorcht und während der Übungen brav am Rand des Platzes ausgeharrt, doch jetzt hielt ihn nichts mehr dort. Mit heraushängender Zunge kam er freudig auf sie zugerannt, setzte sich hechelnd auf die Hinterläufe und blickte sie erwartungsvoll an. Jora holte ein Stück getrocknetes Fleisch aus dem Beutel an ihrem Gürtel und belohnte seinen Gehorsam. Gierig verschlang Grimm den Leckerbissen und schleckte sich die Schnauze. Es hatte sie einige Mühe gekostet, ihm abzugewöhnen, sie anzuspringen. Obwohl Jora mit sechs Fuß groß für eine Frau war, würde der Wolfshund sie überragen, wenn er sich auf die Hinterbeine stellte, und sie unweigerlich zu Fall bringen. Versonnen kraulte Jora sein grau-weiß geschecktes, borstiges Fell. Hinter den kleinen Ohren mochte er das besonders gerne.
Bald zwei Jahre zuvor, an einem regnerischen Herbsttag, hatten Sven und sie bei einem Streifzug durch den Wald den Wurf einer wilden Hündin entdeckt. Drei der fünf Welpen waren tot; die beiden noch lebenden Kleinen waren abgemagert und fiepten jämmerlich. Vermutlich war ihre Mutter von einem Jäger getötet worden. Sven hatte nach einem dicken Ast gegriffen und die Welpen erschlagen wollen. Doch Jora war ihm in den Arm gefallen.
Hitzig, fast zornig hatte Sven sie angefahren: Sie wisse doch, dass die Welpen zu Bestien heranwüchsen. Als Kind habe er die Angriffe von ganzen Wolfshundrudeln erlebt. Wie aus dem Nichts seien sie aufgetaucht, hätten Schweine und Schafe gerissen und auch Menschen angegriffen. Sie solle doch Digur fragen – der habe nach einem ihrer Angriffe sein Bein verloren. Erst nachdem viele Wolfshunde den Pfeilen und Spießen der Siedler zum Opfer gefallen seien, hätten die Tiere die Gefahr erkannt und die Nähe Waldhafens gemieden.
Natürlich wusste Jora das, doch sie hatte sich schließlich gegen Sven durchgesetzt und die beiden Welpen mitgenommen.
Der kleinere der beiden starb noch in der ersten Nacht, der größere aber besaß einen starken Überlebenswillen. Viele Tage fütterte sie ihn geduldig, anfangs mit Milch, die der Welpe gierig von ihrem Finger schleckte, später dann mit Fleisch, das sie sehr klein schnitt und ihm mehrmals am Tag in kleinen Portionen vorsetzte. Als er über den Berg war, gab sie ihm den Namen Grimm.
Wie Jora es gehofft hatte, besaß der heranwachsende Rüde das Wesen eines Hundes und nur wenig von der räuberischen, aggressiven Natur seiner wilden Artgenossen in den Wäldern. Er war sanftmütig und erduldete es stoisch, wenn Kinder ihn an den Ohren zupften oder gar am Schwanz zogen. Doch wenn Männer sich Jora näherten, die er nicht kannte, entstieg Grimms Kehle ein tiefes, gefährliches Knurren, das selbst Hartgesottene verschreckte.
Vom Übungsplatz am nördlichen Ende Waldhafens war es nicht weit bis zum Zentrum der Siedlung mit der großen Versammlungshalle. Jora ließ sich Zeit, die Arbeit zu Hause konnte warten. Mit Grimm an ihrer Seite schlenderte sie die Gasse entlang, an der die Häuser verschiedener Handwerker lagen. Linker Hand befanden sich die Heim- und Werkstätten eines Gerbers, eines Wagners und eines Töpfers, auf der anderen Seite die Schmiede von Bran, einem der beiden Schmiede im Ort, und die Werkstatt eines Tischlers. Abgesehen von Kindern, die Verstecken spielten oder um die Wette Murmeln in ein Loch der lehmigen Gasse rollen ließen, war kaum jemand unterwegs.
Als Jora sich jedoch dem Dorfplatz näherte, hörte sie Frauen und Männer lauthals Waren feilbieten, feilschen und miteinander streiten. Klar, heute war Markttag! Deshalb war die Gasse so leer. Auf dem großen Platz vor der Versammlungshalle boten nicht nur die Handwerker, Bauern und Fischer ihre Waren an, sondern auch Frauen, die in häuslicher Arbeit mit ihren Mägden Stoffe gewebt, Kleider genäht oder Körbe aus Binsen geflochten hatten und nun die Produkte ihres Fleißes gegen Silber, Gold oder andere Waren tauschten.
Jora stieg der köstliche Geruch frisch gebackener Fladenbrote in die Nase und sie hätte sich gerne ein mit Honig bestrichenes geholt. Doch Grimm mochte keine großen Menschenansammlungen. Er knurrte dann unentwegt und Jora befürchtete, er könnte auch einmal zubeißen. Vermutlich überforderten ihn solche Situationen, in denen er nicht mehr zu unterscheiden vermochte, wer der vielen sich nähernden Menschen es gut oder böse mit seiner Herrin meinte.
Also ging sie weiter, an der Halle von Digur und Stina vorbei zum Haus ihrer Mutter. Vor vielen Jahren hatte auch ihr Vater ganz in der Nähe gewohnt, doch als Thorolf Fürst geworden war, hatte er sich ein prächtiges Anwesen weiter oben am Hang bauen lassen.
Als Jora sich dem Haus näherte, hörte sie die lauten Stimmen ihrer geschiedenen Eltern. Sie zankten. Wie so oft, wenn sie zusammenkamen. Manchmal fragte sich Jora, wie es die beiden überhaupt einmal miteinander ausgehalten hatten.
Sie befahl Grimm, neben der Tür Platz zu machen, und ging hinein. Im hinteren Bereich des Hauses saß Leif auf ihrer Schlafstätte und hielt den Kopf in die Hände gestützt. Nur kurz blickte er auf, um ihr zuzunicken, während ihre Eltern keine Notiz von ihr nahmen, sie waren zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Wie lauernde Kampfhunde standen sie sich an dem grob gezimmerten Tisch gegenüber, auf dem regungslos ein halb nackter junger Mann lag. Betroffen erkannte sie Alf.
„Wie konntest du das zulassen? Er war dein Sohn! Kümmert dich sein Tod denn gar nicht?“, giftete Asla.
Thorolf stützte sich mit beiden Fäusten am Tisch ab, beugte sich vor, presste die Lippen zusammen und musterte sie mit verengten Augen. „Er war mein Knecht und seine Arbeitskraft wird mir fehlen. Ja, das kümmert mich! Mehr aber auch nicht! Wo kämen wir denn hin, wenn jeder seine Bastarde als Söhne oder Töchter anerkennen würde?“
„Vielleicht in eine bessere Welt?“ Aslas Stimme klang gereizt. „Vielleicht in eine, die dein Bruder Yngvi für uns alle wollte? In eine, in der es keine Unfreien gibt, die ungestraft wie Tiere behandelt werden können?“
„Lass Yngvi aus dem Spiel!“, brüllte er sie an.
Ihre Mutter hatte da wohl einen wunden Punkt getroffen.
Mit gesenkter Stimme fuhr Thorolf fort: „Ich sorge für meine Unfreien und behandle sie gerecht. Das weißt du! Die meisten Familienoberhäupter tun das. Hätte ich gewusst, dass Alf krank war, hätte ich ihn vom Arbeitstrupp abgezogen.“
„Und warum wusstest du es nicht?“, fragte Asla höhnisch. „Ich verrate es dir: Weil du einem Menschenschinder wie Runar die Führung des Bautrupps anvertraut hast. Weil es dich nicht kümmert, wie er mit den Knechten umspringt. Dir ist doch nur wichtig, dass der Weg zum neuen Dorf möglichst schnell fertig wird und dich so wenig wie nur möglich kostet.“
Thorolf schwieg und mahlte mit den Zähnen. Vielleicht erkannte er, dass in Aslas Worten mehr als ein Fünkchen Wahrheit steckte.
„Ich bin nicht gekommen, um mit dir zu streiten“, sagte er schließlich in normaler Lautstärke.
„Sondern?“
„Du musst mir einen Zahn ziehen. Er quält mich schon seit Tagen.“
„Dann setz dich drüben ans Fenster. Ich hole meine Zange.“ Asla klang distanziert, so wie meist im Umgang mit ihrem früheren Mann.
Jora setzte sich neben Leif. Der Tod Alfs schien ihren Halbbruder stark mitzunehmen. Kein Wunder, dachte sie. Die beiden waren zusammen im Haushalt von Thorolf und Vildis aufgewachsen. Jora hingegen, die bei ihrer Mutter groß geworden war, hatte den schüchternen jungen Knecht, von dem man sagte, er sei ein Bastard des Fürsten, nicht näher gekannt.
Schweigend beobachteten sie das Geschehen am anderen Ende des Raumes. Thorolf setzte sich auf einen Hocker vor dem kleinen Fenster neben der Tür und hielt sein Gesicht in das hereinfallende Tageslicht. Asla befahl ihm, den Mund zu öffnen, und schob ihm ein Beißholz zwischen die Backenzähne der gesunden Kieferseite.
„Das macht sie wahrscheinlich, damit ihr Thorolf nicht die Finger abbeißt“, flüsterte Jora in einem eher unbeholfenen Versuch, Leif ein wenig aufzumuntern.
„Nein, das macht sie, damit er den Mund offen hält und nicht vor Schmerzen auf die Zange beißt. Dann wären wahrscheinlich seine Vorderzähne dahin“, erwiderte dieser ernst.
Thorolf gab ein unterdrücktes Stöhnen von sich, als Asla mit der Zange an seinem kranken Zahn werkelte.
„Hmm“, brummte sie leise. „Der sitzt noch ziemlich fest und ist schwer zu fassen.“
Thorolf stöhnte erneut.
„Ob sie absichtlich an seinem Zahn wackelt?“, flüsterte Jora.
„Niemals!“, sagte Leif noch immer ernst. „Deine Mutter ist eine Heilerin. Sie würde nie jemandem absichtlich wehtun.“
Du kleiner Tor, dachte Jora amüsiert. Wenn du von meiner Mutter erzogen worden wärst, würdest du anders denken. Asla konnte, wenn sie wütend war, durchaus auch gemein sein und Jora war sich sicher, dass der Zorn ihrer Mutter auf Thorolf noch nicht verraucht war und sie den kranken Zahn erst ein wenig necken würde, bevor sie ihn endgültig seiner Heimstatt beraubte.
Als Thorolf den Wüterich in seinem Kiefer endlich los war, stieß er einen erleichterten Seufzer aus, spülte seinen Mund mit einer klaren Flüssigkeit aus und spie sie dunkelrot in eine Schüssel. Erst jetzt schien er Leif und Jora wahrzunehmen.
„Was machst du eigentlich schon wieder hier?“, herrschte er seinen Sohn an. „Das war eine ziemlich erbärmliche Vorstellung, die du da heute mal wieder geboten hast. Schäm dich!“ Thorolf stand auf. Die Fäuste in die Seiten gestemmt baute er sich vor seinem Sohn auf. „Schau mich gefälligst an, wenn ich mit dir rede!“
Leif gehorchte. Sein rundes Gesicht war bleich und seine Augen schimmerten verräterisch. Jora war versucht, seine Hand zu nehmen, um ihm beizustehen, doch das hätte ihn in den Augen Thorolfs nur noch schwächer erscheinen lassen, und so unterließ sie es.
„Nimm dir ein Beispiel an deiner Schwester. Heute hat sie sogar Sven geschlagen. Und das, obwohl sie nur ein Mädchen ist.“
Jora hätte sich geschmeichelt gefühlt, wenn ihr Vater auf das Wörtchen „nur“ verzichtet hätte. Seit sie denken konnte, hatte Thorolf sie mit diesem kleinen Wort erniedrigt und in ihr umso mehr das Bedürfnis geweckt, all das zu können und zu tun, was auch ein Junge konnte. Bis in die Fingerspitzen hatte sie der Wunsch erfüllt, von Thorolf, den sie liebte und verehrte, geachtet zu werden. Doch was sie auch machte, ob sie mit sicherer Hand den Bogen gebrauchte oder geschickt mit dem Schwert umging, ihr Vater war allenfalls verwundert. Mehr als „nur eine Tochter“ würde sie für ihn wohl nie sein.
Thorolf war noch nicht fertig. „Würdest du nur halb so gut mit dem Schwert umgehen wie deine Schwester, wäre ich schon zufrieden. Sehr sogar.“
Oh, dachte Jora, fehlte in dem seltenen Lob nicht das Wörtchen „nur“?
„Wenn du eines Tages mein Nachfolger werden willst, musst du in der Lage sein, Männer in ihre Schranken zu weisen. Und das geht nun mal meist nur, indem man das Schwert sprechen lässt. Kapierst du das nicht?“ Den letzten Satz hatte Thorolf gebrüllt.
Leif sah wieder zu Boden und krümmte den Rücken wie ein verängstigtes Kaninchen.
Thorolf sah sich in Aslas Kräuterküche um. „Und hier möchte ich dich nicht mehr sehen! Statt deine Zeit mit Weiberkram zu vergeuden, wirst du von nun an jeden Tag mit dem Schwert üben.“
Jora warf einen Blick zu Asla, die mit zusammengezogenen Brauen und gerunzelter Stirn hinter ihrem früheren Mann stand. Ihre Mutter schüttelte stumm den Kopf, um ihr zu bedeuten, es habe keinen Sinn, sich einzumischen.
Thorolf wandte sich an Jora. „Und du wirst Leif unterrichten! Jeden verdammten Nachmittag!“
Energisch schüttelte Jora den Kopf. „Leif ist nicht für den Kampf geschaffen, Vater. Er hat nicht den Körperbau dazu und er reagiert zu langsam. Es ist, als würdest du von mir verlangen, ich solle einem Ochsen das Tanzen beibringen.“ Sie warf ihrem Bruder einen entschuldigenden Blick zu.
Thorolf verengte die Augen und schob den Unterkiefer vor. Die Drohung in seiner Stimme war unüberhörbar, als er sagte: „Überlass gefälligst mir das Urteil darüber, wozu mein erstgeborener Sohn fähig ist und wozu nicht, Mädchen. Tu einfach, was ich dir gesagt habe.“
Jora nickte resigniert.
Sie hatte sich schon oft gefragt, warum ihr Vater aus Leif unbedingt einen heldenhaften Schwertkämpfer machen wollte. Es war doch offensichtlich, dass dem Jungen alle körperlichen Voraussetzungen dafür fehlten. Thorolf hatte mit dem neunjährigen Thorstein doch auch noch einen zweiten Sohn, der mit seinem ungestümen Wesen und seinem schlanken, gewandten Körper ganz den Vorstellungen seines Vaters entsprach. Als Thorstein sein erstes Holzschwert geschenkt bekommen hatte, hatten die Augen des Jungen vor Freude geleuchtet. Er hatte es pfeifend durch die Luft geschwungen und war damit unverzüglich durch die Gassen Waldhafens gestürmt. Bald lehrte er nicht nur gleichaltrigen, sondern auch einige ältere Jungen das Fürchten.
Erst kürzlich hatte Jora ihre Mutter gefragt, warum Thorolf seinen Ältesten mit Ansprüchen überfordere, denen dieser nicht genügen konnte, und sein Augenmerk nicht stattdessen auf Thorstein richte. Asla hatte gelacht und ihr erzählt, ihrem Vater sei in seiner Jugend von einem Runenkundigen prophezeit worden, sein erstgeborener Sohn werde das Schicksal der Sippe zum Guten wenden – am Glauben an diese Prophezeiung halte Thorolf seitdem unerschütterlich fest.
KAPITEL 3
Caven
Mit dicken Lederhandschuhen fasste Caven den Eisenstab an den Enden und positionierte dessen gelb glühende Mitte an einem runden Metallpfosten. Es kostete ihn nicht viel Kraft, den Stab um den Pfosten herum zu einer schmalen U-Form zu biegen. Es zischte und dampfte, als er sein Werk in den Wasserzuber tauchte. Gespannt legte er den gebogenen Stab um den bereitliegenden, etwa zwei Fuß langen Kern des entstehenden Schwertes. Er nickte zufrieden. Beide Teile passten perfekt zusammen. Aus dem äußeren, härteren Metall würde er später die scharfe Schneide der Waffe herausarbeiten. Der weichere, aufwendig geschmiedete Kern war die Seele des Schwerts und würde diesem Elastizität und Bruchsicherheit verleihen.
Jetzt galt es, die beiden Teile fest miteinander zu verschweißen. Caven begann mit der Spitze des Schwerts und hielt sie in die Glut der Feuerstelle. Als sie sich gelb verfärbte, platzierte er sie auf dem Amboss und schlug mit dem Schmiedehammer kraftvoll auf die Nahtstellen der beiden Teile ein. Er liebte es, wenn sich das äußere, härtere Eisen mit dem weicheren verband. Das gab ihm ein Gefühl der Macht und das Empfinden, mehr als nur ein bedeutungsloser Knecht zu sein. Als die Schwertspitze zu kalt zum Schmieden wurde, legte er sie ins Feuer, um sie erneut zum Glühen zu bringen.
Obwohl die große Schmiede mit ihren drei Arbeitsplätzen zwischen dem Dach und den Wänden einen durchgängigen, einen Fuß breiten Spalt besaß, der den von den Bergen kommenden Wind hereinließ, trieb die Hitze der nahen Feuerstelle und des glühenden Eisens Schweißperlen über Cavens nackten, muskulösen Oberkörper. Er war durstig, doch er hämmerte unverdrossen weiter. Zu kostbar war die wenige Zeit, die ihm für die Herstellung dieses Schwerts, seines Meisterwerks, zur Verfügung stand.
„Das wird“, lobte ihn sein Halbbruder Knut mit einem anerkennenden Lächeln. „In dir fließt das Blut eines Schmieds.“ Knut war zwei Jahre älter als er und der jüngere der beiden legitimen Söhne Haralds.
Ja, dachte Caven bitter. In ihnen beiden floss Haralds Blut. Doch während ihr Vater Knut und Runar das Schmiedehandwerk beigebracht hatte, war er selbst, der Bastard und Knecht, nur mit Handlangerarbeiten betraut worden. Aber das sagte er nicht. Seine Stimme hätte vorwurfsvoll geklungen und einen Vorwurf verdiente sein Halbbruder nicht, der ihm anders als der ältere Runar immer freundlich gesinnt war. Ohne die Hilfe Knuts könnte er das Schwert niemals fertigen, denn Harald hatte ihm die Arbeit mit Hammer und Amboss verboten. „Du bist ein Knecht“, hatte sein Vater gepoltert, als er ihn beim Schmieden von Nägeln erwischte. „Knechte können keine Schmiede werden.“
Doch Caven hatte, wenn er niedere Dienste in der Schmiede verrichtete, mit Habichtsaugen alle Handgriffe Haralds und seiner Halbbrüder beobachtet und das Wissen um die Abläufe der Herstellung eines Werkzeugs, eines Messers oder auch eines Schwertes wie ein durstiger Schwamm aufgesaugt, und glücklicherweise gab es immer wieder Tage, an denen Harald und Runar unterwegs waren. Dann legte Knut ihm einen schweren Schmiedehammer in die Hände, gab ihm eine Zange und ein Stück Eisen und überließ ihm einen der drei Ambosse. Es waren die glücklichsten Momente in Cavens Leben, wenn er sein theoretisches Wissen in die Praxis umsetzen durfte. Natürlich machte er Fehler, aber Knut korrigierte sie geduldig und gab ihm wertvolle Hinweise, die ihm halfen, sein Können zu verbessern.
Wenn Harald an solchen Tagen abends zur Schmiede zurückkehrte, lobte er verwundert den Fleiß Knuts, der weitaus mehr geschafft hatte, als sein Vater erwartet hatte.
Auch heute konnte Caven am Amboss stehen. Runar leitete die Bauarbeiten an dem neuen Weg nach Grünheim und Harald lag steif wie ein Stock auf seinem Lager. Mit seinen sechzig Wintern zwackte es den alternden Schmied immer häufiger an allen möglichen Stellen seines Körpers, und als er sich am Morgen des Vortags von seinem Lager erhoben hatte, hatte er vor Schmerz gebrüllt und war sogleich wieder niedergesunken.
Laut Shea, die sich um den Haushalt kümmerte, hatte Harald geflucht, es müsse Odin selbst gewesen sein, der ihm solch einen mächtigen Blitz in den Rücken gejagt habe. Caven dachte an die rothaarige Magd, die Harald von einem Bauern gegen ein einfaches Schwert eingetauscht hatte. Er mochte sie. Shea hielt zu ihm und würde ihn nie bei ihrem Herrn verraten, genauso wenig wie Lars und Aldwyn. Die beiden jüngeren Knechte halfen Caven sogar, indem sie einen Großteil der eigentlich ihm übertragenen Arbeiten übernahmen, wenn er schmiedete. Und der alte Rutger bekam kaum mehr etwas mit.
Caven betrachtete die unfertige Waffe. Es war in seinem einundzwanzigsten Winter gewesen, als er mit ihrer Herstellung begonnen hatte. Seither waren fast zwei Jahre vergangen, in denen er bei jeder Gelegenheit an seinem Meisterwerk gearbeitet hatte.
Zunächst hatte er acht dünne Stäbe aus weichem und hartem Eisen geschmiedet, jeden einzelnen Stab in sich gedreht und schließlich alle acht Stäbe zu dem elastischen Kern des Schwertes verschweißt. Das Wissen um die Herstellung einer solch hochwertigen Waffe hatte er sich wie beinahe all sein Wissen um das Schmieden von Harald abgeschaut. Der war in jungen Jahren durch das Frankenreich gereist und hatte dort in mehreren führenden Schmieden die hohe Kunst erlernt, besonders bruchsichere Schwerter anzufertigen. Zuletzt hatte Harald für den reichen Bauern Finnur eine solche Waffe geschmiedet und auch Thorolf und Digur trugen ähnliche Schwerter, deren fränkische Herkunft und besondere Güte durch den Namenszug „Ulfberht“ beglaubigt wurde. Genau so eines wollte Caven schmieden.
„Wir sollten deinen Platz aufräumen“, sagte Knut, während er einen zweiten fertigen Axtkopf neben den ersten stellte, und erinnerte Caven damit an die bevorstehende Rückkehr Runars.
Caven seufzte und überreichte seinem Halbbruder die unfertige Waffe. „Ich hoffe, Harald bleibt noch einige Zeit an sein Lager gefesselt, sonst bekomme ich es nicht mehr fertig.“
„Du schaffst das“, antwortete Knut zuversichtlich, während er das Schwert in seiner persönlichen Truhe einschloss. „Es sind ja noch ein paar Wochen, bis ich nach Grünheim aufbreche.“
Hoffentlich dauerte es noch länger, wünschte sich Caven. Knut würde in sechs Wochen die Tochter eines Fischers heiraten und sich danach mit ihr in der neuen Siedlung niederlassen. Dort wollte er mit den Mitteln, die Harald ihm versprochen hatte, und der Mitgift seiner Zukünftigen eine eigene Schmiede aufbauen. Runar würde dann im nächsten Jahr die väterliche Schmiede übernehmen.
„Für wen fertigst du das Schwert eigentlich?“, fragte Knut. „Für dich doch sicher nicht; du kannst ja überhaupt nicht damit umgehen.“
Caven runzelte die Stirn. „Das fragst du mich jetzt schon zum dritten Mal. Ich glaube, in erster Linie schmiede ich das Schwert für mich. Ich möchte mir beweisen, dass ich es kann. Verkaufen kann ich es leider nicht, denn Harald würde sicher Wind davon bekommen und Runar freie Hand lassen, mich zu bestrafen. Du weißt, welch große Freude der an so etwas hat.“
Caven dachte an die vielen blauen Flecken, die ihm sein älterer Halbbruder in der Kindheit und Jugend zugefügt hatte. Harald war nur eingeschritten, wenn sein Bastard sichtbare Wunden davongetragen hatte. Dann hatte er die Peitsche vom Haken genommen und Runar gezüchtigt, was dieser mit hasserfülltem Blick über sich hatte ergehen lassen.
Irgendwann hatte Caven erkannt, dass Harald Runar nicht bestrafte, um ihm, seinem Bastardsohn, zukünftig Leid und Schmerz zu ersparen; dem Schmied ging es alleine darum, die Arbeitskraft eines tüchtigen Knechts zu erhalten. Er behandelte Caven da nicht anders als seine anderen Unfreien.
Runar aber gab stets Caven die Schuld, wenn er die Peitsche seines Vaters zu spüren bekam, und zahlte es ihm einige Tage später auf subtile Weise heim. So sorgte er dafür, dass Caven kein Essen bekam, oder sabotierte die diesem aufgetragenen Arbeiten, was zur Folge hatte, dass wiederum Caven ausgepeitscht wurde. Zwar achtete Harald darauf, dass die Striemen nicht bluteten, dennoch brannten sie höllisch, und in den Nächten, in denen Caven vor Schmerzen kaum schlafen konnte, wuchs in ihm der Wunsch nach einem selbstbestimmten Leben als freier Mann. Mit der Zeit war es ihm fast zur Obsession geworden, sich geeignete Wege zu überlegen, die ihn aus der bitteren Knechtschaft zu befreien vermochten.
„Wenn du das Schwert nicht verkaufen willst, dann kannst du es ja eigentlich nur einer vertrauenswürdigen Person schenken oder es vergraben“, sagte Knut.
„Wem sollte ich es schenken? Da gibt es niemanden“, log Caven.
Er hatte mittlerweile eine Idee, wie er das in den letzten Jahren in ihm gereifte Vorhaben mithilfe des Schwerts verwirklichen konnte. Aber von diesem Plan, der ihn und andere Unfreie in die Freiheit führen sollte, durfte Knut nichts wissen.
***
Caven betrat die große Halle Haralds, um das Abendessen einzunehmen. Lars und Aldwyn folgten ihm. Schweigend nahmen die Männer an dem kleinen Tisch in der Ecke neben der Tür Platz, an dem bereits der alte Rutger saß. Der Geruch von gegrilltem Schweinefleisch und gebratenem Fladenbrot stieg ihnen in die Nase.
„Wir werden uns wohl wieder mit Eintopf und Brot begnügen müssen“, murrte Lars. „Aber vielleicht haben wir ja Glück und die noblen Herren schaffen nicht alles von dem Fleisch und lassen uns ein paar Brocken übrig.“
Caven zuckte mit den Schultern und schenkte dem hageren, glatzköpfigen Knecht ein aufmunterndes Lächeln. „Shea wird schon ein paar Fleischbrocken in unseren Eintopf schummeln.“
Er mochte den griesgrämigen, knapp vierzig Jahre alten Mann mit den herabhängenden Mundwinkeln und traurigen Augen. Lars beobachtete seine Umgebung zwar immerzu mit finsterer Miene und gab nur zu gerne bissige Bemerkungen von sich, war aber im Grunde seines Herzens ein warmer und mitfühlender Mensch.