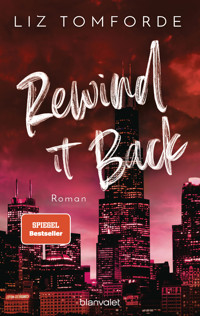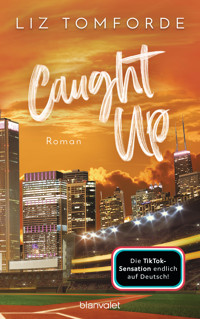
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Windy City-Reihe
- Sprache: Deutsch
Single-Daddy und Baseball-Superstar Kai bricht die goldene Regel: Verliebe dich nicht in die Nanny! Der TikTok-Hype endlich auf Deutsch!
Kai Rhodes hat ein Problem: Der Pitcher des Baseball-Teams von Chicago braucht dringend eine neue Nanny, doch bisher hat keine der Kandidatinnen überzeugt. Auch Miller Montgomery erfüllt seine Ansprüche nicht. Sie ist wild und sprunghaft – und viel zu anziehend! Doch sie ist die Tochter des Trainers und somit unkündbar. Für Miller ist der neue Nanny-Job eine willkommene Abwechslung, und der kleine Max ist ein Schatz, doch sein Vater Kai ist eine Spaßbremse. Miller will ihn daran erinnern, wie man das Leben genießt! Dass sie Vater und Sohn dabei wirklich ins Herz schließt, war aber nicht geplant, kann sie doch nur einen Sommer lang in Chicago bleiben …
Sports Romance trifft auf Good Guy x Wild Girl und Found Family – auch Band 3 der »Windy City«-Reihe ist unwiderstehlich!
Enthaltene Tropes: Sports Romance, Found Family
Spice-Level: 4 von 5
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 677
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Buch
Kai Rhodes hat ein Problem: Der Pitcher des Baseballteams von Chicago braucht dringend eine neue Nanny, doch bisher hat keine der Kandidatinnen überzeugt. Auch Miller Montgomery erfüllt seine Ansprüche nicht. Sie ist wild und sprunghaft – und viel zu anziehend! Doch sie ist die Tochter des Trainers und somit unkündbar. Für Miller ist der neue Nanny-Job eine willkommene Abwechslung, und der kleine Max ist ein Schatz, doch sein Vater Kai ist eine Spaßbremse. Miller will ihn daran erinnern, wie man das Leben genießt! Dass sie Vater und Sohn dabei wirklich ins Herz schließt, war aber nicht geplant, kann sie doch nur einen Sommer lang in Chicago bleiben …
Sports Romance trifft auf Good Guy x Wild Girl und Found Family – der unwiderstehliche 3. Band der »Windy City«-Reihe!
Autorin
Liz Tomforde ist selbst Fan von Sports Romance und hat es sich auf die Fahne geschrieben, in ihren Romanen gesunde Beziehungen zu zeigen und Männer zu erschaffen, in die man sich einfach verlieben muss. Neben ihrer Tätigkeit als Autorin ist sie selbst Flugbegleiterin für ein NHL-Team und verbindet so ihre beiden weiteren Leidenschaften, das Reisen und Eishockey. Während der Pandemie nutzte sie die Inspiration aus ihrem Job und schrieb ihren ersten Roman »Mile High«. Schon bald entstand die ganze »Windy City«-Reihe, die einen regelrechten TikTok-Hype auslöste. Die ersten beiden Bände stiegen direkt in den Top 20 der SPIEGEL-Bestsellerliste ein. Liz Tomforde lebt und schreibt in Kalifornien.
Liz Tomforde
Caught Up
Roman
Aus dem Englischen von Maike Hallmann
Die Originalausgabe erschien 2023 unter dem Titel »Caught Up« bei Hodder & Stoughton Ltd., London.
Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Copyright der Originalausgabe © 2023 by Liz Tomforde
Translation rights arranged by The Sandra Dijkstra Literary Agency
All Rights Reserved
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2024 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Catherine Beck
Umschlaggestaltung: www.buerosued.de nach einer Originalvorlage von Ever After Cover Design
Umschlagdesign: Ever After Cover Design
Umschlagmotive: stock.adobe.com (rabbit75_fot; LeArchitecto); iusubov nizami / Shutterstock.com
JS · Herstellung: DiMo
Satz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, München
ISBN 978-3-641-31966-3V002
www.blanvalet.de
Übersicht
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Epilog
Danksagung
Haben Sie Lust gleich weiterzulesen? Dann lassen Sie sich von unseren Lesetipps inspirieren.
Newsletter-Anmeldung
Der 10. Oktober (das Erscheinungsdatum der Originalausgabe von Caught Up) wäre der Geburtstag meines Vaters gewesen. Kai und Monty sind ihm gewidmet, weil er das Vorbild für meine beiden fiktionalen Lieblings-Dads war.
Und Allyson – Miller ist dir gewidmet.
Kapitel 1
Kai
»Das soll wohl ein Scherz sein, Ace.« Monty lässt den Scouting-Bericht auf seinen Hotelzimmer-Schreibtisch fallen. »Du hast ihn gefeuert – an einem Spieltag? Was zum Teufel willst du heute Abend mit Max machen? Es ist dein großer Tag!«
Ich habe meinen Sohn mitgebracht – weil ich niemanden habe, der auf ihn aufpassen kann, und weil ich wusste, dass Monty sauer sein würde, weil ich schon wieder mein Kindermädchen gefeuert habe. Max’ pausbäckiges Lächeln stimmt ihn immer ein bisschen friedlicher.
»Ich weiß es noch nicht. Ich überleg mir was.«
»Wir hatten uns schon was überlegt. Mit Troy war alles in bester Ordnung.«
Von wegen. Nach meiner morgendlichen Sitzung mit Mannschaftsarzt und Trainingsteam, bei dem wir meine Schulter für heute Abend gelockert haben, bin ich in mein Zimmer zurückgekommen und habe meinen Sohn mit einer seit Stunden prall gefüllten Windel vorgefunden. Nachdem Troy schon seit Wochen eher den Fanboy für meine Kollegen gibt, statt sich auf seine Arbeit zu konzentrieren, hatte ich jetzt endgültig die Nase voll.
»Es hat einfach nicht gepasst«, sage ich nur.
Gereizt stößt Monty die Luft aus, und Max kichert vergnügt.
Monty beäugt ihn über den Schreibtisch hinweg und beugt sich vor. »Findest du das etwa lustig, Junge? Dank deinem Vater krieg ich ein graues Haar nach dem anderen.«
»Ich glaube, das schaffst du auch ganz ohne mich, alter Mann.«
Mein fünfzehn Monate alter Sohn sitzt auf meinem Schoß und strahlt meinen Coach mit blitzenden Milchzähnchen an. Monty wird sofort weich, so wie ich es mir gedacht hatte … Er hat eine Schwäche für den Kleinen. Verdammt, er hat eine Schwäche für das ganze Team, aber ganz besonders für den Mann, der ihm gerade in diesem Hotelzimmer gegenübersitzt, und seinen Sohn.
Emmett Montgomery – oder Monty, wie wir ihn nennen – ist nicht nur der Field Manager der Windy City Warriors, Chicagos MLB-Team, sondern auch alleinerziehender Vater, genau wie ich. Er hat mir nie Einzelheiten erzählt, aber ich wäre schockiert, wenn seine Situation auch nur annähernd so absurd wäre wie meine. Es sei denn, auch bei ihm wäre eine frühere Affäre fast ein Jahr nach dem letzten Treffen quer durchs Land geflogen, um ihm zu erklären, dass er Vater geworden sei und sie weder mit ihm noch mit dem Kind etwas zu tun haben wolle, hätte ihm einen sechs Monate alten kleinen Jungen dagelassen und wäre wieder abgehauen.
Ich versuche, Montys weiches Herz nicht auszunutzen – mir ist bewusst, dass er und der gesamte Verband sich für mich ohnehin schon sehr ins Zeug legen –, aber wenn es darum geht, dass mein Kind gut versorgt ist, während ich arbeite, mache ich keine Kompromisse.
»Ich rede mal mit Sanderson«, schlage ich vor – Sanderson ist einer der Teamärzte. »Er ist ja sowieso den ganzen Abend im Trainingsraum, und solange niemand verletzt wird, ist es ruhig genug, dass Max problemlos dort schlafen kann.«
Monty reibt sich mit Daumen und Zeigefinger über die Schläfen. »Kai, ich tu alles für dich, was ich kann, aber ohne verlässliche Kinderbetreuung funktioniert es einfach nicht.«
Monty nennt mich nur dann bei meinem Vornamen, wenn er will, dass ich mir seine Worte zu Herzen nehme. Ansonsten benutzen er und das ganze Team meinen Spitznamen – Ace.
Aber ich habe mir seine Worte schon zu Herzen genommen – er predigt es mir bereits seit drei Monaten, also seit Beginn der Saison. Troy ist der fünfte Babysitter, den ich feuere. Und wenn ich ehrlich bin, ist einer der Gründe dafür, dass es nicht klappt: Ich bin nicht ganz sicher, ob ich das überhaupt will.
Ich bin nicht sicher, ob ich weiterhin Baseball spielen will.
Momentan weiß ich nur eines ganz sicher: Ich will Max ein so guter Vater sein, wie ich nur kann. An diesem Punkt in meinem Leben, mit zweiunddreißig und in meinem zehnten Jahr in der Major League, zählt für mich nichts anderes mehr.
Das Spiel, das ich früher so sehr geliebt und als mein ganzes Leben betrachtet habe, empfinde ich jetzt als lästige Pflicht, die mich von meiner Familie fernhält.
»Ich weiß, Monty. Ich kümmere mich darum, sobald wir zurück in Chicago sind. Fest versprochen.«
Er stößt einen weiteren tiefen Seufzer aus. »Wenn ich nicht auch deinen Bruder am Hals hätte, wärst du die größte Nervensäge in meinem Leben, Ace.«
Ich versuche, nicht zu lächeln. »Das ist mir bewusst.«
»Und wenn du nicht so verdammt talentiert wärst, würde ich dich sofort an ein anderes Team verschachern.«
Darüber kann ich nur lachen – so ein Bullshit. Ich bin einer der besten Pitcher der Liga, ja, aber unabhängig von meinem Talent liebt Monty mich.
»Und wenn du mich nicht so sehr mögen würdest«, ergänze ich.
»Raus hier. Los, geh zu Sanderson und klär mit ihm ab, dass er heute Abend auf Max aufpasst.«
Ich erhebe mich und setze mir meinen Sohn auf die Hüfte, bevor ich mich umdrehe, um das Hotelzimmer zu verlassen.
»Und Max?«, ruft Monty meinem Kind hinterher. »Hör auf, immer so verdammt süß zu sein, damit ich deinen Vater ab und zu mal ordentlich anschreien kann.«
Ich verdrehe die Augen und sage zu meinem Sohn: »Wink Monty zum Abschied und sag ihm, dass er auf seine alten Tage ganz schön mürrisch und auch irgendwie hässlich wird.«
»Ich bin fünfundvierzig, du Arsch, und du kannst nur beten, dass du in dreizehn Jahren auch noch so gut aussiehst wie ich.«
Max kichert und winkt meinem Coach zu. Er hat keine Ahnung, wovon wir reden, aber er liebt Monty genauso sehr wie umgekehrt. »Hi!«, ruft er quer durchs Zimmer.
Fast.
»Hi, Kumpel.« Monty lacht. »Wir sehen uns später, ja?«
Ich hätte nicht gedacht, dass ich jemals einem Coach so nahestehen würde wie Monty. Vor der letzten Saison habe ich für die Seattle Saints gespielt, für die ich damals gedraftet wurde und bei denen ich die ersten acht Jahre meiner Karriere verbracht habe. Ich habe das Team respektiert, und ich mochte den Field Manager, aber es war eine rein geschäftliche Beziehung.
In der letzten Saison hat mich dann die Free Agency nach Chicago gebracht, weil mein jüngerer Bruder als Shortstop bei den Warriors spielt und ich es wahnsinnig vermisst habe, mit dem kleinen Scheißkerl Ball zu spielen. Als ich Monty kennenlernte, mochte ich ihn sofort, aber so eng, wie es jetzt ist, wurde es erst, als Max letzten Herbst in mein Leben trat. Ich kann Monty niemals genug für das danken, was er für mich getan hat. Nur seinetwegen hat mich diese plötzliche Veränderung meiner Lebenssituation nicht aus dem Profisport gekegelt. Er versteht die Herausforderungen, vor denen alleinerziehende Eltern stehen.
Er hat der Teamleitung mitgeteilt, dass mein Sohn in dieser Saison mit mir reisen würde, und war nicht bereit, ein Nein zu akzeptieren. Er wusste, dass ich ansonsten in den Vorruhestand gehen würde – mein Kind wurde im Alter von sechs Monaten von seiner eigenen Mutter verlassen und braucht eine konstante und stabile Bezugsperson in seinem Leben. Ich lasse nicht zu, dass ihm etwas so Elementares vorenthalten wird, nur weil ich aufs Spielfeld will.
Allerdings sollte ich wahrscheinlich aufhören, ständig die Kindermädchen zu feuern, um Monty das Leben ein wenig leichter zu machen, aber das ist ein anderes Thema.
Mein Bruder Isaiah joggt uns über den Flur hinterher und springt hinter uns in den Aufzug. Sein hellbraunes Haar sieht aus, als wäre er gerade erst aus dem Bett gekrabbelt. Ich hingegen bin schon seit Stunden auf den Beinen, weil Max schon früh wach war und ich beim morgendlichen Work-out, aber ich würde eine Stange Geld darauf wetten, dass Isaiah tatsächlich gerade erst sein Bett verlassen hat.
Und ich würde mein Leben darauf verwetten, dass in besagtem Bett eine nackte Frau liegt.
»Hey, Mann«, sagt er. »Hi, Maxie«, fügt er dann hinzu und drückt meinem Sohn einen knallenden Kuss auf die Wange. »Wo wollt ihr denn hin?«
»Ich will Sanderson bitten, heute Abend während des Spiels auf Max aufzupassen.«
Isaiah sagt nichts, sondern wartet einfach auf die Erklärung.
»Ich habe Troy gefeuert.«
Er lacht. »Mein Gott, Malakai. Zeig doch noch ein bisschen deutlicher, dass du gar nicht willst, dass es funktioniert.«
»Troy hat einen Scheißjob gemacht, und das weißt du.«
Isaiah zuckt mit den Schultern. »Ich meine, klar, ich bevorzuge es, wenn deine Kindermädchen Titten haben und unbedingt mit mir in die Kiste springen wollen, aber abgesehen davon war er doch gar nicht so übel.«
»Du bist ein Idiot.«
»Max …« Isaiah wendet sich an meinen Sohn. »Hättest du nicht gern eine Tante? Sag deinem Daddy, dass dein nächstes Kindermädchen eine Frau sein soll, ledig, in ihren Zwanzigern oder Dreißigern. Bonuspunkte, wenn sie in meinem Trikot knackig aussieht.«
Max lächelt ihn an.
»Und außerdem sollte sie gern für einen dreißigjährigen Mann die Mama spielen«, ergänze ich. »Und sie darf kein Problem mit einer absolut widerlichen Wohnung haben und muss wissen, wie man kocht und putzt, da du dich als männliches Kind ja solchen Aufgaben verweigerst.«
»Mmm, ja, klingt perfekt. Halt die Augen offen nach jemandem wie …« – der Fahrstuhl hält unten in der Eingangshalle – »… ihr.«
Die Türen öffnen sich, und mein Bruder starrt wie gebannt hinaus.
»Scheiße, ich habe Sandersons Etage verpasst. Schande«, korrigiere ich mich. »Sag ja nicht Scheiße, Max.«
Mein Kind ist zu abgelenkt, um mir beim Fluchen zuzuhören – es kaut auf seinen Fingern und beobachtet seinen Onkel. Besagter Onkel steht immer noch da und glotzt.
»Isaiah, steigst du jetzt aus oder nicht?«
Eine Frau betritt den Aufzug und stellt sich zwischen uns, und seine Schockstarre wird schlimmer. Hübsche Mädchen bringen ihn aus dem Konzept.
Und dieses hier ist wirklich hübsch.
Ihr Haar hat die Farbe von dunkler Schokolade und fällt ihr auf die gebräunten Schultern. Ihre Haut ist über und über mit verschlungenen Tätowierungen bedeckt – und sie zeigt eine Menge Haut. Unter ihrer Latzhose blitzt ein winziger Stofffetzen hervor, entweder Tanktop oder BH, und aus dem ausgefransten Saum der abgeschnittenen Hosenbeine ragen kräftige Oberschenkel heraus. Sie sind im Gegensatz zu den Armen nicht tätowiert.
»Hi«, bringt Isaiah benommen heraus.
Ich verpasse ihm einen leichten Klaps auf den Hinterkopf – das Letzte, was er braucht, ist noch eine Frau. Ich habe auch so gelebt wie er, eine Frau nach der anderen, und jetzt habe ich ein fünfzehn Monate altes Kind auf der Hüfte sitzen. Ich kann es nicht gebrauchen, dass mein kleiner Bruder in meine Fußstapfen tritt und ich mich auch noch um ihn kümmern muss … Der Gedanke ist ähnlich verlockend wie eine Wurzelbehandlung. »Raus aus dem Aufzug, Isaiah.«
Er nickt, winkt und geht rückwärts in die Lobby. »Tschüss«, sagt er mit Herzchen in den Augen, und dabei sieht er nicht mich oder meinen Sohn an.
Die Frau im Aufzug hebt zum Abschied eine der beiden Flaschen mit Corona, die sie in den Händen hält. »Stockwerk?«, fragt sie mich mit rauer, tiefer Stimme, ehe sie sich mit einem Schluck Bier die Kehle schmiert. Sie greift an mir vorbei und drückt den Knopf der Etage, von der ich gerade gekommen bin, bevor sie mich über die Schulter hinweg fragend ansieht.
Ihre Augen sind jadegrün, unter ihrer Nase glänzt ein winziger goldener Septumring, und jetzt verstehe ich, warum sich mein Bruder so ruckartig in einen Teenager verwandelt hat, denn mir geht es nicht anders.
»Soll ich einfach raten? Wenn du willst, kann ich sie auch einfach alle drücken, und wir machen eine schöne lange Aufzugfahrt zusammen.«
Max streckt die Hände nach ihr aus, und das bringt mich zum Glück in die Gegenwart zurück. Ich drehe mich zur Seite, um zu verhindern, dass er seine kleinen Finger in ihrem Haar vergräbt. Sie klingt ja sehr lustig, aber, diese Frau trinkt nicht nur ein Bier um neun Uhr morgens an einem Donnerstag, sondern zwei.
Ich räuspere mich und drücke selbst auf den Knopf der Etage, in der Sandersons Zimmer liegt.
Miss Zwei-Bier-unter-der-Woche wirft sich das Haar über die Schulter und stellt sich wieder neben mich. Trotz ihrer Getränkewahl riecht sie nicht nach Alkohol, sondern eher wie ein Kuchen, und plötzlich habe ich Lust auf was Süßes.
Aus den Augenwinkeln sehe ich, wie sie Max mit einem kleinen Lächeln anschaut. »Du hast ein süßes Kind.«
Du bist selbst ganz schön süß, möchte ich antworten.
Aber ich verkneife es mir. Seit letztem Herbst ist alles anders, und ich bin nicht mehr der Typ, der mit jeder hübschen Frau flirtet, die ihm über den Weg läuft. Ich kann nicht mehr um neun Uhr morgens Bier trinken. Ich kann nicht mehr nach Belieben irgendeine Frau ins Hotelzimmer mitnehmen, von der ich nicht mal den Namen weiß, weil diese Hotelzimmer mit Kinderbetten, Hochstühlen und Spielzeug vollgestopft sind.
Und vor allem mit dieser Frau werde ich ganz sicher nicht flirten. Man muss kein Gedankenleser sein, um zu wissen, dass sie wild drauf ist.
»Spricht er?«, fragt sie.
»Er hier?«
Sie lacht in sich hinein. »Nein, ich meinte dich. Offenbar ignorierst du gern Leute, die gerade mit dir reden?«
»Äh, nein.« Max greift schon wieder nach ihr, und ich drehe mich noch weiter weg, um ihn davon abzuhalten, die Fremde zu begrapschen. »Sorry. Danke.«
Mein Sohn wirft sich in meinem Griff zur Seite und streckt die pummligen kleinen Finger aus, entweder nach ihr oder nach einer der Bierflaschen, ich bin mir nicht ganz sicher.
Die Frau kichert leise in sich hinein. »Vielleicht weiß er, dass du so was gerade gut gebrauchen könntest.« Sie bietet mir ihr zweites Corona an.
»Es ist neun Uhr morgens.«
»Und?«
»Und es ist Donnerstag.«
»Wir sind also auch noch voreingenommen, wie ich sehe.«
»Verantwortungsbewusst«, korrigiere ich.
»Mein Gott.« Sie lacht. »Du brauchst was Stärkeres als Corona.«
Vor allem bräuchte ich einen schnelleren Aufzug, aber vielleicht hat sie gar nicht so unrecht. Ich könnte tatsächlich ein Bier gebrauchen. Oder zehn. Oder ein paar vergnügliche Stunden mit einer nackten Frau. Ich kann mich nicht entsinnen, wann das letzte Mal war. Jedenfalls hatte ich, seit Max in mein Leben getreten ist – und das ist neun Monate her –, weder Bier noch Frauen.
»Dadda.« Max drückt meine Wangen und zeigt dann auf die Frau.
»Ich weiß, Kumpel.«
Ich weiß gar nichts. Nur dass mein Kind immer wieder versucht, sich von mir abzustoßen, um zu ihr zu gelangen. Das ist seltsam … Max mag eigentlich keine Fremden, und vor allem hat er Scheu vor fremden Frauen.
Ich schiebe es auf die Tatsache, dass jene Frau, die ihn geboren hat, ihn einfach bei seinem Vater abgeladen hat, der alleinerziehend ist und ihm als Umfeld vor allem einen leichtsinnigen Onkel und ein Team aus lauter rüpelhaften Baseballspielern zu bieten hat. Die einzige Frau in seinem Leben, mit der er bisher richtig warm geworden ist, ist die Verlobte meines Kumpels, aber selbst bei ihr hat es eine Weile gedauert.
Aber aus irgendeinem Grund ist er von dieser Frau hier sehr angetan.
»Komm schon, Max«, schnaube ich und richte ihn wieder auf. »Hör mit dem Gezappel auf.«
»Klingt bestimmt nach einem seltsamen Angebot, aber ich kann ihn halten, wenn du …«
»Nein«, blaffe ich sie an.
»Liebe Güte.«
»Ich meine, nein, danke. Er kann nicht gut mit Frauen.«
»Woher er das wohl hat?«
Ich werfe ihr einen giftigen Blick zu, aber sie zuckt nur mit den Schultern und trinkt einen weiteren Schluck.
Max kichert völlig grundlos. Der Junge ist offenbar völlig in sie verknallt, und diese Aufzugfahrt dauert viel zu lange.
»Hast du dein Lächeln von deiner Mama?«, fragt sie ihn, legt den Kopf schief und mustert ihn voller Bewunderung. »Von deinem Vater kannst du es jedenfalls nicht haben.«
»Sehr witzig.«
»Ich tu mal so, als wäre das nicht sarkastisch gemeint, und du hättest tatsächlich Sinn für Humor.«
»Er hat keine Mutter.«
Kurz wird es unheimlich still, so wie praktisch immer, wenn ich diese vier Worte sage. Die meisten Leute denken erschrocken, dass sie in ein schreckliches Fettnäpfchen gestolpert sind und seine Mutter auf tragische Weise ums Leben gekommen ist. Auf die Idee, dass sie mir nicht gesagt haben könnte, dass sie schwanger ist, um dann sechs Monate nach der Geburt aufzutauchen, meine ganze Welt auf den Kopf zu stellen und abzuhauen, kommt natürlich niemand.
Ihr neckischer Tonfall schlägt um. »O Gott, es tut mir so leid. Ich wollte nicht …«
»Sie ist am Leben. Sie ist nur nicht da.«
Ich kann förmlich sehen, wie Erleichterung über sie hinwegspült. »Oh, okay, das ist gut. Ich meine, nein, gut ist das natürlich nicht. Oder vielleicht doch? Wer bin ich, dass ich das sagen könnte? Dieser Aufzug braucht ja ewig, verdammt.« Sie schlägt sich eine Hand vor den Mund, ihr Blick zuckt zu Max. »Ich meine, verflixt noch mal.«
Ich spüre, wie meine Mundwinkel zucken.
Ihr Blick wird ein wenig weicher. »Oh, er kann ja doch lächeln.«
»Er lächelt noch viel mehr, wenn er nicht gerade von einer Fremden im Aufzug beschimpft wird, die gleich nach dem Aufstehen in jeder Faust ein Bier spazieren trägt.«
»Vielleicht war sie ja noch gar nicht im Bett.« Sie zuckt lässig mit den Schultern.
Lieber Gott.
»Vielleicht sollten gewisse Leute mal damit aufhören, wie ein paar überhebliche A-Löcher von sich selbst in der dritten Person zu sprechen.«
Endlich hält der Aufzug in dem Stockwerk, das sie gedrückt hat.
»Vielleicht sollte er sich mal ein bisschen lockerer machen. Er hat ein verdammt süßes Kind und ein noch süßeres Lächeln, wenn er es denn mal benutzt.« Grüßend hebt sie ihr Corona und prostet mir zu, ehe sie den Rest austrinkt und sich zum Ausgang wendet. »Danke für die Fahrt, Baby-Daddy. Es war … interessant.«
Das war es in der Tat.
Kapitel 2
Miller
Ich liebe Butter. Man stelle sich vor, man wäre selbst derjenige, der dieses größte Geschenk an die Menschheit erschaffen hat. Ich könnte diesen Menschen für seine Entdeckung küssen. Butter auf Brot? Perfekt. Geschmolzen auf einer gebackenen Kartoffel? Ein Geschenk des Himmels. Oder, mein persönlicher Favorit: Butter, eingebacken in meine berühmten Chocolate Chip Cookies.
Natürlich denken jetzt alle, ach, Schokoladenkekse sind doch alle gleich. Falsch gedacht. Völlig falsch. Ich mag ja im ganzen Land dafür bekannt sein, für Restaurants, die gern einen Michelin-Stern hätten, die mittelprächtigen Dessertkarten aufzumöbeln, aber manchmal wünschte ich, eins dieser schicken Restaurants würde sich ein Herz fassen und meine verdammten Schokoladenkekse auf die Speisekarte setzen.
Sie wären ausverkauft. Jeden Abend.
Aber nein … Selbst wenn ein Restaurant bereit wäre, einen solchen Klassiker ins Programm aufzunehmen, dieses Rezept gehört mir allein. Ich stelle meinen Kunden all meine Kreativität, meine Tipps und Techniken zur Verfügung. Selbst einem Restaurant, das jahrelange Wartelisten für seine Reservierungen hat, könnte ich noch neuen, frischen Schwung für seine Dessertkarte liefern. Aber die klassischen Rezepte – die, an denen ich seit fünfzehn Jahren feile und bei denen der ganze Körper aufseufzt, sobald der Zucker die Zunge küsst; jene Rezepte, die einen unweigerlich an zu Hause erinnern –, die gehören mir.
Nach diesen Rezepten fragt sowieso niemand. Sie sind nicht das, wofür ich bekannt bin.
Aber wenn ich nicht bald ein neues Dessert kreiere – seit drei Wochen bin ich dran, aber es will einfach nicht klappen –, werde ich vermutlich dafür bekannt, mitten in dieser Küche in Miami einen Nervenzusammenbruch zu erleiden.
»Montgomery«, ruft einer der Köche. Aus irgendeinem Grund hält er es nicht für nötig, mich mit meinem Titel anzusprechen, also schere ich mich nicht darum, mir seinen Namen zu merken. »Ziehst du nachher mit uns um die Häuser?«
Ohne ihn eines Blicks zu würdigen, räume ich meinen Arbeitsplatz auf und bete, dass das Soufflé im Ofen nicht zusammensackt. »Du hast offenbar vergessen, dass ich Chefköchin bin«, sage ich über die Schulter.
»Süße, du backst nur Kuchen. Ich nenne dich auf keinen Fall Chefköchin.«
Als wäre die Wirklichkeit eine Schallplatte mit einem Sprung, verstummt urplötzlich die ganze Küche, und alle erstarren.
Es ist schon eine Weile her, dass ich in meinem Beruf nicht respektiert wurde. Ich bin jung, ja, und es ist kein leichter Job, mit fünfundzwanzig in eine Küche zu marschieren und älteren Leuten, in der Regel Männern, zu sagen, was sie besser machen sollen. Aber in den letzten Jahren habe ich mir einen Ruf erarbeitet, der Respekt verlangt.
Vor drei Wochen habe ich den James Beard Award gewonnen, die höchste Auszeichnung meiner Branche, und seit der Ernennung zum Outstanding Pastry Chef of the Year sind meine Beratungstermine auf drei Jahre hinaus ausgebucht, so viele Küchen wollen mich eine Saison lang dafür bezahlen, dass ich ihr Dessertprogramm auf Trab bringe, damit sie eine Chance auf einen Michelin-Stern haben.
Also ja, ich habe mir den Titel verdient.
»Kommst du mit, Montgomery?«, drängt er. »Ich geb dir auch ein Bier aus oder irgendeinen Drink mit Schirmchen, das gefällt dir bestimmt. Irgendwas Süßes, Rosafarbenes.«
Wie kann es sein, dass dieser Typ nicht schnallt, dass seine Kollegen ihn stumm anflehen, den Mund zu halten?
»Ich kenne da übrigens noch was anderes Süßes, Rosafarbenes, das ich selbst gern mal probieren würde«, setzt er noch einen drauf.
Er versucht, mich zu provozieren, will die einzige Frau, die in dieser Küche arbeitet, zum Ausrasten bringen, aber er ist meine Zeit nicht wert. Und zu seinem Glück piepst mein Timer und lenkt meine Aufmerksamkeit wieder auf meine Arbeit.
Als ich die Ofentür öffne, werde ich von glühender Hitze und einem weiteren eingesunkenen Soufflé begrüßt.
Der James Beard Award ist nur ein Stück Papier, aber irgendwie erdrückt mich sein Gewicht. Ich sollte dankbar und demütig sein, dass ich eine Auszeichnung gewonnen habe, nach der die meisten Köche ihr ganzes Leben lang streben, aber stattdessen verspüre ich einen lähmenden Druck. Mein Verstand ist völlig leer, und ich bekomme auf einmal nichts Neues mehr auf die Reihe.
Ich habe niemandem von meinen Problemen erzählt. Es ist mir peinlich. Mehr denn je sind alle Augen auf mich gerichtet, und ich versuche zu verbergen, dass ich ins Trudeln geraten bin.
Aber in zwei Monaten kann ich mich nicht mehr verstecken. Denn dann stehe ich auf der Titelseite der Herbstausgabe des Magazins Food & Wine, und ich befürchte inzwischen, im dazugehörigen Artikel wird stehen, wie betrübt die Kritiker darüber sind, dass ein weiteres neues Talent sein Potenzial nicht ausschöpft.
Ich kann das nicht mehr. So peinlich es mir auch ist, aber ich komme mit dem Druck nicht klar. Es ist wie ein Burn-out oder eine Schreibblockade auf Konditorisch. Das geht bestimmt wieder vorbei, aber ganz sicher nicht, während ich in einer fremden Küche arbeite und alle von mir Glanzleistungen erwarten.
Mit dem Rücken zum Personal, damit niemand meinen neuesten Fauxpas sieht, stelle ich die Soufflé-Auflaufform auf den Tresen. Kaum habe ich das getan, legt sich eine Hand in meine Taille, und mir sträuben sich sämtliche Nackenhaare.
»Du bist noch zwei Monate hier, Montgomery, und ich hätte da eine Idee, wie du dir die Zeit vertreiben kannst. Und wie du das Personal hier dazu bringst, dich zu mögen.« Ich spüre seinen heißen Atem auf meiner Haut.
»Hände weg«, sage ich kühl.
Seine Fingerspitzen graben sich in meine Taille, und auf einmal steigt Panik in mir auf. Ich muss weg von diesem Mann. Und ich will nicht mehr in dieser Küche sein. In überhaupt gar keiner Küche.
»Du musst doch einsam sein bei deiner ständigen Herumreiserei. Ich wette, du findest in jeder Stadt, die du besuchst, einen Freund, der dich in deinem kleinen Van warm hält, stimmt’s?« Seine Handfläche gleitet über meinen Rücken Richtung Hintern. Ich schnappe mir sein Handgelenk, drehe mich um und trete ihm in die Eier, fest und ohne eine Sekunde zu zögern.
Mit einem jämmerlichen Wimmern klappt er zusammen.
»Ich habe dir gesagt, du sollst deine verdammten Hände von mir lassen.«
Die anderen Angestellten sind wie erstarrt, während er sich am Boden windet und seine Schreie von den Edelstahlgeräten widerhallen. Am liebsten würde ich eine spitze Bemerkung darüber machen, wie wenig Schwanz ich unter meinem Knie gespürt habe, aber ich nehme an, dass aufgrund seines Benehmens sowieso alle wissen, dass er überkompensiert.
»Ach, komm schon«, sage ich und knöpfe meine Kochjacke auf. »Steh auf. Das ist doch erbärmlich.«
»Curtis.« Jared, der Chefkoch, kommt herbeigerannt und starrt schockiert auf seinen Mitarbeiter hinunter. »Du bist gefeuert. Steh auf und verschwinde aus meiner Küche.«
Curtis – so heißt er also – wälzt sich nur weiter auf dem Boden herum, die Hände zwischen die Beine gepresst.
»Chef Montgomery.« Chefkoch Jared sieht mich an. »Sein Verhalten tut mir sehr leid, das ist völlig inakzeptabel. Ich verspreche Ihnen, das ist nicht die Art Benehmen, die ich in meiner Küche dulde.«
»Ich glaube, ich bin hier fertig.«
Und zwar aus mehreren Gründen. Dieser Hilfskoch, der wohl nie wieder in einem Spitzenrestaurant eingestellt werden wird, war nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Aber auch ohne ihn wäre ich in diesem Sommer leider keine Hilfe für Chefkoch Jared, das weiß ich selbst.
Und ich weiß auch, dass niemand erfahren darf, wie sehr ich gerade mit mir selbst zu kämpfen habe. Diese Branche ist knallhart, und sobald die Kritiker erfahren, dass eine Spitzenköchin – und James-Beard-Preisträgerin – ins Straucheln geraten ist, werden sie wie die Geier über mir kreisen und in sämtlichen Foodblogs über mich herfallen.
Chefkoch Jared schreckt vor mir zurück, was seltsam ist. Der Mann hat sich in der gastronomischen Welt einen guten Namen gemacht und ist doppelt so alt wie ich. »Ich verstehe das vollkommen. Ich werde dafür sorgen, dass Sie für den gesamten Vertrag bezahlt werden, auch für die nächsten zwei Monate.«
»Nein, das ist nicht nötig.« Ich schüttle seine Hand. »Ich gehe jetzt einfach.«
Curtis liegt immer noch auf dem Boden, und ich zeige ich ihm im Gehen den Mittelfinger, denn ja, ich bin vielleicht eine preisgekrönte Patissière, aber manchmal benehme ich mich wie ein Kleinkind.
Als wäre meine Unfähigkeit, meinen Job zu machen, nicht schon erdrückend genug, fällt draußen die schwüle Sommerhitze Südfloridas über mich her. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe, Ende Juni in einer Küche in Südflorida zu arbeiten.
Hastig springe ich in meinen Van, der auf dem Mitarbeiterparkplatz steht, und drehe die Klimaanlage auf volle Pulle. Ich liebe diesen Van. Er ist innen und außen komplett renoviert, mit einem frischen Anstrich in sattem Grün, und hinten drin befindet sich meine eigene kleine Küche.
In diesem Van lebe ich, während ich für die Arbeit durchs Land reise, sorglos und mit offen im Wind wehendem Haar. Wenn ich dann am jeweiligen Reiseziel ankomme, schalte ich auf Arbeitsmodus, decke meine Tattoos ab und lasse mich für die Dauer der anstehenden Saison zehn Stunden am Tag »Chef« nennen.
Dieses widersprüchliche Durcheinander ist mein Leben.
Ehrlich gesagt habe ich das nie so geplant. Früher habe ich davon geträumt, meine eigene Bäckerei zu eröffnen und all die herrlichen Kekse, Riegel und Kuchen zu verkaufen, die ich als Kind für meinen Vater erfunden habe. Aber ich hatte das Glück, direkt nach der Schule eine Ausbildung bei einem der besten Konditoren in Paris zu ergattern, gefolgt von einem Praktikum in New York City.
Und von da an ist meine Karriere ungebremst durchgestartet.
Heute backe ich mundgerechte Tortenhäppchen, mache Mousses, deren Namen die meisten Leute nicht aussprechen können, und Sorbets, von denen wir alle gern behaupten, dass sie uns besser schmecken als richtiges Eis. Und obwohl ich einiges in dieser Hochglanzwelt prätentiös und lächerlich finde, bin ich doch dankbar für den Weg, den mein Leben genommen hat.
Es ist eine beeindruckende Karriere, das weiß ich. Ich habe endlose Stunden Schufterei investiert, um diese unerreichbar scheinenden Ziele zu erreichen. Aber jetzt taumle ich orientierungslos umher und suche nach dem nächsten Häkchen, dem ich nachjagen kann.
Seit drei Wochen kann ich an nichts anderes mehr denken als an die schlichte Tatsache: Entweder bin ich weiterhin erfolgreich, oder ich werde von dem neuen brandheißen Star der Branche von meinem Platz verdrängt.
In Gedanken versunken fahre ich auf den Highway in Richtung des Hotels, in dem mein Vater gerade wohnt, als meine Agentin anruft.
Ich antworte über Bluetooth. »Hallo, Violet.«
»Was zum Teufel hat dieser kleine Scheißer angestellt, dass du deinen Job vorzeitig aufgeben musstest? Chef Jared hat mich angerufen, um sich zu entschuldigen, und wollte drei Monatsgehälter für dich überweisen.«
»Nimm das nicht an«, sage ich ihr. »Ja, sein Angestellter ist ein Vollidiot, aber die Wahrheit ist, dass ich ihm diesen Sommer sowieso keine Hilfe gewesen wäre.«
Kurz herrscht Schweigen. Dann: »Miller, was ist los?«
Violet ist seit drei Jahren meine Agentin, und inzwischen betrachte ich sie auch als Freundin, obwohl ich aufgrund meines rastlosen Lebensstils nicht viele Freunde habe. Sie verwaltet meine Termine und arrangiert meine Interviews. Jeder, der in seinem Foodblog über mich schreiben oder mich als Beraterin engagieren möchte, muss sich zuerst an sie wenden.
Es gibt nur sehr wenige Menschen, denen ich ehrlich sagen kann, was bei mir gerade los ist, aber sie zählt dazu.
»Vi, vielleicht bringst du mich dafür um, aber ich glaube, ich nehme mir den Rest des Sommers frei.«
Wäre die Autobahn in Miami nicht so verdammt laut, könnte man eine Stecknadel fallen hören.
»Warum?« Sie klingt völlig fassungslos. »Im Herbst steht der größte Job deiner ganzen Karriere an. Du bist für das Cover von Food & Wine gebucht. Bitte sag mir nicht, dass du einen Rückzieher machst.«
»Nein. Gott, nein. Zu Beginn des nächsten Jobs bin ich in Los Angeles. Ich habe nur …« Scheiße, wie soll ich ihr sagen, dass ihre bestbezahlte Klientin gerade durchdreht? »Violet, ich habe es seit drei Wochen nicht geschafft, ein neues Dessert zu kreieren.«
»Du meinst, du hattest keine Zeit?«, vermutet sie. »Denn wenn du mehr Zeit brauchst, um die Rezepte für den Artikel zu perfektionieren …«
»Nein. Ich meine, ich bringe gerade nichts mehr zustande, das nicht auseinanderfällt oder anbrennt. Es ist fast schon witzig, wie wenig ich gerade auf die Reihe kriege, nur stehe ich deswegen gerade leider kurz vor einem Nervenzusammenbruch.«
Sie lacht. »Du verarschst mich doch, oder?«
»Violet, jeder Fünfjährige mit einem Easy-Bake Oven könnte im Moment ein besseres Dessert machen als ich.«
Es wird wieder still.
»Violet, bist du noch da?«
»Ich versuche gerade, das zu verdauen.«
Als ich die Ausfahrt zum Hotel meines Vaters nehme, warte ich immer noch darauf, dass sie weiterspricht.
»Okay«, sagt sie und klingt, als wolle sie sich selbst beruhigen. »Okay, schon in Ordnung. Alles ist in Ordnung. Du nimmst dir die nächsten zwei Monate Zeit, um durchzuatmen und dich zu sammeln, und am ersten September startest du im Luna’s.«
Das Luna’s ist das Restaurant von Chefköchin Maven, dort werde ich im Herbst als Beraterin tätig sein. Während meiner Zeit an der Kochschule habe ich ein Seminar von Maven besucht und wollte schon damals unbedingt mit ihr zusammenarbeiten, aber kurz nachdem wir uns kennengelernt hatten, hat sie sich wegen ihrer Schwangerschaft eine längere berufliche Auszeit genommen. Später kehrte sie dann in die Gastronomie zurück und eröffnete ein Restaurant, benannt nach ihrer Tochter. Sie hat mich um Hilfe bei ihrer Dessertkarte gebeten, und das Interview für die Zeitschrift Food & Wine wird in ihrer Küche in Los Angeles stattfinden. Ich freue mich schon sehr darauf.
Zumindest habe ich mich gefreut, ehe irgendwie alles in die Binsen ging.
»Du gehst doch am 1. September ins Luna’s, stimmt’s, Miller?«, fragt Violet, als ich nicht sofort antworte.
»Tu ich.«
»Okay.« Sie stößt die Luft aus. »Das kriege ich so verkauft. Du feierst deine neue Auszeichnung, indem du den Sommer mit deiner Familie verbringst, und freust dich darauf, im September wieder in der Küche zu stehen. Lieber Himmel, was werden mir Blogs und Kritiker deswegen auf den Sack gehen, die werden sich alle fragen, wo zum Teufel du steckst. Bist du sicher, dass dein Vater nicht krank ist? Das könnte ich noch viel besser verkaufen als eine Auszeit.«
»Himmel noch mal, Violet«, schnaube ich ungläubig. »Ihm geht es gut, Gott sei Dank.«
»Gut. Der Mann ist zu schön, um jung zu sterben.«
»Bah. Ich muss jetzt auflegen.«
»Sag Daddy Montgomery einen schönen Gruß von mir.«
»Auf gar keinen Fall. Bye, Vi.«
Seit ein paar Tagen sind die Windy City Warriors in der Stadt, Chicagos Profi-Baseballteam. Seit fünf Jahren ist mein Vater der Field Manager, also der Cheftrainer. Davor hat er, nachdem man ihn aus dem College in unserer Heimatstadt Colorado weggeschnappt hatte, in einer niedrigeren Liga gearbeitet.
Zu seiner aktiven Zeit war Emmett Montgomery ein schnell aufsteigender Stern am Baseballhimmel. Er war auf dem besten Weg, sich in diesem Sport einen Namen zu machen. Doch dann hat er seine blühende Karriere aufgegeben, um sich um mich kümmern zu können, und er hat hartnäckig allen Angeboten widerstanden und blieb Coach am College, bis ich die Highschool abgeschlossen hatte.
Er ist einer der Guten. Ich würde sogar sagen, er ist der Allerbeste.
Die meiste Zeit meines Lebens waren wir nur zu zweit. Als ich mit achtzehn von zu Hause weggegangen bin, habe ich es nicht getan, um mich freier entfalten zu können – ich habe es getan, damit er Raum bekommt, um wieder seinen eigenen Weg zu gehen. Und ich weiß: Sobald ich aufhöre, in der Weltgeschichte umherzuziehen und mich irgendwo fest niederlasse, wird er wieder alles aufgeben und dorthin ziehen, wo er in meiner Nähe sein kann. Ihm zuliebe bin ich immer in Bewegung, und ich habe auch nicht vor, daran etwas zu ändern. Er hat alles für mich aufgegeben. Dafür zu sorgen, dass er nicht noch mehr aufgibt, ist das Mindeste, was ich für ihn tun kann.
Ich halte an einem Supermarkt und kaufe zwei Flaschen Corona, eine für mich und eine für ihn, bevor ich das langärmlige Hemd ausziehe und Küchenhose und rutschsichere Schuhe gegen eine abgeschnittene Latzhose und Flip-Flops tausche. Ich setze meinen Septumring wieder an seinen Platz und parke auf dem Parkplatz, der am weitesten vom Eingang des beeindruckenden Hotels entfernt ist, in dem mein Vater gerade residiert.
Obwohl er jetzt schon seit fünf Jahren die Profiliga trainiert, kann ich es immer noch nicht recht fassen. Früher hatten wir nie schicke oder teure Sachen. Als College-Trainer hat er nicht viel Geld verdient, und er war gerade erst fünfundzwanzig, als er alleinerziehender Vater wurde.
Weil er nicht besonders gut kochen kann, hat er mich anfangs praktisch mit Käsemakkaroni großgezogen. Deshalb habe ich früh kochen gelernt und schon bald meine Liebe zum Backen entdeckt. Es gehört zu meinen schönsten Erinnerungen, wie beeindruckt er von jedem meiner neuen Rezepte war – wobei es ehrlich gesagt keine Herausforderung ist, ihn zu begeistern. Er ist mein größter Fan.
Zu sehen, wie er das tut, was er am meisten liebt, und zwar so gut, dass er bereits einen World-Series-Ring sein Eigen nennt, macht mich unendlich stolz. Er kommt ganz wunderbar ohne mich klar.
Ich möchte ihn genauso stolz machen, erst recht nach allem, was er für mich geopfert hat. Nachdem ich eine der jüngsten Trägerinnen des James Beard Award geworden bin, wurde ich für einen achtseitigen Artikel in Food & Wine gebucht, einschließlich Titelseite und drei brandneuen Rezepten … für die mir leider die Inspiration fehlt. Und ich habe nur noch zwei Monate Zeit, ehe ich für mein nächstes Projekt nach L.A. gehe.
Bloß keinen Druck.
Ich stehe in der Lobby und öffne gerade eine der Bierflaschen, um zu versuchen, mit einem großen Schluck die hohen Erwartungen runterzuspülen, die ich an mich selbst stelle, als sich die Aufzugtür öffnet. Die beiden Männer darin steigen nicht aus, also schiebe ich mich zwischen sie.
Der Mann zu meiner Linken hat hellbraunes Haar und ist anscheinend nicht in der Lage, seinen Mund sauber zu schließen.
»Hi«, sagt er. Ich kenne ihn nicht, aber ich würde darauf wetten, dass dieser Typ für meinen Vater spielt. Er ist groß, athletisch gebaut und sieht frisch gefickt aus.
Die Mannschaft meines Vaters begeistert sich in der Regel ebenso sehr für die Frauen, die die Jungs vom Spielfeld mit nach Hause nehmen, wie für das Spiel selbst.
»Raus aus dem Aufzug, Isaiah«, sagt der Mann zu meiner Rechten. Sie sehen beide gut aus, aber er ist geradezu absurd attraktiv.
Er trägt eine Cap, den Schirm nach hinten gedreht, eine Brille mit dunklem Gestell und auf dem Arm ein Kleinkind mit einem genau zu seiner passenden Cap. Um Himmels willen. Ich bemühe mich, nicht zu genau hinzusehen, aber aus den Augenwinkeln sehe ich dunkles Haar unter der Cap hervorblitzen, und die Brille umrahmt eisblaue Augen. Mit seinem Dreitagebart sieht er aus, als wäre er einige Jährchen älter als ich. Mein Kryptonit. Dazu noch das süße Kind, das er sich auf die Hüfte gesetzt hat. Er ist regelrecht zum Anbeißen.
»Tschüss«, sagt der Mann zu meiner Linken, verlässt den Aufzug und überlässt mich den beiden süßen Jungs.
»Stockwerk?«, frage ich und trinke einen Schluck Bier, während ich die Nummer der Etage drücke, in der das Zimmer meines Vaters liegt.
Ganz bestimmt hat Baby-Daddy mich gehört, aber er sagt kein Wort.
»Soll ich einfach raten?«, frage ich. »Wenn du willst, kann ich sie auch einfach alle drücken, und wir machen eine schöne lange Aufzugfahrt zusammen.«
Er lacht nicht, zuckt nicht mal mit den Mundwinkeln. Red Flag, würde ich mal sagen. Echt komischer Typ.
Sein kleiner Junge streckt die Hand nach mir aus. Ich war nie eins dieser Mädels, die für Kinder schwärmen, aber dieses hier ist schon echt süß, und nach meinem scheußlichen Morgen ist ein Kleinkind, das mich anlächelt, als sei ich das Tollste auf Erden, zu meiner eigenen Überraschung genau das, was ich brauche.
Er ist so pausbäckig, dass die Augen fast in seinem strahlenden Grinsen verschwinden. Sein Vater hingegen tut weiterhin, als wäre ich Luft, und drückt selbst den Knopf für seine Etage.
Na ja, was soll’s. Kann mir ja egal sein.
Auf der definitiv längsten Fahrstuhlfahrt meines Lebens komme ich zu dem Schluss, dass dieser umwerfende Mann einen riesigen Stock im Arsch hat. Froh, dass unsere kurze Begegnung vorbei ist, steige ich aus und klopfe gleich darauf an die Tür meines Vaters.
»Was machst du denn hier?«, fragt mein Vater, und sein Gesicht leuchtet auf. »Ich dachte, wir sehen uns auf dieser Tour nicht mehr.«
Mit gespielter Begeisterung hebe ich beide Bierflaschen, eine leer, eine noch ungeöffnet. »Ich habe meinen Job gekündigt!«
Besorgt mustert er mich und öffnet einladend die Tür ganz weit. »Warum kommst du nicht rein und erzählst mir, warum du um neun Uhr morgens Bier trinkst?«
»Wir trinken Bier«, korrigiere ich.
Er lacht leise. »Du scheinst das zweite gerade selbst mehr zu brauchen als ich, Millie.«
Ich durchquere das Zimmer und setze mich auf die Couch.
»Was ist los?«, fragt er.
»Ich bin scheiße in meinem Job. Im Moment macht mir das Backen überhaupt keinen Spaß, weil ich so schlecht darin bin. Wann hast du mich jemals sagen hören, dass mir das Backen keinen Spaß macht?«
Er hebt die Hände. »Du musst dich vor mir nicht rechtfertigen. Ich möchte, dass du glücklich bist, und wenn dich dieser Job nicht glücklich gemacht hat, dann bin ich froh, dass du gekündigt hast.«
Ich wusste, dass er genau das sagen würde. Und ich weiß jetzt schon: Wenn ich ihm erzähle, dass mein neuer Plan für den Sommer darin besteht, in meinem Van quer durchs Land zu fahren, mich zu entspannen und eine neue Perspektive zu finden, wird er sagen, dass er sich für mich freut, auch wenn in seiner Stimme Sorge mitschwingt.
Seine Besorgnis macht mir nichts aus. Ich habe einzig und allein Angst davor, in seinem Blick Enttäuschung zu sehen.
In meinem ganzen Leben hat er mich noch kein einziges Mal enttäuscht angesehen, also weiß ich nicht, warum ich mich so sehr davor fürchte. Aber ich würde mir den Arsch aufreißen und für den Rest meines Lebens in der erbärmlichsten Küche der Welt schuften, wenn ich dadurch vermeiden könnte, ihn zu enttäuschen.
Ich habe ein angeborenes Bedürfnis danach, in allem, was ich ernsthaft anpacke, die Beste zu sein. Im Moment bin ich nicht die Beste, und ich will nicht, dass mich jemand scheitern sieht. Vor allem nicht er. Schließlich strebe ich vor allem seinetwegen in meiner Karriere so sehr nach Perfektion … Im Privatleben hingegen bin ich eher ein Freigeist.
»Willst du ganz hinschmeißen?«, fragt er.
»O Gott, nein. Ich nehme mir nur den Sommer über Zeit, um wieder Schwung zu sammeln. Und dann steige ich wieder ein, besser als je zuvor. Ich brauche nur ein bisschen Zeit für mich, ohne dass mich die ganze Zeit neugierige Augen beobachten. Eine kleine Pause.«
Seine Augen fangen vor Aufregung an zu leuchten. »Und wo verbringst du diese Sommerpause?«
»Ich habe mich noch nicht entschieden. Ich habe zwei Monate, mein nächster Job ist in L.A. … Vielleicht nehme ich mir Zeit, um ganz in Ruhe an die Westküste zu fahren und mir unterwegs ein paar Sehenswürdigkeiten anzusehen. Und arbeite ein bisschen in meiner Küche auf Rädern.«
»Lebst in deinem Van.«
»Ja, Dad.« Ich lache. »Ich lebe in meinem Van und versuche rauszufinden, warum seit diesem verdammten Preis jeder meiner Versuche, ein neues Dessert zu kreieren, ein völliges Desaster war.«
»Nie im Leben ist jedes deiner Desserts eine Katastrophe. Alles, was du mir je gemacht hast, war phänomenal. Du bist zu streng mit dir.«
»Einfache Kekse und Kuchen sind was anderes. Es ist das kreative Zeug, was mir zu schaffen macht.«
»Tja, vielleicht ist ja das kreative Zeug das Problem. Vielleicht solltest du zu den Grundlagen zurückkehren.«
Er kennt sich in der gastronomischen Welt nicht gut aus … Er versteht nicht, dass ein Schokokeks nicht ausreicht.
»Weißt du …«, beginnt er. »Du könntest den Sommer mit mir in Chicago verbringen.«
»Hm – du wirst die Hälfte der Zeit unterwegs sein und arbeiten, und wenn du zu Hause bist, rennst du auf dem Spielfeld herum.«
»Komm mit zu den Auswärtsspielen. Seit du achtzehn bist, waren wir nie mehr als ein paar Tage am selben Ort, und ich vermisse mein Mädchen.«
Seit sieben Jahren hatte ich keinen Feiertag, kein Wochenende und keinen einzigen ganzen Abend frei. Ich habe ununterbrochen gearbeitet, mich in wechselnden Küchen fast zu Tode geschuftet. Ich weiß, dass die Mannschaft meines Vaters heute Abend ein Spiel in der Stadt hat, aber bisher ist mir nie in den Sinn gekommen, mir mal einen Abend freizunehmen, um es mir anzusehen.
»Dad …«
»Ich bin mir nicht zu schade zum Betteln, Miller. Dein alter Herr braucht ein bisschen Familienzeit.«
»Ich habe gerade drei Wochen in einer Küche voller Kerle verbracht, von denen einer mich praktisch angefleht hat, mich wegen sexueller Belästigung bei der Personalabteilung über ihn zu beschweren. Auf gar keinen Fall werde ich meinen Sommer mit einem Team aus lauter Männern verbringen.«
Er beugt sich vor, die tätowierten Arme auf die Knie gestützt, die Augen weit aufgerissen. »Wie bitte?«
»Keine Sorge, ich hab mich drum gekümmert.«
»Und wie?«
»Knie in die Eier.« Lässig trinke ich einen Schluck Bier. »Genau wie du es mir beigebracht hast.«
Leise lachend schüttelt er den Kopf. »Das habe ich dir nie beigebracht, du kleiner Psycho, aber ich wünschte, ich hätte es getan. Und jetzt bestehe ich noch mehr darauf, dass du mit mir auf Tour kommst. Du weißt doch, dass meine Jungs nicht so sind.«
»Dad, ich hatte eigentlich vor …« Die Worte ersterben mir auf der Zunge, als ich ihn genauer ansehe. Traurige, flehende Augen. Er wirkt müde. »Bist du einsam in Chicago?«
»Darauf werde ich nicht antworten. Natürlich vermisse ich dich, aber ich möchte, dass du den Sommer mit mir verbringst, weil du mich ebenfalls vermisst, und nicht, weil du dich dazu verpflichtet fühlst.«
Ich fühle mich nicht verpflichtet. Jedenfalls nicht dazu, den Sommer mit ihm zu verbringen. Auch wenn ansonsten mein ganzes Leben quasi der Versuch ist, meine Schuld zu tilgen, weil er damals mit erst fünfundzwanzig Jahren sein ganzes Leben für mich aufgegeben hat.
Aber zu behaupten, ich würde ihn nicht auch vermissen, wäre glatt gelogen. Nur deshalb sorge ich ja dafür, dass sich die Standorte meiner Jobs mit seinen Reisen überschneiden. Ich suche mir gezielt Küchen in Großstädten mit MLB-Teams aus, bei denen eine hohe Chance besteht, dass mein Vater aus beruflichen Gründen dort sein wird. Also ja … Ich vermisse ihn auch.
Ein Sommer mit meinem alten Herrn hört sich gut an. Und wenn es ihn glücklich macht, mich eine Weile in seiner Nähe zu haben, dann ist es nach allem, was er für mich getan hat, das Mindeste, was ich für ihn tun kann.
Es gibt nur ein Problem.
»Das würde die Geschäftsleitung auf keinen Fall erlauben«, erinnere ich ihn. »Niemand aus dem Team oder der Belegschaft darf Familienmitglieder auf Reisen mitnehmen.«
»Oh, ein Familienmitglied darf bereits für diese Saison mit dem Team reisen.« Ein verschmitztes Lächeln huscht über seine Lippen. »Ich habe da eine Idee.«
Kapitel 3
Kai
Monty: Lass Max bei Isaiah und komm zurück in mein Zimmer. Wir müssen uns unterhalten.
Ich: Soll ich Max hierlassen, damit du mich anschreien kannst?
Monty: Ja.
Ich: Cool, cool. Ich eile.
»Ich habe ein neues Kindermädchen für Max gefunden«, sagt er, noch bevor ich die Tür hinter mir geschlossen habe.
Hm? Ich setze mich Monty gegenüber an den Schreibtisch und sehe ihn verwirrt an. »Wie das? Ich habe Troy erst vor einer Stunde gefeuert.«
»Tja, ich bin einfach gut. Und du wirst sie einstellen. Du hast offensichtlich kein gutes Händchen für Kindermädchen, wenn man sich ansieht, wie du sie alle naselang wieder feuerst, also übernehme ich das jetzt.«
»Und wer ist dieses Kindermädchen?«
»Meine Tochter.«
Mein Blick wandert zu dem gerahmten Foto neben ihm. Es ist dasselbe Foto wie in seinem Büro in Chicago. Er stellt es in jeder Stadt, die wir besuchen, auf seinen Schreibtisch.
Ich wusste, dass das Mädchen auf dem Bild seine Tochter ist, das liegt ja auch nahe, aber trotz unserer freundschaftlichen Beziehung hat er nie viel von ihr erzählt. Ich bin immer davon ausgegangen, dass es daran liegt, dass er ihr gegenüber ein schlechtes Gewissen hat. Schließlich ist er ständig unterwegs, wie wir alle. Oder er denkt, es wäre eine dumme Idee, mit mir über sie zu reden, weil es mir nur bestätigen würde, dass es praktisch unmöglich ist, diesen Job mit der Verantwortung eines alleinerziehenden Vaters zu vereinbaren.
Das Mädchen auf dem Foto kann nicht älter als dreizehn oder vierzehn sein. Sie befindet sich in dieser unbeholfenen Phase, die wir alle in den frühen Teenagerjahren durchgemacht haben, mitsamt Zahnspange und Akne. Ihr dunkles Haar ist zu einem strengen Pferdeschwanz hochgebunden, die Schirmmütze beschattet ihr Gesicht, und sie trägt ein leuchtend gelbes T-Shirt mit der Nummer vierzehn auf der Brust. Das Shirt ist noch zu groß, die zu weiten Ärmel sind an den Schultern mit einem Band oder Gummi gerafft. Sie posiert für ihr Saisonfoto, eine Hand ruht im Pitcherhandschuh auf einem Knie.
Natürlich spielt Montys Tochter Softball.
»Sie hat den Sommer über frei, und ich möchte, dass sie mit uns reist«, fährt er fort.
Na klar. Sommerferien.
»Ja, aber Monty, das ist mein Kind, über das wir hier reden.«
»Und mein Kind.« Er zieht die Brauen hoch, als wolle er mich herausfordern, seinem Plan zu widersprechen. »Ich frage dich nicht nach deiner Meinung, Ace. Ich sage dir, was Sache ist. Ich habe es satt, dass du einen Babysitter nach dem anderen feuerst. Alle paar Wochen machen wir für jemand Neuen einen vollständigen Hintergrundcheck, und im Büro hat keiner mehr Lust darauf, ständig für Hotelzimmer und Flugmanifeste einen neuen Namen einzutragen. Sie ist jetzt Max’ Kindermädchen, basta. Und das Beste daran ist, dass sie mein Kind ist und du sie nicht feuern kannst.«
Scheiße.
»Sie hat nur bis September frei, also müssen wir bis dahin jemand anders finden, der sie dann zum Schluss der Saison ersetzt, aber darum kümmern wir uns, wenn es so weit ist.«
Mir ist klar, dass es keinen Ausweg gibt. Nach allem, was er für Max und mich getan hat, stehe ich in seiner Schuld, und das wissen wir beide.
Wenn ich meinen Sohn schon bei jemand anderem lassen muss, dann ist es wohl nicht die schlechteste Lösung. Die Kleine wird sich in dem Alter wohl kaum um irgendwelche Profi-Baseballspieler scheren, und ihr Vater wird wahrscheinlich mit Adleraugen über sie wachen, wenn sie sich nicht gerade um Max kümmert.
Was sind schon zwei Monate? Das ist doppelt so lange wie die längste Zeit, in der ich mal kein Kindermädchen gefeuert habe.
»Hat sie einen Führerschein?«, frage ich.
Verwirrt runzelt er die Stirn. »Was?«
»Wenn Max etwas zustößt, während ich nicht da bin, kann sie ihn dann ins Krankenhaus bringen?«
»Japp …«
Okay, das ist gut. Sie ist also mindestens sechzehn. Das Foto ist wahrscheinlich schon ein paar Jahre alt.
»Ist sie verantwortungsbewusst?«
»Sie ist …«, er zögert. »Bei der Arbeit ist sie sehr verantwortungsbewusst, ja.«
Seltsame Antwort.
Ich höre ein Geräusch an der Tür – jemand öffnet das elektronische Schloss mit einer Schlüsselkarte. Ich blicke über die Schulter und sehe, wie eine Frau mit dunklem Haar hereinkommt … rückwärts, weil sie die Tür mit dem Hintern aufschiebt.
Schokoladenbraunes Haar. Ausgefranster Saum an den abgeschnittenen Beinen der Latzhose. Kräftige Oberschenkel.
Sie dreht sich um. Es ist Miss Zwei-Flaschen-Corona, die da mitten im Hotelzimmer meines Trainers steht. Und sie hat schon wieder beide Hände voll, nur sind es diesmal Kaffeetassen statt Bierflaschen.
Ich rücke meine Brille zurecht, um mich zu vergewissern, dass ich mich nicht irre, und begegne dem Blick grüner Augen. »Du!«, sage ich … Es klingt halb wütend, halb erschüttert.
Sie stößt einen Seufzer aus und lässt die Schultern sinken. »Ich hatte das Gefühl, dass du es sein würdest.«
Wie bitte?
»Ace, das ist meine Tochter Miller Montgomery. Das neue Kindermädchen.«
Mein Kopf schnellt zu ihm herum. »Du verarschst mich doch.«
»Miller, das ist Kai Rhodes. Es ist sein Sohn, um den du dich diesen Sommer kümmern wirst.«
»Auf keinen Fall«, protestiere ich.
Miller verdreht die Augen und reicht ihrem Vater eine der beiden Kaffeetassen.
Wie ist das möglich? Sie ist ganz sicher nicht dreizehn oder vierzehn, sondern eine erwachsene Frau, die Bier trinkt und offenbar nie schläft. Die Akne vom Foto ist längst verschwunden, die gebräunte Haut makellos; die Zahnspange hat ihr perfekte gerade Zähne beschert in einem Mund, der offenbar immer sagt, was ihr gerade einfällt.
Der Name Miller passt gut zu ihr. Mit ihren abgeschnittenen Latzhosen und den Tattoos wirkt sie wild und jungenhaft.
»Sie passt ganz bestimmt nicht auf mein Kind auf.«
Miller setzt sich auf den Stuhl neben mir, zeigt mit dem Daumen auf mich und wirft ihrem Vater einen Blick zu, der mehr als deutlich sagt: Was für ein komischer Typ.
Monty lacht. Verräter. »Wie ich sehe, seid ihr euch bereits begegnet.«
»Ja. Sie hat um neun Uhr morgens im Aufzug zwei Flaschen Bier spazieren gefahren.«
»O Gott.« Sie wirft den Kopf zurück, und mein Schwanz zuckt beim rauen Klang ihrer Stimme … und weil mein Hirn den Ausruf unwillkürlich sexuell interpretiert. »Es war nur Corona. Weißt du, wie viel Alkohol das enthält? Manche Leute betrachten das einfach als ganz normale Flüssigkeitszufuhr.«
»Das ist mir egal.« Ich sehe ihren Vater an. »Ich lasse nicht zu, dass so jemand die Verantwortung für Max übernimmt.«
»Entspann dich, Baby-Daddy.« Sie nippt an ihrem Kaffee – beziehungsweise an ihrem Chai Latte, jedenfalls steht das auf dem Pappbecher.
»Nenn mich nicht so.«
»Ich habe heute Morgen ein Bier getrunken, um zu feiern, dass ich meinen Job hingeschmissen habe. Du tust so, als hätte ich im Aufzug eine Line Koks vom Handlauf genommen. Was sich jetzt, da ich es laut ausspreche, verdächtig spezifisch anhört, aber ich schwöre hoch und heilig, dass ich das niemals getan habe.«
Ich wende mich wieder an Monty. »Das ist dein Kind?«
»Mein einziges«, sagt er voller Stolz.
»Wie alt bist du?«, frage ich Miller.
»Fünfundzwanzig.«
Ich wusste nicht, dass Monty in so jungen Jahren Vater geworden war. Dann war er ja … zwanzig Jahre alt, als sie geboren wurde? Verdammt! Und ich dachte, mit meinen zweiunddreißig Jahren wäre das schon hart.
»Wie alt bist du?«, fragt sie.
»Ich stelle hier die Fragen. Ich versuche herauszufinden, ob ich die Sicherheit meines Kindes riskieren soll, indem ich dich einstelle, nur damit dein Vater endlich Ruhe gibt.«
»Und ich versuche herauszufinden, ob es sich lohnt, mir den Sommer zu ruinieren, indem ich die nächsten zwei Monate für einen Typen arbeite, dem ein riesiger Stock im Arsch steckt.«
»Mir steckt kein Stock im Arsch, ich bin einfach nur verantwortungsbewusst.«
»Wahrscheinlich steckt er einfach schon so lange da drin, dass du vergessen hast, dass er da ist.«
»Miller«, wirft Monty ein. »Das hilft null.«
»Hast du überhaupt Erfahrung in der Kinderbetreuung?«
»Erwachsene Kinder: Ja.«
Ich werfe Monty einen scharfen Blick zu. »Wir wissen nicht mal, ob Max sie überhaupt leiden kann. Du weißt doch, dass er mit Frauen schwierig ist.«
»Er hat sich mir im Aufzug praktisch an den Hals geworfen. Ich denke, in der Hinsicht müssen wir uns keine Sorgen machen.«
»Ich bin ziemlich sicher, dass er es auf deine Flaschen abgesehen hatte. Sie sehen seinen Fläschchen sehr ähnlich.«
»Über das Bier kommst du einfach nicht hinweg, was?«
»Nein.«
»Okay.« Monty klatscht in die Hände. »Das wird interessant.«
»Rauchst du?« Ihre Stimme klingt jedenfalls danach.
»Nein, aber wenn der Sommer so verläuft wie dieses Gespräch, muss ich vielleicht damit anfangen.«
»Miller«, unterbricht Monty uns wie ein strenger Vater, der einen Streit zwischen seinen Kindern beendet. »Danke für den Kaffee. Gibst du mir bitte eine Minute allein mit Kai?«
Miller seufzt und bindet sich rasch das lange braune Haar zu einem Knoten auf dem Kopf zusammen. Ich erhasche einen Blick auf das Kunstwerk auf Arm und Schulter … ein verschlungenes, ornamentartiges Muster, wie ein Ärmel aus Blumen. Es erinnert fast an eine Seite in einem Malbuch.
Das wird Max gefallen.
»Na schön.« Sie steht auf und schnappt sich ihren Chai. Als sie sich mir zuwendet, umweht mich wieder der leichte Duft nach Gebäck. »Aber nur damit du es weißt, ich tu dir damit einen Gefallen. Also, versuch, nicht so ein Arschloch zu sein, ja? Wir sehen uns später, Baby-Daddy.« Sie geht, aber an der Tür bleibt sie noch mal stehen, die Hand schon auf dem Knauf, und schüttelt nachdenklich den Kopf. »Oder sollte ich sagen, Baseball-Daddy? O ja, viel besser. Dann also Baseball-Daddy!«
Damit lässt sie uns allein.
Ich schüttle ungläubig den Kopf. »Deine Tochter ist ja ein schräger Vogel.«
»Sie ist großartig, was?« Monty sieht mich an und lacht über meine Gereiztheit.
»Das kann doch nicht dein Ernst sein. Sie ist auf keinen Fall die Richtige, um sich um Max zu kümmern.«
Er lehnt sich zurück und verschränkt die tätowierten Hände über dem Bauch. »Glaub mir, ich sage das ganz unparteiisch: Du kannst dich glücklich schätzen über ihr Angebot. Meine Tochter ist wild und manchmal sehr … ungefiltert, aber wenn es um die Arbeit geht, kennt sie nichts. Sie wird alles für deinen Jungen geben.«
Ich werfe den Kopf zurück. »Komm schon, Mann. Das kann nicht dein Ernst sein.«
»Allerdings ist es mein Ernst. Vertrau mir, Kai, ich kenne meine Tochter. Sollte sie dir jemals einen triftigen Grund liefern, sie zu entlassen, übernehme ich das selbst. So sehr vertraue ich darauf, dass es klappen wird.«
Schweigend starre ich ihn an. Warte auf ein Zeichen dafür, dass es nur ein Scherz ist.
Ich kenne Miller nicht und traue ihr nicht über den Weg, aber Monty würde ich mein Leben anvertrauen und auch das meines Kindes. Ich weiß, dass er Max niemals in Gefahr bringen würde, nicht mal dann, wenn es für ihn einen Vorteil bedeuten würde.
Ich kann nicht fassen, dass ich mich darauf einlasse, aber ich schulde ihm etwas. »Na schön. Sie bekommt einen Strike«, sage ich und hebe einen Finger.
»Ein Baseball-Wortspiel, Ace? Ernsthaft? Ich habe mehr von dir erwartet.«
»Halt die Klappe.«
Er streckt mir die Hand entgegen. »Ein Strike, und sie ist aus dem Spiel!«
»Okay, jetzt reicht’s.« Ich schüttle ihm die Hand und will meine Hand wieder wegziehen, aber er hält sie fest und sieht mir in die Augen.
»Ich gebe dir einen Rat, mein Sohn. Wie ich sie kenne, wird sie dafür sorgen, dass ihr den Sommer eures Lebens habt, du und Max. Aber denk nicht mal daran, dich an sie zu gewöhnen.«
Verwirrt runzle ich die Stirn. »Warst du bei unserem Gespräch eben nicht dabei?« Ich ziehe meine Hand aus seinem Griff und zeige auf die Tür, durch die Miller verschwunden ist.
»Ich sage dir das nicht als ihr Vater, sondern als dein Freund. Sie wird gehen, wenn der Sommer vorbei ist. Ich liebe meine Tochter über alles, aber sie ist eine Streunerin, und sie wird sich auf keinen Fall binden.«
Monty sollte mich inzwischen gut genug kennen, um zu wissen, dass ich mich ebenfalls auf keinen Fall an sie binden will – das ist so ziemlich das Letzte, wonach mir der Sinn steht. Am liebsten würde ich den Sommer vorspulen, wenn das nicht auch bedeuten würde, dass Max viel zu schnell älter wird.
»Vertrau mir, Monty, du hast nichts zu befürchten.«
Er brummt irgendwas in sich hinein, klingt aber nicht sonderlich überzeugt.
Ich stehe auf und schiebe meinen Stuhl unter den Schreibtisch. »Wir sehen uns auf dem Feld.« Fast bin ich schon aus der Tür, als Monty noch etwas einfällt.
»Und Ace«, ruft er. »Lass deinen Schwanz in der Hose. Wir alle wissen, wie verdammt fruchtbar du bist, und ich bin zu jung und zu verdammt attraktiv, um schon Opa zu werden.«
»Lieber Himmel«, schnaube ich und sehe zu, dass ich wegkomme.
Kapitel 4
Kai