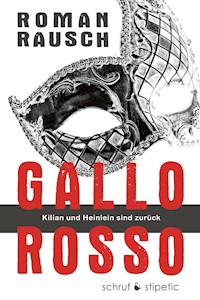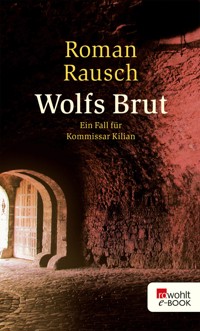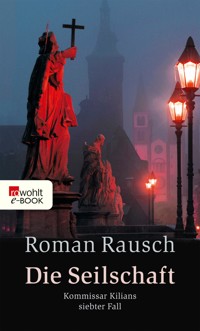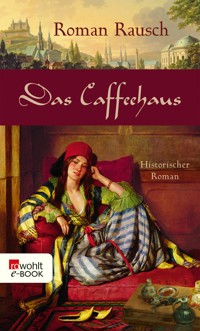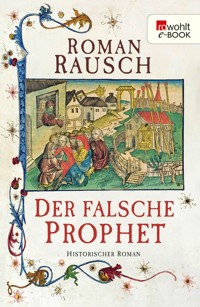7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Zeit zu sterben Ein Bombenanschlag erschüttert das Hanseviertel in Hamburg, ein US-Bürger kommt dabei ums Leben. Die Behörden sind alarmiert: Hat der islamistische Terror jetzt Deutschland im Visier? Sind die «Schläfer» geweckt worden? Als kurz darauf eine weitere Bombe in einem Kino detoniert, wird der Profiler Levy eingeschaltet. Der mag zwar nicht an einen islamistischen Hintergrund glauben, findet aber heraus: Die Spur führt in den Irak – zu einem Mann, der sich «Blade Runner» nennt. «Levy hat alle Voraussetzungen zur Kultfigur.» (Nürnberger Nachrichten) «Ein Kriminalpsychologe, der – wie Mankells Kurt Wallander – als äußerst komplexe Person gezeichnet ist.» (Mainpost)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 326
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Roman Rausch
Code Freebird
Thriller
Danksagung
Dem Terrorismus- und Sprengstoffexperten Hauptmann Nico Schönfeld, der mir schauerliche Einblicke in die Welt des Bombenbaus ermöglicht und das Skript mitbetreut hat.
KHK Bernd Schabel, Hans Strecker und Dr.Thomas Tatschner – meinen treuen Helfern bei der Recherche.
Blanka – wie immer–, der kritischen Stimme bei der Überarbeitung.
Amy Goodman, Evan Wright und Danny Schechter, deren Arbeiten Grundlage für dieses Buch waren.
Schließlich: Philip K.Dick. Sein Blade Runner war meine Inspiration.
Prolog
«Sie sagten, die Menschen werden es uns danken.
Sie sagten, dass wir einen gerechten Krieg führen.
Sie sagten, Gott selbst habe uns den Auftrag erteilt.
Moto.
Sie haben vergessen, dass es im Krieg ums Töten geht.
Sie haben uns eingeredet, dass es heldenhaft sei, für die Freiheit zu sterben.
Sie haben den Krieg zur Show gemacht.
Get some!
Einen Menschen sterben zu sehen ist keine schöne Sache. Und wir beide, mein Freund, sind dem Tod oft begegnet. Furcht ist der Bruder des Todes, hast du mir einmal gesagt. Wenn man in Furcht lebt, sei man schon zur Hälfte tot. Ich werde dein Bruder bleiben. Du als der Tod, ich als die Furcht.»
Er steckte die Pistole tief in den Wüstensand, der das Grab bedeckte, und sprach das Gebet.
«Ich habe Dinge gesehen, die ihr Menschen niemals glauben würdet. Gigantische Schiffe, die brannten, draußen vor der Schulter des Orion. Und ich habe C-Beams gesehen, glitzernd im Dunkeln, nah dem Tannhäuser Tor. All diese Momente werden verloren sein in der Zeit, so wie Tränen im Regen… Zeit zu sterben.»
Dann machte er sich auf den Weg.
«Ihr fürchtet den Tod.
Wir aber fürchten das Leben.»
Terroristen der Madrider Bombenanschläge 2004
«Eine beachtliche Erfahrung, in Furcht leben zu müssen, nicht wahr?»
Der Blade Runner
1
Hamburg glich einer besetzten Stadt.
Nie zuvor hatte Levy eine größere Ansammlung von Sicherheitskräften der Polizei und überraschenderweise auch der Bundeswehr gesehen. Letztere für die innere Sicherheit einzusetzen war seit dem 11.September oft und ausgiebig diskutiert worden. Bisher hatten sich die Kritiker gegen deren Einsatz durchsetzen können, doch wie sich nun zeigte, waren diese Bedenken nicht mehr zu rechtfertigen.
Als er vom Bahnsteig in die Wandelhalle gekommen war, hatte er bewaffnete Polizisten, die nach verdächtigen Personen Ausschau hielten, bemerkt. Hoch oben an der Decke verfolgten Überwachungskameras seine Schritte, und an den Ausgängen waren Soldaten positioniert, Spürhunde hielten ihre Nasen in die Menge. Diese Präsenz machte Eindruck, die geschulterten Waffen und das beklemmende Gefühl, stets im Fokus einer Ordnungskraft zu stehen.
Levy ging an ihnen vorbei und stieg in ein Taxi.
«Seit wann ist das Militär in der Stadt?», fragte er den Taxifahrer.
«Begonnen hat es vor vier Wochen mit dem ersten Anschlag», antwortete der Fahrer, ein junger Mann Anfang zwanzig.
«Wo hat er stattgefunden?»
«In einer Einkaufspassage im Hanseviertel.»
«Gab es Tote?»
«Ja, einen. Wie durch ein Wunder hat es nicht mehr erwischt. Dafür war der Sachschaden enorm. Überall flogen die Schaufensterscheiben heraus, und die Scherben surrten wie Sicheln durch die Luft. Hat mir ein Kollege erzählt, der dort geparkt hatte.»
«Wer war das Opfer?»
«Ein Ami, glaube ich.»
Der Taxifahrer ging vom Gas. Vor ihm hatte sich ein Stau gebildet. Rund zwanzig Meter entfernt winkten Polizisten die Fahrzeuge durch eine Absperrung.
«Was ist da vorne los?», fragte Levy.
«Ein Kontrollpunkt. Sie machen Stichproben. Keine Ahnung, wonach die suchen. Wenn die glauben, auf diese Weise Terroristen zu fangen, dann sind sie auf dem falschen Dampfer.»
«Es handelt sich also um eine Gruppe?»
«Was?»
«Sie sagten ‹Terroristen›. Mehrzahl.»
«Egal, ob einer oder eine Gruppe. Ich weiß es nicht, niemand weiß das. Ich dachte nur…»
Der Wagen war auf Höhe des Kontrollpunktes angekommen. Er fuhr im Schritttempo, vorbei an den Mündungsläufen von Schnellfeuerwaffen und gepanzerten Einsatzfahrzeugen.
Levy gefiel diese Perspektive ganz und gar nicht. Es ist eine Sache, von Maschinenpistolen zu hören, eine andere, nur durch dünnes Glas getrennt und keinen Meter entfernt in den Lauf einer solchen Waffe zu blicken. Dabei hatte der Beamte auch noch den Finger gefährlich nahe am Abzug. Levy konnte nur hoffen, dass er nicht schreckhaft und die Waffe gesichert war.
Ein kurzer, prüfender Blick auf Chauffeur und Fahrgast, dann wurden sie durchgewinkt.
«Wie lange geht das jetzt schon so?», fragte Levy, während der Wagen beschleunigte.
«Es ist der zehnte Tag, und seit gestern haben sie noch einen draufgelegt.»
«Was meinen Sie damit?»
«Gestern Nachmittag ging auf dem Kiez wieder eine Bombe hoch. Diesmal in einem Kino. Seitdem haben sie die Kontrollen verdoppelt. Weitere Bundeswehreinheiten sind über Nacht angerückt und unterstützen die Polizei. Wenn das so weitergeht, dann komm ich mir langsam vor wie in Jerusalem.»
«Wie kommen Sie gerade auf Jerusalem?»
«Ich bin dort geboren.»
«Sie sind Israeli?»
«Nein, Deutscher. Mein Vater war an der Uni tätig. Ich habe die ersten sechs Jahre meines Lebens dort verbracht. Dann sind wir Gott sei Dank weg. Auf die Dauer ist das nicht auszuhalten. Du weißt nie, wann es dich erwischt. Und jetzt fängt die gleiche Scheiße hier an. Man weiß langsam gar nicht mehr, wo man noch sicher ist.»
«Fidschi, Grönland…», scherzte Levy.
Der Taxifahrer schüttelte den Kopf. «Grönland ist dänisch. Und Fidschi hat am Irakkrieg teilgenommen. Sind dort nicht auch amerikanische Einheiten stationiert?»
«Glauben Sie, dass die Anschläge in Hamburg gegen Amerika gerichtet waren?»
Der Taxifahrer blickte in den Rückspiegel, er zögerte mit der Antwort. Doch dann: «Hinter allem stecken die Amis.»
Der letzte Teil der Fahrt verlief wortlos. Keiner der beiden wollte sich auf politisch brisantem Terrain weiter vorwagen.
Vor dem mächtigen, sternförmigen Polizeipräsidium am Bruno-Georges-Platz angekommen, stieg Levy aus.
Dieses Ungetüm von einem Gebäude konnte einem auf den ersten Blick Angst machen, so martialisch thronte es inmitten des weitläufigen Geländes. Unwillkürlich dachte Levy an ein riesiges Raumschiff in Form eines Zahnrads, das von Außerirdischen zurückgelassen worden war.
Er verbannte diese Gedanken aus seinem Bewusstsein und trat ein.
Eine halbe Stunde musste Levy auf dem Gang warten, bis sich die Tür vor ihm öffnete. Heraus traten Hortensia Michaelis, Sven Demandt und der Innensenator. Obwohl er Levy vorher noch nicht begegnet war, erkannte er ihn sofort. Er reichte ihm die Hand.
«Herr Levy, schön, dass Sie endlich da sind», begrüßte er ihn. «Kommen Sie, lassen Sie uns das Wichtigste gleich besprechen.»
Der Innensenator ging weiter, Levy folgte ihm an dessen Seite, Michaelis und Demandt im Schlepptau.
Er konnte sehen, dass Demandt über sein Erscheinen keineswegs erfreut war, im Gegensatz zu Michaelis, die ihm ein gewinnendes Lächeln schenkte.
«Wie Sie bereits wissen», begann der Innensenator, «ist Hamburg erneut ins Visier von Terroristen geraten. Sie geben sich nicht mehr damit zufrieden, von hier aus Anschläge zu planen, sondern wir stehen auf deren Liste der feindlichen Länder.»
«Ist denn schon sicher, dass es sich um Terroristen handelt?», unterbrach Levy. «Ich meine, könnte nicht ein Täter oder eine Tätergruppe mit anderen Motiven dahinterstecken?»
«So wie es nach aktuellem Kenntnisstand aussieht, nein. Aber behalten Sie diese Möglichkeit dennoch im Hinterkopf.
Nach dem ersten Anschlag in Hamburg und dem zweiten in Frankfurt, bei dem ein Angehöriger der US-Streitkräfte ums Leben gekommen ist, weisen alle Indizien auf einen Täter oder eine Gruppe aus dem radikal-islamistischen Bereich hin. Auch der in beiden Fällen verwendete Sprengstoff stützt diese These. Lassen Sie sich dazu von meinen Mitarbeitern informieren…»
Levys Blick ging kurz zurück zu Michaelis und Demandt. Seit wann war der BKA-Mann Demandt Mitarbeiter der Ermittlungsbehörden in Hamburg?, fragte er sich.
Der Innensenator fuhr fort. «Wir haben weiterhin Erkenntnisse der Nachrichtendienste, dass sich eine Gruppe von gewaltbereiten und arabisch sprechenden Personen gebildet hat, die sich Shamal nennt. Zu Shamal ist uns und den Nachrichtendiensten nichts weiter bekannt. Sie ist neu auf der internationalen Terrorbühne. Woher sie kommt und was genau ihre Ziele sind, ist unbekannt.»
«Es liegen keine Bekennerschreiben oder Forderungen vor?», fragte Levy.
«Nein, es herrscht absolute Funkstille.»
«Ist das nicht untypisch? Ich meine, solchen Anschlägen liegt doch meist die erwünschte Außenwirkung zugrunde? Je mehr…»
«Außenwirkung hat er ja durchaus erreicht», platzte Demandt dazwischen.
Levy wandte sich zu ihm um. Es schien Demandt nicht leichtzufallen, seine Verärgerung zurückzuhalten. Ihre Blicke trafen sich nur kurz.
Der Innensenator versuchte zu beschwichtigen. «Wie Sie sehen, ist die Stimmung etwas aufgeheizt. Herr Demandt teilt zwar meine Meinung nicht, Sie auf Empfehlung von Frau Michaelis in diesem Fall hinzuzuziehen, aber sie hat mir glaubhaft versichert, dass Sie für das Ermittlungsgebiet, für das ich verantwortlich bin, der geeignete Mann sind.»
«Und das ist ausschließlich Hamburg und nicht das Bundesgebiet», legte Demandt nach. «Außerdem befindet sich Herr Levy noch am Beginn seiner körperlichen und seelischen Rehabilitation. Darüber hinaus erscheint er mir vom Umfang dieser Angelegenheit doch deutlich überfordert.»
Levy blieb abrupt stehen. Was sagte da Sven, sein Freund, Ziehvater und Ausbilder, über ihn? Unverständnis stieg ihn ihm hoch.
Der Innensenator zog ihn weiter. «Sehen Sie es ihm nach, Herr Levy. An seiner Stelle würde ich wahrscheinlich genauso reagieren. Aber es bleibt dabei. Ich verlasse mich auf das Urteil meiner bewährten Mitarbeiter.» Damit meinte er eindeutig Michaelis. Levy blickte über die Schulter zurück. Sie trug ein stolzes Lächeln im Gesicht.
«Sie hat alle anderen Kriminalpsychologen abgelehnt», fuhr er fort. «Sie wissen, was das für Sie bedeutet. Enttäuschen Sie sie und vor allem mich nicht.»
Vor dem Raum, in dem der Krisenstab arbeitete, angekommen, reichte er Levy die Hand. «Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Wenn es Probleme gibt, zögern Sie nicht, mich anzurufen.»
Der Innensenator ging weiter und machte Platz für Michaelis, die resolut die Führung übernahm. Die Hand an der Klinke, forderte sie die beiden auf, ihr zu folgen.
Demandt schritt an Levy vorbei, nicht ohne die Positionen eindeutig zu klären. «Du weißt nicht, worauf du dich hier einlässt.»
Levy nahm es unwidersprochen hin und trat ein.
Der Krisenstab zählte rund fünfzig Männer und Frauen. Telefone klingelten, Drucker spuckten Listen aus, und eine Melange von unterschiedlichen Stimmen und Sprachen erstreckte sich bis zur Stirnseite des Raumes, auf die Michaelis zuhielt. Dort hielt sich der engere Kreis um die Einsatzleiterin auf. Levy erkannte die Gesichter sofort.
Erfreut über sein Kommen erhoben sie sich und schüttelten ihm die Hand. Als sie die Wunden in seiner linken Gesichtshälfte sahen, mischte sich eine gewisse Besorgnis in ihre Mienen.
«Schön, dass du wieder bei uns bist», sagte Naima Hassiri, eine Deutsch-Libanesin, die vor einem Jahr von der Kripo Berlin nach Hamburg gekommen war. Sie küsste ihn vorsichtig auf die Wange.
«Danke, Naima», erwiderte Levy leicht verlegen. Dieses warme Willkommen hatte er nicht erwartet, erst recht nicht nach dem Verhalten, das Demandt auf dem Gang an den Tag gelegt hatte.
«Schalom», sagte Falk Gudmann, der Verhörspezialist von der Kripo Tel Aviv. Eigentlich war er nur für ein Jahr zum Austausch in Hamburg. Es schien ihm hier zu gefallen.
«Mach endlich Platz», protestierte Luansi Benguela. Er war der Älteste und Erfahrenste in Michaelis’ Team. Er wirkte als ihr Stellvertreter, führte das Einsatztagebuch und koordinierte die Abläufe im Team. Aus Angola stammend, wurde er noch unter Honecker deutscher Staatsbürger und in den Polizeidienst übernommen. Er nahm Levy in den Arm, klopfte ihm vorsichtig auf die Schulter. «Es freut mich, ehrlich.»
Der blonde Schopf, der sich hinter Luansi aufbaute, war Alexej Naumov, ein Wolga-Deutscher und der Computerfreak der Truppe. Seine wasserblauen Augen hatten nichts von ihrer jugendlichen Strahlkraft verloren. Vorsichtig nahm er Levys Hand und schüttelte sie stumm. Sein Lächeln zeigte, wie sehr auch er sich freute.
Als Letzter begrüßte ihn Dragan Milanovic, der Gerichtsmediziner, der aus dem ehemaligen Jugoslawien stammte und während des Studiums eingebürgert worden war. Sein medizinisch geschulter Blick legte sich prüfend auf Levys Gesicht. «Gute Arbeit», konstatierte er. «Transplantate?»
Levy nickte.
«Genug, genug», beendete Michaelis die Begrüßung. «Es ist Zeit, mit der Arbeit fortzufahren.»
Wie es ihre Art war, sammelte sie, für Levys Geschmack etwas zu bedeutungsschwanger, die Unterlagen auf ihrem Tisch zu einem Bündel zusammen, stieß sie auf und legte sie beiseite.
«Jetzt, wo die Truppe wieder beisammen ist, bin ich guten Mutes, dass wir unseren Mann zur Strecke bringen.»
«Wieso Mann?», ging Demandt dazwischen. Er hatte an einem der Schreibtische Platz genommen. «Wer sagt, dass wir es hier mit einem Mann und nicht mit einer Frau oder beidem oder gleich einer ganzen Bande zu tun haben?»
Sein Ton war für alle überraschend scharf. Sie blickten ihn fragend an.
Michaelis ließ sich davon nicht beeindrucken. «Insoweit gebe ich Sven recht. Wir wissen nicht sicher, um wen es sich bei den Anschlägen im Einzelnen handelt. Doch lasst mich euch zuerst mitteilen, wie die zukünftige Marschrichtung aussieht. Der Innensenator ist mit dem Chef des LKA Hessen, dem Präsidenten des BKA und weiteren beteiligten Stellen, auf die ich später noch eingehen werde, übereingekommen, dass wir für das Ermittlungsgebiet Hamburg und Umgebung auf operativer Ebene federführend sind.»
Zustimmendes, spontanes Klopfen auf die Tische. Alle hatten diese Entscheidung erhofft. Alle, bis auf einen.
Demandt hielt dagegen. «So ein Irrsinn. Ihr habt nicht die leiseste Ahnung, worauf ihr euch da einlasst.»
Die Toleranzschwelle von Michaelis schien allmählich erreicht. Sie schlug einen formellen, fast schon bissigen Ton an. «Nun, Herr Demandt, dann klären Sie uns doch bitte auf, wieso nur das BKA imstande sein sollte, diesen Fall zu lösen?»
Demandt verwies auf die enormen technischen Möglichkeiten, die notwendig seien, um eine Terroristengruppe zu fassen. Erschwerend käme die Beteiligung weiterer Dienste hinzu, nicht zuletzt des CIC, des Criminal Investigation Command, einer Art FBI der US-Armee, das sich aufgrund des getöteten US-Soldaten in Frankfurt in die Ermittlungen eingeschaltet hatte.
Unnützes Kompetenzgerangel, dachte Levy. Während sie hier stritten, würde die Terrorgruppe Shamal das nächste Ziel auswählen, eine neue Bombe bauen, Ort und Zeitpunkt des Anschlages festlegen.
Aber noch hatte er keine Informationen in der Hand, um einen derartigen Rückschluss ziehen zu können. Lediglich die Statistik und die Erfahrungswerte lehrten ihn, dass Bombenleger von sich aus nicht mit den Anschlägen aufhörten. Sie bastelten so lange an ihren Höllenmaschinen, bis sie geschnappt wurden. Insoweit waren die bisherigen Anschläge möglicherweise nur die ersten Glieder einer Kette, die sehr, sehr lang werden konnte.
Opfer, Art der Bombe und der Tatort mussten schnellstens überprüft werden, stattdessen hackten sich Michaelis und Demandt die Augen aus.
Levy hörte nicht zu, sondern betrachtete die beiden, die er schon einige Zeit nicht mehr gesehen hatte.
Demandt war Mitte fünfzig, bei der Arbeit ergraut, hatte gut zehn Kilo zu viel auf den Rippen, seine Haut war ungesund blass, seine Augen schauten müde drein. Nach der Aufbauarbeit der Abteilung Operative Fallanalyse beim BKA hätte er einen mehrmonatigen Urlaub fern von geistig gestörten Serientätern und dem Erwartungsdruck von Vorgesetzten und Öffentlichkeit dringend nötig gehabt. Seine Ehe war in die Brüche gegangen, sein Sohn wurde ohne ihn erwachsen.
Ihm gegenüber Michaelis, Ende dreißig, noch immer voller Schaffensdrang. Wenn sie in diesem Tempo weitermachte, würde ihr der Job als Sonderermittlerin bald nicht mehr genügen. Auch sie hatte Mann und Kind für die Karriere geopfert. Lediglich ihre kranke Schwester bildete eine Brücke hinüber in eine private Welt.
Ihre schulterlangen, blonden Haare waren seit ihrem gemeinsamen Rettungssprung durch das Feuer auf einen rasanten Kurzhaarschnitt gestutzt, den sie meist stachlig aufgelte, was gut zu ihrem Charakter passte.
«…und dann auch noch Levy», hörte Levy an sein Ohr dringen. Es holte ihn aus seinen Gedanken.
«Was ist mit mir?», fragte er unbedarft, ohne die Vorrede und die Zusammenhänge zu kennen.
Als habe er auf diese Reaktion gewartet, breitete Demandt die Arme aus. «Seht ihr? Er ist noch nicht einmal hier wirklich anwesend. Er gehört zurück in die Rehabilitation. Die schweren Verletzungen, die er sich beim Sprung durch den Feuerring zugezogen hat, sind noch nicht verheilt, ganz zu schweigen von den psychischen. Der Mann ist krank und für den Dienst untauglich. Hortensia, nimm ihn raus. Es ist unverantwortlich, was du hier tust.»
Michaelis blickte zu Levy. Sie ging mit ihm ein großes Risiko ein, das hatte sie gewusst, bevor sie ihn angerufen und um seine Mitarbeit gebeten hatte.
Statt ihrer antwortete Levy. «Welches Problem hast du mit mir, Sven? Okay, ich gebe zu, ich habe schon bessere Tage gesehen, und ein paar Wochen Entspannung würden mir durchaus guttun, doch ich bin gesund, auch wenn es auf den ersten Anschein nicht so aussieht. Und was deine Befürchtungen angeht, ich sei psychisch nicht ausgeglichen, kann ich dir nur eins dazu sagen: Unser Täter – ob Frau oder Gruppe – muss in einer ähnlichen Situation sein, um diese Anschläge zu begehen. Wer wäre also besser für den Job geeignet als ich?»
«Wie viele Bombenleger hast du schon bearbeitet?», fragte Demandt.
Levy zögerte. «Noch keinen.»
«Siehst du, Hortensia? Er ist eindeutig die falsche Wahl. Nimm einen Mann aus meinem Team. Wir kennen uns mit…»
«Wie viele radikal-islamistische Bombenleger habt ihr schon überführt?», schlug Levy zurück.
Demandt stockte. «Was soll das? Einige. Zum Beispiel den geplanten Anschlag in Straßburg…»
«Ich meine aktive Bombenleger, und zwar vermutlich aus dem arabischen Kulturraum», schnitt Levy ihm den Satz ab. «Keine Schläfer, sondern aktive, die bereits zwei, drei Anschläge in Deutschland verübt haben und sich auf die nächsten vorbereiten?»
«In Afghanistan haben wir…»
«In Deutschland! Afghanistan ist weit weg. Die Umstände dort sind doch völlig andere als hier, nicht zu vergleichen. Also, wie viele?»
Demandt wich der provokanten Frage aus. «Meine Leute haben die Ausbildung und den Apparat hinter sich, den sie für die Aufklärung der Anschläge benötigen. Beides fehlt dir.»
«Ich habe die Befürchtung», sagte Levy, «dass es hier – und besonders dir – um etwas ganz anderes geht als um die Frage, ob ich der richtige Mann für die kriminalpsychologischen Ermittlungen bin oder nicht.»
2
Drei Tatorte, drei Explosionen, ein Täter.
Für diese Theorie sprachen nicht nur der verwendete Sprengstoff Triacetontriperoxid, kurz TATP und wegen seiner Unberechenbarkeit in Kreisen arabischer Bombenbauer auch die Mutter des Satans genannt, sondern auch unverbrannte Teile ein und desselben Klebebandes, das an allen drei Orten aufgefunden wurde. Die Wahrscheinlichkeit, dass verschiedene Täter das gleiche Band benutzten, war nach den Erfahrungen der Bombenexperten gering.
Die Spurenanalytik vor Ort und die späteren Laboranalysen der an den Tatorten aufgefundenen Rückstände legten den Schluss nahe, dass aus einer einmal angefertigten Tranche drei Sprengsätze gebaut worden waren. Die Bestandteile mussten dabei aufs Gramm genau abgestimmt sein, um ein derart hohes Maß an Effizienz zu erzielen.
Wer so vorging, sagte sich Levy, fertigt keine Überproduktion an. Sie hatten es also mit einem genau planenden Täter zu tun, der obendrein in der lebensgefährlichen Kunst des Baus von Bomben ausgesprochen versiert war.
TATP war ein derart reaktionsfreudiger Stoff, hieß es im Bericht weiter, dass der Fall aus Schreibtischhöhe bereits ausreichte, um ihn zur Detonation zu bringen. Der oder die Täter mussten daher entweder lebensmüde Hobbychemiker oder eiskalte Profis sein, so lautete eine kurze Bewertung.
Extreme dieser Art schätzte Levy gar nicht. Sie verlagerten alle weiteren Überlegungen in das eine oder das andere Feld, ohne eine Zwischenlösung zu berücksichtigen. In der grauen Mitte waren oft die schrecklichsten und niederträchtigsten Verbrechen zu finden.
Levy rieb sich die müden Augen. Es war mittlerweile nach zweiundzwanzig Uhr. In den vergangenen Stunden hatte er sich auf den aktuellen Ermittlungsstand gebracht. Alexej hatte ihm die Datei mit allen eingescannten Dokumenten zur Verfügung gestellt, die von Belang waren. Darunter waren die Gutachten der chemischen Untersuchungsstelle des Landeskriminalamtes, für die es schwierig gewesen war, das TATP überhaupt nachzuweisen, da es nahezu rückstandslos detonierte, Tatortfotos, Berichte der Spurensicherung und der Tatortgruppe Sprengstoff/Brand, schließlich Zeugenaussagen und die Obduktionsprotokolle der Gerichtsmediziner.
Die Opfer, drei an der Zahl, waren von der Wucht der Detonation mehr oder minder zerrissen worden. Es fiel nicht leicht, die Namen der ersten beiden festzustellen, da sowohl die Gesichter als auch die Oberkörper durch die Wucht der Explosionen zerfetzt waren. Die Identität des dritten Opfers war zu diesem Zeitpunkt noch ungeklärt. Ein Mann, so viel konnten die Gerichtsmediziner immerhin sagen.
Etwaige Ausweisdokumente, die die Opfer in den Brusttaschen mit sich geführt hatten, mussten in mühevoller Kleinarbeit vom Boden aufgesammelt und im Labor zusammengesetzt werden. Der Abgleich der Fingerabdrücke hatte in allen drei Fällen nichts erbracht, da die Opfer offensichtlich bisher nicht straffällig geworden waren.
So dauerte es mehrere Tage, bis die Identitäten der ersten beiden gesichert waren. Opfer Nummer eins hieß Steve Pratchett, Amerikaner und PR-Fachmann, der für einen Kurzbesuch in Hamburg war. Er hatte an einem Symposion für Kommunikationsstrategien teilgenommen.
Nach Aussage eines seiner Kollegen hatte er sich für einen Kaffee im nahegelegenen Hanseviertel verabredet. Fest stand, wäre er nur dreißig Sekunden früher oder später losgegangen, so hätte ihm nicht einer der insgesamt fünf Sprengsätze das Leben genommen.
Fünf Sprengsätze. Was wollte der Täter damit erreichen?, fragte sich Levy. Hätte nicht einer vollauf genügt, um Entsetzen und Panik in der Bevölkerung zu verbreiten?
Das Video eines schwedischen Touristen, der zu diesem Zeitpunkt in der Nähe war, hatte den Vorfall dokumentiert.
Es war ein schöner und sonniger Tag. Elf Uhr zweiunddreißig. In einer halben Stunde würden sich Cafés und Restaurants zur Mittagszeit füllen. Leichter Wind beugte Blumen und bauschte Haare auf. In der für Handkameras typischen, etwas wackligen Aufnahme war eine Gruppe gutgelaunter Touristen zu sehen. Sie machten Späße, tranken Bier und sprachen mit dem Amateurfilmer.
Die erste Explosion erschütterte das Bild. Dann die zweite. Ruckhaft suchte das Kameraauge die Quelle des Lärms. Im Hintergrund hörte man Glasscheiben bersten und wenig später Scherben auf den Boden prasseln, gefolgt von ersten Schreien. Das Bild wurde unscharf, der Autofokus konzentrierte sich auf eine Fassade. Im Bildanschnitt verschwanden Menschen, duckten oder warfen sich zu Boden. Dann, in einer Reihe, explodierten die Sprengsätze drei, vier und fünf kurz hintereinander. Jetzt begriff der Schwede, dass auch er sich in Lebensgefahr befand. Das Bild wackelte und fiel zu Boden. Aus ungewohnter Perspektive nahm die Kamera weiter die Bilder des Schreckens auf. Wie Hagel regneten Glasscherben und Steinsplitter auf die Menschen herab. Die meisten kauerten oder lagen am Boden, die Hände schützend über den Kopf. Ein Kind, vielleicht drei Jahre alt, stand weinend zwischen ihnen. Im Off war lautes Schreien zu hören.
Ergebnis: ein Toter, sechsunddreißig zum Teil schwer Verletzte. Ein Wunder, dass nicht mehr verletzt oder getötet wurden.
Fall Nummer zwei, fünfzehn Tage später. Tatort Frankfurt. Die Einkaufsstraße Zeil, neunzehn Uhr fünfzig. Bericht des Augenzeugen Wolfram Kleinert, eines Versicherungsangestellten, der ein Geschenk für seine Frau kaufen wollte und kurz vor Ladenschluss ein Geschäft betrat.
«Ich sah diesen Mann unter einer der Straßenlampen stehen. Er versuchte händeringend, jemandem etwas zu erklären. Ich glaubte, es war ein Tourist, erkennen konnte ich ihn nicht. Unsere Blicke traf sich für einen Moment. Ich vermutete, dass er Hilfe suchte. Durch die große Fensterscheibe im Geschäft konnte ich dann sehen, dass der Mann mit seinem Handy telefonierte und dabei zwischen den Sitzbänken, die rund um die Bäume angebracht sind, hin und her ging.
Ich kümmerte mich nicht weiter darum. Kaum war er aus meinem Blickfeld verschwunden, krachte es auch schon. Ich spürte die Druckwelle bis ins Geschäft hinein. Alles um mich herum wackelte und erzitterte. Dann drückte es die Scheiben herein. Ich kann von Glück sprechen, dass ich hinter der Wand stand. Ein paar Splitter habe ich mir am Bein eingefangen.»
Das Opfer war Robert Townsend, US-Offizier im Rang eines Majors aus einem der in Frankfurt und Umgebung zahlreichen Stützpunkte der amerikanischen Streitkräfte. Der Sprengsatz war unter einer Sitzbank direkt am Baumstamm festgemacht. Dadurch erhielt die Explosion eine Richtung, sie strahlte nach vorne weg, direkt in die Fußgängerzone. Lediglich vier Personen wurden verletzt, eine schwer, die anderen leicht. Dass nicht mehr Passanten betroffen waren, lag an einem Transporter, der kurz vorher in der Nähe des Baumes geparkt worden war und damit eine weitere tödliche Ausbreitung verhindert hatte.
Die schwierigen Laboranalysen erbrachten eine Verbindung zum Hamburger Sprengsatz. Auch der Zünder und die verwendeten Materialien, darunter Reste desselben Klebebandes, stützten die These.
Townsend war lediglich anhand der Zeugenaussage Kleinerts und einer später durchgeführten DNA-Analyse zu identifizieren. Sein Körper war durch die Explosion fast völlig unkenntlich.
Die Stellungnahme eines hessischen Kollegen schilderte die Vorgehensweise während der Ermittlungen.
«Erschwert wurde die Identifikation durch die amerikanischen Militärbehörden, besser gesagt, durch deren mangelnde Informationsbereitschaft.»
Levy schaute sich den Bericht genauer an. Was war da los? Da das Land Hessen und die Stadt Frankfurt sich jahrzehntelang unter Besatzungsstatut befanden, hatte sich eine seltsame Art der Kooperation zwischen den hessischen und den amerikanischen Ermittlungsbehörden entwickelt. Kaum war der Tatort von der Streifenpolizei gesichert und von den Spezialisten des LKA aufgenommen, übernahm die CID, die örtliche Kriminalpolizei der US-Armee, das Kommando.
Die hessischen Ermittler traten beiseite, da «die Interessen des Landes» gegenüber den amerikanischen zurückstehen mussten – das sei eine gängige Vorgehensweise, wenn ein US-Soldat auf deutschem Boden zu Tode kam.
Levy schüttelte über so viel sonderbare Verbundenheit den Kopf. Mehr noch, als erst eine Woche nach dem Anschlag in einer deutschen Fußgängerzone nur ein kurzes Statement zur Identifikation Townsends über das US-Kommando verlautbart wurde. Weitergehende Hinweise, wie etwa zum Aufbau dieser sogenannten Unkonventionellen Spreng- und Brandvorrichtung (USBV), zum Zünder oder zum Opfer, blieben aus. Einzig was die deutschen Beamten selbst sichergestellt hatten, konnte den Ermittlungen dienen.
Dass in diesem Fall die bisher etablierte Vorgehensweise der Amerikaner nicht ohne Folgen blieb, ließ sich nur aus dem Anschlag in Hamburg ableiten.
Der gleiche Sprengstoff, vermutlich der gleiche Täter oder Täterkreis, Reste eines bestimmten Klebebandes. Ein lokaler Journalist, der über die Jahre gute Kontakte zu beiden Seiten aufgebaut hatte, brachte die Fakten ans Licht.
Bombenkrater Deutschland hieß die Schlagzeile. Eine Kopie des Artikels lag den Unterlagen bei. Amerikanisches Militär verweigert Zusammenarbeit bei der Aufklärung des zweiten Bombenanschlags in Deutschland, der mit radikalislamistischen Gruppen in Verbindung gebracht wird.
Eine mutige These, dachte Levy. Wobei der Sprengstoff TATP die bevorzugte Waffe islamistischer Terroristen war. Die Anschläge in London und viele in Israel wurden damit verübt.
Aber gerade das Beispiel London hatte auch gezeigt, dass TATP nicht zwangsläufig eine Verwicklung von arabischen Terroristen bedeuten musste, da die dortigen Täter als Einheimische, sprich Engländer, einzustufen waren. Zudem handelte es sich bei TATP um einen mit einfachen Mitteln herzustellenden und äußerst effektiven Sprengstoff, dessen Detonationsgeschwindigkeit an militärischen Sprengstoff heranreichte. Die Zutaten fanden sich in Nagellack, Haarfärbemittel und Salzsäure, die in jeder Drogerie beschafft werden konnten. Eine attraktive Waffe sowohl für naivunbedarfte Amateure als auch für kaltblütige Profis.
Was jedoch noch immer fehlte, war ein Bekennerschreiben. Nach vier Wochen, beziehungsweise zehn Tagen, war es an der Zeit, dass sich die verantwortliche Gruppe zu Wort meldete. Doch nichts Ernstzunehmendes tat sich – ausgenommen die Trittbrettfahrer, denen jedoch die entscheidenden Informationen fehlten: Um welche Art Sprengstoff handelte es sich? Womit wurde er gezündet? Welche Komponenten wurden verwendet?
Das konnte nur der wirkliche Täter wissen.
Obgleich bei den ersten beiden Anschlägen kein deutscher Staatsbürger getötet worden war, war die Wirkung enorm. Levy hatte sie bis in das Kaff an der Ostsee gespürt. Die Welt steht in Flammen hatte sein Therapeut gesagt. In dem kleinen Wirtshaus, wo er zu Abend aß, war die Stimmung zuerst von Entrüstung, dann von Betroffenheit geprägt, schließlich schlug sie in eine Art Selbstverteidigung um.
Die allgemeine wirtschaftliche Misere im Osten, das noch immer lähmende Gefühl der Benachteiligung nach bald zwei Jahrzehnten der Wiedervereinigung, die anhaltende Landflucht der Jungen und schließlich auch noch Muslime, die sich daranmachten, das Grundgesetz gegen die Scharia auszutauschen – all dies war der Nährboden einer um sich greifenden Verunsicherung.
Nie zuvor hatte man den Beschwichtigungen der Politiker weniger Glauben geschenkt. Es schien fast so, als ob sie wider besseres Wissen die Bevölkerung vorsätzlich und anhaltend belogen.
Nicht anders konnte Levy die Zeitungsartikel und Fernsehbeiträge bewerten, die ihm Alexej an die Protokolle und Berichte angehängt hatte. Die heimischen Verantwortlichen gerieten immer mehr ins Visier der öffentlichen Meinung. Was gedachte der Staat gegen die Gefahren zu tun? Konnte man sich im eigenen Land noch sicher fühlen? Welche Maßnahmen mussten konkret ergriffen werden, damit Sicherheit und Ordnung wieder gewährleistet werden konnten?
Einer Antwort darauf hatte Levy an diesem Tag ins Auge geschaut. Dem Lauf einer Heckler & Koch, der Maschinenpistole eines deutschen Polizisten. Daneben, zum Landesschutz verpflichtet und das Schnellfeuergewehr geschultert, ein Bundeswehrsoldat. Sicherheit war nicht mehr länger unterteilt in außen und innen, ab jetzt war der Schutz oberstes Staatsziel, dem sich Recht und Freiheit des Einzelnen unterzuordnen hatten.
Wann endlich, fragte sich Levy, fangt ihr an, einer Bedrohung nicht mit Abschottung, sondern mit Offenheit zu begegnen, um einer möglichen Eskalation Einhalt zu gebieten?
Stattdessen verbarrikadieren sie sich und wetzen die Messer.
Levy gähnte und schaute dabei auf die Computeruhr. Sie meldete zwanzig vor elf. Eigentlich war es noch nicht Zeit fürs Bett, aber der Tag hatte ihn viel Kraft gekostet. Nicht zuletzt wegen der Auseinandersetzungen mit Demandt. Der bestand weiterhin darauf, dass die Hamburger Ermittlungen in die landesweiten, sprich die hessischen des BKA einfließen sollten. Alles andere wäre eine Verschwendung von Ressourcen, und schließlich würde Michaelis mit ihrem Team den Fall ohnehin nicht stemmen können.
Nachdem Levy und Michaelis ihn in diesem Glauben beließen, wurden die anstehenden Aufgaben verteilt. Levy musste sich schnellstens einarbeiten. Unterstützung würde er von Demandt und seinen Leuten wohl kaum zu erwarten haben, selbst wenn er sich beim Innensenator beschweren würde. In diesem Fall schien Demandt ganz auf amerikanischer Linie zu sein. Er spielte sein Spiel, und Levy gehörte zur gegnerischen Mannschaft.
Die Maske der elektronischen Telefonanlage zeigte einen eingehenden Anruf auf dem Bildschirm. Levy las die Nummer. Sie war ihm unbekannt. Wer rief so spät bei ihm an?, fragte er sich.
«Levy», sprach er müde ins Mikrofon und schickte ein Gähnen hinterher.
Eine Frauenstimme meldete sich. Sie war ihm unbekannt. Auch woher sie anrief, konnte er nicht genau verstehen. Im Hintergrund sprachen noch andere Personen. Er verstand nur zwei Wörter: Klinik und besorgniserregend.
«Wer sind Sie?», wiederholte er die Frage.
«Mein Name ist Hingsen», antwortete sie. «Ich rufe im Auftrag von Dr.Felsenberg an.»
«Wer ist Dr.Felsenberg?»
«Der behandelnde Arzt von Frank de Meer, Ihrem Bruder. Sie sind doch Balthasar Levy?»
Levy schluckte. Mit einem Schlag hatte ihn seine Vergangenheit eingeholt. So wie ein Tropfen Wellen schlägt, so breitete sich Unruhe in ihm aus. Er fühlte, wie seine Fingerspitzen kribbelten und sich seine Zehen verkrampften. Für ein Gespräch über seinen Bruder war es eindeutig noch zu früh.
«Was wollen Sie?», fragte er barsch.
«Dr.Felsenberg bittet um ein Gespräch mit Ihnen.»
«Wieso? Was will er von mir?»
«Wie gesagt, es geht um Ihren Bruder. Sein Zustand gibt Anlass zur Sorge. Dr.Felsenberg möchte…»
«Kein Interesse», unterbrach Levy sie.
«Wie bitte?»
«Ich sagte, ich habe kein Interesse, mit wem auch immer über Frank de Meer zu sprechen.»
«Meinen Unterlagen zufolge sind Sie der einzig lebende Familienangehörige. Sie können doch nicht…»
«Und ob ich kann. Rufen Sie hier nie wieder an.»
Levy klickte das Gespräch weg. Es gelang ihm nicht sofort. Seine Hand zitterte, und der Mauszeiger schlug Haken wie ein Hase auf der Flucht.
«Hören Sie, wir benötigen Ihre Einwilligung, was im Falle…», hörte er die Frau noch sagen, bevor die Verbindung ganz abbrach.
«Zum Teufel mit ihm», schickte Levy hinterher.
Er stand auf. Sein Körper fühlte sich an, als hätte er in die Steckdose gefasst, seine Gedanken überschlugen sich. Bilder von brennenden Körpern schossen ihm durch den Kopf. Verzweifelte Schreie drangen aus dem dunklen Keller seiner Erinnerungen nach oben. Das Gesicht seines Bruders in der Maske des Anubis tauchte vor ihm auf. Er meinte, den Geruch von Benzin und verkohltem Fleisch zu riechen.
Dieser verdammte Geruch. Er musste raus aus seinem Körper, aus seinem Gehirn, aus seinem Leben.
Wo war die Flasche? Er blickte sich um. Nichts vorhanden, was ihm Erleichterung verschaffen könnte. Demandt hatte die Wohnung nach seiner Einlieferung ins Krankenhaus gesäubert. Hatte er noch die Reserve für den Notfall? Die hatte Demandt bestimmt nicht gefunden. Dafür war das Versteck zu gut.
Levy ging ins Badezimmer. Die Wanne war in einem gefliesten Sockel eingelassen. Eine Kachel ließ sich entfernen, um Zugang zum Abfluss zu bekommen. Er drückte die Kachel nach hinten weg und streckte den Arm hinein. Dort, wo der Abfluss im Mauerwerk verschwindet, hatte er die Flasche deponiert. Sie musste mittlerweile zur Köstlichkeit gereift sein.
Während er blind im finsteren Loch Reste von Dichtungsmitteln, verwaiste Spinnennetze und tote Käfer ertastete, brannte es ihm heiß in Mund, Kehle und Brust.
Verdammt, wo war das Ding nur? Er hatte die Flasche eigenhändig an die Krümmung des Rohrs gelegt, damit er sie schnell zur Hand hatte, wenn er sie brauchte.
Doch da war nichts außer Schmutz und Friedhof.
Er zog den Arm heraus und blickte hinein. Das einfallende Licht reichte nicht aus, um die Schatzhöhle zu erhellen.
Eine Taschenlampe. Er hatte noch eine. Irgendwo. Er brach die Suche ab, nahm stattdessen die Streichhölzer.
Auf dem Rücken liegend, hielt er den Arm und die Flamme ins dunkle Versteck. Irgendwoher kam hier Zugluft. Die dünne Flamme erlosch schnell. Dem nächsten Streichholz erging es nicht besser. Eins ums andere verbrannte am roten Schwefelkopf.
Klopapier. Das war die Lösung. Er rupfte ein, zwei Meter ab, zerknüllte es zu einem Ball und zündete ihn an. Mit der Eleganz eines Fußballanfängers kickte er ihn ins Loch.
Auf den Knien verfolgte er wie zum Freitagsgebet gebeugt den Gang der Dinge. Die Flammen ließen die verstaubten Spinnennetze schmoren und die dürren Käferbeine zucken. Ein hohler Panzer poppte wie ein Maiskorn im heißen Topf zur Seite.
Er sah wirr hüpfende Schatten, hörte panisch flüchtende Mitbewohner auf dünnen Beinchen und roch ätzendes Chitin. Der Geruch war so intensiv, dass Levy augenblicklich zurückzuckte.
Er schnäuzte aus, um diesen beißenden Gestank aus Nase und Hirn zu bekommen; er hatte eine ekelerregende Spur auf seinen Schleimhäuten hinterlassen.
Levy setzte sich auf den Klodeckel und wartete ab, bis das Feuer unter seiner Badewanne erloschen war. Von der Flasche Wodka war nichts zu sehen. Er verfluchte Demandt, er wünschte, er würde brennen wie das Viehzeugs.
Doch wie der Gestank in seiner Nase allmählich verschwand, so ließ auch der Druck in seinem Inneren nach. Es war ein kurzer, aber heftiger Anfall gewesen. Beinahe wäre er wieder in sein altes Schema verfallen.
Levy hatte für diesen Tag genug. Er ging zurück an den Computer. Mit zwei Klicks fuhr er die Anlage auf Stand-by. Noch immer stand sie inmitten des großen Lofts, das er erst einmal seit seinem Krankenhausaufenthalt betreten hatte. Die wenigen Kleidungsstücke, die er für die Reha an der Ostsee gebraucht hatte, waren aus dem ohnehin knappen Bestand des Schranks schnell zusammengewühlt. Nur den großen Kühlschrank galt es abzustellen. Ansonsten stellte die karge Möblierung – ein Bücherregal, ein Bett, ein Tisch, zwei Stühle – keine Ansprüche.
Auf dem Weg zurück ins Badezimmer entledigte er sich seiner Sachen und stopfte sie in die Waschmaschine. Das Kurzprogramm sollte genügen. Ohnehin ging es ihm bei dieser Routine nur um das monotone und beruhigende Drehen der Trommel, das ihn bei seinem allabendlichen Bad sanft auf den Schlaf vorbereiten sollte.
Während das Badewasser einlief, riskierte er einen Blick in den Spiegel.
Er hatte zugenommen. Gottlob, er sah halbwegs gesund aus. Die Brandmale an seiner linken Körperseite, die sich bis zum Scheitel hinaufzogen, waren leidlich mit den Transplantaten verheilt. Noch ein paar Monate, und er würde sich wieder in Badehosen sehen lassen können.
Was würde eine Frau sagen, wenn sie ihn so sähe, fragte er sich. Würde sie sich erschrocken abwenden?
Dr.Frankenstein und seine Kreatur. Der Vergleich war nicht ohne. Sein Leib und seine Seele waren von zu vielen Toten gezeichnet.
3
Die Wirkung des Heroins ließ nach. Stufe um Stufe stieg er hinab in den Keller seiner Erinnerungen. Jeder Schritt schmerzte. Seine blutunterlaufenen Augen sahen im speckigen Grau an der Decke einen Film, wie immer, wenn die Droge ihn allein in der Welt zurückließ.
Die Nacht war schwarz und klebrig.
Leuchtspurmunition tackerte Morse-Codes über die Dächer der einst so stolzen Stadt rund fünfzig Kilometer westlich von Bagdad. Eine Antwort ließ nicht lange auf sich warten.
Binnen kurzem war die Luft erfüllt von Detonationen. In diesem Gefecht gab es keine Zuschauer, die sicher wie bei einer Talk-Show das Treiben auf der Bühne beobachten konnten. Hier war jeder mitten im Geschehen. Jeder war Teil einer Inszenierung von Macht – sowohl jene, die Demokratie und westliche Zivilisation ins Zweistromland brachten, als auch jene Teile der Bevölkerung, die sich verzweifelt dagegen zur Wehr setzten.
Für sie war ihre Heimat die Wiege der westlichen Kultur. Beide Parteien waren der festen Überzeugung, jeweils in Gottes eigenem Land zu leben, während die Gegenseite ihr Leben und ihre Kultur aus niederträchtigen Gründen zerstören wollte.
So ging es viele Tage und Nächte lang. Da sich die Bürger dieser Stadt nicht so schnell wie gewünscht überzeugen ließen, griffen die Befreier in ihrer Verzweiflung zu den äußersten Mitteln. So kamen die Waffen doch noch zum Einsatz, deren angeblicher Besitz den Krieg hatte rechtfertigen sollen.
Der Tod kam mit viel Getöse aus der Luft. Er war wunderschön anzusehen, wie er sich am Himmel in bunten Spuren verlöschender Sterne zeigte.
Muhammed, so hieß der Prophet ihres Gottes.
Auch er war eine Art Prophet, und nicht der einzige. Dieser Gott verfügte über viele Propheten, die seine Botschaft in die Welt trugen. All diese Propheten glaubten an dessen Macht. Dieser Gott war kein Hirngespinst, keine Überlieferung aus antiken Zeiten, sondern ein mächtiger Streitherr der Gegenwart. Die Zukunft gehörte ihm, und er war sein Prophet.
Doch in dieser Nacht war sein Gott unbarmherzig. Er sandte Feuer und Schwefel vom Himmel, und er machte keinen Unterschied zwischen Kämpfern und Kindern, Männern und Frauen.
In dieser Nacht war ein blutrotes Kreuz über jeden Türeingang dieser Stadt gezeichnet, und ein jeder würde seinen Glauben im Feuer büßen.
Muhammed erhob sich mit einem Ruck von der Pritsche, seine Hand zitterte zum Tisch. In einem Brillenetui bewahrte er das Besteck und das braune Pulver auf. Er ließ eine Portion auf den Löffel rieseln und gab Zitronensäure und Wasser dazu. Während die Flamme einer Kerze das Gemisch erhitzte, legte er den Stauschlauch um seinen Oberarm und zog ihn mit zusammengekniffenen Zähnen fest. Er fand eine Vene, zog zur Sicherheit ein paar Tropfen Blut in der Spritze hoch, und dann drückte er zu. Das Heroin überflutete Geist und Körper.
Roter Mohn war eine gewöhnliche Blume am Wegesrand. Sie blühte in aller Pracht im Paradies, unter Allahs wohlwollendem Auge.
Auf dem Notebook kam eine Meldung herein. Die Nachrichten eines TV-Senders sprachen von verschärften Sicherheitsvorkehrungen und einer um sich greifenden Verunsicherung in der Bevölkerung. Der Terror habe das Land erfasst, doch man werde sich mit aller Macht dagegen wehren. Namenlose Gesichter auf der Straße schienen es zu bestätigen.
Man wollte ihnen nicht so recht glauben. Die Beklemmung, die stumpfe Angst und ein Gefühl der Mitschuld schwangen in jedem Wort der Selbstermutigung mit. Hinter jeder Ecke ihres beschützten Lebens konnte nun der Tod auf sie lauern – in Form einer achtlos abgestellten Tasche, beim Warten an einer Bushaltestelle oder in Gestalt des netten Studenten aus Nahost, der stets hilfsbereit und ein ruhiger und anständiger Nachbar war.
Ein bemerkenswertes Gefühl, diese Furcht, nicht wahr?, hatte der Replikant zum Blade Runner gesagt.
4
Levy hatte die Nacht fest durchgeschlafen. Ein gutes Zeichen. Seine Gesundung machte Fortschritte, wenngleich ihm der Beinahe-Rückfall der vergangenen Nacht noch in den Knochen steckte.
Bei einer Tasse frischgebrühten Kaffees, schwarz, mit einem Löffel Zucker, erweckte er den Computer aus dem Stand-by-Modus. Das E-Mail-Programm übersäte den Bildschirm mit einer nicht endenden Liste eingegangener Nachrichten aus den letzten fünf Monaten. Es war ihm unmöglich, auch nur einen Teil einer genaueren Prüfung zu unterziehen. Nach kurzem Abwägen entschloss er sich, eine Nachrichtensperre zu verhängen, die Mailbox zu leeren und auf unbestimmte Zeit zu deaktivieren. Tagesgeschäft war das Letzte, mit dem er sich zurzeit beschäftigen wollte.